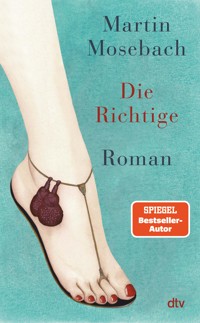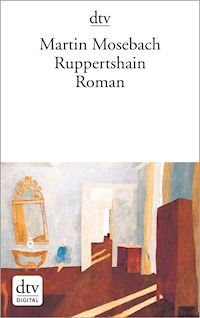
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Sie hatte die Vertreibung aus Böhmen hinter sich, sie war die Mutter eines chaotischen Sohnes, und sie hatte dreißig Jahre lang den täglichen Drahtseilakt einer Ehe mit Heinrich und einer Liaison mit Albrecht bewältigt.« »Sie hatte die Vertreibung aus Böhmen hinter sich, sie war die Mutter eines chaotischen Sohnes, und sie hatte dreißig Jahre lang den täglichen Drahtseilakt einer Ehe mit Heinrich und einer Liaison mit Albrecht bewältigt.« Nun wartet Antonia, die mit fünfzig noch immer attraktiv und schön ist, mit einer Handvoll Menschen auf das Ableben ihres todkranken Mannes. Die Monate vergehen, doch in der weißen Villa in Ruppertshain im Taunus herrscht eine merkwürdige Art von Stillstand. Um so mehr sind seine Bewohner erschüttert, als das erwartete Ereignis tatsächlich eintritt – und ihnen eröffnet wird, daß Haus und Park zutiefst verschuldet sind. Und schon werden aus alten Freunden Feinde, lauern die Finanzhaie darauf, den Besitz des ehemaligen Frankfurter Bankiers zu parzellieren und gewinnbringend zu vermarkten. Antonia aber weiß sich zu wehren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Martin Mosebach
Ruppertshain
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ungekürzte, vom Autor neu durchgesehene Ausgabe
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© 2004 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40092-3 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-13159-9
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de
Inhaltsübersicht
März
Ivanovich konnte den Tag...
Juni
Heute war Batzenberg noch...
September
Albrecht war aus leicht...
November
Zu diesem Zeitpunkt hatte...
März
»Wir werden auf die Straße gesetzt«, sagte Antonia, eine schöne Frau von fünfzig Jahren, zu ihrem Freund Albrecht von Skrba, der seit vielen Jahren bei ihr zu Gast war, und ihrem Sohn Ivanovich, der dick und ebenmäßig wie Napoleon aussah. Mit ihnen am Frühstückstisch saß Hans Joachim, ein sportlicher junger Mann. Er war mit Ivanovich in die Schule gegangen und hatte keinerlei Bedeutung. Auf welche Bemerkung sich Antonias sorgenvolle Worte bezogen, ist nicht weiter wichtig. Sie meinte aber wohl, das Haus, in dem dies Eßzimmer lag, demnächst verlassen zu müssen, ein stattliches, älteres Landhaus, das in einem großen Park lag, nahe von Frankfurt in den Taunusbergen bei dem Dörfchen Ruppertshain.
Draußen herrschte der schönste Frühling seit Jahren. Daß es noch kühl war, steigerte nur die allgemeine Aufbruchsstimmung. Es gab erst wenig Grün, das herbe Klima von Ruppertshain ließ die Rasenflächen rund um das Haus noch so tot erscheinen, als sei die Schneedecke gerade erst geschmolzen, obwohl unten in Frankfurt schon die Primeln in die Vorgärten gepflanzt wurden. Die hohen Bäume, der kostbarste Schmuck des Parks, die Blutbuchen, Kastanien, Akazien und Silberpappeln konnte man zunächst nur an den nassen Haufen überwinterten Laubes unterscheiden, die um die Stämme lagen, aber an den Enden der Äste glitzerten bereits überall die kleinen Knospen, Zeichen neuen Lebens in den kälteerstarrten Riesen. Das Efeu wirkte in der Helle des Tages schwarz, sein Immergrün hatte sich im Winter erschöpft und würde bald neben den ersten Buchenblättern, hellgrün und zart wie die Flügel der Eintagsfliege, alt und ledern aussehen. Ringsum regierte noch die Hinterlassenschaft des Winters, das Welke, Starre und Abgestorbene, aber die Luft strafte dies Bild Lügen, sie war frisch und sanft zugleich und in der Sonne sogar leicht erwärmt wie das Wasser einer milden Thermalquelle im Taunus. Diese Luft war mächtig. Sie verwandelte die Stimmung eines jeden, der sie einatmete.
Antonia beherbergte in den Mauern ihres Parks eine kleine böhmisch-mährische Kolonie: Ihre alte Mutter Stella, die im Rollstuhl saß und an den Frühstücken nicht teilnahm, stammte aus Kremsier und war mit ihrer Tochter nach Deutschland gekommen. Obwohl das Verhältnis zwischen den beiden Frauen nicht herzlich genannt werden konnte, hatten sie sich noch niemals verlassen, und es war selbstverständlich, daß Stella nach Antonias Heirat nach Ruppertshain zog. Albrecht von Skrba kam aus Prag; er war ebensolange Mitglied des Ruppertshainer Haushalts wie Stella, ein ergebener und treuer Freund, der nie daran zweifelte, daß er in die Nähe von Antonia gehöre. Ivanovich hieß eigentlich Hans und hatte sich lange gegen den Namen, den Antonia für ihn erfunden hatte, um ihn ein wenig slawischer erscheinen zu lassen, gewehrt, aber Antonia blieb stärker. Wenn sie sich entschlossen hatte, jemandem einen neuen Namen zu verpassen, setzte sie sich meistens durch. Nur Heinrich, Antonias Mann, hatte mit Böhmen nicht das mindeste zu tun. Er war Frankfurter und hatte sein Leben lang in Ruppertshain gewohnt. Er litt unter dem fremdartigen Ton, den seine Frau ins Haus gebracht hatte, vielleicht deshalb um so mehr, als er die bodenständigen Stimmen seiner Heimat noch deutlich im Ohr hatte. Indessen war Heinrichs Einfluß vor allem in der letzten Zeit im Schwinden, denn er war sehr krank, und Antonia waren auch wirtschaftliche Sorgen zu Ohren gekommen. Die Firma laufe nicht gut, wurde schon seit längerem behauptet. Heinrichs Leiden standen zu dem Sieg des Frühlings in dunklem Kontrast. Es sah aus, als werde er an der allgemeinen Erneuerung des Lebens nicht mehr teilhaben.
So lange er denken konnte, hatte Heinrich den Park von Ruppertshain geliebt, ein Gelände, das nun wie eine Insel inmitten der unendlichen See beschränkter Häuschen, die heute Villen genannt werden, lag. Wer ihn betrat, vergaß das Siedlungswesen, das ihn umwucherte, augenblicklich, denn es konnte in seiner Luft nicht anders sein, als daß er an Wälder, Kornfelder und Apfelgärten grenzte. Die nähere Umgebung versank, und sichtbar blieben nur die blauen Taunusberge am Horizont, die sich wie gemalte Meereswellen hintereinander staffelten. Man folgte dem Kiesweg und glaubte zunächst, in einen Wald geraten zu sein. Farnkraut bedeckte den Boden, die Tannen standen in lichtem Abstand voneinander, mit Laubbäumen gemischt, der Kies hörte auf, der Weg bekam den federnden Charakter des Waldbodens und wurde hin und wieder von einer dicken Wurzel gekreuzt. Seitenwege führten ins Gehölz, einmal sah man in eine Lichtung hinüber, auf der ein eingestürzter kleiner Tempel stand, von hohem Gras verborgen lag eine seiner hölzernen Säulen auf dem Boden und wurde allmählich wieder zu Erde. Im Sommer wuchs hier der Fingerhut, Antonia hatte auch einmal einen Igel gesehen. Dann hörte der Wald auf und öffnete den Blick in ein Wiesental, das ringsum von einer schwarzen Baumkulisse begrenzt war. Dort, wo der Weg wieder anstieg, stand das Haus, das inmitten dieser Weite klein wirkte und sich erst, wenn man unmittelbar davor stand, in seiner vollen Größe zeigte.
Das Haus war weiß und hatte ein blaues Schieferdach mit zwei Türmchen. Es war in den Jahren gebaut worden, als der Großherzog von Luxemburg, die Rothschilds und die Kaiserin Friedrich im Sommer in den Taunus kamen. Der Architekt hatte wohl an die Loire gedacht, die Fenster waren schmal und tief, und die dunkelgrünen Läden berührten sich, wenn sie aufgeklappt wurden. Zum Tal hin hatte das Haus eine Terrasse, von der man die Gewächshäuser erkennen konnte, eine wohl schon seit langem nicht mehr gepflegte Ansammlung von blinden Glasdächern, kleinen Holzschuppen, Regentonnen, verwahrlosten Beeten, auf denen man hin und wieder noch einem hoch ins Kraut geschossenen Salat begegnen konnte oder einer einzelnen, an geschützter Stelle braungefrorenen, über den Winter gekommenen Rose. Von den Gewächshäusern durch eine hohe, nicht mehr geschnittene und daher pelzig ausgeschlagene Thujahecke getrennt, lag ein langes, in Zement gegossenes Schwimmbecken mit dunkelgrünem, undurchdringlichem Wasser. Rostige Liegestühle standen auf dem hier spärlicher wachsenden Gras in häßlicher Unordnung, als habe sie jemand umhergeschleudert. Am Schwimmbad war es zugig und unfreundlich. Diese Stelle war mit weniger Anmut verkommen als die Gewächshäuser, die allerdings durch ihre Nähe zum Komposthaufen in einem fruchtbaren Verhältnis zum Verfall standen. Die Tennisplätze, die sich weiter unten, ebenfalls durch hohe Hecken verborgen, an das Schwimmbad anschlossen, lagen im Dunkeln, das mit rotem Staub bestreute Areal war von Moosen bewachsen, die weißen Markierungslinien, die auf das Feld genagelt waren, hatten sich hin und wieder gelöst, aber bildeten im großen und ganzen noch ihre Gevierte. Das nasse Netz in der Mitte war zerfetzt und schleifte am Boden, und der Leiter zum Hochsitz des Schiedsrichters fehlten fast alle Sprossen. Fern von den Zwecken, für die er angelegt worden war, lag dieser Platz wie eine düstere Kampfstätte in einem auch im Sommer niemals weichenden Schatten, die Natur aber konnte sich den solide in sie hineingesetzten Platz nicht ohne noch längere Anstrengungen zurückholen.
Wenn man den Tennisplatz über eine wacklige Steintreppe wieder verließ und einem grünen Pfad folgte, erreichte man eine kleine Gruppe von fast im Boden verschwundenen Grabsteinen aus rotem Sandstein. Dort stand »Nero«, »Falk«, »Hexe«, »Waldmann«, »Püppi« und »Hassan«, mit schon weit zurückliegenden Jahreszahlen. Dahinter schimmerte durch das schüttere Gebüsch die Wasserfläche des Teiches in der Farbe des Himmels. Äste, die hineingefallen waren und sich nun schon jahrelang mit Wasser vollgesogen hatten, schauten wie seltsame Gewächse heraus und verrieten, wie flach dieser Tümpel war. Wer den schmalen Weg um den Teich herum ging, wurde plötzlich wieder durch einen Blick auf das Haus und seine Terrasse überrascht, die nun auf einmal ganz nahe lag. Vom Haus aus erschien der Teich in weiter Ferne.
An diesem köstlichen und ganz unerwarteten Frühlingstag, der auch nicht mehr den kleinsten Zweifel am Ende des Winters ließ, hielten sich noch andere Personen im Haus auf, die zu dieser obschon vorgerückten Morgenstunde alle in tiefem Schlaf lagen: Marie-France, eine junge Französin, die au pair im Haus lebte und erst tief in der Nacht nach Hause gekommen war, Schwester Julia, die sich von ihrer Nachtwache erholte, und Herr Anton, der in seinem Zimmerchen unterm Dach, perfekt zum Ausgehen gekleidet, einen festen Morgenschlummer im Ohrensessel tat, während das Fernsehen ihm, dem Schwerhörigen, in dröhnender Lautstärke eine politische Diskussion freundlicher Kosmopoliten übertrug.
Nur Stella war wach und schließlich Heinrich, dessen Zimmer auf demselben Korridor wie das seiner Schwiegermutter lag, aber nicht den Blick zum Tal hin hatte, sondern auf eine dichte Wand aus Kastanienbäumen, die das Zimmer im Sommer in ein grüngoldenes Dunkel tauchten, im Winter aber wie die Linien eines japanischen Holzschnitts das weiße Fenster in kleine Felder gliederten. Heinrichs Augen waren seit der Dämmerung fest auf das Viereck des Fensterausschnitts geheftet. Er hatte sich jede der geometrischen Figuren, die die dürren Kastanienäste in ihren Überschneidungen bildeten, schon lange eingeprägt und wanderte sie von der unteren linken Fensterecke zur unteren rechten Fensterecke und von dort aus wieder zurück, nur eine Reihe höher, hin und her ab, bis er am oberen Fensterrand angekommen war. Schwester Julia bettete ihn jeden Morgen, bevor sie sich hinlegte, immer in dieselbe Position; richtig lag er, wenn er denselben Fensterausschnitt wie am Vortag sah. Wenn er rasiert wurde und sich dabei im Spiegel betrachtete, kam es ihm vor, als sei sein Kopf kleiner geworden, obwohl man ihm nichts von seiner Hirnschale weggenommen hatte, sondern nur von deren Inhalt, und obwohl ihm das Haar, das für die Operation kahlgeschoren worden war, schon wieder kräftig schwarzgrau nachwuchs, als sei die Operation nichts anderes als ein gärtnerischer Eingriff in seine Natur gewesen, der brennt, schneidet, ausreißt oder pfropft und danach das Wachstum nur noch heftiger sprießen läßt. In der Tat war Heinrich mit der Operation und ihrem Ergebnis vollständig zufrieden. Er hatte keine Kopfschmerzen mehr, es verschwamm ihm nichts mehr vor den Augen, er hörte jedes Geräusch, er roch den Kaffee und die Bouillon, die Schwester Julia brachte, und er erzählte ihr alle zweifelhaften Witze, die er als junger Mann liebte und die ihm Antonia, die keinen Sinn dafür zu haben vorgab, verbot und sie damit für lange Zeit auch in Vergessenheit geraten ließ.
Es gab nur eine einzige Erscheinung, die er vor der Operation noch nicht recht gekannt hatte und die ihm jetzt, vor allem in den stillen Stunden, fast die Besinnung raubte, und das war der Schluckauf, der genau alle drei Minuten auftrat, gleichgültig, ob Heinrich müde oder wach war, und der, je länger sein unbestechlicher Rhythmus anhielt, eine immer größere Verzweiflung in ihm entstehen ließ. Heinrich wußte nun zum ersten Mal in seinem Leben, was drei Minuten waren, welche Welt sich in diesem abgemessenen Zeitraum verbarg. Der trockene Schmerz in der Luftröhre ließ dann nach. Wenn Heinrich den Mustern der Äste in diesem Augenblick mit besonderem Eifer folgte, konnte es sein, daß sich Bauch und Luftröhre vollkommen entkrampft anfühlten, ohne die leichteste Erinnerung an die hunderttausend kleinen Krämpfe, die sie inzwischen wundgeschmirgelt haben mußten. Heinrich hatte sich angewöhnt, diese Zeitspanne zu genießen, und er lebte inzwischen so vollständig in ihrem Rhythmus, daß ihm sogar gelegentlich die Übung gelang, während eben dieser Zeit seine Leiden ganz und gar zu vergessen – der Schluckauf war dann nicht nur verschwunden, er würde auch, wenn nicht alle Empfindungen trogen, nie mehr wiederkehren, er hatte abgedankt, die körperlichen Voraussetzungen für einen Schluckauf waren eben einfach nicht mehr gegeben. Heinrich atmete einmal tief auf und fühlte dankbar seinen von jedem Zwang befreiten Brustkorb. Jetzt in diesem Augenblick glich er in wunderbarer Weise den Millionen Gesunden, zu denen er sein ganzes Leben lang gehört hatte, er war nun wieder gesund wie Antonia, die keine Kranken sehen wollte, und konnte über die erbarmungslosen Witze, die ihr über Krüppel einfielen, laut lachen wie vor dreißig Jahren, als er sich in die Frechheiten des hungrigen mageren Mädchens mit einer Art Unterwürfigkeit verliebt hatte. Dank dieser Fähigkeit, im Intervall des Schluckaufs den einzigen wirklich schmerzfreien Raum, der sich nur über wenige Sekunden erstreckte, von den Abläufen der Verkrampfung zu lösen und ihn gleichsam als ewige Sekunde zu erleben, eine Sekunde, die strahlend hinter den Mauern des Schluckaufs lebte, schwankte Heinrichs Befinden in diesen kurzen Zeitabständen, die seinen Tag in zahllose kleine Splitter zerhackten, beständig zwischen dem äußersten, wehrlos ertragenen Schmerz und dem gierigen Genuß einer Gesundheit, die sich noch zeigen konnte, die aber nicht mehr zu bleiben vermochte. Denn bald nach den glücklichen Augenblicken, die Heinrich mit der Geschicklichkeit des Häftlings zu dehnen verstand, nahte schon der Augenblick, an dem der Krampf selbst zwar noch keinen Anteil hatte, an dem aber sicher war, daß er wiederkehrte. Wenn Heinrich dann in die eiserne Zwinge genommen wurde, gegen die keine Anspannung mehr etwas vermochte, war alles stets schlimmer als in der Erinnerung. Danach folgte die betäubende Phase, in der sich sein Körper von der Anstrengung erholte, und dann tauchten auch schon am Horizont die sanften Hügel des Landes auf, das den Schmerz nicht kannte.
Heinrich lag unter der Last der Arbeit, die er auf diese Weise leistete, oft schweißbedeckt in seinem kühlen Schlafzimmer unter dem schwarz nachgedunkelten Jagdbild, auf dem ein Hirsch mit panisch herausquellenden Augen von einer Meute weißgefleckter Hunde zerrissen wurde. Heinrich wußte nicht mehr, daß dies Bild über seinem Kopf hing, obwohl er noch die Geschichte hätte erzählen können, wie er es nach dem Krieg für ein Pfund Butter erworben hatte. Es fielen ihm überhaupt jetzt viele Geschichten aus der wilden Zeit kurz nach dem Krieg ein, als er noch nicht mit Antonia lebte, Geschichten, die er schon lange niemandem mehr erzählt hatte, weil sie eigentlich nur verständlich waren, wenn man einen Begriff von dieser Zeit hatte, weil man dabeigewesen war. Er verstand seinen Sohn Hans nicht, wenn der ihn »Schieber« nannte, was wußte Hans schon von Schiebern? Der Junge kannte doch nur die Welt, die Heinrich ihm geschaffen hatte, und in dieser Welt wurde so gut wie nichts geschoben – allenfalls mal eine Frau, dachte Heinrich und hätte gelächelt, wenn nicht der Schluckauf schon wieder im Anmarsch gewesen wäre. Der Schluckauf machte regelmäßig seinen Reflexionen ein jähes Ende. Es gelang ihm nicht, danach den abgerissenen Faden wiederzufinden, der Krampf war wie ein Schwamm, der die Tafel leer wischt. Heinrich war wach und fühlte sich geistig voll bei Kräften, aber er konnte keinen Gedanken mehr richtig zu fassen bekommen, alles fiel ihm aus den Händen, um sein Bett hätte ein Haufen bunter Scherben liegen müssen, die aber, wollte man sie zusammenfügen, keineswegs ein heiles Ganzes ergeben hätten, weil jedes Stück von einem anderen Gefäß stammte.
Sein alter Freund und Bankier Georg Batzenberg, der mit seiner ewigen Leichenbittermiene an Heinrichs Bett getreten war, um ihm eine höchst wichtige, keinesfalls mehr aufschiebbare Forderungsabtretung abzuringen, erinnerte sich mit Schaudern an die fast erfolglos gebliebene Prozedur: Er hatte ihm den Sachverhalt immer wieder neu ins wehrlos auf dem Kissen liegende Ohr gekrächzt und ihm danach in die Augen gesehen, ob ein Funken Verständnis aufleuchtete, und es kam ihm mehrmals so vor, als sei Heinrichs Konzentration allmählich so weit angewachsen, daß er das ihm zugeworfene Seil ergreifen konnte, aber als Batzenberg ihm dann die Feder in die Hand drücken wollte, hatte ihn Heinrich mit verblüffter Miene angesehen, die verriet, daß ihm alles Vorangegangene entfallen war.
Die Unterschriften, die nach einstündigem Kampf zustande kamen, einem Kampf, den Schwester Julia mehrmals abzubrechen versucht hatte, indem sie beschwörende Pantomimen hinter Heinrichs Kopf aufführte, was Batzenberg stur übersah, waren im übrigen kaum brauchbar, um die Transaktion, die Batzenberg im eigenen Interesse für geraten hielt, zu ermöglichen. Sie stellten den motorischen Fähigkeiten des Schreibers ein verheerendes Zeugnis aus, und selbst wenn man wußte, daß Heinrich auch als gesunder Mann eine sehr häßliche Handschrift gehabt hatte, waren doch diese kraftlosen, fadenhaften Linien, die in den mit Schreibmaschine geschriebenen Brieftext hineinragten, wie wenn ein kleines Kind mit der ganzen Hand einen Bleistift umfaßt und ein paar ziellose Kritzeleien auf einer Bilderbuchseite hinterläßt, eigentlich gar nicht mehr als Schrift zu erkennen oder als in ihrer Form von irgendeiner noch so schwachen Absicht bestimmte Gebilde.
»Die zeige mer net«, sagte Batzenberg deshalb nach gründlicher Überlegung, die er auf der Fahrt nach Frankfurt angestellt hatte, zu seinem Partner Czibulski, »wenn Sie einer frägt, sage Se, ich hab die Unterschrift und damit basta.«
Das Frühstückszimmer hatte seine Unruhe verloren, denn Ivanovich und Albrecht, die allein darin zurückgeblieben waren, besaßen beide den Willen zum orientalischen Gespräch, dem es im Kern nur darum geht, niemals ein Ende zu finden. Antonia stand sofort auf, wenn sie gefrühstückt hatte, während ihr Sohn die Toastbrote und den Tee vor allem als Vorwand betrachtete, sich in die Gesellschaft der anderen Hausbewohner zu begeben. Nur um den Hunger zu stillen, konnte man sich auch am offenen Eisschrank aufhalten, was Ivanovich, nebenbei, auch mehrmals am Tage tat, so daß er am Eßtisch schon satt war und nicht durch das Kauen am Sprechen gehindert wurde. Albrecht hingegen nutzte die Zeit, in der er sich durch Ivanovich vorzüglich unterhalten fühlte, um alles, was auf dem Tisch geboten wurde, hintereinander aufzuessen. Wenn er den Teller mit den Tomaten zu sich herüberzog, knirschten der über den blanken Mahagoni verstreute Zucker und die gerösteten Brotkrümel, das waren die einzigen Geräusche, die er verursachte, diskret genug, um Ivanovich nicht in seinem Redefluß zu irritieren. Beide besaßen außerdem die Fähigkeit zu delegieren. Als Hans Joachim sich anbot, neuen Tee zu kochen, legten sie ihm keinen Stein in den Weg. Seine Versuche, sich an der Unterhaltung zu beteiligen, hatten ohnehin erwiesen, daß er deren Stil nicht verstand. Kaum war er draußen, rief Ivanovich: »Nein«, ein Ausruf, der sich auf nichts Vorhergehendes bezog, auch nicht auf Hans Joachim oder auf seine Bereitschaft, Tee zu kochen. »Nein« öffnete weite Räume des bisher Ungesagten. Nachdem diese Fanfare verhallt war, begann er in schweifender Manier jenen Teil seines beständigen inneren Monologs sichtbar zu machen, der für Albrecht heute besonders interessant sein mochte.
»Ich finde es komisch, daß Papa ausgerechnet am Gehirntumor stirbt«, sagte Ivanovich in das stille Zimmer hinein. Skrba wartete geduldig, bis es weiterging, tupfte sich aber in der Zwischenzeit sorgfältig mit der Serviette den Mund ab, damit plausibel wurde, warum er schwieg. Ivanovich entfaltete plötzlich einen gewissen Eifer, als ob er Forschungsergebnisse darlegen wolle: »Also, ich gehe von der Theorie aus, daß der Tod jedes Menschen immer irgend etwas mit seinem Leben zu tun hat, daß es da durchaus Zwangsläufigkeiten gibt. Ich glaube nicht an Zufälle, außer natürlich, es fällt eine Atombombe, und jeder stirbt den gleichen Tod, ob er nun zu ihm paßt oder nicht.«
Albrecht von Skrba betrachtete Ivanovich, der ihn im übrigen seit frühester Jugend der Einfachheit halber Onkel nannte, mit Neugier. Er neigte selbst zur Theorienbildung und litt ein wenig darunter, daß es ihm nie gelungen war, ein williges Forum zu finden, das seinen Überlegungen gelauscht hätte. Wo war schließlich die unabsehbar große Stadt mit genügend genialen Müßiggängern, die vom Ansturm ihrer Gedanken in die Kaffeehäuser getrieben wurden, um sich dort endlich aussprechen zu können? »Ja, damals Berlin«, rief Skrba gern aus oder »Ja, damals Wien«, aber auch »Ja, damals Prag«. Sogar Prag lobte er, obwohl dort seine Familie zu Hause war, mit der er niemals gut gestanden hatte, und er erzählte gern, um seine These von der »konservierenden Kraft des Kommunismus« zu belegen, wie er sich vor einigen Jahren dem Haus seiner längst von dort vertriebenen Familie auf der Kleinseite, ganz nahe beim Palais Czernin, genähert habe und dort tatsächlich am Hoftor noch das mittlerweile schwarz oxidierte ovale Messingschild »von Skrba« vorgefunden habe.
Heinrich gab ihm früher immer recht, wenn Albrecht von den Berliner Verhältnissen schwärmte, obwohl Heinrich ganz andere Dinge dabei im Auge hatte als von Genies bevölkerte Kaffeehäuser. Einem unausgesprochenen Komment zufolge unterhielten sich die beiden Männer stets dann über die nie genug zu rühmende Berliner Vergangenheit, wenn sie Antonia ihre Friedlichkeit vorführen wollten, und Antonia sagte, indem sie sich auf solche Gespräche bezog: »Die beiden sind die besten Freunde.« Sie vermied es übrigens, diese Behauptung Heinrich geradezu ins Gesicht zu sagen, denn sie wußte, daß er sich nicht ebenso bereitwillig wie Skrba der von ihr entworfenen Version der Wirklichkeit unterwarf. Skrba hingegen war anpassungsfähig, ohne dabei allzu geschmeidig zu sein, und wirkte deshalb niemals tückisch, sondern ganz einfach vernünftig wie alle Leute, die sich unseren Gedankengängen nicht unnötig versperren. Deshalb kam auch Ivanovich, der gleichermaßen durch Widerspruch wie durch allzu durchsichtige Unterordnung zu seinen berüchtigten Jähzornanfällen verleitet wurde, zu seinem eigenen Erstaunen gut mit ihm zurecht.
»Sieh zum Beispiel mal mich«, sagte er zu Skrba, der sofort interessiert war zu erfahren, woran Ivanovich zu sterben gedenke, »ich weiß ganz genau, daß ich mal von einem Auto überfahren werde. Und warum? Weil ich vor Autos panische Angst habe. Ich nehme meinen Unfall durch eine Art vorauseilende Erinnerung vorweg. Verstehst du? Oder zum Beispiel«, er sah einen Augenblick ins Leere, wo aber keine weiteren geeigneten Todesfälle auftauchten, »oder von mir aus eben auch Trotzki.«
»Trotzki ist ermordet worden«, sagte Skrba in sehr respektvollem Ton, als wolle er streng vermeiden, daß sein Beitrag wie ein Widerspruch klang. Ivanovich machte eine verdrossene Bewegung, als sei er unruhig und gelangweilt zugleich, und hing immer noch seinen Gedanken nach. »In Mexiko übrigens, wenn ich mich recht erinnere«, erwähnte Skrba nun noch vorsichtiger.
»Ach geschenkt, alles geschenkt«, rief Ivanovich plötzlich mit wildem Ausdruck in seinen schokoladenfarbenen Augen. »Das ist doch alles sinnlos. Ein völlig sinnloser Vorgang. Ein Mann, der nie – ich wiederhole, nie – in seinem Leben irgend etwas mit dem Kopf gemacht hat, stirbt am Gehirntumor. Das ist doch widersinnig. Wenn dem Nietzsche so etwas passiert wäre. Aber der kriegt die Syphilis.« Nach einer Pause fügte er in düsterer Spekulation noch hinzu: »Die hätte viel besser zum Papa gepaßt.«
Hans Joachims Dienstwilligkeit gewann ihm viele Herzen, war aber trügerisch. Er hatte sich angewöhnt, die Menschen mit der Ankündigung seiner Hilfsbereitschaft glücklich zu machen, und fand, daß es nur taktvoll sei, wenn man ihn dann von jeder Verpflichtung wieder entband; das Insistieren war keine noble Eigenschaft. Daß er keinen Tee für Albrecht und Ivanovich kochte, war dabei noch zu verschmerzen, denn die beiden vergaßen, kurz nachdem er sie verlassen hatte, daß er ihnen etwas bringen wollte. Statt dessen saß er bei Antonia in ihrem Schlafzimmer und ließ sich über das Ruppertshainer Wasser aus, mit dem er nun den Tee nicht kochte, obwohl er es lobte und genau erklärte, warum es gut sei. Er entwickelte mit Feuer den Gedanken, sich von diesem Wasser einen Kanister nach Frankfurt hinunterzunehmen, und Antonia, die in ihr Schminkgeschäft so intensiv wie ein Kabukischauspieler versunken schien, hielt, indem sie den eifrigen Jungen mit einem Seitenblick streifte, durchaus für denkbar, daß er zu Hause friesisch-japanische Teezeremonien veranstaltete, er wirkte so häuslich. Antonia fand es lobenswert, daß er sich ganz selbstverständlich benahm, wenngleich er sich vielleicht, während er plauderte, etwas zu ungeniert umsah. Auch darin liegt jedoch nichts Bösartiges, dachte Antonia, die den Jungen nur im Spiegel betrachtete und nicht jedem seiner Worte folgte, weil sie mit ihren Pinseln, Wischern, Stiften und Quasten in komplizierten Arbeitsgängen beschäftigt war. Gerade bei jungen Leuten traf man gewöhnlich auf eine stumpfsinnige Befangenheit, eine mürrische Maulfaulheit, verbunden mit angstvollem Umherglotzen.
»Wir haben uns angestrengt, als wir zwanzig waren«, sagte Antonia gern. »Wir wollten unterhalten, wir mußten amüsant sein, man war selbstverständlich kokett, was mir übrigens gar nicht lag. Ich habe auf Festen hart gearbeitet.« Gerade diese Behauptung stellte sie mit gereizter Stimme auf, in der moralische Entrüstung darüber mitklang, daß man sich dem Vergnügen nicht mehr mit dem gehörigen Ernst widme, wie er nun einmal erforderlich sei, wenn es sich um ein wirkliches Vergnügen handele.
Zutraulich wie ein junger Hund war Hans Joachim ein wenig im Haus herumgestreunt und hatte einen Ort gesucht, an dem es freundlicher zuging als im Speisezimmer. Antonia verhielt sich anders als wahrscheinlich viele Frauen in ihrem Alter. Sie ließ sich gern bei der Maquillage zuschauen, sie dachte an die Gemälde Longhis, auf denen eine Dame bei der Morgentoilette immer in Gesellschaft von Kavalieren zu sehen ist, die ihr mit den Neuigkeiten der letzten Nacht die Frisierzeit verkürzen. Man müßte wie im achtzehnten Jahrhundert sein, jung, mit weißgepudertem Haar, schön und weise, dachte Antonia und überlegte sich, was Hans Joachim wohl dazu sagen würde, wenn sie ihn auch ein wenig anmalte, wie sie es mit dem kleinen Ivanovich immer getan hatte, wenn Leute kamen und das Kind zu blaß aussah.
Beständig kamen ihr Einfälle, um den tristen Tagesablauf zu dekorieren und zu beleben, die sie aber schnell wieder verwarf, denn sie besaß nur wenig Perseveranz, und das eine »Man müßte eigentlich . . .« wurde, kaum, daß es entstanden war, von einem neuen »Man müßte in Wahrheit ganz anders . . .« abgelöst.
Hans Joachim erzählte währenddessen von dem Stiftungsfest der Mammolshainer Feuerwehr, das er mit Ivanovich und Marie-France gestern abend besucht hatte. Das Fest fand in der Turnhalle statt, mit einer Band für Kaffeefahrten, die Hans Joachims Kopfschütteln erregte, und überhaupt war er noch immer verblüfft, daß er, ausgerechnet er, eine solche Veranstaltung mitgemacht hatte, Ivanovich komme eben manchmal auf geradezu verbotene Ideen. »Hat er sich wieder geprügelt?« fragte Antonia. Hans Joachim beeilte sich, sie zu beruhigen, alles sei friedlich abgelaufen, obwohl sie natürlich schon irgendwie Fremdkörper gewesen seien, und gelegentlich sei auch eine gewisse Spannung entstanden, vor allem, als ein kleiner verschwitzter Dicker mit Marie-France habe tanzen wollen.
»Da wollte sie dann nicht, sie ist ja was Besseres«, sagte Antonia. Hans Joachim ließ sich vorsichtigerweise nicht auf diese Äußerung ein. Er stellte sich jetzt auf eine sehr hübsche, durchaus bescheidene Weise in den Vordergrund, als er von den flehenden Blicken berichtete, die Marie-France ihm zugeworfen habe, und von der geschickten Art, mit der er daraufhin den verschwitzten Dicken beruhigt und schließlich abgelenkt habe, ohne daß wirklicher Ärger entstanden sei – obschon natürlich die Lage etwas brenzlig war.
»Und Ivanovich?« fragte Antonia, die sich jetzt ihren Wimpern widmete.
»Ivanovich hat eigentlich nichts dabei gefunden«, antwortete Hans Joachim ohne Anklage.
»War er schon wieder betrunken?« fragte Antonia. »Ich hasse Ivanovich, wenn er betrunken ist.« Und der drohende Ton in ihrer Stimme erreichte Hans Joachim sogar durch die Wolken seiner guten Laune hindurch und brachte ihn etwas durcheinander. »Ivanovich befindet sich dann auf einer tieferen Organisationsstufe, er wird abscheulich. Er wird dann wie Wasser, das alles überflutet, er besteht dann nur noch aus formloser, warmer Seele.«
Hans Joachim nickte mit ernstem Gesicht und hoffte, sich Antonias Stimmung entsprechend zu verhalten. »Wir mußten ihn suchen, er war auf einmal im Gewühl verschwunden. Schließlich habe ich weit weg lautes Gebrüll gehört, da führte Ivanovich mit drei Feuerwehrmännern eine politische Diskussion. Es war aber ganz ungefährlich, sie hauten sich alle auf die Schultern.«
Hans Joachim kam es vor, als wende sich Antonia jetzt aus Ärger von ihm ab. Ihm sank der Mut, denn seine erste Maxime war, allzeit zu gefallen.
»Und das Mädchen?« fragte Antonia. »Läßt die sich denn das alles bieten?« Dazu fiel Hans Joachim keine rechte Antwort ein. Er erinnerte sich zwar, daß Marie-France schweigsam und nicht in der rechten Feststimmung war, solange sie sich in der Turnhalle aufhielten, hatte aber keine Mißstimmung zwischen ihr und seinem sanguinischen Freund bemerkt.
»Sehen Sie«, sagte Antonia, »wir haben hier immer Personalsorgen gehabt, auch früher schon, und mit den Au-pair-Mädchen habe ich kein Glück. Marie-France ist die erste, die schon ein paar Wochen geblieben ist, und das auch nur, weil Ivanovich wohl gelegentlich mit ihr schläft. Wenn sich das ändern sollte, sieht es traurig bei uns aus – ich sehe viel Arbeit auf mich zukommen, wenn ich allein dastehen würde und meiner Mutter, der Schwester Julia und dem Herrn Anton das Essen bringen müßte, während Ivanovich seinen Rausch ausschläft und Heinrich stirbt.«
Dies Parlando lief in sanftem Auf und Ab aus Antonias nunmehr für den Tag rot angemaltem Mund, ohne dramatische Betonungen, ohne heftige Handbewegungen oder ernste Blicke. Sie räumte währenddessen ein bißchen im Zimmer auf und schien ein Selbstgespräch zu führen.
Antonias Schlafzimmer war neu eingerichtet worden, als sie Heinrich geheiratet hatte. Die Ausstattung war als Überraschung gedacht, und tatsächlich hatte sie den Mund kaum schließen können, als Heinrich sie strahlend hineinführte und den Kronleuchter anknipste. Wer dies Zimmer betrat, mußte glauben, daß die einzige Blume, die es wert war, auf Stoffe und Tapeten gedruckt zu werden, die Rose sei, die rosafarbene Rose, die sich in allen Größen, vom winzigen Röschen bis hin zur riesenhaften Gloria-dei, über das ganze Zimmer ausbreitete. Die große Bettdecke und die Sessel waren aus Rosenchintz, die Vorhänge Rosenseide, die Wände Rosenpapier. Der Schminktisch hatte eine Rosenschürze an, und auf dem Boden blühten in dem dicken weißlichen, an manchen Stellen abgetretenen Teppich Rosenranken, und im Muranolüster glühten gläserne Rosen und warfen eigentümlich starre Schatten an die Zimmerdecke.
Dreißig Jahre lang war an diesem Zimmer und seiner Liebeslust nichts verändert worden, das viele Rosa war nun grau, die Tapete hatte Risse und war über der Heizung schwarz, und die kräftigen, leuchtenden Farben von Antonias Kleidern, die überall herumlagen, drängten die Rosenstoffe an den Rand der Wahrnehmung. Antonia hatte im Zusammenhang mit einer allmählich wieder verflogenen Begeisterung für die moderne Kunst das Plakat einer Picasso-Ausstellung auf die Rosenwand geheftet, aber auch dies Plakat war nun schon wieder zwanzig Jahre alt, und der Klebestreifen, mit dem es repariert war, sah gelb und trocken wie ein Stück Horn aus. Dafür flutete das frische Frühlingslicht durch die Fenster, die schon lange niemand mehr geputzt hatte, so daß hinter ihrem blendenden Bleigrau kaum noch etwas zu erkennen war.
Von draußen schlug eine Uhr mit hellen Glöckchen zwölfmal und erinnerte Antonia daran, daß Schwester Julia schlief und Heinrich jetzt seine Suppe bekommen mußte, aber Hans Joachim konnte sich immer noch nicht von ihren letzten Worten lösen. Mit dem Tod machte man keine Scherze, man setzte vielmehr eine betroffene Miene auf und murmelte: »Herzliches Beileid«, während man schon das Weite suchte. Es war auch Naivität dabei, als er sich noch einmal vergewisserte, ob er richtig gehört habe, und Antonia sagte sich, daß er doch wohl noch sehr jung sei, als er stockend fragte: »Ihr Mann – er stirbt nicht wirklich, oder doch?«
Antonia wurde vom Teufel geritten. Sie sagte oft, daß sie die Kontrolle verliere, wenn ein Dummkopf ihr das Stichwort gebe, aber es mußte in Wahrheit nicht unbedingt ein Dummkopf sein, wenn nur sicher war, daß der Betreffende dramatische Darbietungen zu schätzen wissen werde. Sie nahm daher aus einer Obstschale eine vergessene weihnachtliche Walnuß und knackte sie überraschend kräftig mit den Ballen ihrer Hände auf. In ihrer Hand lag der Kern, vertrocknet, aber unversehrt.
»Das ist Heinrichs Gehirn«, sagte Antonia, »es war wohl auch schon etwas verschrumpelt, er hat ja so unvernünftig gelebt.« Dann steckte sie ihm die Nuß zwischen seine weißen Zähne und sagte: »Beiß ab«, und der verblüffte Hans Joachim gehorchte nicht ohne panische Empfindungen. Antonia behielt die halbe Nuß in ihrer Hand und sagte: »Wie lange, glauben Sie, kann man mit so einem Gehirnrest noch leben?« Hans Joachim verstand nicht, daß sie keine Antwort erwartete, und zuckte betreten, während er die kleine Nuß kaute, mit den Schultern. Antonia fuhr fort: »Ich habe gedacht, so kann er keinen Tag mehr leben, und das war vor vier Monaten. Man braucht viel weniger Hirn zum Leben, als man hat. Wir sind wohl doch eine hoffnungslos degenerierte Rasse.«
Bei dem Wort Rasse fiel Antonia ihr Hund ein, den sie leidenschaftlich liebte und der doch gerade hinsichtlich seiner Rasse kein Paradetier war, und sie war keineswegs erstaunt, als sich die Tür leise bewegte und Toby hereintappte und ihr entgegenlief, als habe er nur sie allein schon seit Stunden gesucht. Er war doppelt willkommen, weil er Antonia den Abschluß eines Monologs ermöglichte, der vielleicht doch nicht ganz einwandfrei war, und sie klopfte ihm dankbar die Seiten und sprach in einem Idiom zu ihm, das sie die Hundesprache nannte. Hans Joachim glaubte ein langgezogenes Ojojojojoj zu hören, und er machte kein sehr gescheites Gesicht, als Antonia zu ihm hinaufsah und sagte: »Toby versteht jedes Wort.«
In der Nähe ihres Hundes konnte Antonia Glückssekunden empfinden. Blitzschnell zogen die Bilder ihrer gegenwärtigen Lebensumstände an ihrem inneren Auge vorbei: Heinrich versorgt und lieb in seinem sauberen Bett liegend, Stella mit ihren Fotos und allen Erinnerungen an früher, nahe und doch nicht anstrengend, im Speisezimmer unten Albrecht und Ivanovich in ihrem uferlosen Geschwätz versunken und immer noch nicht angezogen, Schwester Julia im Haus, die offenbar bereit war, noch etwas zu bleiben, und sie selbst mit einem sportlichen, offensichtlich begeisterungsfähigen Mann allein in ihrem Schlafzimmer. »Und du, mein Hundi«, sagte Antonia laut, richtete sich auf, legte Hans Joachim den Arm um die Schulter, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt, und ließ sich von ihm aus ihrem Zimmer in das Dienerzimmer führen, ohne zur Kenntnis zu nehmen, daß der Junge vor Aufregung rot geworden war.
Wie die bloße Kenntnis der Tatsache, Papst Pius VII. habe auf seinem Weg nach Paris in einem bestimmten Haus übernachtet, diesem Haus auch dann etwas hinzufügt, wenn nichts mehr in ihm an den hohen Gast erinnert, empfand auch Heinrich die Tatsache, daß Herr Anton nicht ins Altersheim gezogen war, sondern seine Tage im Ruppertshainer Haus verschlief, als eine schwer zu beschreibende, aber deutlich spürbare Qualität seines Hauses. Herr Anton sah so englisch aus, daß seine Behauptung, er sei in seiner Jugend Footman beim Herzog von Windsor gewesen, möglich schien und ihm in allen Fragen der Haushaltsführung in den Augen Heinrichs die Infallibilität sicherte.
Herr Anton hatte nie wirklich viel im Haus gearbeitet, da er einerseits schon alt war, als Heinrich ihn in einem Wiesbadener Hotel entdeckte, und andererseits nach seiner selbstverständlich unwidersprochenen Auffassung eine Fülle der ihm angetragenen Aufgaben nicht in seinen Pflichtenkreis fiel. Es sah aber ehrfurchtgebietend aus, wenn er mit steifen Beinen in einem ihm um den Leib schlotternden schwarzen Anzug den Rasen herunterkam, um den Tennisspielern in einem großen Krug eine seiner verwässerten Bowlen zu bringen, und dieser Anblick, der Heinrichs und Antonias Wochenendeinladungen die Würze gab, erleichterte es auch, daß man dem Herrn Anton gegenüber sonst ein Auge zudrückte, zumal sein gelegentlich aufflammendes Interesse an der unreifen männlichen Jugend durch seine Senilität, der dies Interesse wohl auch entstammte, längst harmlos geworden war. Antonia, die weniger durch Stimmungszauber zu vernebeln war, entging es allerdings bald nicht mehr, daß der staksige Gang des Herrn Anton immer unsicherer wurde, und sie fürchtete dann um das mit Gläsern vollgepackte Tablett, das seine entfleischten Hände so krampfhaft festhielten, als sei es eine Stütze. Es kam im übrigen niemals zu einem bühnenreifen Desaster, bei dem sich Tomatensauce über weiße Kleider ergossen hätte, weil Antonia ihm das Servieren bei Tisch schon seit längerem nicht mehr erlaubte. Aber seine wenigen verbliebenen Pflichten reduzierten sich noch einmal, als Antonia ihn eines Tages japsend auf einem Stuhl in der Anrichte vorfand und von ihm erfuhr, daß er schwindelig sei. »Ei, ich hab ja das Wegsteuer net mehr«, jammerte Herr Anton, und Antonia erklärte ihm, daß er von heute an nur noch Heinrichs Bett zu machen und Toby zu versorgen habe. »Aber net in dem Zustand«, antwortete ihr der alte Mann mit einem vorwurfsvollen Blick, zu dem ihn seine Schwäche berechtigte und der darüber hinaus daran erinnern sollte, daß er von Frauen keine Anweisungen entgegennahm. Seither war seine Existenz rein dekorativ. Er tappte sorgfältig angezogen durchs Haus, vor allem wenn Gäste da waren, als gehe er einer Beschäftigung nach, er sortierte aus der Post die Briefe aus, die an Heinrich gerichtet waren, und legte sie neben dessen Kaffeetasse, und er betrat gelegentlich Heinrichs Schlafzimmer, spürte darin herum und verließ es wieder, wenn er feststellte, daß es schon aufgeräumt war.
Besucher, die zum ersten Mal da waren, hielten Herrn Anton manchmal für einen alten Onkel, obwohl er keine Familienähnlichkeit mit seinem Dienstherrn hatte, sah man davon ab, daß er Heinrichs alte Anzüge trug. Wenn überhaupt, dann war eine gewisse Verwandtschaft mit Georg Batzenberg festzustellen, dessen Hals ebenso schildkrötenartig aus dem zu weit gewordenen Hemdkragen ragte und dessen Augen ebenso grau verschleiert in die Welt guckten, so daß man nie wußte, ob der Star ihn geblendet hatte oder ob seine Iris eben einfach aus einer dickeren, hornigeren Substanz bestand.
Zwischen Anton und Batzenberg gab es eine stumme, geheimnisvolle Beziehung. Wann immer Batzenberg kam, tauchte auch Anton auf, obwohl er längst nicht mehr davon unterrichtet wurde, was im Haus vor sich ging und wen man erwartete, und manchmal tagelang gar nicht zu sehen war. Batzenberg nickte ihm knurrend zu, Anton half ihm ächzend aus dem Mantel und war, ohne gerufen zu sein, auch zur Stelle, wenn Batzenberg wieder aufbrach, wobei es nicht die Hoffnung auf ein Trinkgeld gewesen sein konnte, die früher mit seherischer Kraft Herrn Anton aus seinem Giebelzimmer heruntergeführt hatte, denn von Batzenberg war ihm noch niemals auch nur ein Pfennig zugekommen.
Vergleichbares ereignete sich sonst nur zwischen Heinrich und Anton, deren Beziehung jedoch nicht so wortarm war, vielleicht, weil Heinrich in Antons Augen eine geringere Bedeutung zukam als Batzenberg. Heinrich konnte wild werden, wenn Antonia wieder einmal einen Vorstoß unternahm, Herrn Anton nun endlich in ein Altersheim umzuquartieren.
»Der Mann bleibt im Haus«, sagte Heinrich im Befehlston. »Einen Mann von solchen Kenntnissen kann man gar nicht entbehren«, fuhr er ruhiger fort, während Antonia mit hochgezogenen Augenbrauen aus dem Zimmer ging. Es gab übrigens keinerlei soziale Beweggründe für Heinrich, sich nicht von Herrn Anton, der keine Familie mehr hatte, zu trennen. »In diesem Staat kann keiner verhungern«, sagte Heinrich gern und hätte diesen Trost auch Herrn Anton mitgegeben, wenn er entschlossen gewesen wäre, ihn aus dem Haus zu weisen. Es kam ihm aber vor, als sei sein Leben ohne Anton nicht vorstellbar, als müsse ein Unglück eintreten, wenn der dürre Mann im schwarzen Anzug nicht mehr räuspernd vor seinem Fernseher säße und den Frieden des Hauses bewachte.
Heinrich erlebte die Welt in ihren äußeren Merkmalen: Konnte man Verhältnisse, in denen es einen Herrn Anton gab, anders als stattlich nennen? Das sind die Dinge, die man nicht kaufen kann, dachte Heinrich, wenn er Anton von weitem beobachtete, das heißt, man braucht natürlich erst einmal Geld dafür, aber dann eben doch etwas mehr. Selbstverständlich liebte Heinrich seinen Sohn, der ihm dies nicht leicht machte, inniger als Anton. Aber er hatte oft das Gefühl, als könne er mit dem Herrn Anton einfach etwas mehr anfangen, eine Empfindung, die nicht dadurch entkräftet wurde, daß man mit dem Herrn Anton bekanntermaßen überhaupt nichts mehr anfangen konnte. Ivanovich und Herr Anton hatten gemeinsam, daß sie sich beide nicht für Heinrichs Geschäfte interessierten, Heinrich war sogar davon überzeugt, daß Anton nicht einmal wußte, ob Heinrich überhaupt irgendwo Geld verdiente oder ob dessen periodische Abwesenheit während des Tages von Besuchen im Dampfbad oder im Kaffeehaus herrührten. Je mehr er sich in seinem Büro und unterwegs abstrampelte, desto gerührter betrachtete er den alten Mann, den das alles nichts anging, weil seine Anteilnahme nicht über den Klingelknopf hinausging, den er mit Sidol und einem schwarzen Lappen jede Woche blank wienerte.
Hans Joachim lächelte, als er den stickigen Geruch des Zimmers in die Nase bekam. Das Zimmer, in dessen Einrichtung Herr Anton völlig frei gewesen war, war von einer selbst an diesem strahlenden Tag nicht gemilderten Unwirtlichkeit, das Licht des Frühlings wirkte hier oben winterlich kalt und mitleidslos. Ein großer, leerer Tisch mit einem schweren Schneiderbügeleisen erinnerte daran, daß zu den früheren Obliegenheiten Antons das Aufbügeln der Anzüge gehört hatte, eine Fertigkeit, die er in einem Londoner Atelier erworben haben wollte. Wie bei einem alten Förster die Jagdwaffe an der Wand, so erinnerte nun das Bügeleisen an die Anforderungen eines Berufs, der gestorben war, bevor Anton starb.
Antonia stellte den Fernseher ab, und Anton wachte auf. Er betrachtete Antonia schweigend und begann sich langsam zu bewegen, als ob an seinen Knochen Fäden befestigt seien, an denen Antonia gezogen habe. Das Ziel dieser knackenden kleinen Bewegungen war wohl der Versuch, sich aus dem Sessel zu erheben. Antonia verbot ihm aufzustehen und stellte Hans Joachim vor, den Herr Anton nun begrüßte. Der hämische Zug, der sich dabei auf seinem Gesicht zeigte, rührte allein daher, daß er, wenn er wie üblich allein war, der Versuchung, sein Gebiß herauszunehmen, nicht widerstand. Antonia fragte ihn nach seinem Befinden, und es kam eine zwar undeutliche und knappe, aber doch einigermaßen flüssige Unterhaltung zustande, deren Schläfrigkeit allerdings auf die Frage Antonias, ob er in den letzten Tagen wieder einmal bei Heinrich gewesen sei, verschwand. Der alte Mann wurde erregt. Er erklärte, daß er Heinrich so lange nicht mehr besuchen werde, wie »die Person« da sei. »Ich geh net mer zum Herrn Heinrich, wenn er das Weibstück net wegschickt, ich hab’s ihm selber gesagt«, erklärte er mit harter Stimme. Antonia verstand jetzt, daß Anton Schwester Julia meinte. Am meisten hatte ihn empört, daß Heinrich nicht antwortete. Er habe nur so dagelegen und kein Wort gesagt, als ihm Anton kurz und deutlich das unerträgliche Auftreten der Schwester schilderte.
»Ich werde das Haus verlassen«, sagte Herr Anton und kniff die Augen zusammen wie ein Kurzsichtiger. »Ja, wohin werden Sie denn gehen«, fragte Antonia mit freundlicher Stimme, um ihn nicht durch Widerspruch zu reizen. »In den Frankfurter Hof«, sagte Anton und sah an ihr vorbei, als fürchtete er, daß der Blick in die Augen des Gegners allzu häufig den ersten Schritt zur Kapitulation darstelle. »Sie oder ich«, sagte er starr vor sich hin.
»Heinrich wird sehr unglücklich sein, wenn Sie gehen«, sagte Antonia vorsichtig, aber ohne seine Ankündigung ernst zu nehmen. Sie schien während der ganzen Unterhaltung besorgt, daß der Zuschauer Hans Joachim jedes Detail der Szene mitbekam. Antonia führte ihm jetzt ein kleines Theaterstück auf, das wie die Commedia dell’arte improvisiert wurde und in dem Antonia die entzückende Rosine und Herr Anton den grämlichen Doktor Bartolo verkörperten. Anton fügte sich in diesen Entwurf, ohne ihn zu kennen, allerdings ohne den mindesten Humor, und blieb feindselig. »Der Herr Heinrich muß ein Machtwort sprechen«, sagte er, »das ist meine Bedingung.«
»Aber der Herr Heinrich kann doch kein Machtwort sprechen«, sagte Antonia, »der Herr Heinrich hat doch seinen Schluckauf. Es geht ihm doch gar nicht gut. Das wissen Sie doch.« In Antons Gesicht war deutlich abzulesen, daß diese Worte nicht zu seiner Besänftigung beitrugen. Jetzt ballte er sogar die Fäuste und zischte: »Da nimmt mer sich zusamme, wenn mer Herr im Haus is. Die Person. Weggejagt gehört se.«
Antonia, die den Alten kannte und ihn häufig verstimmt, aber noch nie so zornig gesehen hatte und etwas beunruhigt war, entschloß sich um ihres jungen Gastes willen, die Angelegenheit weiterhin komisch zu nehmen.
»Aber vorher wollen wir beim Frankfurter Hof anrufen, ob Sie da genommen werden«, sagte sie und lächelte Hans Joachim zu, »damit Sie uns nicht auf der Straße sitzen.«
Herr Anton sagte jetzt gar nichts mehr, er hatte schon genug mit einer Frau gesprochen. Er blieb still sitzen und rührte sich nicht. Ein peinliches Schweigen entstand. Dann ging Antonia, ein unwillkürliches Gefühl des Ärgers durch ihre schnellen Bewegungen niederkämpfend, mit lauten Schritten aus dem Zimmer.
Stella hörte Antonias Schritte durch Mauern und Decken. Sie waren für sie von der Mitteilungskraft eines tickenden Telegrafen. Sie saß schon viele Stunden auf, als Antonia, Albrecht von Skrba, Ivanovich und Hans Joachim im Haus jene unbestimmten Geräusche zu erzeugen begannen, die mit dem Erwachen und Aufstehen einhergehen, und obwohl sie froh war, daß sie nicht unten mit der Gesellschaft am Frühstückstisch sitzen mußte, hatte sie doch mit wachsender Ungeduld auf diese Geräusche gewartet und sogar den Atem angehalten, als sie die erste Tür klappen hörte. Manchmal versank danach alles für lange Zeit wieder in Schweigen.
Mutter und Tochter verständigten sich nicht mit vielen Worten, aber Stellas Ansichten und Wünsche enthielten dennoch meist einen Unterton, der sie, wie Antonia bekannte, nervös machen konnte. Stets erklärte Stella, die Einsamkeit zu lieben. Sie war imstande, Antonia über alles mögliche Vorhaltungen zu machen, nur niemals darüber, daß sie soviel allein sei. Wenn Antonia sich anderen gegenüber auf eine Manier über ihre Mutter beschwerte, die den Zuhörer in Ehrfurcht vor der alten Königin ersterben lassen sollte, warf sie sich gern auch vor, daß sie die alte Frau nur so selten besuche, daß sie sich kaum Zeit für sie nehme und sich nie richtig um sie gekümmert habe, Anschuldigungen, gegen die man sie in Schutz zu nehmen pflegte: der Umgang mit solch ausgeprägten Persönlichkeiten sei eben schwierig. Dabei wußte Antonia genau, daß sie sich um die Einsamkeit Stellas keine Sorgen machen mußte, ohne deshalb erklären zu können, weshalb sie, wenn sie an ihre Mutter dachte, in ihrer Brust eine Spannung spürte, als ob sie jemandem eine Ohrfeige geben wolle.
Indessen konnte Antonia sich ein Leben ohne ihre Mutter nicht vorstellen, und auch Stella bat niemals darum, eine eigene Wohnung zu bekommen, obwohl Heinrich ihr in guten Tagen immer wieder bequeme Appartements in der Stadt angeboten hatte, nicht aus Nächstenliebe nebenbei, denn er fühlte deutlich, daß Stella von seiner Persönlichkeit und seinen Lebensumständen nicht sonderlich beeindruckt war. Antonia konnte nachts wie aus einem Alptraum erwachen und in die Höhe fahren, weil eine schreckliche Ahnung sie befallen hatte. Sie stand dann auf und lief leise durchs Haus bis vor Stellas Tür. Dort horchte sie, zauderte, ob sie eintreten solle oder nicht, unterließ es schließlich, um sich nicht lächerlich zu machen, und ging in Gedanken langsam in ihr Schlafzimmer zurück.
Stella war in ihren Instinkten, die Antonia betrafen, viel sicherer. Sie lächelte in ihrem Sessel, als sie den scharfen Schritt ihrer Tochter hörte, denn sie sah dabei eine Auseinandersetzung mit dem alten Diener vor sich, dessen Quartier dort oben lag, und sie vermutete, daß Antonia, auf Grund der Privilegien des Herrn Anton, bei dieser Auseinandersetzung wieder einmal den kürzeren gezogen haben mußte. Ohne Herrn Anton zu schätzen, teilte sie seine Meinung über Schwester Julia. Sie hatte Julia ein für allemal verboten, sie zu besuchen, weil die Pflegerin nicht an sich halten konnte, aufdringliche Vorschläge zu unterbreiten, etwa Stella mit Franzbranntwein abzureiben, mit ihr geriatrische Gymnastik zu machen oder ihren Blutdruck zu messen. Schwester Julia war widerspenstige alte Leute gewöhnt, aber nicht, daß auf deren Willen Rücksicht genommen wurde, und sie fand es sträflich von Antonia, ihre alte Mutter so »verkommen zu lassen«, wie sie sagte, ohne allerdings zu wagen, ihr Mißfallen auch Antonia kundzutun. Es war durchaus nicht Feigheit, aber Schwester Julia empfand deutlich, daß sie »keinen Draht zu Antonia« hatte, wie sie sich in ihrem emsig geführten Tagebuch ausdrückte. Sie hatte häufig Privatpflegen gehabt und manchen Einblick getan, wobei die Dankbarkeit, die ihr die vom Anblick des Sterbens belasteten Angehörigen entgegenbrachten, weil Schwester Julia sie der Notwendigkeit dieser Zeugenschaft stundenweise enthob, auch den sozialen Abstand, bis zum Tod jedenfalls, schrumpfen ließ. Nicht so in diesem Haus. Schwester Julia hatte weder Antonia noch Ivanovich bisher in Tränen gesehen, ein bedenkliches Phänomen aus ihrer Perspektive, zumal sie auch die Tatsache, daß fast jeden Abend mit den Gästen geräuschvoll gegessen und vor allem getrunken wurde, wie sie am nächsten Morgen an den leeren Flaschen in der Anrichte feststellen konnte, vorsichtig gesprochen als »unverständlich« empfand. Es war deutlich, daß sie diesem Haus nichts hinzuzufügen vermochte, und obwohl Heinrichs Pflege sie Tag und Nacht in Trab hielt, fühlte sie sich seltsam überflüssig.
»Wie geht es Heinrich?« fragte Stella, als Antonia, die Hans Joachim zu den anderen geschickt hatte, vor ihr stand. Antonia konnte sich zunächst im Halbdunkel des Zimmers nicht zurechtfinden. Sie sah ihre Mutter nur als Silhouette, umgeben von einem Wald von Fotografien in hohen Standrahmen, die in dieser Beleuchtung wie schwarze Tafeln um sie herumstanden. »Ich weiß nicht, ob jemand, der stirbt, zu bedauern ist«, fuhr Stella fort, »aber ich spüre zum ersten Mal eine gewisse Sympathie für ihn, wahrscheinlich, weil auch ich bald an der Reihe bin. Ich entdecke sogar Gemeinsamkeiten mit diesem Herrn. Weder er noch ich werden einen Priester am Sterbebett haben, freilich aus unterschiedlichen Gründen – er, weil er ein gottloser Lump ist, und ich, weil ich die Reformpriester nicht leiden kann.«
»Er wird lange vor dir sterben«, sagte Antonia. »Er ist schon ganz durcheinander. Er vergißt alles, er hat mich heute morgen nicht erkannt, außerdem hat er geweint, nicht vor Schmerzen, sondern wegen dem Schluckauf, glaube ich.«
Antonia fragte sich, ob ihre Mutter es nicht zu kühl im Zimmer fand, denn sie fröstelte schon im Stehen, und Stella saß bereits seit Stunden unbeweglich in ihrem Rollstuhl. Sie berührte die alte Hand und stellte fest, daß sie eiskalt war. Sie ist wechselwarm wie eine Eidechse, dachte Antonia und bemerkte zugleich, daß ihre Mutter ihre Hand zurückzog, als habe Antonia einen Schneckenfühler berührt.
»Was war es eigentlich, was du gegen Heinrich einzuwenden hattest?« fragte sie nach einer Weile, und ihre Stimme klang, als ob sie aus einem Traum heraus spräche.
»Gegen Heinrich?« sagte Stella, und ihre Augen blitzten im Halbdunkel. »Was soll ich gegen einen Sterbenden haben? Das Problem Heinrich erledigt sich jetzt. Ich habe nicht geglaubt, daß er dreißig Jahre mit dir leben würde. Er mußte immer etwas tun, immer etwas unternehmen, solche Leute haben meist keine wirkliche Widerstandskraft. Ich will dir etwas sagen, Antonia, ich wäre glücklicher gewesen, wenn wir ein etwas individuelleres Leben hätten führen können, mit Heinrich war man so leicht einzuordnen. Du weißt hoffentlich, daß ich keinerlei gesellschaftliches Vorurteil gegen ihn hatte. Er hätte nur ein bißchen privater sein können. Ich leide bekanntlich unter der Sentimentalität wie unter einer Mückenplage, sie macht mich konfus. Und Heinrich hatte so eine Art zehrenden Blick, wenn er dich oder Ivanovich ansah. Ich habe auch meine Fehler. Wenn man sehr individuell ist, neigt man leicht zur Illoyalität. Sage Heinrich bitte, daß ich mich von ihm verabschieden möchte, wenn es soweit ist.«
Zwischen den Vorhangritzen hatte ein scharf goldener Strahl seinen Weg ins Zimmer gefunden. Er erleuchtete eine braune Löwentatze, eines der Beine von Stellas Bett, und Antonia stellte sich vor, daß das der wirkliche Fuß ihrer Mutter sei, im Rollstuhl sitze eine Sphinx. »Du müßtest hinausgucken, Mama«, sagte sie laut, als ob ihr unheimlich sei, »es ist ein Frühling wie in Kremsier.«
»Ich habe fünfundvierzig Frühlinge in Kremsier erlebt«, antwortete Stella. »Sie waren schön, aber fünfundvierzig sind genug. Wenn ich heute noch in Kremsier säße, meine Vorhänge wären trotzdem zugezogen.«
Stella hatte einen klösterlich strengen Tagesablauf und stand zur selben Stunde auf, in der die benediktinischen Mönche die Laudes als Dank für den Sonnenaufgang und das Ende nächtlicher Dämonenherrschaft anstimmen. Wie diese Mönche, deren Klöster oft an markanten Stellen der Landschaft standen, ohne daß sie sich deswegen um die Naturschönheit gekümmert hätten, wollte auch Stella nicht sehen, was vor ihrem Fenster stattfand und was alle Besucher als »himmlischen Blick« bezeichneten. Vor allem die Tannen waren ihr ein Dorn im Auge, was Antonia natürlich wußte, die Frage der Vorhänge wurde nicht zum ersten Mal zwischen ihnen erörtert.
Antonia fühlte wieder ihre Abneigung aufsteigen. Sie wunderte sich, warum sie gegen ihre Mutter so wenige Reserven ins Feld führen konnte. Dabei hatte Stella sie ja gar nicht angegriffen, wie es gelegentlich vorkam. Antonia verstimmte aber die Unabhängigkeit, die Stella ihr geradezu boshaft vorzeigte, eine Überlegenheit, die in kompromißloser Untätigkeit allen Notwendigkeiten zum Trotz wurzelte. Früher war Stella in der Offenbarung ihrer Ansichten allerdings erheblich diskreter gewesen, und Antonia glaubte plötzlich, daß ihre Ehe mit Heinrich sicher glücklicher verlaufen wäre, wenn Stella von Anfang an ehrlich opponiert hätte. Durch Stella war überhaupt alles, was nach der Zeit in Mähren kam, im Potentiellen geblieben. Man konnte Heinrich heiraten, aber man konnte es ebenso lassen, man konnte in Ruppertshain wohnen, aber es gab keinen zwingenden Grund dafür, man konnte einen Sohn haben, aber wer war das eigentlich? Eine höchst zufällige Ergänzung des Haushalts, eine biologische Laune. Antonia hatte den Verdacht, daß sie selbst gar nicht so empfand, und konnte doch auf der anderen Seite Stella weiß Gott nicht vorwerfen, sie in diese Richtung gedrängt zu haben, denn Stella war so frei von Schuld wie jeder, der sich der Einmischung in das trübe Geschäft des Lebens stets sorgfältig enthalten hat. Antonia fühlte, wie sich der Druck in ihrer Brust ihrer Kehle näherte. Wie häufig nach einer Unterhaltung mit ihrer Mutter war sie in Zerstörungslaune, und nur die Angst, mit hellblauem Blick verspottet zu werden, hielt sie von der Äußerung ihrer Gefühlsaufwallung zurück.
Zu ihrer Rettung erschien jetzt Marie-France mit einer Gemüsesuppe für Stella. Sie trug enge Hosen und hatte die Stöpsel eines kleinen Tonbandes im Ohr, deren metallischer Reif wie ein Kopfputz aussah. Ihre Augen waren auf den vollen Suppenteller gerichtet, der leicht schwappte, und ihre schönen Lippen bewegten sich leise, als ob sie ein Lied memoriere. »Schon auf?« fragte Antonia laut, und Marie-France erschrak, denn sie war in ihre Musik so versunken, daß sie nichts um sich herum bemerkt hatte. Antonia nahm ihr mit unwilliger Miene den Suppenteller ab und schaute auf den Fleck, den die Bouillon auf dem Teppich gemacht hatte. Marie-France nahm ihren Kopfhörer ab, und leise, wie das Summen um ein Bienenhaus, drang ein symphonisches Geigenrauschen in das Zimmer. »Tschaikowsky«, sagte Marie-France, als ob sie eine Schuld einzugestehen habe.
Antonia sah versonnen vor sich hin. »Im Internat hatten wir eine Art Intelligenz- und Geschmackstest. Die Mädchen, die Tschaikowsky liebten, wurden abserviert, man mußte sich zu Bach bekennen.«
»Mir war alle Musik schon immer verdächtig«, antwortete Stella. »Im übrigen hat Heinrich ja wohl auch nie für Bach votiert.«
»Das ist wahr«, sagte Antonia, »ein einziges Mal habe ich ihn in eine Kantate geschleppt. Als der Chor anfing: Es kommt der Fürst, es kommt der Fürst, es kommt der Fürst – stand er plötzlich auf und sagte laut: ›Der Fürst, der geht.‹«
»Es war ein Fehler, mir diese Geschichte nicht früher zu erzählen«, sagte Stella, und Antonia antwortete sofort: »Aber du hast doch Konversation im allgemeinen so ungern, Mama.«
Marie-France stand während dieses Wortwechsels hilflos im Zimmer und sah von einem zum anderen. Die Deutschen in diesem Haus sprachen erheblich schneller, als man ihr das zu Hause angekündigt hatte, aber sie war nun an das Tempo gewöhnt, und Ivanovich gab sich mitunter rührende Mühe, die kleinen Fehler, die sie manchmal noch machte, zu verbessern. Er behauptete sogar, ihre Fehler zu lieben, denn sie hinderten ihn nicht, ihre Sätze zu verstehen, aber sie zeigten ihm zugleich seine eigene Sprache in einem neuen Licht.
Marie-France stammte aus Arras, wo sie auch zur Schule gegangen war. Sie wußte noch nicht, was sie studieren sollte. »Arras ist ja schon fast Flandern«, sagte Ivanovich zu Hans Joachim, als er seinem Schulfreund Marie-France beschrieb, »und dementsprechend hat das Mädchen eben auch diesen phantastischen flämischen Pferdehintern.« Sein Blick schweifte in die Ferne. Vor seinen Augen schienen die rabenschwarzen Fabriken, die platte Landschaft, die heruntergewirtschafteten Städte des nordfranzösischen Kohlenreviers aufzusteigen. »Kleinbürgerliche Verhältnisse, proletarischer Hintergrund, Mutter allerdings Arzttochter, mißtrauisch, total zynisches Milieu–«, dabei sah er Hans Joachim wild an, »das Mädchen selber völlig unbeeindruckbar, intelligent, noch nicht sehr erfahren«, hierbei lächelte er genießerisch, »insgesamt ein ganz anderer Schlag als das, was hier so rumläuft.« Dann verlor er die Lust zu genauerer Charakterisierung, weil er fühlte, daß für Hans Joachim die Maßstäbe, die er anlegte, nicht viel bedeuteten.
Hans Joachim war im Gegensatz zu Ivanovich ganz ohne jedes Vorurteil. Er näherte sich schmeichelnd und anschmiegsam jedem, der ihn dazu ermutigte, und blieb indifferent, wo die Ermunterung ausblieb. Ivanovich war literarisch in seinen Vorlieben und Abneigungen. Wenn er sich in eine Frau verliebte, wollte er gleich auch ihre Welt, ihre Herkunft, ihr Schicksal mitverspeisen, und wenn es sich um ein Mädchen ohne spezifischen Hintergrund handelte, das Ivanovich trotzdem liebenswürdig vorkam, dann machte er sich eben an die Arbeit, die vielleicht nur schwach gezeichneten Linien der sozialen Bezüge, die dieses Mädchen umgaben, ins Holzschnitthafte weiterzuentwickeln. Diese Neigung trübte bisweilen seinen von Antonia ererbten Realitätssinn. Hans Joachim hatte nach Ivanovichs Schilderung eine schwerblütige Kleinbäuerin oder Bergarbeiterin erwartet, und er fand nicht nur die Beschreibung des Hinterteils etwas übertrieben, sondern er entdeckte auch sonst nichts Vulgär-Exotisches an Marie-France, die ihn zunächst übrigens kaum eines Blickes würdigte, ja sogar, als er sie wie gewohnt strahlend anlächelte, ein eiskaltes Gesicht machte und damit aus Hans Joachims Überlegungen vorerst heraustrat.
Auch den Sohn des Hauses hatte sie nicht ermuntert, als sie nach Ruppertshain gekommen war, um dort halbtags aufzuräumen und in ihrer Freizeit, zweimal in der Woche, nach Frankfurt zu einem Sprachkurs zu fahren. Aber Ivanovich hatte ihre etwas verstockte Miene überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, sondern seinen Redefluß vom ersten Tag an in ihre Richtung gelenkt. Marie-France war zunächst entschlossen, schnell wieder abzureisen, als sie hörte, daß ein Sterbender im Haus sei. Sie grauste sich vor Sterbenden, obwohl sie noch keine erlebt hatte, und äußerte ihr Unbehagen ganz ungeniert, wie sie das auch beim Anblick von Leuten tat, denen ein Arm fehlte oder deren Gesicht ein Unfall entstellt hatte. Sie wußte nichts von dem in bürgerlichen Häusern herrschenden Brauch, solche gerade dort besonders häufigen Ekelempfindungen hinter einer Wolke geheuchelten Mitleids zu verbergen. Ihre Hartherzigkeit blieb unfrisiert und hilflos und glich darin ihrer Weichherzigkeit. Wo immer sie die ersten Klänge der ›Pathétique‹ hörte, sprangen ihr die Tränen in die Augen, und wären tausend Menschen dabeigewesen.
Als sie sich eingewöhnt hatte, war ihr der Gedanke an Heinrich bald nicht mehr so gräßlich. Vor allem sein Anblick besänftigte ihre abergläubischen Ängste, denn Heinrich sah mit seinem rosigen Gesicht, der dichten Haarbürste und dem kleinen silberweißen Schnurrbart überhaupt nicht wie ein Sterbender aus, und daß sein Leiden jedenfalls äußerlich vor allem aus einem Schluckauf bestand, der doch eigentlich etwas Komisches war, ein drolliges Mißgeschick, gegen das man ebenso drollige Mittel empfahl wie zum Beispiel ganz schnell an drei Männer mit einer Glatze zu denken oder einen gehäuften Eßlöffel Zucker herunterzuwürgen, nahm ihm in ihren Augen alles Grauenhafte. Sie besuchte ihn gern und nahm es gutmütig auf, daß er, wenn er sie sah, mit äußerster Mühe seine Hand in Richtung auf ihr Hinterteil zu bewegte, um einen schwachen Versuch zu unternehmen, sie dort zu kneifen, einen Versuch, der an der Kraftlosigkeit seiner Finger scheiterte, so daß Marie-France von dieser Huldigung nicht mehr als ein zartes Kratzen auf dem harten Drillich ihrer engen Hose spürte. Es rührte sie, daß er »Olala, Mademoiselle« sagte, wenn sie zu ihm kam, und zwar nach jedem Schluckauf, wenn er sie jedesmal ganz neu wahrzunehmen schien, und daß er dann oft noch rief: »Grüßen Sie Paris. Ach Gott, Paris, Paris« und dabei die Augen nach innen wandte, wo wer weiß welches hängengebliebene Bild seiner zahlreichen Paris-Aufenthalte leuchtete. Immerhin vermochte er noch, ihr das Gefühl zu geben, daß sie ihm gefiel, und dafür war Marie-France durchaus empfänglich.
»Er ist nett«, dachte sie, und damit war keineswegs gemeint, daß sie Heinrich für lieb, brav, freundlich, verträglich oder sympathisch hielt, sondern vor allem, daß er sie erotisch reizte. Marie-France gebrauchte das Wort »nett« ausschließlich in diesem Sinn, weil ihre erotischen Wünsche weniger ins Hitzig-Leidenschaftliche gingen, als vielmehr dem Ideal angenehmen körperlichen Befriedigtseins und einer Regelmäßigkeit, die nur durch gelegentliche hübsche Ablenkungen unterbrochen wird, entsprachen. Sie war nicht sicher, ob sie, wenn Heinrich gesund gewesen wäre, dem Vater oder dem Sohn den Vorzug gegeben hätte, denn ganz gewiß war Heinrich der nettere von beiden, schon weil er nicht pausenlos gesprochen oder dumpf gebrütet hätte, sondern mit ihr im offenen Auto durch den Taunus gerast wäre, und Ivanovich hatte nicht einmal den Führerschein, was in Ruppertshain nicht nur in den Augen von Marie-France ein Handicap darstellte.