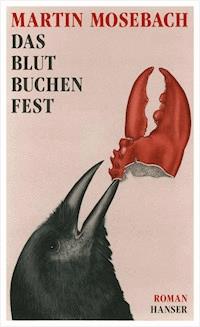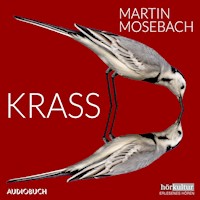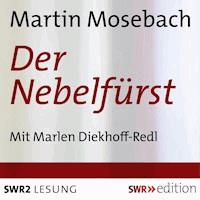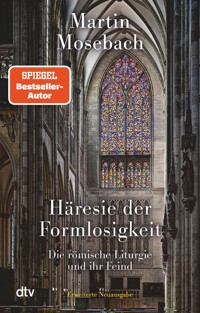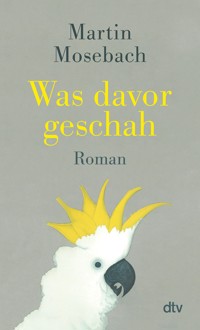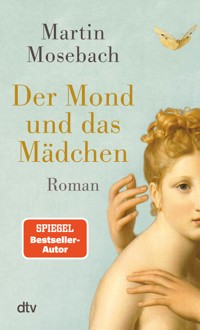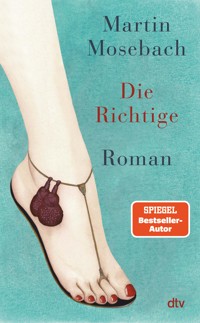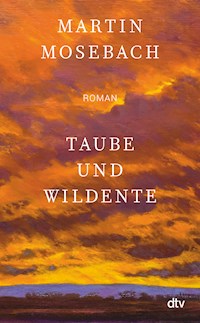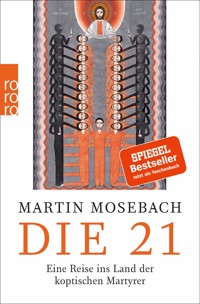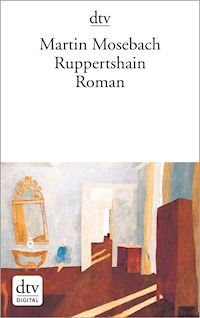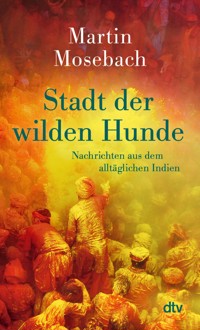
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein überraschendes Porträt von Indien und seiner Menschen Martin Mosebach auf der Reise in Indien: Er berichtet von seinen Eindrücken aus einer Provinzhauptstadt im Bundesstaat Rajasthan, von einem Sandsturm in der Wüste, dem Rattentempel in Deshnok, vom Gott der wilden Hunde und dem Heiligen des Shivatempels, von den Kasten und der Konfrontation mit dem uralten Königtum. Nur wenige deutsche Schriftsteller der jüngsten Zeit haben sich so tief eingelassen auf die verstörende Erfahrung einer ganz und gar anderen Tradition.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Während einer seiner großen Indienreisen hat Martin Mosebach einige Monate in Bikaner zugebracht, einer Stadt am Rande der Wüste, 1488 als Hauptstadt eines Königreichs gegründet und heute Provinzhauptstadt im Bundesstaat Rajastan. Was entdeckt ein deutscher Romanschriftsteller in dieser tiefen Provinz? Es war gerade die Alltäglichkeit, die ihn dort gefesselt hat. Er berichtet über Dinge und Menschen, die nur einer kennenlernt, der sich Zeit nimmt und nicht den ausgetretenen Wegen folgt.
Mitreißend schreibt Martin Mosebach von seinen Eindrücken und Begegnungen: vom Sandsturm in der Wüstenstadt und dem Rattentempel von Deshnok, vom Herrn der wilden Hunde und dem Heiligen des Shiva-Tempels, von Brahmanen, Rajputen und Kastenlosen, und schließlich vom Lebensstil einer indischen Familie, von den Frauen und Töchtern und den Dienern, die das Haus regieren. Ein überraschendes Porträt eines Landes und seiner Menschen.
Von Martin Mosebach ist bei dtv außerdem lieferbar:
Das Bett
Rotkäppchen und der Wolf
Das Beben
Ruppertshain
Der Mond und das Mädchen
Was davor geschah
Häresie der Formlosigkeit
Taube und Wildente
Die Richtige
Martin Mosebach
Stadt der wilden Hunde
Nachrichten aus dem alltäglichen Indien
Bikanir (Bikaner), britisch-ind. Vasallenstaat in Radschputana, zwischen 27° 12’ – 30° 12’ nördl. Br. und 72° 15’ – 75° 30’ östl. L., 57, 859 qkm, mit (1891) 831,955 Einw. Das Land gehört im N. und NW. zur Tharwüste, der Süden und Südosten besteht aus öden Sandflächen, nur die bewässerte Nordostecke ist fruchtbarer. Die Sommer sind sehr heiß, die Winter sehr kalt. Man zieht treffliche Pferde, Rinder, Schafe und Kamele. Der Maharadscha unterhält 2700 Soldaten mit 10 Geschützen. Die Staatseinnahmen betragen 102,000 Pfd. Sterl. Die Hauptstadt B., in dürrer Ebene, hat eine starke Mauer, deren Türme ein mächtiges Fort überragt, mit dem Palast des Maharadscha, 13 Hindutempel, 14 Moscheen, ein College, 7 Dschainaklöster, Fabrikation von berühmten Zuckerwaren und Wollendecken und (1901) 53,071 Einw. (meist Hindu).
Meyers Großes KonversationsLexikon
Sechste Auflage, 1903
Bikaner, Stadt im Bundesstaat Rajasthan, NW-Indien, im Trockengebiet der Thar, 529 000 Ew.; Museum, Bibliothek (alte Schriften); elektrotechn., Glas-, Woll- und Zigarettenindustrie, Teppichwebereien, Töpferei und Lederverarbeitung; ehem. wichtiger Karawanenort im Transasienhandel. – Palast- und Festungsanlage Junagarh Fort aus dem 16.–20. Jahrhundert. – 1488 gegr., wurde B. Mittelpunkt eines von Rajputen beherrschten Fürstenstaates, der 1818 unter brit. Oberhoheit, 1949 zum ind. Staat Rajasthan kam.
Brockhaus Enzyklopädie
Zwölfte Auflage, 2006
Für Dinesh und Alka Pathak
in Dankbarkeit und Verehrung
Der stinkende Gürtel
Zu den großen Riten gehören stets die kleinen. 1977 habe ich in Venedig einen braunen Rindsledergürtel gekauft, mit einer vernickelten Schnalle, wie ein simpler Kofferriemen. Daß ich da einen besonderen Gürtel gefunden hatte, erkannte ich erst, als sein Leder schließlich mürbe wurde und an den Löchern einriß. Nirgendwo war ein solch einfacher Gürtel zu finden. Immer war das Leder geprägt, geflochten oder lackiert, gesteppt, gepolstert oder in delikate Farben getaucht, nur niemals ein natürliches helles Rindsleder, das sich im Gebrauch allmählich tief dunkelbraun färbte und vom Tragen zu einem milden Glanz poliert wurde. Von der Schnalle ganz zu schweigen: Es gab offenbar nur noch besondere, keine archetypischen Schnallen mehr, nur noch entworfene, vom Geschmack des Industrie-Designers gezeichnete Schnallen; die anonyme Schnalle, die am Anfang allen Schnallenwesens stand, war ganz aufgegangen in der Vielfalt. Schnallen in jeder erdenklichen Form und Verformung, silbrig oder gar golden bedampft; aber meine Individualität forderte die unindividuelle Gürtelschnalle. 1994 zerriß im belagerten Sarajevo der Gürtel an zwei Stellen; wie den Schwanz der fliehenden Eidechse hielt ich, als ich ihn mir um den Leib zog, unversehens ein Stück in der Hand. Im alten türkischen Basar der Stadt, der, wahrscheinlich für die Olympiade, gründlich restauriert und aufgehübscht worden war mit seinen ebenmäßigen Ladenreihen, fand ich den einzigen Schuster, der im dritten Jahr der Belagerung sein Geschäft noch fortführte, »gelegentlich«, wie er sagte. Er schnitt mir einen neuen Gürtel nach dem Vorbild des alten und setzte die bewährte Schnalle ein. Siebzehn Jahre hatte der venezianische Gürtel gehalten; der bosnische brach schon nach knapp zwölf Jahren auseinander. Das Leder wird nicht besser in Kriegszeiten, der Basarschuster war an keine haltbare Ware mehr gekommen.
Ich war davon überzeugt, in Indien, dem Land ungebrochener Handwerkstradition, ohne Mühe einen Sattler zu finden, der mir einen neuen Gürtel unter Verwendung der alten Schnalle machte, aber es war nicht so. An Gürteln herrschte kein Mangel, bündelweise hingen sie an den Buden der Straßenhändler, aus gestepptem Kunstleder und mit Prachtschnallen – je dünner der Bauch, je weniger Fleisch in der flatternden Hose, desto prächtiger sollte die Leibesmitte akzentuiert werden, das schien die modische Doktrin.
Erst allmählich wurde mir klar, wie heikel die Frage nach dem Leder war. Nach Rindsleder konnte im Reich der heiligen Kuh ohnehin nicht gefragt werden – und wenn es vorrätig gewesen wäre, hätte man es ungern beim Namen genannt. Es ist die eine Sache, ein altüberliefertes, heiliges Gebot zu brechen, und eine andere, sich dessen lauthals zu rühmen. Wenn die Menschen, die ich in Indien traf, ein Speisegebot brachen, schwiegen sie einfach. Mir war, als werde mit dem Aussprechen des Verstoßes die Tat erst wirklich sakrilegisch, weil erst im Aussprechen das Gebot selbst in Frage gestellt wurde. Jedes religiöse Gebot hat seine Geschichte, jedes ist mit einer sinnlichen Vorstellung verbunden, die erforscht und aufgedeckt werden kann, ohne daß man deshalb seinem Wesenskern näher käme. In diesem Kern ist das religiöse Gebot unbegründbar, sein Unbegründbares ist das Abzeichen seiner Heiligkeit. Das religiöse Gebot stellt die Mauer dar, an der die langen Ketten der Begründungen enden. Es ist, weil es ist. Oder wagt jemand sich auf eine Begründung zu verlassen, warum man das Menschenleben heilig nennt?
Um Leder zu haben, muß man ein Tier töten. Das war hier selbst dann bedenklich, wenn es nicht die Kuh war, die geschlachtet wurde. Leder hing nun einmal mit Blutvergießen zusammen; in manchen Tempeln geboten große Schrifttafeln den menstruierenden Frauen, dem Heiligtum fernzubleiben, und den Männern, ihre Ledergürtel draußen abzulegen, wo ein zahnloser Greis mit schmutzigem Turban sie bewachte – die Schuhe blieben ja ohnehin draußen.
Nach einigen Wochen in Bikaner glaubte ich beobachtet zu haben, daß die religiöse Praxis gestattete, vom Alltag erzwungene Verstöße gegen die Gebote in jene niedrigen Kasten zu verlagern, die ohnehin keine Fähigkeit zur Reinheit besaßen. Wer mit Leder arbeitete, als Gerber oder als Schuhflicker, stand ohne Zweifel ganz unten auf der Rangleiter menschlicher Daseinsformen, denn die Berührung mit Leder verunreinigte; war einer aber durch Zugehörigkeit zu einer niedrigen Kaste oder gar durch Kastenlosigkeit selber bereits unrein, dann kam hier nur Schmutz zu Schmutz. Ich hörte sogar eine besonders mildtätige, um das Los der Armen besorgte Frau die große Barmherzigkeit rühmen, daß denen, die sich schon durch ihre Geburt außerhalb jeder Möglichkeit zur Reinheit befänden, wenigstens die strengen Reinheitsgebote der Religion nicht auferlegt seien, so daß sie unreine Berufe ausüben könnten, um sich und ihre bedauernswerte Nachkommenschaft zu erhalten.
In Jaipur, einer Stadt voller Werkstätten und Handwerksbetriebe, in denen längst die europäischen Modehäuser arbeiten lassen, war ich Gast einer Familie, die der uralten, vielleicht vorbuddhistischen Jain-Religion angehörte. Die Jains halten es mit dem Tötungsverbot besonders streng, erfuhr ich später, auch die Speisegebote werden üblicherweise wohl strikter eingehalten als in anderen Kasten; die Hindus rechnen die Jains vereinfachend der Großkaste der Kaufleute zu, obwohl der Jainismus wie der Buddhismus die Vorstellung von Kasten eigentlich verneint – ich meinte dann im Jain-Puritanismus eine Verwandtschaft zu der moralischen Rigidität einstiger Krefelder Kaufmannsfamilien erkennen zu dürfen.
Mein Gastgeber war von jener Gastfreundlichkeit, wie sie Frömmigkeit und Menschenliebe verleihen, ein älterer Mann, wohlbeleibt, der von den Geschäften zurückgezogen lebte und gerade eben seiner Neigung zu einem bis zur Unvernunft poetischen Luxus zum ersten Mal in seinem Leben stattgegeben hatte – hinter dem Rücken seiner Frau, die sich auf Vortragsreise befand: Das schmale Grundstück der kleinen Villa war mit fünf Marmorbrunnen zugebaut worden, die wegen der Wasserknappheit in Jaipur niemals Wasser sprudeln lassen würden, sondern jetzt schon als Lagerplatz für unbrauchbares Zeug aus dem Haushalt dienten. Daß dieser Mann meine Bitte, mir eine Werkstatt zu zeigen, bei der ich einen neuen Gürtel bestellen könnte, niemals abgeschlagen hätte, blieb mir auch später klar, als ich verstand, wie wenig angenehm ihm solche Hilfe sein mußte. Es sei schwierig, sagte er mit besorgtem, aber auch liebevollem Gesicht. Aber er werde mir helfen.
Wir fuhren mit einem Taxi lang durch staubige Straßen und hatten das Weichbild des alten Jaipur verlassen, als wir vor einem Großhandel für bedruckten Kattun hielten. Hatte mein wenig englisch sprechender Gastgeber mich nicht verstanden? Nein, nicht Baumwolle suchte ich, sondern einen Gürtel. Aber er lächelte verheißungsvoll und bat mit der erhobenen Handfläche um Geduld. Den Männern im Baumwoll-Lager hielt er mit strenger Miene den zerrissenen Sarajevo-Gürtel hin und klapperte mit der Schnalle. Dann wandte er sich ab, ließ Tee bringen und gab die Anordnung, mir schön bedruckte Baumwolltücher zu zeigen.
Ich war unruhig. Zu meiner Vorstellung vom Anfertigenlassen gehörten kleine Konferenzen mit dem Handwerker, ein Erörtern meiner Wünsche, ein Besprechen der Details. Nichts davon. Ich solle nur sehen, was jetzt geschehe, und mich an den Baumwolldrucken erfreuen.
Es werde aber doch ein Ledergürtel gemacht? Selbstverständlich. Ein brauner Ledergürtel? Nichts anderes.
Es war schön in dem Warenlager. Die Gehilfen breiteten unerschrocken riesige Tücher vor mir aus, sie würden lange mit dem Wiederzusammenfalten beschäftigt sein.
Dann kam der Gürtel. Er war nicht braun, sondern schwarz. Seine Oberfläche war von makelloser Feinporigkeit, die Rückseite grob aufgerauht.
»Es ist Leder?«
»Das ist Leder«, sagte der Mann, der den Gürtel gebracht hatte. Das Gesicht meines Gastfreundes war vollkommen ausdruckslos. Ich hob den Gürtel an die Nase. Er roch nach überhaupt nichts. Doch, schließlich gelang es mir, ein zartes Geruchsfädchen zu erfassen: nach neuem Autoreifen. Immerhin, die alte Schnalle war dran.
»Es ist Leder«, so faßte mein Gastfreund mein Forschungsergebnis zusammen. Und ich wußte, wie ich mir diese Bemerkung zu übersetzen hatte: »Sie haben mich mit Ihrem Wunsch in Verlegenheit gebracht, aber es war meine Pflicht, ihn zu erfüllen. Sie halten nun einen Gürtel in Händen, den man benutzen kann, auch Ihre Schnalle ist daran. Und wenn wir uns jetzt entschließen, das Material dieses Gürtels Leder zu nennen, dann haben wir beide unseren Pflichten – Sie denen des Gastrechtes, ich denen meiner Religion – genügt.«
Die neue Verbindung meiner alten Schnalle war schicksalhaft, rückgängig machen ließ sich diese Gabe nicht, aber der Wunsch nach einem neuen Gürtel, der es mit den beiden historisch gewordenen Gürteln an Würde aufnahm, blieb unerfüllt. In Bikaner hatte ich es bei meiner Suche nach einer Sattlerei aber genauso schwer wie in Delhi und Jaipur. Was im Basar an Lederpantoffeln, gespitzt und geschnäbelt, angeboten wurde, kam aus Werkstätten, die mir verborgen blieben; auf die Frage nach einem Ledergürtel schüttelten alle Pantoffelverkäufer den Kopf.
Schließlich fand ich ein paar Buden unmittelbar vor dem Stadttor, an deren Pforten große Lederplatten hingen, ein stocksteifes Kamelleder, wie sich herausstellte. Die Männer, die hier arbeiteten, hockten auf dem Boden und sahen kaum auf, als ich ihre offene Hütte betrat. Es war drinnen so schmutzig und verkommen wie dem Umgang mit den Häuten der Toten angemessen. Eine Schinderhütte war die Bude zwar nicht gerade, aber die finster Hockenden kannten sich im Schindegeschäft gewiß aus. Mir war schon bekannt, daß Freundlichkeit und Höflichkeit dort, wo der Abstand zu groß war, um noch durch den Appell an gemeinsame Formen überbrückt oder verdeckt zu werden, vollständig erlöschen; dann wird von unten nach oben nicht mehr werbend oder unterwürfig gelächelt, sondern mit der stumpfen Ablehnung geguckt, die dem Verhältnis tatsächlich entspricht.
Einen Gürtel machen, das verstand der ausgedörrte, in seiner Entfleischtheit selbst zu runzligem Leder gewordene Sattler – so nannte ich ihn bei mir, obwohl in dieser Berufsbezeichnung Zunftgerechtigkeit und Meisterprüfung und Handwerkskammer mitklangen, von denen dieser Kamelschinder im Straßenstaub von Bikaner nichts ahnte. Ein in Fetzen gekleideter Junge nahm ein Stück Kamelleder vom Haken. Der Sattler legte es auf eine abgeschliffene glatte Steinplatte, rot wie jeder Stein in Bikaner, und schnitt mit scharfem Messer einen langen Streifen davon ab. Der Streifen war wie ein Stock; mit einem anderen, einem Faustkeil gleichenden Stein klopfte der Mann den Streifen nun so weich, daß er ihn zur Rolle wickeln konnte. Die Rolle tauchte er in eine Schüssel mit schwarz-grauem Wasser und haute danach solange auf ihr herum, bis das Leder beweglich wie eine Zunge war.
Um die richtige Gürtelschnalle mußte ich mir hier keine Sorgen machen, etwas anderes als die von mir allein gesuchte quintessentielle Urschnalle gab es hier gar nicht, freilich nicht vernickelt, sondern deutlich angerostet. Noch besser! Der Mann tat den fertigen Gürtel in einen Kunststoffbeutel. »Er muß vor dem Tragen noch in zehn Gramm Öl gelegt werden«, Öl habe er hier aber nicht. Die Augen des Mannes, der mich von unten herauf ansah, waren gelb. Seine langen Fingernägel waren orangefarben wie Rhinozeroshorn. Dort, wo vermutlich eine durch nichts zu überwindende Gleichgültigkeit herrschte, meinte ich Vorwurf und Bitterkeit erkennen zu sollen. Der Gürtel kostete beinahe nichts. Es war mir klar, daß dies der schönste Gürtel sei, den ich je besessen hatte. Dann vergaß ich ihn, erst in Deutschland fiel er mir wieder in die Hände. Schon als ich den Koffer öffnete, drang mir ein Schwall entgegen, als hätte ich Fleisch verschimmeln lassen. Aber beim Zerreißen des Kunststoffbeutels platzte eine Stinkbombe. Das bißchen Leder bewahrte die Geruchskraft eines ganzen Kamels; mir war, als säße ich bei einer Leiche, die sich in die Hosen gemacht hat.
Die mir aufgetragene Ölkur habe ich dennoch versucht. Der Gürtel trank eine Tasse Olivenöl wie ein durstiges Tier, er war danach vollkommen trocken, keineswegs fettig, und hatte die Farbe von reifen Maronen mit ihrer polierten Schale. Und der Geruch? Vielleicht etwas weniger durchdringend als vor dem Ölbad, aber noch übel genug. So hatte ich es doch offenbar haben wollen – von tief unten, aus Regionen, über die man nicht spricht, aus Händen, die man nicht berührt, hatte ich empfangen, wovor Takt und Rücksicht mich vergeblich zu bewahren suchten.
Der Sandsturm
Die neuen Villen von Bikaner extra muros glichen Bunkern mit wenigen Schießscharten, die kaum Tageslicht ins Haus ließen. Fliegendraht vor diesen Fensteröffnungen machte es drinnen noch ein wenig dunkler, wenn die Neonröhren nicht angeknipst waren. Vor welchen Fliegen wollte man sich mitten in der Wüste schützen? Wie schafften es die Tsetse-Fliege und die noch bösartigere Dengue-Mücke in weithin wasserlosem Land zu überleben? Sie machten es wie die Menschen und sammelten sich um die Wassertöpfe, die es auch hier hin und wieder gab.
Vor allem neben einer menschlichen Wohnung. In einer indischen Stadt ohne Kanalisation fließen die Abwässer dorthin, wo sie auch in Europa die längste Zeit geflossen sind, auf die Straße. Um große stehende Pfützen zu vermeiden, waren die Häuser vielfach mit Rinnen umzogen, in denen weißschaumig und muffig riechend das Abwasser stand. Auch waren die Vorläufer der teuren Klimaanlagen, ohne die das Bürgertum von Bikaner nicht mehr leben wollte, die Wasserkühler noch häufig in Gebrauch oder trotz der neuen Anlagen nicht abmontiert. In den großen Kühl-Kästen auf den Dächern oder in den Höfen der Häuser wurde Wasser gespeichert, und so lagen auch in Perioden vollständiger Austrocknung die Brutgebiete der schlimmen Insekten unmittelbar in Menschennähe. Jeder wußte das, die Zeitungen schrieben täglich darüber, man plauderte lächelnd über die Mükken und ihre Gefahren, ganz ohne Aufgeregtheit, und man dachte vor allem nicht daran, die Wassertanks endlich zu leeren.
Morgens preßten sich zwei Tauben mit ihren rund geplusterten Federbrüsten an den rostigen Fliegendraht, vielleicht um die dem Haus entströmende Kühlung zu genießen, und ich war gleichfalls von innen her so nah wie möglich an das briefbogenbreite Fensterchen gerückt, um einen Strahl drahtgefiltertes Tageslicht auf mein Arbeitstischchen fallen zu lassen. Der Blick durch die winzigen Löcher im Fliegendraht erzeugte einen Lupeneffekt. Vor meinem kleinen Gefängnis-Ausschnitt lief während eines Vormittags ein Bilderbogen über den unmittelbar vor meinen Augen gurrenden und atmenden Taubenkörpern ab.
Im Sand der Straße lag eine trächtige Hündin, die in ihrer Erschöpfung die schon geschwollene Zitzenreihe geradezu schamlos, wie mir vorkam, ausstellte. Ein Kamel, dessen Fell über den dicken ledrigen Knien abgescheuert war, zog in Staubwölkchen vorüber. Ein zarter Vogel, eine von mir nie zuvor gesehene Rotkehlchenart, das Brust-Rot durch die Drahtlupe überdeutlich hervorgehoben, hüpfte vorbei. Aus dem gedrungenen Rohbau gegenüber – das Haus sollte, wenn es fertig war, eine sechsunddreißigköpfige Familie beherbergen – trat eine schlanke Frau in einem purpurrosa Sari – ich weiß kein besseres Wort für die vor dem Sandgrau der Straße phosphoreszierende Farbe dieses Gewandes – mit einem Kind auf dem Arm; sie begleitete einen Mann zu seinem Motorrad, der schon einen militärisch geformten Motorradhelm trug, und reichte ihm zum Abschied die Hand; diese Szene sollte sich täglich wiederholen, ich nannte sie schließlich »Hektors Abschied von Andromache und dem kleinen Astyanax«, und ich werde in Zukunft, wenn ich den Namen Hektor lese, an diese Szene denken, in der sein großes Bild, gerade in dieser stetigen Wiederkehr, rein aufgehoben war.
Ich gewöhnte mich nur schwer an die Fensterlosigkeit dieses Hauses und der vielen anderen, die ihm glichen. Als wir Kittys Freundin besuchten, eine in äußerster Gepflegtheit gegen das Altern ankämpfende, elegante, etwas bitter wirkende Dame, empfing sie uns in einem Salon, der wie ein Kellerraum gegen die Außenwelt abgeschlossen war und im wesentlichen von einem riesigen, dramatisch illuminierten Aquarium beleuchtet wurde. Intra muros hatte man die Fensterlosigkeit womöglich noch weiter getrieben. Es gab dort Paläste mit vier oder fünf Kellergeschossen. In den Wohnräumen dort unten blieb die Temperatur auch in der brüllenden Hitze des Hochsommers stets konstant auf fünfzehn Grad. Die Bewohner zogen sich von einer feindseligen Erdoberfläche gleichsam ins Erdinnere zurück. Das Leitungswasser war so salzig, daß es in Verbindung mit Milch und Zucker dem Tee eine Art Karamelbonbongeschmack gab, wie von englischen, gesalzenen Butterdrops. Ich stellte mir vor, daß die Hitze das Wasser aus der Leitung und das Blut in den Adern gleichermaßen eindicken ließ.
Es gab in Bikaner aber einen schlimmeren Feind des Lebens, keineswegs nur im Sommer, sondern auch wenn die Hitze nachließ und man glaubte aufatmen zu dürfen. Ich hatte mich eines Nachmittags nach dem leichten Essen, dem üblichen Linsenbrei, unter dem kreiselnden Deckenventilator aufs Bett gelegt – diesen Ventilator schaltete ich nur ein, wenn ich nicht arbeitete, denn in seinem Wind bekamen alle losen Blätter Willen und Bewegung und segelten durch das Zimmer –, da klopfte Sikander und befahl mich in seiner kurzangebundenen Art auf die Dachterrasse.
Dort erwartete mich Sudhir, sorgenvoll mit seiner Frau telephonierend, die er unterwegs wußte. Um die Mittagszeit war der Himmel noch hellblau, und jetzt hatte er sich grau bezogen. Die weithin ausgebreiteten Häuserwürfel mit ihren oft unfertigen Betonterrassen und Fernsehschüsseln, von oben gesehen kaum weniger dicht aneinandergerückt als das Engstgeschachtel intra muros, formten die Stadtansicht der Zukunft, das Einheitsgesicht mittlerer Städte von Kolumbien über Kenia bis nach China, deren durch das Billigbauen mit Beton und Eisenträgern geprägte Gestalt sich wieder der steinzeitlichen Finsternis von Sodom und Gomorrha annähert.
Der Horizont in dem flachen, durch sanfte Dünenwellen bewegten Sandreich war von einer schwarzen Wolke bedeckt, die schwer auf dem Boden lag, als brenne dort hinten weit weg ein unabsehbar großes Ölfeld. Das kraftvolle Quellen des Qualms, seine unablässig explodierende Fruchtbarkeit der Gestalterfindung, war bis hier zu erkennen, ein blumenkohlförmiges Gestaltentwickeln, das, so wurde jetzt deutlich, im unermeßlichen Ganzen etwas von einer Walze hatte, und diese Walze, in ihrem Innern rasend wirbelnd, rollte mit drohender Allmählichkeit auf uns zu.
Nur dreihundert Kilometer von Bikaner erprobte der indische Staat seine Atombomben in verlassenem Land. Der schaudererregende Pilz, den man von unzähligen Bildern kennt, war dies nicht, aber der Qualm könnte sich leicht dazu auswachsen, das schien mir jetzt wahrscheinlich, und das Auftürmen, das aus der Horizontale nun auch die Lüfte Gewinnende des Rauchschwarz bereitete sich vor. In den höheren Regionen wurde der Rauch aus dem fetten Rußschwarz zu üppigem Graubeige, stand aber immer noch scharf abgegrenzt zum Himmelsgrau, das uns überwölbte.
Es begann zu wehen; Sudhir mußte mit erhobener Stimme in sein kleines Telephon sprechen, um verstanden zu werden. Da bog der Wagen mit Kitty auch schon um die Ecke, der Chauffeur drückte solange auf die Hupe, bis Sikander aus dem Haus gelaufen kam und das Tor öffnete. Kittys smaragdfarbener Sari – das war die einzige starke Farbe in diesem grauen Saugen – war so lang, daß er ihre Füße verbarg. So schnell, wie sie zum Hause lief, schien sie auf Rollen zu gleiten.
»Es ist der Sandsturm«, sagte Sudhir. Das Licht wandelte sich. Der Himmel wurde unversehens maisgelb. Die Atmosphäre trübte sich. Das Wehen wurde stärker, man hörte es sausen. Die Brandqualmwolke am Horizont, eben noch gestochen scharf, löste sich auf. Es wurde dunkler und trüb, die Wolke war da und wir waren in ihr.
Im Haus war der Strom ausgefallen. Sikander und die Frauen hatten alle Fenster verrammelt, nun versammelten wir uns bei Kerzenlicht in der Halle des hohen Treppenhauses. Das Sturmesheulen war hier nur noch gedämpft zu vernehmen. Kitty ging in ihr Ankleidezimmer, um sich bequemer anzuziehen. Bald schon erschallte ihr gewohnter Ruf: »Choto, cay!«, »Kleiner, Tee!«, Zeichen eines im Sturmgebraus ungebrochenen Willens, den Gang des Haushalts nicht antasten zu lassen. Ihrer Sicherheit bei diesem Ruf entnahm ich, daß sie damit rechnen durfte, ihr kleiner Haushofmeister werde auch ohne Strom Tee kochen. Es war, als werde sie immer, in Glück und Leid, bis ans Ende ihrer Tage durch diesen Ruf »Choto! Cay!« den Geschehnissen in ihrer Umgebung Struktur zu verleihen wissen.
In meinem Zimmer lag ich lange im Dunkel. Wie schützten sich in diesem Augenblick die vielen, die sich nicht in solchen Burgen verschanzen konnten? Die Zigeuner in ihren Fetzenzelten am Ende der Straße, die Bettler, die von weither, aus den Wüstendörfern in die Stadt gewandert waren, und die Tagelöhner? Die Straßenhändler legten sich unter ihre Drückkarren mit den Kartoffeln, die sie vom Land hereingebracht hatten. Die Luft draußen war jetzt so voller Staub wie bei schlagendem Wetter unter Tage. Der Sandstaub fand seinen Weg durch jede winzige Ritze. Als plötzlich das Licht wieder anging, sah ich ein Sandhäufchen unter meinem Schießschartenfenster. Sand knirschte im ganzen Haus. Auf den Sesseln des Salons lag eine graugelbe Staubschicht, als sei dies Haus seit Jahren sich selbst überlassen gewesen.
Allmählich war es möglich, aus dem Fenster zu sehen. Es war Nacht geworden, aber die gelben Straßenlaternen verbreiteten ein filmstudiohaftes Licht. Der Sand, den der Sturm herbeigetragen hatte, wirkte in diesem Licht wie Schnee: seine Verwehungen deckten den meisten Unrat zu, der sonst draußen umherlag, sie gaben der zerklüfteten Straße mit ihren tief eingefahrenen Spuren ein weicheres Aussehen, als habe eine große Hand alles Schroffe und Schrundige entfernt. Die wilden Hunde liefen wieder herum und hinterließen auf der jungfräulichen Fläche den Abdruck ihrer Pfoten. Und auch innerhalb des Hauses stieß ich auf Spuren der Rückkehr des Lebens.
Als ich im Badezimmer Wasser laufen ließ, wimmelten bei den ersten Tropfen aus dem Hahn plötzlich fünf große Käfer in dem schwarzen Porzellanbecken, jeder beinahe so lang wie ein Finger. Sie waren schlank, mit harten braunen Flügeln, und hatten lange, überaus bewegliche Fühler. Wie hatten sie es bei ihrer Leibespracht in dem dunklen Abfluß ausgehalten? Waren sie nicht zu groß, um sich durch das Sieb zu drängen? Durfte ich meinen Augen trauen? Nichts Unappetitliches war an diesen großen Käfern. Man konnte bei ihrem stattlich dekorativen Anblick verstehen, warum die russischen Juweliere der vorletzten Jahrhundertwende für Broschen und Agraffen Käfer zum Modell genommen hatten. Waren das wirklich Kakerlaken, wie es – ohne irgendeinen Ausdruck des Entsetzens – bei meinen Gastgebern hieß, als ich ihnen von den Mitbewohnern des Badezimmers berichtete? Die Käfer tummelten sich im Glanz der Chitinpanzer und mit der Beweglichkeit ihrer unablässig spielenden Antennen auf dem Beckenboden. Einen wollte ich in einer Streichholzschachtel fangen, um ihn mit nach Deutschland zu nehmen. Aber als die Käfer trotz meiner Ungeschicklichkeit den Ernst meines Planes erkannten, waren sie mit einem Schlage verschwunden, wie sie gekommen waren – aus dem gefahrvollen Licht zurück in die feucht-dunklen Tiefen.