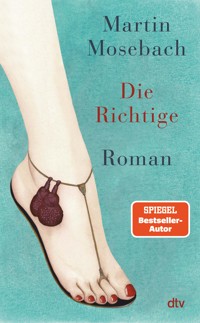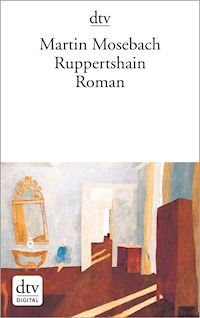9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sommernachtstraum mitten in Frankfurt Hans kann sich glücklich schätzen. So glücklich, dass er, gerade ins Berufsleben eingetaucht und frisch verheiratet, in Abwesenheit seiner jungen Frau Ina eine etwas schäbige Wohnung im Frankfurter Bahnhofsviertel mietet. Dort findet Ina im Schlafzimmer eine tote Taube. Ein Ehering geht verloren, die Mitbewohner entpuppen sich als Zauberwesen, ein Besäufnis gerät zum Hexentanz. Und auch die Wirrungen der Verführungskunst stellen das junge Glück auf eine harte Probe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Über Glück und Schrecken im Schein des Sommermondes
Hans kann sich glücklich schätzen. So glücklich, dass er, gerade ins Berufsleben eingetaucht und frisch verheiratet, in Abwesenheit seiner Frau eine etwas schäbige Wohnung im Frankfurter Bahnhofsviertel mietet. Dort findet sie im Schlafzimmer eine tote Taube. Ein Ehering geht verloren, die Mitbewohner entpuppen sich als Zauberwesen, ein Besäufnis gerät zum Hexentanz. Und auch die Wirrungen der Verführungskunst stellen das junge Paar auf eine Probe.
Von Martin Mosebach sind bei dtv außerdem erschienen:
Das Bett
Rotkäppchen und der Wolf
Das Beben
Stadt der wilden Hunde
Was davor geschah
Taube und Wildente
Die Richtige
Martin Mosebach
Der Mond und das Mädchen
Roman
I
Wer eine Wohnung sucht, hat es mit einem der seltenen Augenblicke zu tun, in denen der Mensch wirklich einmal glauben darf, über die Zukunft seines Lebens zu entscheiden, denn im Wohnen, so vieldeutig dies Wort eben ist, liegt doch das ganze Leben beschlossen. Der junge Mann, der auf dem Fahrrad durch die Straßen der ihm noch fremden Stadt Frankfurt fuhr, hatte ein paar Tage zuvor geheiratet und hielt Ausschau nach der ersten Wohnung, die er mit seiner Frau gemeinsam bewohnen würde. »Meine Frau« zu sagen, ging ihm noch nicht glatt von den Lippen. »Meine Frau« – wäre das nicht eher eine Matrone? Um »meine Frau« zu werden, müßte das Mädchen, das er geheiratet hatte, alles verlieren, was jetzt zu ihm gehörte: Kindlichkeit, Schmetterlingszartheit, Elfenleichtigkeit. Das waren nicht seine Gedanken, poetische Ausdrucksweise wollte er sich nicht zutrauen, aber eine leise klingende, feingläserne Zerbrechlichkeit war es schon, was ihm vorschwebte, wenn er an dies Mädchen dachte, ein zartes Glasgeklingel, Silbrigkeit in Stimme und Haar. Dabei war sie gar nicht viel jünger als er, aber aufgewachsen und behütet in einem Reservat abschirmender Bürgerlichkeit wie ein exquisites Frühgemüse, das nur mit Wärme und Tau, nicht aber mit Frost und rauhen Winden in Berührung kommen darf.
Die ersten Wochen dieser Ehe sahen ein wenig anders aus, als es solch geordneten Verhältnissen entsprochen hätte. Unzählige Gäste gratulierten dem jungen Paar. Die meisten waren für den Bräutigam Wildfremde und blieben es auch, als er die Hochzeitsphotos betrachtete; da hätte man ihm hinlegen können, wen man wollte, er hätte bereitwillig geglaubt, das Gesicht irgendwann auf seiner Hochzeit gesehen zu haben. Aber nach dieser »mariage à la mode« fand die berühmte rituelle Hochzeitsreise leider nicht statt. Es ging nicht. Es war nicht zu machen, der Antritt der neuen Arbeitsstelle, der ersten nach der Universität, hatte sich nicht verschieben lassen; es war auch gar nicht ernsthaft daran herumgeschoben worden, denn das, was in früheren Zeiten auf einer solchen Hochzeitsreise geschehen sollte, hatte, wie üblich, längst stattgefunden, und der eigentlichen Hochzeit waren mindestens drei kleine Hochzeitsreisen vorangegangen. Für Sentimentalitäten war keine Zeit, so drückte es seine Schwiegermutter aus, in deren Nähe es nicht nur die Sentimentalitäten, sondern eigentlich sämtliche Gefühlsregungen schwer hatten, sich zu behaupten.
Noch mehr als Gefühlsregungen verabscheute die Dame jede Anstrengung, und mochte man auch alles, was sich nur delegieren ließ, Hilfskräften übertragen, so täuschte doch nichts darüber hinweg, daß die Hochzeit vor allem eine solche immense Anstrengung gewesen war. Nur wenige Tage, nachdem das Feuerwerk der Brautsoirée abgebrannt worden war, reiste sie in den Süden und nahm dabei ihre Tochter mit, denn sie trat bei anderen Leuten ungern allein auf. Immer mußte sie jemanden aus der eigenen Sphäre dabei haben, um vom fremden Milieu nicht zu leicht vereinnahmt zu werden. Der junge Mann war mit dieser Reise grundsätzlich einverstanden. Er war immer froh, wenn das Mädchen etwas Angenehmes erlebte, und es war viel unkomplizierter so: Er zog in Frankfurt in eine kleine Pension und würde sehr schnell, abends nach der Arbeit und an den Wochenenden, eine Wohnung gefunden haben, und wenn sie zurückkam, würde er sie überraschen – eine köstliche Vorstellung –, und sie würden den Lastwagen mit Hochzeitsgeschenken aus Hamburg kommen lassen und mit dem Auspacken und Einrichten beginnen.
Nur daß der Wunsch der Mutter so ganz fraglos und ohne Abwägung befolgt zu werden hatte, verwunderte ihn ein wenig, wenn er jetzt in seinem Alleinsein darüber nachdachte. Ob er in diesen ersten Tagen am neuen Ort den Beistand seiner soeben erst geheirateten Frau brauchen könnte, wurde nicht einmal in Betracht gezogen. Ina machte keine glückliche Miene, als sie ihm vom Vorhaben ihrer Mutter berichtete, aber ihr Bedauern angesichts der objektiven Notwendigkeit – denn die stellte die mütterliche Anordnung ohne jeden Zweifel her – blieb doch klein. Es war nicht das erste Mal, daß ein solches Inbeschlagnehmen vorkam, aber solange sie nicht verheiratet waren, hatte es ihn nicht weiter belastet. Es paßte zur Kindlichkeit des Mädchens, daß es so innig an seiner Mutter hing. Die Schwiegermutter war Witwe, war es da nicht naheliegend, sich mehr um sie zu kümmern? Wenn er nur nicht den Eindruck gewonnen hätte, daß diese Frau einen Menschen, der sich um sie sorgte, gar nicht nötig hatte.
Frau von Klein war nicht so grazil gewachsen wie ihre Tochter. Ihr hübsches Gesicht war keine altersmäßige Fortentwicklung oder Entfaltung dessen, was im Gesicht ihrer Tochter angelegt war, sondern nur ein wenig weitläufiger, und natürlich lag jenes feine Netz über der Haut, das die auch von der Mutter bewahrte Kindlichkeit auf rührende und Zärtlichkeit weckende Weise gealtert erscheinen ließ. Sie war die schönste Schwiegermutter, die sich denken ließ, mit langsamen, lässigen Bewegungen. Auf der Hochzeit hatte sie Rosa getragen, ohne albern zu wirken, und wer weiß wie viele Dummköpfe, weibliche zumeist, hatten die Plattheit nicht gescheut, jedermann zu versichern, Mutter und Tochter sähen aus wie Schwestern – »Ich hoffe doch nicht«, sagte Frau von Klein mit unbewegter Miene, wenn sie so etwas hörte.
Der junge Mann sah sie vor sich, wie sie nach dem Hochzeitsempfang mit entfernten Verwandten in der Hotelhalle saß und den Friseur, einen häßlichen kleinen Italiener, der sich stets aufs neue schüchtern näherte, dreimal aufs neue wegschickte, obwohl sie ihn bestellt hatte. Der verzweifelte Mann mußte logistisch Außerordentliches leisten und beständig die Termine der anderen Damen umlegen, ohne daß er von ihr mehr als einen blanken Blick ohne die Spur auch nur gespielten Bedauerns erhielt.
»Sie ist vollkommen unabhängig von der Zustimmung anderer«, dachte der junge Mann, »sie nimmt andere Menschen kaum wahr.« Beim Abendessen war ihr Haarhelm dann makellos, als hätte sie den Nachmittag unter der Haube verbracht. Wirkliche Kälte hat etwas mit vollständiger Gerechtigkeit gemeinsam. Sie vermag sogar als Stärke erscheinen und dämpft zunächst auch die Empörung der anderen. Trotzdem wuchs da inzwischen ein kleiner Groll bei dem jungen Mann. »Frankfurt ist eine scheußliche Stadt«, sagte Frau von Klein, als er ihr stolz von seiner neuen Stelle erzählte. War das alles, was sie zu dieser erfreulichen Nachricht zu sagen hatte?
Ina hing an den Lippen ihrer Mutter, aber als sie zu ihm hinübersah, lächelte sie. Und so mußte es auch sein. Dieser gemeinsame Neubeginn mußte Ina mit Freude und Zuversicht erfüllen. Ob sich in Frankfurt auch für sie sofort ein Job finden würde, durfte durchaus erst einmal unwichtig sein. Man lebte in der Stadt, in der man arbeitete. Was war überhaupt eine scheußliche Stadt? Gewiß nicht die, durch die er jetzt nach dem Büro mit dem Fahrrad fuhr.
Er trug noch seinen dunklen Nadelstreifenanzug, seine Uniform als assistant executive, wie er auf seiner neuen Visitenkarte genannt wurde, aber die Krawatte hatte er in die Rocktasche gesteckt, denn wenn man den gekühlten Glasturm verließ, in dem sein Büro lag, prallte man gegen die Hitze wie gegen eine Wand. Es war erst Juni, aber in Frankfurt schon heißer als am Mittelmeer, wie er von Ina wußte. Sie sprach von einem bedeckten Himmel und geradezu ungemütlicher Abendkühle am Golf von Neapel, während sich über Frankfurt ein blühendes Hellblau spannte, das gegen Abend weicher wurde, aber noch lange nicht verblaßte.
Außerhalb der Innenstadt waren die Straßen leer. Das Fahrradfahren war ein Dahingleiten durch streichelnde, gesättigte Luft. Selbst die Autoabgase gaben ihr, wenn er einmal solch eine Fahne streifte, gewürzhafte Fülle. Eine gewisse Schwere, eine gleichsam wattige Substanzhaftigkeit gehört geradezu zur Stadtluft. Viel Staub und Schmutz in der Luft gibt dem Licht eine unvergleichliche Schönheit, wie jeder weiß, dem die Sonnenuntergänge von Delhi oder Mexico City vor Augen stehen – hinter den Rauchfiltern wird die Sonne riesengroß und verströmt eine in reinen Sphären unbekannte rotgoldene Pracht. Für solche Schauspiele war die Luft in Frankfurt allerdings nicht schmutzig genug, und exotische Lichtwunder wurden auch gar nicht vermißt, wenn Häuser und Vorgärten ihren biedermeierlichen Abendfrieden ausstrahlten, Feierabendstille, in die tatsächlich auch eine bimmelnde Kirchenglocke klang. Es mußte hier irgendwo eine Kapelle in der Nähe sein, für eine große Glocke war der Klang zu hell. Vor vielen Fenstern waren die Rolläden heruntergelassen, um die Sonne tagsüber abzuhalten. Und nun rumpelte es überall leise, weil sie hinaufgezogen wurden, um das ausgeschlossene Licht, dem endlich die brennende Hitze fehlte, wieder in die Zimmer fallen zu lassen. Die Straßen, die er ohne große Pläne durchfuhr, waren wohl vor hundert Jahren angelegt worden. Die Mietshäuser mit drei, höchstens vier Stockwerken bestanden vielfach aus rotem Mainsandstein, wenigstens die Torpfosten, das Sockelgeschoß und die Fensterumrahmungen waren rot, etwas Deutsches, Provinzielles hatte dieser Stein, eine gewisse burg- und kirchenhafte Düsterkeit. Jetzt aber war er so sanft beschienen, daß er geradezu von innen heraus strahlte.
»Wie wäre es, hier zu wohnen?« fragte sich der junge Mann und blickte in ein Eßzimmer, in dem eine schöne Lampe vor einem großen Spiegel brannte, ein weiteres Zimmer schloß sich an, und durch das hintere Fenster sah es grün herein. Nein, niemals ein Erdgeschoß, dachte er dann, Ina fürchtete sich und hätte in einer Parterrewohnung nie bei offenem Fenster geschlafen. Aber man konnte ja auch in den ersten Stock ziehen, der gewiß ein wenig heller war und dessen pompöser kleiner Balkon eine dicke Barockbalustrade hatte. Auf diese Balustrade würde sie wohl Terracotta-Töpfe mit Buchsbaumkugeln setzen, wie die Leute das hier auch getan hatten. Eine Reihe von Häusern hier war derart geschmückt, als schlage das diskrete Innenleben durch die dicken Mauern hindurch nach außen, um den im Innern herrschenden Geschmack auch zur Straße hin auszustellen. In der Wärme des Sommerabends atmeten die starren Häuser und wurden zu großen Klangkörpern, wie von Musikinstrumenten, die leise hallen und dröhnen, wenn sie angestoßen werden oder wenn die Luft durch sie hindurchbläst.
Der junge Mann war von der schweigenden, aber lebensvollen Schönheit der Straße so erfüllt, daß jeder Zweifel und jede Sorge, ob sich in dieser Stadt wohl die passende Wohnung für Ina und ihn verberge, dahinschwand. Ihm war, als stünden alle diese noch wenig erleuchteten, aber offensichtlich bewohnten Wohnungen zu seiner Verfügung, als spielten die Leute, die in ihnen die Fenster öffneten und die Rolläden hinaufzogen, ihm bloß vor, wie es sich darin lebte, bis er sich für eine von ihnen entschieden hatte. Ohne sich zu fragen, was er eigentlich suchte, stieg er vom Fahrrad und ging durch ein geöffnetes eisernes Gartentor den Gang entlang, der an der schweren Haustür und der kleineren, aber gleichfalls mit geschmiedetem Gitter geschützten Tür zur Hintertreppe vorbei in den Hof führte.
Dort stand eine riesige Kastanie, mit einer Blätterfülle, die den ganzen Hof in grünes Licht tauchte. Der Baum ragte bis über die Dächer. Der enge Hof hatte sein Wachstum angetrieben wie das einer Palme, eine grüne Säule, ein grüner Wasserfall, ein Naturwunder war in diesem Hof entstanden. Zwischen den Wurzeln des Baumes stand ein Sandkasten mit Eimern und Schippchen, als seien die Kinder gerade eben erst ins Haus gelaufen. Unter diesem Baum zu spielen und aufzuwachsen, in der Gegenwart seiner friedlichen Größe – konnte ein solches Jugenderlebnis nicht vor einer Kindheit im Hochgebirge bestehen?
Es war eigentlich nicht so, daß der junge Mann schon an Kinder dachte. Er hatte diesen Gedanken vielmehr bisher verbannt. Er wollte mit Ina als Liebespaar leben. Sie genügte ihm, und sie hatte ihm vielfach versichert, daß auch er ihr genüge, sie brauche niemanden sonst, wolle niemanden sonst sehen und betrachte es als einen besonderen Glücksumstand ihrer Ehe, aus dem gesellschaftlichen Betrieb zuhause endgültig herausgezogen zu sein. Aber da war nun diese Sandkiste – hätten die Kinder, denen sie gehörte, darin gesessen, wären ihm eigene Kinder nicht in den Sinn gekommen. Kleine Kinder mit ihrem egoistischen Geschrei waren ihm ein Graus, und noch mehr befremdete ihn die Veränderung, die in seinen Studiengenossen vor sich ging, wenn sie, wie in drei Fällen geschehen, Väter geworden waren.
Was die leere Sandkiste im Schatten der Kastanie ihm sagte, lag dabei gar nicht so fern. Wenn Ina nun wirklich zunächst hier in Frankfurt mit ihrem kunsthistorischen Magister keine passende Tätigkeit finden würde – und was sollte das wohl für eine sein, es wurde auch kaum davon gesprochen, denn allein die Magisterarbeit war ein langjähriger Albtraum für alle Menschen in Inas Umkreis gewesen, und an ein Danach dachte niemand –, warum sollte sie die geschenkte freie Zeit nicht mit einem Kind zubringen? Er ging langsam zum Fahrrad zurück und studierte am Briefkasten angelegentlich die Namen der Bewohner, als schließe sich der Charakter des Hauses anhand dieser Namen auf. Im Weiterfahren sah er an der Ecke den hübschen Wirtsgarten eines italienischen Restaurants mit großen Veroneser Marktschirmen. Dort saßen Frauen in Sommerkleidern, und dort würde er sich sehr gern mit Ina niederlassen, an einem heißen Abend wie diesem. Ihm war, als werde Frankfurt immer in solche Hitze getaucht sein, als habe jede Entscheidung bei der Suche nach einer Wohnung mit solch einer außergewöhnlichen Hitze zu rechnen.
Der Park, an dem er jetzt vorüberfuhr, war vernachlässigt und ächzte förmlich unter der Last des Sommers. Er war jetzt verlassen bis auf ein paar junge Männer, die mit Bierdosen in der Hand auf den Lehnen der Bänke saßen und mit wiegenden Köpfen einer Musik aus ihren Kopfhörern lauschten, aber die Grasflächen waren so früh im Jahr schon niedergetrampelt und ausgetrocknet, und die Papierkörbe quollen über von Abfällen; wieviele Picknicks waren hier den Tag über abgehalten worden?
»Immerhin, ein schöner kleiner Park in nächster Nähe«, dachte der junge Mann. Ein Park mußte sein. Keinesfalls kam eine Wohnung ohne nahegelegenen Park in Frage. Vielleicht könnte er Ina überreden, morgens früh mit ihm um diesen Park herumzutraben? Bisher wäre ihm ein solcher Gedanke nicht eingefallen, aber jetzt sah er vor sich, wie genußvoll und vernünftig sie hier wohnen würden. Dazu die Nähe zur Innenstadt. In diesem ganzen Viertel, das er mit seinem Fahrrad durchzog, hatte er bis jetzt noch überhaupt keine scheußliche Straße gefunden, und woraus bestand schließlich die von seiner Schwiegermutter so drohend und abschätzig beschworene »scheußliche« Stadt? Doch wohl aus ihren Straßen. Das würde er ihr beim nächsten Mal sagen, nahm er sich vor und dachte nicht an jenen blanken und undurchdringlichen Blick, den sie auf jeden warf, der ihr widersprach.
Offener und bereitwilliger als der junge Mann konnte ein Mietinteressent also nicht sein. Der Angestellte des Maklerbüros, der ihn in dem großen Mietshaus hinter dem Park erwartete, durfte sich glücklich schätzen. Das Viertel gefiel dem jungen Mann so gut, daß die Beschaffenheit einer möglichen Wohnung schon beinahe gleichgültig war, wenn sie nur in dieser Gegend lag.
Das Treppenhaus sah noch ordentlich aus, nur waren die Treppenstufen mit graugesprenkeltem Linoleum belegt. Aber die Wohnung war in einem finsteren Zustand. Dies war ein stattlicher Jugendstilbau, mit vielen erhaltenen Details, schönen Türgriffen etwa, aber sonst hatte man alles getan, um die Wohnung gegen ihren Strich zu bürsten. In den beiden zur Straße hinausgehenden Zimmern klebte ein grasgrüner Teppichboden. Schmutzige Fußpfade durchzogen diese Kunststoff-Flor-Savanne. Die Wände hatte man blutrot gestrichen, Glühbirnenlicht fiel kalt und grausam auf Flecken und Risse. Das Badezimmer war ein enger Schlauch, aber hier wußte der Makler Rat: Man würde nur eine Mauer versetzen und von dem Nachbarzimmer einen Meter abknapsen müssen, und das perfekte Bad sei gewonnen. »Schade um das schöne Zimmer«, sagte der junge Mann, denn dieses Zimmer wäre das Schlafzimmer gewesen. Es blickte in die Krone eines Ahornbaumes, die etwas schütter belaubt war.
»Man kann nicht alles haben«, sagte der Makler. Dem jungen Mann fiel verwundert die Grobheit des Maklers auf. »Sie müssen sich sofort entscheiden, die Wohnung ist eigentlich schon weg.«
War es wirklich ein guter Einfall, ohne Ina auf Wohnungssuche zu gehen? Der junge Mann spürte schmerzlich seine Unfähigkeit, sich die Wohnung in renoviertem und verschönertem Zustand vorzustellen. Grausiges mußte auf diesem Boden und zwischen diesen blutroten Wänden vor sich gegangen sein. Eine tote Luft stand in den Räumen, die gewiß zu vertreiben gewesen wäre, wenn man die Fenster geöffnet hätte, aber jetzt war es wie bei einem Menschen mit widrigem Geruch, der durch ein Bad eine Weile zurückgedrängt werden mag, der einem aber in dieser Höchstpersönlichkeit die Lust am näheren Umgang mit dem Bedauernswerten ein für allemal vertreibt. Er fühlte sich dem Makler gegenüber dennoch wie ein Schwächling, als er gestand, die verlangte augenblickliche Entscheidung jetzt nicht fällen zu können. Ihm war, als sage er dem ganzen eben noch so bewunderten Stadtviertel mit diesem Unvermögen Lebewohl. Leicht hatte er sich seine Absage nicht gemacht.
Als er wieder auf der Straße stand, war der Mond auf dem immer noch blaßblauen Himmel aufgegangen. Zum Vollmond fehlte noch soviel, als habe man mit einer Nagelschere von der runden Scheibe eine hauchzarte Sichel weggeschnitten. Die Straße war immer noch schön, aber diese Schönheit hatte jetzt etwas Kulissenhaftes angenommen.
II
»Eigentlich ist es doch gleichgültig, wo man wohnt«, dachte der junge Mann, nachdem er siebzehn Wohnungen in schönen, weniger schönen und trostlosen Wohnvierteln besichtigt hatte. Alles, was man ihm gezeigt hatte, war unerhört teuer gewesen. Die Hälfte seines Einkommens, das für ein Anfängergehalt recht nett war, würde auf die Wohnung draufgehen, so sah das nach dieser ersten größeren Recherche aus. Und geboten wurde für das schrecklich viele Geld wenig. Auch ein Mann, der über einen etwas begabteren Blick auf Räume und die in ihnen ruhenden Möglichkeiten verfügt hätte, ein Mensch mit einem Minimum dekorativer Phantasie, wäre bei diesem Angebot an die Grenzen seines Vorstellungsvermögens geführt worden. Die einzige große, geradezu prachtvolle Wohnung, die geheimnisvollerweise bezahlbar gewesen wäre – hatte sie etwa Kakerlaken? –, schnappte ihm ein Rechtsanwaltsehepaar vor der Nase weg. Der Hauswirt ließ durchblicken, daß ihm verheiratete Mieter am liebsten wären, und der junge Mann, der notgedrungen allein auftrat, sah offenbar noch nicht verheiratet genug aus. Der neue Zustand war in seine Physis noch nicht eingedrungen. Ja, selbst der schmale Ehering war ihm noch lästig, er lag auf dem Nachttisch in der Pension, keineswegs aus bedenklicher, sich bereits distanzierender Haltung zur Ehe heraus, im Gegenteil, er war voll Sehnsucht und rief dreimal am Tag bei Ina an.
Sie war heiter und freute sich auf ihre Rückkehr und die Wohnung, als gebe es die schon. Er verschwieg ihr, wie schwer das Suchen war, denn er wollte vermeiden, daß Frau von Klein einen skeptischen Kommentar zu seinen organisatorischen Fähigkeiten abgab. Er hatte zwar gesehen, daß die Sarkasmen seiner Schwiegermutter an Ina abperlten, ohne richtig wahrgenommen worden zu sein – Ina sah bei allem, was ihre Mutter sagte, nur deren bemitleidenswerte Einsamkeit und Witwenschaft –, aber es war ihm die Vorstellung beständigen Einträufelns von Bosheit in die winzigen Ohrmuscheln seiner Frau doch eine tiefe Beunruhigung. Wie es sich eben mit Salzsäure verhält: Irgendwann ist die dickste Schutzschicht weggeätzt.
Die neue Gleichgültigkeit gegenüber Art und Lage der eigenen Wohnung, die der junge Mann so souverän formulierte, war aber weniger das Ergebnis seiner Erschöpfung, als der Versuch, die Lebensgrundsätze eines von ihm sehr geschätzten, bereits jetzt erfolgreichen Kollegen zu übernehmen, der freilich noch unverheiratet war.
»Ich brauche ein großes Bett und eine Badewanne«, sagte dieser braungebrannte, sportliche Mann, dessen Anzüge ihn so starr und knapp umschlossen, als seien sie aus biegsamem Leichtmetall geschmiedet. »Und das Ganze bitte über einem Fitneßstudio und fünf Minuten zu Fuß von der Firma.« Eine ganze Weltanschauung lag in diesem Programm. Wenn er sie schon nicht im Ganzen übernehmen konnte, wollte der junge Mann sie doch wenigstens als Haltung ausprobieren.
»In zwei Jahren müssen Sie hier ohnehin weg sein – sonst haben Sie etwas falsch gemacht«, diesen Satz des Kollegen teilte er Ina mit, denn ein bißchen sollte sie schon fühlen, unter welchem Druck er hier stand. Das neue Bild von einer Karriere – nicht, wie einstmals, die übertragene Tätigkeit immer besser zu verstehen und immer vollkommener zu durchdringen, bis man Meister geworden war, sondern jede Beschäftigung nur als Übergang, nur als Sprungstein für eine ganz andere zu begreifen – hatte für ihn noch etwas Berauschendes, da konnte die Wohnungsfrage wirklich nicht die erste Geige spielen. Es schmeichelte ihm aber, daß Ina sich so fest auf ihn verließ. Er erinnerte sich, wann sie ihm das erste Zeichen solch unbeschränkten Vertrauens gegeben hatte, aus ganz harmlosem Anlaß. Er hatte sie, ohne daß es verabredet war, vom Bahnhof abgeholt, und sie sagte: »Ich wußte, daß du kommst.« An diesem Tag war ihr Liebesverhältnis in ein neues Stadium getreten.
*
Lange war der junge Mann der sinkenden Nacht mit seinem Sportrad entgegengefahren. Er hatte die Steigungen und Senkungen des Frankfurter Terrains kennengelernt, den Tiefpunkt des Geländes am Fluß und den allmählichen Anstieg, mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbar, dafür aber mit den Waden, die kräftiger treten mußten. An diesem Sommerabend rückten die Taunus-Berge näher, bläulich und mit den fließenden Linien eines gelassenen Ein- und Ausatmens. Obwohl dies Mittelgebirge nicht zu schroffen Höhen ansteigt, war es jetzt als große Masse, als mächtiger Gebirgskörper spürbar. Die Stadt lag in einem weiten, aber wohldefinierten, sich nicht formlos verlierenden Raum. Hier oben, vom Stadtzentrum schon recht weit entfernt, denn die Anhöhe schluckte den Blick auf die untere Hälfte der Hochhäuser und ließ sie nur noch mit ihren Dachgeschossen aus dem Gelände wie aus einem Sumpf aufragen, zogen sich Straßen mit kleinen Villen entlang. Der Zerfall des festen Stadtgefüges bereitete sich vor, obwohl das eigentliche Ausfransen noch nicht begonnen hatte. Die Schatten der Nacht ließen das Bergmassiv geschlossen und fern erscheinen und verbargen, daß die Siedlungen bis weit die Hänge hinauf kein Ende nahmen.
Es schien dem jungen Mann jetzt völlig aussichtslos, in dieser Stadt Fuß fassen zu wollen. Gerade diese kleinen Villen, von denen die eine oder andere Ina vielleicht sogar gefallen hätte, sahen auf geradezu endgültige Weise bewohnt aus. Der Fahrtwind trocknete den Schweiß auf seiner Stirn. Es war, als gleite er auf einer Schiene voran.
Die letzten Tage waren anstrengend gewesen, und davor lag ja die in der Erinnerung zwar schon ferngerückte Groß-Aufregung der Hochzeit, die sein Körper aber noch keineswegs überwunden hatte. In seinem Pensionszimmer überfiel den jungen Mann eine Müdigkeit, die ihm das bloße Ausziehen zur Last werden ließ. Er warf die Kleider auf den Boden. Sie aufzuhängen fehlte die Kraft. Wie spät war es? Der Wecker war stehengeblieben. Konnte die Hitze die Uhren stehen lassen? Das schien auf einmal möglich. Bevor er in tiefen Schlaf sank, fiel ihm noch ein, daß er für morgen Vormittag um zehn eine Wohnungsbesichtigung verabredet hatte. Die Wohnung kam nicht vom Makler und war erheblich billiger als das bisher Gesehene. Aber das hieß, daß er an einem Samstagvormittag, der ersten Gelegenheit auszuschlafen, hätte aufstehen müssen. Er blickte zum Wecker hinüber. Wie wäre das Erwachen möglich ohne den gnadenlosen Piepton, der den Schlaf sonst gewaltsam beendete? »Ich lasse es darauf ankommen«, dachte der junge Mann und fühlte in einem einzigen seligen, wie immer für den Genuß allzu kurzen Augenblick sein Entgleiten in die Ohnmacht.
*
Er erwachte, als die Sonne am Himmel stand und so unverdrossen wie gestern auf die Stadt herunterbrannte. Das Fenster ging auf einen öden Hof, in dem nur ein großer Abfallbehälter stand. Es war so still wie tief in einem dichten Wald. Ein Vogel zwitscherte. Auf manche Menschen hat das Vogelzwitschern eine tröstliche und ermutigende Wirkung. Der junge Mann hatte das Vogelzwitschern bisher nicht wirklich wahrgenommen, eigentlich nur wenn ihn nach durchfeierter Nacht auf der Straße die ersten Vogelstimmen begrüßten, um den jungen Morgen anzukündigen. Aber heute war dies einzige Zeichen von Leben in diesem Haus und in diesem traurigen Hof plötzlich wie ein Anruf. War das ein Merkmal des Älterwerdens? Er fühlte sich erfrischt, doch er blieb noch ein Weilchen liegen. Die Verabredung fiel ihm ein. Die Uhr stand immer noch. Hätte sie sich in der Nacht etwa einen Ruck geben sollen? Das Schweigen um ihn herum war so dicht, daß er sich von der Welt abgetrennt fühlte wie in einem Keller. Auf dem Gang keine Schritte. Er stand langsam auf. Heute mußte er keine Büro-Uniform tragen. Als habe er alle Zeit der Welt, räumte er sein Zimmer ein wenig auf, die mißhandelte Anzugjacke kam auf einen Bügel. Ob es noch Frühstück gab? Die Serbin, die in diesem Haus den Kaffee kochte, verließ ihre Küche um elf.
Der Frühstücksraum war leer. Am Wochenende hatte die Pension meist wenige Gäste. Die Serbin trat ein und brachte Kaffee. Der junge Mann schlug die Zeitung auf und las sie gründlich. Er fühlte, daß er heute alles ganz langsam machen müsse, diese friedvolle Langsamkeit gehörte noch zum Schlaf. Er bestellte ein zweites Kännchen Kaffee. Die Zeitung war ausgelesen. Es gab eigentlich keinen Grund mehr, sich in diesem Frühstücksraum aufzuhalten, der, sowie man gefrühstückt hatte, gleich ein wenig unwirtlicher zu werden schien. Bis zu diesem Augenblick hatte der junge Mann es sich verboten, nach der Uhr zu fragen. Das tat er jetzt.
Die Serbin sagte »Halb zehn«.
Es sei nicht gut, daß der Mensch allein sei, heißt es schon in der Genesis. Man könnte diesen Grundsatz einschränken, indem man einräumt, daß das Alleinsein jedenfalls gelernt sein will, wenn es zu einem wünschenswerten und fruchtbaren Zustand werden soll. Der junge Mann hatte darin gar keine Übung. Er war sein Lebtag noch niemals zwei Wochen hintereinander allein gewesen, im Internat und beim Militär hatte er sich besonders wohlgefühlt, und Ina ließ er schon zwei Jahre vor der Hochzeit kaum einen Augenblick aus den Augen. Mit den eigenen Gedanken allein zu sein war ein Abenteuer, das Überraschungen bereithielt. Was man in Gesellschaft gar nicht richtig mitbekam: den Wechsel der Stimmungen, wurde, sowie man allein war, zum staunenerregenden Phänomen. In Gesellschaft war jede Stimmung Antwort auf das Betragen oder die Worte eines anderen; ein anderer Mensch machte einen wütend oder brachte einen zum Lachen, aber nun stellte sich heraus, daß Wut, Erregung, Zufriedenheit und Heiterkeit auch ganz ohne ein Gegenüber auftreten konnten und sich genauso heftig wie in Gesellschaft, ja noch viel gewaltsamer Aufmerksamkeit verschafften.
Niemals zuvor hatte der junge Mann mit dem »Schicksal«, so nannte er das jetzt hochtrabend, ein solches Spiel getrieben wie heute morgen, als es darum ging, die Verabredung in der Wohnung einzuhalten oder aber zu versäumen. Wenn du willst – wer sollte da wollen? –, daß ich diese Wohnung anschaue, dann halte du die Zeit an, hatte der junge Mann offenbar im geheimsten während seiner vormittäglichen derart provozierend in die Länge gezogenen Trödelei gedacht, und so war er jetzt von der schlichten Antwort der Serbin in einem Maße überrascht, das die Frau, die er ungläubig ansah, wohl kaum verstand.
Ein Zeichen! Wie gut, daß der sportliche Kollege nicht zugegen war, er hätte, was die beruflichen Aussichten des jungen Mannes anging, besorgt den Kopf gewiegt.
Die beiden großen Bedingungen, denen die gesuchte Wohnung genügen mußte, waren von der Wohnung am Baseler Platz erfüllt: Sie war keine Parterre-Wohnung, dafür allerdings im vierten Stock, Aufzug gab es keinen, die Treppe war wendeltreppenartig eng und ausgetreten – aber gut, darauf sollte es nicht ankommen –, und ein Park lag zwar nicht in der Nähe, aber dafür das Mainufer mit langen auf den Kais angelegten Rasenflächen; da konnte man an dem breiten braunen Wasser, von Möwen umflattert, durchaus etwas herumspazieren, sich womöglich gar auf den Rasen legen, wenn einem die zahlreichen Sonnenbadenden, die unter einer Wolke von Sonnenölduft lagerten, nicht zuwider waren.
Aber davon abgesehen waren das Haus und seine Lage wohl so weit von allen Plänen und Vorstellungen entfernt, die das junge Paar bisher erwogen haben mochte, daß man sich fragen darf, warum der junge Mann bei seinem Anblick nicht auf dem Absatz umkehrte. Ein Eckhaus mit den vertrauenerweckenden Buntsandsteinquadern im Sockel, aber wie anders wirkte dieser Stein hier als in den schönen Wohnvierteln! Etwas Rauchig-Schmutziges lag über ihm, die Kälte eines gründerzeitlichen Spekulantenbaus. Der Hauptbahnhof, der nicht weit im Rücken des Hauses lag, war hier schon spürbar, längst vergangene Lokomotivenrußigkeit blieb hier noch vorstellbar. Das eigentliche große Hurenviertel lag auf der anderen