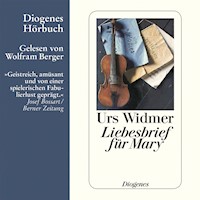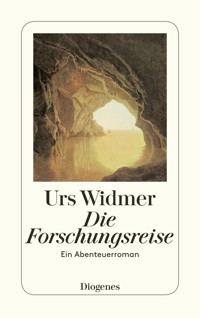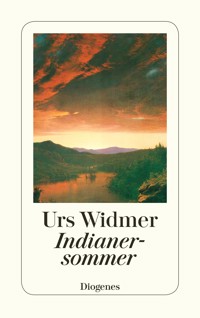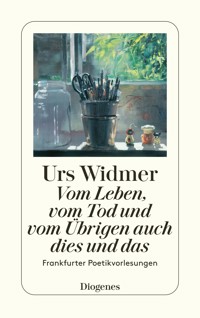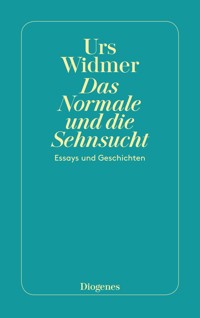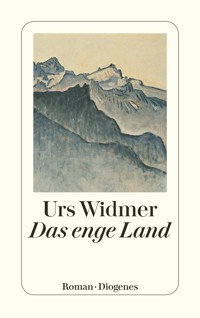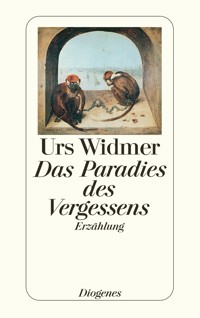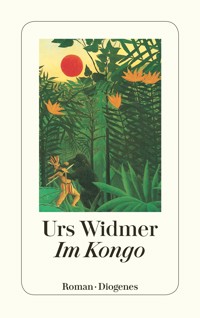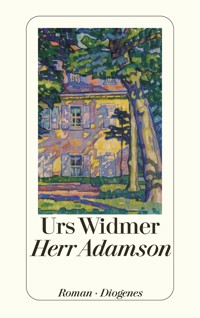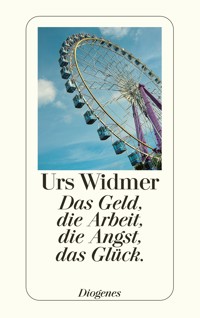
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kolumnen – kurze Texte, die mit unserem Commonsense sprechen – und Essays, die uns etwas mehr Raum und Zeit geben, um über ihren Gegenstand nachzudenken, von großer Vielfalt und Intensität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Urs Widmer
Das Geld,die Arbeit,die Angst,das Glück.
Die Erstausgabe erschien
2002 im Diogenes Verlag
Bibliographischer Nachweis
am Ende des Bandes
Umschlagfoto von Philipp Keel
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23394 0 (3.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60578 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
I
Das Geld, die Arbeit, die Angst, das Glück [11]
II
Die Verbesserung von Zürich [35]
Ab durch die Mitte [38]
Carpe diem [41]
Klare Verhältnisse [44]
Alles voll [47]
Die Füchse in der Stadt [50]
Freud-Bashing [53]
Wir Hysteriker [56]
Alle zusammen einander fremd [59]
Gott, Hund, Katze [62]
Moral, Autorität, Freiheit [65]
Real-time-Kolumne [68]
Kurze Geschichte Zürichs [71]
Zorro der Rächer [74]
Gerade jetzt [77]
Die heiteren Toten [80]
Das Monopol der Gewalt [83]
Grüezi! [86]
Von der Unsterblichkeit [90]
Rapper Homer [93]
[6] Weihnachten bei 42° [96]
Gute Vorsätze [99]
Kulturkatastrophen [102]
Fremdes Hirn [105]
Die beste aller Welten [108]
Er ist’s! [111]
Im Ausland trinken [114]
Gute Frage [117]
Mein Axiom [120]
III
Ernst, unterhaltend, langweilig? [125]
Über das Arschlochtum einiger Helden Vladimir Nabokovs [132]
Über Joseph Conrads Herz der Finsternis[154]
Über Gottfried Kellers Fähnlein der sieben Aufrechten[176]
Le poète travaille [250]
IV
[7] Vorbemerkung
Dieses Buch versammelt Essays, die ich in den letzten zehn oder auch dreizehn Jahren geschrieben habe, und Kolumnen, die zwischen Januar 2001 und April 2002 fürs Magazin des Tages-Anzeiger in Zürich entstanden sind. – Jene Leserinnen und Leser, die meine Grazer Poetikvorlesungen gehört oder gelesen haben, mögen im Teil m dieses Buchs auf den einen oder andern vertrauten Gedanken stoßen. Ich habe damals, in meiner Not, einige Sätze aus meinen Arbeiten zu Vladimir Nabokov und Gottfried Keller herausgeplündert. Hier also die ausführliche Version. – Im übrigen habe ich da und dort einzelne Passagen behutsam überarbeitet; sehr behutsam; sozusagen fast gar nicht.
U. W.
[9] I
[11] Das Geld, die Arbeit, die Angst, das Glück
Im Anfang war nicht das Geld. Im Gegenteil, es gab an manchen verborgenen Orten bis in unsere Jahre hinein Gesellschaften, deren Mitglieder sich alles, was sie benötigten, durch Tauschhandel beschafften. Ganz konkret, Topf gegen Huhn, Jacke für Hose, wie seit den Urzeiten. Ihre Welt war so konkret, daß sogar ihre Sprache keine Abstrakta enthielt, keine Begriffe, und jede Abstraktion – die Arbeit, die Angst, das Glück – durch eine Erzählung erläutert werden mußte, so routiniert dann bald, daß diese Mini-Erzählung so etwas wie ein Begriff wurde, wiedererkennbar auf Anhieb.
Man schreibt den frühen Bewohnern Mesopotamiens, den Sumerern, zu, im 4.Jahrtausend die Schrift und das Rechnen erfunden zu haben. Sie machten das Tauschgeschäft, das bis dahin ein immer neues Feilschen gewesen war, zu einer mathematischen Aufgabe. Sie schufen Normen, nach denen der Wert einer Kuh oder einer Sandale benannt werden konnte. Und sie bezogen als erste diese Norm auf ein Metall, auf Kupfer und, vor allem und immer mehr, auf Gold und Silber. Deren sakrale Aura – bei den Sumerern verwalteten die Priester die heiligen Metalle – ist uns bis heute erhalten geblieben, denn bis heute haben der Wert des Goldes und des Silbers nichts mit einem sozusagen natürlichen Wert zu tun, der aus ihrer realen [12] Verwendbarkeit definiert wäre. Münzen allerdings, eigentliches Geld, hatten die Sumerer noch nicht. Viele Kulturen an vielen Orten erfanden viele, zuweilen bizarre Tauschsymbole, Geld eben: Muscheln oder besondere Steine oder sogar Vogelfedern. Es waren dann die Lyder, die die eigentlichen Münzen erfanden, und bald dann auch, so ums Jahr 700 herum, die Griechen. (Homer, hundert Jahre älter, rechnete noch mit Ochsen. Ein Mann galt bei ihm hundert Rinder, eine Frau an einer Stelle zwanzig, an einer andern sogar nur vier. Es war schon wie heute.)
Und natürlich berührten und überlappten sich bald die verschiedenen Münzsysteme, je deutlicher sich die alte Welt globalisierte. Geldwechsler in einem Hafen der Antike zu sein, das war ein Traumjob. Währungen wie Sand am Meer, saftige Courtagen. Und damals begann bereits zu gelten, was die pragmatischen Engländer dann mit einer berühmten Definition des Geldes beschrieben, die just durch ihre tautologische Formulierung besticht: »Money is accepted because it is accepted.«
Alles in allem ist die Geschichte des Geldes eine Illustration der zunehmenden Abstraktionsfähigkeit von uns Menschen. Irgendwann mußten wir die Kuh nicht mehr mit eigenen Augen sehen, wir glaubten, daß wir für die Münze, die wir statt ihrer erhielten, dann schon eine kriegen würden. Noch später reichte, statt der Goldmünze, ein Stück Papier, das uns versicherte, daß das Gold, das es repräsentierte, vorhanden und sicher aufbewahrt sei. Dann existierte auch das Gold nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so viel, wie Papierzettel im Umlauf waren. Heute genügen uns grüne Ziffern auf Bildschirmen und hie und da ein [13] Bankauszug. Der letzte Schritt ist noch nicht getan: Daß wir auch auf diese Hilfen verzichten können und in einem Zustand perfekter Abstraktion jeder jederzeit über eines jeden Besitz unterrichtet ist. Wie einst am ersten Tag der Menschheit, als so wenige Menschen lebten, daß ein jeder alles vom andern wußte. Das Abstrakte hätte mit dem Konkreten gleichgezogen.
Ich hätte gern, zu Beginn meiner Überlegungen, mit einigen knallharten Fakten aufgewartet. Mit handfesten, unwiderruflich recherchierten Zahlen. Ich hätte zum Beispiel gern herausgefunden, wieviel Geld es auf der Welt eigentlich gibt. Alles Geld, alles – die Summe muß, da sie gewiß endlich ist, bezifferbar sein. Aber niemand weiß das, niemand auch nur annähernd. Keine Statistik, kein Ökonom, kein Mensch. Niemand auf dieser Welt hat – vollständig und genau – ein konkretes Wissen, was wie wo abläuft, gar warum. Das Geld bestimmt unsere Existenz wie nichts sonst auf Erden, aber keiner kann sagen, wie der Geldaustausch vor sich geht und was er bewirkt. Es ist wie ein Flug im Nebel, und die Instrumente sind ausgefallen. Die Piloten halten die Maschine in der Luft, mindestens solange der Sprit reicht, aber wie sie sie auf die Erde zurückbringen wollen, wissen sie nicht.
Deshalb, und wohl auch noch aus anderen Gründen, macht einen das Nachdenken über das Geld seltsam hilflos. Man geht den Spuren des Geldes nach, die bis ins hinterletzte Bergtal führen und noch den fernsten Sandstrand verwüsten, man schnüffelt seinem Geruch nach, der die Atemluft bis in alle Winkel füllt, und man wird immer [14] ratloser. Dümmer. Über das Geld nachdenkend, wird man leer, gelähmt oder jäh aggressiv, weil das alles so entsetzlich undurchschaubar ist. Das Geld macht jeden klein, es macht sogar die Größten der Großen klein, weil da immer ein noch größeres Geld bleibt, über das der größte Große nicht verfügt und dessen Wirkung er nicht versteht. Das Geld, das doch wie das Objektive selber aussieht, bewirkt in uns nur allzuoft irrationales Verhalten. Jene Ökonomen, deren Verhalten und Sprache uns signalisieren, daß sie alles im Griff haben, glauben vielleicht selber, daß sie den Markt steuern, weil sie seine Logik verstehen und das Kommende prognostizieren können. Das ist aber nicht so. Es genügt, die Prognosen des vergangenen Jahrs mit den Wirklichkeiten von heute zu vergleichen. Der einzelne Ökonom mag sich und vielleicht sogar uns vernünftig Vorkommen. Der Markt denkt nicht daran, sich vernünftig zu verhalten. Er reguliert sich nicht selber, schon gar nicht nach den Gesetzen irgendeiner ökonomischen Vernunft, und das aus einem ganz simplen Grund. Der simple Grund sind wir. Wir ökonomisch Handelnden, mit unserer Gier, unserer Machtlust, unserer Hoffnung, einen größeren Happen von der Beute als die andern zu kriegen. Immer, auch wenn längst alle Alarmglocken schrillen, findet sich noch einer, der sich, aufheulend vor Gier, doch noch ins Getümmel wirft. Und dadurch auch den letzten Rest von Rationalität im Markt über den Haufen rennt. Der Markt verhält sich irrational, weil die Menschen, die in ihm handeln, sich irrational verhalten. Sie können gar nicht anders handeln. Es gibt keine Objektivität im Umgang mit Geld.
[15] Nämlich, es gibt im Umgang mit Geld längst keine sinnliche Vorstellung mehr für das, was unser Handeln mit Geld bewirkt. In dem Maße, in dem der Tauschprozeß abstrakter wurde, haben wir den Bezug zu den Dingen verloren, die das Geld eigentlich repräsentieren sollte. Das System hat sich verselbständigt und ist für unsere sinnliche Vernunft undurchschaubar geworden. Logisch eigentlich, daß wir, wenn wir mit Geld umgehen, in Verhaltensweisen jenseits der Vernunft zurückfallen. In alte magische Muster. Wir verhalten uns wie Gläubige, einige natürlich auch wie Ungläubige, wie die trunkenen oder aber skeptischen Teilnehmer eines Kults. Wir sind alle, freiwillig-unfreiwillig, Mitglieder einer weltumspannenden Religion, und wir sind gezwungen, zu glauben oder wenigstens hinzunehmen, was uns die Priester verkünden, weil uns die rationale Erkenntnis verwehrt bleibt. Gewiß haben unsere Priester und Päpste in Fragen der Ökonomie einen großem Durchblick als wir Glaubensfußvolk, aber auch Herr Greenspan oder meinetwegen Herr Ospel haben ein Wissen von ihrem Gott, dem Geld, das auf der Auslegung ihrer Bücher – der Bilanzen – und auf dem Deuten von Zeichen gründet. Der wirkliche Papst, jener in Rom, weiß ja von seinem Gott auch nichts sonderlich Genaues und kennt das, was Gott bewirkt, auch nur vom Hörensagen. Er ist, wie die Großen der Finanzwelt, ein Vorbild des Glaubens, nicht des Wissens. Das Abstrakte gleicht dem Göttlichen in seiner Unverstehbarkeit durch unsere Sinne. Unser Geldsystem hat heute eine Abstraktionshöhe erreicht, in dem die Deuter und Propheten wieder die größte Macht haben. Wie, bizarrerweise, bei den Sumerern schon [16] einmal, gleich bei den ersten zögernden Abstraktionsschritten, die man außerhalb der Tempel nicht zu tun wagte. Die Analysten von heute tragen immer noch Kultgewänder, keine Tücher und Turbane mehr, aber doch jene grauen Maßanzüge, ohne die das Zelebrieren des Kults des Gelds noch nicht möglich scheint. Den Vogelflug deuten sie nicht mehr, aber die Kurven, die der Dow Jones und der Dax und der Swiss-Market-Index und der Nasdaq fliegen, gleichen der Flugbahn von Bussarden und Geiern.
Es ist das Einfachste von der Welt, die Katastrophe zu prophezeien. Kassandra ist eine Rolle geworden, die jede und jeder spielen kann. Es liegt auf der Hand, daß das alles nicht gutgehen kann, die Erhitzung der Weltwirtschaft, die ungleiche Verteilung des Besitzes, der kriminelle Umgang mit unserer Natur, die zukunftsblinde Ausbeutung der Rohstoffe, das schier ungebremste Wachstum der Weltbevölkerung. Wer unsern Untergang voraussagt, hat beinah sicher recht.
Wann, wie und warum, da mag man noch ein bißchen drum rechten. Aber hier natürlich fangen die Fragen an, und es gibt beinah so viele Antworten wie Fragende. Es ist schwieriger, die diffuse Gegenwart auszuhalten und halbwegs rational zu betrachten, als auf die apokalyptischen Reiter zu deuten, die den Horizont entlanggaloppieren. Das nämlich tun wir sogar mit einer gewissen Lust. Die Apokalypse ist nicht nur schrecklich, sie ist auch großartig, allein schon, weil das eigene individuelle Sterben im allgemeinen Sterben ertragbarer wird. Es trifft alle, nicht nur mich.
[17] Ist es ein Zufall, daß mir beim Nachdenken über das Geld das Weltende einfällt? Das Geld, selber so neutral, daß es Gutes wie Böses bewirken kann, scheint doch mehr Unheil zu stiften, als daß es Glück schafft. Es macht – Ausnahmen bestätigen die Regel – egoistisch, es vereinzelt die Menschen und hindert sie daran, sich als Mitglieder einer Gemeinschaft zu verstehen, in der keiner ohne den andern leben und überleben kann. Wir denken längst, wir können das allein, unser Leben leben, besser sogar als mit den andern; wir müssen dafür allenfalls noch irgendeinen Jackpot leerräumen. Geld ist, was es wirkt. Es schafft die Unterschiede. Die Unterschiede schaffen den Neid, der Neid schafft die Wut, die Wut schafft die Gewalt, die Gewalt heißt dann oft Mord, Massenmord, Krieg. Geld schafft den Tod.
In jedem und jeder von uns lebt deshalb der Traum, vom Geld unabhängig zu sein. Nicht viel zu haben, nein, gar nicht darauf angewiesen zu sein. Ein Leben ohne Geld zu leben. Mit andern Kriterien: Mit sich selber identisch eine Arbeit zu tun, die genau deshalb gar nicht mehr als Arbeit empfunden würde, mit Beziehungen zu Menschen, die nicht von Interessen geprägt wären. Manche, sogenannte Aussteiger, steigen auf einer einsamen Insel aus und winken dem davonfahrenden Boot nach und leben von Kokosnüssen und Krabbengetier. Es klappt, in der Regel, gerade bis zur ersten Magenkolik. Ein gebrochener Zeh reicht, und man gräbt nach seiner Versicherungspolice. Wenn ich mich in den letzten hundert Jahren umsehe, erkenne ich eigentlich nur einen, der die terroristische Macht des Geldes aufgehoben hat, indem er sich eine eigene Währung schuf: Pablo Picasso. Er lernte, sein eigenes Geld zu zeichnen. [18] Wenn er in einem Restaurant aß, überließ er dem Wirt das Papiertischtuch, auf das er eine Taube oder einen liegenden Akt gezeichnet hatte, und der Wirt war überglücklich. Picasso war vom Geld so unabhängig, daß er in Schlotterhose und Matrosenleibchen lebte, von Käse und Brot, völlig anspruchslos, falls zur Anspruchslosigkeit ein Haus mit achtzehn Zimmern, ein Auto mit einem Chauffeur und ein parkgroßer Garten gehören.
Aber sogar Picasso umlauerte die Angst, ihn wohl noch mehr als uns. Eine Angst, einem Picasso angemessen. Archaisch, gewaltig. Unsere Ängste hingegen haben oft und nicht ohne Gründe mit den sozialen Bedingungen zu tun, in denen das Schicksal uns zu leben zwingt. Mit Geld eben. Die Geldgesellschaft ist, unausweichlich, eine Terrorgesellschaft. Die einen üben den Terror aus, zu ihrem Gewinn, die andern erleiden ihn. Wo Geld ist, ist auch Macht, und wo Macht ist, wird sie auch ausgeübt. Heute muß man keinen mehr ausschicken, das Fürchten zu lernen, wie im Märchen. Glitschig nasse Fische, die schlimmstmögliche Angst von damals, beeindrucken uns nicht mehr. Heute werden wir Tag für Tag mit Informationen überschüttet, die uns das Fürchten so sehr lehren könnten, daß es im Gegenteil ein Wunder ist, daß wir das, was wir wissen, in der Regel relativ unbeschadet aushalten. Daß uns die Erkenntnis der Menge des Entsetzens auf dieser Erde nicht längst zerfetzt hat. Denn nähmen wir an all dem Schrecken wirklich und angemessen teil, wir überlebten ihn keinen Tag. Die Gemetzelten, die Erschlagenen, die Verhungernden, die Verblutenden. Millionen und Abermillionen Ermordete.
[19] Ich habe, so wie ich die Menge des existierenden Geldes hochzurechnen versuchte, auch versucht, die Zahl der Opfer der Genozide dieser Erde auszurechnen. Nicht aller Toten auf Erden, natürlich nicht, unser aller Tod ist immer noch zu hundert Prozent sicher, nicht einmal die Zahl der Opfer der vielen Kriege, nein, »nur« derer, die in systematischen Völkermorden gewaltsam umgekommen sind, weil es ihren Mördern um Macht und Geld ging. Die fünfzehn Millionen Sklaven, die ihren Bestimmungsort nie erreichten. Die Abermillionen Ureinwohner Südamerikas. Die vier Millionen Indianer auf dem Gebiet der heutigen USA. Die Tasmanier. Die Hottentotten. Die Guanchen. Die Armenier, eine Million auch sie. Die Juden, die Zigeuner. Ruanda, der Kongo, zu Zeiten Leopolds II., und jetzt. Auch hier sind genaue Zahlen kaum zu erfahren, die Angaben klaffen, je nach Quelle, um mehrere Millionen auseinander: Wo doch schon ein Mensch mehr oder weniger einen ungeheuren Unterschied macht, jedenfalls für diesen einzelnen Menschen. Sind es neunzig Millionen? Hundert? Oder doch zweihundert Millionen? Tote jedenfalls, Hekatomben.
Es ist wiederum kein Zufall, daß wir mal jene Zahl hören, mal diese. So genau wollen wir es nämlich gar nicht wissen. Nur weil wir den Schrecken, den wir eigentlich empfinden müßten, abwehren können, halten wir das Leben aus. Können wir es ohne allzu verschlingende Ängste verbringen. Ein Hoch auf die Abwehr, ein Hurra auf unsere Fähigkeit, einzeln und kollektiv das Entsetzen von uns fernzuhalten. Man kann nicht zuviel von uns verlangen, überleben zu wollen, ist etwas Egoistisches. Wir tun [20] denn auch buchstäblich alles, was unsere Ängste von uns fernhalten könnte. Alles Erklären (auch dieses hier) dient (wenn auch nicht ausschließlich) dazu, das Chaos, das uns zu überschwemmen droht, zu strukturieren und aushaltbar zu machen. Ob die Erklärung auch stimmt, ist nur halb so wichtig. Wenn nur ihre Form und Struktur so kraftvoll ist, daß sie die Angst zu binden vermag.
Afrika zum Beispiel: jener Kontinent, der am vernichtendsten hat erfahren müssen, daß der Kolonialismus die hemmungslose Variante des Kapitalismus ist und daß dieser, wenn man ihn keiner Kontrolle unterwirft, zum Massenmord fähig ist. Ungezählte Tote auch heute noch, wo die Einheimischen das, was ihnen angetan worden ist, inzwischen selber tun. Wir sind entsetzt.
Sind wir entsetzt? Vielleicht ist nämlich alles noch viel schlimmer. Wir sind gar nicht entsetzt, wir sind einverstanden. Wir sind damit einverstanden, daß die Menschen in Afrika sterben; und nicht bei uns. Denn wir wissen, daß die Götter pro Jahr so und so viele Opfer haben wollen, ein paar Millionen per annum, denn die Götter sind gnadenlos und verschlängen auch uns ohne ein Wimpernzucken, kämen wir je in ihr Gesichtsfeld. Also tun wir alles, um sie von uns abzulenken. Damit nicht wir die Opfer werden.
Wie gut, daß es die Dritte Welt gibt. Afrika insbesondere. Die Afrikaner mögen magisch denken, wir tun es allemal. Die Opfer von Ruanda oder des Kongo verstören uns nur an unserer politisch korrekten Oberfläche, in unsern paar zivilisierten Hirnzellen. In unsern Tiefen beruhigen uns die Toten anderswo. Die [21] menschenverschlingenden Ungeheuer sind anderswo beschäftigt, nicht bei uns. Man kann sich fragen, wie bewußt Politik und Wirtschaft diesen magischen Vorgang mitbetreiben. Ihn fördern selbst da, wo von Hilfe und Kooperation die Rede ist. Aids, jenes Gegengewicht der uns bedrohenden Bevölkerungsexplosion: Vielleicht sind wir klammheimlich auch mit Aids einverstanden, solange es die Afrikaner wegrafft und nicht uns. Was geschähe, wenn dieses Afrika zu Kräften käme? Was geschähe mit uns? Kämen sie alle, die Schwarzen, und schlügen uns tot?
Man sagt, wir lebten in einer Spaß-Gesellschaft, man sagt es oft kritisch. Ich lebe lieber in einer Spaß- als in einer Mord-Gesellschaft. Dennoch, es kann schon sein, daß ein Zusammenhang zwischen unserer Sucht nach Entertainment und unsern kollektiven Ängsten besteht. Das zwanzigste Jahrhundert hat jedenfalls keine und keiner überstanden, ohne eine Ahnung mitgenommen zu haben, daß hienieden die Katastrophen die Regel sind und die Zeiten friedlichen Glücks die Ausnahme. Dabei, wir, die wir erst mittelalterlich oder gar noch jünger sind, was haben wir für ein Massel gehabt. Kein Krieg in unserer Gegend seit 1945. Tiefer Friede seit mehr als fünfzig Jahren. Trotzdem leiden wir, und vielleicht sogar zunehmend, an Ängsten. Ängste sind eine Art Volkskrankheit geworden. Vernichtungsängste, Versagensängste. Die Weltgesundheitsorganisation hat kürzlich erst berechnet, daß in Europa siebenunddreißig Millionen Menschen leben, die, wie sie das formuliert, »an beschäftigungsbedingten Depressionen« leiden. Siebenunddreißig Millionen Menschen in Europa, [22] denen die Art ihrer Arbeit so zusetzt, daß sie gelähmt die Waffen strecken. Manche retten sich, um das Schlimmste zu verhindern – und Ängste sind das Schlimmste – in eine manisch-aggressive Tüchtigkeit. »Lead, follow or get out of the way.« Noch andere werden Angstbeißer, rasieren sich die Haare ab und halten sich Hunde.
Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig wir uns in der Regel des schreienden Widerspruchs bewußt sind, der unsern Alltag prägt. Nämlich, wir erleben uns als politisch reife Demokraten und wehren uns aus guten Gründen gegen jeden Abbau unserer demokratischen Rechte. Wir gestehen unsern Politikern keine noch so kleine Selbstherrlichkeit zu. Wehe, sie fragen uns nicht, ob sie das Dach des Kunstmuseums flicken dürfen. Gleichzeitig begeben wir uns jeden Tag in eine Arbeitswelt, in der nichts, aber auch gar nichts demokratisch geregelt ist. Alles läuft streng hierarchisch ab. Der Chef hat recht, auch wenn er unrecht hat, und zuweilen sind wir dieser Chef. Wie halten wir das eigentlich aus, ohne irre zu werden, tagsüber Weisungen zu empfangen und Weisungen weiterzugeben, genau nach Funktionsdefinition, und am Abend ein reifer Bürger zu sein, gleichmäßig am Wohle aller interessiert? Die Wirtschaft hat eine schwach entwickelte demokratische Tradition – kaum eine, um es deutlicher zu sagen –, und sie hat bis heute ein nur schwach entwickeltes demokratisches Selbstverständnis. Sie war und ist am Mehrwert interessiert und am demokratischen Staat nur soweit, als dieser Bedingungen zu schaffen vermag, die das Geldverdienen möglichst reibungslos erlauben. Sie selbst ist undemokratisch, schätzt aber die Demokratie als Struktur, innerhalb [23] derer sie auf ihre Weise funktionieren kann. Tatsächlich hat die Wirtschaft – wohl selber überrascht – im Lauf der Jahrzehnte gelernt, daß die Demokratie, just die Demokratie, das geeignetste System für die eigene Geldvermehrung ist. Sie ist aus Schaden klug geworden. In früheren Jahren haben mehr Industrielle als heute auf Diktaturen gesetzt, auch in der Schweiz einige. Die Ähnlichkeit der Konzepte ihrer eigenen Betriebe und der Staatsführung – beide Male starke Autoritäten an der Spitze – mag sie verführt haben, aber sie mußten dann die Erfahrung machen, daß ihnen jenes Ähnliche just schadete. Nicht half. Das Zusammenspannen der Wirtschaft mit dem Nationalsozialismus – auch, freiwillig-unfreiwillig, der schweizerischen – war ein Fiasko. Das Zusammenarbeiten mit allen Diktaturen war ein Fiasko für die, die es versucht haben. Alles ging immer nur ein paar Jahre lang gut – um es »gut« zu nennen – und endete stets erneut mit einem Scherbenhaufen. Nein, nicht stets. Zumeist. Einige Freunde Pinochets sind ziemlich ungeschoren davongekommen. Und er selber ja eigentlich auch.
Vielleicht hängt die – trotz dem eben Gesagten – relativ geringe Verführbarkeit der Schweizer im allgemeinen und der Schweizer Wirtschaft im besonderen für faschistische Konzepte damit zusammen, daß sie länger als andere die Erfahrung machen konnten, daß eben just die Demokratie das fürs Geldverdienen ideale System ist. Was brauchten sie da einen starken Führer. Seit 1848, länger als alle andern rings um sie herum, testet die Wirtschaft die Möglichkeiten dieses Systems aus. Und siehe, es ist das, mit dem die in [24] aller Regel äußerst undemokratisch geführten Firmen am besten auskommen. Die Erkenntnis setzt sich so radikal durch, daß Demokratie inzwischen weltweit die Grundvoraussetzung für jene Marktwirtschaft geworden ist, die sich frei nennt und damit die möglichst große Freiheit von staatlichen Einschränkungen meint.
Die Wirtschaft braucht keine Führer außerhalb ihrer eigenen Strukturen. Sie führt selber. Sie ist das System, das autoritär und nach seinen eigenen Regeln sagt, wo’s langgeht. Sie will keinen autoritären Staat um sich herum, sie ist selber autoritär. In der Tat haben just in der modernen Ökonomie eine ganze Reihe von Werten überlebt, die den alten Faschismus prägten. Beider Religion ist ein grobschlächtiger Darwinismus, in dem sie sich selber als die Starken sehen, die, weil die Natur das vorschreibt, die Schwachen fressen müssen. Sie setzen ganz auf die Sieger und sehen in einem Verlierer einen, der nicht lebenswert ist. Die Werte der Sieger sind gut, die Werte der Verlierer schlecht. Es gibt kein Sowohl-als-auch. Es gibt keine Ambivalenz. Die Harten von damals sind die Coolen von heute, und die Alphatiere von heute joggen um sechs Uhr früh durch den Wald, um gesund zu sein, gesund und kompetitiv, und man hat auch bei ihnen zuweilen den Verdacht, daß sie in den Nicht-so-Gesunden und weniger Kompetitiven, wie einst die Faschisten, unwertes Leben sehen. Mit hoher Aggression jedenfalls wenden sich die, die die Werte der Ökonomie vertreten, gegen alles, was von den Normen abweicht. Die Kraft von einst gleicht der Power von heute aufs Haar, und der Wille, sich um jeden Preis durchsetzen zu müssen, ist zur Efficiency geworden. [25] Militärisches Denken ist in der Neuen Ökonomie allgegenwärtig. Größere Firmen verfügen über Divisionen, und ihre Mitarbeiter arbeiten an der Front. Manager sind so etwas wie Söldner geworden, Troubleshooter, verdingen sich für möglichst viel Geld da, dann dort, und bleiben selten mehr als fünf Jahre.
Die Neue Ökonomie hat oft perverse Züge, wenn denn Perversion ein Abweichen von ethischen und moralischen Normen ist, das andern (und oft auch sich selber) Schaden zufügt und dennoch zwanghaft vollzogen werden muß. Die Ökonomie von heute zerstört Menschen, immer wieder, und ist unermüdlich in der Rechtfertigung ihres Tuns. Es ist ein Kennzeichen der Perversion, daß die Gefühle, die dazugehören, vom tatsächlichen Handeln abgekoppelt sind. Ja, sie verkehren sich nur allzuoft in ihr Gegenteil. Dann, in der sadistischen Spielart des Handelns, bereitet Lust, was Entsetzen auslösen sollte. Seinen Konkurrenten zerstören, den Mitarbeiter erniedrigen, den Rivalen demütigen. Die perverse Lust an der Zerstörung ist ein Teil der Wirtschaft, und perverses Handeln wird dann positiv bewertet. Applaus für den Zerstörer. Es wird nicht gefragt, ob eine Handlung ethisch vertretbar ist. Sondern ob sie sich rechnet.
Im Modell der modernen Ökonomie schlummert also faschistisches Denken. Aber erst die Kombination eines undemokratischen Selbstverständnisses mit der schieren Größe der Unternehmen macht sie gefährlich. Gar nicht so wenige Firmen machen inzwischen Umsätze, die mit den Bruttosozialprodukten ganzer Staaten rivalisieren können. Diese Firmen haben so viele Standbeine in so vielen [26] Rechtssystemen, daß eines immer paßt. Nationale Grenzen greifen nicht mehr. Ist die notwendige Folge aus diesem Dilemma nicht, daß auch die Staaten sich mit einer großflächigen gemeinsamen Gesetzgebung organisieren müssen, um demokratisches Leben zu garantieren?
Nicht nur Deutschland – ganz Europa –, auch die Schweiz hat sich in den letzten zwanzig, dreißig Jahren verändert, und zwar auf vergleichbare Weise. Die Probleme der Schweizer sind ebenfalls die, vor die sie die Neue Ökonomie stellt. Denn auch die Teilnehmer der Schwing- und Trachtenfeste – sie sind die letzten, die sich noch an Wilhelm Teil und Winkelried erinnern – arbeiten während der Woche in einer Bank oder verkaufen Immobilien.
Auch sie sind den Ängsten ausgeliefert, die das Jahr 1989 so überraschend in die Welt gesetzt hat. Denn eigentlich war das ja ein Freudenjahr. Die fallende Mauer: ein unvergeßlicher Lebensaugenblick. Aber dann geschah etwas Beunruhigendes. Es gab jäh nur noch eine Klasse, uns, und ein Denken. Das unsere. Wenn aber eine Gesellschaft von einem einzigen Denkmodell beherrscht wird, ist sie kaum mehr fähig, sich selber zu beobachten und zu kritisieren. Sie ist blind für sich selber. Sie analysiert nicht mehr grundsätzlich, sondern bastelt allenfalls an kleinen Systemkorrekturen herum. So geht ihr, blind für die eigenen Defizite, auch ihr Gefühl für Moral verloren. Statt Moral zu haben, moralisiert sie, um so heftiger, als sie den Verlust wahrhaftiger Moral ahnt. Wir sind politisch korrekt bis zum Gehtnichtmehr. Aber die Ungeheuerlichkeiten dieser Welt werden seltsam ruhig hingenommen.
[27] Wir sind alle in einem Maß durch die Arbeit, die wir täglich tun, definiert, daß wir uns eine andere Selbstdefinition kaum vorstellen können. Ich bin, was ich arbeite. Das hat bis heute ja auch halbwegs funktioniert, und die Marktwirtschaft baut mehr als jedes andere System auf diesem Denken auf. Sie hat ja, auf den ersten Blick, auch recht. Wir alle heben nur den Hintern, wenn wir mit den andern rivalisieren können und müssen. Wir wollen uns messen, die meisten von uns. Wir wollen den andern ein Schnippchen schlagen und besser sein als sie. Wir sind in der Tat nicht alle für alles gleich begabt. Hans ist nicht Heini. So ist es auch im Leben der Wirtschaft. Die UBS rivalisiert mit der Crédit Suisse und der Deutschen Bank, so weit, so gut. So schlecht, denn die Folgen einer Niederlage sind für die Verlierer oft verheerend. Einem, der einfach seine Arbeit tun will, ist wenig damit gedient, daß die ökonomische Theorie von »schöpferischer Zerstörung« redet. Ihm hat man seine Arbeit genommen. Der Markt, der alles regeln soll, regelt eines am allerschlechtesten: eine verläßliche Kontinuität unseres Arbeitslebens.
Wie also kann unsere produktive Rivalität erhalten bleiben und dennoch erreicht werden, daß keiner von uns zerstört wird, wenn er dem Rivalisieren nicht gewachsen ist? Wie kann man die Verteilung des erarbeiteten Geldes von der Arbeit der Menschen abkoppeln? Wie können Belohnungssysteme aussehen, die sich nicht in Rappen und Franken beziffern lassen? Würdige Formen der Arbeit? Belohnungssysteme, die bedächten, daß es unangenehmer ist, ein Klo zu putzen als eine Firma zu leiten? Glanz und Gloria? Nobelpreise? Das rosa Licht der Prominenz? Ich [28] habe keinen Dunst, ich weiß nur, daß wir gern arbeiten, wenn unsere Arbeit einen Sinn macht, und daß umgekehrt irgendwann einmal, bald wahrscheinlich, von uns allen viel weniger Arbeit geleistet werden muß. Es ist gewiß ja auch wünschenswert, nicht verwerflich, wenn unsere Autos oder Kühlschränke von Robotern montiert werden. Es ist bloß verwerflich, den Menschen, die das vorher getan haben, keine Mittel für ihr Leben zu geben. Es ist menschenverachtend, es ist ökonomisch dumm, denn sie sind auch Kunden, und es ist politisch gefährlich, weil an den Rand gedrängte Menschen zu einem undifferenzierten und undemokratischen Denken neigen.
Sowieso sind viele unserer Beschäftigungen in dieser Arbeitswelt einigermaßen absurd geworden. Dies sind die Stellenangebote eines einzigen Tages, einer einzigen Zeitung: Da wird zum Beispiel ein »Corporate Key Relationship Manager« gesucht, mit »natürlicher Affinität zum transatlantischen Kommunikationsstil und interkultureller Rundumbildung«. Oder ein Vice President Corporate Staff Management Resources, ein Change Manager, ein Manager Component Purchasing and Subcontracting, ein Business Process Engineer, ein Area Sales Manager, ein Event Coordinator, ein Human Resources Consultant, ein Chief Executive Officer, ein Integration Manager Supplier, ein Supply Chain Manager, ein Procurement Officer, ein Senior Consultant, ein Head of Operations und ein Deal Manager.
All diese Berufe stammen aus einer deutschsprachigen Zeitung, wohlgemerkt, aus der Neuen Zürcher Zeitung. Mir ist schon auch klar, daß da manche altvertraute [29] Tätigkeit mit prächtig klingenden Titeln aufgemotzt wird. Der Area Sales Manager wird wohl wie eh und je mit seinen Staubsaugern losziehen und von unwilligen Hausfrauen die Tür auf die Nase geknallt bekommen. Dennoch. Früher gab es – die Älteren unter Ihnen werden sich daran erinnern – den Begriff der entfremdeten Arbeit, weil man sich eine nicht entfremdete Arbeit immerhin noch vorstellen konnte. Heute ist der Begriff verschwunden, entweder weil es keine entfremdete Arbeit mehr gibt oder weil alle Arbeit entfremdet ist. Dabei ist doch dem einen Last, was dem andern Lust bereitet. Lokomotivführer oder Pilot, das waren einst die Kinderwünsche. Wir wurden dann doch etwas anderes. Aber etwas von einem erfüllten Kinderwunsch sollte unsere Erwachsenenarbeit schon haben, um von uns als bereichernd erlebt zu werden. Wer aber hat als Zwölfjähriger davon geträumt, ein Corporate Key Relationship Manager zu werden?
Wir sind dem Glück nahe. Unserm letzten Kapitel. Glück hat viel mit erfüllten Kinderwünschen zu tun, bekanntlich. Warum ist Glück dennoch so wenig ein gesellschaftliches Ziel, daß der Satz, der in der Präambel der amerikanischen Verfassung steht, allenfalls als eine skurrile Bizarrerie zitiert wird? Nämlich, daß das Ziel des Staates und seines Handelns sein müsse, seinen Bürgern zum Glück zu verhelfen. Wir, heute, finden das ein bißchen komisch. Wir wollen das Glück weniger als anderes, es ist ein Wert, aber einer, der radikal dem Privaten zugewiesen bleibt und auch dort immer erneut scheinbar Wichtigerem Platz machen muß. Alltagsnotwendigkeiten und Sachzwängen. Das inzwischen schier ausgestorbene [30] Bürgertum von einst hat uns die Fähigkeit vererbt, das Glück immer erneut auf morgen zu verschieben. Als sei es kein wirklich erreichbares Ziel, sondern allenfalls eine ideale Theorie.
Aber es gibt das Glück. Es ist selten, es ist flüchtig, es ist kostbar. Aber jene, die es erlebt haben, wissen, daß es existiert. Vielleicht ist just diesen Glücklichen am deutlichsten, daß das Glück nicht das Ziel des einzelnen sein kann, sondern – wie das die klugen Amerikaner schon im Jahr 1788 erkannt hatten – das der Gesellschaft werden muß, denn es kann kein einzelnes Glück im allgemeinen Unglück geben. Es gibt, um Adorno zu variieren, kein richtiges Glück im falschen.
In der Welt der Ökonomie, die beinahe schon die ganze Welt ist, heißt das Glück Geld. Es ist handelbar und hat seinen Tageskurs. Dieses Glück, das kleine Glück, ist immer noch, wie sein großer Bruder, ein Gefühl. Aber ein kleines. Es gibt in der Welt der Ökonomie keine Atriden mehr, keine Gefühle, wie sie die Atriden empfanden, obwohl es auch diesen um Gold und Macht ging. Heute, wenn atridengroße Gefühle auch nur am Horizont auftauchen, wird Chemie eingesetzt. Hätten die ärztlichen Priester im alten Griechenland Klytemnestra Prozac verschrieben, ein Pfund Valium, Agamemnon lebte heute noch. Gefühle müssen heute unter allen Umständen handhabbar bleiben und heißen deshalb Emotionen. Emotions. Weniger ist mehr, dieser Satz gilt bei den Gefühlen besonders. Allerdings, keine Gefühle zu haben, das ist inzwischen auch tabu. Der alte Boss, der alle Probleme mit Handkantenschlägen löst, ist ein Auslaufmodell. Es gibt den IQ [31] zwar noch, den Intelligenzquotienten, aber sein junger Bruder, der Emotional Quotient, hat ihm den Rang abgelaufen. Manager und Managerinnen müssen nun nicht mehr nur leistungsfähig, fachlich kompetent, durchsetzungsfähig und belastbar sein, nein, sie müssen auch über eine Emotionalität verfügen, die den Bedürfnissen ihrer Arbeit angemessen ist. Zärtlich aber gnadenlos, verständnisvoll aber beinhart, so etwa. Eine solche Emotionalität fordern heißt, das Glück abgeschrieben zu haben. Man kann nicht beides haben. Das Glück, jenes mit Großbuchstaben, kennt keine Bedingungen und läßt sich in keine Strategien einbinden. Die Emotionalität der Neuen Ökonomie ist der größte Feind des alten Glücks, just weil sie ihm, sorglos betrachtet, zuweilen ein bißchen gleicht.
Zum Schluß möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich bin sicher, daß Sie sie kennen. Es ist die Geschichte von König Midas und geht so: König Midas war der König von Phrygien, das ist in der heutigen Türkei, und er hatte einen Wunsch frei bei den Göttern von damals. Er wünschte sich, daß alles, was er anfaßte, auf der Stelle zu Gold werde. Aber bitte, sagten die Götter, es sei. Midas faßte einen Stuhl an, und schon war der aus Gold. Einen Teller. Gold. Einen Stein. Auch Gold. Super. Aber dann kriegte König Midas Hunger und wollte essen, ein Falafel oder ein Dönerkebab, und die wurden auch zu Gold, und er biß sich einen Zahn aus. Das Wasser war Gold in einem Glas aus Gold. Hilfe, brüllte König Midas, Götter, Irrtum, großer Irrtum, befreiet mich von diesem Fluch. Und weil die Götter damals gute Götter waren, sagten sie ihm, er solle im Fluß Paktolos baden, dann sei alles [32] wieder gut, und tatsächlich, als König Midas aus dem Wasser stieg, konnte er sein Falafel essen und das Wasser trinken. Im Fluß Paktolos aber findet man heute noch Gold.
Dann war König Midas noch berühmt für seine Eselsohren. Das ist eine andere Geschichte. Er hatte wieder einmal über die Stränge geschlagen und sich über Apollo lustig gemacht, und der hexte ihm, sauer geworden, Eselsohren an. König Midas schämte sich entsetzlich und trug nur noch Turbane oder riesige Hüte. Er sagte niemandem, daß er Eselsohren hatte, aber irgendwie mußte er es doch sagen, er wäre sonst geplatzt mit dem entsetzlichen Geheimnis, und so schlich er jede Nacht aufs Feld hinaus und grub ein tiefes Loch und flüsterte in dieses Loch: »König Midas hat Eselsohren!« und schaufelte das Loch schnell wieder zu. Niemand hat ihn je gehört, kein Mensch. Aber Schilf wuchs aus all den Löchern, und wenn der Wind wehte, flüsterte das Schilf: »König Midas hat Eselsohren!«, und das tut es heute noch, das Schilf, alles Schilf auf der Welt, und deshalb wissen wir, daß König Midas Eselsohren hat. Daß heute noch alle Midasse Eselsohren haben.
[33] II
[35] Die Verbesserung von Zürich
Es gibt ein Buch von Oswald Wiener, einem Schriftsteller aus Wien, das Die Verbesserung von Mitteleuropa heißt. Es ist ein spannendes, auch schwieriges Buch, ein Schlüsselbuch der neueren deutschen Literatur. Mich interessiert hier vor allem das Projekt, von dem Oswald Wiener ausgeht und das er, im Laufe seines Schreibens, dann eher aus den Augen verliert: die Verbesserung von etwas, was unverrückbar scheint, wie die Natur selber. Von Mitteleuropa in seinem Fall, das es bei Erscheinen des Buchs (1968) kaum noch zu geben schien. Ja, das können Bücher, das können wir Menschen in unsern Köpfen: ein Bestehendes verbessern, simuliert zwar, aber dennoch. – Ein anderer Schriftsteller, auch ein Wiener übrigens, Dominik Steiger nämlich, hat eine Verbesserung der Oktoberrevolution erdacht, ohne Frage ein ebenfalls sinnvolles und sehr notwendiges Projekt. Ja, für das Verbessern gibt es ein weites Tätigkeitsfeld. Alles eigentlich scheint mir verbesserungswürdig, schier alles. Die Büroklammer ist perfekt, und die Toblerone. Aber sonst? In Angriff zu nehmen wäre, von Toblerone, Büroklammer und vielleicht noch dem Espresso im Bahnhofbuffet von Domodossola einmal abgesehen, die Verbesserung der Welt. Insbesondere die Verbesserung von Amerika und Rußland, dann auch des Balkans, Asiens, Afrikas und Liechtensteins. Aber auch [36] die Verbesserung der Schweiz wird nicht zu umgehen sein, ich denke da an den Mutterschutz, das Fernsehen und die Expo. Aber beschränken wir uns auf Zürich. Die Verbesserung von Zürich.