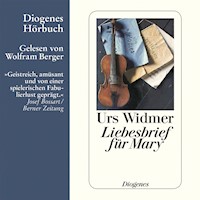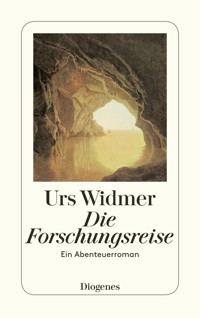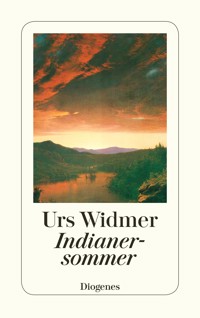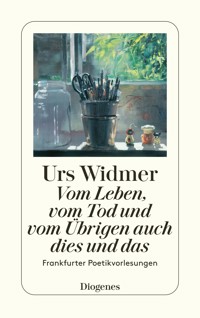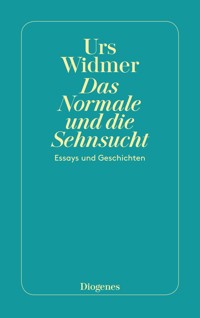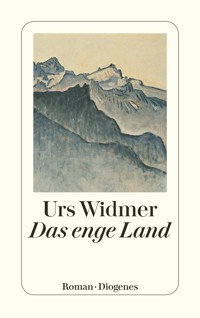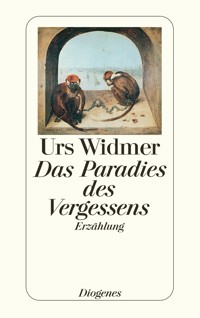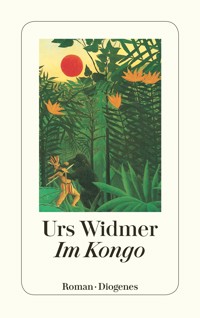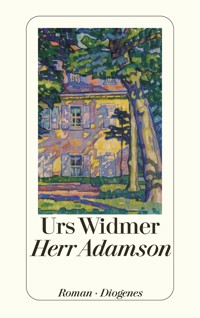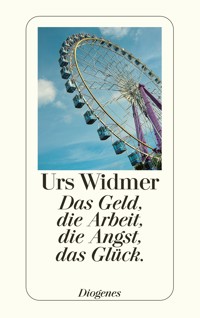7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Chinesen, Doppelgänger, zehn Rätsel und einige Utopien, die Prostituierte, der Bundeskanzler, ein Architekt, der Papphäuser baut, und andere Berufe, das Bildnis der Eltern als junges Paar und eine Kuh und das Land dazu – ein Buch mit Geschichten, Liedern und Bildern zur sogenannten Wirklichkeit voller Phantasie und Sinn für Realität, ›weil es da, wo man wohnt, irgendwie nicht immer schön genug ist‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Urs Widmer
Das Verschwinden der Chinesen im neuen Jahr
Mit einem Nachwort von H.C. Artmann
Diogenes
»Urs«
Als ich auf die Welt kam, hatte ich einen Kopf wie eine Birne, ungelogen. Trotzdem bin ich nicht Kanzler geworden. Kürzlich, ganz unschuldig, wollte ich in einem Buch diese Geschichte erzählen, und da kam ich erst drauf, auf die Birne und ihren derzeitigen Assoziationshof. Und weil niemand glaubt, daß das Leben wahre Geschichten schreibt, habe ich eine Quitte aus ihr gemacht. – Aus meiner Birne ist inzwischen ein Bärenkopf geworden, das hängt mit meinem Namen zusammen. Urs.
Lange Zeit hatte ich eher das Gefühl, meine Eltern hätten nicht mehr als das strikte Minimum für mich getan – drei Buchstaben! Andere hießen Johann Wolfgang oder Rainer Maria!
Auch meine Mutter begann die Namenswahl zu bedauern, man kann so kurze Namen nicht rufen, und mich mußte man immer rufen. Ich lag irgendwo unter den Kirschen oder zündete Hecken an, genauer, mein Freund F. (zehn Buchstaben) zündete; er war ein begnadeter Pyroman, er ist es immer noch; ging später allerdings zum Sprengen über. Heute hat er noch sechs Finger, und seine Mutter, die mir als der Inbegriff der Muttermilchwärme erschienen war, ist längst tot; sein Vater, ein Lustiger, hat sich im Estrich erhängt. – Solche Geschichten schreibt das Leben.
Urs ist der Bär, und Bären sind mir heute noch sympathisch. Zwar halte ich es inzwischen eher mit den Waschbären, nie aber habe ich mich mit so blöden Tieren wie Löwen oder Adlern identifiziert. Samson in der Sesamstraße hingegen ist mir lieb.
Wer ein Bär ist, stößt ständig auf Bäriges. An jeder Ecke steht ein Gasthof meines Namens. – Nur reisen kann ich mit meinem Urs schlecht. In Frankreich rufen sie mich mit einem spitzen Ü, ÜRSÖ, in Amerika klingt es wie Rülpsen. Dafür aber besteigen andere Menschen mit anderen Namen einfach einen Raucher- oder Nichtraucher-Waggon, wenn sie verreisen: ich aber einen Fume-Urs. Der Ursprung ist ursprünglich ein Urs-Sprung, man weiß ja, wie die Sprache mit Konsonantenhäufungen umgeht. Die Urs-Szene gar spielt in meinem Leben eine gewaltige Rolle, obwohl ich sie noch nie gesehen habe.
Im übrigen ist mein Name in meiner Heimat häufig. In meinem jahrelangen Wohnland hatte er den Reiz eines exotischen Klangs, aber hier, back home in Switzerland, sitze ich ständig neben einem andern Urs und einem andern Widmer gegenüber. Gottseidank merke ich das erst jetzt, ich hätte mir sonst vielleicht – vor Jahren, beim ersten Gedicht – ein Pseudonym ausgedacht, eins mit vielen Buchstaben. Heinrich von! Jetzt aber müssen die anderen Urse sich eins suchen.
Abschließend will ich nur noch sagen, daß ich inzwischen gelernt habe, daß die Wörter nicht wirklich zaubern. Man kann ein Wort einfach so sagen, und gar nichts passiert. Die Ausnahme sind die Namen. Noch immer darf niemand mit ihnen Schindluder treiben, wenn er nicht riskieren will, daß die Götter sich schrecklich rächen. Neben mir wohnt ein Tiefbauingenieur, der Würmli heißt. Nie würde ich darüber lachen.
I
Eine Herbstgeschichte
Ich möchte erzählen, wie ich jenen Herbst verbracht habe, in dem Männer und Frauen erschossen wurden, Fahndungsfotos in Gaststätten hingen und das Fernsehen zeigte, wie man Todesschützen entwaffnete. Tankstellenwarte hatten mich angestarrt und waren dann zum Telefon gegangen. Überall standen Zivilfahnder mit Walkie-talkies. Ich wies mich an jeder Straßenecke aus. Dann fuhr ich weg. In meine Identitätskarte hatte ich ein Foto einer Frau gelegt, wegen der ich es nicht mehr in meinem Zimmer in Frankfurt aushielt. Ich fuhr nach Süden, ohne den Mut aufzubringen, ihr Foto zu Hause liegen zu lassen. Ich verglich es immer wieder mit denen auf den Plakaten. Wenn mein Gesicht unterwegs einer Polizeistreife auffiel, gab ich meinen Ausweis her und stand da und hielt, während die Beamten am Stempelaufdruck leckten, das Wasserzeichen gegen den Himmel hoben, in ihr Funkgerät sprachen und ihre Maschinenpistolen auf meinen Bauch richteten, ihr Foto in der Hand und sah es an. Ich war süchtig auf ihr Gesicht.
Im Sommer war das Getreide auf den Feldern verfault, und die Kühe waren in den Weiden ertrunken. Aber der Herbst war voller Sonne. In den Gärten wuchsen Dahlien und Sonnenblumen. Über die Felder ratterten Maschinen, die Maisstauden fällten. In den Wäldern krachten Schüsse. Vogelschwärme stoben aus Stoppelfeldern auf. Die Mauern waren mit roten wilden Rosen überwuchert.
Ich wohnte in einem Zimmer in einem Dorf mit Fachwerkhäusern und Kastanienbäumen. Ich saß am Fenster, an einem großen Holztisch, die Luft war herrlich, eine warme Sonne schien, ich sah über einen verwilderten verwunschenen einsamen Garten hin auf Stoppelfelder, eine Straße und dahinter auf einen großen See. Wie lange hatte ich kein Korn mehr gesehen, keine Kuh, keine Sonne. Wespen summten. Schiffe fuhren auf das gegenüberliegende Ufer zu, blauen Bergen entgegen, mit langen ruhigen Sogwellen. Es roch nach Rauch. Ich dachte, hier sind die Menschen gottesfürchtig und glauben nicht alles, was ein Minister im Fernsehen sagt, ich rieb mir die Hände und packte die Schreibmaschine aus, die, auf der schon mein Vater auf seinen Reisen geschrieben hatte, und Papier. Mein Vater, wie oft brach er auf, und wo kam er an. Auf der Straße unten fuhren Autos mit heulenden Signalhörnern und Blaulicht vorbei. Ich spannte ein Papier ein, ich wollte eine Geschichte schreiben, in der Glück und Sonne vorkamen und Gestorbene wieder lebten, etwas von früher, wie das Laub roch, wie die Anemonen aus den Moosen wuchsen, wie meine Mutter, die lange fort gewesen war, plötzlich im Hausflur stand, ein Axthieb aus dem Himmel. Ich horchte den leiser werdenden Signalhörnern nach und schrieb »Arschlöcher, alles Arschlöcher« und riß schnell das Papier aus der Maschine und zerknüllte es und warf es unter den Tisch.
Dann schaute ich auf die weiß gekalkte Zimmerwand. Der Decke entlang war mit einer Schablone ein blaßblaues Rautenmuster gemalt. In einer Ecke stand mein Koffer, und darauf lag ein Mantel mit rosa Knöpfen. Darüber hing ein Bild, auf dem ein Mann und eine Frau mit Gesichtern wie vor vierzig Jahren innig ein kleines Kind anschauten. Ich stand auf, steckte das Foto der Frau in den Rahmen des Bilds und versuchte dann, einen Satz zu Ende zu schreiben, bevor ich einen neuen Blick auf das Foto warf. Wieso, dachte ich, kann ich nicht wie jedermann an einfache, ruhige Dinge denken, an Kornfelder, an Blumen? »Wieso schaue ich ständig dieser Frau auf dem Foto in die Augen?« schrieb ich und riß das Papier aus der Maschine. »Diese Frau«, schrieb ich auf ein neues Papier, »ist einfach in einen Zug gestiegen, in einem weißen Kleid, hat einmal durch das spiegelnde Fenster gewinkt, dann hat sie die Abteiltür zugezogen. Ich bin in die Bahnhofsgaststätte gegangen und habe ein Bier getrunken. Mit blinden Augen las ich die Zeitung. Überall erschossen sich Menschen. Die Frau fuhr in den Norden. Sie wollte in der Mitternachtssonne leben, im Mitternachtsschatten.« Gott, dachte ich, ich werde aufbrechen müssen in dieses eiskalte Lappland, ihrer Tränen wegen, obwohl ich Rentiere nicht mag und Mücken hasse.
Was nützte es mir zu denken, daß alle Frauen falsch wie Schlangen seien? Sie waren nicht falsch wie Schlangen. Sie waren richtig wie Frauen, und ich war hilflos wie eine Maus. Jene Frau hatte einmal zu mir gesagt, daß ich zuviel spräche. Sie hatte recht. Sie allerdings hatte, wenn sie in Form war, auch viel gesprochen. Es hatte mich nicht gestört. Sie hatte dann auf der Vorderkante des Stuhls gesessen – es machte mich schon wahnsinnig, daran zu denken, wie sie auf der Vorderkante des Stuhls saß –, war darauf hin und her gerutscht, hatte mit der rechten Hand Spaghettis auf ihre Gabel gedreht, mit der Linken nach ihrem Weinglas gelangt, und dazu hatte sie gesprochen. Sie sagte, sie glaube, sie sei zu baufällig konstruiert für dieses Leben. Was mochte sie den Lappen erzählen? Wahrscheinlich ging sie schweigend dem Ufer von einem dieser tausend Seen entlang. Sie starrte über das Wasser, in dem Baumstämme trieben, auf denen Flößer standen mit gespreizten Beinen. Sie schaute sie an. Sie hatten gegerbte Gesichter und Hände, die doppelt so groß wie ihre waren. Dann ging sie weiter, durch Heidekraut. In einer Bucht, als eine fahle Sonne durch die Wolken brach, zog sie ihren Pullover aus. Sie wollte baden, allein, aber dann ließ sie es sein, weil Millionen Mücken sie heimtrieben.
Ich hob den Kopf und sah, durch die Gitterstäbe des Fensters, einen Zug Störche. Sie schlugen mit ihren Flügeln. Ich wäre gern mit ihnen geflogen. Überm Meer hätten wir unter uns Schiffe mit weißen Sogwellen gesehen. Angesichts der herrlichen Stadt Tanger hätte jeder von uns Störchen einen Seufzer der Erleichterung ausgestoßen. Rings um ein abendliches Minarett hätten wir uns ausgeruht. Der Muezzin hätte seinen Ramadan verkündigt, stundenlang. Wie hatte ich die Nase voll von meiner Stadt, dem Land, den Zeitungen, dem Fernseher.
Die Sonne stand jetzt höher über den Stoppelfeldern. Die heulenden Signalhörner kamen wieder näher. Ein Westwind wehte über den See, eine Luft, die nach Fischen roch wie in Tintagel, wo ich einmal mit jener Frau gewesen war. Winde hatten uns umheult. Wir hatten uns mit Möwen fotografiert, Nachtigallen, die uns auf den Schultern saßen. Die Frau hatte ihren Mantel getragen und einen blauen Regenhut, der ihr ins Gesicht gerutscht war. Ich seufzte. Über der Gartenmauer sah ich das sich drehende Blaulicht eines Polizeifahrzeugs. Polizisten stiegen aus und schoben Haltebarrieren auf die Straße. Ich las das bisher Geschriebene, warf es unter den Tisch und sah auf das Foto. Die Frau darauf stand vor einer Steinmauer, in einem Kleid aus Flicken und Bändern. Sie sah aus wie bei einem geheimen Gedanken überrascht, wie eine Erscheinung. Ihre Augen saugten mich in einem jähen Wirbel in eine andere Zeit hinein. Ich dachte, jetzt zerspringen die Gefäße in mir, die das Leben zusammenhalten. Schnell schrieb ich auf ein neues Blatt: »Ein Essay. Es ist eine größere Strapaze, in seinem Zimmer zu bleiben, als Afrika zu erforschen.« Ich war ja schon auf dem Weg dahin gewesen, aber gleich im Reisebüro hatte mir ein Reiseleiter unter die Arme gegriffen. Ich wollte mich aber nicht mehr anfassen lassen. »In meinen Garten kommt nicht mehr jeder«, schrieb ich. »Nur, ich starre trotzdem auf die Scharniere des Tors und hoffe, daß sie sich öffnen werden, und wir stürzen uns in die Arme. Wir werden uns im Gras wälzen, wir werden stöhnen, wir werden auf Stühlen im Garten sitzen und an einem Glas nippen und darüber sprechen, gehört zu haben, daß unser Wohnland die Todesstrafe einzuführen gedenkt und daß die Buben von ihren Vätern zu Weihnachten wieder Wasserwerfer aus Plastik bekommen. Wir werden uns ansehen, bis unsere Blicke verschwimmen. Wir werden ernst sein.« Ich biß mir in die Unterlippe und riß das Blatt aus der Maschine.
In Tintagel hatte ich ihr erzählt, wie Isolde hemmungslos Tristan verfallen war, der sie mit einer Leidenschaft liebte, die ihn vergessen ließ, ob es Tag war oder Nacht, Winter oder Sommer. Sie liebten sich in Speichern und Kornfeldern, um Mitternacht und am Vormittag, lachend und weinend. Nie war es ihnen zu viel. Nie war es ihnen zu wenig.
Und dann? hatte sie gesagt. Das Meer donnerte gegen die Mauern der Ruinen. Der Sturm trieb uns Salzwasser ins Gesicht. Ich hielt ihre Hand, die naß war. Das weißt du doch, hatte ich geantwortet. Sie verglühten. Kein Mensch ist für die Temperaturen gebaut, die die Liebe erzeugt.
Ich dachte, nein, so geht das nicht, bald werde ich auf dem Kopf gehen statt auf den Füßen, ich werde ihr einen Brief schreiben: »Ich habe deinen Mantel noch, den mit den rosa Knöpfen. Es geht mir gut, und dir? Wo soll ich den Mantel hinschicken. Ich habe deine Adresse nicht.« Ich stand auf und nahm den Mantel, zog ihn an und ging im Zimmer auf und ab. Von der Straße her hörte ich laute Rufe. Autotüren schlugen zu, und Schüsse krachten. Ich blinzelte in die Sonne. Der Mantel war mir zu klein. Wenn ich die Schultern nach innen bewegte, krachten die Nähte. Ich holte aus meinem Koffer ein Buch mit den Briefen Eduard Mörikes, des Verfassers von Unser Fritz. Mörike zitterte immer am ganzen Leib, wenn er einen Brief bekam von seiner Braut oder seiner Mutter, genau gleich wie Adalbert Stifter, von dem ich aber keine Briefausgabe hatte. Ich blätterte in den Beschwörungen Mörikes und dachte, was für eine Zeit, wo man von Frankfurt nach Darmstadt einen Tag brauchte. Man brauchte mehrere Wochen bis ins Burgund. Nach Lappland ging niemand. Im Burgund sang man zu der Zeit Lieder in Tonarten mit sieben Kreuzen, die allen Schauer den Rücken hinabjagten. Man starb schnell. Man hing an einer Eiche oder hatte einen Pfahl im Bauch. Aber man schiß, wo man wollte. Ich zerknüllte meinen Brief und sagte: »Manchmal sprechen Menschen verschiedene Sprachen. Manchmal redeten wir stundenlang miteinander und verstanden jedes Wort. Manchmal standen wir in leeren Zimmern, und jedes Wort tat weh.« Ich spürte, wie mich mein Rücken schmerzte, »ich brauche eine Anstrengung, die mir das Blut in den Kopf treibt«, stand auf, zog den Mantel aus, zerknüllte ihn zu einem Klumpen und warf ihn gegen die Wand. Das Bild zerklirrte am Boden, und das Foto rutschte aus dem Rahmen. Ich gab dem Tisch einen Tritt. »Was ist denn los, verdammt?« brüllte ich. »Was ist los?« Lange stand ich dann unbeweglich mitten im Zimmer, mit Muskeln, die mich gleichzeitig nach links, rechts, oben und unten rissen. Dann legte ich den Mantel aufs Bett und las die Scherben zusammen. Ich rollte mich auf dem Bett zusammen und zog den Mantel über mich. »Ich stehe nie wieder auf«, stöhnte ich in mich hinein.
Mit geschlossenen Augen lag ich da und dachte daran, daß ich, als ich ein kleiner Bub gewesen war, mit meinem Vater meine Mutter besucht hatte, die in einem Krankenhaus war, einer Heilanstalt, die in sonnigen Kornfeldern am Ufer eines Sees stand. Mein Vater und ich fuhren lange mit einer Eisenbahn. Wir saßen am Fenster und sahen von hohen Brücken in blaue Wasser hinab. Mein Vater erzählte Geschichten, aber manchmal schauten wir beide schweigend auf Hügel und Felder. Im Krankenhaus standen wir in einem großen Garten. Von weither kam meine Mutter einen abfallenden Rasen herab, langsam wie eine Erscheinung, in einem weißen Kleid. Sie bewegte sich wie in einem Traum. Dann standen wir beieinander, und der Vater sagte, geht es dir besser, ja, das sieht man sofort, es geht dir besser. Ich rupfte an der Schürze der Mutter, die in die Ferne sah. Ich sagte etwas mit einer zu lauten Stimme. Dann sagte die Mutter, ich muß jetzt wieder gehen. Sie strich mir über den Kopf und ging davon. Sie drehte sich nicht um. Ich starrte ihr nach. Nachher brachte mich mein Vater zu einem Arzt, in einer Stadt, und ich mußte mit Spielsachen spielen, und der Arzt sah mir zu. Ich wußte, daß der Vater fort war für immer. Ich legte Bauklötze aufeinander. Dann kam mein Vater wieder, und wir gingen ein Eis essen. Wir saßen auf einer Terrasse und sahen in einen Fluß hinunter, und dann lächelte ich und legte eine Hand auf die Hand meines Vaters, bis auch der wieder lächelte.
Draußen donnerte es jetzt. Ich stand mit einem Ruck vom Bett auf. Über den Himmel zogen Wolken. Hinter dem See, in den schwarzen Bergen, blitzte es. Das Blaulicht des Polizeifahrzeugs warf einen Widerschein auf die Decke des Zimmers. Ich spannte ein neues Papier in die Maschine und schrieb: »Ein Drama. A: Ich kannte einmal eine Frau, die wegging auf eine Reise in den Norden, und ich wußte die ganze Zeit über nicht, wann sie zurückkommen wird. B: Und wann ist sie zurückgekommen? A: Nie. B: Oh. A: Eine Zeitlang traf ich sie oft, weißt du. Wir taten alles zusammen. Wir fuhren durch neblige Moore, in denen Schafe weideten, die farbig angemalt waren. B: Wieso das? A: Wegen den Schafdieben. B: Und dann? A: Was, und dann? B: Deine Freundin. A: Wir lagen nebeneinander wie fremde Steine. An einem Morgen nach einem Abend, an dem wir hektisch Grappa getrunken hatten, stand sie auf, ging ins Bad und duschte eine Stunde lang. Ich ging in ein Café und las Zeitung. Dann kam sie, mit ihrer Reisetasche in der Hand. Sie trug ein blaues Kleid mit rosa Bändern. Sie wohnt jetzt in Lappland. Sie ist glücklich. B: Hm. A: Sie setzte sich an meinen Tisch im Café, auf die Vorderkante des Stuhls, fluchtbereit. Ihre Lippen zitterten, während sie sprach, ruhig, mit ihrer tiefen Stimme. Sie rauchte eine Zigarette nach der anderen. Ich dachte, es ist das letzte Mal, daß wir zusammen sind. B: Aber du hast doch mich. A: Nur um das fertig zu machen, wir standen dann auf und gingen zum Bahnhof. Sie stieg in einen Zug und winkte durch das Fenster, als sie durch den Zugkorridor ging, aber ich sah sie kaum, weil das Glas spiegelte. Ich winkte. Sie ging in ein Abteil, schloß die Tür, und ich sah sie nicht mehr. Dann fuhr der Zug ab.«
Ich las das Geschriebene durch und zog es langsam aus der Maschine und legte es daneben. Sie ist jemand, dachte ich, der innen zittert. Sie hat eine Katze, die sie überströmend liebt und der sie das Futter hinzustellen vergißt. Sie wird von einem der Flößer ein Kind bekommen und es lieben und sterben, weil die Flößer zu wild für sie sind. Dann stand ich auf – draußen regnete es jetzt –, packte die Schreibmaschine in die Plastikhülle, nahm den Koffer, ging aus dem Zimmer und die Treppe hinunter in den Empfangsraum. Ich wartete, bis eine ältere Frau mit einem Haarknoten die Rechnung geschrieben hatte. Männer und Frauen saßen in Morgenmänteln oder Pyjamas um Tische herum und spielten Karten. Die Frau mit dem Haarknoten gab mir die Hand und sagte »Leben Sie wohl«, und ich zog den Mantel an und ging zur Tür hinaus, in einen rauschenden Regen, langsam und ohne besondere Bewegungen an dem Einsatzfahrzeug mit dem sich drehenden Blaulicht vorbei, vor dem Polizisten mit umgehängten Maschinenpistolen standen. Ich sah ihnen in die Augen. Ich ging die Straße hinunter bis zum Platz, wo die Autobushaltestelle war. Ich wartete. Der Regen stürzte aus dem Himmel. Nach einiger Zeit, ich war naß bis auf die Haut, nahm ich die Rechnung aus der Tasche und eine Feder und schrieb auf die Rückseite ein Gedicht, in dem Möwen und Nachtigallen vorkamen. Ich warf das Papier weg. Dann stand ich da und sah in die Scheinwerfer der vorbeifahrenden Autos. Der Bus kam, und ich stieg ein.
Hand und Fuß – ein Buch
Vorwort Die Freundschaft der Männer gehet für und für, und wessen Hand den ersten Stein auf sie werfet, dem wird sie abfaulen im Handumdrehn. So ist das, und weil das so ist, möchte ich dieses Buch, das von der Freundschaft zwischen meinem Freund Max und mir handelt, mit einer Geschichte beginnen, die ich aus erster Hand habe, einer wahren Geschichte.
Erstes Kapitel Früher waren Geschichten wahrer als das Leben, heute ist das Leben irrer als sie. Einmal, vor ein paar Jahren, war ich auf ein Schäferstündchen aus, nicht mit Max, sondern mit der Frau von Max, mit Eva, ich summte also in Evas Ohr, ich küsse Ihre Hand, Madame, aber als ich, mit gespitztem Mündchen, Evas Hand küssen wollte, schob Eva ihren Mund hin, ich meine, ihren Hund hin, und ich bekam einen Mund voll Hund, der ein Schäfer war.
Zweites Kapitel Wahrscheinlich war ein Schäfer, verliebt in einem lichten Hain sitzend, auch der Traum Adas, einer blutjungen Frau – sie war erschütternd in ihrer zärtlichen Lauterkeit –, die eines Nachts bemerkte, daß ich, den sie als ersten liebte und dem sie sich als erstem hinzugeben gewillt war, eine eiskalte Hand hatte. Mitleidig rubbelte sie mein graues Fleisch, bis es mir zu viel wurde und ich meine Zähne in ihren Hals schlug, ich handsgemeiner Mensch, ich meine, Unmensch.
Drittes Kapitel