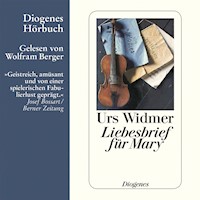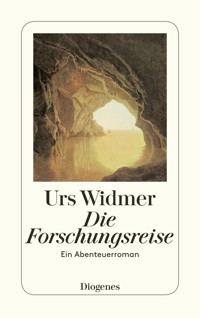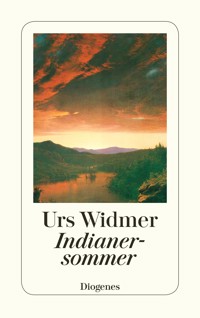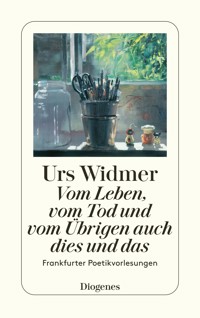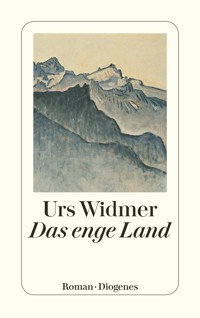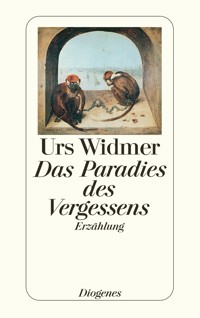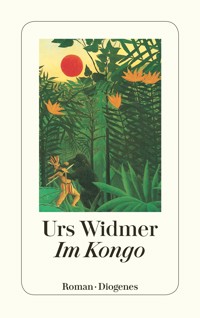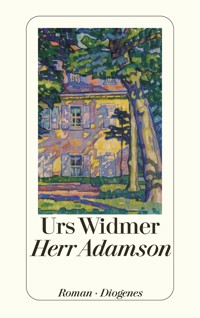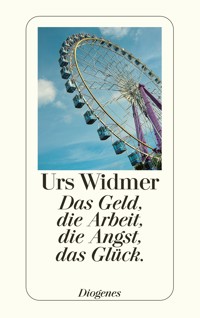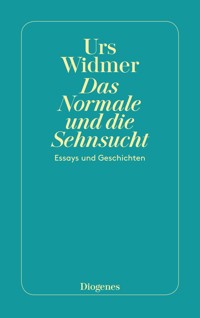
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Essays über ›Das Normale und die Sehnsucht‹, ›Über (triviale) Mythen‹, über Jules Verne und ›Die Wörter und die Pornographie‹ … Geschichten von ›Jim Strong in Arizona‹, von ›Tod und Sehnsucht‹, von ›Helden‹, vom ›letzten Ball des jungen Grafen‹ und vieles mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Urs Widmer
Das Normale und die Sehnsucht
Essays und Geschichten
Diogenes
»›Junger Mann, was tun Sie denn so den ganzen Tag‹, fragte der Baron …«
1
Das Normale und die Sehnsucht
Ist es eine Binsenwahrheit, zu sagen, daß das, was normal ist, eine Abmachung ist? Hilft es uns etwas, zu wissen, daß in andern Gesellschaften, zu andern Zeiten, das, was für uns unverrückbar aussieht, zu den undenkbaren Dingen gehört? In welchem Maß ist die Wirklichkeit das, was wir denken, es sei die Wirklichkeit? Wie reagieren wir darauf, daß wir, obwohl diese Wirklichkeit wie eine nasse Seife nicht recht zu fassen ist, mit der Notwendigkeit ausgerüstet sind, uns an das Geflecht der Spielregeln anzupassen, das wir bei unserm Erscheinen auf der Welt vorfinden? Ist unsre individuelle Entwicklung nur ein Anpassungsprozeß? Wie gern, wie ungern geben wir mehr und mehr die privaten Bedeutungen unserer Kinderwörter zugunsten des gemeinsamen Nenners auf, auf den sich die vielen vor uns schon geeinigt hatten? Ist die Sprache ein Anker, mit dem wir uns in der Außenwelt festhalten? Geben wir mit dem Annehmen von Sprache vor allem auch zu erkennen, daß wir bereit sind, die Realität und deren Spielregeln zu akzeptieren? Sind die elementarsten Gedanken, Sehnsüchte, Gefühle außerhalb der Sprache angesiedelt? Kollidieren die Sehnsüchte mit der Wirklichkeit?
Lernen wir nur widerwillig, daß der Lehrer, wenn er »öffnet die Bücher« sagt, damit ausdrücken will, daß wir die Bücher öffnen sollen? Kränkt es uns, daß wir uns auf Konzepte, die von den vielen andern und jedenfalls nicht von uns kommen, überhaupt einlassen müssen? Geben wir dem Druck von außen nach, weil wir gar keine andere Wahl haben, und verschließen wir uns dann schnell dem Gedanken, daß unsre Autonomie dadurch eine relative geworden ist? Hilft uns die Gesellschaft nur dann beim Überleben, wenn wir uns dafür in unsern Entschlüssen, Gedanken, Gefühlen von ihr beeinflussen lassen? Werden Ideologien als Betrachtungsmodelle einer gesellschaftlichen Wirklichkeit erkannt? Oder erheben sie in der Praxis bald einmal einen Ausschließlichkeitsanspruch? Wollen sie, daß wir sie für die ganze Wirklichkeit halten? Sollen wir, aus welchen Gründen auch immer, weiterhin im Zirkel unserer sieben Gedanken rotieren? Kann die Sprache unversehens zu einem Schutzgitter werden, an das sich die Beteiligten krallen? Bietet ein Sprachsystem, das sich vor die Wirklichkeit schiebt, Vorteile, die die Wirklichkeit nicht haben kann? Ist es, weil diese Sprache statisch, klar und überschaubar ist, während die Wirklichkeit dynamisch, fluktuierend und wenig faßbar bleibt? Soll diese Sprache nicht ein optimales Kommunikationsinstrument sein, sondern vor allem ein Schutz vor den diffusen Manifestationen der Außenwelt? Ist für den Ängstlichen die Ideologie eine Lebenshilfe, weil er sich so sicher in ihr fühlen kann? Kann das Kommunikationssystem zu einer Art Versicherung auf Gegenseitigkeit pervertiert werden, zu einer stillschweigenden Abmachung, daß alles so ist, wie man es sagt? Verursacht jemand, der etwas ›anderes‹ sagt (oder gar tut), deshalb heftige emotionale Reaktionen, weil er demonstriert, daß das ganze mühsam errichtete System der Ordnungen durchbrochen werden kann? Erinnert er daran, daß die Kommunikation zwischen den Menschen zusammenbrechen könnte? Ist das sogenannte Genie wirklich dem Wahnsinn nahe? Spielen sich die Vorstöße in irgendein Neuland (in der Wissenschaft, in der Kunst) in einem Grenzland zwischen dem Wahnsinn in uns und der bewußten, gesicherten Realität ab? Ist es ein Zufall, daß das Konzept der ›Kreativität‹ wie das des ›Genies‹ nicht viel mehr als ein Wort geblieben ist? Schützt das Konzept von den ›Kreativen‹ und ›Genialen‹ nicht vor allem vor der Bedrohung, die von denen auszugehen scheint, denen Veränderungen keine Angst machen? Sind Begriffe wie ›Kreativität‹, ›Genie‹, ›Kunst‹ als eine Abwehr derer entstanden, die Angst vor der Veränderung der Wirklichkeit haben? Unterscheidet sich der sogenannt ›Kreative‹ vom sogenannt ›Normalen‹ vor allem dadurch, daß er dessen Angst vor dem, was unvertraut ist, nicht hat? Ist das mit der bekannten Verwirrung vergleichbar, die man empfinden kann, wenn man vor einer bizarren Erscheinung steht, und mit der Erleichterung, wenn man dann hört, daß sie als Kunst anzusehen sei?
Könnte jeder kreativ arbeiten, der die Angst überwunden hat? Wären das dann Beutezüge irgendwo an der Grenze zwischen dem Sagbaren und dem Unsagbaren? Ist dann für die nächste Generation das, was eben noch ›wie Wahnsinn‹ war, ›normal‹? Oder ist der Begriff der Kreativität in der Praxis unserer Gesellschaft längst zum Gegenteil dessen, was er ursprünglich bedeutete, pervertiert? Meint er nun eine besonders entwickelte Begabung, die schon angelegten Trends zu verlängern? Ist er ein Euphemismus für besonders gute Anpassung an die Konzepte der Leistungsgesellschaft geworden? Wird heute kreativ geheißen, wer die Normen just nicht in Frage stellt, sondern innerhalb der Gesellschaftskonzepte die Maschinerie funktionstüchtig erhält, durch einen Handgriff hier, einen Tropfen öl da?
Spiegelt die Kunst dagegen vor allem die triste Tatsache, daß die menschliche Phantasie und die Wirklichkeit auseinanderklaffen? Entwickelt sie insgeheim die wahnsinnige Hoffnung, den Graben zwischen Wunsch und Realität zuzuschütten: sozusagen die Entfremdung abzuschaffen? Ist die Entfremdung das Thema der Kunst überhaupt, weil allein schon die Tatsache, daß die wie auch immer gearteten Sehnsüchte immer wieder aufgeschrieben werden statt gelebt, ein Hinweis auf den entfremdeten Zustand der Existenz aller ist? Möchte die Kunst, daß die Wirklichkeit sie einholt? Ist es ihr Ziel, sich selber abzuschaffen? Kann Kunst, weil die Realität stärker ist als die Sehnsüchte, nur sozusagen bewußt scheitern, mindestens so lange die Spielregeln unserer Gesellschaft dem die größten Erfolge zuerkennen, der, mit welchen Mitteln auch immer, am meisten Dollars, Mark und Franken in sein Sparschwein tut?
Wäre die Sehnsucht erfüllt, wenn das Bild der innern Wirklichkeit mit der äußern zur Deckung gebracht würde? Würden, täten, hätten und könnten wir dann endlich?
Es wäre warm, und da, wo das Grau in das Blau überginge, würden die schroffen Felsenschründe in den Himmel ragen. Ober den eisblauen Viertausendern stünde die klirrende Kälte. Was für eine Luft wehte! Welch ein Licht schiene! Die Bergvögel zögen ihre Kreise. Das Stoppelgras knirschte, während die letzten Kühe durch den Rauhreif stapften. Die Herbstzeitlosen wären vom Wind zerfetzt, das Alpenrosenkraut wäre brandrot, die Arven, die Föhren, die Tannen stünden. Welcher Wind wäre! Was für ein Frost herrschte! Über dem Bergbach läge die erste Eisschicht, die Bretterbrücke wäre eine plötzliche Lebensgefahr. Wie still es wäre! Die uralte Forelle, die unter dem Stein schwömme, dächte, ihr letzter Winter ist da. Die Schwalben hätten die jähe Ahnung, werden wir die ersten Opfer der kommenden Schneestürme sein? Der Saumweg käme aus dem tiefen Tal den kalten Berghang hoch, zur Kapelle, in deren Gitter die Aster steckte, durch den Wald mit den vermoosten Baumstrünken, durchs Tobel, über den Wasserfall, am Schlund vorbei, unterm Bergsturz durch, über die Schwebebrücke, die Felsleiter hinauf, den glitschigen Abgrund entlang, über die Gletscherzunge, durchs Geröll, die steile Hochalpenwiese hinauf. Da wären sie endlich! Sie kämen in ihrer Einerkolonne den Pfad vom Gletschersee herab. Wie kräftig pfiffen sie das Lied! Sie wären noch immer sechs, der mit der blauen Joppe, der Mürrische, der mit der vernarbten Nase, der Dicke, der mit den kräftigen Füßen, der ohne Bart. Wie sängen sie! Zwischen dem Dicken und dem mit den kräftigen Füßen wäre eine Art Lücke. Sie wären klein, sie hätten ihre Bärte, Kappen, Joppen und Schuhe. Wie sie aussähen! Sie würden die Pfade des Gebirges kennen, die da begännen, wo jeglicher menschliche Fuß zurückschaudert. Es gäbe keine Wegmarkierungen da oben. Die Kühe und Ziegen wären ihre Geheimnisse. Sie wüßten, wer das höchstgelegene Kornfeld hätte, in Wirklichkeit. Sie hätten die Hutten auf dem Rücken. Sie hüpften fast, ihre Bergbeine sprängen von Fels zu Fels. Sie hätten das Brennholz gesammelt. Summend kämen sie zum Haus. Wie es dastünde! Wie es aussähe! Es hätte kleine Fenster und kleine Türen, ein Steinplattendach, einen Balkon ohne Geländer, es wäre arvenbraun, schwarze Holzbalken ragten aus den Ecken. Es hätte einen Felskeller, in dem das Trockenfleisch und der Weißwein lagerten. Welch ein Blick über das Tal wäre! Tief unten wäre das Dorf mit den tanzenden Bauern.
Sie beträten das Haus durch die Holzküchentür. Sie stellten ihre Hutten ab, sie holten sich die Flaschen, sie gössen sich jeder ein Glas Rotwein ein. Wie gut er ihnen täte! Sie redeten. Der mit der blauen Joppe hätte eine dunkle Stimme, der Mürrische brummelte, der mit der vernarbten Nase hätte eine Stimme wie ein junges Mädchen, der Dicke lachte beim Reden, der mit den kräftigen Füßen redete durch die Nase. Der ohne Bart spräche leise.
Sie fachten ihr Holzfeuer an. Im kupfernen Kessel über dem Feuer hinge die Polenta. Es röche. Der Dicke wäre der Koch. Die Falter surrten um die Lampe. Sie säßen da und täten Karten spielen, sie lösten Kreuzworträtsel und Rebusse. Wie warm es wäre in der Küche! Wie der Wind draußen heulte! Sie dächten an die Urzeiten. Um ihre Bergschuhe wären Pfützen entstanden. Die Nebelbänke zögen tief unten vorbei. Die Krähen stürzten tot ins Tobel, die Eise bildeten sich, die Felsspalten bärsten, die Lawinen donnerten. Die Sonne näherte sich den Bergkämmen des Horizonts.
Der mit der blauen Joppe säße am Tisch am Fenster. Die Sonne schiene schräg auf sein Gesicht. Er hätte den Wurzelvermouth und die Knoblauchzehe vor sich. Sein Gesicht wäre rosa, sein Bart weiß. Sein Blick ginge aus dem Fenster, auf die Dohlen, auf die Föhren, auf die Schatten der Felsen. Was er dächte! Wie er träumte! Er dächte an den unbekannten siebenten. Wie sähe er aus! Welch glitzernde Hosen er hätte! Wie groß er wäre! Welche Wörter er sagte! Der mit der dunklen Stimme nähme einen Schluck und einen Biß. Bis hinab zu den Nebelbänken rührte sich nichts. Die Wolken ballten sich dichter. Ja, der siebente, dächte der mit der blauen Joppe, der stünde in seinem Großstadtzimmer, der hätte ein Hemd, eine Hose und Schuhe, in seinen Geschichten kämen D-Marks und Dollars vor. Aber in seinem Innern wüchse eine Ahnung, nämlich die, das Leben gehe an ihm vorbei, dächte der mit der dunklen Stimme. Er nähme einen Aperitifschluck. Er dächte, es wäre dem siebenten, ein unsichtbarer Riesenvogel flöge durchs Zimmer, der kalte Hauch streifte sein Gesicht. Mit heftigen Schritten stürzte er hinaus, er packte die Forscherschuhe und den Helm. Schon wäre er am Schiffssteg. Seufzend nähme der mit der blauen Joppe einen Schluck. Sein Blick ginge den Berg hinab. Hinten im Tal, wo die Staumauer wäre, bildeten sich die Regenwolken. Hier wäre noch die letzte Sonne. Der Mürrische und der mit der vernarbten Nase spielten ihre Schachpartie. Die Habichte flögen. Es wäre still. Auf dem Fensterbrett lägen die Versteinerungen und die Kristalle. Es wäre schon etwas, sich einmal einem dieser Vögel an die Beine zu hängen!
Der Wind rüttelte heftig an der Tür. Er heulte. In dem tiefen Tal läge die erste Dämmerung. Die Arven stünden schräg am Hang. Die Schatten der Wolken gingen über den Rübenacker. Der mit der dunklen Stimme nähme noch einen Schluck, diesmal einen heftigen. Welch ein Rumoren! Was für eine heiße Luft!
Da! riefe er plötzlich. Alle sechs wären sie auf die Holzterrasse gerannt und starrten nach unten. Wie sie sich über die Augen wischten! Was für offene Münder sie hätten! Sie könnten es nicht glauben. Nur mechanisch tränken sie ihre Schlucke und bissen sie in die knoblaucherne Zeh. Ihr Blick hinge an dem, was da käme. Wer mag denn das sein, sagten die sechs zueinander, während sie den schwarzen großen Punkt nicht aus den Augen ließen. Insgeheim dächten sie alle, daß da endlich der siebente käme.
Wie ihre Herzen klopften! Was für ein Zittern durch sie ginge!
Der siebente stiege. Seine Beine schmerzten. Er wäre über die entfernte Industrieebene gekommen, über den ersten Berg, über die Steppe, durch das Sandtal, über das Hitzeplateau, den Bergkamm entlang, über den zweiten Berg, an der Wasserstelle vorbei, über den Schilfweg, über den dritten Berg, durch den Hohlweg, über die Schlingpflanzenbrücke, über den vierten Berg, durch den staubenden Kalk, über die Weide, über den fünften Berg, in die Klus, die Eiswand hoch, den Holzwasserleitungen entlang, über den sechsten Berg, über den siebenten Berg, ins Tal hinab, über den Talboden am Dorf mit den Häusern auf den Steinplattenpilzen vorbei, den Saumweg am kalten Berghang hoch, zur Kapelle, durch den Wald mit den vermoosten Baumstrünken, durchs Tobel, über den Wasserfall, am Schlund vorbei, unterm Bergsturz durch, über die Schwebebrücke, die Felsleiter hinauf, den glitschigen Abgrund entlang, über die Gletscherzunge, durchs Geröll, die steile Hochalpenwiese hinauf. Er bliebe schnaufend stehen. Er nähme sich die Kappe vom Kopf und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er sähe durch den Augenschleier am Berghang hoch, die tiefe Sonne blendete ihn, er keuchte und stellte den Rucksack beim stehenden Ausruhen auf einen Felsblock. Wie dünn die Luft wäre! Welche Wolken sein Atem machte! Noch nie wäre er so hoch gekommen. Hier wüchse das kurze dürre Gras, hier sprössen aus den Schneeflecken die kleinen Blumen. Ein eisiger Wind käme von den Bergkämmen herab. Die sechs, die er jetzt hoch oben als kleine schwarze Punkte sähe, schwenkten das Leintuch zur Begrüßung. Er winkte mit der Kappe. Die Dämmerung wäre da. Er sähe das Haus über sich nur noch undeutlich im Abenddunst, aber er erkennte, daß die sechs in gewaltigen leichten Sätzen bergab gerannt kämen. Sie riefen Sätze, die er nicht verstünde. Er bliebe stehen. Da wären sie. Sie lachten alle. Ein Luftzug striche über sie hinweg. Er würfe das Marschgepäck hin und zeigte ihnen die Mitbringsel aus dem Unterland. Sie hätten so etwas noch nie gesehen. Sie gingen los. Ganz automatisch nähme er den Platz zwischen dem Dicken und dem mit den kräftigen Füßen in der Einerkolonne ein, ganz von selbst pfiffe er den Beginn des Lieds. Wie es in ihm rumorte! Wie es klänge, zusammen mit den sechs andern Stimmen! Sie gingen bergauf. Er sähe die Kühe. Er schritte ganz leicht, entgegen jeder Regel lachte und spräche er beim Hochstieg. Wieviel würde ihm einfallen! Er spräche vom Schwimmen, vom Bergsteigen, von den Wettrennen, den Zehenkämpfen, den Holzbetten, dem Eisenbahnfahren, dem Abseilen, den Höhlen etc. Es wäre jetzt dunkel. Was freute er sich auf das Festessen! Er sähe die Kappen vor sich als schwarze Schatten gegen den Sternenhimmel. Er hörte das Geräusch der Lederschuhe. Sie pfiffen nicht mehr, aber sie wären schnell. Er sähe das Licht des Hauses über sich. Dann wäre es verschwunden. Die Farben der Joppen der sechs wären nicht mehr zu erkennen, aber er könnte sie sich vorstellen. Was hätten sie sich zu erzählen! Er sähe die Schatten der Tannen. Sein Fuß stieße an die unsichtbaren Felsbrocken. Die andern machten kaum Geräusche. Sie schwiegen jetzt mit ihren merkwürdigen Stimmen. Auf der Bretterbrücke merkte er, daß unter ihm der Abgrund wäre, aber es ginge gut. Er hörte, daß der Dicke zu dem mit den kräftigen Füßen etwas sagte. Er keuchte, denn sie gingen schneller. Er hielte das Tempo. Wie gesund sie wären! Wie sie sich auskennten in ihren Alpen! Das Eis knirschte unter seinen Nagelschuhen. Er spürte beim Ausglitt die Fäuste des Dicken und dessen mit den kräftigen Füßen unter den Achseln. Die ersten Regentropfen fielen auf sein Gesicht. Er stimmte, für sich, das Lied wieder an. Er bliebe stehen, er keuchte, er blickte sich um. Welch ein Sturm! Welche Kälte! Eis bildete sich an seinen Augenlidern.
Er sähe nichts in der Dunkelheit. Sein Herz stockte. Er sähe ihre Kappen nicht mehr. Er riefe, seine Stimme hallte über die tiefen Täler dahin. Er wäre auf einem Gipfel, mit den Händen spürte er die Gipfelsteine. Er dächte, da seien sie doch eben noch gewesen. Er schriee. Er tappte hin und her. Er suchte nach dem Licht des Hauses, wo sie sein mußten. Es wäre finster. Er rennte bergab. Er fiele in Löcher und Moore, er bräche durch die Schneebrücke, er zerkratzte sich das Gesicht an den Tannenästen. Er schlüge sich das Knie auf beim Purzelbaum. Nicht einmal die Sterne wären zu sehen. Er setzte sich, im dichten Nebel, auf den Stein. Er dächte, im eisigen Regen sitzend, sicher hätten ihnen die Geschenke keine Freude gemacht. Es fiele der erste Hagel. Es wäre zu spät. Wie traurig er wäre! Wie ihm die Tränen in den Bart rönnen! Ach, wenn sie da wären und ihm den Bart kraulten! Die Hagelschläge auf den Kopf schmerzten. Seine Hände wären starr, in den Bergschuhen wäre das Wasser. Der Eisregen dränge durch den Regenschutz. Er zitterte. Es wäre eine Frage von Stunden. Er torkelte. Er stürzte die Schlünde hinab und bräche durchs Unterholz. Er schluchzte. Er wüßte nicht wie, aber er käme ins Tal hinab. Wie hart sie gewesen wären! Wie ihre Augen geglüht hätten!
Es wäre ein rechtes Wunder, daß er dieses Abenteuer überlebte. Niemand verstünde, wie er den Abstieg durch Sturm, Nacht und Nebel geschafft hätte, auch die grölenden Bauern nicht, die über seinen erschöpften Körper am Dorfeingang gestolpert wären. Schlotternd säße er in der Wirtschaft. Die Bauern gäben ihm Tee und Schnaps in den Mund. Es ginge ein bißchen besser. Diese Säue, riefe er. In den trockenen Socken des Wirts säße er am Fenster und sähe am Berghang hoch. Der Mond schiene. Auf den fernen Gipfeln läge ein blaues Licht. Die weintrinkenden Bauern tippten sich mit den Zeigefingern an die Stirn, während sie zuhörten. Da oben, sagten sie, ist das Geröll und das Eis, in das seit Menschengedenken keine Seele den Fuß hineinsetzt. Er hätte einen roten Kopf, vom Schnaps und vom Hochsehen. Ganz hoch oben, im Mondlicht, wäre etwas, was der Rauch von ihrem Haus sein könnte. Er drehte sich um und redete mit seinen Freunden. Sie hätten Stimmen mit rollenden Rs. Er nähme den Wickenstrauß aus der Vase und böte ihn dem dasitzenden jungen Mädchen an, das ihn errötend annähme.
Über (triviale) Mythen
Triviale) Mythen sind vor allem dann wirksam, wenn wir sie als solche nicht erkennen. (Triviale) Mythen erkennen wollen bedeutet: wissen wollen, wie es wirklich ist. Ich sehe jetzt zum Fenster hinaus und sehe, wie es wirklich ist: da ist ein Baum, dort aber versperrt mir ein großes gelbes Haus die Sicht, und ich muß schnell um das Haus herumrennen, um zu sehen, wie es hinter dem Haus wirklich ist. Hinter dem Haus ist der Stadtpark, ich müßte durch den ganzen Park rennen, um zu erfahren, wie es hinter dem Park wirklich ist. Mir bleiben folglich, hauptsächlich, die (trivialen) Mythen. Meistens, vermute ich, erkenne ich sie nicht einmal, und ich staune über Leute, die (triviale) Mythen entlarven. Sie behaupten zu wissen, was ›in Wirklichkeit‹ hinter dem (trivialen) Mythos steckt. Unermüdlich scharren sie die (trivialen) Mythen von der Wirklichkeit weg und zeigen uns, wie unansehnlich die Wirklichkeit darunter ist. Aber gleich daneben ist diese Wirklichkeit von einem andern (trivialen) Mythos zugedeckt, und schnell machen sie sich auch da ans Freischaufeln. Und jetzt sind wir also, wie wir gleich bemerkt haben, in Chicago, und da kommt Al Capone, den wir gleich erkannt haben. Da kommt er mit seinem schwarzen Maschinenpistolenfutteral, seinem breitkrempigen Hut, seinem grellgelben Schlips, seiner dicken Havannazigarre und seinem grauen Fischgrätenanzug durch die Oak Lane. Die Kugeln pfeifen ihm um die Ohren, er schiebt seinen Hut an seinem Spazierstock um die Straßenecke, und schon hat er einen Schuß drin. Jetzt sitzt er in seiner Corso-Bar. Es ist Prohibition. Alle seine Kunden trinken seinen fünfzigprozentigen Schnaps aus seinen Kaffeetassen. Wenn sein Wirt sich unauffällig dreimal räuspert, bedeutet das, daß ein Polizist in seine Bar gekommen ist, den Al noch nicht geschmiert hat, und daß man nie weiß. Dann trinken alle Kunden den Brandy schnell aus und gießen richtigen Kaffee aus richtigen Kaffeekannen nach. Da steht Al jetzt hinter seinem riesengroßen marmorierten Schreibtisch an der Oak Lane in Chicagos bestem Geschäftsviertel, und ein heimlicher Besucher könnte jetzt seine Goldzähne böse aufflackern sehen. Niemand würde in ihm den berühmten Al Capone vermuten, wie er jetzt so dasteht mit seinen kleinen Füßen und seinen blaßblauen, kalten, scheinbar träumenden Augen.
Unsere Köpfe sind voll mit Heldenbildern, Vorstellungen, Dingen, die ganz selbstverständlich so sind, wie sie sind, obwohl sie möglicherweise ganz anders sind, mit Personen, Gegenständen und Ereignissen, die nicht nur sind, sondern für uns auch etwas bedeuten. Al Capone, der manchmal in meinem Kopf ist, ist nicht Al Capone selbst. Denn wer Al Capone gekannt hat, weiß genau, daß Al Capone nach Achselschweiß roch. Jetzt, als (trivialer) Mythos in meinem Kopf, riecht er nicht mehr, dafür hat er eine Bedeutung.