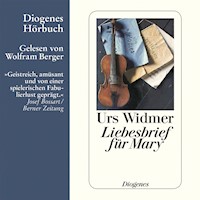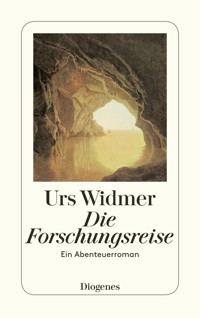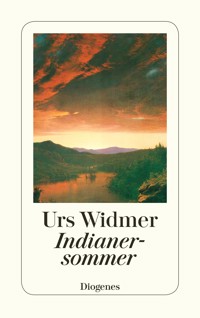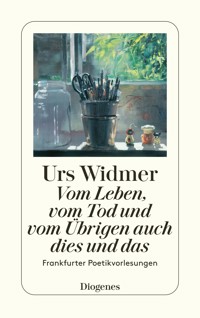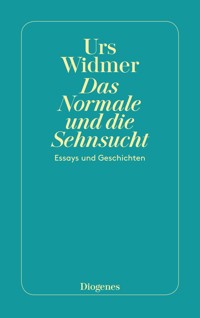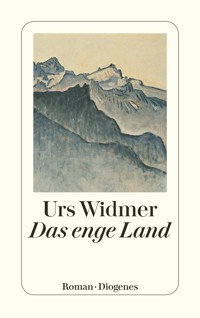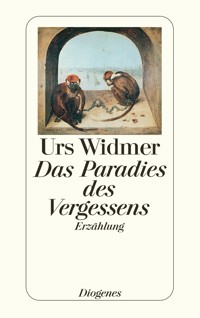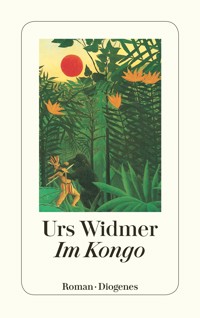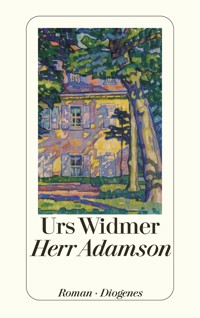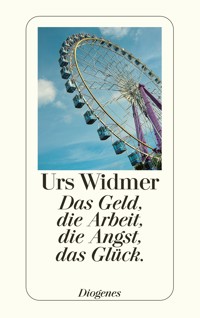7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie liest man als Autor andere Autoren? Urs Widmers Buch ist ein Erfahrungsbericht, in dem er sich als Schriftsteller in der heutigen Zeit definiert. Urs Widmer erzählt in bildreicher Sprache von Schriftstellern als Erinnerungselefanten, von ihrer Kassandra-Rolle, vom Schreiben als Widerstand gegen Unglück und Tod, dem Einfluß der eigenen Biographie, vom Jammer mit den Frauen und von befreiendem Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Urs Widmer
Die sechste Puppe im Bauch der fünften Puppe im Bauch der vierten
und andere Überlegungen zur Literatur
Grazer Poetikvorlesungen
Diogenes
1
Das erste Mal kam ich im Winter 1968 nach Graz. Ich war stunden-, um nicht zu sagen tagelang mit einem Zug gefahren, der an jedem Hühnerstall hielt und voller Menschen aus vergangenen Jahrhunderten war, alten Männern mit Felleisen und Frauen mit Eierkörben. Tiere überall. Natürlich hatte der Zug eine gehörige Verspätung, wie das alle Züge im Spätmittelalter hatten, und also tigerte Fredi Kolleritsch in endgültiger Panik am Bahnsteig hin und her, denn ich sollte um acht Uhr im Forum Stadtpark aus meinen Werken vorlesen. Es war die zweite Lesung meines Lebens, und mein Gesamtwerk war eine Broschüre mit dem Titel Alois. Wir schafften es rechtzeitig, ich las, und als ich zu der Stelle kam, wo Frau Knuchelbacher ihre Tochter Miriam fragt, Was tut ihr denn da?, und Miriam antwortet, Wir vögeln, Mami, da traute ich mich nicht und verschluckte Miriams unschuldige Antwort, und nachher machte mir Wolfi Bauer die heftigsten Vorwürfe und sagte, er sei überhaupt nur dieser Stelle wegen gekommen. Als wir vor das Forum traten, hatte es geschneit, und alles – Park, Bäume, die Stadt – lag in einem dicken Weiß. Alles still. Ich wurde von einer Frau im Auto mitgenommen, die so fuhr, als sei sie das unerreicht gebliebene Vorbild Niki Laudas, sich nicht um die neue Straßenglätte kümmerte, Dreher um 360 Grad kommentarlos hinnahm und verkehrt herumdurch Einbahnstraßen fuhr. Tatsächlich stießen wir in einer engen Gasse auf ein Polizeiauto und standen Scheinwerfer an Scheinwerfer, und die Frau überzeugte die Polizisten in kürzester Zeit, daß bei diesem Schnee etc., und die Polizisten wünschten ihr und sogar mir noch einen schönen Abend. Eine Zauberstadt. Später saßen wir in tiefen Gewölben und tranken viel Wein, und noch später, als ich aufbrechen wollte und in der Küche meine Reisetasche suchte, kriegte ich von der Wirtin eine Ohrfeige. Spätestens dann dachte ich, hier bin ich daheim.
Als ich nun, zweiundzwanzig Jahre später, in Graz ankam, war Graz eine Stadt dieses Jahrhunderts geworden, ich hatte mit der AUA eineinhalb Stunden gebraucht, um hinzukommen, und am Flughafen standen, gar nicht nervös, Gerhard Melzer und Kurt Bartsch, die Initiatoren des Lehrstuhls für Poetik an der Universität Graz. Wieder Schnee, aber kein verzauberter, so einer wie bei uns halt. Immerhin erkannte ich, aus dem Auto in den Nebel lugend, die Stadt recht bald wieder. Wir landeten auch tatsächlich wieder in einem Gewölbe, einer andern Höhle, und bald stellte sich jene Herzlichkeit ein, die ich an andern Orten nicht so leicht finde.
Klaus Hoffer war nun auch da, der Schöpfer des Bieresch-Mythos, er hatte mich eingeladen, bei ihm zu wohnen, und ich hatte natürlich begeistert zugesagt und die obenhin geflüsterte Bemerkung überhört, er habe jetzt übrigens einen Hund. Er hatte einen Hund, einen jungen Hund namens Hraban, bizarrerweise nach dem edlen Hrabanus Maurus getauft, obwohl er weder maurisch ist noch irgend etwas – im Gegensatz zum verehrungswürdigen Bischofvon Mainz – für die Verbreitung der Bildung auf deutschem Boden getan hat. Ganz im Gegenteil. Früher unterhielten Klaus und ich uns stundenlang über Bücher. Diesmal sprachen wir eigentlich nur von Hunden bzw. von einem Hund, von diesem dummen kleinen Hundelein, das mir schon, wenn ich um sieben Uhr früh in meinem Nachthemdchen aufs Klo tappte, unter die Röcke schnüffelte und mir, begeistert leckend, ins Gesicht sprang.
Aber ich war ja gekommen, eine Vorlesung zu halten, und das tat ich dann auch. Sechs Doppelstunden! Mehr als eine Stunde am Stück zu theoretisieren, das schien mir unmöglich und auch meinen Zuhörern unzumutbar. Also entschloß ich mich, in der ersten Stunde jeweils über Literatur zu sprechen – meine und die anderer –, in der zweiten jedoch mich in den Erzähler jener Geschichten zurückzuverwandeln, derentwegen ich eingeladen worden war, und erfüllte mir also einen alten Traum: einmal ein ganzes Buch vorzulesen, nicht immer nur, wie bei Lesungen unvermeidlich, zusammenhanglose Teile. Ich las also meine Erzählung Das Paradies des Vergessens vor, die ihrerseits eine in einer Geschichte versteckte Poetik ist, so daß sie zuweilen wie ein Echo des zuvor anders theoretisch Gesagten klang.
Ein großer Hörsaal, viele Leute, Neonlicht, keine Fenster. Eigentlich habe ich Schulen nie gemocht, und auch Universitäten nicht besonders. Aber spätestens als Gerhard Melzer seine Begrüßungsworte gesagt hatte, war alles Eis geschmolzen, und ich fühlte mich am richtigen Ort. Gerhard sagte nämlich:
Urs Widmer ist mir neuerdings zum Problem geworden. Seit Tagen beschäftigt mich die Frage: Wie mache ich’s nur, wie stelle ich ihn vor, ohne in den peinlichen Pleonasmus zu verfallen, mit einem Bekannten bekanntzumachen oder – noch schlimmer: diese Peinlichkeit als willkommene Ausrede zu benützen und Zuflucht zu suchen beim alten rhetorischen Trick, daß Widmer einer sei, den man ohnehin nicht vorstellen müsse. Zusätzliche Schweißperlen auf die Stirn trieb mir dann ein Satz in Widmers jüngstem Buch Das Paradies des Vergessens: »Germanisten sind Arschlöcher«, heißt es da kurz, klar und unmißverständlich. Tröstlich immerhin, daß der Satz aus dem Mund eines rücksichtslosen Verlegers kommt, der nicht unbedingt die Sympathie des Autors besitzt. Aber trotzdem: die narzißtische Kränkung sitzt, ein trüber Rest bleibt, und die toxischen Gifte, die von ihm ausstrahlen, nisten nachhaltig in meinem Gemüt. Was also tun, da sich bestimmte Rituale der Introduktion offenbar von selbst verbieten? Nichts da mit dem handverlesenen Lebenslauf, keine einschüchternde Verkündung der Preise, die unserem Autor zuteil wurden, und eine Auflistung der Publikationen hatte ich ohnehin nicht vor: man ist schließlich lernfähig, obwohl – wie das Beispiel zeigt – auch der Lernfähigste gegen Rückschläge und Niederschläge aus der Tiefe der Bücher nicht gefeit ist. Mach einfach was anderes, raunte es in mir, spring über deinen Schatten, und da das auch Widmers Figuren immer wieder tun, bevor sie zu den großen Horizonten ihrer Forschungs- und Abenteuerreisen aufbrechen, war die Richtung vorgezeichnet: kein Gerede über Widmer durfte es sein, sondern eine Geschichte in Widmers Manier. So vergraulst du den Autor nicht mit deinem Gequassel aus zweiter Hand, läßt aber trotzdem unaufdringlich einfließen, daß du sein Werk gelesen und verstanden hast. Gleichzeitig genügst du deiner Informationspflicht, erweist dich als höflicher Mensch und befriedigst obendrein deine Eitelkeit: wenn du dich nur gehörig anstrengst, sprach ich mir gut zu, dringst auch du endlich zum Kern der Sache vor, nach der sich dein germanistischer Diskurs seit Jahr und Tag vergeblich verzehrt. Die Geschichte, stellte ich mir vor, müßte von einer Sehnsucht handeln, die sich – wie meist bei Widmer – an der schlechten Wirklichkeit reibt. Selbstbezogen, wie ich bin, dachte ich zuerst an mich und daß ich ja eigentlich nur von meiner Sehnsucht nach einer Geschichte zu erzählen brauchte, einer wirklichen, unerhörten Geschichte ohne kleinmütige Skrupel und noch kleinmütigere Fußnoten, bis mir einfiel, daß Widmers hochmögende Reisende ihr Wunschziel selten erreichen, also auch meine Geschichte einer Geschichte konsequenterweise nie zustande kommen dürfte. Und wo bliebe im übrigen Widmer selbst? Der käme in so einer Geschichte gar nicht vor; dabei sollte er doch der einzige Gegenstand dieses Erzählversuchs, sozusagen dessen Herzstück sein. Angelangt an diesem toten Punkt, stieg ein beunruhigender Gedanke in mir auf: Wie, wenn es auf Widmer gar nicht ankäme? Wittgenstein hatte es vorausgedacht, und ich brauchte ihm nur hinterherzudenken: »Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems.« Mit einem Mal wurde mir klar, daß dieser hochkarätige Satz aus dem Tractatus auch Anleitungen zur Lösung meines eigenen kleinen, aber doch irgendwie lästigen Problems enthielt. Wie hatte ich Urs Widmer bedrängt, die Poetikvorlesung an der Universität Graz zu übernehmen! Die Vorstellung, seiner Kehle jenes unvergleichlich kernige, schwyzerdeutsche »Ja« zu entlocken, das in meinen Träumen und Tagträumen bereits zu einem kräftigen gregorianischen Choral angeschwollen war, hatte meine Anstrengungen beflügelt, und nun, da er leibhaftig kommen sollte: nichts als Verdruß! Wittgensteins Einsicht verstörte mich zunächst, aber mittlerweile ist Ruhe eingekehrt in mein Nervensystem, und ich stehe vor Ihnen abgeklärt, gefaßt, als einer, der aus seinen Verwirrungen geläutert hervorgegangen ist, so daß er jetzt auch den Mut aufbringt, Ihnen eine unangenehme Mitteilung zu machen: Urs Widmer hat seine Zusage zurückgezogen. Er ist nicht da, denke ich. Seltsam: Irgendwie bin ich erleichtert. Die Vorstellung, daß er vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr kommt, stimmt mich heiter. Ich warte gerne. Und wenn er dann immer noch vorgestellt werden muß, weiß ich bestimmt, wie’s geht.
Wir fielen uns coram publico in die Arme, Gerhard und ich, und also vorgestellt konnte ich meine erste Vorlesung getrost angehen.
Meine Damen und Herren, sagte ich, Sie kennen sie: diese russischen Puppen, mit denen schon der Zar spielte und dann Stalin und die heute noch der Exportschlager der UdSSR sind, made in Hongkong vielleicht, seitdem die Russen die freie Marktwirtschaft lernen, jene Babuschkas, außen dick und mächtig und nach innen immer kleiner, so daß im Bauch der sechsten Puppe, die im Bauch der fünften steckt etc., ein ganz kleines rätselhaftes Püppchen verborgen ist, jenes, das man, wie die Lösung aller Rätsel, beim Babuschkaöffnen als letztes entdeckt. So will ich meine Vorlesungen organisieren, die von der Poetik und also vom Schreiben handeln werden, von meinem Schreiben und vom Schreiben anderer. Sechs Vorlesungen wie sechs Babuschkas. Nur will ich umgekehrt vorgehen. Ich zeige Ihnen die kleinste Puppe zuerst. Ich spreche zuerst von mir, von meinen Rätseln, Rätseln im übrigen, von denen manche auch für immer ungelöst sind. Später wird mein Reden öffentlicher werden, allgemeiner, und wenn mein Plan aufgeht, werden wir in der letzten Stunde gemeinsam das Wort Ich vergessen haben.
Ja, mach nur einen Plan, singt Peachum in der Dreigroschenoper: Meine Vorlesung wird also gewiß auch eine Bestätigung der alten Erfahrung sein, daß Pläne nie aufgehen. Immerhin, die gute Absicht ist auch schon etwas. Der brave Christ kommt in den Himmel, nicht weil er nie gesündigt hat – ohne Schuld geht keiner durchs Leben –, sondern weil er es wenigstens versucht hat. Der Buddhist wird nicht mehr Wurm, sondern vielleicht, in der nächsten Reinkarnation, Igel oder Waschbär gar, wenn er sich wenigstens bemüht hat, ein geradliniges Leben zu führen.
Ein Schriftsteller an einer Universität – ganz widerspruchslos sollten Sie das nicht hinnehmen. Als sei das eine Selbstverständlichkeit. Denn die Literatur und die Germanistik sind nicht nur Freunde. Sie tun zwar oft so, sie sind es auch zuweilen, aber die Wahrheit ist dennoch, daß unser Verhältnis nicht immer ungetrübt ist. Es ist oft von Rivalität und Neid geprägt, von Idealisierung zuweilen auch. Dabei brauchen wir uns gegenseitig: die Germanisten die Schriftsteller, weil sie ohne deren Texte keine Literaturbetrachtung treiben könnten, und die Schriftsteller die Germanisten, weil diese den Rezeptionsraum erweitern, ihn heller und oft erst faßbar machen, und weil diese neue Erkenntnisdimension in die Literatur zurückfließt. Sonst allerdings haben Germanisten und Schriftsteller verschiedene Ziele. Germanisten lehren, sind Pädagogen, und wer lehrt, zielt auf Eindeutigkeit. Der Schriftsteller hingegen hat, wenn er schreibt, keinerlei pädagogisches Ziel, in der Regel jedenfalls nicht; und eindeutig will er schon gar nicht sein. Die Ambivalenz – daß jedem Weiß auch ein bißchen Schwarz beigemischt ist, und umgekehrt – ist geradezu sein Metier. Daraus entstand und entsteht manches Mißverständnis. Früher, lange Zeit, war der sanft schwelende Konflikt einigermaßen unbemerkt geblieben, denn die Germanisten wandelten gemessen und würdig in einem Abstand von fünfzig oder hundert Jahren hinter den Schriftstellern drein. Dachten über Klopstock nach, während Kafka schrieb. Aber irgendwann einmal legten sie, von den Dichtern unbemerkt, einen Zwischenspurt ein, und nun haben sie uns eingeholt und schauen uns schon während des Schreibens über die Schulter, und natürlich geht das nicht ohne Spannungen ab. So hat es auch mich an einen Ort verschlagen, an dessen Erwartungen ich mich erst gewöhnen muß. Eigentlich würde ich am liebsten absichtslos vor Ihnen monologisieren und zuweilen, hoffe ich, auch ein bißchen dialogisieren. Poetisch sprechen, sozusagen. Aber gleichzeitig ist mir klar, daß das nicht möglich ist und daß ich es auch gar nicht will. In meiner Prosa will ich weiß Gott nicht »lehren«, aber hier, in meiner Vorlesung, durchaus. Natürlich wird das auf meine Art geschehen, geschehen müssen. Hohe Begrifflichkeit ist nicht meine Sache, ist selten die Sache der Schriftsteller. Ihre Stärke ist die Metapher, der Reichtum des Bilds, das oft mehr enthält, als der Begriffes könnte; aber dessen Eindeutigkeit vermissen läßt. – Schriftsteller sind zudem nicht die, die besonders fraglos und sicher die Sprache beherrschen. Man könnte im Gegenteil sagen, daß oft die die Sprache zu ihrem Leben machen, die mit ihr die größte Mühe haben. Unsre Virtuosität ist oft besiegte Legasthenie.
Niemand geht freiwillig unter. Hölderlin wurde nicht freiwillig der arme Irre im Turm; Kleist sehnte sich sehr unfreiwillig so heftig nach dem Tod. Auch Goethes Leben und Werk – dabei war Goethe nun wirklich ein Liebling der Götter – sieht erst aus der Ferne wie ein Sieg aus. Es ist ein Sieg. Aber es ist ein Sieg, der zu Lebzeiten den Preis höchster Gefährdungen kostete. Als er den Werther schrieb, seinen einzigen Bestseller, überlegte er monatelang, wie er sich umbringen solle. Wie, nicht ob. Nur ob Strick oder Revolver. – Den Dichtern, jenen, die wir lieben, scheint die Lösung verwehrt zu sein, die viele andere wählen: sich blindlings denen anzuhängen, die den Sieg versprechen. Die stumpfsinnigsten Programme finden Anhänger, wenn sie nur versprechen, daß man zu den Siegern gehören wird, nicht zu den Opfern. Sogar die Demokratie funktioniert so (um es funktionieren zu nennen). Ununterbrochen stimmt die Mehrheit der Bevölkerung gegen die eigenen Interessen, weil eine fatale Identifikation mit den Mächtigen sie zwingt, deren Interessen zu verteidigen, als seien sie die eigenen. Es beruhigt, bei den Mächtigen zu sein. Wie vieles, was wir tun, dient ausschließlich der Beruhigung! Wir bringen Ordnung in das Chaos, und oft ist uns die Ordnung wichtiger als die Frage, ob die gefundene Ordnung etwas mit der Wirklichkeit zu tun habe. – Sie haben im letzten oder vorletzten Jahr einen renommierten Chaos-Forscher bei sich gehabt, meinen Kollegen Jürg Laederach, aus der gleichen ordentlichen Stadt wie ich stammend, und er schon hat Ihnen klar gemacht, daß Literatur nicht, nicht immer jedenfalls, auf Beruhigung aus ist. Sie ist genau deshalb selten populär, und sie ist für keinen immer auszuhalten. Wer, außer Jürg Laederach, hielte das Chaos immer aus?
»Warum schreiben Sie?« heißt jene so oft gestellte Frage, daß sie heute als eine dumme Frage gilt. Ich will mit ihr beginnen, denn sie ist natürlich keine dumme Frage. Sie ist eine kluge Frage, die einzig den Nachteil hat, daß sie schwer zu beantworten ist. Nur darum hat die Autorenlobby sie zu einem Tabu erklärt. Die Antwort kann nur ein Mosaik aus Antwortteilen sein, und wenn wir dann am Ende die Puzzlesteine zusammenfügen, werden wir immer noch keine ganze Antwort haben. Denn Kunst »geschieht«, und sie geschieht zu einem wichtigen Teil unbewußt. Man tut, und man weiß nicht genau, was man tut. Ja, zuweilen ist der Künstler gar der, der als letzter begreift, was er da eigentlich getan hat: wo doch alle denken, er müßte der erste sein. Aber ein ihm unbewußtes Etwas hat ihn gesteuert. Oft komme ich mir, ein leidlich rationaler Mensch eigentlich, der ganz selbständig Straßenbahn fahren und Steuererklärungen ausfüllen kann, wie ein Medium vor, das eine fremde Geschichte aufnotiert. – Ich sehe recht gut in mich hinein und ahne doch einen Kern, für den ich blind bin, und dieser Kern ist just mein Eigentliches. – Die durchaus unvertrauten Wörter rinnen durch einen hindurch. Man hat diesen geheimnisvollen Mitarbeiter früher einmal Inspiration genannt. Dann begannen die Geisteswissenschaften und die Dichter selber, mit den Naturwissenschaften, den sogenannt exakten, zu rivalisieren und wollten auch exakt werden. Die Schriftsteller nannten sich nicht mehr Dichter, und die Germanisten vergaßen, daß ihr Tun zur einen Hälfte Kunst ist – es erfordert das empathische Nachschöpfen des zu interpretierenden Textes – und zur andern Handwerk, wenn man etwa lernt, wie man bibliographiert oder wie man die alte Sütterlinschrift liest. Die Musen stahlen sich aus unseren Betten davon. Dabei gibt es sie, sie küssen immer noch, denn woher käme es sonst, daß man am einen Tag wie tot ist, während am nächsten die Zaubersätze nur so aus einem herauspurzeln? Die Musen wohnen bekanntlich auf dem Parnaß. Ich war einmal auf dem Parnaß, die Musen zu suchen, es war ein langer, steiniger Weg bergauf. Oben fand ich nur Skifahrer, die in einem sehr griechischen Stil einen schmalen Schneestreifen heruntertobten.
»Warum schreiben Sie?« Als ich noch nicht schrieb – ich war ein Spätzünder und brauchte für alles (Schreiben, Frauen, Leben) sehr lange –, als ich dafür um so mehr las, verspürte ich zuweilen, wenn ich las, eine Entrückung wie an einen andern Ort, in eine andere Zeit, ein Gefühl, das mir sagte, daß irgendwo tatsächlich etwas anderes existierte – sonst wäre das Buch, das ich las, nicht möglich geworden –, Glück vermutlich, und daß ich nicht dazu verurteilt sei, im ewigen Status quo eines relativen Unglücks zu verbleiben. Das konnten sehr verschiedene Bücher sein, gute natürlich allesamt, sonst hätten sie nicht diese Wirkung gehabt: aber keineswegs nur die aus dem Kanon der großen Werke. Henry Miller oder Stendhal oder Karl May oder Somerset Maugham oder Melville. Damals keimte in mir wohl die Hoffnung, einmal selber so etwas auslösen zu können. Bei anderen. Vielleicht war ich einmal eine Art Untoter – traute mich nicht, auf meine in Wahrheit wild in mir herumtobenden Gefühle zu hören – und versuchte, schreibend zu prüfen, ob ich überhaupt lebte. Ob ich etwas spürte, und was. Ich versuchte und versuche noch immer, Leben herzustellen in einer Welt, die mir vom Tod bedroht vorkam und vorkommt. Glück herzustellen, auch für mich. Heute noch erkenne ich die sehr guten Bücher daran, daß mich auf der Stelle jene Erregung packt. Zugegeben, es geschieht selten, aber es geschieht. Leben ist nicht jeden Tag, Liebe auch nicht, Glück schon gar nicht.
»Warum schreiben Sie?« Normalerweise rette ich mich mit Witzen. Sage zum Beispiel, daß ich gern ausschlafe, ja, daß ich überhaupt nur Schriftsteller geworden sei, um nie mehr um acht Uhr früh ein Büro betreten zu müssen. Wie jeder Witz enthält auch dieser mehr als ein Gran Wahrheit. Ich war in Büros, und ich litt in ihnen. Aber ich erinnere mich auch, um eine dennoch ernsthaftere Antwort zu versuchen, daß ich als Kind schon beschloß, ganz bewußt und mit jenem heiligen Ernst, zu dem nur Kinder fähig sind – Moral in ihrem état pur –, die Lebenslüge der Erwachsenen nicht mitzumachen, die um mich herum lebten. Die mir nahe waren. Jenes Als-ob-Leben, das die bürgerliche Welt besonders prägt. Als ob alles in Ordnung sei. Ich wollte die Belohnung für die aktuellen Mühen nicht ständig auf später aufschieben. Denn nie gab es ein Später, wie es geplant war. Immer war der Herzinfarkt schneller, oder die Geliebte, mit der man das aufgeschobene Glück teilen wollte, war längst ungeliebt bzw. mit einem andern über alle Berge.
Nun. Das Leben war dann das Leben, ist es, und ganz ohne Lüge und Schuld ging und geht es nicht ab. Auch das muß man lernen. Aber die Kunst ist ein Bereich, ein Simulationsraum, in dem man die Wahrhaftigkeit versuchen kann und muß, denn die Lüge in der Poesie ist tödlich. Die Wahrheit eines Textes ist nicht zu beweisen – sie hat nichts mit Faktenwahrheit zu tun; auf der Faktenebene wird in der Kunst geflunkert wie nirgendwo sonst –, sie ist nur an einem Gefühl der Evidenz ablesbar, das Schreiber und Leser gemeinsam spüren. Im übrigen wird die Kunst just von den Bürgern am heftigsten geliebt, weil auch der bürgerlichste Bürger ein nicht zu bändigendes Gefühl hat, »das Leben zu verpassen«, ein mulmiges Seelengrummeln, das er in der Regel erfolgreich besänftigt, indem er sich aufheulend ins nächste Geschäft stürzt, wieder das Leben verpassend, aber wenigstens nicht den Profit. Wenn er dann einen Künstler trifft, tritt er ihm wie seiner eigenen Janusköpfigkeit entgegen. Der Künstler ist sein Stellvertreter und tut, was er nicht tut. Die Kunst ist jener von der Macht ins Leben gerufene oder immerhin geduldete Simulationsraum, innerhalb dessen man ein »anderes« Leben wenigstens in der Simulation führen darf, nicht korrupt, nicht lügend, nicht mordend. Oder eben gerade mordend, just lügend, völlig korrupt: sich nicht – Simulation! – um die faktische Wirklichkeit kümmern müssend. Die Stellvertreterfunktion – daß jeder Mächtige uns die vermeintliche Reinheit delegiert hat – schützt uns, und wir werden, auch wenn wir uns aus bürgerlicher Sicht seltsam benehmen, nicht gleich auf der Stelle zum sozialen Tod verurteilt. Nur wie Rimbaud aufführen dürfen wir uns nicht, jenseits aller Tischsitten und Gesetze. Das dann doch nicht. Auf wirklichen Barrikaden stehen und auch das geheimste Einverständnis verweigern. Und so haben es die Rimbauds aller Zeiten schwer, niemand erkennt sie, auch wir potentiellen Kollegen erkennen sie oft nicht. Sie erschrecken auch uns. Sie tun ja nicht freiwillig, was sie tun. Niemand tut freiwillig, was er tut. Die Klügsten und die Glücklichsten unter uns können aus ihren Nöten Tugenden machen, und das nennen wir dann Begabung. Immer aber, so wie unsere Welt ist, bleibt Kunst im allgemeinen und die Literatur im besonderen auf die Welt der Macht bezogen und bewegt sich, ihr widersprechend und um sich schlagend, in ihrer Nähe. Wie hat sich die Literatur bemüht, das ganz andere zu tun: sie ist den-noch, in unserer bürgerlichen Gesellschaft, bürgerliche Literatur geblieben. Es scheint keinen begehbaren Ausweg zu geben.
Als ich ein Kind war, lernte ich einen Mann kennen, den ich hier Otto nennen will. Er ist längst tot. Dieser Otto war zusammen mit seinem Bruder der Erbe eines Betriebs, der, glaube ich, Badewannen herstellte. Irgendwas Sanitäres. Der Bruder zahlte Otto 1000 oder auch 3000 Franken im Monat – keine weltbewegende Summe, die Badewannen waren nicht sehr erfolgreich –, unter der Bedingung, daß er den Betrieb nie betrat. Das tat Otto dann auch nie, leidenschaftlich. Er ist der einzige Mensch bis heute geblieben, den ich kennengelernt habe, der nie – im Sinne von NIE – etwas tat, was dem Gelderwerb diente. Nicht, daß er nichts tat. Ständig erfand er irgendwas, Aschenbecher, die Danke sagten, wenn man die Asche hineintat, oder eine Garagentür, die sich automatisch öffnete, wenn er »Stormy weather« pfiff. Zuweilen saß er die halbe Nacht im Auto und versuchte, sich an die Melodie zu erinnern. Einmal, als ich ihn wieder einmal besuchte (er wohnte zu der Zeit an einem See), maß er mit mir zusammen die Breite dieses Sees aus, indem wir mit einem rachitischen Motorboot, das keinen Geschwindigkeitsmesser hatte, dessen Höchstgeschwindigkeit Otto jedoch selbstsicher mit 30km/h angab, quer über den See donnerten, und Otto drückte beim Start auf die Stoppuhr. Das tat er bei der Landung dann wieder. Logischerweise konnten wir so die Distanz genau ausrechnen. Allerdings konnten wir auf der anderen Seeseite, die von einer Mauer abgegrenzt war, nicht ungebremst landen, mit den vollen dreißig Stundenkilometern, und so nahm Otto vorher etwas Gas weg und glich das beim Drücken der Stoppuhr mit viel Gefühl wieder aus. So einer war Otto. Ich erzähle Ihnen diese Geschichte, weil Otto, in einem gewissen Sinn, eins meiner Vorbilder geblieben ist. Ich arbeite zwar für Geld – grad können Sie mir dabei zuschauen –, weil ich keinen Bruder in der Badewannenbranche habe. Versuche immer erneut, tolle Honorare herauszuschinden, und gebe mich dann mit dem zufrieden, was ich kriege. Aber Literatur hat immer auch etwas Nutzloses, etwas lebenslang Dilettantisches, etwas Spielerisches in all dem Ernst, etwas Kindliches und durchaus auch Kindisches. Sogar die Gesetze der Marktwirtschaft, dessen wichtigstes heißt, daß ihre Hunde stets den Letzten beißen, sind dem Entstehen von Dichtung gar nicht so ungünstig gesinnt. Denn mit Geld hat das Bücherschreiben herzlich wenig zu tun. Das fressen irgendwelche Hunde uns Letzten weg, bevor es zu uns kommt, und das ist, abgesehen davon, daß es sehr ärgerlich ist, wunderschön. Jahrelang dürfen wir an unserer Konfession sitzen, und nicht einmal