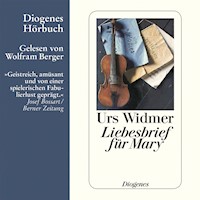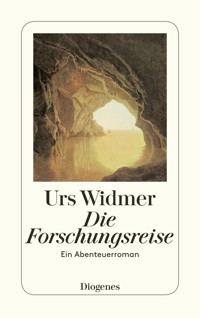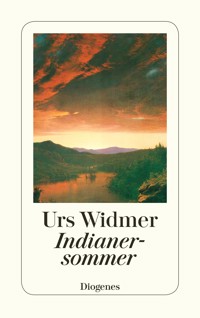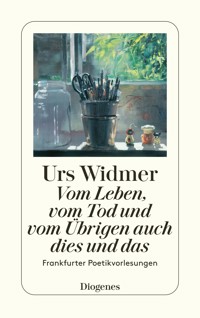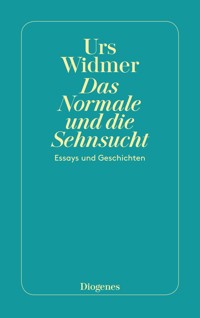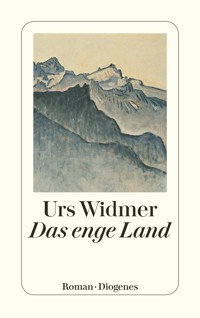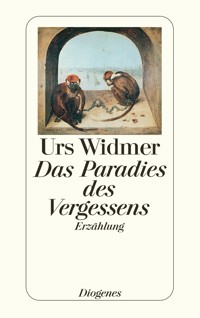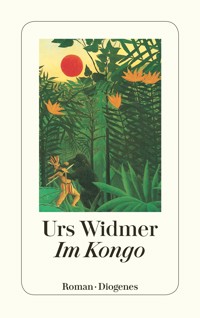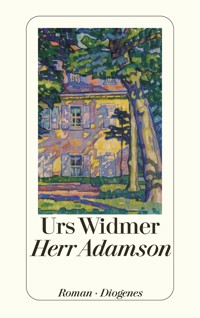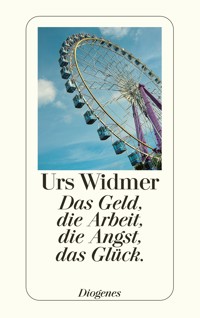6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elf wunderbare Geschichten, zwanzig sehr persönliche Berufsporträts, siebzehn besondere Charakteristiken von Dichtern und acht Dialoge auf Schwyzerdütsch, in Urs Widmers launig verspieltem, immer aber tiefsinnigem Ton.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Urs Widmer
Vom Fenstermeines Hauses aus
Prosa
Die Erstausgabe erschien
1977 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
René Magritte, ›La bonne aventure‹, 1939 (Ausschnitt)
Copyright © 2014, ProLitteris, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 20793 4 (3.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60577 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
1
Vom Fenster meines Hauses aus [9]
2
Gespräch mit meinem Kind über das Treiben der Nazis im Wald [49]
Die schreckliche Verwirrung des Giuseppe Verdi [69]
Der unbekannte Duft der fremden Frauen [87]
Die Bücher von früher oder Ein Beweis, daß der Schnupfen der Vater aller Dichtung ist, ein Essay [98]
Berufe!
Bundesligaspieler![108]
Bäcker![109]
Buchhändler![110]
Paukist![110]
Manager![111]
Hausfrau![112]
Polizist![113]
Bruder Pförtner![114]
Sachbearbeiterin![114]
Prostituierte![115]
Lokomotivführer![116]
Filmemacherin![117]
Skirennfahrer![118]
Arzt![119]
Verfassungsschützer![120]
Bundeskanzler![121]
Programmierer![122]
Uhrmacher![123]
Papst![124]
Senn![124]
[6] 3
Bildnisse von Dichtern
Wolfgang Bauer[129]
Barbara Frischmuth[130]
Gunter Falk[132]
H. C. Artmann[134]
Gert Jonke[135]
Ernst Jandl[137]
Michael Krüger[138]
Alfred Kolleritsch[139]
Klaus Hoffer[140]
Friederike Mayröcker[142]
Gerhard Rühm[143]
Oswald Wiener[146]
Wyni Sauter[148]
Päuli Zwigli[149]
Günter Brus[150]
Gerald Bisinger[152]
Gerhard Roth[152]
4
Erinnerung an Schneewittchen [159]
Rinaldo Rinaldini [175]
Ein ganzes Leben [183]
Ein Spaziergang [186]
Freitag der dreizehnte [194]
Das ist das Ende [199]
5
Schweizer Dialoge
Dialog über den 1.August
[9] Vom Fenster meines Hauses aus
I
Vom Fenster meines Hauses aus, an dem ich an einem Holztisch sitze, sehe ich, hinter Telefondrähten, die voller Schwalben mit zitternden Schwänzen sind, die Giebel der Dächer der Häuser von Sesenheim. Wenn ich einatme, pfeifen meine Lungen. Gewitterwolken stehen über der Rheinebene, und hinten bei Sesenheim, das heute Sessenheim heißt, grollt es. Ich weiß, dort, wo jetzt eine Erntemaschine durchs Getreide rast, dort standen Goethe und Friederike, die sich küßten, und es war der letzte Kuß im Leben Friederikes. Es donnerte über dem Schwarzwald. Als Friederike starb, etwa 20Kilometer südlich von Sesenheim, war das Elsaß immer noch ein stilles Land mit krähenden Hähnen, Störchen, Fachwerkhäusern, Blumen, aber Goethe war ein großes Tier geworden, mit dicken schweren Füßen, einem breiten Mund, fetten Händen und einer öligen Nase. Drei alte Freundinnen gingen hinter dem Sarg her. Sie weinten wasserlose [10] Tränen und warfen mit ihren dürren Händen Erdkrümel in das Grab. Sie hatten Friederike gemocht. Sie hatte nie von Goethe gesprochen. Dieser wandelte zu dieser Stunde durch einen französisch angelegten Park und sagte gerade zu seinem Eckermann: Begreif er, Eckermann, ein jeder hat einen schwarzen Abgrund in seinem Innern, auch ich. Zuweilen, wenn ich in den unendlichen Nachthimmel hinaufsehe, dröhnt in mir das wilde Pochen einer längst vergangenen Schuld, notier er sich das, Eckermann.
Ein Zahnarzt aus meiner Bekanntschaft zum Beispiel hat einen Teil der Leiche Napoleons im Keller, ein Bein, auf einer Apfelhurde. Er zerstößelt es in einem Mörser zu feinem Pulver und analysiert dieses und stellt fest, daß Napoleon eine Überdosis Arsen enthält. Ich, ich schrecke manchmal nachts hoch und denke, mein Bruder ist tot und liegt in meinem Keller. Aber ich habe gar keinen Bruder, oder ist gerade das der Beweis? Ich mache nie Licht im Keller, d.h. ich gehe nie in den Keller. Ich sitze an meinem breiten Holztisch am Fenster und sehe über die Rheinebene hinweg. Bauern und Bäuerinnen stehen in den Stoppelfeldern und sehen zum Himmel hinauf. Es donnert. Ich schlage auf die Tasten meiner Schreibmaschine, auch wenn ich nach Sesenheim hinüberschaue, ich schreibe blind. Ich [11] erinnere mich, daß Gottfried Keller eine lebenslange Angst hatte, lebendig begraben zu werden. Es ist entsetzlich, wenn man in eine helle klare Luft eingemauert ist wie in einen Glassarg.
Es ist sowieso bekannt, daß die Lebenswege aller Menschen von ihren Namen beeinflußt werden. Das ist die letzte magische Macht, die die entmachteten Zauberer noch ausüben. Aber die meisten Menschen machen schier übermenschliche Anstrengungen, ihrer Bestimmung zu entgehen. Herr Keller wurde, auch auf Kosten seines Glücks, Schriftsteller. Herr Bauer. Herr Falk. Herr Lenz. Herr Sommer. Herr Wiener. Herr Bayer. Herr Hesse. Herr Essig. Herr Kluge. Herr Kaiser. Herr Graf. Herr Bürger. Herr Mann. Herr Klopstock. Was soll die Auflehnung gegen unsre Namen? Wer einmal einer Susanne im Liebesrausch Irma ins Ohr geflüstert hat, weiß, wovon ich spreche.
Der erste Schriftsteller, den ich kennenlernte, war ein Kriegsblinder. Er hatte den Krieg nur gehört. Er hatte eine junge Frau, die jeden Tag ein neues Halskettchen für ihn anzog und seine Gedichte in einer zierlichen Schrift in einen Blindband eines Romans eines Freundes des Schriftstellers schrieb, der von den Leiden der Deutschen in Rußland handelte. Als ich zur Tür hereinkam, kam mir der Schriftsteller mit weit [12] ausgebreiteten Armen entgegengeeilt. Er schüttelte meine Hände und führte mich in sein Arbeitszimmer und öffnete, während er etwas über den neuen Roman seines Freunds sagte, nämlich, er habe ihn nicht gelesen, eine Rotweinflasche. Ich saß auf der Vorderkante eines Stuhls und sagte, ich auch nicht, und sah, er war taub, nicht blind. Eine Granate war im ersten Kriegsmonat vor seinen Ohren explodiert. Jetzt schrieb er seine Gedichte mit Filzstiften auf große Papierbögen, und abends las seine Frau sie ihm vor. Er hing an ihren Lippen. Er wußte genau, an welcher Stelle sie war. Wenn sie einmal einen Text sagte, der nicht von ihm war, verstand er nichts. Ratlos starrte er sie an und schüttelte den Kopf. Schließlich nahm sie ein Papier und einen Filzstift und schrieb etwas darauf und gab es ihm. Sie rannte zur Tür hinaus und schlug sie hinter sich zu. Der Dichter zuckte zusammen. Er las das Geschriebene. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er sah mich an. Langsam wurden seine Haare weiß, oder meine.
Eines Morgens, als ich aufwachte, waren meine Haare wirklich weiß. Ich hatte die Nacht mit einem stämmigen Dichter verbracht. Wir waren auf einer gemeinsamen Fahrt. Ich sah auf seine bebenden Nasenflügel. Ich hörte das Schnarchen, das ich schon die ganze Nacht gehört hatte. Ich bringe ihn um, dachte ich. Ich packte ihn an den [13] Beinen, den Dichter, und zerrte ihn durch lange Korridore. Sein Kopf schlug die Treppenstufen hinunter. Im Keller legte ich ihn auf eine Apfelhurde. Ich sah ihn genau an. Er sah widerwärtig aus, ganz anders als seine Gedichte. Er öffnete ein Auge. Ich rannte die Treppen hinauf, an verdutzten Stubenmädchen und Hotelburschen in grünen Schürzen vorbei, mit weißen Haaren. Das war in Kufstein, wo alle Bauern Zither spielten und jede Bäuerin vielfarbige Stickereien auf ihren großen milchweißen Brüsten hatte.
Gottfried Kellers Lieblingstiere waren Katzen. Er war es, der seinen Bruder umbrachte und in den Keller schleifte. Kein lebender Bruder ist in Gottfried Kellers Leben nachweisbar. Obwohl Gottfried Keller nicht an die Reinkarnation glaubte, ist es bei dieser so, daß, wenn man sich gut benommen hat, man im nächsten Leben ein hochentwickelter Säuger wird, war man ein Lump, ein Wurm. Im Alter wurde Gottfried Keller schlohweiß. Er saß jeden Abend in einem Weinkeller in Zürich und trank und brummte vor sich hin. Man verstand nie, was er sagte, aber man nahm an, daß es unflätige Bemerkungen über den Magistrat waren. Einmal träumte er, er sei über Nacht völlig schwarz geworden, ein Neger, oder, wie man heute sagt, ein Schwarzer. Gottfried Keller hatte in seiner Jugend Mühe mit [14] dem Atmen, dann nicht mehr, dann im Alter wieder.
Ich besitze ein Sechstel des Hauses, aus dem ich über die Rheinebene hinwegsehe, jetzt in eine schwarze Regenwand hinein. Die Erntemaschine ist weg, und die Bauern rennen über die Stoppelfelder. Die Bäuerinnen schlagen die Röcke über die Köpfe. Im Estrich unsres Hauses sind Hornissen, die bei Gewittern besonders nervös sind. Der Estrich gehört zu meinem Sechstel, in den untern Sechsteln, in denen gemütliche Lehnstühle und geheizte Öfen stehen, sind die andern fünf Inhaber meines Hauses, z.B. ein hagerer älterer Herr, der Versicherungsaquisitör ist. Sein Hobby ist das Beobachten von Hornissen. Stundenlang liegt er in dicke Tücher eingehüllt und mit einer Skifahrerbrille über den Augen in meinem Sechstel des Hauses. Einer der fünf andern Hausbesitzer ist ein Hund. Ihm gehört das schönste Zimmer. Der Keller gehört allen. Nie geht jemand hinunter, und wenn, etwa um Wein zu holen, mit geschlossenen Augen. Er riecht säuerlich. Immer wieder schauen wir, ob einer von uns fehlt oder ob in der Zeitung von einem vermißten Schriftsteller geschrieben wird.
Mich interessiert eher das, was ich nicht kann. Ich bewundere z.B. Revolutionäre, die fette gesunde stinkreiche zynische mörderische [15] Diktatoren erstechen. Wir, meine Frau und ich, haben statt dessen ein Pferd angeschafft, erstens, weil meine Frau glaubt, es könnte die Seele von Gottfried Kellers Bruder beherbergen, zweitens, weil der Verkäufer sagte, es frißt Hornissen. Es steht oben im Estrich. Als ich jetzt eben, auf Zehenspitzen, in den Estrich hinaufstieg, fand ich den Satz bestätigt, daß zwei Hornissen ein Roß töten. Von entsetzlichen Stichen übersät gelang es mir, das röchelnde Tier in den Keller zu schleifen. Wir sahen, wie es starb. Es krümmte sich vor Schmerz. Es schnaubte. Susanne, meine Frau, versuchte, die Seele von Gottfried Kellers Bruder beim Entweichen in einer Plastictüte aufzufangen, vergeblich. Wir ließen die Pferdeleiche auf der Apfelhurde liegen, auch, weil mein Herzschlag plötzlich aussetzte und Susanne wie ein Teufel mit eingeschalteten Scheinwerfern ins Spital rasen mußte, wo der Arzt mir Kalziumspritzen gab. Sie haben eine Konstitution wie ein Roß, sagte er, als ich aus meiner Bewußtlosigkeit aufwachte. Sie haben mindestens zehn Stiche und leben noch. Ich nickte. Susanne, zu der ich im Vergeß zuweilen Irma sage, nahm mich bei der Hand. Wir gingen in ein Café, in dem wir uns mit Cognacs vollpumpten, bis wir genügend Mut hatten, noch einen Weinkeller zu besuchen.
Dort sagte Susanne, ich sei blöd. Blöd, blöd, [16] blöd. Ich sagte: Das kann schon sein, daß ich blöd bin, aber ich glaube nicht an die Vererbung. Mein Vater war ganz anders blöd. Er stand um vier Uhr früh auf, setzte sich an seine Schreibmaschine an seinem Tisch in seinem Haus und schrieb wie rasend auf ihr herum bis um acht Uhr abends. Seine Werke sind verschollen, sie liegen in irgendeinem Keller. Dein Vater war nett, sagte Susanne, der war gar nicht so blöd wie du Blödian immer meinst. Wie dem auch sei, sagte ich, meine Mutter war so blöd: sie stand um sieben Uhr früh auf und putzte bis acht Uhr abends all das sauber, was wir schmutzig gemacht hatten. Ich, heute, schreibe kaum je, nie, so viel und so schnell wie heute. Sonst sitze ich eher am Fenster und schaue auf die Rheinebene und den fernen Schwarzwald, wenn ich nicht gerade in meinem Stadthaus in Frankfurt bin und telefoniere oder fernsehe. Manchmal brülle ich auf und schlage die Fäuste gegen die Zimmerwand. Jahrelang hatte ich eine Schreibmaschine, deren L abgebrochen war. Was ich noch sagen wollte, sagte ich zu Susanne, die inzwischen, wie ich, betrunken war, manchmal sucht mich mein Vater heim. Er kommt aus dem Keller. Plötzlich ist er da. Er trägt ein Manuskript unter dem Arm. Keinem von uns ist ganz klar, ist es eines von seinen oder von meinen. Mein Vater kann die Gesichter in [17] Sekundenschnelle von jung auf uralt wechseln. Ich bin zwar tot, sagt er dann, aber heute habe ich Ausgang. Dann gehen wir ins Kino, wie früher, wie früher sehen wir uns einen Schießfilm an mit unzähligen Leichen. Unser Lieblingsfilm war eine Geschichte, in der Peter Lorre zwei Leichen in einem Keller hatte und an ihnen herumoperierte, ich weiß nicht mehr was und warum. Ich rief nach dem Wirt und bestellte nochmals eine Flasche. Ich leckte meine Hornissenstiche. Susanne hatte glänzende Augen und schrie, der einzige wirkliche Mann für eine wirkliche Frau sei ihr Vater. Das kann sein, sagte ich, jedenfalls, nachher aßen mein Vater und ich ein Eis, und dann war sein Urlaub abgelaufen und er mußte zurück, in den Himmel oder in die Hölle, blöderweise habe ich vergessen, ihn zu fragen.
Ich wohne in einem Haus, über dem die Nato Formationsflüge übt. Es sind Kanadier, die die Elsässer vor den Russen beschützen. Sie rasen im Tiefflug über die Rheinebene. Ich fühle, wie ich langsam taub werde. Irgendwann einmal werde ich die Flugzeuge nur noch sehen. Ich könnte natürlich beim fernsten Düsengeräusch in den Keller rennen und den Angriff abwarten, aber erstens sind die Flugzeuge schneller als ich und zweitens will ich nicht in den Keller. Der Vorbesitzer des Hauses hat die Tragebalken des Hauses [18] vom Keller aus mit Baumstämmen abgestützt, denn schon zu seinen Zeiten war Krieg. Er sah aus dem Kellerfenster, wie deutsche Panzer über die Rheinebene gerollt kamen, und vorbei, und am nächsten Tag kamen amerikanische aus der andern Richtung, und vorbei. Der Vorbesitzer war schlohweiß geworden. Er hatte jahrelang im Keller gelebt. Nun grub er den alten Wein aus, und das Geld, und er rief und rief nach seiner Frau, und dann trank er alle Flaschen auf einen Ruck aus. Vollständig betrunken fanden ihn die Befreier, und als wir ihn, dreißig Jahre später, kennenlernten, war er immer noch betrunken, oder wieder. Er verkaufte uns das Haus, in dem er ein Leben verbracht hatte, mir einen Sechstel, Susanne einen Sechstel, dem Versicherungsaquisitör einen Sechstel, seinem Hund einen Sechstel, und zwei weiteren Personen, die ich noch nicht vorgestellt habe, die letzten zwei Sechstel. Diese zwei Personen sind ein Gelehrter und seine Frau. Der Gelehrte lehrt Steuerrecht an der Akademie für Management in Baden-Baden. Jeden Tag fährt er mit seiner Mobylette über die Grenze, aber abends wühlt er sich hinter komplizierte Partituren und erforscht das Leben tauber Komponisten. Er erzählte mir einmal, wie Beethoven mit einem starren Gesicht vor seinem Orchester stand und die neunte Sinfonie dirigierte. Als die [19] Musiker ihre Instrumente absetzten und die Sänger die Münder schlossen, hörte auch er mit dem Dirigieren auf. Er drehte sich um und nahm den tosenden Applaus entgegen, bis er sah, daß niemand mehr im Saal war. Seine Haushälterin führte ihn ins Künstlerzimmer und heim. Die Frau des Gelehrten hat zwei Kinder, die gut hören, und wir hören sie auch gut. Wenn sie und die Nato gleichzeitig angreifen, gehe sogar ich in den Keller. Ich setze mich auf die Romane meines Vaters, und die Füße stelle ich auf das tote Pferd. Susanne legt sich auf die Apfelhurde. Gemeinsam warten wir, bis das Gewitter vorüber ist. Dann steigen wir wieder an die Oberwelt. Im Salon steht der Steuerrechtler mit einer Partitur, er dirigiert still vor sich hin, mit einem Cognacglas in der Hand. Ich sehe, daß er seine Lippen bewegt. Was? sage ich. Diesmal konzentriere ich mich auf seine Mundbewegungen. Hast du dir die Haare färben lassen? sagen seine Lippen. Auch Irma sieht mich entsetzt an.
Ich schreibe dies am 22.Juli 1976, hauptsächlich weil mein Schwager auf Besuch ist. Er sitzt im Fauteuil und löst Kreuzworträtsel. Er weiß, daß man arbeitende Menschen nicht anspricht. Ich darf keine Sekunde aufhören zu schreiben, sonst fragt er mich nach einer Stadt ohne Autoverkehr mit sieben Buchstaben. Nur wenn er [20] einschläft, schaue ich zum Fenster hinaus auf die Schwalben, die auf den Telefondrähten sitzen und sich die weißen Federn unter den schwarzen Flügeln putzen. Sie haben zwei Nester an den Tragebalken des Kellers, seit dem Krieg. Immer lassen wir das Fenster offen. Später will ich meinen Schwager fragen, ob er sie sich ansehen will. Bei seinem letzten Besuch ruinierte ich meine Schreibmaschine, indem ich hunderte von Seiten mit großen und kleinen Ls füllte. Die Taste brach ab. Deshalb schreibe ich jetzt einen richtigen Text mit einem richtigen Sinn, damit die mittlere Buchstabendichte, auf die hin die Maschine konstruiert ist, richtig auftritt. Die Garantie für die Maschine ist längst abgelaufen, es ist die, auf der schon mein Vater geschrieben hat.
Mein Schwager ist aufgewacht. Er sitzt mit offenem Mund bolzgerade im Sessel, gerade jetzt, wo mir der Stoff ausgeht. Ich schreibe jetzt irrsinnig schnell. In meiner derzeitigen Form könnte ich Gabriele Wohmann zu einem Wettschreiben herausfordern. Allerdings kenne ich Gabriele Wohmanns derzeitige Form nicht. Sie ist viel trainierter als ich, sicher hat sie eingespielte Helfer, jemanden, der ihr Kaffee bringt, und Mechaniker, die eine Schreibmaschinenwalze in dreißig Sekunden auswechseln können, wenn sie einmal an die Boxen muß. Inzwischen sind alle [21]
[22] II
Vom Fenster meines andern Hauses aus, dem in Frankfurt, könnte ich das andere Haus Goethes, das am Großen Hirschgraben, sehen, wenn nicht so viele andere Häuser dazwischenstünden. Früher nannte man solche Häuser Wolkenkratzer. Irgendwie bin ich nie dazugekommen, Goethes ehemaligen Wohnsitz zu besuchen, obwohl man dort vergilbte Liebesbriefe von Friederike lesen kann und einen Tintenklecks bewundern, der davon herrührt, daß Goethe, als er den Faust schrieb, einer eintretenden Magd ein Tintenfaß entgegenschleuderte, weil er meinte, sie sei der Teufel. Ich bin bei jedem Versuch, sein Haus zu besuchen, abgelenkt worden. Ich fand mich dann im Kaufhof wieder, oder in der Deutschen Bank, oder bei Montanus. Ich blättere dort manchmal in der Deutschen Waffenzeitschrift oder im Playboy.
Vom Fenster meines Stadthauses aus, das gar nicht mein Haus ist, sondern einem Hersteller von Verpackungsmaterial gehört, der mit seinem PVC so viel Geld verdient, daß er mir eine völlig humane Miete abverlangt, vom Fenster meines Stadthauses aus sehe ich auf eine Straße mit Kopfsteinpflaster. Früher rumpelten Kutschen und Biertransporte darüber. Man sieht heute [23] noch die mit Teer verschmierten Geleise der Straßenbahnen, die von schweren Gäulen gezogen wurden. Heute gleiten, bei Regen, die Radfahrer auf ihnen aus. Um die Autos nicht allzu deutlich zu hören, spiele ich Platten mit Klaviersonaten von Beethoven. Wenn ich zuweilen in ein Konzert gehe, in den Musiksaal der Deutschen Bank zum Beispiel, lehne ich mich wie alle Konzertbesucher zurück: und genieße die Wucht der Tonsprache, aber irgendwie fehlen mir immer die begleitenden Bässe der Automotoren.
Gegenüber von meinem Haus steht eine Trinkhalle mit einer niederen Mauer, auf der fast immer Männer mit Bierflaschen sitzen und trinken und reden. Manchmal, ich schaue ja nicht ununterbrochen auf meine Kollegen, kracht es dann plötzlich, und einer der Männer hat in der Hitze seiner Argumentation seine Flasche auf den Boden gedonnert. Scherben und Bierlachen sind am Boden, und die Trinker, die dann laut reden, sind naßgespritzt. Der Trinkhallenpächter, ein Jugoslawe, kommt vor die Tür und sagt etwas Serbokroatisches oder Serbisches oder Kroatisches. Je nachdem wird die Stimmung sanfter oder aggressiver. Nachts verlagert sich die Auseinandersetzung in die Gastwirtschaft, die auch vom Trinkhallenpächter betrieben wird, der sie übernehmen konnte, weil vor zwei Jahren einer der [24] Serbokroaten oder Serben oder Kroaten sein Bier mit einem Revolver bestellte und der damalige Wirt dann genug davon hatte, mit einem Bein im Gefängnis und mit dem andern im Grab zu stehen. Er wußte, so nahe war er dem Grab noch nie gewesen. Sein Gast ist inzwischen aus dem Gefängnis heraus und sitzt wieder auf der Mauer vor der Trinkhalle. Nachts dann, wenn Susanne und ich schon schlafen, herrscht zuweilen ein plötzliches Gebrüll, dann stehen wir auf und gehen ans Fenster. Zuerst hören wir die serbokroatische Auseinandersetzung nur, oder die serbische, oder die kroatische, Glas splittert, Holz kracht, Schreie schreien, dann geht die Tür auf und, wie aus einem Dampfkessel, in dem ein Überdruck herrscht, zischen vier oder fünf Serbokroaten oder Serben oder Kroaten heraus, fassen auf dem Kopfsteinpflaster wieder Fuß und stürzen sich in das unsichtbare Getümmel zurück. Meistens ruft dann jemand, der nicht ich bin, die Polizei. Sie kommt, und dadurch wird das Ganze auch nicht besser. Ich glaube, die vom Haus gegenüber rufen an, da ist so eine Sauna für Manager, wo man einen Martini on the Rocks schlürfen kann, während einem eine Thailänderin zwischen den Beinen krault.
Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter, die eine Dame ist und mit Messerbänkchen auf dem [25] Tisch aufgewachsen, neben mir in der Gaststätte saß. Wir tranken einen Wein, Susanne war auch dabei, und dann begann plötzlich und unerwartet eine Schlägerei, viel früher als sonst, und schon flogen Stühle durchs Lokal, und die Männer hatten rote Gesichter. Meine Mutter saß strahlend an ihrem Tisch. Irgendwie hatte sie begriffen, daß sie unverletzbar war, und tatsächlich zischten alle Geschosse an ihr vorbei. Sie saß da wie in einem besonders guten Film. So etwas hatte sie schon lange nicht mehr erlebt, und ich auch nicht.
Vor einiger Zeit wurde ich auf der Straße, direkt vor meinem Haus, von einem Herrn, der einen Hund ausführte, mit einer Pistole bedroht, weil ich etwas über seinen Hund gesagt hatte. Der Herr war sehr betrunken, ich ein bißchen. Der Hund war ein Chow-Chow. Ich trug eine dunkelrote Indianerjacke, die ich heute nicht mehr trage. Damals war 1968. Der betrunkene Herr versprach mir den sofortigen Tod, und es war seltsam, das Klicken des Entsicherungshahns zu hören. Ich hatte das Geräusch vorher nur im Film gehört. Der betrunkene Herr, der, physiognomisch gesehen, etwas von einem Zuhälter an sich hatte, schlug mir im Rhythmus seiner schnellen Worte den Revolver um die Ohren. Ich hielt den Atem an und sprach beruhigend auf ihn ein. [26] Neben mir standen Susanne und der Versicherungsaquisitör. Susanne sagte nichts, d.h. ich hörte nicht, was sie sagte, und ich war froh, daß der Versicherungsaquisitör nicht seinen Stockdegen zog, denn er ist einer, der zu Husarenstücken neigt. Erst als ich oben in meiner Wohnung saß, versagten die Beine unter mir. Noch nie im Leben und bisher nie wieder habe ich einen Schnaps nötiger gebraucht. Das war übrigens nicht in dieser Wohnung hier, obwohl man von ihr aus das Haus Goethes auch nicht sah. Jenes Haus gehörte einem Herrn, der uns die Wohnung mit dem Argument kündigte, ich sei ein maoistischer Advokat und Susanne ein Flittchen. Dabei ist Susanne mit mir verheiratet, ich habe Germanistik studiert, und Mao ist tot.
Meine jetzige Wohnung zittert, wenn ein Omnibus vorbeifährt. Überhaupt hört man bei uns zu Hause viel mehr als man sieht. Oben hört man die Spanier, unten die Oma des Hausbesitzers, und man riecht die Küchen von beiden. Autos hört man überhaupt immer, die höre ich schon gar nicht mehr, auch wegen Beethoven. Susanne sagt zuweilen, wenn wir nicht einschlafen können, daß man sich an alles gewöhnt. Ich sage dann, daß man sich an Schwefel in der Luft, PVC im Essen und Arsen im Wasser nicht gewöhnt. Manchmal beneide ich Schriftsteller wie [27]