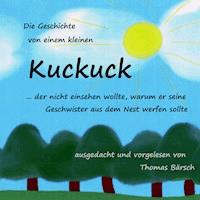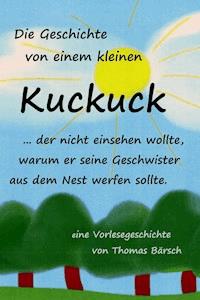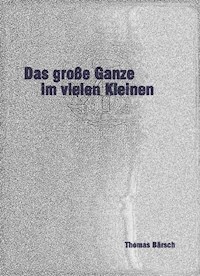
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Das große Ganze im vielen Kleinen" versammelt Geschichten aus Kindheit und Jugend in der DDR der 1970er und `80er Jahre. Die kurzen Erzählungen und Anekdoten beschreiben die Lebenswirklichkeit in all ihren Facetten: Rührend, skurril, hintergründig und oft sehr komisch, doch manchmal auch erschreckend. Denn immer wieder zeigt sich, wie die Diktatur in das Leben des Autors hineinregierte, auch damals schon, als Kind. Das Buch richtet sich an die, die mehr über die DDR wissen wollen als sie über die SED, Honecker, Stasi und Mauer in der Schule gelernt haben. Es richtet sich an Leserinnen und Leser die wissen wollen, wie es sich "anfühlte", in der DDR, in einer Diktatur aufzuwachsen. Im dritten Jahrzehnt der deutschen Einheit, in Zeiten politischer Umbrüche, richtet sich der Blick wieder stärker in den Osten des Landes. So leistet das Buch vielleicht auch einen kleinen Beitrag zur Debatte, wie das Leben in der DDR die Menschen formte und welche Prägungen sie mit in die deutsche Einheit brachten. Prägungen, die bis heute fortdauern. Es liefert unerwartete Einblicke in eine Erfahrungswelt, die nicht alle Deutschen teilen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das große Ganze
im vielen Kleinen
Thomas Bärsch
Das Buch
In der Geschichtensammlung blickt der Autor zurück auf seine Kindheit und Jugend in der DDR der 1970er und `80er Jahre. In kurzen Erzählungen und Anekdoten beschreibt er seine Lebenswirklichkeit in all ihren Facetten: Rührend, skurril, hintergründig und oft sehr komisch, doch manchmal auch erschreckend. Denn immer wieder zeigt sich, wie die Diktatur in sein Leben hineinregierte, auch damals schon, als Kind.
Im dritten Jahrzehnt der deutschen Einheit, in Zeiten politischer Umbrüche, richtet sich der Blick wieder stärker in den Osten des Landes. So leistet das Buch vielleicht auch einen kleinen Beitrag zur Debatte, wie das Leben in der DDR die Menschen formte und welche Prägungen sie mit in die deutsche Einheit brachten. Prägungen, die bis heute fortdauern. Es liefert unerwartete Einblicke in eine Erfahrungswelt, die nicht alle Deutschen teilen.
Impressum
Texte/Umschlag:Copyright by Thomas Bärsch
Verlag:Thomas Bärsch, privat
Alaunplatz 3b01099 Dresden, [email protected]
https://thomasbaersch.jimdo.com/
Vertrieb: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Warum
Tränen wegen Langeweile
Luft schnappen und Augen zu
Hirnhautentzündung
Fürfrienunsozialismuseidbereit
Brigaden und Grußformeln
Kang-Fi und die Hakenkreuze
Der Westen auf Taste 3
Republikflucht, die erste
Bananensternenhimmel
Freiheit für Luis Corvalan
Wofür kämpfte Emmi Meier?
Falsche Bomben
Bertha. Ärger. Richard. Schule
Opa in Russland. Mit Hitler
Ach was, das schöne Kinderferienlager!
Irgendwann wieder wie die Urmenschen
Polittheater und die großen Brüste von Frau T.
Kannste mal kurz halten? Der 1. Mai
Oma und Opa in der Sowjetunion. Mit mir.
Frau Tilly und was ich vom Westen wusste
Keiner wollte Timur sein
Colorado
BOB`s und BUB`s – und Helden und Schurken
Fußball
Mit Erich Haase in Buchenwald
Der Schwur
Siebte Klasse, oder so. Satz des Pythagoras.
Plaketten: Reich mit 15
Plaketten: Das rätselhafte „50/50“
Plaketten: Das Klackern der Schreibmaschine
Bertolt Brecht und Heiner Geißler
Exkurs: Kennste den?
Lilo Herrmann
Bewusstlos atmen
Tanzstunde
FDJ-Lager & blaue Pimmel
Kollektiverziehung mit Neptun
Wenn Sie dann 1989 studieren…
BAP
Abistoff: Alles eine Sache der Definition
BAP zum zweiten:
Tickets zum Paradies
George Orwell und der Hitler-Stalin-Pakt
Nachtschicht Brauerei
Sieben, Acht, Neun… Leipzig grüßt Halle!
Der 1.Mai: Die Züchter der Kaninchen
Scham. Und Rache für Assani
Lehm aus der Erde kratzen
Das Päckel Kaffee
541 Tage Eilenburg
Die andere Seite
Geschichten vom Aufstand
Wieder in Zivil: Ein Bier für ein paar Pfennige
Kati Witt und zwanziguhrfünfundvierzig
Studium: Plötzlich doch Offizier?
Man muss doch mal fragen dürfen
20 Seiten für einen Satz
Kaffee mit Folgen – was wollte Frau B.?
Republikflucht: Das Schweigen in Ost-Berlin
Die Scheiß-Banane
Warum
Ich bin im April 1967 in Leipzig geboren, nur 22 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs. Historisch ein Katzensprung, doch für mich: Unendlich weit weg. Diktatur, Hitler, Krieg: Geschichtsunterricht.
Meine Kinder kamen um 2010 herum auf die Welt. Ihre zeitliche Distanz zum Fall der Berliner Mauer ist teils noch größer als meine zu Hitler. Die DDR meiner Kindheit und Jugend wird für sie das sein, was für mich der Nationalsozialismus war: Geschichtsunterricht.
Sie werden die DDR „behandeln“, reduziert auf die Stasi, auf Erich Honecker, auf die Mauer und auf die „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“. Das alles wird ihnen im schlimmsten Fall noch von den letzten Vertretern genau der Lehrergeneration vermittelt, die damals mir gegenüber die Fahne des Sozialismus hochhielt.
Ich weiß erst heute, dass „Leben in der DDR“ weit mehr war, als sich durch Schlagworte beschreiben lässt. Erst in der Rückschau sehe ich, wie tief die dunklen Strukturen der Diktatur eingedrungen sind, selbst in unsere Familie und in meine kleine Kinderwelt, und wie sie mich prägten – ohne, dass ich das damals unmittelbar spürte. Und ich fürchte, genau das wird im Schulunterricht nicht vermittelt. Ich fürchte, die Lehrer belassen es beim Lehrplan. Bei Stasi, Mauer und SED. Weil sie hoffen, ihre Schüler mögen nicht fragen, wie sie eigentlich durchs Lehrerleben in der DDR gekommen sind.
Hier wurden Geschichten gesammelt. Für meine Kinder. Anekdoten, kleine Erzählungen, Erinnerungen. Nicht alle haben etwas mit „dem Staat“ zu tun. Trotzdem verbinde ich mit ihnen die Hoffnung, es möge sich ein Gefühl dafür entfalten, wie ihr Vater in der DDR aufwuchs. Wie es sich dort lebte, in einer Diktatur. Wie gruselig, wie armselig, wie gefährlich sie war. Welche informelle Macht ihr innewohnte. Dass die DDR eben mehr war als Mauer, Honecker und Stasi. Weil sie jeden einzelnen praktisch zur Mittäterschaft zwang. Auch mich, und ich war zum Mauerfall gerade mal zweiundzwanzig Jahre alt.
Vorgeschichte
1961, nur sechs Jahre vor meiner Geburt, hatte die DDR quer durch Berlin eine Mauer gezogen und die innerdeutsche Grenze mit einem sogenannten Todesstreifen gesichert. Sie teilte damit Deutschland endgültig in zwei Staaten, die sich feindlich gegenüberstanden. Die ganze Welt stand sich damals feindlich gegenüber. Aufgeteilt in zwei riesige Blöcke und Verteidigungsbündnisse, der NATO und dem Warschauer Pakt.
Es herrschte der „Kalte Krieg“, ein atomares Wettrüsten zwischen zwei Gesellschaftsordnungen. Und mittendrin das zerrissene Deutschland. Beide deutsche Staaten zementierten diesen Zustand Stück für Stück immer weiter.
Tränen wegen Langeweile
Ein paar Worte zum Kennenlernen. Es ist anfangs ein eher ziemlich trauriges Bild, das ich da von mir zeichnen muss. Ich war ein schlechter Esser und bin oft - gerne auch aus nichtigem Grund - einfach so in Tränen ausgebrochen. Einmal zum Beispiel am Mittagstisch, und das nur, weil ich nicht wusste, was ich nach dem Essen machen sollte. Ich scheute Schwimmbecken, weil dort Kinder mit Wasser spritzten, und im Kindergarten hatte ich Ostern Angst vor dem dunklen Gebüsch, in dem die Erzieherinnen die Körbchen versteckt hatten. Dazu kam, und auch das gehört zur Wahrheit, dass ich anfangs wohl auch nicht ganz so helle war und dafür auch Lehrgeld zahlte.
So bot mir einmal ein völlig fremder Junge in unserem Hof an, dass er mit meinem Bogen aufs Nachbargrundstück gehen, und von dort einen Pfeil über die Mauer herüberschießen würde. Ich weiß heute nicht mehr, wie lange ich erst auf den Pfeil und dann auf die Rückkehr des fremden Jungen gewartet hab, aber es kam mir lange vor.
Und auch, warum ich in den Ferien bei der Oma in Magdeburg auf dem Spielplatz den Kontakt zu einem mir vollkommen unbekannten Einheimischen suchte, ist mir bis heute nicht klar. „Hey, du! Herkomm!“, hatte er gerufen und dabei auf mich gezeigt. Ich wusste nicht, was er vorhatte, also ging ich hin. Wahrscheinlich war ich neugierig. Heute weiß ich, dass er mir einfach eine reinhauen wollte, und das hat er dann auch getan.
Kurz und gut. Klein, dünn, schwach, und manchmal wohl auch nicht ganz so fit im Kopf. Irgendwann im Vorschulalter reichte es meinem Vater, und ich musste zum Judo – aber dort sind wir noch nicht.
Luft schnappen und Augen zu
Es ist vielleicht meine erste Erinnerung. Sommer 1971. Wir stehen in der Kinderkrippe im Leipziger Osten und die Erzieherin meint, wir sollten mal frische Luft schnappen. Sie öffnet das Fenster, und wir Kinder stellen uns hin und schnappen übertrieben nach der Luft. Ansonsten kann ich nicht dienen mit einheitlichen Uniform-Kinderanzügen oder mit gemeinschaftlichem „Aufs-Klo-gehen“.
Der Kindergarten war unpolitisch, ich ging gerne hin. Ich wurde abgegeben, dann gab es was zu essen oder „Beschäftigung“, wofür die Erzieherinnen immer ein Schild an die Tür hängten. Nach dem Mittagessen räumten wir unsere Pritschen aus dem Schrank und legten uns hin, worauf die Erzieherin noch eine Weile durch die Reihen schritt und die Mittagsschlafstille dann und wann durch ein scharfes „Augen zu!“ unterbrach. Wann immer sie ein Kind entdeckte, das mit offenen Augen auf seiner Pritsche lag: „Augen zu!“ Es schoss richtig aus ihr heraus.
Das Quietschen der Schuhe auf dem Linoleum, und ab und zu ein „Augen zu!“… das war der Sound des Kindergartens. Irgendwann schliefen wir ein. So rauschten die Kindergartenjahre vorbei.
… was sonst noch geschah:
*1967
Im Jahr meiner Geburt verabschiedet Ost-Berlin ein Gesetz über die Staatsangehörigkeit zur DDR. Es soll die Souveränität der DDR zum Ausdruck bringen. Das Gesetz löst praktisch die gemeinsame deutsche Staatsbürgerschaft ab.
Die Bundesrepublik erklärt, dass sie zukünftig bei Sportveranstaltungen die Flagge der DDR dulden wird.
Der Staatssicherheitsdienst der DDR erarbeitet eine „Mobilmachungsdirektive“, nach der im Ernstfall innerhalb von vierundzwanzig Stunden Internierungslager für knapp 100.000 Menschen errichtet werden können.
1968
Die „Mark der deutschen Notenbank“ wird zur „Mark der DDR“.
Bei den olympischen Spielen in Mexiko starten erstmals zwei deutsche Mannschaften.
„Prager Frühling“ - Truppen des „Warschauer Pakts“ marschieren in der CSSR (heute Tschechien und Slowakei) ein und schlagen einen Volksaufstand nieder.
Breshnew-Doktrin: Der sowjetische Staatschef verkündet, dass die sozialistischen Staaten nur eingeschränkt souverän seien, und die Sowjetunion jederzeit eingreifen würde, wenn der Sozialismus bedroht sei.
1969
An der innerdeutschen Grenze beginnt der Bau von Wachtürmen aus Beton.
Kambodscha nimmt als erstes nichtsozialistisches Land Beziehungen zur DDR auf. Bonn (Hauptstadt der Bundesrepublik) friert die Beziehungen zu Kambodscha daraufhin vorerst ein.
Mit der Hallstein-Doktrin wertet die Bundesrepublik die Anerkennung der DDR auch weiterhin als „unfreundlichen Akt“. Andererseits akzeptiert sie, dass die DDR bei Sportveranstaltungen eine eigene Hymne spielt.
1970
Die DDR ersetzt das Gütesiegel „Made in Germany“ durch „Made in GDR“.
Die DDR hat inzwischen die innerdeutsche Grenze mit zwei Millionen Minen und 80.000 km Stacheldraht ausgestattet. Mit dieser Länge hätte man den Erdball zweimal umwickeln können.
1971
Erich Honecker löst Walter Ulbricht als Staatschef ab. Er wird bis kurz vor dem Mauerfall 1989 an der Spitze der DDR stehen.
Die DDR testet an der innerdeutschen Grenze Selbstschussanlagen.
Für Briefe und Postkarten in die Bundesrepublik und nach West-Berlin berechnet die DDR fortan Auslandsporto.
1972
Erich Honecker nennt die Bundesrepublik Deutschland „imperialistisches Ausland“.
Beide deutsche Staaten regeln in einem Grundlagenvertrag die gegenseitigen Beziehungen.
Das Verteidigungsministerium der DDR erklärt den Einsatz der Schusswaffe an der innerdeutschen Grenze für zulässig.
Die Schweiz erkennt die DDR an.
1973
Frankreich und Großbritannien nehmen diplomatische Beziehungen zur DDR auf.
Beide deutsche Staaten werden Mitglied der UNO.
DDR-Bürger dürfen im Intershop einkaufen. Mit westlicher Währung.
Hirnhautentzündung
Ich sollte ein Jahr länger im Kindergarten bleiben als geplant, denn: Mit sechs Jahren, an einem Sommertag des Jahres 1973, bekam ich Kopfschmerzen, und meine Mutti1 brachte mich zu einem Arzt in eine Poliklinik2.
Ich war stolz darauf, als sehr tapfer zu gelten. Meine Eltern erklärten mir immer genau den Sinn einer Spritze oder des Blutabnehmens. Dieser Arzt aber hatte den Verdacht auf Hirnhautentzündung und brauchte Rückenmarkflüssigkeit zur Bestätigung. Und er wollte das offenbar anders handhaben mit den Schmerzen und der Ehrlichkeit. „Der Doktor pinselt mal deinen Rücken etwas nass.“, meinte eine Schwester und es klang betont gelangweilt.
Das war es nicht. Eher eine Art geheimes Kommando an sämtliche Schwestern im Raum, sich auf mich zu stürzen, festzuhalten und nach vorn zu biegen, um dem Arzt die Möglichkeit zu geben, seine Injektionsnadel in mein gekrümmtes Rückgrat einzuführen. Mein Vertrauen in Mediziner wurde in dieser einen Sekunde auf Jahre zerstört.
Ich kam ins Leipziger St. Georg-Krankenhaus und musste dort bleiben, im Zimmer mit einer wirklich merkwürdigen erwachsenen Bettnachbarin. Offenbar war es damals noch nicht üblich, Kinder zu Kindern zu legen. Oder das Krankenhaus hatte keine Kinderstation, keine Ahnung.
Wenn ich der merkwürdigen Frau eines meiner vielen selbstgemalten Bilder zeigte, mäkelte sie oft an Kleinigkeiten herum. „`ne orange Sonne, na Hilfe!“ Immer wenn sie Besuch bekam, meistens ein Mann, brachte der ihr Hühnerbrustfleisch mit, gebraten. Verschlossen in einem Schraubglas. Wenn der Besuch dann gegangen war, hielt sie sich das Fleisch immer vor den Mund und meinte genussvoll und zu mir schielend: „Hm, lecker, weißes Hühnerfleisch!“. Sie war wirklich etwas auffällig.
Nach einer Woche etwa hörte ich die Stimme meiner Mutti auf dem Gang – die noch nicht zu mir durfte. Ich schrie so laut ich konnte und wurde für einige Sekunden von der Schwester zum Winken rausgetragen. Nächste Woche könnte sie mich besuchen, rief meine Mutti, und ob ich mir was wünschte? Ich nahm meine ganze Kinderkraft zusammen und schrie durch den leeren Krankenhausgang: „Weißes Hühnerfleisch!“, was meine Mutti etwas überraschte, denn bis dahin hatte ich diese Vorliebe noch nicht gezeigt. Natürlich brachten sie mir welches mit, es schmeckte mir zwar nicht, ich achtete aber drauf, dass es im Nachbarbett bemerkt wurde.
Als es mir besser ging, entwickelte sich zwischen der Verrückten und mir so eine Art Battle, was ich damals natürlich noch nicht so nannte. Immer, wenn einer von uns aufs Klo ging, versteckte sich der andere. Nun war die Frau zwar irre, aber nicht doof. So geschah es oft, dass sie wiederkam und sofort durchschaute, wo ich mich versteckt hatte. Sie sagte dann laut und überdeutlich sowas wie: „Na dann wollen wir doch mal unter der Bettdecke nachsehen wo sich der Tommi versteckt hat…“, um mich dann aber in meinem richtigen Versteck aufzuspüren und sich auf mich zu stürzen und wahnsinnig zu erschrecken.
Ich darf aber sagen, dass ich diesen Psychokrieg letztlich für mich entscheiden konnte. Bei einem der Klogänge meiner Bettnachbarin jagte ich ins Nachbarzimmer und borgte mir dort einen unnatürlich großen Teddy, den ich schnell rüber schleppte und ihn auffällig unter meiner Bettdecke drapierte. Ich selbst aber legte mich unter das Bett.
Kurze Zeit später traten die hässlichen Hexenfüße meiner Zimmergenossin über die Türschwelle und die Stimme sagte: „Der Tommi steht bestimmt hinter der Gardine.“ Die Füße näherten sich schleichend meinem Bett, verharrten kurz, bis sich oben die irre Frau auf den Teddy unter meiner Bettdecke stürzte. Im gleichen Moment umkrallte ich unten ihre Fesseln … Ich hab bis dahin noch nie eine erwachsene Frau so schreien hören. Das hat alles sehr schön funktioniert. Sie wollte sich auf einen kleinen Jungen stürzen, der plötzlich ein Teddy ist, und zur gleichen Zeit packt sie jemand fest an den Knöcheln – ich glaube, das wäre sicher niemandem so ganz egal gewesen. Nie wieder haben wir dieses Spiel gespielt.
Doof fand ich die trotzdem immer noch. Sie holte sich immer Kaffee aus irgendeiner Kanne draußen auf dem Gang, setzte sich dann auf ihr Bett und füllte Würfelzucker in die Tasse, den sie aus einem Becher in ihrem Nachtschrank entnahm. Irgendwie machte sie das so heimlich, fand ich immer.
Eines Tages nun kam eine Visite, und der Arzt fragte all die Sachen ab, die immer so fällig sind: Temperatur, Blutdruck, Laborwerte, und ob mit dem Stuhl alles in Ordnung. Ich fragte mich noch, warum sich der Arzt eigentlich für einen Stuhl interessiert, doch ich konnte dem nicht weiter nachgehen, weil er nun auf das Wesentliche zu sprechen kam. „Haben sie Zucker?“, fragte er mit ernster Stimme, und mir war damals glasklar, dass er nur dieses heimliche Zuckerdepot in ihrem Nachtschrank meinen konnte, denn warum sollte der Arzt denn sonst so ernst danach fragen. Die Frau verneinte, und weil ich diese vermeintliche Lüge nicht im Raum stehen lassen konnte, beugte ich mich aus meinem Bett heraus und schrie der Ärztegruppe entgegen: „Na klar hat die Zucker!“ Die allgemeine Heiterkeit im Raum habe ich nicht verstanden.
Vier Wochen sollte ich in diesem Krankenhaus verbringen. Eigentlich hätte ich im September eingeschult werden müssen, daraus wurde nichts. Das ärgerte mich schon ein wenig. Irgendwann brachten meine Eltern eine Pralinenauswahl mit, die ich als Dankeschön meiner Ärztin, einer Frau Dr. Sommer, geben sollte. Auf dem Deckel dieser Packung waren die einzelnen Pralinen abgedruckt. Kringel, Schnecken, Kugeln… und: eine kleine Zuckertüte aus Nougat. Ich lag im Bett und die Ärztin kam und kam nicht – und die Zuckertüte lächelte mich an. So wie sie da lag und sich in ihr Bett aus Plastik schmiegte, würde es kaum auffallen, wenn sie fehlte, dachte ich mir – und wurde schwach.
Nach langem inneren Kampf piepelte ich die Packung auf und verschlang die Zuckertüte aus Nougat so schnell es ging. Worauf natürlich das Nougatzuckertütenbett plötzlich furchtbar leer aussah – und mir völlig rätselhaft erschien, wie ich jemals glauben konnte, Frau Dr. Sommer würde das Fehlen des Nougatstücks nicht bemerken.
Nach einer unruhigen Nacht überreichte ich am nächsten Tag die Schachtel und sagte nichts. Am Nachmittag kam Frau Dr. Sommer wieder, ungeplant und schenkte mir: Eine Zuckertüte, eine kleine, aber eine richtige. Sie wisse, wie sehr ich mich auf die Schule gefreut habe, sagte sie, und dass sie hofft, dass die Zuckertüte mich etwas tröstet. Und wenn ich das nächste Mal Appetit auf Nougat hätte, solle ich es ihr sagen.
Vier Wochen blieb ich also im Krankenhaus, der Sommer war gegessen. Ich wurde „zurückgesetzt“. Im September ging ich also, statt in die Schule, wieder in den Kindergarten. Das einzige Schöne daran: Ich war plötzlich der Älteste.3
1974
Die DDR ersetzt das Autokennzeichen „D“ durch „DDR“.
In beiden Teilen Deutschlands nehmen „ständige Vertretungen“ des jeweils anderen Staates ihre Arbeit auf.
Bei der Fußball-WM schießt Jürgen Sparwasser die DDR zum 1:0-Sieg über den späteren Weltmeister BRD. Es sollte das einzige Aufeinandertreffen der zwei deutschen Fußballnationalmannschaften in vierzig Jahren bleiben.
Ost-Berlin streicht den Begriff „deutsche Nation“ aus der DDR-Verfassung.
Fürfrienunsozialismuseidbereit
Ein Jahr später, 1974, dann also Einschulung. Ich kam in die Hermann-Duncker-Oberschule Leipzig4. Dazu gehörte auch: Pionier werden. Jungpionier. Blaues Halstuch. Kleiner Ausweis mit Geboten. Wir Jungpioniere lieben den Frieden, wir Jungpioniere halten unseren Körper sauber und gesund, treiben Sport und sind fröhlich. Das „Fröhlichsein“ spielte eine enorm große Rolle. „Fröhlich sein, und singen. Stolz das blaue Halstuch tragen!“ – so ging unsere Pionierhymne. „Fröhlich sein und singen“, das ließ sich auch gut abkürzen zu „FRÖSI“, so hieß unsere Pionierzeitschrift.
Die Lehrer lasen uns die Gebote vor, machten dabei bedeutungsvolle Gesichter und meinten, in der vierten Klasse würden wir dann Thälmannpioniere5 werden. Wir bekämen ein rotes Halstuch und die Thälmannpioniere hätten auch keine Gebote mehr, sondern Gesetze, und ob wir den Unterschied kennen. Das lag aber noch in weiter Ferne, blaue Halstücher waren voll in Ordnung und getragen haben wir sie ohnehin nur selten, zum Beispiel zu den Appellen.
Ein Appell war eine Art Vollversammlung auf dem Schulhof oder in der Aula. Da standen die Klassen mit den Jungpionieren im Karree ganz links (weiße Bluse6, blaue Halstücher), daneben die Klassen mit den Thälmannpionieren (weiße Bluse, rote Halstücher) in der Mitte, und dann noch die Klassen mit FDJ´lern7 (blaue Hemden), ganz rechts. Wir Jung- und Thälmannpioniere warteten auf die magischen Worte des Appellleiters – meist ein FDJler aus dem Freundschaftsrat8 der Schule: „Ich begrüße die Jung-und Thälmannpioniere mit dem Gruß: „Für Frieden und Sozialismus: Seid bereit!“
Worauf wir mit unseren donnernden Kinderstimmen ein hundertfaches „Immer bereit!“ schmetterten und dabei die gestreckte rechte Hand mit dicht aneinandergelegten Fingern an die rechte Kopfseite führten.
Die fünf Finger sollten für die fünf Erdteile stehen, die ganz fest zusammenhalten müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen, im Kampf um Frieden und für eine glückliche Zukunft der Kinder aus aller Welt9.
Ich erinnere mich daran, wie mir beim Nachdenken einmal auffiel, dass es ja mehrere Worte waren, auf die wir da „Immer bereit!“ zurückschrien. Ich war ganz überrascht. Bis zu diesem Moment dachte ich immer, es sei nur ein Wort: „Fürfrienunsozialsmuseidbereit“. So ähnlich wie morgens immer im Radio, wo es nach den Piepstönen um sieben Uhr immer hieß, dass es „Beimletzentondeszeitzeichens“ sieben Uhr gewesen war.
Und ich erinnere mich, dass ich eigentlich überhaupt nicht recht wusste, was sie mit diesem „Sozialismus“ meinten, zu dem alle „immer bereit“ waren. Wohl auch deswegen war ich auf die FDJ-ler etwas neidisch, denn die hatten nicht so eine komplizierte Grußformel, bei denen war alles klar: Der Apellleiter gab vor: „Ich begrüße die Mitglieder der Freien Deutschen Jugend mit „Freundschaft“ – Und die FDJ-ler antworteten nur: „Freundschaft“. Viele von ihnen ließen dabei auch den gerade überstandenen Stimmwechsel heraushängen, was der „Freundschaft“ etwas beiläufig Dahingesagtes verlieh – und sich ziemlich cool anhörte. Manche von uns Pionieren sagten auch „Freundschaft“ (mit möglichst tiefer Stimme) und kicherten. Es wurde milde und wohlwollend lächelnd geduldet.
Gleich am Anfang des Schuljahres wählten wir uns einen „Gruppenrat“. Naja, „wählen“… natürlich wählten wir die, die der Lehrer uns vorschlug. Machen wollte das immer keiner, aber es war unausgesprochen klar, dass das ein Job für die eher guten Schüler war. Es gab einen Vorsitzenden, seinen Stellvertreter, einen Kassierer für die Pionierbeiträge und einen Agitator. Ja, der hieß damals schon so. In jeder Klasse gab es einen Agitator.
Meine Eltern erzählten mir in späteren Jahren noch mit Begeisterung die Geschichte, dass ich, als ich klein war, gesagt haben soll. „Mutti, die Lehrerin meint, ich soll den Aggressor machen!“ Mörderkomisch. Meistens war der Agitator für die vielen Wandzeitungen verantwortlich, die im Laufe des Schuljahres unter Mithilfe des Lehrers gestaltet werden sollten.
Dass ich da mitmachen musste, das hatten mir meine Eltern nahegelegt, also ging`s nun um die Frage, welcher Posten am wenigsten Stress macht. Der Kassierer war sehr begehrt oder der Stellvertreter. Der Vorsitzende nicht so. Man musste dauernd mit dem Lehrer irgendwas besprechen, hatte sonst keinerlei Autorität, aber wenigstens die Dankbarkeit der Mitschüler, dass sich einer gefunden hatte, der`s macht.
Brigaden und Grußformeln
Wir hatten in der DDR-Schule aber auch Unterricht. Dort bildeten wir Lernbrigaden. Immer fünf bis sechs Schüler stark, die sich gegenseitig helfen sollten. Doch das mit dem „gegenseitig“ funktionierte natürlich überhaupt nicht. Ich war ziemlich gut in der Grundschule und damit unausgesprochen Brigadeleiter. Immer, wenn unsere Zensuren nicht gut ausfielen, fühlte ich mich schlecht. Denn manche Lehrer brachten es tatsächlich fertig, bei Klassenarbeiten auch die Ergebnisse der Lernbrigaden zu vergleichen.
Wenn der Unterricht begann, musste sich immer ein Schüler bereithalten für die Meldung. Das war meist einer aus der gerade diensthabenden Brigade, oder der Routine halber der Vorsitzende des Gruppenrates. Wenn die Lehrerin die Klasse betrat, rief der Meldeschüler „Achtung!“, und alle huschten an ihre Plätze und stellten sich dort hin. Die Lehrerin schritt zu ihrem Tisch, und drehte sich zum Meldeschüler um. Der sagte, natürlich mit der Pioniergruß-Hand am Kopf: „Frau XY, ich melde, die Klasse 1c ist zum Unterricht bereit“. Manche Lehrer wollten in der Meldung noch hören, wer gerade fehlt, oder ob alle ihre Hausaufgaben gemacht haben – aber meistens ging`s nur um die Info, dass die Klasse nun zum Unterricht bereit ist.
Der Lehrer drehte sich dann zur Klasse und sagte – je nach politischem Engagement entweder nur „Seid bereit!“, oder „Für Frieden und Sozialismus: Seid bereit!“ Wir bekundeten dann, dass wir für Frieden und Sozialismus „Immer bereit“ (Pioniergruß-Hand!) seien und durften uns setzen.
Später in Russisch antworteten wir auf das „Butje gotowej!“ des Lehrers erst mit „Wsjegda gotowej!“ und noch später, wenn der Lehrer „Druschba“ (Freundschaft) sagte, auch einfach nur mir „Druschba“. Im Englischen ab der siebenten Klasse begannen wir den Unterricht ganz unpolitisch mit „Good morning!“ oder „Good afternoon!“ und im Sport hieß es: „Wir begrüßen uns zu unserem Sportunterricht mit einem einfachen: „Sport:“ … Und wir schrien: „Frei!“. Und in Musik gab`s immer ein Lied, und das immer bei geöffnetem Fenster, auch im Winter.
Ab und an standen „Pioniernachmittage“ an. Nach dem Unterricht. Auch nicht direkt im Anschluss, wir mussten später dafür nochmal in die Schule kommen. Die Veranstaltungen müssen aber ziemlich öde gewesen sein, ich erinnere mich an keine. Sie waren förmlich organisiert vom Gruppenrat, lagen aber natürlich fest in der Hand der Lehrer.
Also, zusammengefasst: Grundschule, das hieß für mich: Lesen lernen, Rechnen lernen, Schreiben lernen, fröhlich sein und singen, ab und zu ein Appell, einmal im Jahr Gruppenratswahl. Manchmal ein Pioniernachmittag, und auf dem Rückweg nach Haus flatterte das Halstuch im Wind… das war der Schuleinstieg. Ich fand das Gesamtpaket also nicht schlimm. Schule war machbar und störte auch nicht besonders – und der Staat dahinter blieb vorerst unsichtbar.
1975
Als erstes westliches Land erkennt Österreich eine eigene DDR-Staatsbürgerschaft an.
Die DDR und die Sowjetunion schließen ein Abkommen, das erstmals keinen Hinweis mehr auf eine zukünftige Wiedervereinigung Deutschlands enthält.
Der DDR-Gründungstag (7.10.1949) wird „Nationalfeiertag“.
Kang-Fi und die Hakenkreuze
Dass es da aber etwas gab, das ich später „den Staat“ nennen würde, das sollte ich schon in der ersten Klasse lernen, ohne dass ich es hätte verstehen können. Ich sollte es spüren, denn es hatte mit starken körperlichen Schmerzen zu tun. Mir zugefügt von meinen Eltern, und das auch nicht im Affekt, sondern nachdem sie sich eingehend beraten hatten. Es sollte in einer fürchterlichen Tracht Prügel enden, der einzigen, die mir meine Eltern in meinem ganzen Leben zukommen ließen.
Kang-Fi war ein Nachbarsjunge, ein Halbchinese, der Sohn des Kneipers im Haus nebenan. Er ging schon in die 5. Klasse und war deswegen auch schon Thälmannpionier. Groß und etwas dick und stark. Wenn ich mit Kang-Fi ins Vorstadtkino um die Ecke gehen durfte, und er sagte, ich solle mal den Arm heben und ein Schattenspiel auf der Leinwand machen – dann tat ich es. Regelmäßig kam der Vorführer und drohte flüsternd mit Rausschmiss. Regelmäßig sagte ich ihm, dass Kang-Fi mir gesagt hätte, ich solle es tun und regelmäßig fragte der Filmvorführer, ob ich auch aus dem Fenster springen würde, wenn Kang-Fi es mir sagte. Regelmäßig lachte Kang-Fi dann, nahm die Schuld auf sich, gelobte Besserung und schicke den Filmvorführer weg.
Eines Nachmittags saß ich mit Kang-Fi auf der Treppe bei uns im Hof, als er sich einen etwas stärkeren Zweig griff und ein Symbol in den Staub zeichnete. Ich weiß noch wie sich der Zweig beugte, als sträubte er sich dagegen. Es war ein Hakenkreuz, das da vor meinen Augen entstand. „Das“, sagte Kang-Fi und blickte sich um, „ist ein ganz (und er betonte jeden Buchstaben dieses Wortes) ganz, ganz schlimmes Zeichen. Das darfst du nie, nie nachmalen, niemals!“ Ich versprach, es nicht zu tun, während ich die Krakel im Staub anstarrte, die in diesen Momenten eine hypnotische Kraft entfalteten.
Am nächsten Nachmittag stand meine Mutter in meinem Zimmer und hielt mir meine Schulhefte unter die Augen. Was das sei. Und das hier. Und das. Was sie meinte, zeigte sie, indem sie Seiten umblätterte und jedes Mal, wenn sie ein Hakenkreuz entdeckte, drauftippte. Das. Und das. Und das. So ging das noch eine Weile weiter.
Ich hatte so gut wie jede freie Stelle in meinen Heften mit Hakenkreuzen ausgefüllt. Hakenkreuze zwischen Matheaufgaben, Hakenkreuze zwischen Zeichnungen von verschiedenen Gemüsen, Hakenkreuze als Satzzeichen, Hakenkreuze im Hausaufgabenheft, als Rahmen für anstehenden Hausaufgaben: „Hakenkreuz, Mathebuch Seite 17, Aufgabe 5, Hakenkreuz“
Es überraschte mich nicht, dass meine Mutti böse war, deswegen. Denn dass es mit diesem Zauberzeichen irgendetwas auf sich haben musste, das hatte mir Kang-Fi ja erklärt. Überrascht war ich, wie böse sie war und dass sich so viele Hakenkreuze angesammelt hatten. Ich erinnerte mich nicht an den Schaffensprozess, die Kreuze waren einfach da. Auf Heftinnenseiten. Am Rand einer Arbeit, kunstvoll auf den quadratischen vorgedruckten Heftlinien nachgezeichnet. Ich sehe meine Eltern vor mir, wie sie fast panisch nach Hakenkreuzen suchen, als seien es aggressive Insekten, von denen kein einziges überleben durfte, weil sie sich sonst vielleicht vermehrten.
Als sie sicher waren, alle erwischt zu haben, nahmen sie mich zur Seite. Und erzählten von Hitler. Und vom Krieg. Und dass er die Juden umgebracht hat.
Sie ersparten mir, dass sie sich Sorgen machten, dass so ein Vorkommnis schon als Kind in der Grundschule mein Leben in der DDR nachhaltig beeinflussen könnte. Wahrscheinlich eine unbegründete Sorge, aber wer konnte das schon wissen? Wie konnten sie sicher sein, dass nicht ein hakenkreuzmalender siebenjähriger die Neugier eines Lehrers weckt, der das vielleicht weitererzählt, vielleicht auch an jemanden von der Stasi10, der dann mit diesem Vorgang eine Akte anlegt, oder eine Akte meiner Eltern bereichert, die vielleicht schon existiert – wer konnte das schon wissen?
Niemand konnte das wissen - aber meine Eltern hielten es für möglich. Ich für meinen Teil ahnte von dieser Sorge nichts, wollte aber natürlich keine Symbole mit mir herumtragen, die mit Hitler etwas zu tun hatten, denn der hatte die Juden umgebracht und den zweiten Weltkrieg angezettelt. Ich versprach, es nicht mehr zu tun. Alles ok, neue Hefte waren noch da, austauschen: fertig.
Die nächste Erinnerung sieht einen kleinen Jungen am nächsten Abend, in banger Erwartung auf seinem Bett sitzend. Mein Zimmer grenzte an die Küche und dort berieten meine Eltern. Sie sollten eine schwere Entscheidung treffen. Am Nachmittag hatte ich meine Hausaufgaben zur Kontrolle vorgelegt – als meine Eltern die neuen Hakenkreuze entdeckten. Wieder waren sie mir einfach aus dem Füller geflossen. Ich weiß noch wie erschrocken ich war, und ich spürte Unheil aufziehen, weil Wortfetzen aus der Küche herüberschallten. Von „der kann das nicht verstehen“ war die Rede, und davon, dass jetzt alles nichts helfe, und dass man „den“ – und ich bin sicher, der Gedanke stammte von meinem Vater – „verprügeln“ müsse. Mit “den“ war ich gemeint, doch ich hielt das Ganze für einen Irrtum.
Ich konnte das nicht fassen, ich war absolut sicher, dass ich mich verhört hatte. Abgesehen von ein paar Rüffeln meines Vaters, wenn ich mal wieder herumheulte („Damit du einen Grund hast!“), war ich fast gewaltfrei aufgewachsen und von unerschütterlichem Urvertrauen, dass das auch so bleiben sollte. Ich täuschte mich. Offenbar hatten sich meine Eltern darauf verständigt, dass mein Vater das Erziehungsvorhaben in die Tat umsetzen sollte. Es wurde eine Gewaltorgie. Schlimm war das laute Klatschen der Hand auf meinem nackten Po, schlimm waren die Schmerzen, schlimm war aber vor allem die Kraft meines Vaters, die verhinderte, dass ich den Schmerzen und dem Klatschen entrinnen konnte.
Ich habe seitdem nie wieder ein Hakenkreuz gemalt, bis heute übrigens nicht. Ich verstand nicht, was da über mich hereingebrochen war, und warum es eine so drastische Reaktion meiner Eltern hervorrief. Ich war ihnen auch nicht „böse“ oder so, denn ich fühlte, dass es da etwas gab, das außerhalb unserer Familie lag. Eine Macht, die ich nicht sah, eine unsichtbare Macht, die aber stark genug war, meine Eltern dazu zu bringen, mir so etwas anzutun.