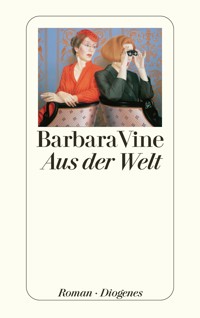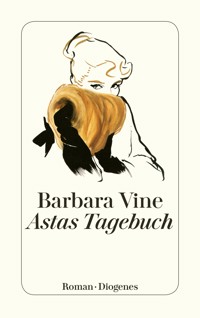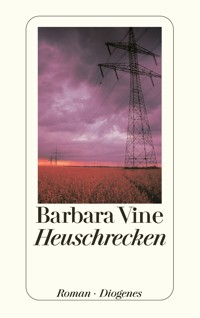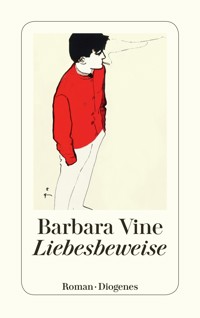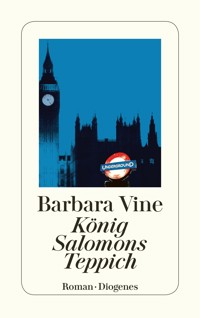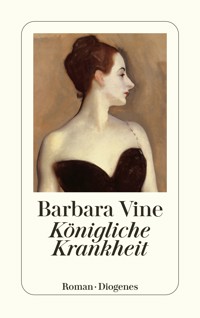9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Cosettes Ehemann stirbt, wagt sie im vorgerückten Alter einen Neuanfang, verlässt ihren Landsitz und erwirbt das ›Haus der Stufen‹. In diesem offenen Haus in einem Londoner Vorort gehen Alt und Jung ein und aus. Ja, sie leben in einer gemischten WG zusammen, in der entspannten Atmosphäre der 60er Jahre. Bis Bell Sager, eine ebenso schöne wie bodenlos abgründige Frau, die Bühne betritt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Barbara Vine
Das HausderStufen
Roman
Aus dem Englischen vonRenate Orth-Guttmann
Titel der 1988 erschienenen Originalausgabe
›The House of Stairs‹
Copyright © 1988 by
Kingsmarkham Enterprises Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1990
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Bronzino,
›Ritratto di Lucrezia Panciatichi‹,
um 1540
Foto: Scala, Antella (Firenze)
Für David
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22582 2 (9.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60120 6
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] 1
Der Taxifahrer dachte, er hätte mich beleidigt, weil ich eine Fünf-Pfund-Note durch den Spalt in der Trennscheibe schob und sagte, er solle anhalten und mich absetzen. Die Ampel sprang gerade auf Grün um, und während er links heranfuhr, sagte er mit streitbarer Stimme:
»Man darf ja wohl noch seine eigene Meinung haben.«
Er hatte sich über die Zwangssterilisierung Behinderter ausgelassen – irgendein Zeitungsartikel hatte ihn wohl darauf gebracht –, für die er sich rückhaltlos und mit großer Leidenschaft einsetzte. Ich, jawohl, gerade ich hätte sehr wohl beleidigt sein können – wenn ich überhaupt erfaßt hätte, was er sagte, wenn nicht das meiste an mir vorbeigerauscht wäre.
»Ich habe gar nicht hingehört«, sagte ich, begriff, sobald es heraus war, daß ich damit alles nur noch schlimmer machte, und versuchte es mit der Wahrheit, obwohl ich wußte, daß es nichts nützen würde. »Ich habe eine Bekannte gesehen, eine Bekannte von früher. Auf der Kreuzung. Ich muß unbedingt mit ihr sprechen.« Draußen auf dem Gehsteig rief ich ihm zu: »Behalten Sie den Rest!«
»Rest? Ist ja wohl ’n Witz«, sagte er, obgleich es ein durchaus anständiges Trinkgeld war. Er gehörte zu jenen Männern, die der Ansicht sind, alle Frauen seien verrückt, oder die sich das zumindest einreden, weil sie sich nur so ansonsten unerklärliche Verhaltensweisen erklären, nur [6] so drohende Dominanz abwehren können. »Sie kann man ja nicht frei rumlaufen lassen«, brüllte er, womit er womöglich wieder bei seinem ursprünglichen Thema war.
Er hatte mich nicht aus Bosheit auf der Südseite des Greens abgesetzt. Es schien mir nur so in diesem Augenblick, als ich, abgeschnitten durch den brandenden Verkehr, dort stand und wartete und gleichzeitig das Gefühl hatte, als schlüge mir jemand ständig eine Tür vor der Nase zu. Während der Grünphase entfernte sich Bell immer weiter von mir. Auf der blechernen Flut vollzog sich der große Exodus aus der Wood Lane und der Uxbridge Road, vom West End über die Holland Park Avenue und die West Cross Route, und das smaragdene Leuchten zog die Flut an, trieb sie zu immer schnellerem Vorwärtsdrängen, immer lauterem Dröhnen. Sie versperrte mir die Sicht auf das Green, das Bell jetzt überqueren mußte – aber in welche Richtung?
Durch die Windschutzscheibe des Taxis hatte ich sie auf der Kreuzung gesehen. Mit unverändert gleitendem Gang, kerzengeradem Rücken, hocherhobenen Hauptes, als balanciere sie eine Amphore auf dem Kopf, schritt Bell von der Hammersmith-Seite nach Norden. Ich hatte hörbar nach Luft geschnappt, vielleicht sogar einen Schrei ausgestoßen, was wohl mein Taxifahrer als Widerspruch zu seinen Äußerungen gedeutet hatte. Sie verschwand so rasch in Richtung Holland Park, daß es auch eine Halluzination gewesen sein konnte. Aber ich wußte es besser. So eigenartig es sein mochte, sie ausgerechnet hier zu entdecken – ich wußte, daß es Bell gewesen war, [7] die ich gesehen hatte, und daß ich ihr folgen mußte, ungeachtet all der Jahre, die vergangen, ungeachtet all der schlimmen Dinge, die geschehen waren.
Warten zu müssen, wenn man vor Eile fiebert, gehört unter den kleineren Heimsuchungen unseres Lebens zu den schlimmsten – nur empfand ich sie in diesem Augenblick als gar nicht so klein. Ich trat von einem Fuß auf den anderen, ich wippte auf den Fußsohlen, ich flehte die Ampel an, endlich umzuspringen. Und dann sah ich sie wieder. Die rote Mauer der Busse rückte weiter und gab mir den Blick frei. Sie überquerte das Green, eine rasch entschwindende Gestalt, groß und aufrecht, unbeirrt geradeausblickend. Sie trug Schwarz, nur Schwarz, irgendwelche bauschig-flattrigen Gewänder, wie sie nur sehr große, schlanke Frauen tragen können, die zerbrechlich wirkende Taille hielt ein breiter schwarzer Gürtel zusammen, als solle er verhindern, daß sie in der Mitte durchbrach. Schon bei meinem allerersten Blick hatte ich eine erschreckende Veränderung an ihr bemerkt. Das früher ganz hellblonde Haar hatte die Farbe gewechselt. Inzwischen konnte ich jenseits der breiten, von Wegen durchzogenen Grünfläche die kleiner werdende Gestalt nicht mehr deutlich erkennen, aber ich begriff bestürzt, mit einer Art von hohlem Schmerz, daß ihr Haar grau geworden war.
Die Ampel sprang um, und wir ergossen uns vor den ungeduldigen, kaum im Zaum zu haltenden Wagen über die Fahrbahn, das heißt, ich stürmte los, stürmte über das Green und Bell nach, die ich nicht mehr sah, die von der Bildfläche verschwunden war. Ich wußte natürlich, wohin sie verschwunden war, sie war zur U-Bahn [8] hinuntergefahren. Ein Fünfzig-Pence-Fahrschein aus dem Automaten, dann stand ich auf der Rolltreppe, konfrontiert mit Alternativen, gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Die alte, immer neue Wahl am Scheideweg… Die Frage in diesem Fall war: nach Westen oder nach Osten? Bell war früher, ehe sie aus unser aller Leben in die Jahre des Vergessens abgetaucht war, ins Niemandsland, hinter Klostermauern kalt und streng, Londonerin gewesen. Trotz etlicher Aufenthalte im Exil hatte sie sich immer damit gebrüstet, daß sie sich westlich von Ladbroke Grove oder östlich von Aldgate nie zurechtfinden würde. Heute abend war sie westlich von Ladbroke Grove gewesen (der Grove, wie wir damals alle sagten), aber sicher nur zu Besuch, dachte ich. Irgendwie wußte ich, daß sie auf dem Heimweg war.
Ich entschied mich deshalb für den Bahnsteig in Richtung Osten. In diesem Moment kam der Zug, und vor dem Einsteigen sah ich sie wieder. Sie stand weit weg von mir und ging auf die sich öffnenden Türen zu, und ihr Haar war aschgrau. Aschgrau und locker aufgesteckt, wie einst Cosette es getragen hatte, genau so, hoch und rund wie ein Laib Landbrot, mit einem Knoten in der Mitte, der aussah wie ein Klumpen Teig, genau die gleiche Frisur hatte Cosette gehabt, als sie ins Haus der Stufen gezogen war.
Der Anblick hatte etwas zutiefst Bestürzendes, Verstörendes, so daß ich das dringende Bedürfnis verspürte, mich hinzusetzen, um mich davon zu erholen, die Augen zu schließen, vielleicht tief durchzuatmen. Natürlich ging das nicht an. Ich mußte in der Nähe der Tür stehenbleiben, damit ich Bell sehen konnte, wenn sie ausstieg und auf dem Weg zum Ausgang an meinem Wagen vorbeikam. Oder [9] besser noch, ich mußte an jeder Station kurz aussteigen für den Fall, daß sie einen anderen Ausgang benutzte, weil sie dann ja nicht an mir vorbeikommen würde. Trotz meiner Angst, sie zu verlieren, konnte ich inzwischen wieder einigermaßen klar denken. Erst jetzt kam ich dazu, mir zu überlegen, ob Bell mich überhaupt würde sehen wollen, und ich fragte mich, was wir einander sagen, wie wir anfangen würden. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß Bell mir einen Vorwurf machen würde, wie es etwa Cosette getan hatte. Aber würde sie vielleicht von mir Vorwürfe erwarten?
In diese Richtung gingen meine Gedanken, als der Zug in Holland Park hielt. Die Türen öffneten sich, und ich beugte mich vor und sah am Zug entlang, aber Bell tauchte nicht auf. Inzwischen war es halb acht geworden, es war zwar noch belebt, aber das große Gedränge war vorbei. Was ich hier trieb, wäre während des Berufsverkehrs unmöglich gewesen. Die nächste Station war Notting Hill Gate, und ich hätte fast wetten mögen, daß Bell dort nicht aussteigen würde, denn das war die Station, die wir damals alle benutzt hatten – bis auf Cosette, die immer mit dem eigenen Wagen oder mit dem Taxi gefahren war. Bell wäre, so sehr sie an diesem Teil Westlondons hängen mochte, nicht so unsensibel gewesen, aus freien Stücken in diese Straßen, zu dieser U-Bahnstation zurückzukehren, nachdem sie aus dem Gefängnis gekommen war.
So, jetzt hatte ich es ausgesprochen, lautlos und nur für mich, aber das Wort war gefallen: Gefängnis. Nichts da von Klostermauern kalt und streng, von Jahren des Vergessens, von Niemandsland. Ein Gefühl der Schwäche, fast des Schwindels überkam mich. Und schon folgte, fast ebenso [10] verstörend, die nächste Überlegung. Ich habe nicht mit ihrer Freilassung gerechnet, noch mindestens ein Jahr, habe ich gedacht, ich bin nicht vorbereitet. Hatte ich mir überhaupt je vorstellen können, daß man sie freiließ? Aber ich mußte mich vorbereiten, ich mußte den Zug verlassen für den Fall, daß ich mich geirrt hatte, für den Fall, daß Bell hier zwar nicht wohnte, aber jemanden besuchen wollte, so daß sie genötigt war, auf diesem Bahnhof auszusteigen. Ich stellte mich auf den Bahnsteig und hielt nach ihr Ausschau, aber auch hier kam sie nicht zum Vorschein.
Sie stieg in Queensway aus, und ich folgte ihr. Jetzt würde ich sie wohl in der Gruppe zu fassen bekommen, die auf den Lift wartete. Doch der Lift nahm nur einen Teil der wartenden Fahrgäste auf. Ich sah Bell einsteigen, ihr schöner aschfarbener Kopf überragte alle bis auf zwei. Ich mußte den zweiten Lift nehmen. Ehe ich einstieg, ehe die Türen des ersten Lifts sich schlossen, wandte Bell sich um und blickte genau in meine Richtung. Ob sie mich sah, weiß ich nicht, ich habe mir lange darüber den Kopf zerbrochen, könnte es aber nach wie vor nicht sagen. Allerdings glaube ich eher, daß es nicht der Fall war. Die Türen schlossen sich, der Lift trug sie davon.
Die Sonne ging unter, als ich auf die Bayswater Road hinaustrat, über den blaßroten Himmel wälzten sich rostfarbene, scharlachrote und fast schwarze Wolken. Wieviel schöner ist doch ein Himmel über der Stadt als auf dem Lande, und am allerschönsten ist er über London, auch wenn ich weiß, daß die Amerikaner diesen Anspruch für New York anmelden, und ich bin gern bereit, ihnen den zweiten Rang zuzubilligen. T. H. Huxley sah bei [11] Sonnenuntergang die Oxford Street hinunter und hatte apokalyptische Visionen, und an diesem Abend meinte auch ich, wundersame Gebilde über dem Park und den Kensington Palace Gardens zu erblicken, gewaltig aufgeblähte Wolkenmassen, ockerfarben und wie mit getrocknetem Blut befleckt, die sich im Wind teilten, kleine, klare, zartblaue Teiche freilegten und sich erneut in schwärzlich-dampfigem Gewalle zusammenschlossen. Aber Bell sah ich nicht, Bell hatte ich verloren.
Ich machte kehrt, blickte die Queensway hinauf, blickte in beide Richtungen die Bayswater Road hinunter. In beträchtlicher Entfernung sah ich eine hochgewachsene schwarz gekleidete Frau in westliche Richtung gehen, und ich glaube, schon in diesem Augenblick wußte ich insgeheim, daß es nicht Bell war, obwohl die Frau eine schmale Taille und graues Haar hatte. Ich machte mir etwas vor, was hätte ich sonst auch tun sollen? Mit leeren Händen und mit leerem Herzen heimgehen? Früher oder später mußte ich das wohl, aber nicht jetzt, nicht gleich. Und sobald die Frau aus der Bayswater Road auf den St.Petersburgh Place einbog, war ich wieder überzeugt davon, daß es Bell war, daß es Bell sein mußte – denn wie hätte sie so schnell entkommen, untertauchen können? –, und ich nahm mit Feuereifer die Verfolgung auf, über den St.Petersburgh Place, vorbei an der Synagoge und der Matthäus-Kirche, die Moscow Road entlang, zum Pembridge Square, über Pembridge Villas hinweg. Inzwischen war es natürlich näher zur U-Bahnstation Notting Hill Gate als zur Queensway, und ich sagte mir, daß Bell diese Station absichtlich mied, einen langen Umweg zu ihrer Wohnung in Kauf nahm, weil es ihr ebenso [12] schwerfiel wie mir – oder noch schwerer –, den alten Bildern zu begegnen.
Ich verlor sie irgendwo diesseits der Portobello Road. »Irgendwo diesseits«, sagte ich, als sei mir diese Gegend nicht zutiefst vertraut, als ließe mich auch nur ein Zoll des Pflasters unberührt, als hätte ich auch nur eine Elle dieser Straßenzüge vergessen. Ich verlor sie in der Ledbury Road und fand sie an der Ecke Portobello wieder, wo sie eine Bekannte getroffen hatte und zu einem Schwatz stehengeblieben war. Und dann sah ich, daß es nicht Bell war, wie mein inneres Ich, das sie mit verbundenen Augen erkannt hätte, von Anfang an gewußt hatte. Die Frau, die ich verfolgt hatte, war älter als Bell, die jetzt fünfundvierzig sein mußte, und die junge Person, mit der sie an der Ecke sprach, war eine kleine pummelige Blondine, deren schrilles Lachen in jener leeren, häßlich-bestrickenden Straße widerhallte. Ich ging an ihnen vorbei und sah, daß der rote Himmel nicht mehr rot war, sondern grau, stürmischgrau und wildbewegt, mit dicken drängelnden Wolken und gewittriger Schwärze über Kensal Town.
Es waren kaum Menschen auf der Straße. Vor zwanzig Jahren war das anders gewesen, als ich zum erstenmal in diese Gegend gekommen war, als ein neuer Überschwang die ganze englische Jugend erfaßt hatte, ganz besonders aber, so fand ich damals, in Notting Hill. Jetzt haben wir statt dessen die Autos, menschenverschlingende Ungetüme, die uns abgekapselt durch die Lande fahren. Hier gibt es Häuser mit Gärten, in denen im Mai die Bäume blühen, und dann riecht es nach Motorenöl und Weißdorn, Geißblatt [13] und Abgasen. Damals, zu Cosettes Zeiten, hatte es nach französischen Zigaretten gerochen, nein, nach allen möglichen Zigaretten, französischen und englischen und russischen. Und im Electric Cinema nach Marihuana. Ich ging weiter, nicht den Weg, den ich gekommen war, sondern südlicher, über Chapstow Villas, und ich wußte genau, wo ich war, keine Rede davon, daß ich zufällig dorthin geraten sei, daß ich Archangel Place in dieser Richtung nicht vermutet hätte.
Doch ich dachte an Bell, während ich meinen Weg fortsetzte, und überlegte, wer mich zu ihr führen, wer Bescheid wissen könnte. Nach wie vor war ich davon überzeugt, daß sie nach Hause gefahren, daß sie höchstwahrscheinlich inzwischen zu Hause angekommen war. Es war mein Anblick vor dem Lift gewesen, der sie zur Eile angetrieben, sie vielleicht sogar bewogen hatte, sich zu verbergen. Sie brauchte nur im Coburg Hotel oder auch im U-Bahnhof Bayswater zu verschwinden, und schon war sie mir entwischt. Und natürlich wohnte sie nicht in Notting Hill, sondern irgendwo in Bayswater. Irgend jemand mußte ja ihre genaue Adresse haben. Aber daß sie mir hatte aus dem Weg gehen wollen… Ich, die ich Fußwege nach Möglichkeit vermeide, war gerannt, war der richtigen und der falschen Bell nachgerannt, und meine Beine fingen an zu schmerzen.
Es gibt kein Entkommen vor diesem Gefühl, daß es jetzt vielleicht soweit ist, daß es sich nicht um eine natürliche Erschöpfung, sondern um die erste Vorwarnung handelt, und das gewohnte Unbehagen überkommt mich, die gewohnte zitternde Angst. Ich bin noch nicht so alt, daß die Gefahr [14] überwunden wäre, noch ist die rettende Grenze nicht erreicht. Aber was ist das doch für ein Stumpfsinn, wie fad, wie gleichbleibend und schlicht langweilig nach all den Jahren, und doch – wie kann etwas gleichzeitig Stumpfsinn und Schrecken sein? Ich habe es niemandem erzählt außer Bell und Cosette. Das heißt, Cosette wußte es natürlich schon. Ob Bell sich erinnert? Ob es ihr eingefallen ist, als sie mich auf dem Bahnhof sah? Hat sie sich gefragt, ob ich es schon habe oder ob es an mir vorbeigegangen ist und mich verschont hat?
Ich sagte mir das, was ich mir immer sage, die Beine tun dir weh, weil du dich nicht fit hältst (dein Kinnmuskel zuckt, weil du müde bist, das Glas ist dir aus der Hand gefallen, weil du nicht aufgepaßt hast). Selber schuld, dachte ich, daß du auf hohen Absätzen herumläufst und in spitzen Schuhen, die dir die Zehen einzwängen. Es half nicht viel, nichts hilft, außer dem Nachlassen des Schmerzes, des Tics, der Schwäche…
Ich halte das nächste Taxi an, sagte ich mir, das, aus einem Crescent oder einer Terrace kommend, um eine dieser laubreichen Ecken biegt, denn dieser Teil von London West Eleven ist ein eng verflochtenes Gewirr, ein Labyrinth von Gassen und Höfen, windverwehten Feldern und blumenbepflanzten Plätzen, grüner Lust und grauem Gram.
Kein Taxi ließ sich sehen, und ich belog mich selbst, als ich mir sagte, ich hätte eins genommen, wenn es gekommen wäre. Ich hatte jetzt die schmale Straße erreicht, die zu den Mews und von dort zum Archangel Place führt. Trotz tiefhängender Zweige und dichter Hecken könnte man sich auf [15] diesem Sträßchen nie einbilden, auf dem Land zu sein. Es ist mit Schiefer gepflastert, die Platten sind blankgewetzt von Stadtschuhen und ihrem Abrieb, die Hecke besteht aus Ligusterbüschen, die Bäume sind Stadtpflanzen wie der Trompetenbaum. Es riecht nach Stadt, verbraucht und muffig, und unter den Füßen spürt man nicht Erde, sondern Staub. Zwischen den Mews und der Straße steht die viktorianisch-byzantinische Kirche zum Hl. Erzengel Michael, sie ist unverändert, nicht geschlossen und vernagelt, nicht in einem dieser leicht blasphemischen Verwandlungsprozesse zu Wohnungen umfunktioniert, genau wie früher stehen die Türen weit offen, so daß man im Altarraum den Erzengel mit seinen ausgebreiteten Flügeln sieht.
Ich blieb an der Ecke stehen, beugte mich vor, um meine Wadenmuskeln zu massieren, dann blickte ich hoch, richtete mich auf und sah in die schmale, gerade, ziemlich kurze Straße hinein. Von hier aus schien auch das Haus der Stufen unverändert. Inzwischen aber war die Dämmerung gekommen, die lange, düster-kühle Londoner Sommerdämmerung, die Veränderungen verhüllen mochte. Langsam und gemächlich, wie eine Spaziergängerin, ging ich auf der anderen Straßenseite entlang. Als Cosette noch dort wohnte, saßen überall Leute unter den Türen, und wenn es warm war, lagen sie auf den Flachdächern der Vorbauten und sonnten sich. Inzwischen aber hatte Archangel Place sich tüchtig gemausert, vermutlich waren jetzt hinter den niederländischen, viktorianisch-barocken, neugotischen und Bayswater-palladianischen Fassaden geschmackvolle »Luxusaltbauwohnungen« mit dickem Teppichboden und tief gehängter Decke und Isolierverglasung. [16] Auch Nummer Fünfzehn war offenbar von dieser Entwicklung nicht verschont geblieben, denn an der Stelle, wo Cosettes verbogener schmiedeeiserner Klingelzug gehangen hatte, prangte nun eine Gegensprechanlage mit einer Reihe von Namensschildchen.
Wie war ich nur auf den abwegigen Gedanken verfallen, auf einem könne Bells Name stehen? Ich überquerte eigens die Straße, um nachzuschauen. Das Haus der Stufen war in sechs Wohnungen aufgeteilt worden, vom Souterrain bis zum Dach war jedes Stockwerk rationell genutzt, die Bewohner hatten griechische und arabische Namen, einer mochte dem Klang nach ein Franzose sein, ein Inder war dabei und eine deutsche Jüdin (oder Amerikanerin). Keine Spur von Bell. Natürlich nicht. Das Haus hatte eine andere Farbe. Von der Ecke aus hatte man es nicht erkennen können, jetzt aber bemerkte ich diesen neuen, zweifelhaften Ton, der bei Tageslicht ganz anders sein mochte als jetzt im Schein der Straßenbeleuchtung, ein ziemlich dunkles Braun. Als Cosette das Haus gekauft hatte, war es kohlblattgrün gestrichen gewesen, nur die Steinmetzarbeiten hatte man, wie jetzt auch, in ihrem natürlichen Beigeton belassen. Die Fenster, fünf Reihen oberhalb, eine unterhalb der Grundlinie, kann man in Ruskins Die Steine von Venedig nachschlagen, auf der Tafel, die das Maßwerk im Broletto von Como zeigt. Ob der Architekt hingefahren ist und es sich angesehen, oder ob er einfach die Fenster bei Ruskin kopiert hat, weiß ich nicht, aber es sind sehr getreue Nachbildungen, jedes Fenster besteht aus drei Bögen mit einem Knoten wie ein Webeleinstek auf halber Höhe der Doppelschäfte, die [17] von korinthischen Kapitellen gekrönt werden. Anhand der Abbildung kann man es sich besser vorstellen.
Hinter den Fenstern brannte Licht, und nicht überall waren die Vorhänge zugezogen. Ich ging wieder auf die andere Straßenseite und postierte mich unter einer der Platanen am Straßenrand. Von den welkenden Blüten wehte das helle flaumige Zeug, das bei Perpetua, wie sie immer behauptete, Heuschnupfen auszulösen pflegte. Die neuen Besitzer oder die Architekten hatten die Haustür erneuert. Die aus Cosettes Zeit hätte bestimmt auch Ruskin genehmigt, sie hatte einen Spitzbogen, und die Türfüllung war zwischen schlanken Leisten mit Ähren und Eichenlaub verziert. Die neue Tür war eine neogeorgianische Scheußlichkeit, in dem gebogten Abschluß des Architravs prangte eine Rubinglasscheibe. Unverändert war nur der Garten, das heißt der Vorgarten, denn was hinter dem Haus lag, konnte ich von meinem Standort aus nicht sehen.
Es ist ein ganz kleines Gartenstück, das zwischen dem Gehsteig und dem tiefen Einschnitt des Souterrainfensters liegt. Charakteristisch für die Flächen vor wie hinter dem Haus war seit jeher der Grauton: graue Blüten und graues Laub, Zinerarien und Mannstreu, Hasenohr, Lavandula lanata – der silberne Zwerglavendel –, Lychnis coronaria mit Blättern wie Filz, Karden, die Schwestern der Artischocke, Artemisien mit ihrem filigranen Laub, Gottvergeß und Kreuzkraut, auch Greiskraut genannt. Ich, die ich keine Ahnung von Gärten hatte, lernte nach und nach, wie die Pflanzen in Cosettes Garten hießen. Jimmy, ihr Gärtner, brachte es mir bei, er war überglücklich, daß sich [18] jemand dafür interessierte, und die Namen haben sich bei mir festgesetzt. Ob Jimmy noch kommt? Die Lanata ist furchtbar empfindlich, sagte er immer, die käme ohne meine Pflege nie durch. Die Pflanzen sahen sehr gut aus, fand ich, und die hellsilbrigen Schwertlilien standen in voller Blüte, ihre papierdünnen Blütenblätter schimmerten im grünlichen Lampenlicht.
Ohne ihn gesehen zu haben – und mir war klar, daß ich den Anblick nicht ertragen hätte –, wußte ich, daß der Garten hinter dem Haus nicht so sein würde wie früher, daß er grundlegend verändert sein mußte. Wer immer das Haus nach Cosette – und nachdem ich es nicht hatte haben wollen – gekauft hatte, war mit Sicherheit im Bilde gewesen, war diskret informiert worden und hatte wohl beschlossen, sich mit den Fakten abzufinden und mit ihnen zu leben. Gleichzeitig aber mußte der Wunsch erwacht sein, den Garten, die ganze Anlage zu verändern, vielleicht strengen Buchs zu pflanzen, spitze Koniferen, bunte Blumen, um damit die Geister zu bannen, die, wie es heißt, durch die Energie freigesetzt werden, die nach einer Gewalttat am Ort verbleibt.
Ich versuchte zwischen den Häusern hindurchzusehen, mit meinem Blick Backsteinmauer, hohe Hecke, schwarze, nahezu kompakte immergrüne Laubmassen zu durchdringen. Wäre der Eukalyptusbaum noch dagewesen, hätten seine dünnen Zweige mit den zarten spitzen grauen Blättern jetzt Ilex und Lorbeer weit überragen müssen, denn Gummibäume sind schnellwüchsig, wie Jimmy mir einmal erklärte. Hätte es den Baum noch gegeben, hätte er jetzt fast an das hohe Fenster herangereicht. Nein, er war nicht mehr [19] da, konnte nicht mehr da sein, und ehe ich den Blick abwandte, stellte ich mir vor, wie er gefällt worden war, sah seinen Sturz vor mir, hatte den kräftigen Medizingeruch in der Nase, der von den welkenden Blättern, dem durchtrennten Stamm ausging.
An der Fassade sind nur zwei Balkone, einer vor den Fenstern des Salons, der andere vor dem sogenannten Elternschlafzimmer, Nachbauten der Balkone von Ca’ Lanier mit wulstiger Basis, fast wie Körbe. Diesen Jünger Ruskins hatte ein Stilmischmasch offenbar nicht gestört. Unvermittelt öffnete sich das mittlere Fenster des Salons, und ein Mann kam auf den Balkon, um eine Topfpflanze hereinzuholen. Er sah nicht in meine Richtung, sondern auf seine Pflanze, und beim Hineingehen schob er den Vorhang zur Seite, und ich konnte einen Blick in ein goldleuchtendes Interieur tun, bestehend vornehmlich aus einem sehr kleinen funkelnden Lüster und einer dunkelroten Wand in einem Abstand von wenig mehr als drei Metern hinter dem Fenster, mit Spiegeln und weißgerahmten Bildern. Ich spürte den Schock wie einen Schlag gegen den Leib. Dabei wußte ich natürlich, daß man den Salon geteilt hatte, daß jetzt – denn er war zehn Meter lang gewesen – vermutlich eine ganze Wohnung daraus geworden war. Der Vorhang fiel, das Fenster schloß sich wieder. Plötzlich erinnerte ich mich sehr deutlich daran, wie ich nach längerer Abwesenheit, nach einem Besuch in Thornham vielleicht, zurückgekommen war, ich sah mich die Treppe hinaufgehen, den Salon im ersten Stock betreten, wo Cosette am Tisch saß und mir sogleich den Kopf zuwandte, wie ihr warmherziges Lächeln das leicht [20] melancholische Gesicht verwandelte, wie sie mit ausgestreckten Armen aufstand und mich mit ihrer unerschöpflichen Liebe umfing.
»Hast du dich gut amüsiert, mein Schatz? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du uns allen gefehlt hast.«
Wie immer wartete in dem Durcheinander auf dem Tisch ein Geschenk auf mich, eine liebevoll ausgesuchte Willkommensgabe, das Erdbeernadelkissen vielleicht oder eins der Halbedelsteineier. Eingewickelt in wunderschönes Geschenkpapier, kostbar wie ein William-Morris-Stoff, mit Satinband umwunden, von einer zufälligen Berührung nach ihrer Haut, ihrem Kleid duftend.
Ich hatte die Augen fest zugemacht, hatte sie unwillkürlich geschlossen, als der Mieter oder Besitzer der Wohnung im ersten Stock mir einen Blick auf sein Wohnzimmer gestattete und ich mir Cosette dorthin gezaubert hatte, wo jetzt die rote Wand war. Ich machte die Augen wieder auf, warf einen letzten Blick auf das veränderte, verwandelte, verschandelte Haus und wandte mich ab. Inzwischen war es dunkel geworden, und während ich in Richtung Pembridge Villas ging, aus einem unbestimmt melodramatischen Gefühl heraus keinen Blick mehr zurückwerfend, kam ein Taxi aus einer der Mews, und ich stieg ein. Seltsam erschöpft und ausgepumpt ließ ich mich auf die glatten Sitzpolster fallen. Und Bell? Hatte ich sie vergessen? Nein, die Erinnerung an Cosette und all die anderen Empfindungen, die durch das Haus der Stufen geweckt worden waren, hatten sie nur zeitweilig aus meinem Gedächtnis verdrängt. Vergessen hatte ich nur den Schmerz in meinen Beinen, und der war jetzt verschwunden. Ich war [21] begnadigt, Stumpfsinn und Schrecken waren für ein, zwei Wochen gebannt.
An Bell konnte ich jetzt ruhiger, abgeklärter denken. Vielleicht war es ganz gut, daß ich sie verloren hatte, daß es nicht zu einer Konfrontation gekommen war. Wieder überlegte ich, ob sie mich über die Köpfe im Aufzug hinweg gesehen hatte, und wieder konnte ich mir nicht darüber klar werden. War sie vor mir geflohen, oder hatte sie, ohne zu wissen, daß ich ihr nachlief, den Bahnhof verlassen und war geradewegs in eins der Geschäfte auf der Queensway gegangen? Es war sogar denkbar – und das war beruhigend –, daß sie hinter mir hergegangen war, ohne zu wissen, wer ich war. Oder unbekümmert darum, daß ich es war? Auch dieser Möglichkeit würde ich mich stellen müssen.
Vielleicht legte sie keinen Wert auf Bekannte aus jenen Tagen, wollte mit neuen Freunden, neuen Interessen einen neuen Anfang machen. Eine Bestätigung für diese Ansicht war, wie ich mir jetzt sagte, daß sie ihr Zuhause in Bayswater oder Paddington hatte, in einer Gegend also, in der sie, soviel ich wußte, vorher nie gewohnt hatte.
All das änderte nichts an meinem Entschluß, nach ihr zu suchen. Ich würde feststellen, wo sie war und wie sie lebte und wie sie sich jetzt nannte, ich würde versuchen sie zu sehen – auch wenn nicht mehr daraus werden sollte. Ein wenig sank mir der Mut, wenn ich an die Jahre im Gefängnis dachte, soweit ich sie mir überhaupt vorstellen konnte, an das vergeudete Leben, die verlorene Jugend. Und wie ich in einer Art Vision Cosette an ihrem Tisch im Salon gesehen hatte, der wie immer vollgepackt gewesen war mit Büchern und Blumen, Papier und Nähzeug, Telefon, Brillengläsern [22] und Trinkgläsern und Photos und Postkarten und Briefen in Briefumschlägen, so schien es mir, als erblickte ich Bell, wie ich sie zum ersten, nein, fast zum ersten Mal gesehen hatte, als sie plötzlich in der Halle von Thornham stand und uns eröffnete, daß ihr Mann sich erschossen hatte.
[23] 2
Ich war vierzehn, als sie es mir sagten. Sagen mußten sie es mir, das war schon richtig, aber vielleicht hätten sie es noch ein paar Jahre hinausschieben können. Was waren schon vier Jahre? In diesen vier Jahren hätte ich kaum geheiratet, hätte schwerlich ein Kind bekommen.
So formulierte ich es, als ich Bell die Geschichte erzählte. Sie ist die einzige, der ich sie je erzählt habe. Elsa kennt sie nicht, nicht einmal mein geschiedener Mann Robin kennt sie. Nur Bell schüttete ich mein Herz aus, an einem dunklen Wintertag im Haus der Stufen, nicht oben in dem Zimmer mit dem hohen Fenster, sondern auf der Treppe sitzend, beim Wein.
Die Krankheit meiner Mutter war äußerlich nicht erkennbar, es stand noch nicht einmal fest, ob meine Mutter erkrankt war, jedenfalls körperlich. Psychische Veränderungen – so hieß es in den Lehrbüchern über ihren Zustand – konnten alles mögliche oder gar nichts bedeuten. Aber sie hatten sich auf vierzehn Jahre versteift, und daran hielten sie sich und sagten es mir, nicht am Geburtstag selbst wie bei den Helden oder Heldinnen einer Romanze, die in einem bestimmten Alter in Sippenrituale, in Familiengeheimnisse eingeweiht werden, sondern zwei Monate später, an einem nassen Sonntagnachmittag. Sie müssen gewußt haben, daß es mich erschrecken, mich unglücklich machen würde. Aber war ihnen klar, was für ein Schock es war? Konnten sie [24] sich nicht vorstellen, daß ich mich durch dieses Wissen von normalen Menschen so abgesondert fühlen würde wie mit einem Buckel oder als hätte ich soeben erfahren, daß ich einmal über zwei Meter groß werden würde?
Ich begriff nun, warum ich ein Einzelkind war, nicht aber, warum ich überhaupt das Licht der Welt erblickt hatte. Eine Weile machte ich ihnen Vorwürfe, daß sie meine Geburt zugelassen hatten, daß sie leichtsinnig gewesen waren, obwohl sie damals schon Bescheid gewußt hatten. Und einige Zeit – lange Zeit! – wollte ich sie nicht mehr als Eltern haben, hätte ich sie am liebsten nicht mehr gekannt. Daran änderte auch nichts, daß die Krankheit meiner Mutter rasch fortschritt. Nie ist der Mensch so kompromißlos unbarmherzig wie als Heranwachsender. Ich kehrte mich von meinen Eltern und ihrem Geheimnis ab, von meiner Mutter mit ihren verkorksten Genen, von dem Vater, der wachsam und angespannt auf erste Anzeichen wartete, und hielt Ausschau nach einem Menschen, der gütig war, der mir nicht wehtat. Ich fand Cosette.
Ich kannte Cosette von klein auf. Sie war mit einem Vetter meiner Mutter, mit Douglas Kingsley, verheiratet, und weil wir – naheliegenderweise! – eine kleine Familie sind, rückten die wenigen Verwandten in London enger zusammen. Außerdem wohnte sie ganz in der Nähe, relativ nah zumindest, zu Fuß zu erreichen, wenn man bereit war, einen längeren Fußweg in Kauf zu nehmen, und das machte mir wohl damals nichts aus. Sie wohnte in der Wellgarth Avenue in Hampstead, fast schon in Golders Green, mit Blick auf die Teiche und die Wildwood Road. Das Haus im Tudorstil der dreißiger Jahre, ein riesiger Kasten für zwei, [25] sollte nach dem Willen des Architekten wie eins dieser Fachwerkbauernhäuser auf dem Lande aussehen, wirkte aber in dieser Rolle nicht recht überzeugend. Wenn jemand zu Douglas sagte, Garth Manor sei doch recht groß für nur zwei Personen, erwiderte er schlicht und ohne daß man es ihm auch nur im mindesten übelnehmen konnte: »Die Größe eines Hauses hängt nicht von der Größe der Familie ab, sondern von Status und Stellung seines Besitzers. Es ist ein Spiegelbild seines Erfolgs.«
Douglas war ein Erfolgsmensch, ein reicher Mann. Jeden Morgen ließ er sich in seinem dunkelgrünen Rolls-Royce in die Stadt fahren, reihte sich in die schon in den fünfziger und sechziger Jahren lange Autoschlange ein, die sich schwerfällig den Rosslyn Hill hinunterbewegte. Er saß im Fond und las, die Brille mit den dicken Gläsern und der schweren dunklen Fassung auf der Nase, in seinen Akten, während der Fahrer sich durch den dichten Verkehr kämpfte. Douglas hatte eisgraues Haar und ein eisgraues Kinn und trug ebensolche Anzüge, nur hin und wieder zog sich ein feiner weinroter oder ein dunkelgrüner Nadelstreifen durch das eisgraue Tuch. Sein und Cosettes Leben war fest im oberen Mittelstand verankert, zu dem sie sich auch ganz offen bekannten. Als ich älter war und diese Dinge aufmerksamer beobachtete, dachte ich, daß man den Eindruck gewinnen konnte, Douglas habe in jüngeren Jahren eine lange Liste, ja, vielleicht sogar ein ganzes Kompendium von Sitten und Gebräuchen des oberen Mittelstandes aufgestellt und sich daraus als Richtschnur für sein Leben all das ausgewählt, was besonders fade, verbreitet und beliebt und überdies [26] besonders dazu angetan war, die Zustimmung reaktionärer oder konventioneller Kreise zu finden.
Das alles schlug sich in den Zeitschriften auf Cosettes Couchtisch nieder – The Tatler, The Lady, Country Life –,im Essen (nirgendwo sonst habe ich einen derart enormen Verbrauch von Räucherlachs erlebt), in der Garderobe von Burberry, Aquascutum und Scotch House, in seinem Rolls-Royce und ihrem Volvo, den Urlaubsreisen nach Antibes und Luzern und später, Anfang der sechziger Jahre, in die Karibik. Selbstverständlich sah ich das mit vierzehn nicht so, obschon mir natürlich nicht verborgen blieb, daß sie reich waren. Wenn ich mir überhaupt Gedanken darüber machte, so dachte ich, daß sich beide für diese Lebensform freiwillig, ja, freudig entschieden hatten. Erst später begriff ich, daß die Wahl Douglas getroffen hatte und nicht Cosette.
Meine Besuche bei ihr begannen in dem Sommer, als meine Eltern mir eröffnet hatten, welches Erbe auf mir lastete. Sie lud mich zu sich ein, als sie uns besuchen kam. Ich war noch ein Kind, aber sie sprach mit mir – wie mit allen – von gleich zu gleich, in ihrer lächelnd-unbestimmten, zerstreuten Art.
»Komm doch nächste Woche mal vorbei, Liebling, und sag mir, was ich mit meinem Garten machen soll.«
»Von Gärten versteh’ ich nichts.« Ich denke mir, daß es mißgelaunt klang, denn damals hatte ich immer schlechte Laune.
»Meine Lilien kommen zwar, aber sie stehen nicht besonders gut, ein Jammer bei diesen wunderschönen Namen, Gleaming Daylight und Golden Dawn und Precious[27] Bane. Im Katalog steht: ›Gedeihen in jedem Gartenboden, vertragen Nässe wie Trockenheit, volle Sonne oder Halbschatten…‹, aber bei mir kommt das irgendwie nicht hin.«
Ich sah sie gelangweilt und ablehnend an. Ich hatte Cosette immer gern gehabt, weil sie auf mich einging, ohne Getue zu machen oder mich auszufragen, aber an diesem Tag haßte ich die ganze Welt. Seit vierzehn Jahren geschah mir bitteres Unrecht, ohne daß ich etwas davon gewußt hatte, und dafür galt es Rache zu nehmen.
»Wir brauchen nichts zu tun«, sagte Cosette, der offenbar die Aussicht auf süßes Nichtstun besonders verlockend erschien. »Ich meine, wir brauchen nicht zu graben oder zu pflanzen oder uns die Hände schmutzig zu machen. Wir setzen uns einfach hin und trinken etwas und machen Pläne.«
Sie hatten ihr gesagt, daß ich Bescheid wußte, und sie ging sehr behutsam mit mir um. Später hatte sie einfach Freude daran, mit mir zusammen zu sein, da ging es nicht mehr darum, mir einen Gefallen zu tun. Damals aber war ich nur eine junge Verwandte, der man eine schwere Last auferlegt hatte und der zu helfen sie hier eine einzigartige Gelegenheit sah. So war Cosette. Sie begrüßte mich herzlich in Garth Manor bei jenem ersten Besuch, wir hatten es uns draußen bequem gemacht, auf Gartensitzmöbeln, wie sie sonst niemand aus unserer Bekanntschaft hatte, sacht unter Baldachinen schwingenden chintzbezogenen Sitzbänken, Korbsesseln mit hoher Rückenlehne, die Cosette »Pfauen« nannte.
»Weil sie angeblich wie der Pfauenthron aussehen, aber ohne die Juwelen und all das. Ich hätte zu gern ein [28] Pfauenpaar gehabt, das hier herumstolziert. Stell dir mal das Männchen vor mit seinem prachtvollen Gefieder! Aber Douglas konnte sich für die Idee nicht begeistern.«
»Warum nicht?« fragte ich, und schon grollte ich ihm ihretwegen, schon sah ich ihn als grausamen, tyrannischen Gatten.
»Sie kreischen. Das wußte ich nicht, sonst hätte ich es natürlich gar nicht erst vorgeschlagen. Sie kreischen bei Tagesanbruch, man kann die Uhr nach ihnen stellen.«
Unter einem großen weißen Sonnenschirm stand ein weißer Rattantisch mit Glasplatte. Perpetua brachte uns in Schokolade getauchte Erdbeeren und Limonade aus echten Limonen in Gläsern, die durch irgendeinen Kunstgriff mit echtem Rauhreif beschlagen waren. Cosette rauchte Zigaretten aus einer langen Schildpattspitze. Sie sagte mir, wie sehr ihr mein Name gefalle. So hätte sie ihre Tochter genannt, wenn sie je eine Tochter gehabt hätte. Von ihr erfuhr ich, wie es kam, daß der Name Elizabeth durch die Jahrhunderte hindurch in England nichts an Beliebtheit eingebüßt hatte. Später habe ich mir oft überlegt, wieviel Mühe es ihr gemacht haben muß, diese und viele andere Informationen zusammenzutragen, nur um mir eine Freude zu machen und mir die Befangenheit zu nehmen.
»Denn wenn man ihn leise vor sich hinsagt, klingt der Name ganz eigenartig, findest du nicht? Ebenso eigenartig wie die anderen aus dem Alten Testament, Mehetabel oder Hepsibah oder Sulamith, und die hätten alle ebenso modern werden können wie Elizabeth, wenn man eine Königin so getauft hätte. Elizabeth wurde durch Elizabeth die Erste populär, und die war nach ihrer Urgroßmutter Elizabeth [29] Woodville so genannt worden, die Eduard der Vierte zur Frau genommen hatte, da kannst du mal sehen. Vorher war er genauso selten wie die anderen.«
»Cosette muß sehr selten sein.«
»Es heißt ›kleines Ding‹. Meine Mutter hat mich so genannt, und der Name ist mir geblieben. Leider bin ich inzwischen kein »kleines Ding‹ mehr. Soll ich dir verraten, wie ich wirklich heiße? Cora. Scheußlich, nicht? Du mußt mir versprechen, daß du es nicht ausplauderst. Bei der Trauung habe ich den Namen laut vor allen Leuten gesagt, das ging nicht anders. Aber danach nie wieder.«
Ich überlegte, weshalb ihr Douglas wohl einen Verlobungs- und Trauring geschenkt hatte, der nur aus Silber war. Damals hatte ich noch nichts von Platin gehört. Platin war zu der Zeit, als Cosette geheiratet hatte, gerade in Mode gekommen. Die großen Brillanten wirkten düster in der dunkelgrauen Fassung. Nagellack war damals alles, was sich Cosette auf kosmetischem Gebiet leistete, die Nägel leuchteten in sattem Rosarot wie einer der Lilientuffs. Die Geste, mit der sie hindeutete, war von einer ganz eigenen Anmut, irgendwie schwanengleich. Nein, das ist albern, Schwäne deuten nicht. Aber in unserer Vorstellung bewegen sie sich mit langsamen, fließenden Bewegungen, in anmutiger Haltung, und auch das war Cosette.
Das Beet, auf das sie zeigte, war halbmondförmig angelegt, und die Lilien mit ihren roten, gelben und schneeweißen, mokkafarben getüpfelten Blüten sahen schlechthin vollkommen aus, fand ich. Der Gärtner hatte sie gepflanzt und pflegte sie. Cosette mochte in Haus und Garten die Oberleitung haben, aber nie habe ich sie eigenhändig [30] irgendeine Hausarbeit verrichten sehen. Nie habe ich gehört, daß jemand – nicht einmal mein Vater, der gern krittelte – sie faul genannt hätte, und doch war sie es. Sie verbrachte ihre Tage in lächelnd-lässigem, unangreifbarem Müßiggang. Ihre Fähigkeit, absolut nichts zu tun, schien unbegrenzt. Dabei machte sie wunderschöne feine Handarbeiten, sie konnte zeichnen und malen, am liebsten aber saß sie stundenlang still da, ohne zu lesen, ohne Stift oder Nadel in die Hand zu nehmen, ganz in sich ruhend, mit sanftem, heiterem Blick. Denn damals – sie muß ein wenig älter gewesen sein als ich jetzt, etwas über vierzig – hatte sie noch nicht jenen schwermütigen Gesichtsausdruck, den ich schon einmal erwähnt habe. Simone de Beauvoir klagt in ihren Erinnerungen über das Alter, weil es das Gesicht schlaff werden läßt, so daß es traurig wirkt. Es war diese Erschlaffung der Gesichtsmuskeln, die Cosette später – wenn sie nicht gerade lächelte – einen fast tragischen Ausdruck verlieh.
Für mich war sie damals alt. So alt, daß sie fast schon einer anderen Gattung anzugehören schien. Unvorstellbar, daß ich einmal so alt wie sie werden könnte – und, so dachte ich hin und wieder verbittert, auch sehr unwahrscheinlich. Sie war zu jener Zeit eine große blonde Frau, übergewichtig, ja, dick, allerdings hatte ich nicht den Eindruck, daß der Gedanke an ihr Gewicht sie damals beschwerte. Die blassen, graublauen Augen schienen einen unsicher, melancholisch, vielleicht auch scheu zu mustern. Denn in Cosette steckte Schüchternheit ebenso wie eine souveräne Großherzigkeit.
»Dann meinst du also, daß meine Hemerocallis sich dort wirklich wohlfühlt, Liebling?« fragte sie. Auch wenn sie nie eine Pflanze setzte, nie das Unkraut jätete, das ihre Blumen [31] bedrohte, so wußte sie doch eine jede beim Namen zu nennen. Ich sagte nichts, aber sie ließ sich nicht abschrecken. »Wahrscheinlich bin ich zu ungeduldig und erwarte wer weiß was von den armen Dingern, nachdem sie erst ein halbes Jahr an ihrem Platz stehen.«
Selbst ich, trotz meiner Jugend, trotz meines Jammers, mußte lächeln bei der Vorstellung, Cosette könne ein ungeduldiger Mensch sein. Ruhe war der Kern ihres Wesens. Eben dieser fast orientalischen Abgeklärtheit wegen war mir – und nicht nur mir! – immer eine Last von der Seele genommen, fühlte ich mich tröstlich eingehüllt in eine linde, besinnliche Stille, wenn wir zusammen waren. Sonderbarerweise kam einem bei ihr immer der Gegensatz dazu in den Sinn, die rastlose Munterkeit so vieler Frauen der Müttergeneration, mit der sie in jungen Leuten wie mir ein Gefühl der Bangigkeit und Unzulänglichkeit weckten. Cosette blieb sich stets gleich, war immer da, nahm immer Anteil, hatte nie etwas Besseres zu tun.
Bald besuchte ich sie mindestens dreimal in der Woche, und später übernachtete ich auch bei ihr. Ich ging in Hampstead Garden Suburb zur Schule, da konnte ich leicht sagen, die Woche über sei es für mich praktischer, bei Cosette zu wohnen, statt jeden Tag zurück nach Cricklewood zu fahren. Jedenfalls erklärte ich es so, obwohl diese Erklärung auf jeden, der die Entfernung zwischen der Henrietta Barnett und Cricklewood Lane kannte, einigermaßen lächerlich gewirkt haben dürfte. Nur die Tatsache, daß es da noch Douglas gab und daß er sich häufig auf Garth Manor aufhielt, hinderte mich daran, mich dort nach Möglichkeit ganz heimisch zu machen. Jeder kennt Ehepaare, von denen [32] einem ein Partner sympathisch, der andere unsympathisch ist. Für mich warf die abendliche Heimkehr von Douglas, angekündigt durch die über den Kies der Auffahrt knirschenden Räder des Rolls-Royce, einen Schatten auf die enge Gemeinschaft, die mich mit seiner Frau verband. Er war so ganz und gar Mann, so ältlich-steif, so typisch Börsianer, so größtenteils unverständlich in seinen Äußerungen, und er schien, ohne es ausdrücklich zu verlangen, in seinem Haus eine gewisse feierliche Ruhe zu fordern, solange er sich darin aufhielt. Und das tat er zumindest an den Wochenenden immer.
An Cosette war keine Veränderung festzustellen, wenn ihr Mann da war. Sie blieb dasselbe sanfte, lächelnde Geschöpf, abgeklärt und überschwenglich zugleich, die Frau mit der großen Gabe des Zuhörens. Seinen Berichten über Geschäftsabschlüsse und Verhandlungen schenkte sie die gleiche ungeteilte Aufmerksamkeit wie meinen Ergüssen über Träume, Visionen, Enttäuschungen und Ärgernisse. Und sie hörte wirklich zu, es war nicht so, daß sie einfach abschaltete und ihre Gedanken anderswo spazierenführte. Ich staunte über ihre klugen Antworten auf seine rätselhaften Schimpftiraden und beobachtete argwöhnisch und verständnislos, wie sie sich aus ihrem Sessel erhob, schwanengleich durchs Zimmer glitt und eine rundlichweiße Hand sanft an seine Wange legte, wie er daraufhin regelmäßig sein Gesicht in ihre Handfläche schmiegte und einen Kuß hineinhauchte. Das stürzte mich in peinlichste Verlegenheit. Ich weiß jetzt, daß ich Cosette kein eigenes, privates Leben gönnte, das nicht unmittelbar damit befaßt war, das meine leichter und glücklicher zu machen.
[33] Stumpfsinn und Schrecken sprach sie von sich aus nicht an, sondern wartete, bis ich davon anfing. Es kam selten vor, daß Cosette selbst ein Thema anschnitt, Neugier erkennen ließ. Ich sprach davon – nein, es brach leidenschaftlich aus mir heraus –, nachdem ihre Nachbarin, eine gewisse Dawn Castle, mit uns im Garten gesessen hatte, an einem warmen Oktobertag. Die Lilien waren längst abgeblüht, und Cosette und ich bewunderten die späten Dahlien. Dawn Castle sprach ständig von ihren Kindern, wieviel Sorgen sie ihr machten, das Jüngste war gerade von irgendeiner Schule verwiesen worden, ein anderes hatte eine Prüfung nicht bestanden. Sie schloß mit ihrem gewohnten Klischee:
»Trotzdem… Ich möchte sie nicht missen.«
Ich kam nicht auf den Gedanken, daß diese oft wiederholte Bemerkung Cosette weh tun könnte. Ich fand sie nur überaus töricht und sagte rüde: »Warum nicht, wenn Sie sich doch bloß über sie ärgern?«
Sie machte – wer wollte es ihr verdenken! – ein sehr bestürztes Gesicht. »Früher oder später hast du selbst was Kleines, dann sprechen wir uns wieder.«
»Ich werde nie ein Kind haben. Nie.«
Ich hatte sehr schroff gesprochen und spürte Cosettes Blick.
»Ich hätte gern ein Pfund für jedes junge Mädchen, von dem ich das schon mal gehört habe«, sagte Mrs.Castle mit ihrem unfrohen Auflachen, und dann ging sie, denn S|e gehörte zu den Menschen, die sich nur bei seichtem Geplauder wohlfühlen und bei unerquicklichen Themen, wie sie es nennen, schleunigst die Flucht ergreifen.
[34] »Das war aber scharfes Geschütz«, sagte Cosette.
»Es ist gemein«, sagte ich. »Warum denken die Leute nicht nach, ehe sie den Mund aufmachen? Mag ja sein, daß sie nicht weiß, was mit mir los ist. Aber sie weiß doch bestimmt über dich Bescheid, sie weiß, daß Douglas Mutters Vetter ist.«
»Ich habe die Erfahrung gemacht, daß sich niemand die Verwandtschaftsverhältnisse anderer Leute merken kann.«
»Cosette«, sagte ich. »Cosette, hast du deshalb keine Kinder? Hast du dir nie Kinder gewünscht?«
Auf Fragen, die sie nicht ausdrücklich beantworten wollte, pflegte sie mit einem für sie sehr typischen Lächeln zu reagieren. Es war ein leises, geheimnisvolles Lächeln, das sich sanft, fast unmerklich, auf ihrem Gesicht verbreitete, aber fast immer weiteren Nachforschungen einen Riegel vorschob. Aus irgendeinem Grund setzte ich mir damals in den Kopf, Douglas habe Cosette geheiratet, ohne ihr von seiner Erblast zu erzählen. Wohlgemerkt: Diese Ansicht war völlig unbegründet, ich meinte sie in ihrem traurigen Blick, in einer Art Resignation zu lesen. Man hat das oft bei Heranwachsenden, daß sie das Leben älterer Freundinnen mit unerträglich romantischen Schnörkeln versehen. Ich steigerte mich in den Gedanken hinein, Douglas habe Cosette getäuscht, habe ihr Kinder versagt, bis es für sie zu spät war, sich von ihm zu lösen, und habe versucht, sie dadurch zu entschädigen, daß er sie mit Reichtümern überhäufte. Den Winter verbrachten sie in Trinidad, und ich lebte wieder zu Hause, wo ich mich dabei ertappte, daß ich meine Mutter fast klinisch [35] distanziert beobachtete. Einmal ließ sie ein Weinglas fallen, und ich schrie auf. Mein Vater trat zu mir und schlug mir ins
Gesicht.
Es war nur ein Klaps, er hatte nicht wehgetan, aber für mich war es eine tätliche Beleidigung.
»Mach das nicht nochmal«, sagte er.
»Und du mach das nicht nochmal mit mir.«
»Du mußt lernen, dich zu beherrschen, ich habe es auch lernen müssen. In unserer Situation bleibt uns nichts anderes übrig.«
»In unserer Situation? Du bist in einer Situation, ich in einer anderen. Wenn später die Leute schreien, dann doch meinetwegen, nicht etwa deinetwegen.«
Ein starkes Stück für eine Fünfzehnjährige. Im Frühjahr ging ich zurück nach Garth Manor, zu Cosette, von dort konnte ich über die Heath Extension zu Fuß zur Schule gehen, und in meinem großen Zimmer mit Blick auf das Waldland von North End hatte ich so schöne Dinge wie einen eigenen Fernseher, eine elektrische Heizdecke und Telefon am Bett. Allerdings muß ich zu meiner Verteidigung wohl sagen, daß es nicht das war, was mich dorthin zog. Warum sind junge Mädchen in dieser Phase ihrer Entwicklung so gern mit älteren Frauen zusammen? Ich denke, daß es bei mir nicht purer Narzißmus war. Ausschlaggebend, so glaube ich, war nicht, daß die fast dreißig Jahre ältere Cosette keine Konkurrenz darstellte, oder daß mein attraktives Äußeres neben ihrem alternden Gesicht, ihrem alternden Körper besonders reizvoll zur Geltung kam. Denn soviel stand fest: Für mich war sie eine alternde, ja, eine nahezu alte Frau, jenseits von Gut [36] und Böse als weibliches, als sexuelles Wesen. Tatsache war, daß ich Cosette zu meiner zweiten Mutter gemacht hatte, zu einer Mutter, die ich mir ausgesucht hatte, die mir nicht aufgezwungen worden war, zu einer Mutter, die mir zuhörte, unbegrenzt Zeit für mich hatte und mir in großzügiger Weise schmeichelte, was, wie ich bis heute glaube, aufrichtig gemeint war.
Damals schien es ihr nichts auszumachen, daß man sie für meine Mutter hielt. Das kam später, im Archangel Place, da sagte sie es zwar nicht ausdrücklich, aber der Schmerz und die leise Demütigung, die sie empfand, wenn jemand, was häufig geschah, mich (oder Bell oder Birgitte oder Fay) für ihre Tochter hielt, waren in ihren Augen, in dem schwermütigen Zug um den Mund zu sehen. Mrs.Kingsley, Mitglied der Townswomen’s Guild, des Vereins der Wellgarth-Avenue-Bewohner, des Schulvorstands, Mitarbeiterin bei Essen auf Rädern und hin und wieder ehrenamtlich in der Sozialarbeit tätig, war frei von solchen Eitelkeiten. In den Ferien oder am Samstag gingen wir manchmal zusammen einkaufen, und bei Simpson’s oder im Kaufhaus Swan and Edgar, das damals noch die Ecke Piccadilly und Regent Street am Piccadilly Circus beherrschte, sprach mich gelegentlich eine Verkäuferin als Cosettes Tochter an. Ebenso erging es uns in den Restaurants, in denen wir einkehrten, um einen Kaffee zu trinken, den Cosette offenbar alle halbe Stunde zum Überleben brauchte.
»Das würde Ihrer Tochter stehen«, sagte eine Verkäuferin in der Burlington Arcade, und in Cosettes Gesicht trat ein fast anbetender Ausdruck freudiger Zustimmung.
[37] »Ja, das würde dir prächtig stehen, Elizabeth. Probier es doch mal an.« Und dann, wie so oft: »Willst du es nicht nehmen?« Was bedeutete, daß sie es mir kaufen würde.
Damals hatte ich nicht den Eindruck, daß sie jünger erscheinen wollte, als sie war. Aber hätte ich das als Fünfzehnjährige gemerkt? Sie trug maßgeschneiderte Kostüme, was heute undenkbar wäre und auch damals schon als altmodisch galt. Es waren konventionelle Tailleurs aus Stoffen, wie sie sich Douglas für seine Anzüge aussuchte, mit breiten Schultern und Kellerfaltenröcken, sehr unkleidsam für Cosettes Figur. Sie hätte fließende Kleider tragen sollen, Capes mit schönem Faltenwurf. Später hat sie das auch getan, und nicht immer war die Wirkung vorteilhaft. Für sich kaufte sie auf einer solchen Shoppingtour Unterwäsche, grausam einzwängende, wirkungslose Mieder und Unterröcke aus glänzendem, pastellfarbenem Satin, klobige Schnürschuhe mit Blockabsätzen, Blusen mit großen Schleifen, die zwischen den Aufschlägen der Schneiderkostüme hervorsahen.
Als ich älter wurde, betrachtete ich, die ich nie über Cosette ein Urteil gefällt, sondern sie schlicht und bedingungslos geliebt hatte, ihr Aussehen kritischer. Ich sprach nie davon, jedenfalls nicht ihr gegenüber. Leider aber ließ ich bei meinen Freundinnen manchmal eine Bemerkung fallen, und es gab Gekicher in den Ecken. Über Frauen wie Cosette macht man sich insgeheim, hinter ihrem Rücken lustig. Das ist grausam und schmerzlich, aber es ist so. Ich zucke, während ich diese Sätze formuliere. Aber ich bin bemüht, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit, und wahr ist, daß Cosette, wenn ich eine Freundin mit nach Hause [38] brachte (man sieht, daß ich damals Garth Manor als mein Zuhause betrachtete), vielleicht erhitzt und gerötet auf der Bildfläche erschien, oft unordentlich, das Vogelnest aus ergrauendem Goldhaar ein schwankendes Wirrsal aus Flusen und Strähnen, aus dem die Haarnadeln rutschten, die Seidenbluse halb aus dem Bund des zu stramm sitzenden Kostümrocks hängend, und daß wir dann verstohlene Blicke tauschten und ganz leise, verächtlich-milde kicherten.
Häufig, besonders wenn Douglas auf Geschäftsreisen war, lud Cosette mich und eine Freundin nach Hampstead zum Abendessen ein. Vorher aber gab es eine Verschönerungsstunde in ihrem großen, üppigen Schlafzimmer (weißes Himmelbett mit Organzabaldachin, festonierte Vorhänge, gepolsterter Fenstersitz, Frisierkommode mit Organzaröckchen und dreiflügeligem Spiegel), und dort probierten wir unter ihren bewundernden Augen wie kleine Mädchen die Sachen an, die Cosette nicht mehr trug, ihre Pelzcapes und Stolen und Tücher, Gürtel und künstliche Blumen und Schmuck. Ich hütete mich, meiner Begeisterung lauten Ausdruck zu verleihen, denn ich wußte aus Erfahrung, wohin das führen konnte. Meine Freundin aber stieß – aus Unwissenheit oder aus Begehrlichkeit – immer wieder hervor: »Nein, was ist das schön! Phantastisch, nicht? Steht mir das nicht ganz toll?«
»Es gehört dir«, sagte dann Cosette.
Bei der Besichtigung dieser Schätze bekam ich den Blutjaspis zum erstenmal zu Gesicht. Es war ein Ring mit dunkelgrünem Stein und roten Jaspiseinlagerungen in einer Fassung aus dicht ineinander verflochtenen Goldsträngen. Ein Ring für eine kräftige Hand mit langen Fingern, sagte [39] Cosette, und als sie ihn aufsetzte, wirkte er plump an ihrer sehr fraulichen Hand mit den blanken rosafarbenen Nägeln.
»Er hat der Mutter von Douglas gehört«, sagte sie. Ich wußte, was es mit der Mutter von Douglas auf sich hatte und kannte den Grund für ihren viel zu frühen Tod, sagte aber nichts. Ich lächelte nur, ein Lächeln, bei dem die Lippen steif werden, weil man es so mühsam festhalten muß.
»Sie hatte im März Geburtstag«, sagte Cosette, »und Heliotrop ist der Monatsstein für März.«
»Ich dachte immer, Heliotrop wäre eine Blume«, sagte meine Freundin.
Cosette lächelte. »Heliotrop ist alles, was das Gesicht der Sonne zuwendet.«
Ich mag zu ihr nicht so gut gewesen sein, wie sie zu mir war, aber ich habe sie geliebt. Immer. Die Ecken und Kanten der Adoleszenz glätten sich, wenn man auf die Zwanzig zugeht, und wie ich es heute mit bitterstem Schmerz bereue, daß ich nicht mehr Mitgefühl für meine Mutter aufgebracht habe, so schämte ich mich in jener Zeit meines früheren Gelächters und meiner Geringschätzung. Ich war nur froh, daß Cosette davon nie etwas gemerkt hatte. Denn sie verlangte von den Menschen, die sie liebte, nichts anderes, als daß sie ihnen vertrauen konnte. Vielleicht ist das nichts Geringes, vielleicht ist es sehr viel. Ich weiß es nicht, ich könnte es nicht sagen. Sie wollte nur das Gefühl haben, daß sie sich mit Haut und Haar dem geliebten Menschen anvertrauen, sich bei ihm sicher fühlen konnte, ohne Verrat befürchten zu müssen. Viele Jahre später, als ich an der Universität eine Aufführung von The Maid’s Tragedy sah, machten mir [40] zwei Zeilen besonders großen Eindruck, die mich an sie erinnerten: »Es haben die am meisten Macht, uns zu verwunden, die wir lieben. Wir legen unser schlafend Leben ihnen in die Arme.«
Douglas konnte sie vertrauen. Was immer ich mir in früheren Jahren an Zweifeln zusammenphantasiert haben mochte – er hatte sie nie getäuscht. Er hatte sie geliebt, hatte ihr Sicherheit geschenkt, und sie hatte dafür nur das Leben anzunehmen brauchen, das er ihr vorgegeben hatte: Dinnereinladungen bei den Nachbarn, Dinner für die Nachbarn bei ihnen, Sitzungen der Wellgarth Society in ihrem Speisezimmer, Perpetua für den täglichen Hausputz, Maggie zum Kochen, Jimmy zum Unkrautzupfen zwischen den Lilien, Blick auf das North End in der einen, auf die Heath Extension in der anderen Richtung, unerschöpfliche finanzielle Mittel und unendliche Beschaulichkeit, Dawn Castles Stippvisiten mit Platitüden von schnatternden Lippen, eine Ersatztochter und sechs Schlafzimmer. Natürlich war das alles nicht unendlich, alles hat einmal ein Ende. Besonders gern hatte Cosette eine angeblich wahre Geschichte über den sterbenden Buddha, und ich habe oft gehört, wie sie mit ihrer sanften, gelassenen Stimme erzählte:
»Seine Jünger kamen zu ihm und sagten: ›Meister, wir können es nicht ertragen, dich zu verlieren. Wie können wir weiterleben, wenn du uns verlassen hast? Gib uns wenigstens ein Wort des Trostes, das uns helfen mag, wenn du nicht mehr bist.‹ Und der Buddha sagte: ›Es ändert sich.‹«
Dann mußte ich lächeln, denn für Cosette änderte sich nie etwas. So jedenfalls schien es in jenen Jahren, als ich fast die ganze Zeit bei ihr und Douglas verbrachte, als Cosettes [41] Leben eine stete Kette kleiner erfreulicher Obliegenheiten war, ein Leben, in dem es Höhepunkte gab wie die Urlaubsreisen an Orte von konventioneller Exotik und kleine Sensationen wie den Besuch der Schneiderin mit einem neuen Abendkleid für ein Dinner der Gilde oder – wie ich mir egoistisch schmeichelte – meine guten Noten in der Abschlußprüfung. Alles ändert sich, aber in manchem Menschenleben dauert es lange, bis die Änderung eintritt.
An einem Herbstmorgen, als der Verkehr in Hampstead besonders dicht war und der Rolls-Royce in der Schlange vor dem Bahnhof Belsize Park im Stau stand, sah Douglas von der Akte hoch, die er gelesen hatte, lehnte den Kopf an die Rückbank und starb.
Der Chauffeur merkte nichts. Douglas pflegte, sofern nichts Besonderes vorlag, nicht mit ihm zu sprechen, und ein Stau war kein besonderes Vorkommnis. Der Chauffeur hatte von hinten einen Seufzer gehört und ein Geräusch wie ein Räuspern, und dadurch konnten sie später genau bestimmen, wann der Tod eingetreten war. Als sie in der City, in der Lombard Street, angekommen waren, ging der Chauffeur nach hinten, um die Tür aufzumachen, und sah Douglas mit zurückgelegtem Kopf, wie schlafend, im Fond sitzen. Als er ihn berührte, war die Gesichtshaut schon unnatürlich kalt.
Douglas war dreiundfünfzig und deshalb mit ziemlicher Sicherheit über den Zeitpunkt hinweg, da sich seine Erblast hätte bemerkbar machen können. Sein Tod hatte nichts mit dem Familienleiden zu tun, er war schnell und barmherzig gewesen, im Gegensatz zu der langen Qual, die meiner [42] Mutter bevorstand. Eine jähe Gefäßverengung hatte sein Herz zum Stillstand gebracht. Es ist so schnell gegangen, sagte der Arzt zu Cosette, daß er bestimmt nichts gespürt hat.
[43] 3
Sie standen im Regen, Cosette und ihre Brüder und deren Frauen, alle Leidtragenden nebeneinander aufgereiht unter schwarzen Regenschirmen. Douglas hatte natürlich keine Geschwister gehabt. Wir gaben den Brüdern und Schwägerinnen die Hand und küßten Cosette auf die Wange. Ich sah es bei den anderen und tat es ihnen nach. Ich war mit meinem Vater zum Krematorium von Golders Green gekommen, meine Mutter konnte nicht mehr zu Beerdigungen gehen, sie konnte überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Man zeigte mir zahlreiche Verwandte von Cosette, aber außer mir war nur eine Angehörige von Douglas da, unsere gemeinsame Cousine Lilly, Beamtin und unverheiratet, die mit fünfzig so selig darüber war, höchstwahrscheinlich der Geißel entronnen zu sein, daß sie selbst bei einem solchen Anlaß ihre überschäumend heitere Laune kaum im Zaum halten konnte. Sie trat zu meinem Vater und legte ihm eine Hand auf den Arm.
»Sag mal, wie geht’s denn der armen Rosemary?«
Noch nie hat sich jemand in so munterem Ton bei einem Mann nach dem Befinden seiner sterbenden Frau erkundigt. Mich musterte sie mit unverhüllter Neugier, natürlich war ihr nur zu gut bekannt, daß man es nicht bekommt, wenn die Eltern es nicht haben, und daß man nicht erkrankt, wenn der Elternteil, von dem die Gene kommen, bis zum fünfzigsten Lebensjahr gesund geblieben ist.
[44] Perpetua war mit einem erwachsenen Sohn da. Als ich Cosette besuchen ging, hatte Perpetua mir erzählt, daß Cosette geheult und geschluchzt hatte, als man ihr die Nachricht von Douglas’ Tod überbrachte, daß sie hysterisch geweint und mit Selbstmord gedroht hatte. Als ich zu ihr ging, weinte sie. Ich wohnte nicht einmal mehr zeitweise in Garth Manor, denn inzwischen war ich zwanzig und studierte. Wenn man in Regent’s Park studiert, wohnt man, wenn es irgend geht, nicht in Golders Green, aber ich eilte zu Cosette, sobald ich hörte, daß Douglas tot war. Als ich dann da war, wußte ich kaum, wie ich diese Frau trösten sollte, die nichts zu sagen hatte und unablässig weinte. Ich komme aus einer Familie, in der man fast fanatisch darum bemüht ist, keinerlei Emotionen zu zeigen. In diesem Augenblick hätte ich meinen Gefühlen gern freien Lauf gelassen, aber ich wußte nicht, wie man es macht. Eine Freundin, die ich beneidete – eben jene Freundin, die mit so einträglichen Folgen Cosettes Schmuck bewundert hatte, eine gewisse Elsa, die wir natürlich die Löwin nannten –, erzählte mir, daß sie ihre ganze Kindheit hindurch die Eltern nur keifend und einander beschimpfend erlebt hatte, hemmungslos zankend und Gift und Galle speiend, aber zumindest, meinte Elsa, hätten sie keinen Hehl aus ihren Gefühlen gemacht, und so habe auch sie selbst gelernt, aus sich herauszugehen.
Ich behielt Cosette ein wenig ängstlich im Auge, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen, und hatte keine Ahnung, was ich sagen oder tun sollte. Jetzt, eine Woche danach, war ihr Gesicht immer noch rot, die Augen immer noch verschwollen. Unter dem Schirm ihres älteren Bruders stehend, Kränze und Kreuze aus triefenden Blumen zu [45] Füßen, sah sie aus, als habe sie noch bis zum Eingang der Kapelle geweint, als habe sie erst dann jäh aufgehört, als man Douglas’ Sarg hatte verschwinden lassen, um ihn den Flammen zu übergeben. Sie war ganz in Schwarz, nicht in einem ihrer zeitlosen Schneiderkostüme, sondern in einem New-Look-Zweiteiler aus der Nachkriegszeit, womöglich aus dem Jahr meiner Geburt, mit langem Glockenrock, dessen Reißverschluß sich bestimmt nicht mehr hatte schließen lassen, und einer Schößchenjacke. Vermutlich hatte sie das Stück zur Beerdigung ihrer Mutter gekauft, die in jenen Jahren gestorben war. Es roch nach Mottenkugeln. Cosette war eine reiche Frau, sie hatte von Douglas etwa eine Million geerbt – für 1967 eine ungeheure Summe –, aber sie hatte es nicht für nötig gehalten, sich zur Beerdigung ihres Mannes ein neues Kostüm zu kaufen. Sie kann Schwarz nicht leiden, sagte Perpetua später zu mir. Sie mag kein Geld für etwas aus dem Fenster werfen, was sie nie wieder anziehen wird.
Damit hatte Cosette mich zum erstenmal überrascht. Es war der Vorläufer vieler weiterer Überraschungen, die mich noch erwarteten.
Es gab Spekulationen darüber, was sie jetzt tun sollte. Inzwischen weiß ich, daß Verwandte und Nachbarn mit Ratschlägen für eine Frau in ihrer Lage rasch bei der Hand sind, daß sie aber nie das vorschlagen, was sie selbst gern tun würden. Bei den von ihnen vorgebrachten Plänen scheint es vor allem darum zu gehen, daß die so fürsorglich Beratene keine Dummheiten macht.
Weniger anfällig für Dummheiten als Cosette konnte [46]