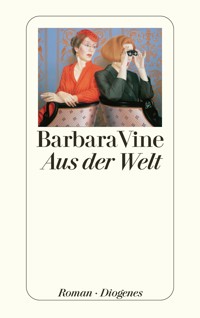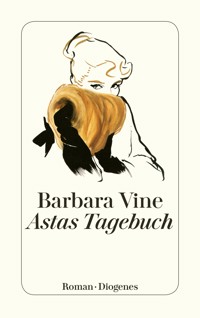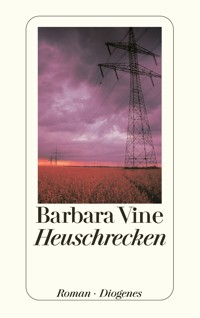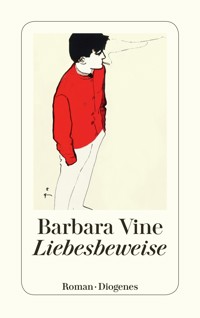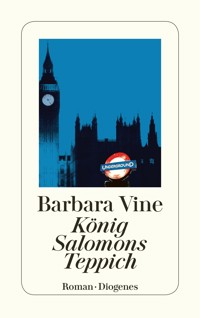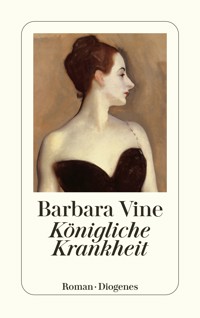10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie waren Papas ein und alles, aber sie hatten keine Ahnung, wer Papa in Wirklichkeit war. Die älteste Tochter Sarah beginnt, die Lebensgeschichte des verstorbenen Vaters zu schreiben. Sarah taucht ein in die Untiefen eines Lebens, das wie das Meer an der Küste von Devonshire, an der der Familiensitz liegt, morsche Bruchstücke freigibt. Zum Vorschein kommen beängstigende Details eines Doppellebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara Vine
Der schwarze Falter
Roman
Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann
Titel der 1998 bei Viking, London, erschienenen Originalausgabe: ›The Chimney Sweeper’s Boy‹
Copyright © 1998 by Kingsmarkham Enterprises Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Imre Goth, ›Portrait de femme‹, 1929 (Ausschnitt)
Für Patrick Maher
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23261 5 (3. Auflage)
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Er wünschte sich eine eigene Familie. Er war noch sehr jung, als ihm das klar wurde, fünfzehn oder sechzehn. Weil er schon damals die Gewohnheit hatte, seine Gedanken zu hinterfragen und Gewissenserforschung zu betreiben, rückte er dieses Wunschbild noch ein bißchen zurecht: Die Familie, die er sich wünschte, sollte die Familie, aus der er stammte, ergänzen: um seine eigenen Kinder. Er stellte sich vor, wie er seinen Geschwistern Kinder zum Liebhaben und seinen Kindern Onkel und Tanten schenken würde. In seinem Traum wohnten sie alle zusammen irgendwo in einem großen Haus, wie sie nie eines gehabt hatten. Er war alt genug, um zu wissen, wie unrealistisch das war.
Etwas später wurde ihm klar, daß für Männer solche Ansichten nicht tragbar sind. Daß die wenigsten Männer solche Sehnsüchte haben. Frauen wünschen sich Kinder, und die Männer erfüllen ihnen diesen Wunsch. Wenn Männer sich welche wünschen, dann deshalb, um ein Geschlecht weiterzuführen oder Erben für ihr Unternehmen zu haben. Er wünschte sie sich, weil er es so schön fand, zu vielen zu sein, und die Schar noch vermehren wollte. Freunde hatten in ihrem Leben nie eine wichtige Rolle gespielt. Was sollten sie mit Freunden, wenn sie Familie hatten?
Vieles von dem, was er empfand und dachte, war in einer Männerwelt nicht tragbar, gehörte sich nicht für einen Mann. So wäre zum Beispiel, wollte er eine solche Familie gründen, eine Frau unverzichtbar. Er wußte, wie das ablief oder abzulaufen hatte. Er müßte ein Mädchen kennenlernen und sich in sie verlieben, ihr den Hof machen, sich mit ihr verloben, sie heiraten, und dieses Hindernis schien unüberwindlich. Er war gern mit Mädchen zusammen, aber nicht auf diese Art und Weise. Bei aller Ahnungslosigkeit – was damit gemeint war, wußte er immerhin schon: Küssen, Anfassen, all das, worüber sie unentwegt und bis zum Überdruß in der Schule redeten. Die anderen konnten es kaum erwarten, so was mit den Mädchen zu machen, manche behaupteten, sie hätten es schon gemacht, aber er wußte bereits damals, daß er sich schwertun würde, damit umzugehen oder es auch nur anzugehen, daß es eine Mühsal für ihn wäre, vergleichbar einer Prüfungsarbeit in Französisch, seinem schlechtesten Fach, oder einem der verhaßten Geländeläufe.
Woher aber wußte er auch, daß es für ihn nicht das Wahre wäre?
Gerald Candless, ›Weniger ist mehr‹
[7] 1
Es ist ein Fehler zu behaupten, Augen seien ausdrucksvoll. Augenbrauen und Lider, Ober- und Unterlippe, die ganze Gesichtsfläche vermittelt Gefühlsregungen. Augen sind lediglich farbige Flüssigkeit in einem Glas.
Der Götterbote
Kein Wort darüber zu meinen Mädchen! hatte er auf der Rückfahrt vom Krankenhaus verlangt. Meinen Mädchen, als wären es nicht auch ihre. Sie war es gewohnt, er redete immer so, und in mancher Hinsicht gehörten sie ja wirklich mehr zu ihm als zu ihr.
»Das darf doch nicht wahr sein«, sagte sie. »Du stehst kurz vor einem größeren Eingriff, und deine erwachsenen Kinder sollen nichts davon erfahren?«
»Einem größeren Eingriff«, wiederholte er. »Du redest wie die Oberschwester aus einer Krankenhausserie. Ich möchte nicht, daß Sarah und Hope sich Sorgen machen und durch die Hölle gehen, bis feststeht, wie es gelaufen ist.«
Mach dir doch nichts vor, dachte sie, aber das war nur eine Anwandlung von Gehässigkeit. Er machte sich nichts vor. Seine Töchter würden tatsächlich durch die Hölle gehen, würden sich quälen, während sie selbst nur ein wenig beklommen sein würde.
Sie mußte es ihm versprechen. Das fiel ihr nicht schwer. Sie hätte es ihnen nur sehr ungern beigebracht.
[8] Die Mädchen kamen wie an jedem Wochenende, im Sommer wie im Winter, sofern die Straßen nicht unpassierbar waren. Sie hatten vergessen, daß die Romneys zum Essen erwartet wurden, und Hope verzog das Gesicht, machte eine Schnute, wie ihr Vater es ausdrückte, mit vorgerecktem Kopf und aufgeworfenen Lippen.
»Seid doch froh, daß sie nur zum Essen kommen«, sagte Gerald. »Ursprünglich hatte ich ihn für das ganze Wochenende eingeladen.«
»Und er hat abgelehnt?« fragte Sarah, als sei die Rede von einem Mann, der eine kostenlose Weltreise ausschlägt.
»Nein, er hat nicht abgelehnt. Ich habe ihm später geschrieben, er könne zum Mittagessen kommen und im Hotel übernachten.«
Alle lachten. Bis auf Ursula.
»Er bringt seine Frau mit.«
»O Gott, Daddy, was denn noch? Hat er etwa auch Kinder?«
»Da fragst du mich zuviel. Eingeladen sind sie jedenfalls nicht.« Gerald lächelte seinen Töchtern liebevoll zu, dann sagte er nachdenklich: »Ich hatte an das Spiel gedacht.«
»Mit den beiden? Super!« sagte Hope. »Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht.«
Titus und Julia Romney empfanden die von Gerald Candless ausgesprochene Einladung als große Ehre, und falls sie damit gerechnet hatten, bei ihm im Haus untergebracht zu werden, statt das Zimmer im Hotel The Dunes selbst bezahlen zu müssen, verloren sie – auch untereinander – kein Wort darüber. Julia, bei einem so berühmten Mann auf [9] exzentrisches, ja flegelhaftes Benehmen gefaßt, war angenehm überrascht, auf einen leutseligen Gastgeber, eine verbindliche, wenn auch ziemlich schweigsame Gastgeberin und zwei gutaussehende junge Damen zu treffen, die sich als die Töchter entpuppten.
Sie wußte, daß Titus, der in mancher Beziehung ein bißchen naiv war, darauf hoffte, das Zimmer zu sehen, in dem der große Mann arbeitete, auf ein Geschenk spekulierte – keine Erstausgabe, das war wohl zuviel verlangt, aber irgendein vom Autor signiertes Buch – und literarische Themen ansprechen wollte, wie und wann Gerald schrieb und jetzt, angesichts der Töchter, vielleicht sogar die Frage, was es hieß, sein Kind zu sein.
Es war ein heißer, sonniger Julitag, gerade noch vor der Hochsaison, sie hätten sonst im Hotel wohl kein Zimmer mehr bekommen. Man nahm das Essen in dem dämmrig-kühlen Speisezimmer ein, das keinen Meerblick hatte. Und das Gespräch der Familie Candless drehte sich keineswegs um Bücher, sondern ums Wetter, um Sommergäste, den Strand und Miss Batty, die zum Abräumen und Abwaschen erwartet wurde. Eine Perle, sagte Gerald, sei Miss Batty nicht gerade, aber eine Frau, die, wie ihr Name schon sage, nicht alle Tassen im Schrank habe, eine Lachnummer, die man sich nicht entgehen lassen dürfe. Es gab noch eine zweite Miss Batty und eine Mrs. Batty, alle drei wohnten in einem Cottage in Croyde. »Hört sich an wie ›Glückliche Familien‹, dieses komische Kartenspiel, nur mit negativen Vorzeichen«, setzte er lachend hinzu, und auch die Töchter lachten.
Vom »Salon« aus (wie der Gastgeber zu sagen pflegte) sah man durch die geöffnete Terrassentür in den Garten [10] hinaus, sah die rosafarbenen und blauen Hortensien, die Klippen, den langen bogenförmigen Strand und das Meer. Was das für eine Insel sei, wollte Julia wissen. Lundy, erwiderte Sarah in einem Ton, als könnten so was nur geistig Minderbemittelte fragen. Den Kaffee brachte eine Frau, die Miss Batty sein mußte, und Hope bot Digestifs an. Gerald und Titus tranken Port, Julia ließ sich von dem Meursault nachschenken, und Sarah und Hope entschieden sich für Kognak, Sarah nahm ihn pur, Hope mit Eis.
Geralds nächste Bemerkung war Julia aus tiefstem Herzen zuwider. Sie hätte nie gedacht, daß so etwas heute überhaupt noch üblich war. Nicht unter Erwachsenen, unter Intellektuellen.
»Und jetzt wollen wir etwas spielen«, sagte Gerald. »Mal sehen, wie schnell Sie schalten.«
»Wäre es toll, jemanden zu finden, der es sofort begreift, Daddy?« fragte Hope. »Oder würden wir uns totärgern?«
»Totärgern würden wir uns«, sagte Sarah und gab Gerald, wie schon mehrmals an diesem Nachmittag, einen Kuß auf die Wange, was die Romneys jedesmal peinlich berührte.
Er griff kurz nach ihrer Hand. »Aber dazu kommt es ja doch nicht.«
Julia begegnete Ursulas Blick. Sie selbst mußte ein ratloses, vielleicht auch nur verschrecktes Gesicht gemacht haben.
»Ich spiele nicht mit«, sagte Ursula. »Ich gehe inzwischen spazieren.«
»In dieser Hitze?«
»Die stört mich nicht. Nachmittags mache ich immer meinen Strandspaziergang.«
[11] Titus, der auch kein Freund von Gesellschaftsspielen war, fragte nach dem Namen des Spiels. »Doch nicht ›Glückliche Familien‹?«
»Es heißt ›Ich übergebe die Schere‹«, sagte Sarah.
»Was müssen wir machen?«
»Sie müssen es richtig machen. Das ist alles.«
»Sie meinen, wir müssen alle etwas machen, was man richtig oder falsch machen kann?«
Sie nickte.
»Und woran merken wir das?«
»Das sagen wir Ihnen dann schon.«
Hope holte die Schere aus der Kommode. Früher hatten sie genommen, was gerade zur Hand war – die Küchenschere, Ursulas Schneiderschere oder eine Nagelschere. Aber weil sie so viel Vergnügen an dem Spiel und dem Gefühl des Eingeweihtseins fanden, hatte Gerald, als seine Töchter noch im Haus waren, eine viktorianische Schere mit scharfen, spitzen Klingen erstanden, deren Griffe aussahen wie silberne Vögel mit ausgebreiteten Schwingen. Diese Schere reichte Hope jetzt ihrem Vater, der den Anfang machen sollte.
Gerald beugte sich in seinem Sessel vor, die Beine gespreizt, den Rücken zum Licht, und öffnete die Schere, so daß sie ein Kreuz bildete. Er lächelte. Er war ein massiger Mann mit dem Kopf eines Löwen, wie Journalisten sich auszudrücken beliebten. Mittlerweile war der Löwe alt geworden, und die lockige Mähne war wie mit grauen Eisenspänen gesprenkelt. Er hatte große Hände mit langen Fingern. Er reichte Julia Romney die Schere und sagte: »Ich übergebe die Schere ungekreuzt.«
[12] Julia reichte die Schere an Hope so weiter, wie ihr Vater sie ihr gegeben hatte. »Ich übergebe die Schere ungekreuzt.«
»Nein, falsch.« Hope klappte die Schere zu, drehte sie um und legte sie in Titus Romneys ausgestreckte Hand.
»Ich übergebe die Schere gekreuzt.«
Titus tat dasselbe und reichte sie an Sarah weiter, wobei er mit einem Blick auf Gerald erklärte, er übergebe die Schere gekreuzt.
»Daneben!« Sarah klappte die Schere auf, faßte sie an einer Klinge und gab sie an ihren Vater weiter. »Ich übergebe die Schere gekreuzt, Dad.«
Er klappte sie zu, drehte sie zweimal in Uhrzeigerrichtung und reichte sie an Julia weiter. »Ich übergebe die Schere ungekreuzt.«
Julia war anzusehen, daß sie eine Erleuchtung hatte oder sich das zumindest einbildete. Sie straffte die Schultern, drehte die Schere zweimal entgegen der Uhrzeigerrichtung, reichte sie Hope und verkündete, sie übergebe die Schere gekreuzt.
»Sieh mal einer an«, sagte Hope. »Aber wissen Sie auch, warum?«
Darauf mußte Julia die Antwort schuldig bleiben. Sie hatte nur geraten. »Aber sie ist gekreuzt, wenn sie geschlossen ist, nicht?«
»Ach ja? Sie müssen sie gekreuzt weitergeben und müssen wissen, warum, und jedem muß es einleuchten. Wenn man es erst mal raus hat, ist die Sache sonnenklar.« Hope klappte die Schere auf. »Ich übergebe die Schere gekreuzt.«
So ging es eine halbe Stunde. Titus Romney wollte wissen, ob irgend jemand es schon mal herausgekriegt hatte, [13] und Gerald sagte, ja, natürlich, aber eben nie beim ersten Anlauf. Jonathan Arthur habe es beim zweitenmal mitbekommen. Beeindruckt von dem Namen des Autors, der den John-Llewellyn-Rhys- und den Somerset-Maugham-Award bekommen hatte, sagte Titus, jetzt würde er sich aber echt Mühe geben. Sarah verkündete, sie brauche noch einen Kognak, und fragte, ob auch die anderen noch etwas wollten.
»Noch einen Port, Dad?«
»Nein, danke, mein Herz, von Port bekomme ich nur Kopfschmerzen. Aber gib Titus einen.«
Sarah schenkte nach und setzte sich bei ihrem Vater auf die Sessellehne. »Ich übergebe die Schere ungekreuzt.«
»Aber warum?« fragte Julia Romney irritiert. Ihr Gesicht rötete sich zusehends. In den Gesichtern der Familienmitglieder machte sich Schadenfreude breit. Man liebte es zu beobachten, wie die Mitspieler langsam, aber sicher die Fassung verloren. »Ich meine – wie kann das sein? Die Schere sieht genauso aus wie eben, als Sie sie gekreuzt weitergegeben haben.«
»Ich habe mir gleich gedacht, daß Sie es nicht beim erstenmal rauskriegen«, sagte Hope gähnend. »Ich übergebe die Schere gekreuzt.«
»Sie übergeben die Schere immer gekreuzt.«
»Ach ja? Na schön, beim nächstenmal übergebe ich sie mal ungekreuzt.«
Während Titus die Schere in Empfang nahm, aufklappte und einmal im Uhrzeigersinn drehte, kam Ursula durch die Terrassentür herein. Sie faßte sich mit der Hand an den Haarknoten, aus dem sich Strähnen ihres ergrauenden [14] blonden Haars zu lösen begannen. Sie lächelte, und Titus dachte, sie würde sagen: »Na, immer noch fleißig?« oder »Haben Sie die harte Nuß schon geknackt?«, aber sie ging wortlos zu der Tür, die in die Diele führte.
Gerald sah sich um. »Lassen wir’s für heute gut sein?«
Die beiden jungen Frauen lachten, wobei Sarah sich vorbeugte, um ihrem Vater in die Augen zu sehen, und Titus begriff, daß diese ziemlich theatralisch gestellte Frage regelmäßig das Ende einer Spielrunde bezeichnete. Vermutlich gehörte auch die nachfolgende Bemerkung zum Ritual.
»Vielleicht klappt’s beim nächstenmal.«
Gerald erhob sich. Titus hatte den unbestimmten Eindruck, daß die Rückkehr seiner Frau den alten Herrn (der fast schon ein Großer Alter Mann war) aus dem Konzept gebracht, ihm den Spaß verdorben hatte. Er wirkte fast ein wenig verstimmt. Sein Gesicht war zwar nicht so grau wie sein Haar, aber fahl und ausdruckslos. Auch seine Tochter Sarah, die der Mutter so ähnlich sah, hatte es bemerkt. Sie wechselte einen raschen Blick mit der Schwester, die große Ähnlichkeit mit dem Vater hatte, und fragte: »Alles in Ordnung, Dad?«
»Aber ja.« Er sah in sein Glas und verzog das Gesicht, aber dann lächelte er ihr zu. »Port bekommt mir nicht, das kenne ich schon. Ich hätte Kognak nehmen sollen.«
»Ich hole dir einen«, sagte Hope.
»Lieber nicht.« Er streckte – Titus hatte noch nie erlebt, daß ein erwachsener Mann das bei einer erwachsenen Frau gemacht hätte – die Hand aus und strich ihr übers Haar. »Wir haben es wieder mal geschafft, meine Herzchen. Ratlosigkeit auf der ganzen Linie!«
[15] »Wie immer.«
»Und jetzt –« er wandte sich an Titus, und in den dunklen Augen lag ein seltsamer Glanz – »wollten Sie ja noch sehen, wo ich arbeite.«
Im Arbeitszimmer – nannte er es so? – gleichviel, dort, wo die meisten seiner Werke entstanden waren, herrschte stickige Wärme. Auch hier hatte man einen Blick auf das Meer und den langen, flachen, eine halbe Meile breiten Strand, von dem das Wasser sich so weit zurückgezogen hatte, daß es kaum mehr zu sehen war. Himmel und Meer trafen sich in flirrender Unschärfe. Die an den vorhanglosen Fenstern angebrachten schwarzen Rollos waren hochgezogen, in breiter Bahn fiel die Sonne in den Raum, Schreibtisch, Sessel und die Bücher hinter und vor ihm mit ihrem Licht überflutend. Gerald Candless benutzte keinen Computer, sondern eine ziemlich altmodische Schreibmaschine, eine Onyxschale enthielt eine Handvoll Füller und Bleistifte.
Links von der Schreibmaschine lagen Druckfahnen eines neuen Romans, rechts lag ein etwa drei Zentimeter hoher Manuskriptstapel. Mehrere tausend Bücher füllten die Regalwände, die vom Boden bis zur Decke reichten, Wörterbücher und Thesauri und Enzyklopädien und andere Nachschlagewerke, Gedichtbände und Biographien und Romane, Hunderte von Romanen einschließlich Gerald Candless’ eigener Werke. Die Sonne tauchte die Rücken aus Leinen und Leder und die bunten Papprücken der Taschenbücher in grelles Licht.
»Alles in Ordnung?«
Titus hatte Sarahs Frage wiederholt, weil Geralds Gesicht [16] wieder grau geworden war und die große knorrige Rechte den linken Oberarm umklammerte. Candless antwortete nicht. Wahrscheinlich, dachte Titus, gehört er zu den Menschen, die nur sprechen, wenn sie etwas zu sagen haben, keine seichte Konversation kennen, auf höfliche Erkundigungen nach ihrem Befinden nicht reagieren.
»Heißen Sie wirklich Titus?«
Die unvermittelte Frage warf ihn aus der Bahn. »Wie?«
»Seit wann sind Sie schwerhörig? Ob Sie wirklich Titus heißen, habe ich gefragt.«
»Natürlich.«
»Ich dachte, es ist ein Pseudonym. Tun Sie doch nicht so beleidigt. Bei weitem nicht jeder heißt so, wie er gerufen wird. Jetzt sehen Sie sich um, sehen Sie sich satt. Nehmen Sie sich ein Buch, tun Sie sich keinen Zwang an, ich signiere es Ihnen. Nur keine Erstausgabe, das dann doch nicht.«
Titus sah sich nach seinem eigenen Buch um, es war nicht da oder zumindest nicht zu sehen. Zaudernd stand er vor den Gerald-Candless-Romanen und entschied sich schließlich für Die Waldnymphe.
»Ach, Sie lesen Finnisch?«
Titus sah, daß er an eine Übersetzung geraten war, aber ehe er noch einmal zugreifen konnte, hatte Gerald Candless eine Buchklubausgabe der Waldnymphe für ihn herausgenommen und signiert. Nur mit seinem Namen, ohne gute Wünsche oder herzliche Zueignung. Sonnenlicht fiel auf seine Hände, die nicht direkt zitterten, aber auch nicht ganz ruhig waren.
»Und jetzt, nachdem Sie bei mir gegessen, mein Zimmer gesehen und Ihr Buch bekommen haben, könnten Sie auch [17] für mich etwas tun. Eine gute Tat – oder vielmehr drei gute Taten – ist eine andere wert, wie?«
Zustimmung war angesagt. Titus nickte. »Aber gern. Soweit ich kann…«
»Im Grunde könnte das jeder, der heute zufällig im Haus ist. Sehen Sie das Zeug da?«
»Die Fahnen?«
»Nein, nicht die Fahnen. Das Manuskript. Ich möchte, daß Sie es mitnehmen. Wollen Sie das für mich tun?«
»Was ist es denn?«
Gerald Candless ging darauf nicht ein. »Ich muß ein paar Tage verreisen und möchte nicht, daß es während meiner Abwesenheit hier herumliegt. Aber vernichten möchte ich es auch nicht. Kann sein, daß ich es eines Tages veröffentliche – das heißt, daß ich es zu Ende schreibe und veröffentliche. Sofern ich es schaffe, über meinen eigenen Schatten zu springen.«
»Was ist es denn? Ihre Autobiographie?«
»Selbstverständlich«, kam die sarkastische Antwort. »Ich habe nicht mal die Namen geändert.« Und dann: »Es ist ein Roman, der Anfang eines Romans – oder das Ende, das weiß ich noch nicht. Aber er ist nicht er, und sie ist nicht sie, und sie sind nicht sie. Klar? Ich will nicht, daß es hier herumliegt. Als ich Sie in Dingsda kennengelernt habe…«
»Haye-on-Wye.«
»Genau. Ich habe Sie kennengelernt und eingeladen und mir gesagt: Der tut’s! Wen verschlägt es sonst schon in diese Gegend?«
»Mich wundert, daß Sie es nicht in einem Schließfach deponiert haben.«
[18] »Soso, das wundert Sie… Wenn Sie es nicht nehmen wollen, brauchen Sie es nur zu sagen. Dann gebe ich es Miss Batty oder stecke es ins Feuer. Genaugenommen wäre Verbrennen vielleicht wirklich das beste.«
»Um Himmels willen, tun Sie das nicht. Ich nehme es ja. Wie und wann wollen Sie es wieder zurückhaben?«
Gerald griff sich den Packen und behielt ihn einen Augenblick in der Hand, so daß man den gepolsterten Umschlag sah, der darunter auf der Schreibtischplatte gelegen hatte, adressiert an Gerald Candless, Lundy View House, Gaunton, North Devon, mit einem Pfund fünfzig Pence frankiert.
»Würden Sie… möchten Sie, daß… hätten Sie etwas dagegen, wenn ich es lese?«
Die Reaktion war schallendes Gelächter, ein starker, kraftvoller Laut, der nicht zu den zittrigen Händen passen wollte. »Nur zu, falls Sie aus meinen chaotischen Tippkünsten schlau werden. Hier ist was für den Transport.«
Es war eine dieser billigen Plastikaktentaschen, wie sie mit der Tagesordnung und entsprechenden Broschüren an Delegierte bei einer Konferenz ausgegeben werden. Normalerweise hätte sich Titus Romney mit so etwas um keinen Preis in der Öffentlichkeit gezeigt, aber bis zum Hotel war es ja nicht weit. Julia saß noch immer im Salon und machte gestelzte Konversation mit Geralds Frau, deren Vornamen Titus schon wieder vergessen hatte. Er suchte auch nicht groß danach, denn inzwischen war es halb vier und Zeit zum Gehen. Die Töchter waren verschwunden.
»Ich begleite Sie bis zum Hotel«, sagte Gerald. »Ich soll jeden Tag ein Stück laufen, wenigstens ein paar Meter.«
[19] Julia war von betonter Herzlichkeit wie immer, wenn sie sich irgendwo besonders unwohl gefühlt hatte.
»Auf Wiedersehen, vielen, vielen Dank, es war ganz reizend. Ein wunderbares Essen.«
»Noch viel Vergnügen hier«, sagte die Frau.
Sie gingen durch den Garten, Titus hatte die Plastikaktentasche in der Hand, die Julia mit einem fragenden Blick streifte. Der Garten reichte bis auf zehn Meter an die Steilküste heran, ein Törchen führte auf den Klippenweg. Von dort konnte man den ganzen Strand und den mit Autos und Anhängern besetzten Parkplatz überblicken. Am Strand war es voll, auch im Wasser waren viele Leute. Julia hatte irgendwo gelesen, daß dies angeblich der schönste Strand der englischen Küste sei, der längste – sieben Meilen lang – und der mit dem besten Sand. Und der ungefährlichste, denn die Flut lief eine halbe Meile weit ab und stieg sanft plätschernd, seicht und friedlich über den fast ebenen Sand wieder an. Das Meer war blau wie ein Juwel, unbewegt, ohne Wellengang.
»Es muß eine große Freude für Sie sein, hier zu leben«, sagte Julia höflich.
Er antwortete nicht. Titus fragte ihn, ob er nicht gern spazierengehe. Seine Worte von vorhin legten den Verdacht nah, daß er sich nichts daraus machte.
»Ich mache mir überhaupt nichts aus körperlicher Bewegung. Spazierengehen ist etwas für Spinner. Deshalb hat ein vernünftiger Mann das Automobil erfunden.«
An einer kleinen Pforte war ein Schild angebracht: »The Dunes Hotel, Zugang nur für Hotelgäste«. Gerald öffnete das Törchen und trat beiseite, um Julia durchgehen zu [20] lassen. Vor ihnen erhob sich das Hotel, ein Bau aus der Zeit der Jahrhundertwende, roter Backstein mit weißen Verblendungen, viele Giebel und Erker. Über der Terrasse war die gestreifte Markise aufgespannt. An den Tischen saßen Gäste und tranken Tee. In einem hinter einer spärlichen Ligusterhecke verborgenen Swimmingpool planschten Kinder.
»Fühlen sich Ihre Kinder wohl hier?«
»Wir haben keine Kinder«, erwiderte Julia.
»Nein? Warum nicht?«
»Ich weiß nicht.« Sie war sehr betroffen. Solche Fragen sollte man nicht stellen dürfen. »Ich… ich weiß nicht, ob ich welche will.«
Noch eine Pforte, dann standen sie auf der großen Rasenfläche.
»Sie wollen keine Kinder?« fragte Gerald. »Wie unnatürlich. Das müssen Sie sich noch mal überlegen. Haben Sie etwa Angst vor dem Kinderkriegen? Solche Frauen gibt es… Kinder sind die Krönung des Daseins. Kinder sind die Quelle allen Glücks, entschädigen für alles. Glauben Sie mir. Ich weiß Bescheid. So, da wären wir. Die Welt hat uns wieder.«
Julia war so verärgert, daß sie fast aus der Rolle gefallen wäre. Sie sah ihren Mann an, der aber mied ihren Blick. Sie wandte sich Gerald Candless zu, entschlossen, ihm wortlos die Hand zu geben, sich umzudrehen und rasch auf ihr Zimmer zu gehen. Zögernd streckte sie die Hand aus, die nicht ergriffen wurde. Doch nicht aus Unhöflichkeit. Verstört, ja fast versteinert sah er zur Hotelterrasse hoch. Unwillkürlich folgte sie seinem betroffenen Blick, fand aber keine Erklärung für dieses unverwandte Starren.
[21] Auf der Terrasse saß die ältere Generation beisammen, das hatte sie schon gestern nachmittag festgestellt, Gäste, die nicht schwammen, keine weiten Wege machten und sich nicht an den Strand hinunterwagten, weil sie den steilen Rückweg fürchteten. Die dort unter den Schirmen und der blau-weiß gestreiften Markise saßen, waren die Alten, Goldene Hochzeiter, Großeltern, die Gesetzten, die Inaktiven.
»Haben Sie Bekannte entdeckt?« fragte Titus.
Gerald Candless wirkte wie ein Träumer, ein Schlafwandler, der blindlings voranschreitend jäh angehalten wird und nun verloren und orientierungslos dasteht. Titus’ Frage brach den Bann oder vertrieb den Traum. Candless strich sich mit einer Hand über die hohe, gefurchte Stirn, fuhr sich mit den Fingern durch das dichte Haar.
»Ich habe mich geirrt«, sagte er, dann ließ er die Hand sinken und verabschiedete sich mit dem für ihn typischen Lächeln, das ein wölfisches Zähneblecken war. Die Augen lächelten nicht mit.
Sie sahen ihm nicht nach, drehten sich nicht noch einmal um, winkten nicht. Während sie über die Terrasse auf die geöffneten Glastüren zugingen, die zum Salon und zur Bar führten, blieb Julia kurz stehen und musterte die Großeltern an den Terrassentischen. Wie diese alten Leute qualmten! Da saßen sie mit ihren Zigaretten, vor sich überquellende Aschenbecher, Teekannen und Teetassen, Kuchenstücke auf Tortenständern und Kartenspiele, aber keine Sonnencreme, keine Sonnenbrillen. Sie gingen nie in die Sonne. Eine Frau frischte im Spiegel einer Puderdose ihr Make-up auf, malte scharlachrote Lippen auf einen alten Runzelmund.
Keine auch nur annähernd interessanten Leute, niemand, [22] dem dieser gebannte Blick hätte gelten können. Nur Getue, dachte sie, nichts als Theater und Imponiergehabe. Dann folgte sie Titus in die kühlen, dämmerigen Innenräume.
Sarah und Hope wollten ausgehen. Hope hatte sich zu einem Grillabend an einem anderen Strand verabredet. Die Gäste waren kaum außer Hörweite, als Sarah schon am Telefon hing, um mit ihrer Clique ein Pub in Barnstaple als Treffpunkt auszumachen. Nicht einmal die Aussicht auf das Zusammensein mit ihrem Vater hielt die beiden am Samstagabend im Haus. Mit den Gefährten von früher, mit Schulfreunden und Freunden von Freunden auszugehen gehörte einfach dazu, war fast eine Pflicht.
»Make my bed and light the light«, sang Miss Batty in der Küche und fügte hinzu: »I’ll arrive late tonight, blackbird, bye-bye. Es liegt viel Wahrheit in diesen alten Schlagern.«
Sie nahm Titus Romneys Glas vom Tablett und trank den Rest Portwein. Sie pflegte, wenn Gäste dagewesen waren, die Gläser zu leeren. Als sie einmal fünfzehn Sektgläser ausgetrunken hatte, war sie so gründlich außer Gefecht gesetzt, daß Ursula sie hatte heimfahren müssen. Bei welcher Gelegenheit war das nur gewesen? Ursula wußte es nicht mehr. Miss Batty – die Ursula schon lange Daphne nannte, so wie Miss Batty ihrerseits Ursula zu ihr sagte – genehmigte sich einen Rest Brandy und räumte die erste Ladung aus der Geschirrspülmaschine.
»Bye-bye, blackbird«, trällerte sie.
[23] Ursula staunte immer wieder, wie vertraut Daphne Batty mit der Popmusik der letzten sechzig Jahre war. Während Gerald sie ihres Namens wegen schätzte, hatte Ursula sie um dieser unerschöpflichen Quelle alten Liedguts willen ins Herz geschlossen. Sie ging wieder in den Salon. Gerald stand mit dem Rücken zum Meer am Fenster. Seit er vom Hotel zurückgekommen war, hatte er kein Wort gesagt und sah aus, als sei er sehr weit weg. Das kam zwar öfter vor, nur schien er diesmal noch viel ferner gerückt, fast so, als habe er über einen Grenzfluß ein anderes Land betreten. Er sah sie mit leerem Blick an. Sie hätte schwören mögen, daß er sekundenlang nicht wußte, wer sie war.
Am Samstagabend, wenn die Mädchen aus waren, verging er fast vor Sorge. Er glaubte, daß Ursula ihm seine Nervosität nicht anmerkte, aber natürlich wußte sie ganz genau, was los war. Wenn seine Töchter in London waren – und das waren sie ja meist –, waren sie vermutlich tagtäglich bis spät in der Nacht unterwegs, ohne daß er sich deswegen beunruhigt hätte. Ursula war überzeugt davon, daß er kaum einen Gedanken darauf verwandte und erst recht nicht im Morgengrauen aufwachte, um sich zu fragen, ob Hope wohlbehalten in ihrem Bett in Crouch End oder Sarah in ihrem in Kentish Town gelandet war. Hier aber legte er sich, wenn sie aus waren, neuerdings nicht einmal hin, sondern saß im Dunkeln in seinem Arbeitszimmer und wartete auf das Geräusch des ersten Wagens, des Schlüssels in der Haustür, des zweiten Wagens, des zweiten Schlüssels.
Seit fast dreißig Jahren hatten sie kein gemeinsames Schlafzimmer mehr, in diesem Haus hatten sie nie [24] zusammen in einem Zimmer geschlafen, aber sie wußte Bescheid. Er schlug sie noch immer in seinen Bann – so wie einen eine Mißbildung oder eine Verstümmelung in den Bann schlägt, dachte sie manchmal. Er nötigte sie zu Blicken voller Abscheu, zu ständiger Spekulation. Sie hatte praktisch keine Möglichkeit festzustellen, ob er in seinem Zimmer war oder nicht. Kein Lichtschimmer, nicht das leiseste Geräusch bot einen Anhaltspunkt. Die Holzböden waren alle mit Teppichen ausgelegt, die Türen saßen fugendicht in den Rahmen. Sein Zimmer und das ihre waren an entgegengesetzten Enden des Gangs. Trotzdem wußte sie es, wenn er abends nicht im Bett war, so wie sie es auch von den Töchtern wußte. Gewöhnlich wachte sie auf, wenn einer der Wagen kam. Sie hatte einen leichten Schlaf. Und auch ihr fiel ein Stein vom Herzen, wenn erst Sarah, dann Hope wieder im Haus waren. Oder umgekehrt – je nachdem. Vor Mitternacht kamen sie nie, meist sehr viel später.
Seine Töchter sollten nicht wissen, daß er ihretwegen aufblieb. Er saß ohne Licht im Arbeitszimmer, damit sie es nicht merkten. Sie sollten nicht wissen, daß er sich Sorgen um sie machte, sie sollten nicht wissen, daß er ein krankes Herz hatte, an dem für Mittwoch eine größere Reparatur geplant war. Er wünschte sie sich so unbeschwert wie zu ihrer Kinderzeit, als sie ihren Vater für unsterblich gehalten hatten. Einen Augenblick überlegte sie, wie es für die beiden wohl wäre, wenn er während der Operation stürbe, dachte an den Abgrund, der sich vor ihnen auftun würde, und dann machte sie das Licht aus und schlief ein.
Den ersten Wagen hörte sie nicht kommen, wohl aber Hopes Wagentür, die immer leise quietschte, wenn man sie [25] weiter als 45 Grad aufmachte. Sarahs Wagen fuhr geräuschvoll und zu schnell vor, demnach hatte sie zuviel getrunken. Ursula überlegte, ob die Presse wohl erfahren – und ausschlachten! – würde, wessen Tochter sie war, wenn die Polizei sie irgendwann beim Überschreiten des Tempolimits erwischte. Die Wagentür wurde zugeschlagen, die Haustür fiel mit einem lauten Knall ins Schloß. Zum Ausgleich schlich Sarah die Treppe auf Zehenspitzen hoch.
Gerald war fast genauso leise. Aber er war groß und massig und hatte einen schweren Schritt. Falls die Mädchen ihn gehört hatten, dachten sie vermutlich, er sei nur mal aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. Ursula blieb still liegen, aber mehr hörte sie nicht und war wohl wieder eingeschlafen, hinterher erinnerte sie sich nur noch an ein Gefühl von Stille und Frieden und daß es, als sie das Licht ausgemacht hatte, kurz nach halb zwei gewesen war. Um 1.50 war Wasserhöchststand, allerdings merkte man in diesen windstillen Sommernächten bei ruhiger See praktisch nichts davon. Es muß wunderschön sein, nachts das Meer zu hören, sagten die Leute oft zu ihr, aber sie hörte es nie. Das Haus war, obwohl es am Rand der Steilküste stand, von dieser seichten, schleichenden See zu weit entfernt.
Er mußte an diesem Nachmittag einen Schock erlitten haben. Diese Erkenntnis, womöglich aber auch irgend etwas anderes, weckte sie aus leichtem Dämmerschlaf. Vielleicht hatte sie von ihm geträumt, das kam manchmal vor. Sie erinnerte sich seiner Reglosigkeit, seines leeren Blicks. Er hatte diese Romneys zum Hotel begleitet, und dort war etwas vorgefallen. Er hatte etwas oder jemanden gesehen, oder jemand hatte etwas zu ihm gesagt, was ihn aus dem [26] Gleichgewicht gebracht hatte. Aufregung ist nicht gut für ihn, dachte sie unbestimmt, während sie sich aufsetzte und die Nachttischlampe anknipste. Vier Uhr. Demnach hatte sie tatsächlich geschlafen. Die Morgendämmerung zog herauf, um die Vorhänge herum zeichneten sich schmale blaßgraue Lichtstreifen ab.
Und in diesem Moment hörte sie ihn. Vielleicht hatte sie ihn auch vorher schon gehört und war davon wach geworden. Ihr Nachthemd war ein dünnes Fähnchen mit schmalen Schulterträgern. Sie zog einen Morgenrock darüber, drehte das lange Haar zu einem Knoten, spießte zwei Haarnadeln hinein.
Sie war noch nie in seinem Schlafzimmer gewesen. Nicht in diesem Haus. Sie wußte nicht einmal, wie es aussah. Daphne Batty putzte dort und bezog das Bett, und dabei summte sie Pop-, Rock- oder Countrysongs. »Gerald?« sagte Ursula.
Wie ein mühsames Ringen nach Luft – so hörte es sich an. Die Vorhänge waren zurückgezogen, und sie sah einen blassen Mond an einem blassen Himmel stehen. Es war ziemlich hell. Er saß aufrecht im Bett, das Gesicht scharlachrot und mit Schweißperlen bedeckt.
Sie nannte noch einmal seinen Namen. »Gerald?«
Er kämpfte um Worte. Sie hatte sofort begriffen, daß es ein Herzanfall war, und sah sich suchend nach seinem Mittel, dem Nitroglyzerin, um, das gottweißwo sein konnte. Auf dem Nachttisch stand es nicht. Während sie auf das Bett zuging, warf er plötzlich den Kopf zurück und schrie laut auf. Es war ein tierischer Schrei wie das Brüllen eines gereizten Bullen, es schien durch Brust und Hals direkt aus [27] den Tiefen seines leidenden Herzens zu kommen. Der Laut verhallte, er schlug sich mit den Fäusten auf die Brust, dann breitete er mit einem Ruck die Arme aus, während sein Gesicht aufquoll und sich dunkelviolett färbte.
Sie wollte seine Hände nehmen, war bereit, alles zu vergessen und ihn festzuhalten. Wie schon einmal, in jener Nacht, als er von dem Tunnel geträumt hatte. Doch er wehrte sich, schlug, während ihm die Augen aus den Höhlen zu springen drohten, mit den Fäusten nach ihr wie ein jähzorniges Kind.
Bestürzt wich sie zurück. Er sog langsam die Luft ein, es klang wie Wasser, das durch einen Abfluß gurgelt, schwerflüssig, mit lautem Blubbern. Aus seinem Gesicht wich die Farbe – Rotwein, der aus einem Rauchglaspokal rinnt –, es wurde fahl und kraftlos, die Muskeln erschlafften. Während das Todesröcheln aus seiner Kehle kam, eine rasselnde Salve letzter Laute, fiel er zurück ins Bett und aus dem Leben.
Sie wußte, daß dies der Tod war, es konnte gar nicht anders sein. Später staunte sie, daß Sarah und Hope all das verschlafen hatten. So wie sie damals ruhig weitergeschlafen hatten, als er laut schreiend von dem Tunnel geträumt hatte. Sie rief einen Krankenwagen, obgleich sie wußte, daß er tot war, und dann ging sie – widerstrebend, voller Bangen, voller Angst vor den eigenen Kindern – die Töchter wecken.
[28] 2
Mag sein, daß die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden, aber behalten werden sie es nicht lange.
Das verfinsterte Auge
Sarah und Hope verfaßten die Todesanzeige gemeinsam. Das »geliebter« fügte Sarah ein, weil nur »Ehemann von« unmöglich gewesen wäre, und »vergöttert« fanden sie beide optimal. Den Vers aus Heraclitus von William Cory wählte Hope aus. Sie hatte das Gedicht, an das sie sich noch von der Schule her erinnerte, in Palgraves Golden Treasury wiederentdeckt. Sarah fand es zwar etwas peinlich, gab aber nach, weil Hope so sehr weinte, als sie Einwände erhob. Die Anzeige erschien in mehreren Tageszeitungen.
Im Alter von 71 Jahren verschied am 6. Juli in seinem Haus in Gaunton, Devon, Candless, Gerald Francis, geliebter Ehemann von Ursula und vergötterter Vater von Sarah und Hope. Beerdigung Ilfracombe, 11. Juli. Keine Blumen, Spenden an die Britische Herzstiftung.
Ich weinte in Erinnerung, Wie oft wir beide ohn’ Verdrießen die Sonne plaudernd langgeweilt und untergehen ließen.
[29] Am nächsten Tag stand der Nachruf in der Times.
Der Schriftsteller Gerald Francis Candless, Officer of the Order of the British Empire, geboren am 10. Mai 1926, starb am 6. Juli im Alter von 71 Jahren.
Gerald Candless schrieb von 1955 bis heute neunzehn Romane. Am nachhaltigsten in Erinnerung bleiben wird wahrscheinlich Die Waldnymphe, die 1979 in die Endauswahl für den Booker-Preis kam.
Seine Romane waren insofern ungewöhnlich, als sie anspruchsvolle Literatur darstellten und sich dennoch, zumindest in der mittleren Schaffensperiode, sowohl allgemeiner Beliebtheit beim Publikum erfreuten, als auch bei der Kritik auf große Anerkennung stießen. Regelmäßig auf den Bestsellerlisten waren seine Werke allerdings erst ab Mitte der achtziger Jahre, und gleichzeitig kühlte die Begeisterung der Kritiker merklich ab. Seine Bücher lebten zu sehr von action, hieß es jetzt, und manche Rezensenten verglichen sie mit den vor hundert Jahren so beliebten Abenteuerromanen. Dennoch war auf einer 1995 von Zeitungskritikern zusammengestellten Liste der fünfundzwanzig führenden Romanschriftsteller der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch sein Name vertreten.
Candless kam in Ipswich, Suffolk, als einziges Kind von George und Kathleen Candless – er Drucker, sie Krankenschwester – zur Welt, wo er auch seine Kindheit und Jugend verbrachte. Er besuchte eine Privatschule und später das Trinity College in Dublin, wo er einen Abschluß in klassischer Philologie machte. Nach dem [30] Studium arbeitete er als Journalist für verschiedene Wochenblätter und Tageszeitungen in der Provinz, zunächst für den Walthamstow Herald in Ostlondon, später, in gehobener Stellung, für die Western Morning News in Plymouth.
In Plymouth schrieb er mit achtundzwanzig Jahren seinen ersten Roman. Viele Jahre danach erklärte er in einem Interview mit dem Daily Telegraph, er sei, Anthony Trollopes Beispiel folgend, jeden Morgen um fünf aufgestanden und habe vor dem Dienstantritt drei Stunden geschrieben. Anziehungskraft wurde von dem dritten Verlag angenommen, an den Candless sein Manuskript schickte, und erschien im Herbst 1955.
Erst nach drei weiteren mit wachsendem Beifall aufgenommenen Romanen konnte Candless vom Schreiben leben. Doch auch dann dauerte es noch geraume Zeit, bis er seine journalistische Tätigkeit ganz aufgab, denn Anfang der sechziger Jahre, etwa zur Zeit seiner Heirat, wurde er Literaturrezensent für die Daily Mail und später zunächst Leiter der Literaturseite, dann stellvertretender Literaturredakteur des Observer.
Damals lebte er im Londoner Stadtteil Hampstead, wo seine Töchter geboren wurden. Später zog er mit seiner Familie in eine Gegend, die ihm seit seiner Tätigkeit in Plymouth besonders ans Herz gewachsen war, ins nördliche Devon zwischen Bideford und Ilfracombe. Dort, kurz hinter der Ortschaft Gaunton, kaufte er Lundy View House, direkt an der Steilküste oberhalb der Gaunton Dunes gelegen, wo er von 1970 bis zu seinem Tod lebte und arbeitete.
[31] Candless wurde 1976 Mitglied der Royal Society of Literature, 1986 wurde ihm der Order of the British Empire verliehen. Todesursache war eine Koronarthrombose. Er hinterläßt seine Witwe Ursula Candless, geborene Wick, und zwei Töchter, Sarah und Hope.
Zur Beerdigung kamen nicht viele Trauergäste. Gerald Candless hatte keine Verwandten, nicht mal den einen oder anderen Vetter. Die Töchter waren da und Hopes Freund Fabian Lerner, Ursulas verwitwete Schwester und ihre verheiratete Nichte Pauline.
»Als meine Mutter jung war, gingen Frauen nicht zur Beerdigung mit«, sagte Daphne Batty, während sie die Sherrygläser spülte. Mrs. Batty war dreiundneunzig. »›Der Leiche folgen‹ hieß das damals, und Frauen machten das nicht.«
»Warum nicht?« fragte Ursula.
»Weil sie das schwache Geschlecht waren, es wäre vielleicht zu viel für sie gewesen.«
»Sind sie denn heute nicht mehr das schwache Geschlecht?«
»Stärker sind sie geworden, immer stärker im Lauf der Jahre.« Daphne sah über die Schulter, um sicherzugehen, daß niemand zuhörte. »Dieser Fabian ist bloß gekommen, weil er noch nie auf einer Beerdigung war. Das hat er mir selber gesagt. Er wollte mal sehen, wie das so ist.«
»Hoffentlich entsprach alles seinen Erwartungen«, sagte Ursula und dachte daran, wie Hope sich aufgeführt hatte, als die Träger den Sarg in die mit Kunstrasen ausgelegte Vertiefung hinabgelassen hatten. Einen Augenblick hatte [32] sie tatsächlich gedacht, ihre Tochter wolle sich in die Grube werfen wie Laertes in Ophelias Grab.
Geralds Verleger hatte wohl ähnliche Befürchtungen gehabt. Er war einen Schritt vorgetreten, und sie hörte ihn murmeln: »Aber nein, nicht doch…«
Doch Hope hatte sich nur auf dem grünglitzernden Zeug hingehockt und laut wehklagend zugesehen, wie die sterblichen Überreste ihres Vaters in die Erde gesenkt wurden. Und als Pauline – warum eigentlich sie? Wer hatte sie darum gebeten? – eine Handvoll Kies auf den Sarg regnen ließ, hatte sie sich schluchzend hin und her geworfen und sich unter dem breitrandigen Hut das Haar büschelweise ausgerissen.
»Es ist ihr sehr nahe gegangen«, sagte Sarah. »Das ist es uns allen, für uns ist es genauso schlimm, nur stellen wir unsere Gefühle nicht so zur Schau.«
Ursula schwieg.
»Er war der wunderbarste Vater, den man sich vorstellen kann. Wenn ich so an die Väter anderer Leute in meinem Alter denke… Als wir klein waren – nein, ich kann nicht darüber reden. Noch nicht. Sonst muß ich weinen. Im Grunde bin ich nicht besser als Hope.«
»Aber nicht so demonstrativ«, sagte Ursula.
Sarah warf ihrer Mutter, die mit einem Becher Kaffee am Küchentisch saß, einen scharfen Blick zu. Ursula war eine kräftig gebaute Frau mit geradem Rücken, angenehmen, aber nicht besonders einprägsamen Zügen, faltenlosem Gesicht, ruhigen blaugrauen Augen und unordentlichem aschblondem Haar mit grauen Strähnen, das sich kaum in einem Knoten halten ließ. Ein Haarknoten, aus dem sich ständig [33] Strähnchen lösen, kann bei einem jungen Mädchen bezaubernd aussehen, dachte Sarah, bei älteren Frauen wirkt es einfach nur schlampig. Doch zum Glück bekamen ja nicht viele Leute ihre Mutter zu sehen, im Grunde war ihr, nachdem Gerald nicht mehr da war, nur noch Daphne Batty geblieben.
Dabei fiel ihr wieder ein, was sie hatte sagen wollen. Oder vielmehr, was sie meinte sagen zu müssen. »Wir können nicht lange bleiben, Hope und ich. Nur noch bis morgen. Wenn du willst, kannst du mit zu mir kommen.« Weil das nicht sehr einladend klang, machte sie einen neuen Anlauf. »Du kannst gern bei mir wohnen. So lange du willst. Du kannst es dir in der Wohnung gemütlich machen, wenn ich an der Uni bin, oder du kannst einkaufen gehen und – und zum Friseur.« Und abends kommt dann Hope vorbei, hatte sie eigentlich noch sagen wollen, war sich aber nicht sicher, ob sie damit nicht zuviel versprochen hätte.
»Du könntest nach Camden Lock zum Einkaufen gehen«, setzte sie noch einmal an. »Du bist ja gut zu Fuß. Wenn du nach St. John’s Wood gehst, ist es gleichzeitig ein schöner Spaziergang.«
»Der Weg nach Franaton Burrows ist auch ein schöner Spaziergang«, sagte Ursula. »Es ist lieb gemeint, Sarah, aber ich komme hier schon zurecht, ich muß mich eben ans Alleinsein gewöhnen.« Sie war mit allem, was ihr wichtig war, seit dreißig Jahren allein gewesen. Daß außer ihr noch jemand im Haus gewesen war, ein großer, bedrückend schwerer, geistreich-hochfahrender Mann, hatte ihre Einsamkeit nicht gemildert. Doch darüber verlor sie kein Wort, weil sie über diese Dinge nie mit ihren Töchtern und auch sonst mit [34] niemandem sprach. »Außerdem will Pauline auf ein paar Tage herkommen«, setzte sie hinzu.
Sarah verdrehte die Augen, enthielt sich aber jedes negativen Kommentars zu dieser Lösung von Ursulas vermeintlichem Problem. Sie und ihre Mutter waren so ungeübt darin, einander zu vermitteln, was sie wirklich empfanden, waren so sehr an den Austausch von Platitüden und unverbindlichen Bemerkungen gewöhnt, daß sie jetzt weder »Herzliches Beileid« noch »Warum tust du dir das bloß an?« sagte, sondern nur: »Immerhin kann sie dir ein bißchen Gesellschaft leisten.«
Das einzige, was Pauline immer geleistet hatte, war Gesellschaft, dafür war sie entschieden besser geeignet als Gerald, denn ihr kam es nicht darauf an, was man zu ihr sagte oder ob man überhaupt etwas sagte. Sie war achtunddreißig. Als die Töchter klein gewesen waren, hatte sie oft ihre Ferien hier verbracht. Sie war gerade so viel älter, daß sie Spaß daran hatte, sich um die beiden Mädchen zu kümmern. Und wie alle Kinder (zumindest alle Mädchen), die ins Haus kamen – in das Haus in Hampstead und später hierher –, fand auch Pauline, daß Gerald Candless der netteste, liebste, beste Erwachsene von der Welt war. Mit vierzehn hatte sie sich in ihn verliebt. Dann war da diese dumme Sache gewesen, eine Sache, von der niemand außer Pauline und Gerald Genaueres wußte, die sie aber offenbar beide verwunden hatten, denn als Pauline mit einundzwanzig heiratete, hatte sie Gerald gebeten, ihr Brautführer zu sein, weil ihr eigener Vater gestorben war.
Mittlerweile waren Paulines Kinder Teenager und konnten gut zu Hause beim Vater bleiben. Bekocht wurden sie [35] von der Großmutter. Pauline hatte vor der Heirat nur drei Jahre gearbeitet und danach nie wieder. Dadurch hatten – zumindest aus ihrer Sicht – sie und Ursula viele Gemeinsamkeiten, denn auch Ursula war ein paar Monate, ehe Gerald sie 1963 in Purley geheiratet hatte, aus dem Erwerbsleben ausgeschieden, wie es so schön hieß.
»Allerdings hast du alle Manuskripte von Onkel Gerald abgetippt, nicht?« sagte Pauline – da war sie schon fast eine Woche in Lundy View House – eines Tages beim Mittagessen. »Er hat sie geschrieben, und du hast seine schreckliche Handschrift entziffert und sie abgetippt. Auf deiner alten Olivetti.«
»Stimmt«, sagte Ursula. »Wie Sonja Tolstoi.«
»Wer?« fragte Pauline.
»Tolstois Frau. Sie hat alle seine Bücher abgeschrieben, manche bis zu siebenmal, sie waren sehr lang, und zwar mit der Hand, weil Schreibmaschinen damals noch nicht erfunden waren oder sie zumindest keine besaßen. Da hatte ich es leichter als sie.«
»Aber du hast doch dafür kein Geld bekommen?« fragte Pauline hoffnungsvoll. Wäre Ursula bezahlt worden – und sei es von ihrem eigenen Mann –, hätte sie damit strenggenommen ihren Anspruch auf Zugehörigkeit zu der Schwesternschaft beschäftigungsloser Ehefrauen verwirkt. »Onkel Gerald hat dich doch nicht bezahlt?«
»Er hat mich ernährt«, sagte Ursula.
»Ja, das versteht sich von selbst. Brian ernährt mich auch, wenn du es so ausdrücken willst.«
»Ich habe das nicht immer gemacht. Von der Hand in den Mund war das letzte Manuskript, das ich für ihn [36] abgeschrieben habe, das war 1984, danach hat er seine Manuskripte selber getippt.«
»Und warum hast du aufgehört?« frage Pauline.
Ursula antwortete nicht. Sie überlegte, wie lang die Anstandspause nach dem Essen wohl sein müßte, ehe sie ihren Spaziergang antreten konnte. Zwanzig Minuten mindestens. Pauline begann abzuräumen. Sie hatte Ursula noch nicht gefragt, ob sie von Onkel Gerald großzügig oder auskömmlich oder nur dürftig versorgt worden war, sie hatte nicht gefragt, ob sie genötigt sein würde, das Haus zu verkaufen, Untermieter oder Frühstücksgäste aufzunehmen, obgleich sie, wie Ursula wußte, darauf brannte, das alles haarklein zu erfahren. Jedermann ging davon aus, daß Gerald alles Sarah und Hope vermacht hatte, und Ursula hatte sich zwar von dem Schock seines Todes – wenn es denn ein Schock gewesen war – leidlich erholt, seine erstaunlichen letztwilligen Verfügungen aber noch nicht recht verarbeitet.
»In zehn Minuten mache ich meinen Spaziergang«, sagte sie, als sie die Geschirrspülmaschine eingeräumt hatten.
»In diesem Nebel?« Pauline schüttelte sich in gespieltem Entsetzen.
»Es ist nur Seedunst.«
»Ich wußte, daß du das sagen würdest. Du hast immer Seedunst dazu gesagt. Das war das einzige, was mir nicht gefiel, wenn ich hier zu Besuch war, diese weißen Nebelschwaden. Onkel Gerald fand sie auch gräßlich. Ich erinnere mich, daß er dann nie einen Fuß vor die Tür gesetzt, sondern sich in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen hat. Warum eigentlich?«
»Ich weiß nicht«, sagte Ursula.
[37] »Regt es dich auf, wenn ich von ihm spreche, Tante Ursula?«
»Willst du nicht allmählich das ›Tante‹ weglassen?« fragte Ursula nicht zum erstenmal.
»Ich will’s versuchen«, sagte Pauline, »aber so eine Gewohnheit läßt sich nur schwer ablegen.«
Kaum jemand ließ sich am Strand sehen, wenn der Nebel von der See her aufzog. Der Parkplatz leerte sich, die Surfer zogen sich in ihre Wohnwagen, die Hotelgäste in den hauseigenen Swimmingpool zurück. Auf den Strand, der sieben Meilen lang und bei Ebbe eine halbe Meile breit war, senkte sich ein weißer Vorhang herab, so daß man, wenn man mittendrin steckte, Dünen und Meer nicht mehr sah. Ursula konnte gerade noch ihre Füße und auf beiden Seiten ein paar Meter Strand erkennen, nicht aber die grün gewellten Dünen zu ihrer Linken oder das Wasser, das zu ihrer Rechten geräuschlos über den Sand schlich.
Der Nebel würde ihr nasses Haar bescheren und sich in feinen Tröpfchen auf ihren Sachen absetzen, aber das störte sie nicht. Es war nicht kalt. Manchmal waren ihr dunstige Tage sogar lieber als die ganz klaren, an denen man die Landspitze sehen konnte und die Bucht und Westward Ho! und über der Steilküste das hochaufragende Hotel mit seinen Parkanlagen und den vielen grellbunten Blumen. Sie ging auf halber Höhe zwischen Dünenrand und steigender Flut nach Süden. Hin und wieder blickte sie auf und sah hinter der dicken weißen Gazeschicht fernes Sonnenlicht flirren, meist aber schaute sie zu Boden, auf den Sand.
Manchmal war er ganz fest und eben, an anderen Tagen [38] durch eine Laune der Gezeiten verrunzelt wie die Haut auf gekochter Milch. Heute war er eine glatte Fläche aus dunklem Ocker, auf der sich hier und da ein Zickzackmuster aus feinem, glitzernd schwarzem Staub abzeichnete. Urlauber, die nach Gaunton kamen, hielten die schwarzen Streifen, die aussahen wie von einem Magneten in diese Form gezogen gleich Eisenspänen auf einem Blatt Papier, für Teer oder andere Verunreinigungen. Ursula aber wußte, daß es durch das ständige Malmen und Kneten der See zu staubfeinem Pulver gemahlene Muschelschalen waren.
Allenthalben lagen Muscheln herum – weiße Jakobsmuscheln, die Gehäuse der elfenbeinfarbenen Napf- und der kreidigen Wellhornschnecken, blauschwarze Miesmuschelschalen mit einem Perlmuttschimmer oder einer Kruste aus Seepocken, Messerscheidemuscheln, die aussahen wie Barbiermesser in Kästchen aus Achat. Als sie hergezogen waren, hatten Ursulas Töchter täglich Muscheln gesammelt, bis sie schließlich des Spiels müde geworden waren. Jahre später hatte Ursula die stumpf-staubigen, muffig riechenden Muscheln in einem Schrank gefunden, sie in einen Einkaufsbeutel getan und bei ihrem Spaziergang am Strand verstreut. Als sie am folgenden Tag die gleiche Strecke abging, hatte das Meer alle so gründlich reingewaschen, daß sie die vom Vortag nicht mehr von den anderen unterscheiden konnte.
Heute war der Strand menschenleer. Der Nebel hing tief und rührte sich nicht. Sie war froh, daß es so einsam war, in der Stille ließ sich gut nachdenken. In Lundy View House kam sie, solange Pauline dabei war, nicht dazu, und abends schluckte sie eine der Schlaftabletten, auf deren Einnahme [39] ihr Arzt bestanden hatte. Sie überlegte, warum sie den Seedunst so gern hatte. Vielleicht, weil er Gerald so verhaßt gewesen war? Die Möglichkeit war nicht von der Hand zu weisen. Sie mochte den Nebel, weil Gerald ihn nicht mochte, irgendwie hatte sie ihn dadurch in Besitz genommen, ihn zu ihrem heimlichen, unantastbaren Eigentum gemacht.
Vielleicht mochte sie ihn auch, weil er so vieles verhüllte – Lundy View House, die übrigen Häuser an der Steilküste, andere Menschen, Gerald. Der weiße Dunst verbarg alles außer dem sauberen, glatten Sand und den reinweiß oder blauschwarz glänzenden Muscheln. Allerdings mußte nun nichts mehr verhüllt, nichts mehr kaschiert werden. Genüßlich wiederholte sie das Wort: kaschiert… In einer fernen Vergangenheit hatte sie sich einmal vorgenommen, jeden Tag ein paar Fremdwörter zu lernen, mit denen sie ihm Eindruck zu machen hoffte.
Du Gans, dachte sie, aber es war ein abgeklärter Gedanke, unaufgeregt und leidenschaftslos.
Als sie sich umdrehte oder vielmehr rasch kehrtmachte, um – jetzt näher an der steigenden Flut – den Rückweg anzutreten, dachte sie (nicht zum erstenmal) über ihre Reaktion auf Geralds Tod nach. Sie hatte zumindest mit einem Schock gerechnet. Doch sie hatte so gut wie keine Erschütterung empfunden, allenfalls Überraschung und dann sehr schnell Erleichterung. Von Schuldgefühlen keine Spur. Irgendwo hatte sie gelesen – nicht zu fassen, wie viele Bücher und Periodika, Tageszeitungen, Wochen- und Monatsschriften sie im Lauf der Jahre verschlungen hatte! –, daß der Verlust eines Menschen den traurig-bitteren Wunsch [40] mit sich bringt, den Toten zurückzubekommen, und sei es nur für wenige Stunden, um jene Fragen zu stellen, die immer dagewesen waren, die man aber zu seinen Lebzeiten nicht gestellt hatte. Ja, dachte sie, ich würde gern wissen, warum. Warum hast du mir das angetan, warum hast du mir so viel genommen? Warum hast du mich meinen Kindern gegenüber ins zweite Glied – ach was, viel weiter zurückgedrängt? Warum hast du mich geheiratet? Nein, warum wolltest du mich heiraten? Nur würde sie dazu einen anderen Menschen ins Leben zurückholen müssen. Der Gerald, den sie kannte, würde ihr keine Antwort geben.
Plötzlich mußte sie an Mrs. Eady denken. Seit Jahren hatte sie nicht mehr an Mrs. Eady gedacht. Eine hochgewachsene, traurige alte Frau mit einer Tochter, die Nonne war, und einem ermordeten Sohn, dessen Foto in einem Silberrahmen neben einer kleinen grün gesprenkelten Vase stand. Sie sah das Bild so deutlich vor sich, wie sie den Sand und die Muscheln sah. Knapp ein Jahr danach waren sie aus Hampstead hierher an die Steilküste, in ein Haus mit Blick auf den Bristol Channel und Lundy Island gezogen.
Der Nebel lichtete sich. Ursula kannte den Seedunst an diesem Küstenstrich und wußte, daß er heute den ganzen Tag nicht ganz verschwinden, sondern immer wieder kommen und gehen würde. Der weiße Vorhang hatte sich ein kleines Stück gehoben, war ein wenig durchlässiger geworden, so daß dunstig-blasse Sonnenstrahlen hindurchfanden. Sie konnte jetzt das Hotel erkennen, die zu flachen Giebel, die Dachziegel in der Farbe der sich in unzähligen Körben spreizenden Hängegeranien. Der Vorhang enthüllte es fast kokett, als stünde am Strand eine [41] Zuschauermenge, die begierig darauf lauerte, einen Blick auf seine Reize zu tun.
Kurz kam auch ihr Haus in Sicht, das jetzt im Wortsinne ihr Haus war. In dem sie nicht nur Wohnrecht auf Lebenszeit, nicht nur lebenslange Nutznießung hatte, sondern das ganz und gar ihr gehörte. Genau wie die künftigen Tantiemen und – mit Ausnahme von großzügigen Legaten an Sarah und Hope – alles, was er besessen hatte. Das Testament hatte sie viel stärker erschüttert als sein Tod. Sie hatte auf diesen Strandspaziergängen ausgiebig darüber nachgedacht und war zu dem Schluß gekommen, daß er mit seinem Letzten Willen etwas bei ihr gutmachen wollte, daß er, wenn er sie schon nicht liebte, zumindest das Gefühl hatte, ihr etwas zurückzahlen zu müssen. Daß er in ihrer Schuld stand, weil er sich ihres Lebens bemächtigt und es mißbraucht hatte.
Oben an der Steilküste war Pauline aus dem Haus gekommen und stand winkend am Gartentor. Ursula winkte zurück, wenn auch weniger lebhaft. Später, beschloß sie, würde sie etwas scheinbar ganz Ungewöhnliches tun: Sie würde ihre Nichte auf einen Drink in die Hotelbar einladen.
Unvermittelt, aber für Ursula nicht unerwartet, senkte sich der Seedunst wieder und entzog die noch immer winkende Pauline ihrem Blick.
[42] 3
Der Mensch glaubt alles, was in der Zeitung steht, bis er eine Meldung über sich findet, die erstunken und erlogen ist. Ihm kommen Zweifel, die jedoch nicht lange vorhalten, schon bald kehrt der alte Glaube an das gedruckte Wort zurück.
Anziehungskraft
Nach Lundy View House wurden jeden Morgen drei Tageszeitungen geliefert. Ursula hatte diese Gepflogenheit beibehalten, damit Pauline zum Frühstück etwas zu lesen hatte, wollte den Zeitungsjungen aber abbestellen, sobald ihre Nichte fort war. Sie freute sich auf den Tag, an dem keine Zeitungen mehr herumliegen würden. Sie selbst sah, während sie ihre Grapefruit und ihren Toast aß, gerne auf den Strand hinaus.
Heute früh war das Meer ruhig, tiefblau und ohne die smaragdfarbenen Streifen, die es sonst so oft durchzogen, und über dem Wasser wölbte sich ein wolkenloser Himmel in lichterem Blau. Die Flut lief ab, und auf dem noch feuchten Sand baute ein Elf- oder Zwölfjähriger eine kunstvolle Sandburg mit Bergfried, Zinnen und Graben. Ein Mann mit zwei kleinen Kindern versuchte, einen großen rotweißen Drachen steigen zu lassen, der sich aber, weil nicht genug Wind war, nicht in die Lüfte erheben wollte. Er erinnerte sie an Gerald, der auch Drachen hatte steigen lassen und unzählige Sandburgen gebaut hatte.
[43] »Ist dir schon mal aufgefallen«, fragte Pauline und sah von ihrer Zeitung auf, »daß eine simple Tatsache nie erwähnt wird, wenn von Arbeitslosigkeit die Rede ist? Fünfzig Prozent aller Arbeitslosen haben wir deshalb, weil so viele Frauen arbeiten. Wenn die Frauen nicht arbeiten würden, wären die Männer nicht arbeitslos, aber keiner traut sich, das laut zu sagen.«
»Es wäre politisch nicht korrekt«, sagte Ursula.
»Hättest du gern einen Job gehabt? Abgesehen von deiner Arbeit für Onkel Gerald natürlich.«
»Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, in dem Hotel babysitten zu gehen. Sie suchen immer Leute.«
Pauline sah prüfend zu ihr hinüber, um festzustellen, ob das ernst gemeint war. Ursulas Gesicht war ausdruckslos.
»Aber gemacht hast du es dann doch nicht?«
»Gerald konnte sich nicht dafür begeistern.«
»Kein Wunder! Die Frau eines berühmten Schriftstellers, die für zwei Pfund die Stunde anderer Leute Kinder hütet…«
»Es waren drei Pfund«, sagte Ursula. »Wenn du fertig bist, räume ich schon mal ab, das mache ich immer gern, ehe Daphne kommt. Nein, bleib nur sitzen und lies deine Zeitung.«
Als sie wieder ins Zimmer kam, um die Kaffeekanne zu holen, sagte Pauline: »Hier schreibt jemand was über Onkel Gerald. Möchtest du es sehen?«
»Nicht unbedingt.« Ursula, die unter der Vorlesewut ihrer Nichte schon viel gelitten hatte, seufzte leise, sagte dann aber doch: »Laß hören.«
[44] »Eine ganz komische Sache. Richtig mysteriös. ›Von dem Herausgeber der Modern Philately‹, steht da.«
»So macht die Times das immer.«
»Wirklich komisch. Jetzt hör zu: ›Sehr geehrte Herren! Ein Wort zu Ihrem Nachruf auf den Schriftsteller Gerald Candless (Nachrufe, 10. Juli). Der Verfasser schreibt, der verstorbene Mr. Candless sei in den Nachkriegsjahren als Journalist beim Walthamstow Herald tätig gewesen. Ich war von 1946 bis 1953 Chefredakteur des genannten Blattes und kann Ihnen versichern, daß ich, hätte dieses bescheidene Presseorgan das Glück gehabt, einen Trinity-Absolventen und Romanschriftsteller, der es zu Weltruhm bringen sollte, zu seinen Mitarbeitern zu zählen, diese seltene Ehre gewiß nicht vergessen hätte. Leider muß ich Ihnen mitteilen, daß Sie sich im Irrtum befinden, wenn Sie von Gerald Candless als einem ›Alumnus‹ des Walthamstow Herald sprechen. Mit vorzüglicher Hochachtung, James Droridge.‹ Was ist ein Alumnus?«
»Jemand, der einmal dazugehört hat.«
»Ach so. Warum haben sie geschrieben, daß Onkel Gerald für dieses Blatt gearbeitet hat, wenn es nicht stimmt?«
»Das weiß ich nicht, Pauline. Solche Fehler kommen eben vor.«
Melodische Klänge aus der Küche kündigten Daphne Batty an. Zu den Klängen von Merle Haggards ›Today I Started Loving You Again‹ trug Ursula die Kaffeekanne hinaus. Daphne hatte die Daily Mail mitgebracht und brannte darauf, Ursula das Interview, das Mary Gunthorpe mit Hope gemacht hatte, zu zeigen, hatte aber offenbar nicht die Absicht, es ihr vorzulesen.
[45] Die Überschrift lautete: »O mein geliebter Vater! Hopes Hoffnung ist dahin.«
Ursula fügte sich in das Unvermeidliche. Sie mußte an Gerald denken, der immer wieder wild entschlossen gewesen war, die Rezensionen seiner Romane nicht zu lesen, und ihnen doch nie hatte entkommen können. Früher oder später rief jemand an und erzählte ihm davon, schickte ihm die Artikel mit rot angestrichenen Stellen oder zitierte in einem Brief daraus. Daphne würde ihr die Zeitung dalassen, Pauline würde sie finden, und dann stand ihr noch viel Schlimmeres bevor. Sie fing an zu lesen, und Daphne sah ihr über die Schulter.
»Er war ein großer, massiger Mann mit großflächigem Gesicht und breitem, ironischem Lächeln. Sie ist schlank, hat eine rosige Haut, trägt ihr dunkles Haar lang und weich gewellt, ihre Augen sind fast zu groß für das herzförmige Gesicht. Trotzdem ist die Ähnlichkeit zwischen Hope Candless und ihrem vor zwei Wochen verstorbenen Vater, dem berühmten Romancier, frappierend. Die gleiche wache Intelligenz in den gleichen braunen Augen, der gleiche durchdringende Blick, die gleiche wohltönende Stimme.
Gerade ist ihre Stimme ins Stocken gekommen, und ihre Augen stehen voller Tränen. Es ist ihr sichtlich peinlich, daß sie nicht mehr an sich halten kann, sobald die Sprache auf ihn kommt. Hope, in rosaweißem Hemdblusenkleid und weißen hochhackigen Sandalen (Jeans und T-Shirt wären bei ihr unvorstellbar), tupft sich mit einem spitzenbesetzten Taschentuch die Augen – das erste Mal [46] seit dem Tod meiner Großmutter vor zehn Jahren, daß ich ein Stofftaschentuch sehe, mit einem rosafarbenen H bestickt.
›Er fehlt mir so sehr‹, sagt sie. ›Er war nicht bloß mein Vater, sondern auch mein bester Freund. Hätte man mir gesagt, ich solle mir von allen Menschen auf dieser Erde einen aussuchen, mit dem ich mein Leben verbringen wollte, hätte ich wohl ihn gewählt. Finden Sie das jetzt ganz und gar verrückt?
Als wir die Todesanzeige für die Zeitung aufsetzten, meine Schwester und ich, brauchten wir ein Adjektiv, das ausdrückte, was wir empfanden. Geliebt war nicht stark genug, und so kamen wir auf vergöttert, er hatte für uns ja wirklich etwas Göttergleiches. Und die Zeilen aus dem viktorianischen Gedicht fanden wir besonders passend, weil wir tatsächlich ‘die Sonne plaudernd langgeweilt’ haben. Wir haben beide geglaubt, seine Lieblingstochter zu sein. Komisch, nicht? Aber ich denke, er hatte uns beide gleich lieb, er hatte ja so viel Liebe in seinem Herzen. Entschuldigen Sie, daß mir immer noch die Tränen kommen, Sie müssen mir das nachsehen, das hier habe ich nämlich von ihm, meiner Schwester hat er auch eine Wohnung geschenkt.‹
›Das hier‹ ist die lichte, geräumige Erdgeschoßwohnung einer Villa in Crouch End mit großem Innenhof und einem Garten voller Obstbäume. Der Verfasser von Die Waldnymphe und Goldpurpur kaufte sie für Hope, als sie vor sieben Jahren die Zulassung als Anwältin erhielt. Sie hat bei der Prüfung der Anwaltskammer als Zweitbeste abgeschnitten und ihren Abschluß in [47] Cambridge mit Auszeichnung gemacht. Ihre Schwester Sarah, zwei Jahre älter als Hope, ist Dozentin für Frauenforschung an der University of London.
›Sarah hat eine Eigentumswohnung in Kentish Town. Wissen Sie, was er gesagt hat? Ich wünschte, ich wäre ein reicher Mann, hat er gesagt, dann könnte ich euch etwas in Mayfair oder Belgravia kaufen. Er hat immer an uns gedacht. Als Kinder hatten wir ihn ständig um uns. Wenn wir nachts weinten, war er es, der aufstand und nach uns sah. Er spielte mit uns und las uns vor und unterhielt sich mit uns. Später habe ich mich gefragt, wann er dazu kam, seine Romane zu schreiben. Wahrscheinlich, wenn wir eingeschlafen waren.
Er hat uns nie bestraft, schon der Gedanke daran ist abwegig. Er konnte sehr wütend werden, wenn er von Leuten hörte, die ihren Kindern hin und wieder einen Klaps gaben. Bloß einen Klaps wohlgemerkt, ich spreche nicht von richtigen Mißhandlungen. Nur bei solchen Anlässen haben wir jemals erlebt, daß er in Wut geriet.‹
Wenn man Hope Candless so reden hört, könnte man denken, sie und ihre Schwester hätten keine Mutter. Oder eine Mutter, die diesem Musterexemplar von Ehegatten mit dem Milchmann durchgebrannt ist, so daß die kleinen Töchter mutterlos aufwuchsen. Doch Ursula Candless lebt – gesund und munter – in dem Haus in North Devon, das sie von ihrem Mann geerbt hat.
›Viele Leute würden sagen, daß sie fein raus war‹, sagt Hope. ›Die meisten Frauen jammern doch ständig, daß ihre Männer sich nicht um die Kinder kümmern, ja nicht [48] mal bereit sind zu helfen. Man hört immer von den Vätern, die ihre Kinder von Sonntagabend bis Freitagabend nicht zu Gesicht bekommen, ganz zu schweigen von denen, hinter denen das Jugendamt herlaufen muß. Nein, ich finde, meine Mutter hatte es wirklich gut.‹«
Ursula warf das Blatt angewidert hin. Sie hätte nicht weitergelesen, wäre nicht in diesem Moment Pauline in die Küche gekommen. Sie begrüßte Daphne mit einem knappen »Guten Morgen«, griff nach der Zeitung und las, wie Ursula befürchtet hatte, den Rest laut vor.
»Wo hast du aufgehört, Tante – ich meine Ursula? ›…wirklich gut‹, ja, ich hab’s schon. Jetzt weiter:
»Haben diese glückliche Kindheit und der hingebungsvolle Vater in Hope den Wunsch geweckt, sich selbst Kinder anzuschaffen? Und müßte ein Lebenspartner ein zweiter Gerald Candless sein?
›Ich bin sehr monogam‹, sagt sie. ›Irgendwie war es für mich kein Problem, eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen, angeblich tut man sich damit leicht, wenn man meine Art von Kindheit und Familienleben hatte. Ja, und eigene Kinder… da muß man mal abwarten.‹ Sie lacht und zückt dann, weil ihr einfällt, daß sie eigentlich gar nicht lachen dürfte, wieder ihr Taschentuch. ›Über Kinder haben mein Partner und ich noch nie ausdrücklich gesprochen.‹
Ihr Partner ist Anwaltskollege Fabian. Sie haben sich in Cambridge kennengelernt und sind seither ein Paar.
›Seit zwölf Jahren‹, sagt Hope. Liegt in ihrem Lächeln [49] eine Spur von Wehmut? Überraschend fügt sie hinzu: ›Wir verbringen die meisten Wochenenden zusammen und machen zusammen Urlaub, haben aber nie unter einem Dach gelebt. Wahrscheinlich finden Sie das eigenartig…‹
Vielleicht. Oder ist es einfach so, daß Hopes zweitwichtigste Bezugsperson sich nicht mit dem alles überragenden Vater messen kann?«
»Ziemlich schnöde,was?«
»Das ist noch milde ausgedrückt«, meinte Ursula.
»Du bist sicher froh, daß Hope und Fabian nicht zusammenleben, das würde in der Zeitung keinen guten Eindruck machen.«
Daphne zog mit dem Staubsauger ins Eßzimmer und trällerte dabei einen Schlager, den Ursula noch nie gehört hatte und der ›Tiptoe Through the Tulips‹ hieß.
Der Tag, als Pauline abreiste, war klar und sonnig, und morgens um neun waren schon viele Leute am Strand. Sie kamen über den privaten Klippenweg vom Hotel und von dem öffentlichen Parkplatz hinter der Eisbude und dem Laden, in dem man Eimer, Spaten und Luftmatratzen kaufen konnte. Einige kamen aus dem Dorf hinter den Dünen, andere vom Campingplatz in Franaton. Die Surfer in ihren Neoprenanzügen waren schon draußen, ehe Ursula und Pauline aufgestanden waren. Pauline sah von ihrem Frühstück hoch und fragte, warum Gerald sich gerade hier niedergelassen habe, obgleich er doch gar nicht aus Devon stammte. Das hatte sie noch nie gefragt. Ursula schüttelte [50] den Kopf und meinte, wahrscheinlich habe es ihm hier einfach gefallen. Wie den meisten Leuten.
»Entschuldige, Tante Ursula, ich vergesse andauernd, daß es dich aufregt, über ihn zu reden. Ich trete eben immer in sämtliche Fettnäpfchen. Auch das von den vielen arbeitenden Frauen hätte ich nicht sagen dürfen, wo Sarah und Hope so gute Jobs haben. Du wirst froh sein, wenn du mich taktlose Person endlich los bist.«
»Aber nein, Liebes«, schwindelte Ursula. »Es war sehr nett, daß du da warst. Du wirst mir fehlen.«
Zum Abschied schenkte sie Pauline eine signierte Erstausgabe von Anrufungen. Der Schutzumschlag mit der Zeichnung einer jungen Frau auf den Stufen eines palladianischen Tempels war nagelneu. Das Buch mochte an die dreihundert Pfund wert sein. Sie konnte nur hoffen, daß Pauline sich darüber im klaren war und es nicht verlieh oder wegschenkte, denn den genauen Wert konnte sie ihr natürlich nicht nennen.
»Ob ich das wohl verstehe?« fragte Pauline skeptisch. »Onkel Gerald war so gescheit.«
Am Bahnhof von Barnstaple war kein Parkplatz aufzutreiben, deshalb stieg Ursula nur kurz aus und gab Pauline einen Kuß, und Pauline sagte besorgt, sie hoffe, Ursula würde allein zurechtkommen. Ursula fuhr schnell weg.
Nach viertelstündigem Kreisen fand sie schließlich doch eine Parklücke. Sie ging zu Fuß in die Innenstadt und betrat den erstbesten Friseursalon. Sie war seit zwanzig Jahren nicht mehr beim Friseur gewesen. Ende der siebziger Jahre hatte sie sich das Haar wachsen lassen. Es war ein [51] Tiefpunkt, einer der schlimmsten Tiefpunkte in ihrem Leben gewesen. Sie waren seit sieben oder acht Jahren in Lundy View House, die Mädchen waren dreizehn und elf. Sie hatte ein anderer Mensch werden wollen, deshalb hatte sie versucht, die Pfunde wieder loszuwerden, die sie nach Hopes Geburt zugelegt hatte, und sich für langes Haar entschieden. Das waren zwei Möglichkeiten, etwas an sich zu ändern, ohne daß es etwas kostete.
Sie nahm fünfzehn Pfund ab, und das Haar reichte ihr zum Schluß bis zur Taille, aber sie war derselbe Mensch geblieben, nur daß sie jetzt dünner war und einen Zopf hatte, den sie am Hinterkopf hochsteckte. Falls Gerald oder den Kindern die Veränderung aufgefallen war, sagten sie nichts dazu. Inzwischen war ihr Haar fast grau. Pfeffer und Salz, wie es so schön hieß, oder Silberfäden im Gold, wie Daphne sagte, die den passenden Schlager dazu sang. Es war dünn und gesplissen und ging beim Bürsten büschelweise aus. Sie ließ es kurz schneiden, mit Stirnfransen.