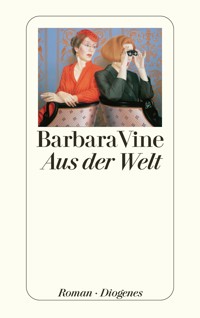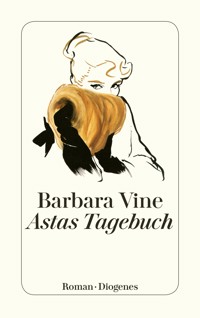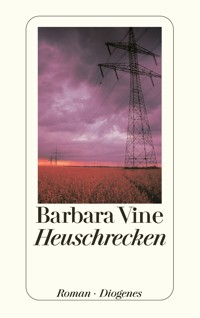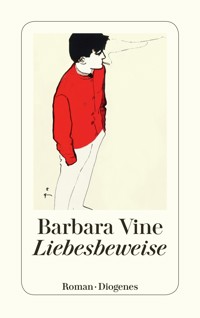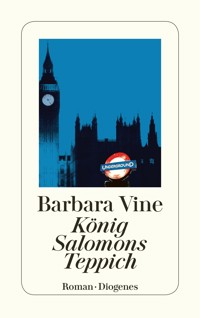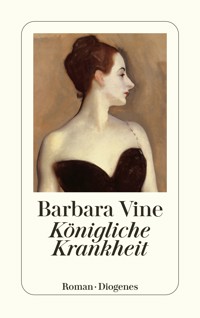11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die alte Dame Stella vererbt ihrer jungen Pflegerin Jenny ein leeres Haus im Moor und ein dunkles Geheimnis. Doch auch Jenny verbirgt etwas, das keiner wissen darf. Abgründig spannend und zutiefst beunruhigend zeichnet Barbara Vine das Doppelporträt zweier faszinierender, höchst unterschiedlicher Frauen, für die das Paradies der Erinnerung auch eine Hölle ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara Vine
Schwefelhochzeit
Roman
Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann
Titel der 1996 bei
Viking, London, erschienenen
Originalausgabe: ›The Brimstone Wedding‹
Copyright ©1995 by Kingsmarkham Enterprises Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien
1997 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Bernard Villemot, ›Une nuit en voiture-lit‹, 1973 (Ausschnitt)
Copyright ©2015, ProLitteris, Zürich
Viele der abergläubischen Bräuche in diesem Buch
habe ich dem Dictionary of Superstitions von Iona Opie
und Moira Tatem entnommen, denen ich an dieser
Stelle meine Anerkennung aussprechen möchte
für ihr Wissen und ihre Fachkenntnisse.
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright ©2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23102 1 (10.Auflage)
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] ERSTER TEIL
1
»Die Kleider der Toten halten nicht lang. Sie trauern dem nach, der sie getragen hat.« Stella lachte, als ich das sagte. Sie legte den Kopf nach hinten und ließ dieses erstaunlich mädchenhafte Lachen hören. Ich hatte ihr erzählt, daß in der Nacht Edith Webster gestorben war und volle Kleiderschränke hinterlassen hatte, und sie lachte und sagte, etwas so Abergläubisches wie ich wäre ihr noch nie vorgekommen.
»Ihre Enkelin ist jetzt hier«, sagte ich, »und verteilt das Zeugs an alle, die was haben wollen. Man sagt ja auch: Wie der Leib zerfällt, so zerfallen die Kleider.«
»Und wer ist ›man‹, Genevieve?«
Ich antwortete nicht, weil ich wußte, daß sie nur Spaß gemacht hatte. Aber ich hab es gern, wenn sie Genevieve zu mir sagt, denn seit ich auf der Welt bin, nennen mich zwar alle nur Jenny, aber getauft bin ich auf Genevieve. Mein Vater hat mich nach einem Oldtimer in einem Film genannt, das muß man sich mal vorstellen, und den meisten Leuten ist das ein bißchen peinlich, aber so, wie Stella den Namen sagt, klingt er richtig hübsch. Dazu kommt natürlich, daß sie eine hübsche Stimme hat, ja eine schöne Stimme, auch wenn sie über das Alter hinaus ist, wo von Hübschsein die Rede sein kann.
[6] Ich erzählte noch ein bißchen von Edith, Sharon hatte sie um sieben gefunden, als sie mit dem Tee zu ihr kam, und eine Stunde später war die Enkelin schon da, so eilig hat sie’s mit dem Herkommen zu Lebzeiten ihrer Großmutter nie gehabt. Ich bin nicht besonders taktlos oder unsensibel und hätte sofort aufgehört, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, der Tod einer anderen alten Dame könnte Stella zu sehr an die Nieren gehen. Aber was ich erzählte, interessierte sie echt, vielleicht weil sie meint, im Vergleich mit Edith noch richtig jung zu sein – die war nämlich vierundneunzig –, und weil sie denkt, daß sie noch viel Zeit vor sich hat, daß sie zu den Leuten gehört, die jahrelang mit ihrem Krebs leben können.
Sie ist jetzt seit einem halben Jahr in Middleton Hall. Theoretisch sind wir Pflegerinnen für alle Heimbewohner zuständig, aber jede von uns hat drei spezielle Pfleglinge, in meinem Fall waren das Stella und Arthur und Edith. Jetzt, wo Edith tot ist, werde ich wohl jemand anders bekommen, hoffentlich nicht jemanden, der allzuviel Pflege braucht. Nicht, daß ich die Arbeit scheue, ich bin während meiner Achtstundenschicht fast die ganze Zeit auf den Beinen – zu £ 3,50 die Stunde, was ja nicht gerade üppig ist –, und Arthur klingelt andauernd nach mir, nein, es ist einfach so, daß es schade wär, wenn ich weniger Zeit für Stella hätte. Ich hab sie nämlich wirklich gern, und das kann ich von Arthur oder Maud Vernon und den anderen so nicht sagen. Sie tun mir leid, ich versuche es ihnen so nett wie möglich zu machen, aber gern haben kann man die nicht mehr. Es ist, als wenn sie in eine Dämmerwelt abgetaucht wären, wo sie alles vergessen haben. Meist wissen sie gar nicht, wo sie sind, [7] und reden dich mit den Namen von irgendwelchen Angehörigen an, bis du ihnen sagst, daß du Jenny bist. Stella ist da anders, Stella ist noch voll da. Neulich hat sie zu mir gesagt: »Ich sehe in Ihnen nicht die Schwester, Genevieve, sondern die Freundin.«
Darüber habe ich mich gefreut, wahrscheinlich weil sie das ist, was Granny eine Lady nennen würde, oder doch jedenfalls jemand aus einer anderen Schicht, aber gesagt habe ich nur, daß es ganz richtig ist, mich nicht als Schwester zu sehen, weil ich nur Altenpflegerin bin. Ich hab die Erfahrung, aber nicht die nötigen Prüfungen.
Sie lächelte. Sie hat ein nettes Lächeln, alles noch eigene, ganz weiße Zähne. »Sie wissen ja, daß ich Ihretwegen hergekommen bin.«
Das sagt sie immer. Es ist natürlich Unfug, es ist gar nicht wahr, aber sie hat ihren Spaß daran. Ihr Sohn hat mit ihr eine Reihe von Altersheimen in Suffolk und Norfolk abgeklappert, sie sollte sich eins aussuchen, das ihr auch wirklich gefiel. Ich war mit Edith im Salon, als sie kamen, und nun sagt Stella immer aus Spaß, ich hätte ihr auf den ersten Blick gefallen und deshalb hätte sie sich für Middleton Hall entschieden. Ausschlaggebend sei nicht das Haus oder der Garten gewesen, nicht das Essen oder das eigene Badezimmer, sondern ich.
»Wie man sieht, habe ich es richtig gemacht«, sagte Stella. »Was täte ich ohne Sie!«
Sie hat es gern, wenn ich von unserem Dorf erzähle und von meiner vielköpfigen Familie, ich erzählte von meiner Mutter und ihrem Freund Len und von dessen Mutter, die von ihrer Schwester einen Pelzmantel geerbt hatte, und als [8] sie ihn zum erstenmal anziehen wollte, waren es nur noch lauter Fetzen. Ich erzählte ihr gerade, daß in den Kleidern von einer Toten plötzlich Löcher waren, als wenn die Motten reingekommen wären, da griff sie zu meiner Überraschung nach meiner Hand, drückte sie, hielt sie gut und gern fünf Minuten fest, dann drückte sie noch einmal zu und ließ los.
In diesem Augenblick steckte Lena den Kopf zur Tür herein und guckte mich auf diese besondere Art an, ich wußte natürlich, was los war, und stand auf, aber nicht mit einem Ruck, den Gefallen tat ich ihr nicht.
Stella zwinkerte mir zu. Sie lächelte dabei, und in dem Moment konnte man sich vorstellen, wie sie in meinem Alter ausgesehen hatte. Hoffentlich zeigt sie mir irgendwann mal Fotos von sich als junger Frau, die würde ich zu gern sehen. Daß man in ihrem Alter nicht mehr von Hübschsein sprechen kann, habe ich vorhin gesagt, aber man soll nicht verallgemeinern. Für Siebzig sieht sie nämlich noch toll aus. Kaum Falten im Gesicht, nur um die Augen, und die sind noch strahlend blau. Gewiß, das Haar ist weiß, aber dicht und wellig, eine Perücke, wie so viele sie hier tragen, hat Stella nicht nötig. Und leider wird sie auch nicht mehr so lange leben, daß sie je eine bräuchte. Sie zieht sich immer nett an, trägt Kleider und Strümpfe und anständige Schuhe, und irgendwie fuchst das Lena. Hinter ihrem Rücken – und nicht immer nur hinter ihrem Rücken! – nennt sie Stella »Lady Newland« oder »die Herzogin«, und dazu grinst sie, damit es nicht ganz so bösartig wirkt. Wahrscheinlich wär’s ihr lieber, wenn Stella wie die anderen in Jogginganzug und Strickjacke rumlaufen würde. Ich kann’s nicht erklären, [9] aber ich finde, gerade wenn die Leute älter werden, müßten sie sich um so mehr pflegen und das Beste aus sich machen. Stella bittet mich manchmal, ihr die Nägel zu maniküren und ihr das Haar zu legen, und das mache ich immer gern.
Sie ist also schon was Besonderes. Wenn sie eine Freundin in mir sieht, so gilt das auch umgekehrt, obgleich ich bisher noch kaum was über sie weiß. Dafür weiß sie sehr viel über mich: wie lange ich verheiratet bin zum Beispiel, daß ich mein ganzes Leben hier in Stoke Tharby verbracht habe, daß mein Mann Mike heißt und Maurer ist, daß meine Mutter ein Pub betreibt und mein Vater in Diss wohnt – und noch viele andere Sachen. Eins weiß sie nicht, das Größte und Wichtigste in meinem Leben, auch wenn es das gar nicht sein dürfte, aber vielleicht erzähle ich ihr auch das irgendwann mal. Von Stella weiß ich nur, daß sie ihr Haus in Bury St. Edmunds verkaufen mußte, um sich hier einzumieten. Daß sie zwei Kinder hat, weiß ich auch, weil die sie besuchen kommen. Was heißt Kinder… Der Sohn ist so alt wie ich, und die Tochter hat selber schon Nachwuchs im Teenageralter.
Bury St. Edmunds liegt zwanzig Meilen südlich von hier, hinter den Brecklands und der Gegend, die wir den Plough nennen. Stella hat ihr Haus dort verkauft, als sie zu krank geworden war, um allein zu leben, und sich allmählich mit dem Gedanken anfreunden mußte, daß sie Pflege brauchte. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen – so hab ich es mal irgendwo gelesen –, wie viele Altersheime es heutzutage gibt und wie viele Alte, Hunderte und Aberhunderte, die darauf warten, einen Platz zu bekommen. Und fast alle mußten ihre Häuser verkaufen, um sich das Heim leisten zu [10] können, und haben damit, wenn man so will, die Nachkommen um ihr Erbe gebracht.
Das Geld stecken dann Leute wie Lena ein. Dabei gehört Middleton Hall wirklich zur Spitzenklasse. Früher war es ein Herrenhaus, es hat einen wunderschönen Park mit herz- und rautenförmigen Blumenbeeten, Thujen- und Eibenhecken, einem Seerosenteich und einem großen Bestand alter Kastanien. Für Lena spricht, daß sie tierlieb ist, wir haben zwei Labradorhunde und drei Katzen im Haus, die ja so gut für alte Leute sein sollen. Allerdings können unsere Alten für das viele Geld, das sie zahlen, ja auch allen modernen Komfort, Haustiere und Gourmet-Mahlzeiten verlangen. Mindestens. An meinem ersten Tag hab ich nicht schlecht gestaunt, als Sharon vor dem Abendessen Aperitifs gereicht hat, Dry Martinis, wie sie immer in amerikanischen Büchern vorkommen, mit japanischem Reisgebäck und Macadamianüssen in kleinen Schälchen. Aber warum nicht? Ich finde es furchtbar, wenn man alte Leute wie Kinder behandelt.
Stella hat ein schönes Zimmer mit Blick über die Wiesen auf den Fluß und die Wälder. Wenn sie will, kann sie von ihrem Zimmer aus direkt auf die Terrasse und in den Garten gehen, aber das macht sie selten. Sie sitzt mit den anderen im Salon, zum Aperitif ist sie immer da und trinkt Gin mit was drin, das war wohl in ihrer Jugend modern. Meist ißt sie auch im Speisesaal, aber an einem Einzeltisch, sie ist sehr zurückhaltend. Ansonsten ist sie viel auf ihrem Zimmer, liest, guckt Fernsehen und macht jeden Tag eins dieser Kreuzworträtsel, bei denen man um die Ecke denken muß und mit denen ich nicht zurechtkomme.
[11] Alle Zimmer haben ein Einzelbett und einen Kleiderschrank, einen Couchtisch und zwei Sessel, und manche Bewohner haben auch noch eigene Möbel. Stella hat einen Nußbaumschreibtisch mitgebracht, wunderschön gemasert und auf Hochglanz poliert. Das macht sie bestimmt selber, Mary hält sich mit so was nicht auf. Sie hat Fotos und Bücher, und an die Wände hat sie ein paar Bilder gehängt. An den Fotos ist nichts Geheimnisvolles, das von ihrer Marianne sieht aus, als wenn die Agentin gesagt hätte, wir brauchen wieder mal ein Bild für die Fernsehproduzenten und solche Leute. Auf einem ist ihr Richard zu sehen in schwarzer Robe und so einem viereckigen Hut, wie man sie an den Unis trägt. Und dann gibt es noch eins, auf dem Mariannes Kinder noch klein sind. Inzwischen stehen sie auf schwarzes Leder und haben mehr Ringe in den Ohren, als auf einer Gardinenstange Platz hätten. Bilder von Stellas verstorbenem Mann gibt es keine, er glänzt durch Abwesenheit.
Ich weiß weder, wie er hieß, noch was er gemacht hat, wann er gestorben ist oder sonstwas, und das ist nun doch geheimnisvoll. Stella ist mir überhaupt ein Rätsel. Sie spricht nie über ihren Mann, sie erwähnt nicht mal, daß sie einen hatte. Sie spricht überhaupt nicht über die Vergangenheit, und das ist in so einem Heim sehr ungewöhnlich, weil die meisten nur dieses eine Gesprächsthema haben, die Vergangenheit nämlich. Und bei manchen, Maud Vernon zum Beispiel, ist es eine ganz ferne Vergangenheit, man hat den Eindruck, daß für sie die Welt 1955 stehengeblieben ist. Neulich hat sie mich gefragt, ob es Schokolade noch auf Marken gibt.
[12] Stella aber lebt in der Gegenwart, das ist unser Gesprächsthema. Wir sprechen über das, was die Nachrichten bringen und was im Fernsehen läuft, wir sprechen über neue Filme, auch wenn wir die immer erst sehen, wenn sie auf Video rauskommen, ob nach der neuesten Mode die Röcke zehn Zentimeter über dem Knie oder dreißig Zentimeter darunter aufhören, über das, was sich im Dorf und in Middleton Hall tut und was ich mache – soweit ich es rauslasse. Sie sagt, daß ich ihr fehle, wenn ich freihabe, und ich muß sagen, daß auch sie mir fehlt. Im Grunde spricht sie sehr wenig über sich. Warum habe ich jetzt immer stärker das Gefühl, sie würde gern ganz viel von sich erzählen? Vielleicht, weil sie mich ab und zu so prüfend ansieht? Weil sie manchmal plötzlich das Thema wechselt, als ob sie am liebsten ein Geständnis machen würde? Vielleicht auch nur, weil sie mitunter Sätze anfängt und dann aufhört und lächelt oder den Kopf schüttelt.
Mein Dienst fängt um acht an, das paßt mir ganz gut in den Kram, ich bin Frühaufsteherin, und wenn Mike die Woche über weg ist, wie jetzt bei seinem neuen Job, ist im Haus nicht viel zu machen. Vom Dorf zum Altersheim sind es nur ein paar Meilen. Wenn ich komme, hole ich zuerst die Post. Zeitungen und Briefe liegen in einem Metallkasten mit Deckel hinter dem Schild am Tor. »Middleton Hall. Seniorenresidenz« steht darauf, und links von dem Namen ist – warum, das weiß kein Mensch – ein gemalter Dachs und rechts davon eine gemalte Glockenblume. In dem Postkasten sind immer jede Menge Zeitungen, ein dicker Stoß, aber nur wenige Briefe und Postkarten. [13] Manche von unseren Alten bekommen nie einen Brief, und daß jemand mehr als einen pro Woche bekommt, ist eher selten.
An dem Tag von Edith Websters Beerdigung – es war der dreizehnte – waren nur drei Umschläge in dem Kasten, zwei für Mrs. Eileen Keep, das ist Lenas richtiger Name, und einer für Mrs. S. M. Newland. Natürlich der übliche Packen Zeitungen, dazu Arthurs Economist und Lois Freemans Woman’s Own. Der Brief für Stella war in einem festen braunen Umschlag, etwa 12 Zentimeter breit und an die dreißig Zentimeter lang und so dick, als ob was Steifes drin gefaltet wäre. Ich meinte zu wissen, was es war, und mir wurde ein bißchen mulmig.
Die Hunde liefen mir entgegen, das machen sie immer, und sprangen an mir hoch, und Ben, der frechere, versuchte mir das Gesicht zu lecken. Wir Altenpflegerinnen tragen keine Tracht wie richtige Krankenschwestern, sondern nur weiße Nylonkittel über unseren normalen Sachen, aber ich hatte mich schon für Ediths Beerdigung hergerichtet, deshalb scheuchte ich die Hunde weg und stauchte sie tüchtig zusammen. Als ich meinen Kittel und meine Turnschuhe angezogen hatte, schrieb ich die einzelnen Namen auf die Zeitungen, legte sie auf den Tisch im Salon und ging mit dem Brief zu Stella.
Sie war auf, aber noch nicht angezogen. Sharon oder vielleicht auch Carolyn hatte ihr das Frühstück gebracht, und sie saß im Morgenrock am Tisch. Es ist ein gesteppter Morgenrock aus schwarzem Satin mit roten Biesen an Kragen und Manschetten, mehr das, was Mum einen Hausmantel nennen würde. Stella hatte gebadet und sich gekämmt, aber [14] sie sah ein bißchen mitgenommen aus, wie man das morgens oft in ihrem Alter hat. Geschminkt hatte sie sich noch nicht, aber auf ihren Nägeln war dunkelroter Lack. Ich finde das furchtbar, und wenn sie mich manchmal bittet, ihr die Nägel zu lackieren, mache ich es nicht gern. An alten, bläulich geäderten Händen sieht das häßlich aus, aber das kann ich ihr nicht sagen. Nicht mal eine gute Freundin kann einem so was sagen.
Stellas Stimme klingt weder heiser noch greisenhaft, sondern ganz jung und irgendwie unberührt. Wie die Stimme von einem dieser gescheiten jungen Dinger an einer vornehmen Privatschule, das noch keine Erfahrungen im Leben gemacht und keine Sorgen hat. »Guten Morgen, Genevieve«, sagte sie lächelnd, das sagt sie immer, und dann fragte sie, wie es mir geht, und ich fragte, wie immer, ob sie gut geschlafen hätte und wie sie sich fühle. Eigentlich soll ich ja ihre Zeitung zu den anderen in den Salon legen, aber ich hatte ihr die Times mitgebracht und gab sie ihr zusammen mit dem dicken braunen Umschlag.
Komisch, wenn Leute etwas ganz dringend anschauen wollen, ist es nicht so, wie man es immer im Fernsehen sieht, daß ihr Gesicht aufleuchtet oder sie die Augen zusammenkneifen, nein, ihr Gesicht wird ganz leer. Stella zuckte nicht mit der Wimper, als ich ihr den Umschlag gab. Ich hatte das Gefühl, daß sie ihn am liebsten sofort aufgerissen hätte, aber weil ich dabei war, zwang sie sich, ganz langsam und ordentlich und wie unbeteiligt die Klappe hochzuziehen. Stella macht oft ihr Bett selber, heute aber war es noch nicht gemacht, da hatte ich etwas, womit ich mich beschäftigen konnte. Ich drehte mich um und zog das Laken zurecht, [15] und als ich auf die andere Seite ging, sah ich, daß sie das, was in dem Umschlag war, rausgenommen hatte, es lag in ihrem Schoß.
›Das, was in dem Umschlag war‹, sage ich, aber natürlich glaubte ich zu wissen, was es war. Ich hatte es gewußt, sobald ich den Brief aus dem Postkasten genommen hatte. In so einem Umschlag und bei diesem steifen, pergamentartigen Papier konnte es nur ein Testament sein.
Stella hatte sich offenbar überzeugt, daß alles seine Richtigkeit hatte, daß es das war, was sie erwartete, jetzt konnte sie es erst mal beiseite legen. Ob ich zu Ediths Beerdigung gehen würde, wollte sie wissen. »Wenn es jemand aus meiner Gruppe ist«, sagte ich, »geh ich immer hin«, und dabei ließ ich es bewenden.
Ich wünschte, ich hätte es irgendwie taktvoller ausdrücken können, aber Stella nickte nur. »Warum tragen Sie nicht Schwarz, Genevieve? Sie sind sonst so konservativ, ich hätte erwartet, daß Sie in Schwarz zur Beerdigung gehen.«
Ich hätte ihr die Wahrheit sagen können, daß ich nichts Schwarzes habe, aber damit hätte ich sie vielleicht in Verlegenheit gebracht, deshalb zog ich den Kittel aus, zeigte ihr, daß ich meine Jeansjacke und den Jeansrock anhatte, und sagte, und das stimmte ja auch: »Blau schützt, es ist eine Glücksfarbe.«
»Ich hätte mir denken können, daß irgendein Aberglaube dahintersteckt. Sie brauchen also Schutz bei einer Beerdigung?«
Ich finde, daß man überall und jederzeit Schutz braucht, aber das sagte ich nicht laut. Ich erzählte ihr von Granny, [16] die eine blaue Glasperlenkette trägt, damit sie keine Arthritis kriegt.
»Und hilft das?«
»Meiner Granny hat noch nie im Leben was weh getan«, sagte ich, weil ich wußte, daß sie das zum Lachen bringen würde, denn vielleicht wär das bei Granny ja auch ohne blaue Perlen so.
Stella lachte wirklich, aber es war ein nettes Lachen. In meiner Familie haben alle große Achtung vor den Mächten, die über uns wachen, Granny und Mum und meine Schwester Janis und mein Bruder Nick, ja sogar mein Dad, auch wenn er es abstreitet. Aber da soll mir mal einer erzählen, es ist kein Aberglaube, die Socke nicht zu wechseln, wenn man sie verkehrt herum angezogen hat, und zu sagen, daß es Ärger gegeben hat, weil man einem grünen Auto begegnet ist! Allerdings mögen wir das Wort Aberglauben nicht sehr, wir sprechen lieber vom Übersinnlichen oder von geheimnisvollen Mächten. Stella war das Datum wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, oder sie hatte sich nicht groß was dabei gedacht. Aber ich brauchte heute viel Glück, weil ich mir von diesem Abend etwas Schönes erhoffte. Und an einem Dreizehnten kommt das Glück nicht von selbst, man muß es sich schon nehmen.
Als ich mit dem Bett fertig war, kümmerte ich mich um Stellas Wäsche. Sie legt immer alles ordentlich zusammen und steckt es in den Wäschesack, so daß ich nicht viel Arbeit damit habe. Doch eins war an diesem Morgen anders: Sie beobachtete mich scharf. Ich spürte es sogar dann, wenn ich sie nicht ansah. Irgendwie hatte ich das Gefühl, daß sie sich jetzt jeden Augenblick einen Ruck geben und sagen [17] würde, sie müßte ein ernstes Wort mit mir sprechen. Mir wurde immer mulmiger. Ich ging ins Badezimmer, legte frische Handtücher raus und klopfte dabei die ganze Zeit auf Holz. Gegen die Unterseite vom Waschtisch, gegen die Rolle mit dem Klopapier, sogar an Stellas Haarbürste. Als ich rauskam, hatte sie das Testament umgedreht oder eine Seite umgeblättert und sah mich lächelnd an.
Ich wußte, was jetzt kommen würde, aber ich wollte es nicht. Seien wir mal ehrlich: In diesen Heimen werden die Alten ständig beharkt – manipuliert ist das Fremdwort dafür, glaube ich –, die Schwester oder die Pflegerin in ihrem Testament zu bedenken. Auch hier in Middleton Hall. Lena hat es in mindestens zwei Fällen versucht, das habe ich selbst miterlebt. Ob sie es bei Edith geschafft hat, muß sich erst noch herausstellen. Jedenfalls hat sie immer an sie hingeredet, sie solle ihr Geld dahin geben, wo es am meisten Gutes tun könnte, und auch an die denken, die ihr »in der Rüste des Lebens« getreulich zur Seite gestanden haben. Sie könne jederzeit ihren Anwalt nach Middleton Hall kommen lassen, sie brauche es nur zu sagen. Und weil ich das alles kenne, will ich nichts damit zu tun haben. Bei dem Gedanken, daß manche Leute sagen würden, ich hätte nur so oft bei Stella gesessen, weil ich auf ihr Geld aus war, kriege ich eine Gänsehaut. Und bei der Vorstellung, daß ich eines Tages wirklich was von ihr erben könnte und mir eingestehen müßte, daß an dem, was die Leute sagen, vielleicht sogar was dran war, wird mir richtig schlecht.
Und deshalb war ich fest entschlossen zu verhindern, daß ich was erbe. Ich würde deutlich und vielleicht sogar grob werden müssen, und das wollte ich natürlich nicht, davor [18] hatte ich eine Heidenangst. Aber warum hätte sie sich sonst vom Anwalt ihr Testament schicken lassen? Und wer sonst sollte die – wie sagt man –, die Begünstigte sein wenn nicht ich, wo sie gestern noch gesagt hatte, daß sie in mir eine Freundin sieht? Ich lächelte nicht zurück, sondern fragte nur, ob ich die Terrassentür aufmachen sollte, es würde wohl wieder ein heißer Tag werden, und sie sagte: »Ja bitte«.
Während ich die Terrassentür aufmachte, klopfte ich wie verrückt auf Holz, ich krallte meine Finger in den Rahmen und traute mich kaum loszulassen, und ich dankte meinen Sternen, meinem Schutzengel, daß ich was Blaues angezogen hatte.
»Genevieve?« sagte Stella.
»Ja?« fragte ich brummig.
»Wissen Sie eigentlich, wie hübsch Sie sind?«
Ich fuhr zusammen, denn das hatte ich nicht erwartet. Aber da sieht man, daß es hilft, auf Holz zu klopfen. Irgendwas hatte Stella von dem Testament und von dem, was sie hatte sagen wollen, abgelenkt. Das Holz hatte die Macht, sie auf andere Gedanken zu bringen, und meine blauen Sachen hatten mich geschützt. Natürlich sagte ich nichts dazu, was soll man dazu schon sagen?
»Nein, nicht hübsch«, sagte Stella. »Das ist das falsche Wort. Schön. Sie sind ein schönes Mädchen, Genevieve.«
»Ich bin zweiunddreißig.«
Stella lachte. Sie hat eine so wunderschöne unschuldige Stimme. »Das ist noch sehr jung. Später werden Sie das begreifen. In Ihrem Alter sieht man es noch nicht so. Schade…« Sie seufzte, aber ich wußte nicht, warum. »Setzen Sie sich einen Augenblick, Genevieve.«
[19] »Ich kann mich nicht lange aufhalten«, sagte ich. Das sage ich sonst nie, wenn sie mich bittet, noch ein bißchen zu bleiben. Aber ich mußte immerzu das Testament angucken, es schien vor meinen Augen größer und größer zu werden. Ich meinte fast den Anfang lesen zu können: Dies ist der Letzte Wille von…
»Wir haben heute vormittag alle Hände voll zu tun«, sagte ich, »weil wir um zwei zu der Beerdigung gehen, Lena und Sharon und ich.«
»Ist Ihr Mann diese Woche in London?«
»Ja, bis Freitag.«
»Was bauen sie dort eigentlich?«
Ich erzählte ihr von den drei großen Häusern am Regent’s Park, die entkernt und in Luxuswohnungen umgewandelt wurden. Sie wollte wissen, wo die Bauarbeiter wohnten, in einem Hotel oder in einem Wohnheim. »Sie wohnen in einer Frühstückspension in Kilburn«, sagte ich, »das geht jetzt schon Wochen, und vor Weihnachten werden sie wohl nicht fertig werden.«
»Er fehlt Ihnen sicher.«
Komischerweise stimmt das sogar. So ganz verstehe ich selber nicht, daß ich in meiner Situation den einen Mann lieben kann, während mir der andere fehlt, wenn er weg ist, aber irgendwie ist es ein ganz gutes Gefühl, daß Mike mir fehlt. Andererseits heuchele ich nicht gern. Ich konnte mich nicht vor Stella hinstellen und ihr sagen, ich hätte Sehnsucht nach meinem Mann, ich könne den Freitag gar nicht erwarten. Sie sah mich durchdringend an, und ich überlegte: ›Wie soll ich es ihr beibringen?‹ Verrückt, dieser Gedanke, daß ich es ihr sagen könnte, ja daß sie die einzige war, der ich es [20] würde sagen können. Was wußte denn sie von so was? Verheiratet, verwitwet, zwei Kinder, jenseits von Gut und Böse. Was Sex ist, hat sie inzwischen längst vergessen, selbst wenn sie mal Spaß dran gehabt hat, was in ihrer Generation keine Selbstverständlichkeit ist.
Dann kam die nächste Überraschung.
»Sie haben mir mal gesagt, daß Sie gern Kinder hätten«, sagte sie. »Gibt es einen Grund, warum Sie keine bekommen können? Vielleicht hätte ich nicht fragen sollen. Wenn es ungehörig war, brauchen Sie nicht zu antworten.«
Mich haben noch nie Leute gefragt, ob sie was Ungehöriges zu mir gesagt haben, und ich mußte lachen. Sie zog die Augenbrauen hoch und lächelte vorsichtig. Und weil ich irgendwas antworten mußte, sagte ich: »Sie wissen ja, wie das ist: Man wartet einfach zu lange, ich meine, bei uns sind es jetzt dreizehn Jahre, man schiebt es immer wieder auf. Man will wohl auch seine Freiheit nicht aufgeben. Man sagt sich, okay, irgendwann, ist ja noch viel Zeit, aber das stimmt eben nicht.«
»Nein.«
Was ich gesagt hatte, war mehr oder weniger leeres Gerede. Für die Wahrheit hätte ich eine halbe Stunde gebraucht; außerdem wußte ich nicht, wie sie es aufnehmen würde. Ich stand auf, und sie schob das Testament wieder in den Umschlag. Mir fiel ein Stein vom Herzen. »Sie hätten wohl keine Lust, heute nachmittag mitzukommen?« fragte ich.
»Zu Ediths Beerdigung?« Das klang sehr erstaunt. Verständlicherweise. Ich hatte nur gefragt, um sie von dem anderen Thema abzubringen.
[21] »Wir haben einen Platz im Wagen frei. Sie brauchen nicht mit in die Halle. Es wird ein wunderschöner Tag, und die Außenanlagen sind sehr hübsch.«
»Die Halle?« fragte sie.
Sie wußte offenbar nicht, was ich meinte. »Das Krematorium«, sagte ich. Ein Wort, bei dem man einen Knoten in die Zunge kriegt.
Sie fröstelte. Manchmal zieht man, wenn einem kalt ist, die Schultern hoch und schüttelt sich dabei, vielleicht denkt man, daß einem wärmer davon wird, aber Stellas Frösteln war anders, es war, als wäre irgendwas von außen auf sie zugekommen, sie war kurz zusammengezuckt, und dann hatte sie angefangen zu zittern.
»Weshalb um alles in der Welt hat sie sich nicht für eine Erdbestattung entschieden?«
»Keine Ahnung«, sagte ich. Ich wußte nicht mal, ob es ihre Entscheidung gewesen war oder ob Lena es so geregelt hatte. »Sich verbrennen zu lassen ist hygienischer.«
»Es ist abscheulich«, sagte Stella für ihre Verhältnisse sehr heftig.
»Geschmackssache. Also Sie wollen nicht mitkommen? Sie könnten sich draußen in den Schatten setzen.«
»Nein, danke, Genevieve. Der Garten hier genügt mir vollauf.«
Sie hat es nicht ausgesprochen, aber ich wußte, warum sie nicht mitkommen wollte. Sie fährt nicht gern Auto. Wenn es unumgänglich ist, macht sie es natürlich. Als sie herkam zum Beispiel. Der nächste Bahnhof ist in Diss, und das sind zehn Meilen, da ging es nicht anders. Aber nur so zum Vergnügen würde sie sich nie in ein Auto setzen. Ich weiß nicht, [22] warum, vielleicht wird ihr schlecht beim Auto fahren. Ich frage nicht, es geht mich nichts an.
Granny sagt, daß bei einer Beerdigung immer Blut fließen muß, weil sonst der Geist der Toten keine Ruhe findet. Ich weiß, daß man diese Dinge ernst nehmen und daß man sich und andere schützen muß, aber irgendwo ist bei mir Schluß. Mir wurde ganz schlecht, als ich nach der Beerdigung von meinem Großvater den langen Schnitt an Grannys Hand sah. Sie hatte ihr Blut vergossen, damit er nicht herumgeistern muß.
Aber als dann Ediths Sarg in der Versenkung verschwunden war und in der Aussegnungskapelle die Vorhänge zugezogen wurden, bekam ich doch Bedenken. Gewiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn man es nicht macht und was Schlimmes passiert, kann es sich zu einer großen Sache auswachsen. Als Lena und Sharon sich vorbeugten und die Hände vors Gesicht legten, um zu beten, nahm ich die Brosche vom Revers, holte tief Luft und stach mir die Nadel in den Daumen. Es tat nur eine Sekunde weh. Ein dicker Blutstropfen kam raus.
Wir stiegen alle drei wieder in den Wagen und kamen uns vor wie in einem Backofen, weil er eine Dreiviertelstunde in der prallen Sonne gestanden hatte. Sharon setzte sich vorn neben Lena, ich mußte nach hinten, aber darüber war ich nicht traurig, denn Lena fährt wie eine Wahnsinnige. Mike nennt den Platz, wo Sharon saß, den Selbstmörderplatz, mein Dad sagt Schleudersitz dazu. Es ist der gefährlichste Platz im Auto, aber Leuten, die zu Reisekrankheit neigen, wird meist hinten schlecht. Vielleicht hat Stella mal einen [23] Autounfall miterlebt und hat dabei auf dem Selbstmörderplatz gesessen.
Hin waren wir über die Umgehungsstraße gefahren, aber zurück fuhr Lena uns durch den Ort. Durch Stoke Tharby, meine ich, mein Dorf. Als wir auf der Straße waren, die am Pub auf die High Street mündet, wurde mir klar, daß wir an dem Haus vorbeifahren würden. Es heißt ›Eberesche‹, aber aus einem ganz bestimmten Grund ist es für mich nur das Haus.
Lena donnerte mit sechzig Sachen den Hang hoch und auf der anderen Seite runter, was unheimlich leichtsinnig ist, weil auf dieser Straße zwei Autos nebeneinander keinen Platz haben. Ihr alter Schlitten hat hinten keine Sicherheitsgurte, deshalb hielt ich mich an ihrem Sitz fest; wenn ihr das nicht gefiel, konnte ich ihr auch nicht helfen. Ich war heilfroh, daß ich mir bei der Beerdigung in den Daumen gestochen und mir was Blaues angezogen hatte. Auf dem Rücksitz von Lenas Auto konnte man nicht auf Holz klopfen, da war überall nur Plastik. Schnellfahren ist wie Sekt, sagt Lena, sie freut sich schon auf ihr neues Auto, weil sie mit dem ohne weiteres auf hundert kommt, und ich wußte, daß sie an das Geld dachte, das sie sich von Edith erhofft.
Wir kamen heil unten an. Es war pures Glück, daß uns niemand entgegengekommen war. Sharon ist nicht von hier, sie kommt jeden Tag aus Norwich, und Lena zeigte ihr die Gegend. »Da wohnt Jenny«, sagte sie, »in der Sozialsiedlung.« Dabei hat die Gemeinde inzwischen alle Häuser verkauft, auch unseres, und die Siedlung heißt Chandler Gardens. Nur nicht bei Lena.
Sie zeigte Sharon die Kirche St. Bartholomew, das [24] Pfarrhaus und unsere Dorfgemeinschaftshalle. Sie fuhr jetzt ganz langsam, weil Sharon sich ein Cottage ansehen sollte, das gerade ein neues Strohdach bekam. Man hört ja oft von Liebespaaren, die um den Ort oder das Haus, wo der Partner wohnt, ein großes Getue machen. Wie in diesem Song aus My Fair Lady. In der Straße, wo du wohnst… Das ist doch bescheuert, habe ich früher gedacht, das sind doch bloß Ziegelsteine und Mörtel, wie kann man sich darüber so aufregen? Wie kann einem ein Haus größer und schöner und bedeutender vorkommen als alle anderen drum rum? So ein Quatsch, hab ich gedacht. Aber jetzt weiß ich, daß es damit seine Richtigkeit hat.
Dabei wohnt er nicht mal ständig dort. Es ist ein Wochenendhaus, und er und seine Frau kommen nicht jedes Wochenende her. Unter der Woche kommt er dann allein, da kommt er zu mir, und einmal haben wir uns dort auch getroffen. Aber warum kriege ich so blödsinniges Herzklopfen und einen trockenen Mund, wenn ich das Cottage auch nur sehe? Ich muß meine Hände festhalten, weil sie sonst zittern. Wenn du einen Vogel rettest und er dir unter den Händen stirbt, zittern dir danach dein ganzes Leben lang die Hände. Stella wollte es nicht glauben, aber es stimmt. So ist mir zumute, wenn ich das Haus ansehe, Neds Haus. Als ob ich mein ganzes Leben lang zittern müßte.
Es ist gar nicht besonders hübsch und nicht richtig alt und hat kein Strohdach, es ist hauptsächlich aus Holz und an das Backsteinhaus daneben angebaut. Lena guckte gar nicht hin. Warum beeindruckt es mich mehr als jedes Schloß? Warum hab ich mich umgedreht, damit ich es, praktisch auf der Rückbank kniend, bis zum letzten [25] Moment sehen konnte? Lena hätte der Schlag getroffen und Stella auch. Der Pikser von der Nadel ist zugeheilt, aber das Blut ist geflossen. Wenn ich heute abend Glück habe – ich muß einfach Glück haben –, ruft er an und sagt, wann wir uns treffen können.
Ich sah noch immer zu dem Haus zurück und wäre fast von der Bank gefallen, als Lena die Kurve zu schnell nahm. Daß wir in eine Vorfahrtsstraße einbogen, schien sie überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen. Die High Street war wie immer mit parkenden Wagen vollgestellt, aber das sieht Lena wohl nicht so eng.
»Malerisch, nicht?« sagte sie. »Ein bißchen wie aus der Spielzeugkiste, aber das macht nichts. Im letzten Jahr waren sie Sieger beim Wettbewerb um das schönste Dorf in Norfolk, stimmt’s, Jenny?«
»Im vorletzten«, sagte ich.
»Und dieses Pub mit dem drolligen Namen, ›Die donnernde Legion‹. Möchte wissen, warum es so komisch heißt.«
Ich klärte sie nicht auf. Und ich glaube, nicht mal Mum weiß die Antwort. Jahrelang hat sie den römischen Soldaten auf dem Wirtshausschild für eine Frau gehalten, weil er einen Lederschurz trägt. Ich weiß es von Ned. Von wem sonst? Lena zeigte Sharon die Weberhäuser, und die machte einen langen Hals, um sie sehen zu können, aber ich schloß die Augen und hielt den Glücksfarn fest, den ich gepflückt hatte, als wir aus der Aussegnungshalle gekommen waren.
[26] 2
Wenn man einen Menschen hintergeht, bedeutet das auch, daß man ihn zum Narren hält. Man zwingt ihn dazu, sich dumm zu benehmen, die Dinge nicht so zu sehen, wie sie sind, oder aber sich Dinge einzubilden, die sich so gar nicht zugetragen haben. Narren benehmen sich so oder Leute, die nicht alle Tassen im Schrank haben, wir sehen auf sie herab, oder wenn wir gemein sind, lachen wir sie aus.
Meine Freundin Philippa hat ein Video von einem Film über den Untergang der Titanic. Das Unglück ist lange her, achtzig oder neunzig Jahre, und damals behandelten Männer die Frauen noch wie mimosenhafte Wesen, von denen man alles Unerfreuliche oder Beängstigende fernhalten mußte. In dem Film bekommen die Frauen von den Männern nicht gesagt, daß das Schiff in einer Stunde sinken wird und nicht genug Rettungsboote da sind. »Wir werden ein bißchen später in New York einlaufen«, sagen die Männer, und die Frauen machen eine lächerliche Figur in ihrer Ahnungslosigkeit. »Es ist nicht gut für die Kinder, wenn wir sie wecken«, sagen sie und überlegen, ob sie ihren Friseurtermin absagen sollen.
So ist das mit jedem Betrug. Der Betrogene fragt, ob du krank oder müde bist, wenn du nicht mit ihm schlafen willst. Als er gestern abend anrief, bist du nicht ans Telefon gegangen, weil du nicht zu Hause warst, aber er läßt sich täuschen und sagt, wir sollten uns vielleicht noch einen Apparat ins Schlafzimmer legen lassen, du hörst es oben nicht immer läuten. Wenn du nicht ein ausgesprochenes Miststück bist, verbietest du dir den Gedanken, daß er sich selbst [27] zum Narren macht, aber ganz los wirst du ihn nicht. Das ist der erste Schritt zur Verachtung. Ich sage diese Dinge nicht gern, und ich tu nicht gern, was ich tun muß, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Zunächst jedenfalls. Bis sich was ändert.
Nach Möglichkeit lüge ich Mike nicht an. Das heißt, ich sage nichts, was nicht stimmt. Ich sage ihm nur nicht die ganze Wahrheit. Wenn er nach Hause kommt und fragt, was ich gemacht habe, erzähle ich ihm alles bis auf das eine. Aber ein ganz hoffnungsloser Fall bin ich wohl doch noch nicht, denn ich weiß natürlich, daß auch das eine Lüge, eine absichtliche Täuschung ist. Eins habe ich mir vorgenommen: daß ich Ned nie zu uns ins Haus lassen werde, das ja zur Hälfte auch Mikes Haus ist. Einmal war ich bei ihm. Es war dunkel, und ich hatte mich sehr vorgesehen, aber als ich am nächsten Tag in die ›Legion‹ kam, weil ich für Mum eingekauft hatte, stand sie allein hinter dem Tresen, sie hatten gerade erst aufgemacht, und sagte: »Shirley Foster hat dich gestern in die ›Eberesche‹ gehen sehen.« Sie guckte mich scharf an. »Ich hab gesagt, daß du ihnen die Eier vorbeigebracht hast.«
Mum hält sich Zwerghühner; es klang plausibel. »Okay, ich denk dran«, sagte ich.
»Ein bißchen aufpassen mußt du schon.« Sie war sehr cool. Nach der Ehe mit Dad war sie noch zweimal verheiratet, und der letzte Mann hat sie mit Len, ihrem jetzigen Freund, im Bett erwischt, mit Sitte und Anstand kann sie mir also kaum kommen. »Laß dir bloß nicht einfallen, dir deinen Märchenprinzen ins Haus zu holen. Das wäre dank Myra Fletcher am nächsten Tag in ganz Norfolk rum.«
[28] Ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Mum ist in Ordnung, sie würde nie was rauslassen oder auch nur Andeutungen machen, aber ins Vertrauen ziehen könnte ich sie nie. Ich könnte nicht sagen, ich liebe ihn, ich muß ihn sehen, wir müssen uns treffen, ich brauche ihn wie das tägliche Brot, ich würde verhungern ohne ihn. Sie würde mich auslachen. Sie würde ihre dröhnende Lache anschlagen und sagen, der ist fein raus, der Junge, Frau und Kinder in Norwich und eine Freundin auf dem Land, die dichthalten muß, weil sie selbst verheiratet ist. Keine Unkosten, nur das Benzingeld, er kann sie ja nicht mal auf einen Drink einladen. Sie würde mir nicht abnehmen, daß es nicht so ist, wie sie sagt, daß er genauso empfindet wie ich, daß ich sein Leben bin und daß er ohne mich sterben würde, und ich höre sie fragen: Wie alt bist du eigentlich, Jenny? Zweiunddreißig oder fünfzehn?
Seitdem treffen wir uns immer noch hier in der Nähe, aber nicht bei ihm zu Hause und bei mir natürlich erst recht nicht. Er kommt unter der Woche her, und weil Sommer ist und noch dazu ein schöner Sommer, suche ich uns Plätze, von denen sonst kaum jemand weiß, ein Versteck im Moor oder im Wald. Wir begegnen dort nie einer Menschenseele. Auf den Feldern sind keine Landarbeiter mehr wie früher, als ich Kind war, die ganze Arbeit machen jetzt Maschinen, und spazieren geht heutzutage auch keiner. Die Landschaft ist menschenleer, und an den Sommerabenden liegen wir im hohen Gras oder auf einer Lichtung und lieben uns. Heuschober gibt es heute kaum noch, meist wickeln sie das Heu zu diesen Biskuitrollen auf, nur die Strohdecker haben noch welche, sie bauen das Getreide mit diesen altmodischen [29] langen Halmen an, die sie für ihre Dächer brauchen, und letzte Woche habe ich einen Heuschober gefunden, der hatte innen einen Hohlraum wie ein Zimmer. Die Sommerabende sind lang und warm, und den Gedanken daran, was werden soll, wenn der Winter kommt, versuche ich erst mal zu verdrängen.
Zu Mum hab ich natürlich von all dem nichts gesagt, sondern schnell das Thema gewechselt, aber als ich mich schon verabschiedet hatte, ist sie mir nachgegangen und hat mir ihr Weißdornamulett gegeben. Dornbüsche sind angeblich Glücksbringer, weil es heißt, daß Jesus unter einem Dornbusch zur Welt gekommen ist, allerdings hab ich mein ganzes Leben auf dem Land verbracht und noch nie einen Hagedorn in einem Stall wachsen sehen. Mums Amulett ist ein geschnitztes Stück Holz, das man sich an einem Riemchen um den Hals hängt, eine Zierde ist es nicht gerade, aber ich hab es umgehängt, um mich und Ned vor den Shirley Fosters und Myra Fletchers dieser Welt zu schützen. Am nächsten Tag hatte ich es noch um, und Stella fand, daß es »interessant« aussieht.
Und da hätte ich ihr am liebsten wieder von Ned und mir erzählt. Es würde mir guttun, ich habe sonst niemanden. Und als sie von Mike anfing und wissen wollte, ob er die Woche über wieder nicht da wäre, hatte ich es schon auf der Zunge. Was hält mich zurück? Vielleicht ihr unschuldiger, fast kindlicher Blick. Sie ist nicht kindisch, das meine ich nicht, ich hab sie noch nie was Dummes sagen hören oder erlebt, daß sie einen Koller gekriegt hätte. Aber ihre Stimme ist so sanft und jugendlich, sie redet ganz schlicht und echt, ohne jedes Getue, und diese klaren blauen Augen sehen [30] einen an, als wenn sie überhaupt nicht wüßten, was ein Geheimnis ist.
Ich sage nichts, weil ich mir denke, daß sie schockiert wäre. In ihrer Welt ist kein Platz für Liebesgeschichten – außereheliche Liebesgeschichten, meine ich. Ich habe noch nie eine so wirklich feine Frau wie Stella kennengelernt. »Puppig« sieht sie aus, würde Granny sagen. Wie eine Porzellanpuppe, die nicht wie ein kleines Mädchen, sondern wie eine alte Dame hergerichtet ist. Beim Husten hält sie sich die Hand vor den Mund, und die Lippen wischt sie sich mit einem Zellstofftuch ab, auf dem Rosenknospen sind. Nur die langen scharlachroten Fingernägel passen nicht dazu. Der Anblick geht mir immer durch und durch. Es ist ein ganz sonderbares Bild – das wellige weiße Haar, der Hauch von Rouge und Puder, Perlenkette, geblümtes Seidenkleid und im Schoß diese knotigen alten Hände mit Saphir- und Brillantringen und blutroten Nägeln.
Aber sie trinkt auch Gin. Und sie raucht. Sie hat mir oft erzählt, daß sie seit wer weiß wann vierzig Zigaretten pro Tag geraucht hat, angefangen hat sie mit siebzehn. Irgendwie paßt das zwar zu den roten Nägeln, aber nicht zu der sanften Stimme und den blauen Augen. Ich hab so viele Hollywoodfilme auf Video gesehen, daß ich mir genau vorstellen kann, wie sie in den vierziger Jahren ausgesehen hat – langes, blondgewelltes Haar und Zigarettenspitze. Aber was sie dann sagte, hat mich doch sehr betroffen gemacht.
»Deshalb habe ich jetzt Lungenkrebs, aber damals wußte man noch nicht, wie schädlich das Rauchen ist. Alle rauchten. Und die wenigen, die es nicht taten, galten als Greenhorn.«
[31] Sie mußte mir das Wort erklären.
»Als unbedarft, als nicht ganz trocken hinter den Ohren.«
Ich räumte die Frühstückssachen ab, und als ich die Teetasse vom Nachttisch nahm, sah ich den langen Umschlag, in dem das Testament gekommen war. Er lag in dem Buch, das sie gelesen hatte. Wo mochte das Testament sein? Hatte sie sich vielleicht einen Anwalt kommen lassen, als ich meinen freien Tag hatte? Wenn ich Glück hatte, war die Sache damit erledigt. Und dann sagte sie so leise, daß ich noch mal nachfragen mußte: »Ich bereue nicht, daß ich geraucht habe. Es hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ich über manche Dinge ohne Zigarette weggekommen wäre.«
Darauf ließ sich nicht viel sagen. Ich lächelte und machte die Terrassentür auf.
»Könnte ich mein Leben noch einmal leben, würde ich wieder rauchen. Auch nach unserem jetzigen Wissensstand.«
»Eigentlich ganz gut, daß Sie es so sehen, nicht?« meinte ich.
Sie schaute mich mit diesem intensiven Blick an, den sie manchmal hat. »Nein, ich bereue es nicht. Es gibt manches in meinem Leben, was ich bereue. Bitter bereue. Aber nicht das.«
»Kommt Richard heute?« fragte ich. Keine sehr intelligente Bemerkung, aber ich hatte das Gefühl, daß wir uns auf ein gefährliches Thema zubewegten. Außerdem kommt er oft montags.
»Ich hoffe es. Vielleicht heute nachmittag. Haben Sie schon die Postkarte gesehen, die Marianne mir aus Korfu geschrieben hat? Sie liegt an meinem Bett.«
[32] Jetzt kannst du aufatmen, dachte ich, aber ich hatte mich zu früh gefreut. »Ach, wenn Sie gerade da sind, Genevieve, könnten Sie mir bitte mal den Umschlag geben, der in dem Buch steckt?«
Ich tat es. Was blieb mir übrig?
»Ich muß weiter«, sagte ich. »Arthur möchte gern, daß ich ihn draußen spazierenfahre, es ist so schönes Wetter.«
»Den kann heute mal jemand anders spazierenfahren«, sagte sie und nahm den langen Umschlag in die Hand. »Setzen Sie sich einen Moment, Genevieve.«
Und dann kamen die langen gefalteten Blätter wieder zum Vorschein. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht, nein zu sagen, dachte ich. Ihr zu sagen: Bitte vermachen Sie mir nichts, Stella… Ich hatte wie immer Ned im Kopf und daß uns mit dem Geld bestimmt geholfen wäre.
Stella hielt die Blätter hoch. »Wissen Sie, was das ist?«
»Ihr Testament?« fragte ich ziemlich unfreundlich.
»Mein Testament? Du lieber Himmel, nein. Hier, schauen Sie es sich mal an! Es ist eine Übertragungsurkunde für Grundeigentum.«
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Die Gefahr war vorüber. Ich hätte der Versuchung nicht widerstehen können, das wußte ich, und deshalb war ich froh und dankbar, daß es nicht so weit gekommen war. Ich legte die Hand an das Weißdornamulett. Sie muß mich für ziemlich blöd gehalten haben, weil ich mir unter einer Übertragungsurkunde nichts vorstellen konnte. Aus dem ersten Blatt wurde ich überhaupt nicht schlau. Es war handgeschrieben, in einer schrägen Schrift mit Schleifen und Kringeln, ein bißchen so, wie mein Großvater geschrieben hat. Ich las laut vor: Diese [33] Abmachung wird am neunundzwanzigsten Juli eintausendneunhundertneunundvierzig getroffen zwischen Thomas Archibald Wainwright, wohnhaft in Palings, Hemingford Grey, Grafschaft Huntingdon, von der Königlichen Marine (nachstehend »der Verkäufer« genannt) einerseits und William John Rogerson…
Sie fiel mir ins Wort. »Ich kenne den Text. Hier ist das nächste…«
Das zweite Dokument war mit der Maschine geschrieben und sah viel moderner aus, dabei war es nur fünfzehn Jahre später datiert. Da Stella offenbar nicht hören wollte, was drinstand, las ich es für mich – jedenfalls einen Teil. Auf der Vorderseite stand: W. J. Rogerson Esq. an Mrs. S. M. Newland und darunter: Übertragung eines schuldenfreien Grundeigentums unter dem Namen Molucca, befindlich in Thelmarsh, Grafschaft Norfolk. Innen war ein ganz ähnlicher Text wie der, den ich laut vorgelesen hatte, nur war diesmal »der Verkäufer« dieser William John Rogerson, und »der Käufer« war Stella.
»Es handelt sich um ein Haus, das ich 1964 gekauft habe«, sagte sie, und ihre Stimme klang plötzlich ernst und gewichtig. Ich hatte den Eindruck, daß sie von einem sehr bedeutsamen, vielleicht dem bedeutsamsten Schritt in ihrem Leben sprach. Sie sah mich kurz an und sah wieder weg. »Das bleibt aber bitte unter uns, Genevieve. Es ist nicht…« Sie zögerte, schien nach dem richtigen Wort zu suchen. »…nicht allgemein bekannt.«
Was sollte man dazu sagen? Ich gab ihr die Dokumente zurück, und sie steckte alles wieder in den Umschlag. »Könnten Sie wohl kurz mit mir nach oben gehen?«
[34] »Wie bitte?« fragte ich.
»Ich möchte Ihnen etwas zeigen.«
Stella ist noch gut zu Fuß. Nicht sehr schnell, weil ihr dann die Puste ausgeht, aber ihre Beine sind in Ordnung, sie hat keine Arthritis wie Maud oder Gracie. Ich wollte ihr meinen Arm anbieten, aber sie schüttelte den Kopf. Die Haupttreppe von Middleton Hall ist breit, und die Stufen sind ziemlich flach, aber schwer zu gehen, weil auf dem blanken Holz kein Läufer liegt. Zuerst habe ich überlegt, warum das so ist, und dann bin ich draufgekommen, daß Lena verhindern will, daß unsere Alten ständig die Treppe rauf- und runterrennen. Ihr ist es lieber, wenn sie langsam gehen und sich am Geländer festhalten müssen oder – besser noch – auf ihren Zimmern bleiben oder im Salon sitzen, weil sie dann leichter die Übersicht behält. Stella ging ganz an der Seite, und als ich sah, wie die alte Hand mit den jugendlich roten Nägeln sich an das rutschige Holz des Geländers klammerte, tat sie mir wieder leid. Und ich ärgerte mich über Lena, weil sie keinen Treppenlift installieren läßt. Bei dem vielen Geld, das sie alle zahlen, müßten die paar hundert Pfund für so was eigentlich drin sein.
Oben mußte Stella stehenbleiben, um wieder zu Atem zu kommen. Ich hatte keinen Schimmer, wohin sie mit mir wollte, ich hatte glatt vergessen, daß hier oben nicht nur Zimmer von Heimbewohnern sind. Am Ende des Ganges ist der sogenannte Obere Salon, nur benutzt den keiner von denen, die hier oben wohnen. Sie sind entweder zu gebrechlich, um überhaupt noch das Zimmer zu verlassen, oder sie wagen sich lieber zweimal am Tag die Treppe rauf und runter, weil sie unten Gesellschaft haben.
[35] Der Obere Salon ist ziemlich klein, ein paar zusammengewürfelte Sessel stehen darin und eine Couchgarnitur, alles um den Fernseher gruppiert, aber es ist ein Schwarzweißgerät, und das Bild wackelt. Das Beste an dem Oberen Salon ist die Aussicht, man sieht meilenweit ins Land hinein. Stella trat mit mir ans Fenster, wir sahen über die Wiesen und das Moor bis zur Little Ouse, die an dieser Stelle zum Waveney-Fluß wird und die Grafschaftsgrenze bildet; auf der anderen Seite liegt Suffolk. Es war ein warmer, klarer Tag, man konnte den Horizont sehen, ohne Dunstschleier und auch nicht rauchgeschwärzt wie früher um diese Jahreszeit. Der Himmel war blaßblau mit vielen hohen Wolken, man sah wie immer im Spätsommer grüne Felder, wo die Rüben stehen, und blonde Felder, wo schon gemäht ist, und Felder, auf denen weiße Segel zu flattern scheinen, das sind die Gänsefarmen. Die Hecken sind wie dunkle Trennstriche zwischen den Wiesen, und das Moor dahinter verschwimmt in einem unbestimmten bläulichen Ton.
»Wissen Sie noch«, sagte ich, »wie sie um diese Zeit die Stoppelfelder abgebrannt haben? Manchmal konnte man vor Rauch den Himmel kaum sehen, und in der Luft war lauter schwarzes Zeugs.«
Sie sah mich irritiert an, als hätte sie mich nicht verstanden.
»Die Bauern«, sagte ich, »haben nach der Ernte die Felder abgebrannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das angefangen, hat mir mein Großvater erzählt. Sie sollten eigentlich zwei Meter Abstand zwischen den Stoppelfeldern und den Hecken lassen, aber es war nicht Vorschrift, und viele [36] haben die Hecken mit verbrannt. Jetzt ist Schluß damit, dieses Jahr ist es zum erstenmal verboten.«
Sie hatte den Kopf abgewandt, wahrscheinlich hatte sie gar nicht zugehört. »Schauen Sie mal geradeaus«, sagte sie. »Sehen Sie den quaderförmigen Kirchturm da drüben?«
»St. John’s in Breckenhall«, sagte ich.
»Das weiß ich nicht, Genevieve, aber wenn Sie es sagen, wird es schon stimmen. Jetzt schauen Sie vom Kirchturm, von der Kirche von Breckenhall, wie Sie sagen, nach links unten, dort sehen Sie ein Haus, das aussieht wie ein weißer Würfel. Wenn Sie von da nach links sehen, erkennen Sie gerade noch etwas Braunes mit einem roten Dach.«
»Ja, stimmt.« Beinah hätte ich gesagt, daß es ganz deutlich und nicht »gerade noch« zu erkennen war, aber dann begriff ich, daß das eben der Unterschied zwischen jungen und alten Augen ist, und ließ es bleiben. »Ein quadratisches Haus mit rotem Dach. Auf der Straße nach Cur-ton.«
»Genau. Das ist mein Haus.«
»Ein schuldenfreies Grundeigentum«, sagte ich, »befindlich in Thelmarsh in der Grafschaft Norfolk.«
»Ja.«
»Sind Sie nach Middleton Hall gekommen, weil Sie von hier aus Ihr Haus sehen können?«
»Eher im Gegenteil. Hätte ich es gewußt, wäre ich vielleicht nicht gekommen.« Sie lachte ein bißchen nervös. »Nicht einmal Ihretwegen…« Wieder dieses Lachen, verlegen oder schüchtern, jedenfalls nicht fröhlich. »Ich war eines Tages hier oben, ich weiß gar nicht mehr, warum – ach doch, jemand hatte gesagt, hier sei ein Schrank mit Büchern, [37] aber das stimmte gar nicht –, sah aus dem Fenster und… und glaubte mein Haus zu erkennen. Ich habe dann Richard gebeten, mir eine Karte mitzubringen, das entsprechende Blatt der Generalstabskarte.«
Sie drückt sich immer sehr präzise, sehr korrekt aus, bestimmt hat sie in ihrem ganzen Leben noch keinen Grammatikfehler gemacht. Manchmal ist es, als ob sie etwas abliest, was sie sich vorher aufgeschrieben hat.
»Natürlich habe ich ihm nur gesagt, daß ich mich orientieren will. Er weiß nicht, daß ich schon mal in dieser Gegend war, und Marianne weiß es auch nicht. Sie haben keine Ahnung.«
Sie stützte sich aufs Fensterbrett und sah zu ihrem Haus hinüber. Ihre Schultern hoben sich, als ob sie fröstelte, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Ich fragte, ob sie ein bißchen allein bleiben wollte, ich müßte nun wirklich weitermachen. Ich dachte mir, sie wäre vielleicht gern allein. Mit ihren Erinnerungen oder so. Sie drehte sich um, und ihr Gesicht kam mir plötzlich älter vor.
»Ja, vielleicht. Ganz kurz nur«, sagte sie, aber bis ich an der Tür war, hatte sie es sich schon wieder anders überlegt. »Nein, ich komme mit. Mit so etwas vertrödelt man nur Zeit, und allzuviel Zeit habe ich ja nicht mehr. Außerdem kann ich nicht behaupten, daß mir der Anblick große Freude macht.«
Diesmal nahm sie meinen Arm. Sie sah beklommen oder vielleicht auch nur unentschlossen aus, und ich dachte: Jetzt sagt sie gleich etwas, was dich umwirft, etwas über das Haus mit dem roten Dach auf der Straße nach Curton. Aber sie fragte nur, warum ich das von dem Felderabbrennen [38] gesagt hatte, und als ich es ihr noch mal erklärte, war sie mit der Antwort offenbar nicht recht zufrieden. Wir gingen ganz langsam, Stella klammerte sich an mich, ihre Nägel gruben sich in meinen Arm, es würde blaue Flecken geben, aber ich sagte nichts, sie machte es ja nicht absichtlich. Und dann erschrak ich wieder, weil das, was sie sagte, so unerwartet kam, dabei müßte ich ihre Gedankensprünge inzwischen eigentlich gewohnt sein.
»Heute vormittag hab ich im Radio ein Musikstück gehört, das mir gefiel, Genevieve. Schade, habe ich gedacht, daß ich es nicht öfter hören kann. Gibt es wohl eine Möglichkeit, Musik aufzunehmen, die mir gefällt?«
Natürlich, sagte ich, sie könnte sich ein Tonbandgerät anschaffen. Es gibt ganz kleine, die nicht viel Platz wegnehmen. Sie nickte. Sie würde Richard oder Marianne fragen. Außerdem wollte sie gern ein Lesepult haben, um ihr Buch anzulehnen, wenn sie im Bett saß. Weil ihr die Arme weh taten und sie so schnell kalte Hände bekam, wenn die nicht unter der Bettdecke waren. Lächerlich, sagte sie, kalte Hände im August, noch dazu einem so heißen August. Dann kamen wir zu der kleinen Galerie, von der man in die Halle sehen kann. Unten stand Richard und unterhielt sich mit Stanley, Lenas Mann. Richard war offenbar gerade gekommen. Sie standen mit dem Rücken zu uns und sahen uns nicht. Richard ist einsachtzig und sehr mager, und Stanley ist klein und unheimlich dick, es war ein gottvoller Anblick.
Normalerweise freut Stella sich immer sehr, wenn ihre Kinder kommen. Sie sagt »Liebling« zu ihnen und ist sehr herzlich, und deshalb war ich ganz erstaunt, daß sie Richard [39] nicht von hier oben begrüßte, sondern meinen Arm noch fester faßte. »Kein Wort von meinem Haus zu Richard, Genevieve«, flüsterte sie mir zu.
Ich sah sie nur an.
»Er weiß nichts von dem Haus und Marianne auch nicht.«
»Ich sag schon nichts«, sagte ich, aber ich war doch ziemlich baff.
Mir hatte sie es erzählt, aber ihren Kindern nicht? Einen Augenblick überlegte ich, ob sie vielleicht nicht mehr ganz da war. Bei Krebskranken kommt das leider manchmal vor, wenn die Metastasen das Gehirn angreifen. Andererseits hatte ich ja mit eigenen Augen die Urkunden gesehen, und als sie zu Richard trat, ihn umarmte und ihm sagte, wie gut er aussah, war sie eindeutig compos mentis (wie Lena sich ausdrückt).
Richard ist groß und dünn wie seine Schwester, aber sonst sieht er ihr überhaupt nicht ähnlich. Er hat sehr helle Haare, als Kind war er bestimmt weißblond, und blaue Augen. Stella hat mir gesagt, daß er Arzt ist, praktischer Arzt in einer Gemeinschaftspraxis in Norwich. Er trägt eine randlose Brille, eine dieser Intellektuellenbrillen, aber er hat noch ein richtiges Jungengesicht. Wenn er lächelt, sieht er aus wie achtzehn. Er ist sehr lieb zu Stella, und sollte ich mal einen Sohn haben, kann ich nur hoffen, daß er mich auch so nett behandelt, wenn ich mal alt und grau bin.
Er hatte ihr einen Strauß pinkfarbener Lilien und Schleierkraut mitgebracht. Ich holte einen pinkfarbenen Krug, und als ich ihr den Strauß brachte, saßen die beiden zusammen und redeten miteinander, er hielt ihre Hand, und der [40] Umschlag mit den Urkunden, den sie auf dem Schreibtisch hatte liegenlassen, war weg. Den Kaffee brachte ihnen Sharon, ich mußte mich um Gracie, meine neue alte Dame, kümmern, aber daß ihre Kinder nichts von dem Haus wußten, daß es ein Geheimnis war, ging mir nach. Und dann fiel mir die Jahreszahl auf der zweiten Urkunde ein. 1964. Sie besaß ein Haus und hatte das dreißig Jahre geheimgehalten?
Gracie ist ganz anders als Stella. Sie ist alt und grau, schwerfällig und immer traurig. Seit einem Schlaganfall ist ihr Gesicht schiefgezogen, und ihre Zahnprothese sitzt nicht mehr richtig, was ihr furchtbar peinlich ist. Sie spricht nur, wenn es unbedingt sein muß, und ißt kaum was und deutet ständig entschuldigend auf ihren Mund. Ob sie Kinder hat oder auch nur eine Nichte oder einen Neffen, weiß ich nicht, hier haben sie sich jedenfalls noch nicht blicken lassen. Niemand war auf die Idee gekommen, die Prothese beim Zahnarzt richten zu lassen, deshalb machte ich von ihrem Zimmer aus telefonisch einen Termin und werde sie am Freitag nach Diss fahren. Lena war nicht begeistert, »da hast du mal wieder reichlich selbständig gehandelt«, sagte sie, aber den Termin absagen wollte sie auch nicht, dazu hat sie zuviel Respekt vor Ärzten und Zahnärzten. Wenn Richard da ist, kann sie sich gar nicht mehr einkriegen vor lauter »Herr Doktor« hier und »Herr Doktor« da.
Den ganzen Tag mußte ich an Stellas Haus denken, und einmal ging ich in den Oberen Salon und sah es mir vom Fenster aus an. Davor war ein Feld voller Gänsegewimmel und dahinter die dunkle Fläche des Moors. Ned und ich [41] waren mal in dieser Ecke gewesen, zwischen Hartriegel und Mädesüß, ich wußte jetzt genau, wo das Haus war. Ich glaube, wir haben im Vorbeigehen sogar gesagt, wie verlassen und unbewohnt es wirkt.
Richard kam heraus, ehe Sharon das Essen brachte. Er wollte wissen, welchen Eindruck ich von seiner Mutter hatte, und ich sagte, wenn man ihren Zustand bedenkt, ist sie noch richtig gut drauf.
»Gibt es irgendwas, das ich ihr besorgen könnte, Jenny, etwas, das ich vergessen habe oder worum sie mich nicht bitten möchte?«
Er ist wirklich sehr nett. Einfühlsam wie eine Frau. Wie manche Frauen.
»Sie hat was von einem Tonbandgerät gesagt«, meinte ich.
»Um Musik aufzunehmen? Ja, sie liebt Musik. Kammermusik, Sie wissen schon, kleine, zarte Stücke.« Ich finde es schön, daß er mich ernst nimmt, daß er mich nicht wie eine Schwachsinnige behandelt, nur weil ich Pflegerin in einem Altersheim bin. »Richtig, das hätte mir auch von selbst einfallen können. Ich habe ein kleines Tonbandgerät, das könnte sie haben. Aber nein, am besten wäre es wohl, ihr einen guten Kassettenrekorder mit eingebautem Mikrophon zu kaufen, nicht?«
Ja, sagte ich, und dann könnte er ihr auch gleich ein paar Stücke auf Kassette mitbringen, die sie gern hat.
»Gut, ich denke dran. Sie ist wohl kein großer Fernsehfan?«
»Ein gutes Fernsehspiel sieht sie hin und wieder ganz gern«, sagte ich, »und alte Kinofilme. Wie ich.«
»Ja, das sind die wahren Kenner«, sagte er, bedankte sich [42] für meinen Vorschlag und war so nett beim Abschied, daß ich einen Augenblick dachte: Ganz gleich, worum Stella gebeten hat, du müßtest es ihm eigentlich sagen. Du müßtest ihm nachlaufen und es ihm sagen. Irgendwas stimmt hier nicht, und wenn Stella stirbt, wenn Stella heute nacht stirbt, und das ist ja durchaus drin, sind da diese Urkunden und das Haus, und niemand weiß Bescheid… Aber dann ließ ich es doch. Ich sah seinem Wagen nach, er fährt für einen praktischen Arzt ein erstaunlich sportlich-schnittiges Modell, aber er fuhr mit Gefühl und brauste nicht mit einem Kavalierstart los, wie Lena es gemacht hätte.
Um vier habe ich Schluß. Ned würde von Norwich rüberkommen, wir waren um sieben verabredet, und an solchen Tagen kann ich an kaum was anderes denken. Er nimmt mich ganz in Beschlag, und wenn ich nicht sehr aufpasse, laufe ich durch die Gegend wie im Traum. Nach Möglichkeit verbringe ich die letzte halbe Stunde meiner Schicht immer bei Stella, dann sitzen wir in ihrem Zimmer und unterhalten uns, oder auch im Salon, wenn ihr danach ist.
Arthur hielt seinen Mittagsschlaf, für Gracie hatte ich im Fernsehen eine Quizsendung rausgesucht, ihren Tee hatten beide gehabt, und zwanzig nach drei klopfte ich bei Stella, aber sie war nicht auf ihrem Zimmer. Sie saß ganz allein im Salon, und wenn man sie so sah, hätte man sie nie für eine hinfällige alte Frau gehalten, die schon bald an Krebs sterben würde. Nein, sie sah aus wie eine Lady, die ihre Freundinnen zum Tee erwartet. Sie saß in einem Sessel und hatte eine Zeitschrift auf dem Schoß. Aber sie las nicht darin, sondern sah aus dem Fenster in den grünen Garten und auf die Schmetterlinge an der Buddleia. Sie hatte das Kinn auf [43] eine Hand gestützt, mit der anderen hielt sie das Handgelenk, so daß das Blut aus den Venen abgeflossen war und die Hände glatt und jung aussahen. Der Friseur hatte ihr die Haare gewaschen und gelegt, und sie trug das Kleid, das ich am liebsten an ihr habe, blaue Seide mit großen beigefarbenen Punkten. In den hellen Strümpfen, die sie immer trägt, würden die Beine von manchen Frauen aussehen wie Baumstämme, aber an Stella mit ihren glatten, wohlgeformten Beinen wirken sie sehr elegant.
Ich hüstelte schüchtern, und sie drehte sich um und schenkte mir ein wunderschönes Lächeln. Auch Richard lächelt sie so an, aber sonst niemanden, glaube ich. Sie hatte Blusher aufgelegt – Rouge, wie sie es nennt – und einen Hauch blauen Lidschatten, aber im Gegensatz zu der armen Maud, die mit scharlachrotem Lippenstift dick aufträgt, nimmt Stella einen Lippenstift in ganz hellem Pink, und ich glaube, sie nimmt einen Pinsel.
»Wie schön, daß Sie noch einmal nach mir sehen, Jenny«, sagte sie.
Ich sagte, daß ich das doch immer mache, wenn es irgend geht, und setzte mich neben sie. Wir guckten uns die Schmetterlinge an und zählten zehn kleine Füchse, sieben Tagpfauenaugen, einen Roten Admiral und einen, der laut Stella Amerikanischer Fleckenfalter heißt. Sie kennt sich aus mit solchen Dingen, mit Wildpflanzen und wildlebenden Tieren. Sie sagt, daß sie zu gern einen Schwalbenschwanz sehen würde, sie hätte gehört, daß es die nur in Norfolk gibt, vielleicht käme einer hierher.
»Vor meinem Tod«, sagte sie. »Vielleicht sehe ich einen Schwalbenschwanz, dann könnte ich glücklich sterben.«
[44] Darauf wußte ich nichts zu sagen.
»Was meinen Sie, Genevieve, ob ich eine Zigarette rauchen könnte? Ich hätte solche Lust darauf.«
»Lieber nicht«, sagte ich. »Strenggenommen ist im ganzen Haus Rauchverbot.« Ich mußte lachen. »Hier auf jeden Fall.«
»Besonders, wenn man Lungenkrebs hat. Dabei ist das im Grunde doch ziemlich albern. Jetzt ist es sowieso zu spät, das Unheil ist geschehen. Da, noch ein Roter Admiral. Er hat einen so hübschen lateinischen Namen. Vanessa atalanta…« Sie sah mich an. »Ich möchte Sie etwas fragen, Sie um einen Gefallen bitten.«
»Wenn ich kann…«, sagte ich, aber ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, warum, daß es keine Kleinigkeit sein würde.
»Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie es ganz offen sagen.«
»Einverstanden.«
»Wenn ich Ihnen den Schlüssel gebe und Ihnen genau sage, wo mein Haus ist, Genevieve, würden Sie hinfahren und sich ein bißchen umsehen und… und mir sagen, in welchem Zustand es ist?«
»Sie meinen das Haus auf der Straße nach Curton?«
»Ja. Es heißt ›Molucca‹. Kapitän Wainwright, der Besitzer vor Mr. Rogerson, fuhr zur See und war wohl auch in Ostindien.« Sie lächelte. »Würden Sie das für mich tun? Sich ein bißchen umschauen und mir sagen, was für einen Eindruck Sie haben?«
»Ist gut«, sagte ich. Und weil sich das etwas muffig anhörte, schob ich nach: »Wenn Sie meinen, Stella.« Ich zögerte, ich wußte nicht, wie ich es sagen sollte, aber ich wollte es wenigstens versuchen. »Wäre es nicht besser, wenn [45] Richard das machen würde? Könnten Sie ihm nicht von dem Haus erzählen und ihn bitten hinzufahren? Sie haben einen so netten Sohn, er tut es bestimmt, er würde nicht böse sein oder einen Aufstand machen.«
Sie freute sich, daß ich gesagt hatte, ihr Sohn sei nett, und wurde ein bißchen rot. »Ich möchte, daß Sie es machen, Jenny. Für Marianne und Richard ist es besser, wenn sie nichts davon wissen. Noch nicht jedenfalls. Nicht, bis – tut mir leid, wenn sich das ein bißchen dramatisch anhört –, nicht, bis ich tot bin.« Sie wandte den Blick ab, aber sie sah nicht aus dem Fenster, sondern auf die leere Wand. »Es ist mir peinlich«, sagte sie leise. »Manche Dinge sagt man eben den eigenen Kindern nicht gern… Würden Sie mir den Gefallen tun?«
»Ich mach es gleich heute abend«, versprach ich.
»Ach, und Genevieve… Fahren Sie vorsichtig, ja?«
3
Über die Straße waren es etwa sieben Meilen, Luftlinie natürlich viel weniger. Vom Fenster aus hatten Stella und ich höchstens ein oder zwei Meilen weit in die Landschaft gesehen. Die Straße führt durch Tharby und vorbei an Thelmarsh Mill, sie ist schnurgerade und ohne Hecken, eine Römerstraße, auf der die »donnernde Legion« durch das östliche England marschiert ist. Hinter Newall Pomeroy folgte ich dem Hinweisschild nach Breckenhall. Ich glaubte fast auf den Punkt genau zu wissen, wo das Haus lag – und ich hatte mich nicht getäuscht. Es war eine schmale, gerade [46] Straße, die Häuser waren alle zurückgesetzt, erst kam das weiße, das Stella nur undeutlich und ich sehr klar gesehen hatte, und dann, etwa hundert Meter danach, ihr Haus.