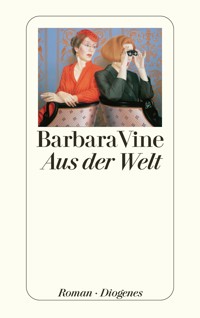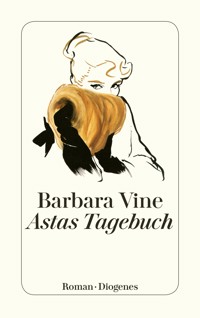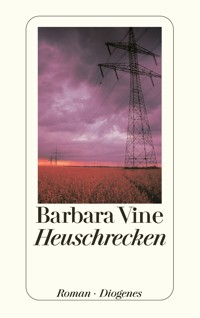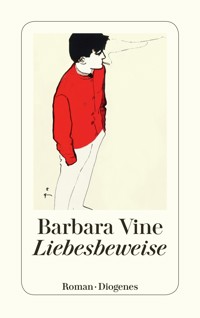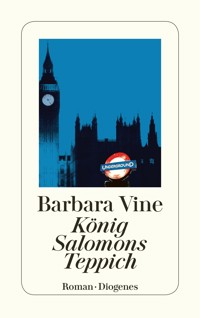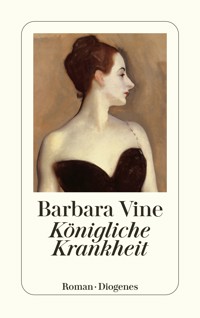9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mehr als laue Gefühle kann Tim Cornish für Frauen nicht aufbringen, und auch die sind vergessen, als er in den Bannkreis des einige Jahre älteren Ivo Steadman gerät. Endlich wird seine Liebe erwidert, und alles könnte wunderbar sein – wenn nicht Tim ausgerechnet in Alaska einer Frau begegnen würde, die sein Innenleben abermals völlig umkrempelt und ihn bis ins Verbrechen treibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara Vine
Keine Nacht dirzu lang
Roman
Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann
Titel der 1994 bei Viking, London,
erschienenen Originalausgabe: ›No Night is Too Long‹
Copyright © 1994 Kingsmarkham Enterprises Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 im Diogenes Verlag
Julius Cäsar von William Shakespeare in der
Übersetzung von Schlegel/Tieck, Diogenes Verlag, 1979,
und Die toten Seelen von Nikolai Gogol in der Übersetzung von Philipp Löbenstein, Diogenes Verlag, 1977
Zitat aus dem Rosenkavalier:
Copyright © Fürstner Musikverlag, Mainz
Abdruck mit Genehmigung von
Schott Musik International, Mainz, und
Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd., London
Umschlagillustration: David Hockney,
›Model with Unfinished Self-Portrait‹,
1977 (Ausschnitt)
Oil on Canvas 60 x 60"
Copyright © David Hockney
Für
Phyllis Grosskurth
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22970 7 (5.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60123 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Wie ich dein Alles werde sein! Mit mir, mit mir keine Kammer dir zu klein, ohne mich, ohne mich jeder Tag dir so bang, mit mir, mit mir keine Nacht dir zu lang
[7] I
Tim
[9] 1
Draußen weht ein starker Wind und sorgt für rauhe See. Schon lange habe ich nicht mehr so mächtige Brecher an diesen grauen, kiesigen Strand schlagen sehen. Das Meer ist hellbraun verfärbt vom Sand, der sich unter das Wasser mischt – wie schwacher Milchkaffee. Selbst an schönen Sommertagen ist das Meer hier meist bräunlich, nur selten blau und klar.
Bald wird es so dunkel sein, daß ich die Farben oder vielmehr Nichtfarben, das schmutzige Kaffeebraun und das Grau, nicht mehr sehen kann. Nachts verschwinden Meer und Strand vor meinem Fenster, und im Licht der Lampen sieht man nur noch die Straße und die Ufermauer. Ebensogut könnten hinter dem Deich eine Stadt sein oder Felder, wenn da nicht das Meer wäre, das sich grollend und kieselkollernd zurückzieht und mit dem gewaltigen Aufprall der Brecher zurückkehrt. Gäbe es diese Geräusche nicht, wäre hinter der Ufermauer alles vorstellbar, sogar ein dunkler Fjord mit einer Insel in der Mitte, zwei Adlern auf einem Baumwipfel, der gespaltenen Schwanzflosse eines Buckelwals, die aus dem Wasser hervorschaut. Wer kann schon sagen, was dort ist, wohin man nicht sehen kann?
Ich schreibe dies, um in Schwung zu kommen. Um einen Anfang zu finden. Und habe mich doch wieder nur dem Stoff genähert, aus dem meine Träume sind. Jene Träume, [10] denen ich zu entkommen versuche. Alle Wege, so scheint es, führen auf die Insel, und zwar um so direkter und gnadenloser, je mehr Zeit vergangen ist. Ich schreibe in der Hoffnung, damit die Zugänge zu versperren, die Wege zu Sackgassen zu machen, ein Schild davor aufstellen zu können: Durchgang verboten. Nur das, wohlgemerkt. Ich bin weder so unschuldig (Unschuldig? Das klingt, auf meine Person bezogen, geradezu lachhaft!) noch so optimistisch zu glauben, daß ich durch das Schreiben geheilt werden könnte. Weder Selbst- noch Fremdtherapie können mir diese Bürde, diese fürchterlichen Gewissensbisse abnehmen. Ich habe mal etwas gelesen, was ich aber nicht recht glauben kann: Daß der einzig freie Mensch der Schriftsteller ist, weil er Schmerz, Scham und Kummer endgültig los ist, sobald er sie sich vom Herzen geschrieben hat.
Ich glaube einzig – oder versuche es mir einzureden –, daß es mir gelingen sollte, mich der Träume zu entledigen, wenn ich sie, wie man so sagt, schwarz auf weiß vor mir sehe. Daß der Stoff, aus dem diese Träume sind, mir eigentlich nicht mehr Nacht für Nacht vor Augen stehen dürfte, wenn ich das alles einmal in Buchstaben eingefangen und zu Papier gebracht habe.
Ich werde die Träume los sein und alles andere in den richtigen Dimensionen sehen, wie es so schön heißt. Warum schreibe ich ständig »wie man so sagt« und »wie es so schön heißt«? Weil ich unter »man« Menschen verstehe, die nicht so sind wie ich. Glückliche Menschen, die traumlos schlafen und ihre Worte setzen können, ohne nachzudenken, die es nicht nötig haben, alles zu hinterfragen, was sie und andere tun und reden.
[11] Ohne die Briefe aber, die ich jetzt schon so lange bekomme, hätte ich mich wohl nicht zum Schreiben entschlossen. Briefe sind nicht das, was man normalerweise so denkt. Meine sind unverlangt gegebene Informationen. Berichte über historische Begebenheiten. Wahre Geschichten mit einem gemeinsamen Thema, das durchaus von allgemeinem Interesse ist, unmittelbar aber im Grunde nur mich betrifft.
Unheimliche Geschichten, von denen eine deutliche Bedrohung ausgeht. Und solche Briefe existieren ja nicht im leeren Raum, ihr Eintreffen oder Ausbleiben hat Konsequenzen. Sie sind die Vorboten künftiger Ereignisse – und das sind dann vielleicht nicht nur beschriebene Seiten, die mit der Post kommen. Deshalb will ich es aufschreiben, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe.
Und das ist wohl die passende Stelle für das erste Schiffbrüchigen-Exzerpt. Hier ist es.
Alexander Selcraig, genannt Selkirk, ein Mann von reizbarem Temperament, geriet auf einer Überfahrt nach Amerika mit seinem seiner Meinung nach unfähigen Kapitän in Streit. Selkirk glaubte, das Schiff würde, weil es nicht sorgfältig genug gepflegt und gewartet wurde, in Kürze untergehen, und verlangte, auf der nächstbesten Insel an Land gelassen zu werden. Wider Erwarten fand sich von der Mannschaft niemand, der sich ihm anzuschließen bereit war, und so wurde er allein ausgesetzt.
Seine Befürchtungen bestätigten sich: Das Schiff sank. Doch das war für Selkirk in seiner mißlichen Lage nur ein geringer Trost. Fünf Jahre vergingen. Er las die Bibel, baute [12] Gemüse an, pökelte Ziegenfleisch und lauschte dem Gebrüll der Seelöwen. Schließlich wurde er von einem spanischen Schiff gerettet und von den Spaniern prompt ins Gefängnis geworfen. Erst nach fünf weiteren Jahren gestattete man ihm die Heimkehr nach Schottland.
Als gebildeter Mann dürfte Ihnen bekannt sein, daß Selkirks abenteuerliches Leben Daniel Defoe als Vorlage für sein Buch Robinson Crusoe diente, das zuweilen als der erste englische Roman bezeichnet wird.
Das war der erste Brief. Auf dem Umschlag waren amerikanische Briefmarken und natürlich ein amerikanischer Poststempel. Aus naheliegenden Gründen reiße ich solche Briefe immer sofort auf. Die Adresse war mit der Hand geschrieben, auf der hinteren Umschlagkappe stand – ungewöhnlich für einen Brief aus Amerika – kein Absender, und deshalb beeilte ich mich diesmal besonders mit dem Aufmachen.
Inzwischen habe ich mich an dieses Papier gewöhnt, damals allerdings kannte ich es nur aus dem Hotel Goncharof in Juneau. Von Isabel. Was das sei? antwortete sie auf meine Frage nach den gelben linierten Seiten. Ein Block mit Kanzleipapier. – Mein Briefpartner schreibt oder vielmehr tippt seine Briefe auf gelbem Kanzleipapier.
Dieses feuchte Haus an der See hat keine Zentralheizung. Ehe ich morgens weggehe, lege ich Kohlen in den Kamin, und wenn ich heimkomme, mache ich Feuer. Ich warf den Umschlag gedankenlos in die Flammen. Auf dem Briefblatt waren weder Adresse noch Unterschrift. Ich las den Text noch einmal und ließ ihn mir durch den Kopf [13] gehen, und dann sagte ich mir, daß so was kein Zufall sein kann, daß es Absicht sein muß. Ein Mann weiß Bescheid und hat mir diesen Brief geschickt, um mir zu signalisieren, daß er Bescheid weiß. Oder eine Frau.
Das erschreckte mich sehr. Mehr, als hätte ich eine direkte Drohung bekommen. Ich begriff nun, daß meine Schuldgefühle und meine Angst zwei verschiedene Dinge waren. Die Angst war eine zusätzliche Bürde. Ich zitterte ein bißchen, als ich dort am Kamin saß. Wer hatte mir diese Kurzfassung von Selkirks Abenteuern geschickt? Wer konnte Bescheid wissen? Und woher wußte er, daß ich hier wohne? Die Bedrohung, die über mir hing, war fast so greifbar wie seine geisterhafte Gegenwart.
Mein Leben verläuft ereignislos. Ich gehe ins Büround komme nach Hause, hin und wieder mache ich im Mainmast halt und genehmige mir eine Halbe Adnams-Bier – andere alkoholische Sachen trinke ich heutzutage nicht mehr –, ich lese, ich koche mir was. Und neuerdings schreibe ich. Dabei ist er immer da, ich sehe ihnaus dem Augenwinkel oder als Schatten, der über den Boden fällt. Manchmal, aber nicht so oft, wie ich sollte, fahre ich mit dem Bus zu meiner Mutter. Er ist mein ständiger Begleiter, und seit die Schiffbrüchigengeschichten auf dem gelben Papier kommen, werde ich auch sie nicht mehr los.
Daß es sich um eine Drohung handelte, wurde ganz klar, als der nächste Brief eintraf.
Defoe meinte, daß Insel- oder Seefahrergeschichten immer wieder neu erzählt und weitergereicht werden, weil sie ›Licht auf das Leben des Menschen‹ werfen. Haben Sie den[14] Eindruck, daß Ihre Erlebnisse Ihnen persönlich das Wesen des Menschen erhellt haben?
Der Spanier Pedro de Serrano war im Jahre 1540 auf dem Pazifik unterwegs. Sein Schiff sank, und er, der einzige Überlebende des Wracks, schwamm, bis er an eine Insel kam. Es gab dort kein Süßwasser und kein Gras, nur kahlen Fels.
Serrano nährte sich von kleinen Seetieren, und um seinen Durst zu stillen, schnitt er Schildkröten die Kehle durch und trank ihr Blut. So lebte er drei Jahre, bis ein zweiter schiffbrüchiger Matrose eintraf, den Serrano zunächst für den Teufel hielt. Er floh vor ihm, und erst als sein Verfolger ihm das Apostolische Glaubensbekenntnis vorsprach, ließ er sich davon überzeugen, daß dieses Wesen ein Mensch und ein Christ war. Die beiden mußten noch weitere vier Jahre zusammen auf der Insel ausharren, ehe sie gerettet wurden. Mittlerweile war ihre Haut dunkelbraun gebrannt, Haare und Bart hingen ihnen lang und zottig herab, und sie sahen sich so ähnlich, daß ihre Retter, die ›mit Verwunderung die behaarten Gestalten erblickten, welche nicht Menschen, sondern Tieren gleichsahen‹, sie für Zwillinge hielten.
Wieder gelbes Kanzleipapier. Die Adresse auf dem Umschlag handgeschrieben, Poststempel San Francisco, eine Briefmarke mit dem Kopf von Harry S. Truman, die andere mit dem von Wendell Willkie. Er kam zwei Wochen nach dem ersten, und aus irgendeinem Grund warf ich den Umschlag nicht weg. Wenn ein anderer von einem Verbrechen erfährt, das man begangen hat, wenn man begreift, daß es kein Geheimnis mehr ist, wird dieses [15] Verbrechen konkret und real. Man kann es sich nicht eingebildet haben, es kann nicht die Ausgeburt eines verstörten Gemütes sein, es gibt keine Möglichkeit mehr, daß es sich um einen Irrtum handelt.
Auch ohne eine Bestätigung wußte ich von Anfang an, was ich getan hatte. Doch jetzt, da die Bestätigung auf so sonderliche, so indirekte Weise gekommen war, sah ich meine Tat vor mir wie seinen Geist, aber im Gegensatz zu ihm war sie nicht unkörperlich, schemenhaft und halb verborgen, sondern etwas Wirkliches. Sie war begangen worden. Ich hatte sie begangen. Sie war zur unumstößlichen Wahrheit geworden, weil nun nicht mehr ich allein von ihr wußte.
Das Schreiben wird die Flut der Briefe nicht zum Stillstand bringen – seit dem aus San Francisco sind drei weitere gekommen –, aber vielleicht hilft es mir, seinen Geist zu bannen. Die Träume kommen schließlich nur nachts, wenn ich im Bett liege und schlafe. Sein Geist erscheint mir überall und zu jeder Zeit. Vor wenigen Sekunden zum Beispiel, als ich das über Serrano noch einmal las, habe ich ihn wieder gesehen. Aus dem linken Augenwinkel. Er stand am Erkerfenster, aber sobald ich mich zu ihm hinwandte, stahl er sich davon. So ist es immer. Er – dieses Wesen – ist eine Ausgeburt meiner Phantasie, die Verkörperung meines schlechten Gewissens, nie zeigt er sich mir direkt, immer sehe ich ihn nur aus einem Augenwinkel, am Rand meines Gesichtsfeldes oder aus der Ferne, am Strand vor einem Wellenbrecher oder auf der anderen Seite der High Street, wo er sich schräg in einer Schaufensterscheibespiegelt.
[16] Damit will ich nicht sagen, daß ich darin etwas Übernatürliches sehe. Ich glaube nicht an Gespenster. Nach wie vor nicht. Er ist das Produkt meines verstörten Gemüts. Die Reue hat ihn aus Rückblenden und alten Fotos und Erinnerungen erstehen lassen. Meist sehe ich ihn gar nicht, ich spüre ihn nur hinter mir, fühle den kalten Luftzug, wenn er eine Tür aufmacht, oder höre seine Schritte auf einer knarrenden Treppenstufe. Was seltsam ist, weil er nie in diesem Haus war. Ich war ja selber nur selten hier, das Haus kennt nur seine klare, volltönende Stimme, die manchmal vom Telefonhörer bis in den fernsten Winkel des Zimmers drang. Sein Geist zeigt sich mir, wo ich auch bin, und ich weiß, daß er mir überallhin folgen würde, seine flüchtigen Erscheinungen hängen mit mir zusammen und nicht mit Orten, an denen wir gemeinsam waren.
Er lebt in mir, und stürbe ich, würde er mit mir sterben. Will ich ihn am Ende, indem ich über ihn schreibe, abermals töten?
[17] 2
Das Haus an der Uferstraße mit Blick aufs Meer gehört zu einer dieser viktorianischen Häuserzeilen, in denen jedes Haus von der Bauweise und von der Höhe her völlig unterschiedlich ist. Unseres ist schmal und hoch, hat in jedem Stockwerk ein breites, dreigeteiltes Fenster, und sein Giebel ist gestuft. Die ursprünglich in Vanillepuddinggelb gestrichene Fassade ist durch Einwirkung von Sonne und Wind zu einem schmutzigen Sandton verblaßt. Eine städtische Vorschrift besagt, daß alle drei Jahre neu getüncht werden sollte, aber meine Eltern haben sich nie daran gehalten und ich auch nicht. Ich könnte mir das gar nicht leisten, ich muß mein Geld zusammenhalten. Andere sparen, damit sie später nicht im Regen stehen, und ich, weil ich mal zu lange im Regen gestanden habe.
Seit jenem Jahr, als mit der Frühjahrsspringflut das Meer über den kiesigen Strand und die Ufermauer bis durch unsere Haustür kam, wohnen wir im ersten Stock. Ich sehe noch die zu Planschbecken gewordenen Zimmer vor mir und die Teppiche, die auf der trüben Flut schwammen. Unten sind das unbenutzte Eßzimmer mit einem Boden aus rohen Dielenbrettern und hinten, auf engem Raum zusammengedrängt, Küche, Spülküche und Speisekammer. In den zwanzig Jahren, die unsere Familie das Haus bewohnt (und davor auch noch einmal gut und gerne zehn Jahre lang) wurde nie etwas modernisiert oder [18] umgebaut, alles ist noch auf dem Stand von 1959. Unter dem Giebel und in dem Stockwerk darunter sind fünf recht schäbige Zimmer, von denen inzwischen nur noch eins wirklich bewohnbar ist. In dem wohne ich. Hier, in diesem geräumigen Zimmer mit Blick aufs Meer sitze ich immer, wenn ich zu Hause bin. Es ist genauso schäbig wie die übrigen Räume, immerhin aber stehen Bücher darin, Stühle und ein Sofa zum Sitzen, und an den Wänden hängen Bilder.
Alles ist alt und vergammelt. Die Stuhlfedern sind kaputt und die Polster abgewetzt. Aus den durchgelaufenen Stellen auf dem roten Teppich werden bald Löcher geworden sein. Die Tapete beginnt sich abzulösen, an manchen Stellen schlägt sie Blasen, an anderen rutscht sie einfach sacht von der Wand. Das ist nicht erst so, seit ich hier wohne, in meiner Erinnerung war es nie anders. Gemalt und tapeziert und Ordnung gemacht wurde nur einmal, nach der Springflut, und auch da gerade nur das Nötigste. Neues gekauft, Kaputtes repariert wurde nie. Meine Eltern sahen offenbar gar nicht, was fehlte, und ich sehe es erst jetzt, seit ich zurück bin. Aber im Grunde stört es mich nicht.
Die Bilder sind alle nichts wert, und die gerahmten Fotos sind vergilbt, so daß nicht nur die von vor 1920 wie Sepiafotos aussehen. Es sind Aufnahmen von der Familie, Schul- und Studentengruppen, auf denen ich kein einziges Gesicht identifizieren kann. Meinen Eltern ging es nicht anders, aber für sie war das kein Grund, die Fotos von der Wand zu nehmen. Sie spekulierten mit großem Eifer darüber, ob dieses oder jenes Gesicht zu Onkel Soundso [19] gehörte und ob das da Großvaters Freund sein könnte, der vor dem Ersten Weltkrieg nach Indien gegangen war.
Alles, sagte ich, ist alt und vergammelt. Für die Bücher gilt das nicht. Auch sie sind alt, denn sie gehörten meinen Großeltern und Urgroßeltern, aber sie sind, da wenig gelesen, in gutem Zustand. Am besten erhalten ist eine Sammlung russischer Romane von Tolstoi, Dostojewskij, Gogol und Turgenjew in dunkelblauem Ledereinband mit Goldprägung. Mein Urgroßvater, der Großvater meines Vaters und Geschäftsführer einer Buch- und Papierwarenhandlung, bekam sie 1910 geschenkt, als er sich zur Ruhe setzte.
Hatte er sie sich gewünscht? Hatte man ihm eine goldene Uhr angeboten und hatte er sich statt dessen diese Bände erbeten? Niemand konnte mir die Frage beantworten. Fest steht, daß er – oder jemand anders – sich zum Entsetzen jedes Bücherfreundes gegen eins dieser Bücher versündigt hat. Mit einem scharfen Messer und ruhiger Hand hat er aus der Mitte des Bandes – so daß die ersten und die letzten fünfzig Seiten unversehrt blieben – ein quadratisches oder besser gesagt würfelförmiges Loch herausgeschnitten. Wenn man das Buch aufschlägt – was ich zum ersten Mal mit elf Jahren tat –, ist zunächst alles in schönster Ordnung, und dann hat man plötzlich die viereckige Wunde im Text vor Augen, die kästchenförmige Höhlung liegt offen zutage.
Damals war ich noch kein sehr eifriger, immerhin aber ein wißbegieriger Leser. Ich nahm das Buch in die Hand, blätterte – und fand in der Mitte zu meiner größten Verwunderung die kleine Schatzkammer, in der die Perlen [20] meiner Mutter, zwei Fünf-Pfund-Noten und eine goldene Uhr ruhten.
Nach Ansicht meines Vaters war ich bis dahin noch zu jung gewesen, um in das Geheimnis eingeweiht zu werden. Nachdem ich es aber jetzt von selbst entdeckt hatte, wurde ich feierlich in den Bund aufgenommen. Hier verwahren wir unsere Wertsachen, du darfst auch etwas hineintun, wenn du willst. Deine Amethystdruse oder dein getrocknetes Seepferdchen. Das so grausam verstümmelte Buch war ein Band mit Erzählungen von Tolstoi, genannt »der Safe« oder »Sergius« nach Vater Sergius, der ersten und einzig unversehrten Erzählung des Bandes, denn die letzte, Die Kreutzersonate, war so lang, daß sie zehn Seiten hatte hergeben müssen.
Solche »falschen« Bücher als Versteck für Wertgegenstände sind heutzutage nichts Besonderes mehr, sie werden eigens zu diesem Zweck hergestellt und in Geschenkboutiquen verkauft. Ich habe sie hier in der High Street gesehen und frage mich, ob die Einbrecher immer geradewegs das Bücherregal ansteuern und nach einem vornehmen Lederband mit üppiger Goldprägung fahnden. Für meine Eltern aber war Sergius die sensationellste und raffinierteste Erfindung aller Zeiten. Es machte ihnen offenbar Spaß, daß ich nun alt genug war, um ihr Geheimnis zu teilen, und wenn Besucher eine Bemerkung über die russischen Bücher machten oder wenn das Gespräch auf Bücher dieser Art kam, wechselten sie vielsagende Blicke mit mir. Sie lebten wohl in einer eigenen Welt, in der die Zeit stillstand oder vielmehr stehengeblieben war, als sie 1965 – beide schon in mittleren Jahren – geheiratet hatten.
[21] Einige Bücher aus dieser Sammlung habe ich dann tatsächlich gelesen. Im Gegensatz zu meinem Vater ließ ich mich von Tolstois düsterer Weltsicht und Dostojewskijs Passion für menschliches Leiden nicht abschrecken. Mein Vater war tierlieb. Dostojewskij, sagte er immer, konnte kein Buch schreiben, in dem nicht irgendwo ein Pferd zu Tode geprügelt wird.
Angeregt durch den Blick auf die dunkelblau-goldenen Russenbände, unter denen auch Sergius steht, werde ich, ihnen folgend, den Ort, in dem ich lebe, als die Stadt N. bezeichnen. »In den Gasthof der Gouvernementstadt N. fuhr ein ziemlich hübscher zweisitziger Wagen, in welchem gewöhnlich Junggesellen fahren…« Was Gogol kann, das kann ich schon lange.
N. liegt an der flachen, ausgewaschenen Küste von Suffolk, wo es keine richtigen Klippen gibt, sondern nur Sandbänke und Kieshügel, und wo die Flußmündungen sich träge durch die tiefliegenden Wiesen zum Meer vorschieben. Auch eine Küstenstraße gibt es nicht. Die Städte und Dörfer sind miteinander und mit der bis zu zehn Meilen entfernten Nord-Süd-Autobahn durch Wege verbunden, die entweder schnurgerade verlaufen oder gewunden sind wie Korkenzieher. Die Feuchtgebiete und Heideflächen sind ideal für Vögel, und jeden Morgen weckt mich der Schrei der Gänse, die von ihrer Obergans zum Flug ins Landesinnere zusammengerufen werden. Entweder gibt es jetzt mehr Gänse als in meiner Kindheit, oder – und das ist wahrscheinlicher – ich hatte damals einen tieferen Schlaf.
Die Stadt selbst ist nicht groß, wenn auch natürlich [22] größer als damals, als ich mit sieben Jahren zusammen mit meinen Eltern herkam. Überall am Stadtrand sind Wohngebiete mit kleinen Siedlungshäusern entstanden. Gegenüber der Kirche aus dem 13. Jahrhundert steht ein neues, sehr häßliches Besucherzentrum, und das Latchpool Hotel an der Uferstraße hat jetzt einen riesigen kasernenartigen Anbau, der bis zur High Street reicht. In dem einstigen Herrenhaus Thorpegate Hall ist nach Umbau und Erweiterung ein Konzertsaal untergebracht, den ein Journalist einmal den besten in ganz Westeuropa genannt hat.
Das Herzstück von N. aber wirkt heute – darüber ist man sich wohl allgemein einig – dank Denkmalschutz und Heimatpflege anziehender als früher. Die Hausbesitzer bekommen Fördermittel, um ihre Häuser in Schuß zu halten und häufig neu zu streichen. Ein jährlicher Vorgartenwettbewerb hat N. den Titel einer Blumenmetropole von East Anglia eingebracht. Noch vor zehn Jahren unentbehrliche Einzelhandelsgeschäfte – Metzger, Bäcker, Gemüsehändler – haben geschlossen (die Bürger von N. fahren zum Einkaufen in die Supermärkte von Ipswich), und an ihre Stelle sind Souvenirläden, Antiquitätenhallen und Boutiquen für Designerkleidung oder die Arbeiten hiesiger Kunsthandwerker oder Maler getreten.
Diese Veränderungen hat hauptsächlich das Festival mit sich gebracht. Denn N. – und das dürfte inzwischen für den Leser keine Überraschung mehr sein – beherbergt Europas berühmtestes Gesangs- und Tanzfestival, das heißt eigentlich mehr als eins, denn der Ehrgeiz der Festspielleitung ist inzwischen fast ins Unermeßliche gestiegen, und die Stadt steht nicht nur zwei Wochen im Juli ganz im Zeichen von [23] Tanz und Gesang, sondern richtet auch Weihnachtsfestspiele und eine Ostergala aus.
Jede gewünschte Spielart der Vokalmusik ist hier zu finden: Oper und Operette, Konzertarien, Musical, Madrigale, ambrosianische Gesänge, Chorwerke, frech-fröhliche Chansons, Balladen, Lieder, Folk und Blues, Spirituals, Rock und Country. Alles, was man der Kunst der Terpsichore zurechnen kann, wie der Festspielleiter, Julius Grindley, neckisch und nur allzu oft bemerkt, wird hier geboten: Ballett, Country Dancing, Flamenco, der alte englische Hornpipe, Polonaisen, Mazurka und Czardas, Militärmärsche, langsamer Walzer und Cancan. Wir sind nicht exklusiv, wir sind keine Snobs. Country und Western sind uns ebenso willkommen wie die opera seria, und in unserem Veranstaltungsprogramm steht der Bossa Nova gleichberechtigt neben Schwanensee.
Man beachte den Gebrauch der ersten Person Plural. Ich benutze das »wir« nicht nur als Bürger von N., sondern als Sekretär der Festspielleitung. Ich kann wohl von Glück sagen, daß ich diesen Job ergattert habe, auch wenn Julius mir stets versichert, ich sei für den Posten überqualifiziert, und sich gleichzeitig wegen des minimalen Gehalts entschuldigt. Als echter Macho sagte er mal, meinen Job könne auch eine Frau machen, sogar eine mit Mittlerer Reife.
Tatsächlich brauche ich, wenn ich die zweihundert Meter zum Verwaltungszentrum der Festspiele zu Fuß zurückgelegt habe, dort nur Briefe zu beantworten und ans Telefon zu gehen, Broschüren und Eintrittskarten zu verschicken und alle wichtigen Anfragen an Julius [24] weiterzuleiten. Für die Gewinnung von Sponsoren sind andere zuständig. Ich habe keine Fahrtkosten, keine stressige Anfahrt, brauche nicht um einen Parkplatz zu kämpfen und bekomme mein Mittagessen täglich von der Fastfood-Theke des Restaurants Thalassa ins Haus geliefert. Vom Fenster meines Büros habe ich mehr oder weniger denselben Blick wie von meinem Haus, nur liegen hier noch der Park des Latchpool und der Tennisplatz des Esplanade dazwischen. Nachmittags um fünf schalte ich den Computer aus und den Anrufbeantworter ein und gehe nach Hause.
Bis hierher habe ich meinen Text gerade noch einmal durchgelesen, und meine Feigheit, meine Drückebergerei widern mich an. Denn bislang habe ich das, worüber ich berichten muß, einfach vor mir hergeschoben, habe in einem forsch-vergnügten Ton geschrieben, als führte ich ein glückliches und zufriedenes Leben.
Was ich geschrieben habe, klingt wie aus einem Prospekt des Fremdenverkehrsbüros. Wem es aber um eine Beschreibung der Stadt oder unserer Musik geht, der ist mit den Broschüren der Festspielleitung besser bedient – oder auch mit Tanz und Spiel brauchen ein Ziel, den Memoiren von Carlton Kingswear, Julius’ Vorgänger.
Für mich ist N. ein Zufluchtsort; das Festspielbüro und seine Arbeit stehen jenen leidenschaftlichen, gewalttätigen und vielleicht, nein, mit Sicherheit verbrecherischen Begebenheiten meines Lebens so fern, daß sie mir wie ein anderer Planet vorkommen. Es ist eine Ironie des Schicksals, daß ich nur in der Arbeit Ruhe finde.
Ich lese viel, aber wenig leichte oder auch nur [25] zeitgenössische Literatur. Gesellschaftliche Kontakte habe ich kaum. Manchmal rede ich im Pub mit den Fischern über das Wetter oder ihren Fang. Vor den Partys der Festspielleitung kann ich mich natürlich nicht drücken, dort mache ich Konversation und trinke meinen Rioja wie alle anderen. Zu den anschließenden Essen werde ich aufgrund meiner bescheidenen Stellung zum Glück nicht eingeladen. Wenn Julius oder auch Sir Brian Wert darauf legen, lasse ich mich bei Palestrinas madrigali spirituali oder bei Ballettmusiken von Sauguet oder Hindemith sehen, die gewöhnlich nicht allzu viele Besucher anlocken, geschweige denn volle Häuser bringen. Danach mache ich, daß ich nach Hause komme.
Als ich nach N. zurückkam, erkannte man mich auf Schritt und Tritt. Meine Mutter war, ehe sie nach Ipswich ins Krankenhaus und dann ins Pflegeheim Sunnyland kam, eine gesellige Frau gewesen und hatte in vielerlei Ausschüssen wohltätig gewirkt. Man sprach mich auf der Straße auf sie an, man lud mich in die Familien ein. Es fällt nicht schwer, seine Mitmenschen vor den Kopf zu stoßen, wenn es einem gleichgültig ist, wie sie darauf reagieren oder über einen denken. Aber ich mußte ziemlich viele Abfuhren verteilen, ehe man mich in Ruhe ließ. Seither gelte ich als Einsiedler, als arrogant oder aber als gemütskrank. Nur ein oder zwei haben es noch nicht aufgegeben.
Ansonsten hat niemand meine Nähe gesucht. Die Zecher im Mainmast reden über das Klima, über Fische und manchmal über den Ausbau des nahegelegenen Atomkraftwerkes, aber nie über Persönliches. Meine Mutter im [26] Sunnyland weiß häufig nicht, wer ich bin. Bei meinen seltenen Besuchen hält sie mich für einen der Ärzte oder für den Neffen der Frau, die neben ihr im Rollstuhl vor dem Fernseher sitzt. Nur ihre Schwester, meine Tante Clarissa, die in Ipswich wohnt und sie oft besucht, erkennt sie immer. Ich fahre jetzt kaum mehr hin; ich täte es eigentlich nur aus sentimentalen Gründen oder um das Personal zu beeindrucken, und beides ist im Grunde witzlos.
Clarissa nimmt kein Blatt vor den Mund. Was denn bei mir schiefgelaufen sei, fragte sie geradeheraus, was michzu einem so gräßlichen »Miesepeter« gemacht habe. Ein andermal hörte ich, wie sie zu meiner Mutter sagte, sie habe ja schon immer gesagt, daß irgendwas mit mir nicht stimme, vielleicht käme es daher, daß ich das einzige Kind einer damals schon siebenundvierzigjährigen Mutter sei. Seither rufe ich immer an, bevor ich zum Sunnyland fahre, um Clarissa nicht zu begegnen.
Bei unserem letzten Gespräch wollte sie wissen, wovon ich eigentlich lebte und ob ich »dieses Buch« schon geschrieben hätte. Ich erwiderte kurz, daß ich im Festspielbüro tätig sei.
»Ich dachte, du hast studiert, um das Bücherschreiben zu lernen«, sagte sie.
Soviel Humor ist mir immerhin noch geblieben, daß ich diese Definition des angesehenen Postgraduierten-Studiengangs für Kreatives Schreiben an der Universität von P. sehr komisch fand. Ich konnte mir Penny Marvells Gesicht vorstellen, wenn man so etwas zu ihr gesagt hätte, oder das von Martin Zeindler oder in diesem Zusammenhang auch das von Ivo. Dabei brauche ich, um an ihn zu denken, [27] keinen Zusammenhang, sein Gesicht steht mir ständig vor Augen. Und in diesem Augenblick spürte ich auch schon, wie sein Schatten über den Rollstuhl meiner Mutter fiel. Als ich mich umdrehte, war er natürlich verschwunden.
»Das Bücherschreiben zu lernen ist nur ein erster Schritt – sofern sich so etwas überhaupt erlernen läßt. Bücher brauchen auch einen Verlag und Leser.«
Damit konnte sie natürlich nichts anfangen. Sie kniff ihre kleinen schwarzen Vogelaugen zusammen und sagte scharf, zunächst müßten sie ja wohl geschrieben werden.
»Sechs Jahre Studium«, sagte sie verächtlich, als hätte ich einen Fachschulabschluß als Landmaschinenmechaniker gemacht. »Möchte wissen, ob du bei der Stange geblieben wärst, wenn du es selber hättest zahlen müssen.«
Leute ihres Schlages sähen es am liebsten, wenn sämtliche Hochschulabsolventen nach dem Abschluß zehn Jahre schuften müßten, um ihre staatlichen Zuschüsse zurückzuzahlen, möglichst noch mit Zinsen. Aber während ich hier sitze und endlich angefangen habe zu schreiben und dem Aufschlagen und Rückwärtsrollen der See zuhöre, denke ich mir, daß das ein ganz guter Anfang wäre: Wie ich an die Hochschule ging, um »das Bücherschreiben zu lernen«.
Meine Kindheit in N., meine Jahre an der Privatschule am anderen Ende der Grafschaft, mein Erststudium der englischen Literatur – all das ist unwichtig und kann übergangen werden. Wenn ich später doch noch auf meine Schule zu sprechen komme, dann nur, um etwas darüber zu sagen, wie es dort zuging, ehe in dem Jahr nach meinem Abgang auch Mädchen zugelassen wurden.
[28] Ich fange am besten an dem Tag an, als ich mit einundzwanzig Jahren an einem Sommernachmittag in dieses Zimmer mit dem großen Fenster und dem Meerblick kam und meinen Vater tot in seinem Sessel vorfand. Ich habe Sergius vorhin bewußt eingeführt, denn als ich meinen Vater sah, hatte er, wie so oft, den »Safe« geöffnet in der Hand, und sein Blick war mit leisem Lächeln auf ihn gerichtet.
Er starb an einem Herzanfall. An jenem sonnigen Nachmittag um drei hatte irgend etwas sein Herz zum Stillstand gebracht. Obwohl er hier in diesem Zimmer gestorben ist, in diesem Sessel, den er sich dicht ans Erkerfenster gerückt hatte, habe ich nie seinen Geist gesehen, habe nie seine Schritte gehört. Das liegt wohl daran, daß ich keine Schuld an seinem Tod trug. Er hatte am Fenster gesessen, damit er, wenn er der Schätze in Sergius müde geworden war, den Blick heben und aufs Meer hinaussehen konnte.
Meine Mutter war nach seinem Tod finanziell sehr gut gestellt, was aber unsere Bekannten nicht daran hinderte, zu mir zu sagen, ich würde es wohl jetzt als meine Pflicht ansehen, nicht weiterzustudieren, sondern mich nach einer Stellung umzusehen. Es sei ein wahres Glück, sagte einer, daß ich noch vor dem Tod meines Vaters meinen Abschluß gemacht hätte. Alle erwarteten, ich würde zu Hause wohnen und »ins Lehrfach« gehen. Es ist erstaunlich, wie viele Leute glauben, daß einem, wenn man nur irgendeinen Hochschulabschluß hat, Schulverwaltungen und Bildungsdezernate eine Lehrerstelle geradezu aufdrängen.
[29] Daß man mir bereits einen Job angeboten hatte, erzählte ich keiner Menschenseele. Die PR-Referentin, die die Sponsoren einer Flamencoaufführung im Rahmen des Festivals vertrat, fragte mich, ob ich mal daran gedacht hätte, Dressman zu werden, und ich kam mir vor wie das Opfer eines Hollywood-Talentsuchers, das zu einer Probeaufnahme geschleppt werden soll.
»Wenn du eine Frau wärst«, sagte sie, »wäre es für dich ganz selbstverständlich, Kapital nicht nur aus deinem Wissen, sondern auch aus deinem Aussehen zu schlagen.«
»Ich bin keine Frau. Außerdem gibt es viele Frauen, die das nicht so sehen.«
»Nur die nicht, die mit ihrem Aussehen sowieso keinen Blumenpott gewinnen können.«
Ich sagte ihr nicht, daß ich zunächst versuchen wollte, Schriftsteller zu werden, und daß ich nicht viel davon hielt, aus irgend etwas oder irgend jemandem Kapital zu schlagen. Als ich mir vorstellte, wie ich nur mit Designerjeans und vielleicht einem goldenen Halskettchen bekleidet vor einem Alpenpanorama lässig an der Kühlerhaube eines Sportwagens lehnte, mußte ich lachen und sie auch.
Wir hatten im Theaterfoyer den Drinks ausgiebig zugesprochen, und ich begleitete sie ins Latchpool Hotel und auf ihr Zimmer.
Sie war betrunkener als ich – immerhin war sie 15cm kleiner und zehn Jahre älter –, und vermutlich deshalb und nicht meiner allenfalls mittelmäßigen Leistung wegen fiel sie vor mir auf die Knie und umfing meine Beine. Fellatio kam für mich nicht in Frage, das hatte ich ihr rundheraus erklärt, die scharlachrote dicke Schicht von Lippenstift [30] wirkte abstoßend. Sie lobte mich – das heißt meine Erscheinung – in den höchsten Tönen, führte mich zum Spiegel an der Badezimmertür und forderte mich auf, mein Abbild zu betrachten.
Ich nahm mich selbst kaum wahr, denn ich war vollauf damit beschäftigt, mir zu meinem Erfolg zu gratulieren; es war mein erster oder zumindest mein erster gelungener Beischlaf gewesen. Falls sie sich so etwas gedacht hatte, behielt sie es für sich. Ich zog mich an und bestellte beim Zimmerservice eine Flasche Champagner. Im Latchpool hatte vermutlich bislang noch niemand um Mitternacht so ein Ansinnen an den Zimmerservice gestellt, aber der Champagner kam, und der Kellner fragte bissig, was wir denn zu feiern hätten. Doch das wußte nur ich.
Als meine Partnerin wegsackte, legte ich sie aufs Bett und stellte ihr ein Glas und eine Flasche Mineralwasser aus der Minibar auf den Nachttisch. Ich habe sie nie wiedergesehen. Es heißt, daß du den Namen deiner ersten Frau nie vergißt, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, nur daß es einer dieser irischen Namen war, Sinead oder Siobhan.
Zwei Tage später teilte mir die Universität von P. mit, daß ich einen Platz in einem zweijährigen Studiengang für Kreatives Schreiben bekommen hatte, und zwar aufgrund meines ersten Studienabschlusses und der eingesandten Kurzgeschichte, die ich sonst niemandem gezeigt hatte. Die Unterschrift war unleserlich, aber darunter war der Name noch einmal getippt: Dr.Martin Zeindler, M. A., Ph. D., Kursleiter und Tutor für Postgraduierten-Studiengänge.
[31] Bei dieser Gelegenheit sah ich den Namen des Mannes, der mich durch mein Studium begleiten sollte, zum ersten Mal. Man könnte ihn wohl einen Katalysator nennen, oder einen Schachspieler, der wie im Schlaf die Steine auf dem Brett verschob, unberührt von den Wechselfällen des Spiels, ja ohne zu wissen, daß Änderungen eingetreten waren.
Ebensogut hätte diese Rolle Penny Marvell oder Piers Churchill zufallen können. Gewöhnlich gingen sie alphabetisch vor. Penny oder Piers übernahmen die Studenten mit Namen von A bis M, Martin die von N bis Z. Nurhatten sie diesmal einen Überhang mit Namen aus der ersten Hälfte des Alphabets, zwei Browns zum Beispiel und keine Smiths und Wilsons. Martin selbst hat mir das einmal erzählt, nachdem er erklärt hatte, er sei enttäuscht von mir.
»Ich habe dich rausgepickt«, sagte er. »Einfach deshalb, weil ich in Cornwall Urlaub gemacht hatte. Cornish, sagte ich mir, warum nicht? Den nehmen wir. Weiß der Himmel, warum ich mich nicht für Dunbar entschieden habe. Ich habe dort mal ein wunderschönes Wochenende verlebt.«
Sophie Dunbar ist die einzige von uns, die schon etwas erreicht hat. Ab und an ist in der Zeitung eine Vorankündigung für ihren zweiten Roman, der im Herbst herauskommen soll. Warum hat er nicht sie herausgepickt? Dann sähe alles anders aus.
[32] 3
Martin Zeindler weiß genau, wie gute Literatur geschrieben sein sollte, selber schreiben aber kann er nicht. Sein einziger Roman war so abstrus und unverständlich wie der spätere Henry James und so ermüdend wie Finnegans Wake, und auch nach zehn Anläufen hatte er keinen Verlag dafür gefunden. Martin ist demnach das lebende Beispiel für Shaws Bonmot, daß die Könner es tun und die anderen es lehren. Ich möchte annehmen, daß er nach wie vor, seine schwarze Katze um die Schultern gelegt wie eine Stola, seine hochkonzentrierten Tutorien für nur zwei oder drei Studenten bei sich zu Hause hält und daß nach wie vor seine Augen strahlen und sein Gesicht aufleuchtet, wenn er sich bemüht, in den Anfängern die Liebe zu perfekter Prosa zu wecken.
Die Gruppe umfaßte vierundzwanzig Studenten, fünfzehn Anfängerinnen und neun Anfänger, alle einundzwanzig oder zweiundzwanzig Jahre alt bis auf unsere »Spätberufene«, die Mitte Dreißig sein mochte. Alle wünschten wir uns insgeheim den Titel Bester Britischer Nachwuchsschriftsteller, und manche bekannten sich auch ganz offen zu diesem Ziel. Von den vierundzwanzig Teilnehmern stiegen zwei am Ende des ersten Studienjahres aus, drei wurden vor die Tür gesetzt, wie Penny sich ausdrückte, einer starb auf geheimnisvolle Weise, wahrscheinlich an Aids, eine Frau wurde schwanger und zog nach [33] Deutschland, und Sophie Dunbar schrieb einen Roman, der in der Sunday Times besprochen wurde und auf die Auswahlliste für den Whitbread Award kam. Die anderen haben sich, soweit ich weiß, noch keine Lorbeeren verdient – nur Jeffrey Browns Namen habe ich mal unter einem Sonettim Spectator gelesen, – aber das kann ja noch kommen.
P. mag früher ein hübscher Ort gewesen sein. Mit sehr viel Phantasie kann man sich anhand der Altstadt mit ihren schmalen Gassen, Steinhäusern und dem Dom aus dem 12. Jahrhundert noch vorstellen, wie es dort früher einmal ausgesehen hat. Diese Reste der Vergangenheit sind umgeben von Bürobauten, Einkaufszentren und pseudo-mittelalterlichen Parkhäusern mit Türmchen und Zinnen. Am Samstag und in der abendlichen Rush-hour herrscht in P. mehr Verkehr als in der Londoner Innenstadt.
Die Universität, in den sechziger Jahren aus grauem Beton und schmutzigweißen Fertigteilen errichtet, steht auf begrüntem und teilweise bewaldetem Gelände an der Ausfallstraße nach Birmingham und zu den Welsh Marches. Der Studiengang für Kreatives Schreiben ist in einem Riesenkasten untergebracht, der sich Zentrum für Geisteswissenschaften nennt und zu dem man von den anderen Gebäuden aus über verglaste Laufgänge gelangt. Als ich dort anfing, waren die Laufgänge noch nicht ausgesprochen unsicher, aber schon reichlich mitgenommen, viele Scheiben waren kaputt und die Betonpfosten innen und außen über und über mit Graffiti beschmiert. Der Architekt hatte das Ganze so angelegt, daß man von dort einen Blick auf die verschandelte Stadt hat, über der die sechs Studentenwohnheime aufragen, anthrazitgraue [34] Wolkenkratzer mit stumpfgrün verwitterten Kupferdächern. Man erzählte sich, daß es in diesen Häusern aussah wie in Innenstadtslums, die Fahrstühle funktionierten nicht, und die sanitären Einrichtungen waren in katastrophalem Zustand.
Wir wohnten nicht dort, sie waren für Studenten im zweiten und dritten Studienjahr bestimmt. Um uns unterzubringen, hatte die Hochschule in den Vororten von P. und den Siedlungen weiter draußen Häuser angekauft, in denen, so klein sie waren, jeweils vier Studenten Platz finden mußten.
Dempster Road 23 hatte drei Schlafzimmer, aus denen durch dünne Zwischenwände vier gemacht worden waren, ein Badezimmer, zwei Toiletten, eine sehr kleine Küche, in deren Kühlschrank jeder von uns ein Fach bekam, und ein gemeinsames, von einem großen Fernseher beherrschtes Wohnzimmer.
Von meinen Mitbewohnern in der Dempster Road war nur Emily Hadfield in meinem Studiengang. Sie war fast zwei Jahre jünger als ich und die einzige unter uns, von der schon etwas gedruckt worden war. Sie hatte den Kurzgeschichtenwettbewerb einer Frauenzeitschrift gewonnen, und die hatte ihren Beitrag gebracht.
Emily war eine kleine, brünette Person mit einem anziehenden Äffchengesicht und einem Afroschopf. Sie hatte einen Wagen, den sie auf der Straße parken mußte, und nahm mich wie selbstverständlich zum Campus mit. Bei Penny Marvells erster Vorlesung saßen wir nebeneinander und bekamen als Tutor Martin Zeindler zugewiesen. Emily wurde meine Freundin.
Das schreibe ich so hin, als wäre es mehr oder weniger [35] selbstverständlich gewesen, aber das war es gerade nicht. Erstens fand ich sie nicht besonders reizvoll, und zweitens waren wir wirklich nur Freunde im ideellen Sinne des Wortes. Zumindest in den ersten Wochen. Emily schien sich – wie weiland wohl ihre Großmutter – mit Gutenachtküssen und später dann mit Zärtlichkeiten zufriedenzugeben, die dort aufhörten, wo es anfing, ernst zu werden. Aber eines Abends löste sie sich in ihrem kleinen, vollgestellten Zimmer aus meinen Armen und sagte nüchtern:
»Ich bin keine Jungfrau mehr.«
Ich schwieg.
»Und ich paß schon auf, daß ich kein Kind kriege.«
Heutzutage würde man wohl noch ergänzen, man sei auch nicht HIV-positiv, aber so weit waren wir vor vier Jahren noch nicht. Bis zu diesem Moment hatte ich eine nicht unangenehme Erregung empfunden und das Gefühl gehabt, daß alles ganz gut lief, aber Emilys Bemerkung war wie eine kalte Dusche. Diese Art von Sachlichkeit, sagte ich, könne alle Romantik kaputtmachen, und begab mich möglichst würdevoll ans andere Ende des Zimmers – ganze drei Meter.
»Wenn du so schreibst, wie du redest, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du aus dem Kurs fliegst«, sagte Emily.
Diese Bemerkung hatte eine ganz erstaunliche Wirkung auf mich. Emily hatte mir weh tun wollen, ihr hätte eine solche Bemerkung weh getan, aber mich freute sie fast, denn sie lenkte von meiner eigentlichen Sorge, meiner schwach ausgeprägten Sexualität, ab. Und zeigte mir von [36] einer Sekunde auf die andere, daß ich nie die Schriftstellerei zum Beruf machen würde. Sie interessierte mich nicht genug. Viel mehr interessierte mich meine sexuelle Orientierung. Wohin trieb sie? Wohin trieb ich?
Wir hatten uns zerstritten, und ich ging schlafen. Emily tat das einzig Richtige. Wie sie darauf kam, weiß ich nicht, vielleicht handelte sie gar nicht gezielt, hatte gar nicht die Absicht gehabt, mir zu helfen, sondern suchte nur Trost und wollte sich wieder mit mir vertragen. Ich lag seit einer halben Stunde in meinem dunklen Zimmer und war drauf und dran einzuschlafen, da kam sie leise herein, legte sich in dem schmalen Einzelbett neben mich und umfaßte mit ihren warmen Händen mein Gesicht.
»Tut mir leid, das hätte ich nicht sagen dürfen. Sei nicht mehr böse, ich hab’s nicht so gemeint. Ich hatte das Gefühl, daß du mich nicht willst, deshalb war ich vorhin so eklig.«
Ich brachte kein Wort heraus. Es war stockdunkel, die Straßenbeleuchtung wurde um Mitternacht abgeschaltet, und mein Körper war schlafbereit und ganz entspannt. Ich fing an, sie liebevoll zu streicheln, weil ich dachte, daß man das wohl mit jemandem machen muß, der mit einem im Bett liegt. Ihre Reaktion war… ja, wie soll ich sagen… passiv, aber erwartungsvoll. Für mich waren das die besten Voraussetzungen. Wohl weil ich nicht getrunken hatte, lief es viel besser als bei der Sponsorfrau im Latchpool, Sinead oder Siobhan. Zu meiner Genugtuung spürte ich, wie Emily sich an mich klammerte und einen leisen Schrei ausstieß, der bestimmt nicht gespielt war. Ich war stolz, weil ich gehört hatte, daß Frauen das machen, wenn es gut für [37] sie war, aber so stolz, daß ich wach geblieben wäre, nun auch wieder nicht. Am nächsten Morgen war sie nicht mehr da. Das Bett sei einfach zu schmal gewesen, sagte sie.
Danach schliefen wir ein-, zweimal die Woche zusammen. Es war angenehm, und es war entspannend. Ich kannte mich in der englischen Literatur gut genug aus, um zu wissen, daß das nicht alles sein konnte, daß meine Empfindungen eine Bedeutung hatten, die sich in Kürze nur allzu deutlich herausstellen sollte. Ich hatte den Satz, mit dem ich mir selbst gegenüber meine Empfindungen rechtfertigte, sogar wörtlich irgendwo gelesen und ein Kapitel später erfahren, wie sich das Schicksal rächte: »Ich gehöre wohl zu den Menschen, die keine besonders ausgeprägte Libido haben.«
Jawohl, das machte ich mir tatsächlich vor. Schau dir dein bisheriges Leben an, sagte ich mir, wobei ich meine Schulzeit vergaß oder absichtlich aussparte. Wer als Zweiundzwanzigjähriger erst mit zwei Frauen geschlafen hat, davon mit einer nur ein einziges Mal, hat kein großes Interesse am Sex – über meine fehlgeschlagenen Versuche mit etlichen Mädchen während meines Erststudiums sah ich dabei großzügig hinweg –, und dazu konnte ich mich letztlich nur beglückwünschen. Was blieb mir da nicht alles an Herzweh und Seelenschmerz, an Komplikationen durch häufig wechselnde Partnerschaften und zerstörerische Leidenschaft erspart!
Ja, das alles sagte ich mir, während ich zweimal in der Woche mechanisch-pflichtschuldig wie ein seit zwanzig Jahren verheirateter braver Ehekrüppel mit Emily schlief.
In unserem ersten Jahr mußten wir mehrere Essays und [38] als Hauptarbeit eine Novelle oder ein Drehbuch schreiben. Wir konnten wählen.
Emily wollte, wie ich, eine Novelle schreiben. Sie plante eine Schauergeschichte aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ich ein »sensibles« Stimmungsbild über einen Jungen, der in einer Stadt an der See aufwächst. Am besten schreibt ihr über Sachen, die ihr kennt, sagte Martin Zeindler und fügte einschränkend hinzu: »Viel kennt ihr ja in diesem Alter noch nicht.«
Aufmerksam überwachte er den Fortgang unserer Arbeit, ähnlich den Lektoren mancher amerikanischer Verlage, die angeblich mit ihren Autoren ein Kapitel nach dem anderen durchgehen, Vorschläge machen, Textteile verwerfen, strenge Forderungen stellen und hin und wieder wohl auch Lob austeilen, was wir bei Martin eher selten erlebten. Sophie Dunbar verschonte er mit seiner beißenden Kritik ebensowenig wie uns. Es ist natürlich denkbar, daß sich diese Technik nur bei ihr bewährte, daß nur Sophie seine Ratschläge umzusetzen vermochte, weil sie eine angeborene schriftstellerische Begabung besaß. Andererseits hätte sie als geborene Schriftstellerin vielleicht auch ohne ihn etwas erreicht – woran man wieder einmal sieht, daß Kurse für Kreatives Schreiben eine sehr zweifelhafte Sache sind.
Martin beschäftigte sich und uns nicht so sehr mit Themenstellungen, Figuren, Anschaulichkeit, Originalität oder phantasievoller Darstellung, sondern mit Stilfragen. Verständlicherweise erwartete er, daß wir viel lasen, besonders bestimmte literarische Größen, die er und Penny Marvell besonders liebten; ich erinnere mich an Meredith, [39] Virginia Woolf, Golding und Malcolm Lowry. Er erwartete von uns, daß wir uns in der Postmoderne, in Strukturalismus und Dekonstruktion auskannten und genau erklären konnten, warum Elizabeth Bowen zur »guten Literatur« zählte, Maugham und Walpole hingegen nicht. Das alles aber war eher unwichtig im Vergleich zu Martins entschiedener Abneigung gegen Apostrophismus und E-Verlust.
Wie die meisten aus unserem Kurs konnte ich zunächst mit diesen Ausdrücken nichts anfangen, aber Martin, der dies mit fast angeekelter Verwunderung zur Kenntnis genommen hatte, beeilte sich, uns aufzuklären. Sein ganzes Leben lang – oder zumindest seit er selbst sich auf seinen ersten Hochschulabschluß vorbereitet hatte – schlug er sich mit dem Problem herum, Auslassungen zu schreiben, ohne daß der Text für das innere Ohr zu gestelzt oder zu umgangssprachlich klang. Mit anderen Worten – wie geht man mit Ausdrücken wie mach’s, tu’s, ist’s um? Mache es ist unmöglich, weil zu steif, mach’s klingt salopp, nachlässig, allzu volkstümlich. Martin löste das Problem durch komplizierte Umschreibungen, was er auch von uns erwartete. Das war seine fixe Idee.
Als Martin mir in seinem Haus das erste Kapitel meiner Novelle zurückgab, sah ich einigermaßen verblüfft das üppige Muster aus Kringeln und Unterstreichungen, das sich durch das ganze Manuskript zog. Bei Emily war es nicht ganz so schlimm, was wohl hauptsächlich daran lag, daß diese Art der sprachlichen Verschleifungen in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts (jedenfalls nach unserer Auffassung) nicht üblich war.
[40] Sie mußte aber zuhören, wie Martin mein Kapitel auseinandernahm.
»Ein Schriftsteller, der es mit seiner Schriftstellerei ernst meint«, sagte er, »darf sich keine Schlamperei erlauben. Dieser Satz war eine Schlamperei. Hättest du dein Hirn ein wenig angestrengt, hättest du die umgangssprachliche Falle umgehen können, Tim. Wie nämlich?«
Der bewußte Satz lautete: »Der verloren am Strand stehende Junge ließ den Blick über die endlose Weite von Kies und Dünen und nassem flachen Sand schweifen und dachte: Ich glaub, mich haut’s um – jetzt hat’s das Schiff erwischt. Das war’s dann wohl.«
Ich fand an dem Satz nichts auszusetzen, auch als ich ihn still für mich wiederholte. Emily wurde um ihre Meinung gebeten, doch ich sah ihr an, daß sie nicht bereit war, sich zu äußern – immer vorausgesetzt, sie hatte überhaupt eine Meinung dazu. Nachdem Martin sie eine Weile, die große schwarze Katze auf dem Schoß, erwartungsvoll angesehen hatte, kam sie mit: »Ich glaube, ich sehe nicht recht…«
Martin lachte verärgert auf. Inzwischen konnte ich mir zumindest denken, worauf er hinauswollte, und schlug vor: »Ich habe den Eindruck, daß mich meine Sinne täuschen…«; aber Martin nahm die Hand vom Rücken der Katze und winkte sehr entschieden ab.
»Es geht nicht nur darum, Vulgarismen zu vermeiden, Tim, sondern auch Gespreiztheit, das vergeßt ihr offenbar immer wieder. Ginge es nur darum, um jeden Preis den gehobenen Stil zu halten, hätten wir kein Problem, statt ›haut’s‹ ›haut es‹ zu verwenden und so weiter. Versuchen [41] wir es doch einmal so: ›Ach du liebe Güte, jetzt ist wohl dem Schiff etwas zugestoßen. Das sieht schlimm aus.‹«
Ob das nun wirklich die bessere Lösung war, könnte ich heute nicht mehr sagen und wußte es wohl auch damals nicht. Das Ende vom Lied war jedenfalls, daß ich seither sehr großzügig in der Verwendung von Apostrophen und Auslassungen bin. Ich erwähne den Vorfall eigentlich nur wegen der bemerkenswerten und sehr eigenartigen Tatsache, daß Martin Zeindler bei meinem ersten Besuch in seinem Haus ausgerechnet einen Satz kritisch beleuchtete und umformulierte, bei dem es um das Meer und eine Aussetzung und ein gesunkenes Schiff ging.
Es war fast, als hätten er oder ich einen Blick in die Zukunft getan, ich dadurch, daß ich diesen Satz überhaupt geschrieben hatte, er, weil er auf dem Versuch einer Umformulierung bestand, in deren Verlauf der Satz mehrmals wiederholt wurde. Doch diese zukunftsweisende Bedeutung hat er für mich erst heute. Damals war er nur der Beginn einer Arbeit, von der ich nicht sehr überzeugt war und die ich am Ende des Semesters zugunsten einer besseren Idee nach zwei Kapiteln aufgab. Deshalb ging es mir durch und durch, als ich sie in der orangefarbenen Mappe, die ich zwei Jahre zuvor aus P. mitgenommen hatte, vollständig vorfand.
Das Manuskript lag in der Kommode meines alten Schlafzimmers in N., wo ich die Erinnerungsstücke aus jener Zeit untergebracht habe, das heißt weniger Erinnerungsstücke als Überreste, die ich nicht hatte wegwerfen mögen: Isabels schwarzweißes Tuch, den Granat, den ich bei den Kindern in Wrangell für sie gekauft hatte, Ivos [42] Briefe. Der Ordner enthielt auch den kurzen Roman, den ich unter Martins Anleitung geschrieben hatte und den er unter vielen Vorbehalten gebilligt hatte, und eine Kurzgeschichte über irgendwelche Leute in einem Schloß in Schottland. Dazwischen lagen die bewußten beiden Kapitel mit jenem Satz, der darauf wartete, gefunden, erneut gelesen und in seiner unheimlichen Bedeutung erkannt zu werden.
Wer eine »gute Adresse« in P. haben wollte, wohnte entweder in der Altstadt oder in einem der beiden Vororte, die eigentlich eingemeindete Dörfer waren. Die Altstadt galt als einen Tick besser. Ihre Straßen waren schmal und malerisch, die Steinhäuser hatten nach hinten heraus tiefe, baumbestandene, fast bewaldete Gärten, die man von der direkt zur Straße hinausgehenden Haustür nicht sah. Eins dieser Häuser – es stand in St.Mary’s Gardens – gehörte Martin Zeindler.
Er konnte von oben einen Türöffner betätigen, um Besucher einzulassen, die sich unten meldeten. Wenn man die Haustür aufmachte und die Diele betrat, standen bisweilen auf dem Korridor im Erdgeschoß weitere Türen und Räume bis hinten zu einer Terrassentür offen, und dahinter sah man den Garten mit seinen vielen Abstufungen von Grün.
Es war wie ein von Bonnard oder Dufy gemalter Ausblick, aber geheimnisvoller, denn der Korridor und die Zimmer hinter den offenstehenden Türen waren stets düster und verschattet, der Blick ins Grüne hingegen so klar, einladend und verheißungsvoll, daß man immer [43] meinte, dort draußen die Sonne scheinen zu sehen. Als ich das Bild zum zweitenmal so sah, war es noch immer sonnig, obgleich wir inzwischen Dezember hatten, und als ich zur Treppe ging, war der Drang, den Korridor entlang bis in den Garten zu gehen und mich dort umzusehen, fast unwiderstehlich.
Natürlich gab ich ihm nicht nach. Die erste offene Tür war die zur Wohnung des Mieters im Erdgeschoß. Martin mußte vermieten, sonst hätte er es sich nicht leisten können, in diesem Haus zu wohnen. Ob dort unten ein Mann oder eine Frau oder vielleicht mehrere Personen wohnten, ob alt oder jung – all das wußte ich nicht.
Oben kam uns Martin entgegen. Er hatte eine Pelzmütze aufgesetzt und sich in ein kariertes Reiseplaid gewickelt und sagte gereizt und nörgelig: »Daß Dr.Steadman ständig sämtliche Türen offenlassen muß! Das ganze Haus kühlt aus. Diese Frischluftmanie ist mir unbegreiflich. Vollkommen altmodisch!«
Während wir ins Wohnzimmer gingen, stellte sich heraus, daß er mit dieser auf den ersten Blick verblüffenden Feststellung besonders auch Emilys Novelle aufs Korn nehmen wollte. Die Viktorianer hätten eine wahre Leidenschaft für frische Luft gehabt, erklärte er, nachts allerdings habe man sie zu jener Zeit nicht für heilsam, sondern für eher schädlich gehalten. Sie kenne sich doch wohl in diesen Dingen aus und habe sich hoffentlich nicht für eine historisch gefärbte Erzählung entschieden – wovon er ganz allgemein ohnehin abraten würde –, ohne sich vorher intensiv mit der Redeweise, den Sitten und Gebräuchen der von ihr gewählten Epoche zu beschäftigen. Allerdings müsse er [44] aufgrund der bisher abgelieferten Arbeitsproben leider sagen, daß dem offenbar nicht so sei.
Während Emily sich noch verteidigte, stand er wieder auf, öffnete die Tür und prallte zurück wie vor einem eisigen Windhauch. Es war kein kalter Tag, und dort oben kam es mir sehr warm vor. Aber Martin murrte, die Zugluft käme von allen Seiten, griff zum Telefon und bat dringend darum, man möge die Terrassentür und die Tür der Erdgeschoßwohnung schließen.
»Ja, Ivo, ich weiß, daß Wärme hochsteigt, soviel weiß sogar ich, obwohl ich kein Naturwissenschaftler bin. Aber wenn keine Wärme da ist, kann auch keine hochsteigen, das dürfte wohl logisch sein. Jetzt sei so nett und mach deine Wohnungstür zu, ja? Mehr verlange ich gar nicht!«
Bei dieser Gelegenheit hörte ich Ivos Namen zum ersten Mal. Er sagte mir nichts. Ich konnte mir nur so viel zusammenreimen, daß Ivo und Dr.Steadman offenbar ein und dieselbe Person waren. Martin legte kopfschüttelnd den Hörer auf. Er war, als er sich in der Frage der aufsteigenden Wärme ereifert hatte, rot angelaufen, inzwischen zeigte sein Gesicht aber wieder die gewohnte fahle Blässe. Mütze und Plaid verliehen ihm etwas vage Russisches – er sah aus wie ein zu Unrecht verurteilter Muschik auf dem Marsch nach Sibirien –, aber als er jetzt die Mütze abnahm und sich das Plaid über die Knie legte, erinnerte er mich wieder – wohl auch durch das dunkle Haar, den Schnurrbart und den geometrisch gestutzten Kinnbart – an Fotos von Peter Sutcliffe, den Yorkshire Ripper. Sogar einen leichten Harrogate-Akzent hatte er, der besonders durchschlug, wenn er sich geärgert hatte.
[45] »Dr.Steadman ist Paläontologe«, erklärte er. »Diese Leute stöbern ständig zwischen Felsen herum, meist in sehr kalten Gegenden. Sie sind arktische Temperaturengewohnt, ja bevorzugen sie sogar. Aber deshalb muß man sie noch lange nicht hier erzeugen.«
Emily und ich interessierten uns nicht sonderlich für die Eigenheiten von Paläontologen. Ich hatte nur eine sehr unbestimmte Vorstellung davon, was Paläontologie ist, irgendwas mit altem Zeugs, die Wissenschaft von altem Zeugs. An altem Zeugs interessierte mich eigentlich nur die Einrichtung von Martins Zimmer, von dem ich aufdie ganze Wohnung schloß. In so einer Wohnung war ich noch nie gewesen.
Nicht etwa, daß die Räume besonders schick oder frisch renoviert oder die Möbel wertvolle Antiquitäten gewesen wären – auch wenn das bei dem einen oder anderen Stück durchaus denkbar war. Alles war fast so alt und schäbig wie zu Hause. Doch die ganze Einrichtung strahlte eine wohltuende Harmonie aus – von den mürben Seidenvorhängen, die bis zum Boden reichten, bis zu dem großen runden Tisch, dessen Platte so satt glänzte, daß man meinte, meterweit in sie hineinsehen zu können. Alles, was aus Holz war, hatte diesen tiefen Glanz, und Ivo erzählte mir später, daß Martin seine Möbel eigenhändig polierte. Das Zimmer hatte keinen Teppichboden, auf dem spiegelnden Parkett lag vielmehr ein großer Läufer persischer oder indischer Herkunft. Dann gab es noch einen großen goldgerahmten Spiegel – ganz schlicht und klassisch, ohne Schnörkel – und Bilder von Venedig, Kanäle und Paläste, eine Kirche auf einer Insel, San Giorgio Maggiore wahrscheinlich. Mein [46] Lieblingsbild aber war eine Schwarzweißdarstellung des Parthenon, das hinter einem dünnen, glitzernden Nebelvorhang im Mondlicht schimmerte.
Als wir zur Uni zurückfuhren, sagte ich zu Emily, wie sehr mir das Zimmer gefallen hatte und daß ein venezianischer Palazzo von innen wohl ähnlich aussehen müßte. Wenn ich mal eine eigene Wohnung hätte, müßte sie so sein wie die von Martin Zeindler. Emily ging sofort hoch.
»So hab ich noch nie einen Mann reden hören. Keinen normalen Mann jedenfalls, der nicht schwul ist. Kein Mann labert über Möbel, Teppiche und so Sachen rum.«
Das sei doch lächerlich, sagte ich. Bilder und Möbel würden meist von Männern gesammelt, die nicht unbedingt, ja nicht mal in der Mehrzahl schwul seien. Ob es ihr denn lieber wäre, wenn ich mich für Fußball und Bier interessierte.
»Sei nicht albern. Du interessierst dich ja gar nicht für Möbel, du verstehst überhaupt nichts davon, wenn du Fachmann wärst, wenn es dein Beruf wäre, wär’s noch was anderes, aber du redest darüber wie Schwule, auch über Klamotten, Frisuren und so Sachen. Die Mütze von Martin und das Plaid mit echtem Schottenmuster, das gehört alles zur Schwulenszene, das weißt du doch.«
Ich sagte nichts, weil ich plötzlich nicht die geringste Lust hatte, mich zu verteidigen. Ich saß neben ihr und überlegte, ob ein »richtiger Mann«, so wie sie ihn sich vorstellte, wohl darauf bestanden hätte, selber zu fahren, obwohl es ihr Wagen war. Und dann mußte ich wieder an vorhin denken, als wir Martins Haus verlassen hatten. Die Tür zur Erdgeschoßwohnung stand noch offen, und auf dem Weg durch die Diele warf ich einen Blick zurück.
[47] Auch die Terrassentür stand offen, der grüne Garten dahinter war noch immer besonnt, aber der im Schatten liegende Raum dazwischen war nicht mehr leer. Ich sah einen aufrechten, dünnen, fast hageren Mann an einem Tisch im hintersten Raum stehen, vor der offenen Terrassentür. Er hatte sich ein wenig vorgebeugt und die Hände auf den Tisch gestützt, als ob er etwas las, eine Zeitung vielleicht, die auf der Tischplatte lag. Gegen das grüne, blasse Winterlicht wirkte die Gestalt sehr dunkel und gab nichts von sich preis außer auf geheimnisvoll-undefinierbare Weise die Tatsache, daß dieser Mann jung war.
Als er Emily mit ziemlich schriller Stimme auf mich einreden hörte, blickte er auf und in unsere Richtung. Sein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Er sah eine ganze Weile sehr intensiv zu uns hin, dann wandte er sich wieder der Zeitung zu oder eben dem, was vor ihm auf dem Tisch lag.
Das war alles, aber es machte tiefen Eindruck auf mich, obschon ich nicht hätte sagen können warum. Vielleicht weil ich wie selbstverständlich davon ausgegangen war, Dr.Steadman sei alt. So wie Martin über ihn gesprochen hatte – ein Paläontologe, der zwischen Felsen herumstöbert, ein Sonderling, ein Frischluftfanatiker –, lag der Gedanke nahe. Dieser Mann aber war jung gewesen. Nicht so jung wie ich, zehn Jahre älter vielleicht – aber immerhin.
Es war deshalb wohl kein Wunder, daß ich von ihm träumte. Oder von dem Mann, den ich mir für die dunkle Gestalt des Zeitungslesers vor dem blendend hellen Hintergrund geschaffen hatte. In meinem Traum ging ich nicht zu Martin hoch, sondern tat das, wozu es mich bei meinem letzten Besuch gedrängt hatte. Ich ging durch die [48] geöffneten Türen – eine lange Reihe, viel mehr als in Wirklichkeit – bis zur Terrassentür.
Draußen sah ich den Garten, und er war schöner, als ich ihn mir je vorgestellt hatte, ein italienischer Garten mit niedrigen Steinmäuerchen, steinernen Vasen, in denen Lilien standen, und bemoosten Wegen, über die Bäume mit dunkelglänzenden Blättern und andere mit Zypressenwedeln ihre Zweige breiteten. Direkt vor dem Fenster lag ein dunkler, stiller Teich, an dessen Rand in ständigem Strahl Wasser aus einem tönernen Krug sprudelte. Darüber stand ein blauer Sommerhimmel, und in dem grünen Rasen blühten viele kleine Sommerblumen.
Ich versuchte, die Terrassentür aufzumachen, aber sie war abgeschlossen, und der Schlüssel fehlte. Der Drang, in den Garten zu gelangen, war viel stärker, als er wohl in Wirklichkeit gewesen wäre. Aber in meinen Träumen war ich oft wie ein Kind in meiner Launenhaftigkeit und der Hartnäckigkeit meiner Wünsche. Ich rüttelte an den Klinken und schlug an die Scheiben. Natürlich nutzte das nichts. Du mußt den Schlüssel finden, sagte ich mir, der Schlüssel ist irgendwo in einem der Zimmer hinter dir. Ich machte kehrt.
Aus dem Schatten tauchte ein Mann auf und kam auf mich zu. Es war noch dunkler geworden, sein Gesicht war nicht zu sehen, ich erkannte nur die schmale, gerade, graziöse Figur, die immer näher kam. Als er dicht vor mir stand, legte er schweigend und völlig unvermutet die Arme um mich und küßte mich auf den Mund.
Ich wachte schwer atmend auf und wälzte mich unruhig hin und her. Zuerst dachte ich, ich hätte eine Erektion, ich [49] war erregt und unglücklich zugleich, aber das war nicht der Fall. Die ganze Geschichte hatte sich ausschließlich in meinem Kopf abgespielt, und natürlich wußte ich, wie sie dahingekommen war: Weil Emily hatte anklingen lassen, ich sei vielleicht schwul oder redete zumindest so, wie ein Schwuler redet.
Wenn wir keine Vorlesung hatten – und die hatten wir nicht oft –, stand sie normalerweise spät auf. An diesem Morgen aber klopfte sie schon sehr früh bei mir und kam herein. Sie habe nicht schlafen können, sagte sie, weil sie immer an das habe denken müssen, was sie zu mir gesagt habe. Sie sei gekommen, um sich zu entschuldigen. Sie habe mir nicht vorwerfen wollen, daß ich schwul sei, sie wisse ja besser als sonst jemand, daß ich in dieser Beziehung schuldlos sei. Und dann kam sie zu mir ins Bett.
»Was heißt hier ›vorwerfen‹? Was heißt hier ›schuldlos‹?« sagte ich. »Liberal und aufgeschlossen, wie du dich gibst, müßte für dich Homosexualität etwas Selbstverständliches sein, einfach eine andere Lebensform und kein Verbrechen. Wenn du dich entschuldigen willst, weil du mir vorgeworfen hast, ich sei schwul, klingt das, als hättest du mir eine Lüge oder eine Gewalttat unterstellt.«
»So hab ich das nicht gemeint«, sagte sie, aber ich merkte, daß sie mich gar nicht verstanden hatte. »Die Leute denken eben, daß du schwul bist, wenn du so daherredest, Tim.«
»Und wen würde das stören?«
»Mich würde es stören.« Sie brabbelte etwas in meinen Nacken hinein, und ich mußte nachfragen. »Ich hab dich inzwischen nämlich mächtig lieb.«
[50] Ich tat, als hätte ich das nicht gehört. Bisher hatte ich noch nie Schwule in Schutz genommen, aber plötzlich ertappte ich mich dabei, daß ich eine flammende Verteidigungsrede auf schwule Lebensart hielt. Und während sich Emily an mich schmiegte und ihre Hände auf meine Brust legte – sie schwitzte ein bißchen –, spürte ich, daß sie mir mit jeder Minute unangenehmer wurde, daß sie mir nicht mal mehr sympathisch war.
Ihre Wange lag an meiner Schulter, und hin und wieder rollte ein Speicheltropfen aus ihrem Mundwinkel auf meine Haut. Es war kein richtiges Sabbern, aber ich war froh, daß ich es nur spürte und nicht sah.
Als sie begriffen hatte, daß ich nicht mit ihr schlafen würde, döste sie eine Weile neben mir und stand dann auf. Nachmittags wollten wir uns einen Vortrag unseres neuen Gastschriftstellers, eines bekannten postmodernen Autors, anhören, vorher aber sollte ich unbedingt mit Emily in einer Weinbar am Fluß essen, die sie ausfindig gemacht hatte. Eigentlich hatte sie sich mit Sophie Dunbar und Karen Pryce in der Mensa verabredet, aber den beiden würde sie absagen. Es sei ein so schöner Tag für Dezember. Ich müsse in die Bibliothek, sagte ich, würde mittags durcharbeiten und mich mit einem Sandwich begnügen.
»Ich liebe dich, Tim«, sagte sie, als müsse sie mich in diesem Punkt beruhigen.
Auf ein »Ich liebe dich« gibt es, wenn man nicht ganz brutal sein will, nur zwei Antworten. Die eine lautet: »Ich dich auch.« Ich gab die andere. »Ich weiß«, sagte ich.
[51] Emily und ich gingen zusammen zu Martin Zeindler, weil er wünschte, daß die Studenten zu zweit zu seinen Tutorien kamen. Wir waren das einzige Paar, das eine sexuelle oder in Emilys Augen romantische Beziehung hatte, und an diesem Tag, zwei Wochen vor Ende des Semesters, sagte ich mir, daß damit Schluß sein müsse. Wenn wir im Januar nach P. zurückkamen, würden Emily und ich notgedrungen weiter im gleichen Haus wohnen, aber nicht mehr miteinander schlafen, und ich würde mir eine andere Partnerin für Martins Tutorium suchen, die ruhige, fleißige Ann Friel vielleicht, so daß ihre Partnerin Kate Rogers sich dann mit Emily zusammentun konnte.
Damals wußte ich noch nicht, daß ich schon zum letztenmal zusammen mit Emily bei Martin gewesen war. Zwei Tage vor Ende des Semesters wäre unser nächster Termin gewesen, aber Emily bekam die Grippe und mußte im Bett bleiben. Eine unserer Hausgenossinnen, Roberta Clifford, erbot sich, sie zu pflegen, sie hatte die Grippe schon hinter sich, Emily höchstwahrscheinlich damit angesteckt und keine Angst mehr vor den Viren. Emily bestand darauf, daß ich ihr nicht zu nahe kam.
Ich fuhr also mit Emilys Wagen allein zu Martin und hoffte, ich würde Dr.Steadman nicht zu Gesicht bekommen. Es war mir schon ein paarmal passiert, daß ich in einem sexuellen Kontext von jemandem geträumt und dann Hemmungen gehabt hatte, der Traumgestalt leibhaftig zu begegnen.
Das Wetter hatte sich stark abgekühlt, nachmittags um vier hatte es schon Frostgrade. Daß der Bewohner der Erdgeschoßwohnung heute seine Türen offenlassen würde, [52] schien unwahrscheinlich. Tatsächlich war seine Wohnungstür geschlossen, und zwar, wie mir schien, sehr nachdrücklich, als habe der Bewohner sie so fest wie möglich verrammelt.