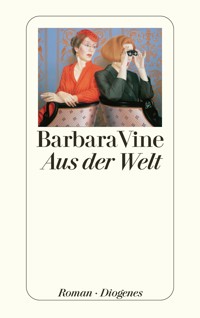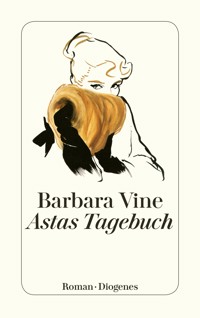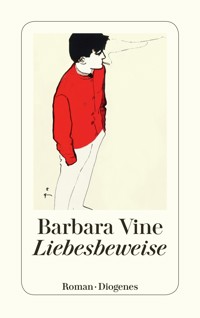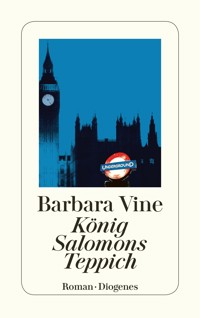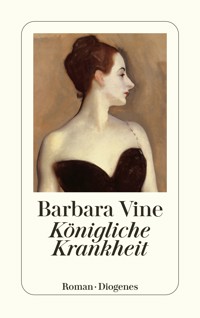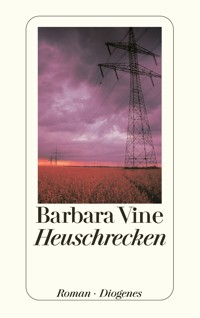
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Clodagh Brown klettert für ihr Leben gern: zunächst auf Bäume, dann, als Teenager mit ihrem ersten Freund Daniel, auf Hochspannungsmaste. In späteren Jahren ist sie auf Londons Dächern unterwegs und erhascht, gemeinsam mit Gleichaltrigen, einen Blick in fremde Leben. Doch die Freiheit in den Lüften hat einen entsetzlichen Preis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara Vine
Heuschrecken
Roman
Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann
Titel der 2000 bei
Viking, London, erschienenen
Originalausgabe: ›Grasshopper‹
Copyright © 2000 by
Kingsmarkham Enterprises Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2001
im Diogenes Verlag
Umschlagfoto:
Copyright © Steven Weinberg/STONE
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23346 9 (2. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60122 0
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Vorbemerkung der Autorin
[7] 1
Sie haben mich hierhergeschickt, weil das mit dem Mast passiert ist. Oder vielleicht, damit ich nicht jedesmal, wenn ich aus dem Haus gehe oder auch nur aus dem Fenster gucke, den Mast sehe.
»Wir haben überlegt, ob wir das Haus verkaufen und wegziehen sollen«, hatte mein Vater gesagt. »Glaub nur ja nicht, daß wir uns darüber keine Gedanken gemacht hätten. Aber du bist ja schließlich…«
Weiter kam er nicht, aber ich wußte, wie der Satz weitergegangen wäre. Du bist ja schließlich nicht ewig hier. In deinem Alter bleibt man nicht mehr lange zu Hause wohnen, du wirst zum Studium an die Uni gehen oder zu arbeiten anfangen und ein eigenes Zuhause haben. Aus den Augen, aus dem Sinn – auch das hatte er damit gemeint. Mit der Zeit werden die Leute aufhören, in uns die Eltern von diesem Mädchen zu sehen, sie werden aufhören, sich zu fragen, was für Eltern so eine wohl hat, sie werden aufhören, uns anzustarren und mit dem Finger auf uns zu zeigen. Vor allem, wenn du dich nicht allzuoft zu Hause sehen läßt. Vielleicht denken sie dann, daß du tot bist. Vielleicht erzählen wir ihnen das sogar.
Die letzten beiden Sätze sind reine Phantasie. Ich behaupte nicht, daß sie wünschten, ich wäre tot. Mein Wohlergehen liegt ihnen am Herzen, wie meine Mutter zu sagen [8] pflegt. Und deshalb war sie wohl so froh und glücklich – seit der Geschichte mit dem Hochspannungsmast habe ich sie nicht mehr so froh und glücklich gesehen –, als Max mit seinem Angebot herausrückte. Bestenfalls hatten sie gehofft, ich würde ein Zimmer im Studentenwohnheim ergattern oder als viertes Mädchen in einer Wohngemeinschaft unterkommen.
»Eine Wohnung für dich allein!« sagte meine Mutter. »Und in einer so angenehmen Gegend.«
Damals sah ich im Geist reihenweise Pseudofachwerkhäuser vor mir, schwarzweiß gestreift wie Zebras, mit Pampasgras im Vorgarten und einem Audi vor der Garage, wie wir sie in Mengen gesehen hatten, Daniel und ich, als wir auf seiner alten Motoguzzi über die lange, breite North Circular Road gegondelt waren. Unser London, das waren die äußeren Vororte, Waltham Cross und Barnet, Colindale und Edgware, Uxbridge und Richmond und Purley. Wir zählten die Hochspannungsmaste und fotografierten die stacheldrahtbewehrten Klettersperren an ihren Beinen. Bis Maida Vale sind wir nie vorgedrungen, und von Little Venice hatten wir noch nicht mal gehört, aber ich stellte mir »eine angenehme Gegend« wie bei mir daheim vor, mit Häusern wie unser Haus. Wie Max darin eine abgetrennte Wohnung unterbringen konnte, war mir ein Rätsel. Wohnungen waren in großen Blocks, auch davon gab es viele an der nördlichen Ringstraße, ausgedehnte Flachdachbauten in Puddingfarben, auf denen die Namen in schwarzen oder silbernen Buchstaben standen: Ferndean Court und Summerhill und Brook House. Auf das, was ich heute nachmittag bei meiner Ankunft hier vorfand, war ich völlig unvorbereitet.
[9] Eigentlich hatte mein Vater mich hinbringen sollen. Üblicherweise machen die Eltern das so, wenn ein Kind auszieht, um zu studieren, ich habe es oft genug miterlebt. Sie packen den Kofferraum und auch die Rückbank voll – mit Klamotten und Sportsachen und Büchern, Radio und CD-Spieler und vielleicht einem Computer, und natürlich mit einem Freßkorb. Es ist ein freudiges Ereignis, ein Wendepunkt: Der Vater fährt das Kind, und die Mutter bleibt zurück, sie lächelt unter Tränen und ruft »Alles Gute«, läßt sich von dem scheidenden Kind versprechen, daß es anrufen wird, sobald es sich eingerichtet hat, und mahnt, es solle das kalte Huhn und den selbstgebackenen Kuchen im Freßkorb nicht vergessen.
Als ich mein Elternhaus verließ, lief das nicht so, ich hatte es auch nicht erwartet und wußte von jeher, daß man auf die Versprechen meines Vaters nicht viel geben konnte. Tags zuvor brachte er den Wagen in die Werkstatt, und dann kam der Anruf, man würde ihn gern noch einen Tag behalten, um die Elektronik zu prüfen. Vielleicht hatte Dad es nicht darauf angelegt, aber es traf sich gut für ihn. Nun hieß es, das sei eben nicht zu ändern, ich müsse mit der Bahn fahren.
So war mein Abschied nicht viel anders als die vergangenen zwei Jahre: bedrückend. Nach der Sache mit dem Mast waren meine Eltern in Therapie gewesen, genau wie ich, und die Therapeutin hatte ihnen gesagt, sie müßten Verständnis haben und mir Halt geben, sie müßten mir helfen, das Vergangene abzuschütteln und noch einmal neu anzufangen, damit ich mir keine Selbstvorwürfe machte und mich nicht ständig mit einem schlechten Gewissen herumplagte. Aber das kriegten sie nicht hin. Beim besten Willen nicht. Sie [10] sahen mich wohl wirklich als grundschlecht an und halfen sich unter anderem damit, daß sie mir sagten, sie wüßten nicht, »woher ich das hätte« – als sei jede Tat, die man begeht, jeder Fehler, den man macht, schon in einer langen Ahnenreihe angelegt und werde in einem Rücksichtslosigkeitsgen, einem Leichtsinns- oder eben einem Schlechtigkeitsgen weitergegeben. Heute vormittag und beim Essen musterten sie mich mit diesen Blicken, die eine Mischung aus Staunen und – ja, wohl auch Resignation sind. Und noch etwas erkannte ich darin: Erleichterung, vielleicht sogar Hoffnung, die Möglichkeit eines Neuanfangs auch für sie.
Ich packte das Notwendigste in zwei Handkoffer und alles andere in einen Schrankkoffer, mit dem schon mein Vater zum Studieren weggezogen war. Meine Mutter sagte, sie würde ihn mir in die Russia Road 19, London W9, nachschicken. Wenn alles gutging, würde ich für die Fahrt keine zwei Stunden brauchen. Sie bestellte telefonisch ein Taxi, das mich zum Bahnhof bringen sollte, vielleicht weil sie es mir nicht zutraute. Sie stand unentschlossen herum, und ich merkte, daß sie sich überlegte, ob sie mir einen Kuß geben sollte. Zwei Jahre lang hatten mich beide nicht geküßt oder auch nur angefaßt. Es war, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. Mein Vater kam aus der Garage, wo er sich ein kleines Refugium mit Fernseher und einem Sessel eingerichtet hat. Es sei wohl allmählich Zeit für mich, sagte er.
Meine Mutter sah auf die Uhr. »Das Taxi ist noch nicht da.«
»Ich habe wirklich versucht, ihn zu retten«, sagte ich. »Ich habe ihn festgehalten, bis ich nicht mehr konnte. Ich hatte einfach nicht genug Kraft.«
[11] »Darüber wird nicht mehr geredet, Clodagh«, sagte meine Mutter. »Das Kapitel ist abgeschlossen.«
Mein Vater sagte: »Unser Leben geht weiter.«
Das Taxi kam. Der Fahrer klingelte und ging dann zurück zu seinem Wagen. Mum hauchte zwei Zentimeter vor meinem Gesicht einen Kuß in die Luft. Dad lachte nachsichtig, wie nett, sollte das heißen, seht mal, was für eine glückliche Familie wir sind, dann griff er sich meine Koffer und trug sie zum Taxi.
Vor dem Einsteigen warf ich einen letzten Blick auf den Hochspannungsmast, der dort mitten im Feld aufgepflanzt war, ein Skelett mit stählernen Knochen. Mein Vater hatte mich beobachtet. Kopfschüttelnd ging er zurück ins Haus. Zehn Minuten vor Einfahrt des Zuges waren wir in Ipswich.
Die U-Bahn-Station heißt Warwick Avenue. Ich war schon ein paarmal mit der U-Bahn gefahren, aber nicht oft und seit meiner Kinderzeit, seit der Autowaschanlage gar nicht mehr. Das Schlimmste, was mir je passiert ist, war die Sache mit dem Hochspannungsmast und das Nächstschlimmste die Waschanlage, aber das schreibe ich ein andermal auf, nicht jetzt. Jetzt – das war die U-Bahn. Ich fühlte mich hundeelend da unten, ich ballte die Fäuste und biß die Zähne zusammen, immerhin war ich von vielen Menschen umgeben, und das half ein bißchen. Am liebsten hätte ich mir von Liverpool Street Station ein Taxi genommen, konnte es mir aber nicht leisten, und außerdem war es ja jetzt zu spät, ich konnte nicht mehr raus aus den Tunnels, wo die Dächer sich auf mich herabsenkten und die Wände immer näher heranrückten. Die ganze Fahrt über, von Oxford Circus bis [12] Paddington, konzentrierte ich mich auf meinen Stadtplan London von A bis Z, und als ich wußte, daß ich mich zurechtfinden würde, ohne noch mal hinzusehen, waren es nur noch eineinhalb Kilometer, bis ich wieder Luft und Licht um mich spürte.
Das erste, was ich sah, als ich die Treppe hochkam, war eine ziemlich häßliche Kirche, die etwa so alt sein mochte wie ich, mit einem Turm, der gleich einer Messerklinge in den blaßgrauen Himmel ragte. Ich lehnte mich an die Kirchenmauer, atmete tief und beschloß, nie wieder in diese U-Bahn zu steigen. Die Kirche war das einzige moderne Gebäude weit und breit. Die Häuserzeilen, die in rechtwinklig zueinander verlaufenden und bogenförmigen Straßen, in Alleen und kürzeren Sträßchen standen, waren alle alt. Viktorianisch, vermute ich, hoch und hell und recht anmutig mit einem Portikus über der Tür und baumdicken weißen Säulen und Stufen davor. Es gab auch viele richtige Bäume, großgewachsen und alt, mit Stämmen, die gelb, grün und braun gefleckt waren wie Daniels Tarnfarbenhosen. Selina, die Frau von Max, hatte am Telefon etwas von einem Kanal gesagt, daß die Gegend wegen eines Kanals Little Venice hieß, aber ich konnte ihn nicht entdecken, jedenfalls nicht in der Richtung, in die ich ging, von der Warwick Avenue Richtung Norden.
Ich war heilfroh, daß ich die meisten Sachen in Dads Schrankkoffer gepackt und meine Handkoffer nicht ganz vollgestopft hatte, sie waren so schon schwer genug. Es gab nicht viel Verkehr, zumindest keinen rollenden Verkehr, die Autos standen alle Stoßstange an Stoßstange am Gehsteig. Ein paar Leute, ausschließlich junge Leute, kamen an mir vorbei, die alle zu ethnischen Minderheiten gehörten, wie es [13] immer in der Zeitung heißt. Es muß sehr ärgerlich sein, wenn man als Schwarzer oder Chinese oder einer dieser schönen Menschen aus Ostafrika eine ethnische Minderheit genannt wird.
Ich fand die Russia Road auf Anhieb, sie lag genau da, wo sie in meinem Stadtplan eingezeichnet ist, in rechtem Winkel von der Castlemaine Road abgehend. Sie mündet mit leichtem Gefälle in einen Kreisverkehr, der in der Mitte mit Blumen und Büschen bepflanzt ist und um den herum Häuser stehen, die wie italienische Paläste aussehen. Die Russia Road hatte mit dem, was ich mir damals unter einem Vorort vorstellte, ungefähr so viel gemein wie mit einem Feldweg. Ich weiß nicht, wie ich auf den Ausdruck kam, weil ich noch nie darüber nachgedacht hatte und nicht mal weiß, was er genau bedeutet, aber ich sagte mir: gotisches London. Die Häuser auf der linken Seite waren sehr hoch, fast wie in langer ununterbrochener Reihe aneinandergebaute Türme aus roten Ziegeln. Daß man damals schon so hohe Häuser bauen konnte, hatte ich nicht gewußt, ich dachte, das hätte erst mit den modernen Wolkenkratzern angefangen. Durch ihre Höhe sperren die Häuser die Sonne aus, wenn sie nicht ganz hoch am Himmel steht. Die Tarnanzugbäume wirken davor richtig klein.
Auf der anderen Seite, der mit den ungeraden Hausnummern, sind die Häuser fast genauso hoch, vielleicht drei Meter niedriger. Sie bilden drei unterschiedliche Blocks. Gemeinsam ist ihnen nur, daß sie alle vier Geschosse haben und eine steinerne Vortreppe. Der erste Block, an dem ich vorbeikam, war hellbeige gestrichen, die Häuser hatten einen großen Erker im Erdgeschoß, Rundbogenfenster und einen [14] gerundeten Portikus, den unten auf scharfkralligen Pfoten ruhende Löwenköpfe stützten. Der nächste Block war aus roten Ziegeln wie auf der gegenüberliegenden Seite, die Fenster waren in elfenbeinfarbenem Stein abgesetzt, und auf halber Höhe der Häuser und noch einmal unter dem Dach verliefen elfenbeinfarbene Friese mit Türmchen oder Zinnen wie bei einer Burg. Das Haus von Max ist das erste im letzten Block (oder das letzte, wenn man von der anderen Seite kommt), Nummer 19, die Fassade hat eine Art Mosaikmuster aus silbergrauen und roten Ziegeln. An seinem Haus ist alles in Schwarz und Beige gestrichen und sieht ganz neu und glänzend aus, aber von den anderen Häusern könnten ein paar einen neuen Anstrich und manche eine komplette Säuberung vertragen.
Ich ging nicht geradewegs zu Nummer 19, sondern lief die Straße hinunter und guckte mir die Gesichter an. Über jeder Haustür, über den Balkonen, die sich in dieser Höhe an den Fassaden entlangziehen und aussehen wie schwarze Spitze, ist ein Fenster aus drei Spitzbogen, von denen der in der Mitte am höchsten ist. Um dessen Spitze herum sind Blumen und Blättergirlanden aus Stuck, und mittendrin, in einem Blätterkranz, ist immer ein anderes Gesicht. Ein anderes Gesicht an jedem Haus, meine ich, ein alter Mann mit Kinnbart und lang herabhängendem Schnurrbart, eine junge Dame mit hochgestecktem Haar und einer Mantilla darüber, ein junger Mann, der einem Bild von Lord Byron ähnelt, das ich mal gesehen habe, und einer mit Turban. Manche sind gesäubert und gestrichen und sehen frisch und neu aus, andere sind noch voller Ruß, der wie ein dunkler Schleier die Gesichter bedeckt.
[15] Ich schleppte meine Koffer wieder zurück und sah hoch. Hoch und immer höher. Das Haus von Max ist so sauber, als ob es regelmäßig gewaschen wird. In der Schule hat mir mal eine Lehrerin erzählt, daß die Holländer ihre Hausfassaden waschen, aber hier habe ich das noch nie gehört. An seinem Haus ist das Gesicht einer Frau mit einer Art Haube auf den langen wallenden Locken. Die Blätter um sie herum sehen aus wie Weinlaub und die Blumen wie Lilien. Darüber sind noch drei Fensterreihen, die erste hat Bogenfenster, die anderen beiden haben ganz gewöhnliche Rechteckfenster. Erst jetzt sah ich, daß in dem Teil vom Dach, der wie eine Blende aus grauem Schiefer vorkragt, noch mehr Fenster waren. Das Haus hatte also nicht vier, sondern fünf Stockwerke.
Warum habe ich nicht auf das Souterrain geachtet? Vielleicht, weil ich gewohnheitsmäßig immer nach oben sehe. Ich ging den kleinen Weg hoch, setzte die Koffer ab und klingelte. Selina kam zur Tür. Ich wußte, wer sie war, ich hatte sie – wie wohl alle hierzulande – auf dem Bildschirm gesehen, vielleicht hielt sie es deshalb nicht für nötig, sich vorzustellen. Außerdem benutzt sie sowieso nie ihren Namen oder den Namen ihrer Mitmenschen, sie nennt alle Leute »Schätzchen«.
»Warum hast du dir kein Taxi genommen, Schätzchen?« fragte sie. »Zum Kofferschleppen ist es viel zu weit.«
Trotz des »Schätzchens« klang das so, als hätte ich was falsch gemacht. Zumindest bildete ich mir das ein. Ich bin, sagt meine Therapeutin, paranoid, ich sehe und höre Kränkungen, Brüskierungen, Verweise. Vielleicht, weil ich soviel davon habe einstecken müssen. Vielleicht war Selina einfach besorgt um mich. Sie drehte sich kurz um, als hoffte sie, daß [16] jemand kommen und die Koffer tragen würde. Aber es kam niemand. Sie griff sich den einen Koffer, verzog das Gesicht, als sie merkte, wie schwer er war, und überließ den anderen mir.
Ich machte mich auf Treppensteigen gefaßt. Ich überlegte sogar, ob sie einen Aufzug hatten. Sie führte mich durch einen langen Gang. Am Ende war eine Tür, und hinter der Tür führten Stufen nach unten. Ich ging ihr nach. Sobald sie unten angekommen war, setzte sie den Koffer ab. Ich glaube, es waren elf Stufen, morgen zähle ich sie mal. Im Grunde spielt es keine Rolle. Wir waren unter der Erde, und obgleich es draußen hell war und noch drei Stunden hell bleiben würde, mußten wir Licht machen.
»Das ist alles dein Reich, Schätzchen«, sagte Selina. »Schau dich in Ruhe um. Wenn du dich frisch gemacht hast, komm in den oberen Stock, dann können wir essen. Max müßte bald wieder da sein.«
»In den oberen Stock?«
»Dem Stockwerk über der Haustür.«
Es ist wohl Klaustrophobie, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, denn ich habe keine Angst vor kleinen Räumen oder davor, in Schränken oder im Aufzug eingesperrt zu werden. Unerträglich sind mir Tunnel und alles, was unter der Erde ist. Die U-Bahn hatte ich ertragen, weil ich wußte, daß sie die einzige Möglichkeit war, zur Russia Road zu kommen, auch wenn die Fahrt mich fast umgebracht hatte. Als ich mich in dem, was mein künftiges Zuhause sein sollte, umsah, gelobte ich, daß ich zumindest nie wieder U-Bahn fahren würde, ich würde den Bus nehmen oder zu Fuß gehen, ich würde nie Unterführungen benutzen, selbst [17] wenn ich meilenweite Umwege machen mußte. Aber ich konnte nicht geloben, daß ich hier nicht wohnen würde. Ich wohne hier, schreibe dieses Tagebuch hier, versuche zu schrumpfen, bis ich ganz klein und hart und unverwundbar bin, damit die Wände nicht noch näher an mich heranrücken und mich zermalmen können. Die Wohnung ist ja gar nicht so klein, aber sie ist eben halb unter der Erde…
[18] 2
Als ich das schrieb, war ich neunzehn.
Tagebuch führte ich, seit ich schreiben konnte, vielleicht, weil ich als Einzelkind niemanden hatte, mit dem ich reden konnte, vielleicht auch, weil ich – so etwas gibt es – eine geborene Tagebuchschreiberin bin. Ob man schriftstellerisch begabt ist, spielt dabei keine Rolle. Es ist mehr ein Bedürfnis, das aufzuzeichnen, was man für aufzeichnenswert hält. Von Anfang an habe ich meine Erlebnisse festgehalten, wenn sie wirklich wichtig waren oder ich sie für wichtig hielt. Der Alltag kam in meinem Tagebuch nicht vor, bis ich Silver kennenlernte, und danach war nichts mehr alltäglich.
Meine Tagebücher nahm ich mit zu Max und dann zu Silver, zurück nach Suffolk, zu Beryl, ins Studium, in unsere Wohnung im East End und schließlich hierher, wo wir jetzt zu Hause sind. Die meisten Einträge sind naheliegenderweise in der Ichform verfaßt. Bis auf einen Text, in dem das Schlimmste erzählt wird, was mir bis dahin widerfahren war, er klingt wie eine Kurzgeschichte. Warum ich das so geschrieben habe, weiß ich nicht, es ist zu lange her. Ich hatte nie literarische Ambitionen. Die Arbeit, die ich jetzt mache – und gerne mache –, ist von der Schriftstellerei meilenweit entfernt. Es könnte sein, daß meine Therapeutin mir geraten hat, mir alles von der Seele zu schreiben, oder aber der [19] Psychiater, an den ich nach der Gerichtsverhandlung überwiesen wurde, und es könnte auch sein, daß sie – oder er – gesagt hat, ich solle es so schreiben, als sei es die Erfahrung einer dritten Person. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, mir war sogar entfallen, daß ich die Geschichte aufgehoben hatte, und erst nach dem Wiedersehen mit Liv habe ich diesen Text und die anderen Aufzeichnungen herausgesucht.
Am Nachmittag war der Anruf einer Mrs. Clarkson eingegangen. Darren, mein Mitarbeiter, (oder eine seiner Freundinnen) hatte den Auftrag entgegengenommen und per e-Mail zusammen mit den anderen Telefonnotizen an mich weitergeleitet. Da er schrieb, er sei mit einer heiklen Installation beschäftigt und noch eine Weile dort angebunden, sah ich im Geiste einen blendend aussehenden geschmeidigen Schwarzen vor mir, der sich – wie Leviathan? – aus einem Gewirr schwarzer Elektrokabel zu befreien sucht. Um Mrs. Clarkson in Downshire Hill und ihre Probleme mit einem Dimmerschalter würde also ich mich kümmern müssen, und ich trug sie als ersten Termin ein.
Seit unserer Heirat vor einem halben Jahr lebe ich in der Penthouse-Wohnung eines Hochhauses in Highgate. Der Blick über London ist atemberaubend. Eine Terrassentür führt vom Wohnzimmer direkt auf den Dachgarten. Die Tiefgarage ist ein kleiner Wermutstropfen, allerdings könnte es schlimmer sein, denn man kann überall zwischen den Betonpfeilern hindurch ins Freie sehen. Außerdem kann ich mittlerweile mit geschlossenen Räumen sehr viel besser umgehen. Ich war sogar ganz allein mit dem Auto in der Waschanlage und habe, umgeben von Seifenschaum, der [20] mir die Sicht nahm, und dem Schlürfen und Schmatzen der großen Bürstenwalzen, in der roten Dunkelheit gesessen wie im Bauch eines Wales.
Am anderen Ende der Spaniards Road beginnt gleich Hampstead, und in weniger als zehn Minuten war ich vor dem Haus in Downshire Hill. Es war offenbar innen umgebaut worden, überall im Vorgarten – zum Glück war er zum größten Teil gepflastert – lagen graue Plastiksäcke mit Schutt herum und haufenweise kaputtes Holz. Ich bemerkte ein verschwommenes Gesicht hinter einem Erdgeschoßfenster, demnach hielt Mrs. Clarkson schon besorgt nach mir Ausschau. Jetzt hatte sie offenbar meinen Wagen gesehen – einen weißen Van mit der Aufschrift C. Brown & Co. Ltd., Elektroingenieure, in roten Buchstaben über meinem Logo, der Rundung eines C, das den Doppelbogen eines B umschließt (Logos sollten immer so schlicht wie möglich sein) –, denn sie ließ den Vorhang fallen und machte mir die Tür auf. Ich erkannte sie auf den ersten Blick. Ob auch sie mich in diesem Moment schon erkannt hatte, weiß ich nicht genau, denn natürlich war wie bei fast allen meinen Kunden zunächst das Staunen groß, daß eine Frau vor ihr stand.
Es gibt immer noch nicht sehr viele weibliche Elektriker und noch weniger hochqualifizierte Frauen, die wie ich eine eigene Firma haben. Weil ich stolz auf meine Leistungen bin und weiß, daß ich meine Arbeit gut mache, gebe ich gern ein bißchen damit an, daß man mir die Elektroinstallation in einem Hotel wie den Four Seasons in Knightsbridge und jetzt für die am Paddington Basin geplanten Neubauten anvertraut hat. Meist aber finden die Leute es doch sehr befremdlich, wenn sie bei C. Brown & Co. anrufen und ein [21] weibliches Wesen bei ihnen auftaucht. Ein- oder zweimal hat man mich sogar wieder weggeschickt, vielen Dank, hieß es, sie hätten einen richtigen Elektriker bestellt. Auch Mrs. Clarkson beäugte mich sehr skeptisch und sagte (diese Reaktion hatte ich allerdings noch nie erlebt): »Kommt Ihr Mann nicht mit?«
Ich verbiß mir das Lachen, ich sagte ihr auch nicht, daß mein Mann in Afrika war und ohnehin nichts von Elektrizität verstand. »Sie werden schon mit mir vorliebnehmen müssen«, meinte ich. »Der Elektriker bin ich.«
»Tja, wenn Sie glauben, daß Sie so was können…«
»Ich weiß zwar noch nicht, was es ist«, sagte ich, »aber versuchen kann ich es ja mal.«
Es war ein erstaunliches Haus, weiträumig, minimalistisch, kahl. Das Wohnzimmer mit dem Marmorboden, auf dem isolierte Möbelstücke wie farbige Maden oder Mollusken herumstanden, wurde diagonal vom Geländer einer Galerie durchschnitten, und genau bis zu dieser Linie ging auch die Decke. Darüber war viel hoher leerer Raum, der, soweit ich das erkennen konnte, in einen gläsernen Turm mündete. Oben im Turm mochte es warm sein, hier unten war es sehr frostig. Vergeblich suchte ich nach Kerzen, ohne die Liv früher nicht hatte auskommen können, statt dessen standen hier jede Menge Lampen herum, Stehlampen in Form von Glastrichtern auf stählernen Stengeln, die aus dem Boden herauszuwachsen schienen, Wandlampen, die wie Champagnerflöten, und Wandlampen, die wie römische Vasen aussahen, und zwei große moderne Kronleuchter, wie man sie jetzt viel in internationalen Hotels sieht (in denen ich nicht absteige, aber die ich verkabele) und die Gletschern oder [22] gefrorenen Wasserfällen nachempfunden sind. Mr. Clarkson war offenbar nicht unbetucht.
In diesem Moment schwankte ich noch, ob ich seine Frau aufklären sollte oder nicht. »Aufklären« ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn inzwischen war ich überzeugt davon, daß sie mich ebenso erkannt hatte wie ich sie. War es am Ende besser, zu reparieren, was zu reparieren war, und dann geradewegs zum Paddington Basin zu fahren, wo ich mittags einen Termin mit dem Bauleiter hatte? Sie hatte mich seit diesem ersten entgeisterten Blick nicht mehr angesehen.
»Ich weiß nicht, ob Sie es machen können«, sagte sie, und jetzt erkannte ich auch den früher so vertrauten Akzent, den Singsang einer Schwedin, die Englisch spricht. Ihr Englisch war jetzt perfekt, aber sie war nervös. »Ich meine, vielleicht hätte ich die Elektriker holen sollen, die ursprünglich hier waren, aber die sind verschwunden, sie stehen nicht mehr im Telefonbuch. Die Schalter funktionieren nicht, das heißt, sie machen nicht das, was sie sollen. Angeblich kann man das Zimmer auf zweiunddreißig verschiedene Arten beleuchten, aber wenn ich auf die Knöpfe drücke, bekomme ich nur jede Menge helles Licht.«
Was zum Teufel brachten einem zweiunddreißig verschiedene Beleuchtungsvarianten? Aber das war schließlich nicht meine Sache. Die Reichen sind eine Rasse für sich. Sie haben mehr Geld und können deshalb so viel oder so wenig Licht verlangen, wie sie zu bezahlen bereit sind. Und dann schoß mir unwillkürlich der Gedanke durch den Kopf, daß ich, wenn ich so weitermachte, womöglich in gar nicht allzu ferner Zukunft auch zu den Reichen gehören würde.
[23] Ich holte meinen Werkzeugkoffer aus dem Wagen, und auf dem Rückweg besah ich mich in dem Spiegel mit dem Edelstahlrahmen und den stählernen Sternen in den Ecken, der eine ganze Wand in der Diele einnahm. Wer kann schon von sich sagen, ob er anders aussieht als vor zwölf Jahren? In so einer Zeitspanne ändert sich wahrscheinlich jeder. Ich sah eine große magere Frau in den gleichen Klamotten, wie Darren sie trägt, Jeans und T-Shirt und Lederjacke, mit sehr kurzem schwarzem Haar, fast schwarzen Augen und Brauen, die sie so häufig zusammenzieht, daß sie schon eine Falte zwischen den Augen hat. Das Beste an meinem Gesicht sind die Wangenknochen, mit denen man, wie Silver sagt, Käse schneiden könnte. Die Stirnfalte macht mich älter, was mich nicht weiter stört, ebenso die Augenfältchen, die von der Freude am Leben kommen.
Liv sah älter, aber auch besser aus. Wunderschön sah sie aus. Sie trug ein Make-up, wie es einem in der Kosmetikabteilung großer Kaufhäuser verpaßt wird, da brauchen sie eine halbe Stunde dazu; wenn man es selber macht, dauert es länger. Das helle Haar, das lang, zottig und verheddert gewesen war, ehe dieser Look in Mode kam, trug sie jetzt ganz glatt mit geraden Stirnfransen, es reichte bis knapp über die Ohren und war in der Farbe ungesalzener Butter gebleicht oder blondiert. Sie hatte, um mir nicht ins Gesicht sehen zu müssen, auf meine Hände geblickt, zu deren Gunsten man allenfalls sagen kann, daß sie sauber sind. Ihre waren milchweiß, die Nägel sehr lang, gerade gefeilt und in Ultramarinblau mit Silberschimmer lackiert, haargenau zu dem Saphir in dem Ring am Mittelfinger ihrer linken Hand passend. Was mich aber am meisten faszinierte, war das, was sie [24] um den Hals trug. Ich wußte, was es war, obgleich ich meinen Augen und meinem Gedächtnis kaum trauen mochte.
Als ich von draußen zurückkam, war sie verschwunden. In der Diele fand ich eine Tür, hinter der ich einen Schrank vermutete. Tatsächlich verbarg sie eine Wand voller Tastenfelder und Flachschalter sowie mehrere Sicherungskästen. Ich machte mich an die Arbeit. Die Verdrahtung durch die ursprünglichen Elektriker war katastrophal und vermutlich ziemlich gefährlich. Ich würde den Strom abschalten müssen, danach war es eine ziemlich einfache Sache, bei der ich nicht groß nachdenken mußte. Ich rief, daß sie in der nächsten halben Stunde keinen Strom haben würde, und als niemand antwortete, unterbrach ich den Stromkreis auf diesem Stockwerk, vielleicht auch auf dem nächsten, das ließ sich schlecht feststellen.
Ich hatte gerade angefangen, die diversen Anschlüsse zu sortieren, mir Gedanken über Liv und über ihren Aufstieg zu diesen schwindelnden Höhen zu machen und zu überlegen, wie sie den wohl im Lauf von zwölf Jahren geschafft hatte, als eine Frau die breite Treppe herunterkam, die an jeder Hand ein Kind hielt. Ich kann das Alter von Kindern schlecht schätzen, aber ich würde sagen, daß der Junge vier und das Mädchen drei war. Die junge Frau war offenbar eins dieser Au-pair-Mädchen mit Kinderhütefunktion, die man auf den ersten Blick erkennt. Sie schauen unweigerlich ratlos und besorgt drein, haben rote Nasen, aufgesprungene Lippen, lange Haare und alle das gleiche Outfit: Jeans, übergroße Pullis und Schnürstiefel, als wollten sie zum Bergwandern in die Cairngorms und nicht mit den Kindern in den Park nach South End Green. Ich übertreibe – [25] aber oft sehen sie wirklich so aus, und diese hier ganz bestimmt. Auf dem Weg zur Haustür kam sie an mir vorbei, und als ich »Guten Morgen« sagte, lächelte sie schüchtern. Genauso hatte Liv ausgesehen, als sie den gleichen Posten bei ähnlichen Kindern gehabt hatte. Aus so einem Haus – wenn auch sicher konventioneller in Bauweise und Einrichtung und in Maida Vale und nicht in Hampstead gelegen – war sie geflohen und in unser Refugium in luftiger Höhe gekommen.
Das Au-pair-Mädchen und die Kinder, fraglos die Kinder von Liv und »Mr. Clarkson«, gaben den Ausschlag. Vorhin war mir die Situation fast ein wenig peinlich gewesen, aber jetzt wollte ich, daß Liv zurückkam. Ich schaltete den Strom ein. Ich testete alle zweiunddreißig Beleuchtungsvarianten durch, stellte fest, daß ich sogar sechsunddreißig zustande gebracht hatte, und war ziemlich stolz auf mich. Weil ich nicht wußte, ob sie oben oder unten war, stellte ich mich an das Geländer der Galerie, von der eine großzügig geschwungene schmiedeeiserne Treppe in einen mindestens ebenso großen Raum im Untergeschoß führte, und rief, was ich immer rufe, wenn ich den Namen eines Kunden nicht kenne oder – wie in diesem Fall – nicht benutzen möchte:
»Sind Sie da?«
Keine Antwort.
Ich rief noch einmal. Aus einem Raum auftauchend, dessen Existenz ich nicht vermutet hatte, stand sie plötzlich hinter mir.
»Liv«, sagte ich.
Wieder regte sich jähe Angst in den schön geschminkten, schwarz umrandeten Augen. Ich mußte wohl behutsam [26] vorgehen. Das, was ich als einen erstaunlichen und lustigen Zufall sah, empfand sie als Bedrohung. Ich zwang mich, den Blick von dem Klumpen Elfenbein, von dem Zahn, zu lösen, den sie goldgefaßt an einer Kette um den Hals trug.
»Ich habe dich sofort erkannt, Liv«, sagte ich. »Hab keine Angst. Du kennst mich doch?«
Sie schüttelte den Kopf, dann nickte sie. »Chloe«, sagte sie.
Es war immerhin denkbar, daß sie vergessen hatte, wie ich wirklich hieß. »Clodagh«, sagte ich. »Clodagh Brown.«
»C. Brown & Co. Ltd.«, flüsterte sie. »Ich habe dich aus den Gelben Seiten. Wie hätte ich ahnen sollen…«
»Ich bin fertig. Möchtest du die Beleuchtung ausprobieren?«
Sie regte sich nicht, nur die Hände verkrampften sich ineinander, die blauen Nägel huschten wie verschreckte Käfer hin und her. Und dann sagte sie mit hoher Stimme etwas Unglaubliches: »Ich überlege die ganze Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Beim Studium wahrscheinlich. Oder bei Lavinia, als ich ihre Assistentin war. Ich kenne so viele Leute, da tut man sich schwer…«
Ich hatte Mitleid mit ihr. In der Russia Road, hatte ich sagen wollen, auf dem Haus von Silvers Eltern, auf den Dächern, weißt du nicht mehr? Erinnerst du dich denn nicht? Jonny und Wim… hast du die wirklich vergessen? Ich sagte es nicht, ich hatte nicht das Herz, sie noch weiter zu quälen, sondern zeigte ihr die verschiedenen Schaltmöglichkeiten für den Dimmer, auch wenn ich genau wußte, daß sie sich die Zuordnung der Schalter nie würde merken können, ich und die Bedrohung, die sie in mir sah, hatten alles [27] andere aus ihrem Kopf verdrängt. Ich hätte ihr gern gesagt, daß sie mich nie wiederzusehen, nie mehr Angst vor mir zu haben brauchte, aber ich wußte nicht, wie ich anfangen sollte. Ich fand keine Worte, um etwas zu sagen, worauf sie doch nur erwidern würde, sie wüßte nicht, was ich meinte.
»Tja, ich muß jetzt los«, sagte ich.
»Soll ich gleich zahlen, oder schickst du deine Rechnung?«
»Du bekommst eine Rechnung«, sagte ich.
Die Haustür klappte zu, noch ehe ich am Gartentor war, und der Gartenweg ist nur ein paar Meter lang. Ich hatte ihr große Angst eingejagt. Wenn ich zum erstenmal bei einem Kunden war, rufe ich ein paar Tage später an und erkundige mich, ob alles in Ordnung ist. Das System hat sich bewährt. In einigen wenigen Fällen ist nicht alles in Ordnung, und der Kunde schäumt vor Wut, weil ihm mein Name entfallen und die Rechnung noch nicht da ist. Wenn aber – wie meist – alles gut gelaufen ist, haben sie dadurch nicht nur meinen Namen wieder im Kopf, sondern freuen sich, daß ich so aufmerksam und gewissenhaft bin. Ich beschloß, bei Liv auf den Rückruf zu verzichten. Er würde mehr schaden als nützen. Sie würde sich sowieso nicht mehr bei mir melden. Damit sollte ich mich irren, aber das wußte ich damals noch nicht.
Für meinen nächsten Termin war ich etwas zu früh dran, machte mich aber trotzdem gleich auf den Weg. Ich habe ziemlich oft Aufträge in Maida Vale, manchmal auch in Little Venice, einmal hatte ich sogar einen in der Russia Road, aber am Paddington Basin war ich nie wieder gewesen, seit ich von der Fachhochschule und aus dem kombinierten Studiengang Betriebswirtschaft und Psychologie geflogen war. [28] Noch heute kann ich nicht an die jetzige University of Latimer denken, ohne eine Gänsehaut zu bekommen und gleich darauf über mich selbst zu lachen. Damals hatte ich mir, um mir unterirdische Wege zu ersparen, eine Strecke ausgeguckt, die den Westway – die Stadtautobahn – unterquerte und am Kanalufer entlangführte.
Mit dem Auto kommt man nicht bis zum Basin. Man muß den Wagen mehr schlecht als recht (und für ein Pfund Parkgebühr pro Stunde) in Howley Place oder Delamere Terrace abstellen und über eine kleine Grünfläche gehen, wo man die Stelle sehen kann, an der sich der Kanal gabelt, und die Insel, auf der Browning gesessen und seine Gedichte geschrieben haben soll. Browning ist hier allgegenwärtig, es gibt ein Pub, das Robert Browning heißt, und Selina trug sogar mal eine Schürze mit einem Bild von ihm und Elizabeth Barrett. Ein Weg, den niemand hier vermuten und dem niemand eine besondere Funktion zutrauen würde, führt durch Buschwerk nach unten zum Kanalufer und zur Brücke, über der die Harrow Road verläuft. Die Brücke ist ziemlich breit, und es ist auf ihr auch nicht so dunkel und abgeschlossen, daß Klaustrophobiker Angstzustände bekommen könnten. Am gegenüberliegenden Kanalufer liegen die Hausboote, Bug an Heck vertäut, die Namen, umrahmt von gemalten Blumenkränzen, stehen an den Seitenwänden, Susannah und Water Queen und Cicero und Garda, und die Bootsleute haben Topfpflanzen auf den Dächern und Blumen in den Gärten, die sie sich am Kanalufer angelegt haben. Um diese Jahreszeit sind die Gärten voll von blühenden Tulpen und Goldlack. Die Tage der Boote sind gezählt. Sobald hier gebaut wird – und das ganze Basin soll bebaut werden –, [29] müssen sie weg und mit ihnen die Gärten, die wilden Buddleias, die ihre langen lila Dolden aus jeder Ritze schieben, die Holunder mit ihren flachen weißen Blütenschirmen und die Brombeeren und Nesseln und hohen Mariendisteln. Und auch der Dreck und die schlimme Verkommenheit.
Auf dieser Seite hatten sie schon viel abgeräumt, ich konnte deshalb ziemlich lange am Ufer weitergehen, unter der Stadtautobahn hindurch und an der Stelle vorbei, wo die Unterführung herauskommt. Gegenüber, auf dem Treidelpfad zwischen den Booten und den Gärten, hatte ich vor zwölf Jahren zum erstenmal Wim gesehen. Er unterhielt sich mit einem Mann auf einem der Boote – ich habe nie erfahren, wer es war –, und beide blickten zum Himmel hoch und auf den Verkehr, der über die große geschwungene Spannbetonüberführung donnerte. Es war kalt an jenem Tag. Die Boote waren mit Persenning zugedeckt wie Pferde mit ihren Umhängen, die Blumen waren braun von den ersten Frösten, und ein eisiger Nebel hing über dem reglosen stumpfgrünen Wasser. Damals wußte ich nicht, daß seins Wim war, ich wußte nicht, wer er war oder wo er wohnte, ich wußte nur, daß seins so mit das eigentümlichste und schönste Gesicht war, das ich je – außer im Kino oder Fernsehen – gesehen hatte.
Unten am Basin hatte der Bauleiter bereits eine provisorische Unterkunft bezogen, die zu anspruchsvoll war, um sie Baubaracke zu schimpfen. Für ihn war es keine Überraschung, daß ich eine Frau war, wir hatten miteinander telefoniert. Gemeinsam sahen wir uns die Pläne der Architekten an, machten einen Rundgang über das schon geräumte Gelände und versuchten uns vorzustellen, wie es aussehen würde, wenn sich an den Ufern des breiten Sees, zu dem sich [30] das Basin an dieser Stelle weitete, hohe Häuser gegenüberstanden. Inzwischen war es nach zwei. Er war, wie alle Männer, hoch erfreut, als ich aus meiner Werkzeugtasche einen mit Bedacht zusammengestellten Imbiß für zwei Personen zutage förderte. Diesmal waren es Räucherlachssandwiches, Leberpastete, Käse und Cracker und Erdbeertörtchen, die ich unterwegs bei Raoul’s gekauft hatte. Männern würde so was nie einfallen, aber wenn ich ihnen damit komme, denken sie, selbst wenn sie sexistisch angehaucht sind, daß es vielleicht gar nicht so dumm war, einer Elektrikerin den Auftrag zu geben. Ich muß eben jede Möglichkeit nutzen, meine Karrierechancen zu verbessern oder meinen Ruf zu fördern.
Anschließend ging ich auf einen Schwatz und eine Tasse Tee zu Beryl. Meinen letzten Auftrag für diesen Tag hatte ich in einem Stadthaus in Tufnell Park, das lag auf meinem Heimweg, und ich ahnte schon, worum es ging. Man kann sich nur darüber wundern, wie viele Hausbesitzer nicht in der Lage sind, eine Sicherung zu reparieren. Und nicht nur das – sie wissen nicht mal, daß sie repariert werden muß und daß sonst nichts weiter kaputt ist. Ich verlange einen Mindestpreis von 40 Pfund für jeden Hausbesuch und staune immer wieder, daß jemand lieber soviel Geld für eine Reparatur ausgibt, die in fünf Minuten gemacht ist, als sich von einer Fachfrau ein für allemal die paar einfachen Handgriffe zeigen zu lassen. Ich habe es versucht, ich habe es meinen Kunden angeboten, aber sie haben entweder kategorisch abgelehnt oder gefragt, warum sie mich wohl hätten kommen lassen. Eine Frau hat sogar gesagt, sie dächte gar nicht daran, sich einen Hund zu halten und selber zu bellen.
[31] Früher war ich auch völlig unwissend in Sachen Elektrizität, sträflich unwissend, so muß man es wohl sagen, und das ist mich teuer zu stehen gekommen, mich und Daniel. Besonders Daniel. Auch wenn ich jetzt aus dem Glashaus raus bin und Steine werfen kann, werde ich doch nie vergessen, wie es war, hinter dem Glas zu sitzen, wie leichtfertig ich mit diesem Mysterium umgegangen bin und wie es sich gerächt hat.
Von Tufnell Park bis zu mir nach North Hill brauchte ich zehn Minuten. Wenn wenig Verkehr ist, sind es nicht mal fünf. Mein Wohnblock hat zehn Stockwerke, und anders als in Beryls Hochhaus in der Harrow Road hat der Fahrstuhl bisher noch nie gestreikt. Die Anlage nennt sich Cityscape Court, aber von meinem Dachgarten sieht man viel mehr als nur die City. Man sieht den Fluß als silbernes Band, Greenwich und das Observatorium und die grünen Hügel dahinter, ein Stück vom Millennium Dome, wenn man weiß, wo man ihn zu suchen hat, hundert Kirchtürme und Turmspitzen, die Royal Festival Hall und das National Theatre und auf dem diesseitigen Flußufer den Palace of Westminster mit den im Sonnenlicht blinkenden Zinnen und das Zifferblatt von Big Ben. Ich ging, wie immer um diese Zeit, wenn ich rechtzeitig heimkomme und es warm genug ist, mit meinem Drink auf den Dachgarten. Dort setze ich mich in einen meiner sehr bequemen Sessel an den Rattantisch mit der Glasplatte und genieße das großartige Panorama unter mir und um mich herum. »Die Erde Schöneres zu bieten nicht vermag«, so steht es in dem einzigen Gedicht, an das ich mich aus meiner Schulzeit erinnere. Nein, doch nicht das einzige, da gibt es noch eins, und auch das gehört zu der Geschichte, [32] die ich hier aufschreiben will. Daß ich regelmäßig Tagebuch geführt habe, nicht jeden Tag, nicht einmal jede Woche, sondern nur von Zeit zu Zeit, wird mir dabei eine Hilfe sein.
Im Winter sitze ich hinter dem Fenster oder besser gesagt hinter der voll verglasten Wand an der Gartenseite meiner Wohnung. Im Sommer oder an warmen Frühlingsabenden oder im Herbst, ehe es feucht und kühl wird, sitze ich draußen. Es gibt nur einen Menschen, den ich in diesem Moment gern bei mir hätte, und der ist dreitausend Meilen weit weg. Ansonsten habe ich nichts dagegen, um diese Zeit allein zu sein. Außerdem bin ich nicht allein, ich habe Mabel. Wenn ich heimkomme, läßt sie das Bett im Stich, auf dem sie gerade gelegen hat, kommt mich begrüßen und begleitet mich nach draußen.
Dann möchte ich nicht gestört werden, sondern nur dasitzen und schauen und Mabel auf meinem Schoß streicheln und meinen Tag Revue passieren lassen und meinen Drink genießen, Gin Tonic oder Wodka mit Soda. Meiner Meinung nach stehen wir, soweit wir keine Weintrinker sind, entweder auf weiße oder auf braune Spirituosen, und ich gehöre zur ersten Kategorie. Ich bin nicht ungesellig, ich bin gern mit meinen Freunden zusammen – lieber noch mit meinem Mann, aber das kann eben nicht sein, noch nicht –, ich freue mich sehr, wenn Darren auf dem Weg zu Junilla oder Campaspe kurz hereinschaut oder Bekannte vorbeikommen, aber bitte nicht vor acht. Um acht habe ich ausgetrunken und zu Ende gedacht und mich satt gesehen und bin bereit, etwas zu essen.
An jenem Abend dachte ich begreiflicherweise an die Zeit vor zwölf Jahren zurück. Ich hatte nicht nur meinen Gin [33] Tonic, sondern auch die Tagebuchauszüge mit auf den Dachgarten genommen und die sonderbare Story, die ich vielleicht auf Geheiß meiner Therapeutin verfaßt hatte. Komisch, fast hätte ich geschrieben: »…die sie verfaßt hatte…«, dabei weiß ich natürlich genau, daß all diese Dinge mir zugestoßen sind und nicht einer anderen Person. Die Leute – vielleicht auch Liv – mögen sagen, was sie wollen, aber wir waren nun mal früher nicht jemand anders, wir haben nicht in einem anderen Leben oder einer anderen Welt gelebt, das ist nur ein Vorwand, ein Versuch, Sachen schönzureden, die wir angestellt haben, weil wir uns seit damals natürlich bis zur Unkenntlichkeit verändert haben und angeblich nicht mehr derselbe Mensch sind – was eben nicht stimmt: Wir sind wir. Das Mädchen, das auf Hochspannungsmaste stieg, und das Mädchen, das auf Dächern herumkletterte, bin ich, und ohne sie, ihr Tun und ihre Vergehen, wenn man so will, wäre ich nicht die Frau, die ich heute bin.
Bei dem, was ich an dem Abend notierte, als ich in das Haus von Max kam, habe ich übrigens eher untertrieben, wie mir in der U-Bahn zumute war. Es hört sich so an, als sei es dort, in den Gängen, auf den Rolltreppen und vor allem in den Zügen, gar nicht so schlimm, als sei die Situation wohl unangenehm gewesen, aber als hätte ich sie im Griff gehabt. Die Wirklichkeit sah anders aus. Ich hatte Erfahrungen mit der U-Bahn nur als kleines Kind gehabt und deshalb keine Ahnung, was mich dort unten erwartete. Wer jemals Orwells 1984 gelesen hat, wird sich an die Szene erinnern, in der Winston Smith mit dem Gegenstand seiner schlimmsten Ängste gefoltert wird. In seinem Fall waren das weiße Ratten, für mich sind es Tunnel. Seit jenem [34] Nachmittag bin ich nicht mehr U-Bahn gefahren. Ich werde es nie vergessen.
Heute komme ich unter der Erde zurecht. Es hilft ja nichts, ich arbeite in Souterrains und Kellern und finde das sehr unerfreulich, aber ich mußte mich entweder damit arrangieren oder mir einen anderen Beruf suchen. Pilotin? Turmarbeiterin? Lehrerin für Bungee-Springen? Ich machte mir mit dem Gedanken Mut, daß ich nur diese eine Schwäche zu überwinden hatte, um das zu werden, wozu ich wirklich Lust hatte. Das Studium selbst machte mir keine Mühe, vielleicht weil ich soviel Spaß daran hatte; Mathe war nur am Anfang ein Problem, und als es an die Praxis ging, war ich in meinem Element. Und deshalb konzentrierte ich mich, wenn ich unter der Erde zu tun hatte, ausschließlich auf meine Arbeit, versuchte, mich nach Möglichkeit nicht umzusehen, die fensterlosen Wände nicht wahrzunehmen, das Gefühl zu verdrängen, daß jeden Augenblick die Decke herunterkommen konnte, um mich zu zermalmen. Manchmal schaffte ich es sogar, mir da unten eine andere Umgebung vorzustellen, ein hohes, luftiges Glasdach (so ähnlich wie bei Liv), weitgeöffnete Türen mit Blick auf einen besonnten blauweißen Himmel. Meist aber beschäftige ich mich intensiv mit dem Mikrokosmos der Kabel vor mir, dem neuen Anschluß, den ich lege, dem kleinen überschaubaren Gebiet komplizierter, aber exakter Verdrahtungen. Guy Wharton hat mir mal erzählt, daß sie in den Ausbeuterfirmen des East End für das Auftragen von Schellackpolitur am liebsten Frauen nahmen, weil deren Finger kleiner und zierlicher waren als die von Männern. Auch deshalb sind Frauen gute Elektriker. Ich bin wohl dort im [35] Untergrund deshalb so flink mit meinen kleinen (wenn auch vielleicht nicht zierlichen) Fingern geworden, weil ich selten auf etwas anderes als auf diese Finger sah, nie eine Pause machte oder aufstand, um mich zu recken oder eine Zigarette zu rauchen, bis die Arbeit getan und ich wieder draußen war.
An jenem Septemberabend aber, als ich zum erstenmal in die Russia Road und in das Haus von Max kam, litt ich unter massiver Klaustrophobie. Angefangen hatte es damit, daß Dad mich zum Autowaschen mitnahm. Da war ich zehn. Unsere Werkstatt hatte eine Autowaschanlage installiert, im Suffolk der siebziger Jahre wohl die neueste Errungenschaft. Dad war begeistert, er hatte so was noch nie benutzt, und Wagenwaschen war ihm verhaßt. Und fairerweise muß ich sagen, daß er wohl dachte, ich würde auch meinen Spaß daran haben. Er wollte mir eine Freude machen.
Damals gab man noch keinen Zahlencode ein, sondern steckte Geld in einen Automaten. Dad warf die Münzen in den Schlitz, vergewisserte sich, daß alle Fenster geschlossen waren, und ließ den Wagen rollen, bis die Ampel auf Rot stand. Ich wußte nicht, was auf mich zukam, und er hat es wohl auch nicht gewußt. Wahrscheinlich stellte ich mir unter einer Waschanlage eine besonders große und kräftige Dusche vor, außerdem war ich nicht darauf gefaßt, daß es so rasch losgehen würde. Das Röhren war wie eine Drohung, und als die großen roten Bürsten so schnell anrückten, den Wagen in eine wirbelnde Masse hüllten, die einem Luft und Licht nahm und uns in ihrem gierigen scharlachfarbenen Schlund zu verschlingen drohte, fing ich an zu schreien. Dad war böse, er dachte, daß ich mir einen Jux machen wollte [36] und meine Angst nur spielte, und fuhr mich grob an. Ich legte meine Hand über den Mund, um die Schreie zu ersticken, und dann kam das Allerschlimmste: Das ganze Dach senkte sich, eine Metallstange bewegte sich auf die Windschutzscheibe zu, gleich würde sie das Glas zerschmettern und mir den Kopf abschlagen. Ich wollte nur noch raus, ich machte die Tür auf, und Wasser schwappte in den Wagen. Die ganze Zeit schrie ich wie am Spieß. Daß die Stange mich nicht köpfen oder mir das Gehirn zermalmen würde, war mir inzwischen klar, aber ich schrie trotzdem weiter. Wenn man sagt, jemand sei außer sich, ist das eine sehr treffende Beschreibung meines damaligen Zustandes. Dad wußte nicht, was er machen sollte, er war völlig hilflos, jetzt weiß ich das natürlich, aber damals habe ich es nicht begriffen. Der Wagen war schon voller Wasser. Er mußte die Tür zumachen, damit sie nicht von dem Metallrahmen der Anlage weggerissen wurde, und er mußte mich zum Schweigen bringen, was er mit einer Ohrfeige bewerkstelligte. Er war wohl nicht weniger erschrocken als ich. Ich dachte, die Waschanlage würde mich verschlingen, und er dachte, seine Tochter sei verrückt geworden.
Das war der Anfang. Ich ging der Sache nicht weiter nach, und sie interessierte auch niemanden. Dad wollte den Vorfall so schnell wie möglich vergessen, und als ich Mum davon erzählte, hielt sie es für eine Übertreibung. Aber was hätten sie auch tun sollen? Wußten sie überhaupt, daß ich Angst vor dem Aufenthalt in geschlossenen Räumen hatte? Nächst der Sahara ist das ländliche Suffolk für Klaustrophobiker so mit die günstigste Gegend. Dort findet er weite, offene Flächen, große Felder, freien Himmel, flaches [37] Land, ebene Horizonte. Die Seebäder nicht gerechnet, dürfte es in Suffolk mehr Bungalows geben als irgendwo sonst auf den britischen Inseln, und normalerweise haben die Häuser nicht mehr als zwei Stockwerke. Einige der großen Straßen mögen Unterführungen haben, aber ich hatte nie welche gesehen, ebensowenig wie Höhlen oder Häuser mit Kellern. Unser Haus war zweigeschossig und hatte große Panoramafenster, und meine Schule war ein moderner Bau, der hauptsächlich aus Glas bestand. Es war ein Paradies für Klaustrophobiker. Und nun war ich plötzlich – nach einer Schreckensfahrt durch enge Tunnel – in der Russia Road gelandet und dazu verdammt, drei Jahre lang – eine halbe Ewigkeit für eine Neunzehnjährige – in einer Wohnung zu hausen, in die kaum Licht kam und deren Fenster mit der Oberkante nicht mal bis zur Straßenhöhe reichten.
Dort unten hatte die Großmutter von Max gewohnt, das erfuhr ich von ihm beim Abendessen. Sowie er über die nötigen Mittel verfügte, hatte er das Haus gekauft und sie aus ihrem kleinen Haus in der Nähe der Paddington Station, das feucht und abrißreif war, hierher ins Souterrain geholt. Nachdem sein Vater die Familie verlassen hatte und seine Mutter gestorben war, hatte die Großmutter von Max ihn in ihren beengten Verhältnissen großgezogen und viele Opfer für ihn gebracht, um ihm eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Wobei er sich – typisch Max – die Bemerkung nicht verkneifen konnte, daß er natürlich Stipendien bekommen und damit auch einen kleinen Beitrag zum Unterhalt geleistet hatte. Seine Großmutter war schon sehr alt, als er sie in die Russia Road holte, und über neunzig, als sie starb.
»Du brauchst keine Angst zu haben, daß sie da unten [38] herumgeistert, Schätzchen«, sagte Selina. »Sie ist nicht dort gestorben.«
Auf diesen Gedanken war ich noch gar nicht gekommen, und das wäre auch meine geringste Sorge gewesen.
Max verzog gepeinigt das Gesicht, als sei die Andeutung, die alte Mrs. Fisherton könne mir als Gespenst erscheinen, beleidigend für die alte Dame, was es ja vielleicht auch war. »Es sind alles ihre Möbel«, sagte er liebevoll. »Ich habe nichts verändert.«
Diese kummervoll-träumerische Miene setzte er häufig auf, wenn er von der Vergangenheit sprach. Vor zwölf Jahren muß er um die Sechzig gewesen sein, inzwischen ist er tot. Er war ein Vetter meiner Mutter, der Sohn vom Bruder ihres Vaters. Und dieser Bruder war der Mann, der seinen zweijährigen Max und dessen Mutter hatte sitzenlassen. Max hatte einen Lehrstuhl für Neue Geschichte an der Londoner Universität. Es hörte sich an, als ob er bis Ende Zwanzig unentwegt akademische Titel gesammelt hätte, ich kenne niemanden, der so viele hat wie er. In all den Jahren, erzählte mir meine Mutter, hatte die alte Mrs. Fisherton in Büros und Wohnungen geputzt, damit er noch ein kleines Zubrot zu seinen Stipendien hatte. Max war sehr groß und für sein Alter sehr schlank. Daß er so fit war, führte er darauf zurück, daß er dreimal in der Woche morgens um den Regent’s Park joggte. Ich habe ihn nie anders als in Freizeitkleidung gesehen, meist im Jogginganzug, aus dessen rundem Ausschnitt sein langer faltiger Hals herausragte wie der einer Schildkröte. Für die Uni zog er über die Joggingjacke ein Tweedjackett und dazu eine ausgebeulte Hose an. Sein Gesicht war jungenhaft, das heißt, eigentlich sah es mehr aus [39] wie das eines Babys – eines ältlichen Babys natürlich. Die glatte Stirn war gewölbt, die Backen waren gebläht, die Augen kugelig, dazwischen stand eine Himmelfahrtsnase. Das spärliche Haar hing – vielleicht als Ausgleich für die Stirnglatze – im Nacken lang herunter. Es war weiß und plusterig und bedeckte die Ohren.
Erstaunlicherweise – denn Selina konnte man durchaus als hübsch bezeichnen – waren die beiden sich ziemlich ähnlich. Man hätte sie für seine viel jüngere Schwester halten können. Sie war – oder ist noch – klein, aber nicht kurz geraten (ein Ausdruck, bei dem man an etwas Stämmiges, Kompaktes denkt), sondern schmal und zierlich wie eine Barbiepuppe oder der Engel an der Weihnachtsbaumspitze. Ihre Beine sind wohlgeformt und ebenmäßig, wie auf der Drehbank aus glänzendem Holz, Ahorn vielleicht, gedrechselt. Ihr Gesicht ist wie ein rundliches Herz geformt, die Augen quellen ein bißchen vor, sie hat eine nette kleine Stupsnase, auch der Mund ist herzförmig. Die Wangen sind so rund wie die beängstigend großen, allen Gesetzen der Schwerkraft hohnsprechenden wippenden Brüste mit Brustwarzen, die sich unter ihren Sachen abzeichnen gleich Fingerspitzen, wenn sie erregt ist.
Ich habe sie nie in Hosen oder Pullovern gesehen, ihre Kleidung war so formell, wie die seine salopp war, sie bevorzugte Kostümchen mit kurzen ausgestellten Röcken und taillierten Jacken oder Kleider mit Gürteln und Schulterpolstern, trug viel Schmuck, viel dickes Make-up, hatte immer lackierte Nägel. Der Mund war mit dunklem Konturenstift umrandet und rosa ausgemalt, um noch verlockender und praller zu wirken. Ich habe in den letzten Jahren viele [40] Schauspielerinnen kennengelernt, in deren Häusern oder Wohnungen ich mich um die Elektrik gekümmert habe, darunter auch einige sehr berühmte, und wenn sie nicht gerade auf dem Set oder auf der Bühne sind, laufen sie immer – ja eigentlich so herum wie ich, in Jeans und T-Shirt, ohne Make-up und als ob sie einen Friseursalon noch nie von innen gesehen hätten. Vielleicht war Selina nicht lange genug im Geschäft gewesen, um sich Schauspielerallüren anzugewöhnen. Nachdem sie jahrelang »pausiert« hatte oder sich mit besseren Statistenrollen hatte begnügen müssen, hatte sie für die Rolle der Annabel vorgesprochen, der Pächterin des Pubs Krone und Anker in der Familienserie Streetwise, wobei sie nie damit gerechnet hatte, daß sie die Rolle bekommen, geschweige denn, daß die Serie so lange laufen würde. Nach vierzehn Jahren läuft sie immer noch, und ihre vier Hauptdarsteller sind inzwischen berühmter als Schauspieler, die ihr Leben lang auf der Bühne gestanden haben.
Ich habe nie ein Paar kennengelernt, das so wenig zueinander paßte wie Max und Selina: er ein staubtrockener Akademiker, krittelig, unduldsam allem gegenüber, was er Ignoranz nannte, ein intellektueller Snob, sie nahezu ungebildet, frivol und oberflächlich. Sie liebte Partys, gleichgültig, ob sie dazu eingeladen wurde oder selber welche gab, Partys von der Art, auf denen die Leute sich nie hinsetzen, sondern herumstehen, Medienklatsch austauschen und sich nur auf der Ebene von Partybekanntschaften näherkommen. Trotz der »Schätzchen«-Anrede aber, mit der sie alle Welt beglückte – von Max bis zu dem Mann, der die Geschirrspülmaschine reparierte –, war sie genauso kalt und mißtrauisch, tadelsüchtig und ungeduldig wie er.
[41] Vielleicht gab es also zwischen ihnen doch Gemeinsamkeiten. Kennengelernt hatte er sie, als seine Universität ihr einen akademischen Titel ehrenhalber verlieh. Keinen Ehrendoktor, dazu konnten sie sich nicht durchringen, schließlich war sie ja nur eine der Hauptdarstellerinnen in einer Seifenoper, sondern einen Mag. Litt (Drama), den sie wohl eigens zu diesem Anlaß erfunden hatten. Max war im Verleihungsausschuß, und hinterher setzte der Vizekanzler ihn beim Tee neben sie. Er hatte sich dagegen gewehrt und versucht, sich zu drücken, aber nachdem sie ihre Sandwiches und ihre Sahnebaisers vertilgt hatten, war er zum erstenmal im Leben verliebt und rettungslos verloren, zumindest wenn man Selinas häufig wiederholter Schilderung dieser Begegnung glauben darf, die ich an diesem ersten Abend zum erstenmal hörte. Max saß dabei und stocherte in seiner Mikrowellen-Lasagne und seinen aufgetauten Erbsen herum. Nur hin und wieder lächelte er schmal, nicht anteilnehmend oder anerkennend oder auch nur in Erinnerung an jene Zeiten, sondern so, als sei er in ein Geheimnis eingeweiht, das Selina und mir verschlossen war. Vielleicht war es aber auch nur seine intellektuelle Überlegenheit.
Als nächsten Gang gab es einen Schokoladenfertigkuchen, danach Nescafé mit haltbarer Kaffeesahne. Meine Mutter war eine gute Köchin, und ich war so ein Essen nicht gewöhnt. Das klingt undankbar und war es wohl auch, aber es sollte, auch wenn ich das damals noch nicht wußte, nicht nur das erste, sondern mit Ausnahme eines Geburtstagsessens auch das letzte Mal sein, daß ich von Selina und Max zum Essen eingeladen wurde. Wir waren kaum aufgestanden, als Selina mich schon nach unten entließ. »Du wirst [42] dich einrichten wollen, Schätzchen, da sagen wir am besten gleich gute Nacht.«
Es war fünf vor halb neun. Damals wußte ich noch nicht – erfuhr es aber sehr bald –, daß sie sich an allen Wochentagen, sofern sie zu Hause war, in Streetwise besichtigte. Wenn sie nicht zu Hause war, hatte sie es um diese Uhrzeit bestimmt nicht weit zu einem Fernseher, und ihre Gastgeber mußten eine halbe Stunde Banalitäten in der Floral Grove, SW12, über sich ergehen lassen. Ich dürfte nicht so überlegen tun, denn auch ich habe mir lange die Sendung jeden Abend angesehen, weil ich nichts Besseres zu tun hatte, als dicht vor dem Schwarzweißfernseher der alten Mrs. Fisherton zu sitzen und auf den Schirm zu starren, um die immer näher rückenden Wände und die sich immer tiefer senkende Decke nicht sehen zu müssen.
Ich hätte mir wohl nichts zum Frühstück mitgebracht, sagte Selina. Ganz in der Nähe seien Läden, die bis sonstwann offen hätten, aber um diese Zeit würde ich da wohl nicht hingehen wollen, meinte sie mit einem skeptisch-fragenden Unterton. Vielleicht hatte sie erwartet, ich würde mit Freude bereit sein, mich zum Proviantfassen in die finsteren, spärlich beleuchteten Straßen von Maida Vale hinauszuwagen. Ich sagte nichts. Ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Solange ich denken konnte, war das Frühstück einfach dagewesen, ich konnte es essen oder stehenlassen, ganz wie ich wollte. Ich war verwöhnt, ich nahm zu vieles als selbstverständlich hin. Selina begann eins jener Selbstgespräche, die für sie typisch waren und bei denen sie ihre Gesprächspartnerin ausnahmsweise nicht »Schätzchen« nannte. Wie sollte ich zu meinem Frühstück kommen? Sie könnte mir was [43] geben. Ja, aber was? Bei ihnen gab es nie das berühmte englische Frühstück, sie mußte ihres Berufs wegen auf die Figur achten. Cornflakes, ja, das ginge vielleicht. Und Brot? Ich würde Butter brauchen und Milch, es hörte gar nicht mehr auf. Aber es war ja nur dieses eine Mal, danach, sobald ich mich eingerichtet hatte…
Max stellte sich indes blind und taub. Er hatte sich ein Buch an den Tisch geholt und las. Ich stand da, freute mich an dem vielen Licht im Eßzimmer, das durch ein großes dreigeteiltes Bogenfenster kam, und erkannte, daß dies das Fenster sein mußte, über dem das Mädchengesicht zwischen den Lilien und Weinblättern saß. Außerdem begriff ich, wenn auch vielleicht nicht genau in diesem Moment, daß ich, sobald ich mich mit dem Gedanken an eine Wohnung in einem Haus vertraut gemacht hatte, ganz selbstverständlich davon ausgegangen war, daß sie ganz oben, daß sie im obersten Stockwerk sein würde.
Ich nahm Selina das Tablett ab, das sie für mich zurechtgemacht hatte, zwei Scheiben Schnittbrot, eine Portion Butter, einen Teebeutel und ein Achtelliter Milch in einem kleinen Wasserglas, ein Schälchen Cornflakes und einen Teller mit einem Löffel Orangenmarmelade am Rand. Außerdem lag noch ein Schlüssel auf dem Tablett.
»Du hast deinen eigenen Eingang zum Lichtgraben, Schätzchen.«
Ich hatte das Wort noch nie gehört, mochte aber nicht fragen. Es würde sich schon herausstellen.
»Ja, dann gute Nacht.« Sie tippte mit einem langen orchideenrosa Fingernagel an das Buch von Max. »Sag gute Nacht, Schätzchen.«
[44] »Gute Nacht«, sagte Max, ohne aufzusehen.
Die Kennmelodie von Streetwise folgte mir die Treppe hinunter. Ich machte das Licht in der Diele an, ehe ich gleichsam einen Sprung in den Untergrund wagte. Es war ein bißchen so, als wenn man in einen dunklen Teich taucht, dessen Tiefe man nicht kennt, von dem man aber weiß, daß man darin ertrinken könnte. Nur, daß von einem Sprung nicht die Rede sein konnte. Ich ging vorsichtig nach unten, mein Tablett in der Hand, und tastete mich an der Wand entlang, bis ich den Schalter gefunden hatte. Die Glühbirnen im Fisherton-Verlies, wie ich die Wohnung taufte, waren alle sehr schwach. Vierzig Watt, würde ich heute sagen. Aber das, dachte ich mir – und diese Einstellung war natürlich nicht weniger schwach als die Glühbirnen (oder Glühlampen, wie wir Elektriker korrekterweise sagen) –, war eben so und ließ sich nicht ändern.
Bei den Wohnungen alter Damen erkennt man auf den ersten Blick, ob sie in den Dreißigern, den Zwanzigern oder dem ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts jung gewesen sind, unabhängig davon, was für Möbel gerade modern waren, als sie erwachsen wurden. Mehr oder weniger ist es immer das gleiche Bild: Sessel mit grauem Samtbezug und einem kleinen Muster aus roten Blüten und schwarzen Blättern, Chintzsofas mit Schutzdeckchen für die Lehnen, weil sich ja mal Leute mit schmutzigen Händen draufsetzen könnten, Tische mit geschnitzten Kanten und verschnörkelten Beinen, verglaste Bücherschränke mit Werken längst vergessener Schriftsteller, graue und rosafarbene Brücken auf größeren roten und schwarzen Brücken auf grün-beigefarbenen Teppichen, Schirmständer, Stehlampen mit [45] Pergamentschirmen und Handarbeitskörbe mit Baumwollgarnknäueln, Vasen aus Riffelglas in Smaragdgrün und Jadefarben und Weiß, innen braun verfleckt von Chrysanthemen, die man zu lange in abgestandenem Wasser gelassen hat, Landschaften in vergoldeten Rahmen, im Lauf der Jahre durch mangelnde Pflege bis zur Unkenntlichkeit nachgedunkelt, unzählige weiße Schälchen und Döschen und Väschen mit rotschwarzgoldenem Wappen und dem Namen des Seebades, in dem sie vor einer halben Ewigkeit gekauft wurden. Und natürlich die gerahmten Fotos, die den Betrachter deprimieren, weil die Abgebildeten fast immer dumpf und täppisch aussehen und bei aller aufgesetzten Aufgeräumtheit unglücklich dreinschauend in unnatürlicher Umgebung oder künstlicher Landschaft posieren.
Eins dieser Fotos in der Wohnung der alten Mrs. Fisherton zeigte Max in akademischem Talar und Barett, es war offenbar in einer Bibliothek aufgenommen. Ich erkannte Max an seinen Glupschaugen und dem langen, damals noch runzelfreien Hals. Auf anderen Fotos waren Leute zu sehen, die sein Großvater, sein Vater, seine Mutter, Tanten und Onkel sein mochten. Was sie hier zu suchen hatten, nachdem die Besitzerin der Wohnung längst das Zeitliche gesegnet hatte, war mir ein Rätsel.
Ich ging von Zimmer zu Zimmer und sah mir alles genau an. Bewegung tut Klaustrophobikern gut. Ein Vorteil der Wohnung waren die großen Räume und die relativ hohe Decke. Das Schlafzimmer wirkte am wenigsten unterirdisch, die obersten Zentimeter des Fensters ragten über die Mauer, die den sogenannten Lichtgraben vom Garten trennte. Ich war sehr froh darüber, denn dort sollte ich [46] schlafen, in dem hohen Bett der alten Dame mit Simsen und Vorsprüngen am Kopfbrett, die offenbar den Zweck hatten, einen am Aufrechtsitzen im Bett zu hindern – vom Lesen ganz zu schweigen –, und einem Fußbrett mit Verzierungen, an denen man sich die Zehen stieß. In dem Kleiderschrank konnten ängstliche Kinder nachts herumgeisternde Gespenster vermuten. Für solche Ängste war ich zu alt, aber auch mir war der klobige Kasten mit den Schnitzereien an den Türen und den Füßen, die an die Klauen eines sehr alten arthritischen Löwen erinnerten, ausgesprochen unsympathisch, insbesondere das wappenähnliche Etwas, das die Vorderfront krönte und mir im Halbdunkel – und auch später viele Male, obgleich ich da schon wußte, was es wirklich war – wie ein in mörderischem Kampf unentwirrbar ineinander verschlungener Knäuel aus Schlangen und Skorpionen vorkam.
Ich packte meine Koffer aus. Auf der Stange im Kleiderschrank hingen viele Drahtbügel, wie man sie von der chemischen Reinigung bekommt. Sie klimperten wie verstimmte Glocken, nicht nur, wenn man die Tür aufmachte, sondern auch, wenn man nur im Vorbeigehen den Kleiderschrank streifte. Ich hängte meine Sachen auf, brachte meine Kosmetiktasche ins Bad (Wanne mit Klauenfüßen, in der Wanne braune Rostflecken, keine Dusche, Spülkasten mit Kette). Auf dem Fußboden lag Linoleum, das ich nicht mal dem Namen nach kannte, bis Beryl mich aufklärte, wohl an dem gleichen Tag, als sie mir sagte, im Supermarkt um die Ecke bekäme ich Glühbirnen, »die genug Licht geben, daß ein normaler Mensch sich nicht die Augen verdirbt«.
Der Schwarzweißfernseher lenkte mich etwa eine halbe [47] Stunde ab, dann wurde das Stillsitzen beklemmend, und ich stand auf, um die beiden Zimmer zu besichtigen, die ich nie benutzen sollte, ein Gästezimmer und ein Eßzimmer, das kein Fenster hatte, sondern nur eine Schnur, mit der man einen Ventilator in Gang setzen konnte. Ich nahm mir vor, diese schattendüstere Höhle mit Drucken uralter Herrenhäuser und Schiffen auf stürmischer See, einem großen rechteckigen Tisch und acht krummbeinigen Stühlen, einer Anrichte und einem alten Teewagen aus Metall, auf dem ein offenbar komplettes Eßservice in Grün und Gold aufgebaut war, unter keinen Umständen noch einmal zu betreten. Womöglich wäre alles anders gekommen, wenn ich mich an diesen Entschluß gehalten und nicht Livs Geld in der Schublade der Anrichte versteckt hätte. Ich hätte die Tür abschließen und den Schlüssel wegwerfen sollen, nur war kein Schlüssel da. Als ich wieder draußen war, atmete ich schnell und flach, würgend und fast schluchzend. An jenem Abend – und es war wohl der schlimmste aller Abende – fragte ich mich, wie ich mit alldem fertig werden, wie ich es ertragen sollte.
Wenn wir älter werden, lernen wir unter anderem, daß sich alles ändert, daß fast nichts so bleibt, wie es ist. Auch wenn das Fisherton-Verlies unveränderlich war – ich würde mich ändern, meine Lebensumstände würden sich ändern. Aber ich war erst neunzehn und jung für mein Alter, trotz der Erfahrung, die mein Leben aus dem Gleis geworfen hatte. Es war nicht nett, wie Max und Selina mit mir umgingen, andererseits hatten sie mir eine große Wohnung in einer sehr begehrten Gegend von London mietfrei zur Verfügung gestellt, in unmittelbarer Nähe der Fachhochschule, [48] die ich besuchen sollte. Die Wohnung war sauber, das Bett war frisch bezogen, im Badezimmer hingen Handtücher. So sehe ich es jetzt; damals sah ich es anders. Ich fühlte mich schlecht behandelt – nicht so sehr von ihnen als von einem wesenlosen Schicksal –, und ich hatte Angst.
Es war wohl ganz gut, daß ich von allem, was den Haushalt betraf, so unbeleckt war, daß mir das Fehlen von Kühlschrank, Waschmaschine und Geschirrspüler nicht auffiel. Bänglich beäugte ich den Gasbackofen und die Elektrokochplatte, auf der ein alter geschwärzter Kessel stand. Ich hatte noch nie im Leben etwas gekocht, mir nie eine Tasse Tee gemacht. Immerhin – und daran klammerte ich mich wie an einen Rettungsring – hatte ich schon mal kochendes Wasser über einen Löffel Pulverkaffee in einen Becher gegossen.