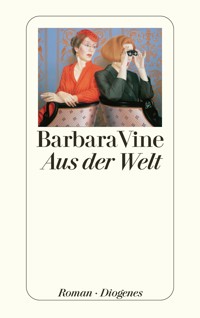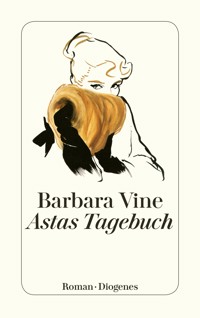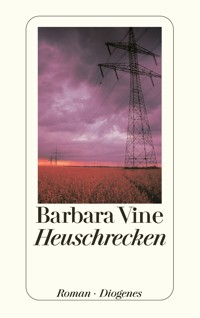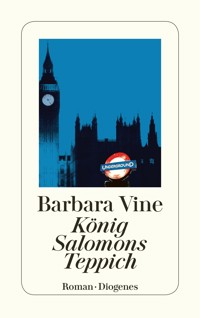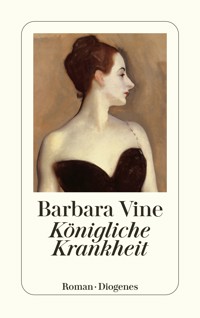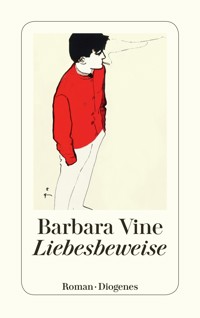
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
November in der Londoner U-Bahn. Die Bahnsteigkante lockt, wäre da nicht Sandor. In letzter Sekunde reißt er Klein-Joe zurück. »Wer bist du?«, fragt er. »Ich habe dir das Leben gerettet, deshalb gehört dein Leben jetzt mir.« Und schon gerät Klein-Joe in neue Nöte, denn auch Sandor hat eine Vergangenheit. Eine Geschichte um Entführung und Begehren bis hin zur Hörigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Barbara Vine
Liebesbeweise
Roman
Aus demEnglischen vonRenate Orth-Guttmann
Titel der 1990 bei Viking, London,
erschienenen Originalausgabe: ›Gallowglass‹
Copyright © 1990 by Kingsmarkham Enterprises Ltd.
Die deutsche Erstausgabe
erschien 1991 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Illustration von René Gruau
Copyright © SARL René Gruau
Foto: © Matthew Corrigan/
Alamy Stock Photo
Für Pat Kavanagh
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2019
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24493 9
ISBN E-Book 978 3 257 60114 5
[5] …Der blut’ge Macdonwald
…hat aus den Inseln westwärts
Der Kern’ und Gallowglasse Schar geworben;
Fortuna, lächelnd diesem schnöden Kampfe,
[6] Ein Großteil der als Hintergrundmaterial für diesen Roman verwendeten Informationen über Kidnapping in Italien stammt aus The Kidnap Business
[7] 1
Wenn man in Rom ist (sagte Sandor), muß man über die Via Condotti gehen, Geschäfte anschauen. Denn da ist das Geld, und die Fenster sind voll von schönen Dingen.
»Was heißt das?« fragte ich. »Was ist das, die Via Condotti?«
»Kidnap-Straße.«
»Im Ernst?« fragte ich. »Heißt die wirklich so?«
Er lachte nur, wie es seine Art ist. Dann erzählte er die Geschichte weiter, die erste Geschichte, die er mir je erzählt hat. Wenn du ein Geschäft in der Via Condotti hast, sagte er, hast du es geschafft, dann bist du reich, ein Schaufenster in der schicksten Einkaufsstraße Roms ist ein sicheres Zeichen von Wohlstand.
Dort gibt es den Juwelier Bulgari. Ein Mitglied der Familie Bulgari wurde 1975 entführt und gegen Zahlung eines Lösegeldes von 650000 Pfund freigelassen. Das heißt, das Lösegeld war in italienischem Geld, sagte Sandor, aber soviel war es in Pfund. Acht Jahre später wurden noch mal zwei Mitglieder der Familie entführt, die kamen für eindreiviertel Millionen Pfund frei. Wenn man auf dieser Straße weitergeht, kommt man zu Piatelli, Herrenbekleidung. Barbara Piatelli wurde entführt, fast ein Jahr lang festgehalten und für 500000 Pfund auf freien Fuß gesetzt.
Gegenüber ist Fürst Piraneso, der Parfümeur. Ob ich [8] schon mal von den Parfüms gehört hätte, die so heißen, fragte Sandor. Nein, sagte ich, von so Sachen hatte ich noch nie gehört, natürlich nicht, und benutzt hatte ich sie schon gar nicht.
»Haben sie den auch entführt?« fragte ich.
»Ihn nicht. Seine Frau.«
»Und wie war das mit ihr?«
Ganz träumerisch, als wäre er mit seinen Gedanken weit weg, sagte er: »Das war gegen Ende der Kidnapping-Ära. Erst vor fünf Jahren. Das Goldene Zeitalter des Menschenraubs war vorbei, sogar in Italien.«
Ich sah ihn erwartungsvoll an. Eigentlich war es gar keine richtige Geschichte. Mehr ein Bericht, eine Darstellung. Nicht wie die Geschichten von der Señora Santa Anna oder von Lichnikoff, die einen Anfang und ein Ende hatten. Aber da wußte ich schon, daß man Sandor nicht drängen darf. Daß er erzählt, wie und wann es ihm paßt. Daß man es ihm überlassen muß, ob er über etwas reden oder ob er es nie mehr zur Sprache bringen will. Er zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich mit halb geschlossenen Augen zurück. Ich sah ihn an. Drei oder vier Tage war meine Liebe jetzt alt, ich spürte, wie sie sich in mir regte, und wie ich ihn so ansah, stieg sie immer höher, wurde immer stärker, als ob sie mit einem Schrei aus meinem Mund herausfahren wollte. Ich legte die Hand über die Lippen und saß da und sah ihn an.
Am nächsten Tag gingen wir zusammen weg. Es war wohl das erste Mal, daß Sandor mich herumführte; er zeigte mir die Stadt, in der ich geboren bin und die ich doch nie richtig gesehen habe. Wir fuhren U-Bahn; ich [9] sollte mich wieder daran gewöhnen, und ich merkte, wie er mich beobachtete, weil er wissen wollte, ob alles in Ordnung war. Oxford Street, im Wind treibender Schnee, der auf den warmen Gehsteigen schmolz.
»Wohl kaum eine Via Condotti«, sagte er.
Ich wußte nicht, wie er das meinte. Menschen und Geschäfte gab es genug. Vielleicht meinte er das Geld. Die Kauflust war schon da, das spürte man, aber es haperte am Geld. Wir gingen in ein großes Warenhaus. Schon von weitem roch man die Abteilung, wo es die Parfüms gibt, die Puder und Cremes und solche Sachen. So stelle ich mir das in exotischen Ländern vor, wenn man zu einem tropischen Garten kommt und ihn noch nicht sehen kann. Sandor führte mich zu einem Tresen, wo alles, was es zu kaufen gab, Fürst Piraneso hieß. Die Sachen für die Frauen waren auf der einen Seite und die für die Männer auf der anderen. Ein Mädchen mit einem Kristallglasflakon in der Hand sprühte mich mit Parfüm an und Sandor auch, und ich staunte nicht schlecht, weil das Sandor offenbar gar nichts ausmachte, er war überhaupt nicht böse. Er hielt sich sogar sein Handgelenk an die Nase und roch daran und lächelte ein bißchen.
Die Sachen für die Frauen waren hellblau verpackt und die für die Männer rot. Sie waren so teuer, daß sie eigentlich viel zu schade fürs Gesicht waren, von Rechts wegen hätte man das Zeug essen müssen. Von diesem Fürsten gab es keine Bilder, nur von weiblichen Models und von einem Mann, der, wie ich fand, Sandor sehr ähnlich war, aber als ich ihm das sagte, schüttelte er den Kopf und runzelte die Stirn. Er machte mich besonders auf ein kleines Photo in [10] einem Oval mit Goldrahmen aufmerksam, das war auf dem Deckel von einer großen Puderschachtel, ein ganz kleines Bild von einem blonden Mädchen mit ganz viel goldenem Haar in einer Hochsteckfrisur mit Perlenschnüren. Sandor stieß mich fast mit der Nase drauf, damit ich es genau sehen konnte.
Wir standen so lange da, daß das Mädchen mit dem Kristallglasflakon uns noch mal ansprühte, aber diesmal fand Sandor das gar nicht gut, er sah sie finster an.
»Komm jetzt, Klein-Joe«, sagte er zu mir. »Das reicht für heute.«
Zu der Zeit wohnte ich schon seit fast einer Woche in Sandors Zimmer in Shepherd’s Bush. Nun hatte ich abends was zu denken, wenn er las. Damals habe ich wohl damit angefangen, über den vergangenen Tag nachzudenken und vielleicht noch über den davor und über alles, was passiert war, und die Sachen, die Sandor mir beigebracht hatte. Meist hatte ich auch neue Worte gelernt, die sagte ich dann leise vor mich hin. Es war ein ziemlich großes Zimmer im ersten Stock, mit einem Doppelbett und einem Stuhl und einem Möbel, das Chaiselongue heißt. Wenn ich an all die Sachen denke, die ich damals zum ersten Mal gemacht und erlebt habe, dann war das, glaube ich, das erste neue Wort, das Sandor mir beigebracht hat. Daß so ein komisches Sofa, sehr hart und unbequem, mit einer Rückenlehne wie das gepolsterte Kopfteil von einem Bett, eine Chaiselongue ist. Die ersten Nächte habe ich auf diesem Ding verbracht, aber so nach einer Woche sagte Sandor vom Bett aus: »Meinetwegen kannst du zu mir rüberkommen.«
[11] Ich schlief ganz am Rand, um ihn in der Nacht nicht anzufassen. Ich hätte ihn sehr gern in der Nacht angefaßt, nur um ganz nah bei ihm zu sein, nicht irgendwie häßlich, nichts mit Sex oder so, sehr sehr gern hätte ich das gemacht, aber das war nun mal nicht möglich. Einmal rollte ich aus Versehen zu ihm hinüber. Er wachte auf und sagte schreckliche Sachen, machte mir Vorwürfe, die mir furchtbar weh taten, und dann schlug er mich ins Gesicht, erst auf die eine Wange, dann auf die andere, mit harten Händen, hart wie ein Gewehrkolben. Die Erinnerung an diese Worte und diese Schläge haben wohl in mein Unterbewußtsein so was wie einen Daueralarm eingebaut, denn nachts, wenn mein Körper dem Schlaf nachgeben will und der Sehnsucht, ertönt ein Warnsignal in meinem Kopf, und ein Ruck geht durch meine Muskeln und hält sie zurück.
Mittlerweile war ich mir über meine Gefühle für Sandor schon klargeworden. Natürlich war ich dankbar. Und ich bewunderte ihn wegen seines Aussehens und seiner Art zu reden. Aber es war auch Liebe. Ich hatte das Gefühl, daß ich mein Leben lang jemanden gesucht hatte, den ich lieben konnte, der irgendwo auf mich wartete, und dieser Jemand war Sandor. Natürlich hatte ich Tilly liebgehabt, ich habe sie immer noch lieb, auch wenn ich sie jetzt seit Monaten nicht mehr gesehen habe, aber so wie ich Sandor liebe – es klingt verrückt, denn er ist ja nur zwei Jahre älter als ich – also ich glaube, so könnte ein Kind seinen Vater lieben. Zu Hause, bei Mams und Paps, wurde über Liebe nicht gesprochen, das Wort ist nie gefallen. Es gab Leute, die »mochte« man, die »konnte man gut leiden«, an denen »hing man«, wie Mams sagte, und das war dann schon das [12] höchste der Gefühle, aber Liebe, nein, ich glaube, Liebe war für die beiden was Sexuelles, und Sex gab es für sie nur, wenn das Licht aus war. Oder in Witzen.
Viel schwerer zu verstehen ist, was Sandor an mir findet. Ich mag im Moment gar nicht an das denken, was mich hauptsächlich zu dem gemacht hat, was ich bin, vor allem nicht an diese letzte Sache, vor der Sandor mich gerettet hat, aber ich will gern zugeben, daß ich praktisch total ungebildet bin und daß ich ehrlich gesagt nichts zu geben habe. Oder besser gesagt: nichts zu bieten. Meine Liebe, ja, die könnte ich ihm geben, aber ich glaube eigentlich nicht, daß es ihm um die zu tun ist. Vielleicht gefällt ihm ja meine Anhänglichkeit (auch einer dieser Ausdrücke von Mams) und daß ich ihm so bereitwillig in allem folge. Oder vielleicht braucht er einen Diener. Ich verdanke ihm mein Leben, weil er es mir damals gerettet hat, und er hat mir erklärt, was das bedeutet: daß ich ihm angehöre und zu tun habe, was er mir sagt.
Das Neueste ist, daß ich mir einen Bart stehenlassen soll. Ob er davon anfing, ehe er mir die nächste Geschichte oder nachdem er mir den ersten Teil der letzten Geschichte erzählt hatte, weiß ich nicht mehr genau, es ist wohl auch nicht weiter wichtig. Damals dachte ich, Sandor hätte mal wieder meine Gedanken gelesen. Es war mir ein bißchen peinlich, daß ich einen dieser Bic-Rasierer benutzte, diese orangefarbenen Plastikdinger, die man in Zehnerpackungen kaufen kann, während Sandor so elegant und fachmännisch mit dem Rasiermesser seines Urgroßvaters hantierte. Es war, als wenn er mich nicht in Verlegenheit bringen wollte.
[13] »Ich hab noch nie einen Bart gehabt«, sagte ich.
»Dann wird’s aber langsam Zeit, Klein-Joe«, sagte er.
Wenn ich diesen Namen höre, wird mir immer ganz warm ums Herz. So hat mich noch keiner genannt. Ich bin nicht klein, ich bin so groß wie er, fast einsachtzig, aber es klingt so väterlich, so wie man einen Sohn nennt. Ich stellte mich vor den Spiegel.
Ich bin sehr mager und langbeinig, richtige Streichholzbeine, sagt Sandor, ein komischer Ausdruck. Ich habe dunkle Haare wie er, aber sie sind dünn und krisselig, nicht glatt und dicht wie seine, und meine Haut ist zu blaß für mein Haar. Ich habe blaßblaue Augen mit rosa Rändern, und Sandor sagt, ich bin »mattäugig und schwach«, wie es von dieser Frau in der Bibel heißt. Nicht gerade schmeichelhaft, aber ich weiß schon, daß ich keine Schönheit bin. Ein zu groß geratenes Wiesel mit langem Hals, so seh ich aus.
Ich rasiere mich, seit ich dreizehn bin, seit vierzehn Jahren also. Eines Tages ging Paps mit mir ins Badezimmer und machte die Tür hinter uns zu, wie wenn er mir was Unanständiges zeigen wollte. Er drückte mir einen dieser Plastikrasierer in die Hand, ab nächsten Morgen sollte ich mich rasieren. Ich hab da nie weiter drüber nachgedacht, und seither habe ich mich jeden Tag rasiert, obgleich meinem nackten Gesicht mit dem kümmerlichen Kinn eine kleine Abdeckung bestimmt ganz gutgetan hätte. Vor einer Woche habe ich den Rasierer weggeworfen, und jetzt habe ich einen dichten dunklen Pelz auf Kinn und Wangen und Oberlippe. Bei Pelz denkt man gleich an Tiere, aber mit meinem Pelz, finde ich, sehe ich mehr aus wie ein richtiger Mensch.
[14] Seit der Geschichte vom Fürsten Piraneso hat er mir noch drei erzählt, die Geschichte von den hannoveranischen Kronjuwelen und wie man sie versteckt hat, als die Preußen kamen, die von dem alten Ehepaar, das eine Affenpfote zum Wünschen hatte, mit der es sich den toten Sohn zurückholte, und wie die beiden sich dann nicht trauten, ihn ins Haus zu lassen. Und dann die von Señora Santa Anna. Das war die Frau des Diktators von Mexiko, und als sie eines Tages mit ihrer Hofdame und ihren Lakaien in der Kutsche ausfuhr, nahmen Banditen sie gefangen.
»Was ist ein Lakai?« fragte ich.
»Eine Art Diener, mit einer Phantasieuniform«, sagte Sandor. »Und gepuderter Perücke.«
Die Banditen wollten sich an General Santa Anna rächen, deshalb zwangen sie die feine Dame und ihren ganzen Hofstaat, die Kleider abzulegen und nackt nach Mexico City zurückzufahren. Sonst haben sie ihnen nichts getan, nur daß sie sich eben ausziehen mußten. Der General war wütend und setzte eine Belohnung auf den Kopf des Oberbanditen aus, den wollte er seiner Frau zu Füßen legen, den Kopf meine ich. Aber er hat den Oberbanditen nicht gekriegt, nur Hunderte von Unschuldigen, die hat er dann alle hinrichten lassen.
Eine grausame Geschichte, nicht? Sandors Geschichten sind alle so, voll dunkler Dinge und voller Leid, aber sie sind auch spannend. Vier Tage vergingen. Würde es irgendwann noch mal eine Geschichte geben, fragte ich mich. Würde ich irgendwann noch mehr über Rom und die Kidnap-Straße und den Fürsten erfahren? Wir hatten uns zum Abendessen was vom Inder geholt und eine [15] Flasche roten vino dazu, und Sandor lag auf dem Bett und las ein Buch, Der goldene Zweig von Sir James Sowieso. Er hatte sich die alte rosagraue Tagesdecke übergelegt. Wenn Vorhänge und Tagesdecken und solche Sachen aus möblierten Zimmern in Vierteln wie Shepherd’s Bush alt und verbraucht sind, haben sie komischerweise immer diese Farbe. Das liegt wohl am Staub und zu scharfen Waschmitteln und der Sonne und wieder Staub. Tillys Freund Brian, der in Indien gewesen ist, hat mir erzählt, daß die Bettler dort alle rosagraue Lumpen tragen.
Sandor hat ein Gesicht, das man nie vergißt. Wenn man Sandor gesehen hat, gefällt einem keiner mehr. Finde ich jedenfalls. Nicht richtig hübsch… aber wenn er nicht hübsch ist, wer dann? Ein besseres Wort fällt mir leider nicht ein. Großer Mund, volle Lippen, große Nase, schmale Wangen, sehr schmal für einen, der noch nicht dreißig ist, tiefliegende braune Augen, ein ganz dunkles Braun, eine kantige Kieferpartie, scharf wie eine Schneide. Wunderschön ist sein Lächeln, besonders, wenn es einem selbst gilt, und in letzter Zeit hat es oft mir gegolten. Sein Haar ist ziemlich kurz geschnitten, sehr dunkel und dicht, und eine Strähne fällt ihm immer in die Stirn. Er hat wunderbare Hände, sie sind lang und dünn, aber nicht wie Frauenhände, die Gelenke sind kräftig, die Fingerspitzen stumpf.
Er legte das Buch aus der Hand, mit den aufgeschlagenen Seiten nach unten, er nimmt keine Lesezeichen. Mams hat sogar in ihre bunten Blättchen Lesezeichen gelegt, das muß man sich mal vorstellen. Sandor legte sein Buch einfach mit den aufgeschlagenen Seiten nach unten auf den [16] Boden und sah mich lächelnd an und meinte, es sei Zeit, mir wieder ein Stück von der Geschichte zu erzählen, die er angefangen, aber nicht zu Ende gebracht hatte.
»Wir können sie als Serie laufen lassen«, sagte er. »Als unsere Seifenoper, wenn du so willst. Zur Erinnerung an das, was dir fehlt.«
Er weiß, daß mir der Fernseher fehlt, dabei habe ich das nie so ausdrücklich gesagt. Nur, daß ich früher immer Fernsehen geguckt habe. Als er wissen wollte, was ich so mit mir anfange. Was hätte ich sonst sagen sollen? Aber Geschichten höre ich genauso gern, eigentlich noch lieber, und wenn ich dabei neben ihm liege, ist das fast wie eine Gutenachtgeschichte. Sandor kann nicht erzählen, ohne zu rauchen. Auch das gefällt mir, obgleich ich den Geruch nicht mag. Genauso, stelle ich mir vor, hätte es sein können, als ich drei oder vier war. Mein Vater zündet sich eine Zigarette an, dann ruft er mich zu sich und nimmt mich auf den Schoß. Sandor nahm ganz tiefe Lungenzüge, es dauerte lange, bis der Rauch wieder aus seinem Mund rauskam, manchmal dachte ich, er käme vielleicht gar nicht mehr raus, sondern bliebe in ihm drin, als ob er von Feuer und Schwefel leben könnte!
Er lehnte den Kopf an die Wand, das Bett hatte kein Kopfteil, und machte die Augen zu. Der Rauch kräuselte sich vor seinen Lippen. »Der Fürst«, sagte er, »war zu Beginn unserer Geschichte ein alter Mann.«
Inzwischen weiß ich schon, wann er möchte, daß ich eine Frage stelle. »Was ist alt?«
»Wir sind jung«, sagte er, und ich merkte, wie schön er es fand, das sagen zu können. Er ließ den Satz sozusagen [17] auf der Zunge zergehen. »Wir sind jung, Klein-Joe. Ich möchte immer jung bleiben, in alle Ewigkeit. Du nicht?« Ich gab keine Antwort, darüber hatte ich noch nie nachgedacht, mir hatte es bisher genügt, am Leben und normal zu bleiben. »Er war alt nicht nur nach unseren Begriffen, sondern überhaupt. Er hatte schon zwei Ehefrauen gehabt. Von der einen war er geschieden, die andere war tot. Er hatte auch Kinder, die waren damals schon ziemlich alt. Alt genug, um die Eltern der Prinzessin zu sein.«
»Welcher Prinzessin?« fragte ich.
»Sie war eine der schönsten Frauen der Welt.« Er sah mich an, fast so, als ob er Widerspruch erwartete. Ich nickte nur. »Aber gleichzeitig war sie ein ganz gewöhnliches kleines Mädchen. Oder war es gewesen. Sie ist in einem kleinen Ort an der Küste zur Welt gekommen. Ob das auch in Italien war, wirst du jetzt fragen. Nein, es war hier, in England. Sie war Engländerin. Als Fürst Barnaba di Piraneso sie kennenlernte, war sie ein berühmtes Model, ihr Gesicht lächelte von allen Titelbildern, dabei war sie erst zweiundzwanzig. Er war achtundsechzig, aber sehr, sehr reich. Hast du schon mal was von einer Gila-Krustenechse gehört, Klein-Joe?«
»Ja, im Fernsehen, in einer dieser Tiersendungen.«
Darüber mußte er lachen. »Dann kennst du sie ja: schuppiges Gesicht, Knopfaugen, dicker Körper mit schwarz-rosa Flecken. Auf Lateinisch hat sie einen fabelhaften Namen, Heloderma horridum. Genau wie H. Horridum sah unser Fürst aus, aber die Prinzessin hat ihn trotzdem geheiratet. Wie in dem Märchen vom Froschkönig, aber ihr Frosch hat sich nie in einen schönen jungen [18] Prinzen verwandelt. Ein Fürst war er ja schon, und um das andere zustandezubringen, ist mehr nötig, als daß man heiratet, dazu braucht es Liebe, und ich glaube, damit war es nicht allzuweit her.«
»Und die ist entführt worden?«
»Ja, aber nicht gleich, erst nach ein paar Jahren.« Sandor zündete sich die nächste Zigarette an und schwieg eine Weile. Das ist wohl der Schluß von Teil eins, dachte ich mir und erschrak fast ein bißchen, als er wieder anfing, jetzt hörte sich seine Stimme viel rauher an. »Sie hatten drei Wohnsitze. Einen in Paris, dann die Wohnung in Rom und ein Haus in der Toskana, nicht weit von Florenz. Der Fürst war fast siebzig und hatte ein krankes Herz, aber im Geschäft war er immer noch der Boss, er hatte den Vorsitz oder wie man das nennt in dem Piraneso-Parfüm-Imperium mit Niederlassungen in Rom und Florenz und Geschäften in London und New York und Paris und Amsterdam und natürlich einem in der Via Condotti, der Kidnap-Straße. Dort, in Rom, war er gerade, als es passierte, als sie die Prinzessin schnappten.«
Wer sie wann schnappte, wollte ich wissen. Es waren Kalabresen, sagte er, und ob ich wüßte, daß Kalabresen die besten Kidnapper seien? In Italien weiß das jedes Kind. Ich weiß nicht mal, was ein Kalabreser ist, am Ende so was Ähnliches wie die Gila-Krustenechse. Aber das habe ich nicht laut gesagt, ich habe gesagt, er soll weitererzählen, und Sandor hat gemeint: »Schluß für heute. Fortsetzung folgt.«
»Du solltest deine Geschichten aufschreiben«, sagte ich. »Du könntest Schriftsteller werden, Sandor.«
[19] Er machte ein trauriges Gesicht und schüttelte den Kopf. »Originalität ist nicht meine Stärke.« Und dann sagte er etwas richtig Schmeichelhaftes. Ich wäre ihm dafür am liebsten um den Hals gefallen, aber natürlich ging das nicht. »Ich wünschte, ich hätte deine Phantasie, Klein-Joe.«
Manchmal aber schreibt er doch. Briefe schreibt er. Sandor hat eine sehr schöne Schrift, mit dünnen Aufstrichen und kräftigen Abstrichen, irgendwie spitzig und sehr gleichmäßig. Ich sollte einmal Papier und Umschläge für ihn besorgen, aber er war nicht so recht begeistert von dem, was ich anbrachte. Als er den Brief geschrieben hatte, warf er ihn selber in den Kasten, und danach ging er in die Bücherei und blieb ganz lange aus. Daß er in der Bücherei war, hat er mir erzählt, aber nicht, was er da wollte.
Wir bekamen nie Post. Nein, das stimmt nicht ganz, denn manchmal, nicht sehr oft, kam ein Brief von Sandors Mutter. Sie wohnt in Norwich. Wenn so ein Brief kommt, läßt er sich Zeit mit dem Aufmachen, und sein Gesicht wird ganz ausdruckslos, wenn er liest, was sie schreibt.
»Ich bin ein schwarzes Schaf, Klein-Joe«, sagte er einmal, nachdem er einen ihrer Briefe gelesen hatte. »Einer, den sich die Familie mit Geld vom Leibe hält. Was meinst du, ob deine Leute dir was zahlen würden, damit du nicht wieder nach Hause kommst? Es käme auf einen Versuch an…«
»Sie haben kein Geld«, sagte ich, aber ich will nicht leugnen, daß sie es wahrscheinlich machen würden, wenn sie welches hätten. Wenn es Geld vom Staat geben würde, um ein schwarzes Schaf in der Familie loszuwerden – [20] Mams und Paps wären ganz fix dabei, den Fragebogen auszufüllen.
Briefe von Sandors Mutter waren die einzigen, die wir je bekamen. Wir hörten die Post kommen, gingen aber nicht extra runter, wenn wir nicht sowieso nach unten mußten. Aber nachdem Sandor seinen ersten Brief geschrieben hatte, fing er an, auf die Post zu lauern. Ich glaube nicht, daß er eine Antwort bekommen hat, aber genau weiß ich es natürlich nicht. In den nächsten Monaten schrieb er noch mehr Briefe, aber es war Mitte März, als er sagte, er würde umziehen. Nicht »wir«, sondern »er«.
»Nach East Anglia, da bin ich näher dran.«
Näher wo dran, wollte ich wissen. Sandor läßt sich nicht gern ausfragen, allenfalls über akademische Dinge, wie er es nennt. Und beim Geschichtenerzählen, wenn er eine Pause macht und die Augenbrauen ein bißchen hochzieht. Er hat’s nicht gern, wenn er einem erklären muß, was er gesagt hat, aber es ist, als wenn er trotzdem darauf wartet, daß man fragt. Er gab keine Antwort.
»Ich müßte einen Wagen haben. Wie komme ich an einen Wagen?«
»Kaufen oder klauen«, sagte ich.
»Oder leihen.« Er sah mich nachdenklich an, und in seinen Augen stand ein Lächeln. »Was ist los mit dir? Warum machst du so ein langes Gesicht?«
»Und ich?« fragte ich. »Was wird aus mir?«
»Du kommst natürlich mit.«
Damals sah ich zum ersten Mal die sonderbaren Sachen, die Sandor mit sich herumtrug, seinen Besitz, seine bewegliche Habe. Eine Plastiktüte voller Autokennzeichen und [21] einen Koffer voller Zeitungsausschnitte, das heißt, nicht nur Ausschnitte, sondern Photos und ganze Zeitschriften. Der Koffer war aufgegangen, deshalb sah ich, was drin war.
»Das geht dich nichts an.«
Da war wieder dieser rauhe, scharfe Ton, der mir so schrecklich ist. Aber er kriegte sich wieder ein, als ich den Koffer zumachte und abschloß, und erzählte mir die Geschichte vom Fürsten Lichnikoff, den sie bei einer Revolution an einen Laternenpfahl geknüpft haben. Kein Wunder, daß ich manchmal nicht weiß, was Dichtung und was Wahrheit ist. In einer alten Tasche, einer Art Aktenmappe, fand ich seinen Paß. Sandor las schon wieder und sah nicht, wie ich ihn mir anschaute. Daß er in Wirklichkeit gar nicht Sandor hieß, sondern Alexander, hat mich richtig geschockt. Der Paß hatte eine Menge Stempel, meist von Orten in Italien, aber der letzte war über vier Jahre alt.
Wir verließen London am nächsten Tag mit unserer gesamten Habe, das heißt, vor allem mit Sandors Sachen, ich habe ja so gut wie nichts. Ich war beladen wie ein Packesel – oder ein Lakai.
»Klingt wie ein Pub in Mayfair«, sagte Sandor. »Zum Lustigen Lakaien, Bruton Street, West One.«
»Ich bin ja auch lustig«, sagte ich.
Er lächelte. »Da geht’s dir besser als mir.«
Der Zug ging in der Liverpool Street ab und fuhr durch Essex. Ich bin kaum mal verreist, bin so gut wie überhaupt nicht rausgekommen. Natürlich habe ich keinen Paß, ja, ich habe nicht mal den Führerschein, aber Auto fahren kann ich natürlich, da gibt’s gar nichts. Einer wie ich läßt [22] sich nicht auf so Sachen wie Tests und Prüfungen ein, und bestehen tut er sie schon gar nicht. Es wurde schon dunkel, hier auf dem Land, obwohl es erst später Nachmittag war. Es sah grau aus, windverweht und unfreundlich.
In Colchester mußten wir umsteigen und eine halbe Stunde auf unseren Anschluß warten. »Es ist der kälteste Bahnhof in East Anglia«, sagte Sandor. »Ehrlich, das ist allgemein bekannt.«
Er erzählte mir eine Geschichte. Eine Geschichte aus Tausendundeiner Nacht, wie er sagte. Sie handelte von einem alten Mann aus dem Morgenland, der will seine Tochter vor den Männern schützen und steckt sie in eine Kiste, und die Kiste steckt er in eine Lade, und die Lade in eine große Truhe, und dann wirft er den Schlüssel zu der Truhe ins Meer. Aber sie kommt trotzdem frei, trifft sich mit ihrem Liebsten, sie gehen zusammen auf und davon, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Und die Moral von der Geschichte ist, sagt Sandor, daß du einen Menschen noch so streng bewachen kannst – wenn er wirklich weg will, schafft er es doch. Ich sagte nichts dazu, aber ich dachte bei mir, daß das wohl im richtigen Leben nicht so ganz stimmen kann, sonst wären ja die Gefängnisse so gut wie leer.
Wir warteten noch auf den Zug, als der Norwich-Expreß durchkam. Er fährt von London nach Norwich ohne Halt durch, mit ungefähr hundertsechzig Stundenkilometern. Zuerst hört man die Lautsprecherdurchsage: Achtung, Reisende auf Bahnsteig zwei, Vorsicht an der Bahnsteigkante… Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante…
Und dann kam er angedonnert. Das trifft es nicht [23] richtig, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Er raste brüllend vorbei, und der ganze Bahnhof bebte. Die Leute wichen zurück wie eine Welle, und das Erstaunliche war, daß sie sich gegenseitig anlachten, sie sahen sich an und lächelten. Sandor lächelte und ich auch. Ich weiß nicht warum, aber der Expreß hatte so etwas Sieghaftes, etwas fabelhaft Aufregendes, als ob er in diesem Wahnsinnstempo zu völlig neuen Welten auf dem Weg war und nicht in die ganz gewöhnliche, stinknormale Stadt, in der Sandors Mutter wohnt.
»Ein toller Zug«, sagte – oder vielmehr brüllte – Sandor über den Krach hinweg.
In diesem Moment kam auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig schwerfällig unser Zug angerumpelt. Der Kontrast war ein richtiger Witz, und auch darüber mußten die Leute grinsen. Sandor sah mich scharf an.
»Hat dich das an etwas erinnert, was du lieber vergessen möchtest?« fragte er.
»Nein«, sagte ich. »Keine Spur…« Aber das stimmte nicht.
[24] 2
Sandor hat mir das Leben gerettet. So haben wir uns kennengelernt.
Ich war lange Zeit ziemlich daneben. Red nicht herum, würde Sandor sagen, du warst krank. Ich war also krank, obgleich ›daneben‹ die Verfassung, in der ich damals war, besser beschreibt. Alles in allem war ich ein paar Jahre lang im Krankenhaus.
Wenn die Leute sagen, daß sie deprimiert sind, meinen sie in Wirklichkeit, daß sie sich mies fühlen, sauer sind, nicht in Form. Was eine Depression ist, davon haben sie keine Ahnung. Eine richtige Depression ist etwas anderes. Wenn du Depressionen hast, bleibt dir nichts mehr, alles fällt von dir ab – Wünsche, Bedürfnisse, Willenskraft, Anteilnahme, Hoffnung, Lust. Lust… daß ich nicht lache! Du kannst nichts mehr entscheiden, absolut nichts mehr. Ob du aufstehen sollst zum Beispiel und ins Badezimmer gehen oder nicht. Oder ob du die Tasse in die Hand nehmen und einen Schluck Tee trinken sollst oder ob du sie doch lieber sein läßt und sie nur weiter anstarrst. Bei einer Depression hast du zu nichts mehr Lust und kannst nichts mehr machen, du hast nicht mal mehr keine Lust, wenn ich das mal so sagen darf, du spürst weder Wut noch Angst noch Panik.
Und das ist noch nicht das Schlimmste. Du gerätst immer tiefer hinein. Das geht so weit, daß du keine Farben [25] mehr siehst, daß du nicht hörst, wenn die Leute mit dir reden, in deinem Kopf ist etwas, das schwappt bei jeder Bewegung, es ist Wasser, eine Spüle voll Schmutzwasser mit einer Fettschicht drauf, diese schillernden Schlieren sind die einzigen Farben, die du noch erkennen kannst, die Regenbogenschlieren auf dem Schmutzwasser, das in deinem Kopf herumschwappt.
Aber was soll ich groß darüber reden! Seit ich Sandor kenne, habe ich das nicht mehr gehabt. Dafür hatte ich andere Sachen, im Krankenhaus kriegten sie mich allmählich wieder hin. Langsam, aber sicher. Von dem, was die Seele krank macht, sind Depressionen das einzige, wogegen man was tun kann. Mit Medikamenten. Gespräche mit den sogenannten Experten, mit Therapeuten, Psychiatern und solchen Typen kannst du vergessen. Aber die Medikamente helfen wirklich. Das Dumme war, daß ich entlassen wurde, ehe die Behandlung abgeschlossen war. Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Sie hatten kein Geld mehr und mußten vier Stationen schließen.
Gesagt haben sie mir das natürlich nicht. Das mit den Einsparungen hat mir Sandor erklärt. Sie sagten, ich sei jetzt so weit, daß es nun auf mich selbst ankäme, sie hätten getan, was sie konnten, und jetzt müsse ich mir selber helfen. Mein örtlicher Sozialdienst würde mich nach besten Kräften unterstützen. Was heißt örtlich, fragte ich. Du hast doch ein Zuhause, hieß es, und Eltern, nicht? Da gehst du jetzt hin.
Komischerweise können einen Freunde und Bekannte besser leiden, wenn man ein Versager ist, wenn man nichts so richtig gut kann. Weil sie dann nämlich nicht neidisch [26] zu sein brauchen, weil sie keine Angst vor Konkurrenz haben müssen. Bei Eltern ist es genau umgekehrt. Eltern wünschen sich erfolgreiche Kinder mit besten Qualifikationen und möglichst üppigem Gehalt. Sandor sagt, das kommt daher, daß sie ihr eigenes Leben in ihren Kindern noch einmal leben und dabei natürlich gut abschneiden wollen. Er hat auch gesagt, wie man so was nennt. Irgendwas mit Sub… Substitution, glaube ich. Dich selbst kannst du nicht beneiden, und dir selbst Konkurrenz machen kannst du auch nicht. Alles gut und schön – Mams und Paps wollten mich jedenfalls nicht haben. Gesagt haben sie das natürlich nicht. Sie waren hilfsbereit und verständnisvoll bis zum Gehtnichtmehr – jedenfalls, solange die Sozialarbeiterin da war.
Ich war lange nicht mehr zu Hause gewesen. Paps hatte aus meinem Zimmer eine Dunkelkammer gemacht, und in Tillys Zimmer wohnte ein Untermieter. Ich würde auf der Couch – entschuldige, Sandor, dem Sofa – im Wohnzimmer schlafen müssen. Mich störte das nicht, ich hätte auch auf dem Fußboden geschlafen oder in der Garage. Sobald wir dann unter uns waren, redeten sie Klartext. Als sie mir das Sofa zeigten zum Beispiel.
»Das dürfte für dich reichen, Joe, bis du eine eigene Bleibe gefunden hast.«
Was meinten sie damit? Bis mir die Bank eine Hypothek bewilligt hatte? Bis ich einen Managerposten ergattert hatte und das entsprechende Haus dazu? Ich wäre zu Tilly gegangen, wenn das möglich gewesen wäre. Und wenn sie nur ein einziges Zimmer gehabt hätte, sie hätte es bestimmt mit mir geteilt. Aber Tilly und ihr Freund waren [27] mit dem Wohnwagen nach Belgien gefahren, warum, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was sie sich davon versprachen. Bei uns zu Hause wurde sie nie erwähnt. Sie war ausgezogen, um mit einem Mann zu leben, mit dem sie nicht verheiratet war, das reichte. Daß sie inzwischen zweimal den Freund gewechselt hatte und jetzt mit ihrem neuesten Typ auf einem Campingplatz hauste, das wußte Mams noch nicht mal. Sie hatte aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht.
»Wenn Matty sich entschlossen hat, ein anständiges Leben zu führen, wenn sie sich selbst wieder achten kann, mag sie zurückkommen, dann werden wir sie mit offenen Armen aufnehmen.«
Ich schluckte noch meine Pillen und geriet vielleicht deshalb nie wieder so ganz in das schlierige Wasser hinein. Ich war so deprimiert wie andere Leute, wenn sie sich dafür halten: mißgestimmt und lustlos. Ich kannte niemanden außer Mams und Paps und dem Untermieter. Meine Freunde waren alle weggezogen. Der Untermieter hatte in reifen Jahren noch mal angefangen zu studieren, ein Fach, das sich Naturopathie nannte, und behauptete, ich hätte Schizophrenie, ausgelöst angeblich durch schlechte Ernährung mit zu wenig Ballaststoffen. Ich glaube, er hatte Angst vor mir. Wenn ich ins Zimmer kam, fuhr er zusammen.
Eines Tages sagte Paps: »Ich glaube, wir sind uns alle klar darüber, daß es Zeit für dich ist, selbständig zu werden, Joe. Selbst wenn du unser eigener Sohn wärst, würden wir das sagen.« Selbst wenn du unser eigener Sohn wärst… »Für jeden Menschen kommt einmal die Zeit, [28] sich auf eigene Füße zu stellen.« Sie hätten mich nicht vor die Tür gesetzt. Wenn ich nicht gewollt hätte, hätten sie es nicht gekonnt. Sie hätten schon die Polizei holen müssen. Aber im Grunde hätte ich ihnen sogar das zugetraut.
Wenn ich ganz ehrlich bin, muß ich sagen, daß ich eigentlich nicht an Selbstmord dachte. Jedenfalls nicht so, daß ich mir vorgenommen hätte, ich mache es so und so, am Donnerstag, um die und die Zeit, ich schreibe einen Abschiedsbrief, und dann mache ich es. So nicht. Ich hatte einfach das Gefühl, daß ja doch alles hoffnungslos war, ohne jeden Sinn und Zweck, da konnte ich genausogut über die Straße gehen, ohne nach rechts und links zu schauen, oder alle meine Pillen auf einmal schlucken und dann einfach abwarten. Statt dessen bin ich abgehauen, bin am Nachmittag aus dem Haus gegangen, ohne was zu sagen, ohne zu wissen wohin, mit acht Pfund in der Tasche, mehr hatte ich nicht. Sandor sagt, ich hätte in dem Moment beispielhaft für all die Patienten gestanden, die durch den Nationalen Gesundheitsdienst zu Bettlern geworden sind, weil der sie aus den Nervenkliniken rausgeworfen hat.
Es war November und sehr kalt. Schon bald tat es mir leid, daß ich nicht den Mantel von Paps mitgenommen hatte, der in der Diele am Garderobenständer hing. Paps war im Regenmantel mit eingeknöpftem Futter zur Arbeit gegangen. In unserer Familie zieht man die Wintersachen erst im Dezember an und nicht vor Mai wieder aus, das ist eine eiserne Regel. Ich wünschte, ich hätte den Mantel mitgenommen, aber jetzt konnte ich nicht zurück. Ich wußte nicht wohin, mir fiel niemand ein, bei dem ich hätte [29] unterkriechen können. Am besten suche ich mir ein paar Leute, denen es gegangen ist wie mir, dachte ich, und tu mich mit ihnen zusammen.
Am Embankment fand ich welche. Keiner sagte was zu mir. Sie bereiteten sich auf die Nacht vor, wickelten sich in Zeitungen und alte Mäntel und manche in Decken. Eine verschrumpelte Alte kroch in einen Pappkarton, in dem mal eine Spülmaschine gewesen war. Ich war fürs Kampieren im Freien nicht ausgerüstet und überlegte, ob ich woanders hin sollte, aber mir fiel nichts ein. Die Kälte war das Schlimmste. Ich zog alles an, was ich in meinem Rucksack hatte, aber es war nicht genug. Irgendwann in der Frühe kaufte ich mir eine Tasse Tee und ein Plunderstück in einer Zellophanhülle, die ich nicht aufkriegte, weil meine Finger so klamm waren. Schließlich mußte ich das Ding mit den Zähnen aufreißen.
Als der U-Bahnhof Embankment aufmachte, um fünf oder sechs, ich hatte keine Uhr und wußte deshalb nicht genau, wie spät es war, ging ich rein, weil ich mir sagte, da ist es wärmer. Komisch, wäre ich zur Northern Line gegangen, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier, sondern mausetot. Ich entschied mich für die Circle Line, weil das eine Ringbahnlinie ist, man kann den ganzen Tag im Zug sitzen und im Kreis rumfahren, alles für eine 60-Pence-Fahrkarte, die ich aus dem Automaten zog. In dem Moment dachte ich noch nicht daran, mich umzubringen, ich überlegte mir was anderes. Wenn ich ein paarmal über die Kensington High Street und Paddington und Faringdon und Liverpool Street und Temple zurück zur Kensington High Street gefahren bin, dachte ich mir, ist mir bestimmt [30] wärmer, dann kann ich was unternehmen. Beispielsweise jemand beklauen, dann nehmen sie mich fest, und ich hab für die nächste Nacht ein Dach über dem Kopf, in einer Zelle.
Schön, für eine Nacht vielleicht, aber dann? Dann stellen sie mich vor Gericht und brummen mir eine bedingte Entlassung auf oder Bewährung und schicken mich wieder zu Mams und Paps. Garantiert sicher kommst du heutzutage nur dann ins Gefängnis – und nicht mal darauf ist immer Verlaß –, wenn du einen umbringst. Inzwischen stand ich auf dem Bahnsteig. Viel Betrieb war nicht, es war noch zu früh.
Ein Zug kam, acht oder neun Leute, die gewartet hatten, stiegen ein, ich nicht. Ich war allein. Was ist, wenn ich einen unter den nächsten Zug stoße? Ich hatte auf einer Bank gesessen, unter einem dieser Fahrpläne, von denen man den ersten und den letzten Zug ablesen kann, aber jetzt stand ich auf und trat dicht an die Bahnsteigkante. Ich war sechs Zentimeter von der Kante entfernt, einen knappen Meter vor der Tunnelöffnung.
Jemand kam auf den Bahnsteig. Ich drehte mich um. Ein Mann, einige Jahre älter als ich, dunkel, dünn, ein hohles Gesicht, ein raubgieriges Gesicht, schwarze, hungrige Augen. Kann ich das alles damals wirklich gesehen haben? Er hatte Jeans an und eine Jeansjacke mit schmutzigem Lammfellfutter. Es wäre schön, wenn ich sagen könnte, ich hätte sofort gewußt, was er mir bedeuten würde, ich hätte sofort meinen besten Freund in ihm erkannt, aber das stimmt so nicht. Ich dachte nur, daß dieser Mann ein Zeuge sein würde.
[31] Inzwischen war meine Stimmung umgeschlagen. Die Bahnsteigkante lockte mich, die schwarze Öffnung des Tunnels zog mich an, ich zitterte beim Anblick der Ampel, die auf Grün stand. Noch hörte ich nichts, spürte keinen Luftzug, aber ich wußte, der Zug würde in… ja, in etwa dreißig Sekunden würde der Zug da sein. Ich schurrte mit den Füßen vorwärts, auf die Kante zu. Ich dachte daran, wie das sein würde, wenn Mams und Paps es erfuhren, und empfand makabre Freude bei der Vorstellung. Wie es sein würde, wenn Tilly es erfuhr, daran mochte ich nicht denken. Meine Füße ragten jetzt über die Kante hinaus, Ballen und Zehen zeigten ins Leere.
Ich lehnte den Körper ein bißchen nach vorn. Mein Kopf hing nach unten. Den Rucksack hatte ich auf dem Bahnsteig abgestellt. Einen anderen Menschen kann ich nicht umbringen, dachte ich, aber mich selbst könnte ich umbringen. Nur das, wohlgemerkt, weiter war ich nicht gekommen. Nicht so weit, daß ich gesagt hätte, ich mach es, ich bring mich um, das war’s, leb wohl, schöne Welt, ich stellte mir nur vor, wie Mams heulend sagen würde, er war schon immer labil, und Paps würde sagen, er hat eben keinen Mumm in den Knochen.
Sandor sagt, ich hätte Selbstmord begehen wollen. Ich will nicht mit ihm streiten. Er weiß es sowieso am besten, er weiß alles besser als ich, er ist schließlich gebildet. Ich habe mich inzwischen gebessert, weil er mir einiges beigebracht hat, aber damals hatte ich von gar nichts eine Ahnung und wußte nie so richtig, was ich eigentlich tat. Sandor hat deshalb sicher recht, wenn er behauptet, daß ich drauf und dran war, mich vor einen Zug zu werfen. Ich [32] kann dazu nichts sagen, an diesem Punkt ist meine Erinnerung ganz nebelhaft. Was meine Gedanken angeht, meine ich. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe oder was ich vorhatte, ich weiß nur, daß ich dastand, die Füße halb über der Bahnsteigkante, den Körper nach vorn geneigt.
Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis der Zug kam. Ich spürte den Windstoß, der mir in die Haare fuhr. Ich hörte den Zug im Tunnel rumpeln. Die Lichter sah ich nicht, ich schaute nicht hin. Der Lärm, mit dem er näherkam, machte sich in meinem Kopf breit, vielleicht war da kein Platz mehr für Gedanken, die hatte der Zug vertrieben, der jetzt angedonnert kam. Daß Sandor hinter mir war, hörte ich nicht, ich hörte nur den Zug. Sandors Atem war heiß in meinem Nacken, und seine Hände lagen warm um meine Taille; seit ich ein Kind war, hatte ich keine solche Wärme mehr gespürt. Sie waren hart wie glühende Eisen und packten mich und zogen mich zurück, und ich fiel hin und rollte herum, und wir kollerten zur Wand, während der Zug aus dem Tunnel hervorbrach.
Ein, zwei Leute stiegen aus, sie hielten uns sicher für Betrunkene. Wir standen auf, und ich holte meinen Rucksack, und wir setzten uns auf die Bank. Wir sahen uns an, ohne Lächeln, wir schauten uns nur an, mit ganz großen Augen. Das schlierige Wasser schwappte in meinem Kopf und gluckste noch mal und verschwand gurgelnd durch ein Abflußloch in meinem Gehirn, damit war ich es los, und da, wo es geschwappt hatte, war alles sauber.
»Wer bist du?« fragte er. »Was treibst du hier, mal abgesehen davon, daß du dich gerade umbringen wolltest?«
[33] Ich sagte ihm, wer ich war. Ich erzählte ihm eine Menge von mir, leise und langsam, den Blick auf meine Hände gerichtet. Als ich zu der Sache mit der Couch kam (damals hat er mich noch nicht korrigiert und gesagt, daß es Sofa heißt) und wie sie meinten, es wäre ja nur vorübergehend, fing ich an zu weinen.
»Am besten kommst du mit zu mir«, sagte er, und dann, als der nächste Zug kam und wir eingestiegen waren: »Ich habe dir das Leben gerettet, deshalb gehört dein Leben jetzt mir.«
»Ist gut«, sagte ich.
[34] 3
Tilly ist nicht meine richtige Schwester. Genau genommen ist niemand so richtig irgendwas von mir. Mams ist nicht meine richtige Mutter und Paps nicht mein richtiger Vater und Sandor nicht mein richtiger Freund. Irgendwo habe ich richtige Eltern, das heißt, ich habe ihr Blut und ihre Gene und all das, ihr Sex hat mich gemacht, und ich weiß, wie sie heißen, das ist alles kein Geheimnis, aber wenn sie mir auf der Straße begegnen würden, dann würden sie mich nicht erkennen und ich sie auch nicht. Mit vier bin ich weggekommen, und bei Mams und Paps bin ich gelandet, als ich sieben war. Da hatten sie schon Tilly, die hatten sie im Jahr davor in Pflege genommen, als sie elf war.
Es klingt kitschig, es klingt nach einem dieser Hollywoodfilme aus den dreißiger Jahren, die sie nur wegen der Kinderstars gedreht haben, aber es stimmt wirklich: Wenn man zwei Kinder auf diese Weise zusammenbringt, haben sie sich lieb, weil sie sonst niemanden haben, den sie liebhaben können. Mams hat uns nie angerührt. Nicht nur, daß sie uns nie einen Kuß gegeben hat, das versteht sich von selbst, nein, sie hat auch nie was Nettes zu uns gesagt, nicht ein einziges Mal hat sie uns ›Schätzchen‹ genannt, uns gelobt oder diesen Schmus gesagt, den man eigentlich von Pflegeeltern erwartet, daß sie sich für uns entschieden und uns zu sich genommen haben, weil sie uns [35] haben wollten. Ich will nicht behaupten, daß sie uns nie mit Vornamen angesprochen hätte, es kam vor, wenn auch sehr, sehr selten. Wenn sie einen von uns rufen mußte und wenn es sonst gar nicht anders ging. Sie war sachlich, frostig, sehr pflichtbewußt. Wir waren da, weil es ihre Pflicht war.
Paps ging arbeiten und kam nach Hause und guckte fern, er ging ins Wettbüro und zum Angeln, er ging schlafen und stand auf und ging arbeiten. Manchmal spielte er uns Streiche, legte uns einen toten Frosch ins Bett oder stellte mir ein rohes Ei in den Eierbecher. Der 1.April war immer ein Alptraum. Aber er rührte uns nie an. Weder im Bösen noch im Guten. Er hat Tilly nie auf seinen Knien sitzen lassen. Nur einmal, beinah. Er las irgendwas, und sie sah ihm über die Schulter, lehnte sich irgendwie an ihn, und er streckte den Arm aus, um sie auf den Schoß zu nehmen. Da war sie ungefähr zwölf. Mams packte Tilly am Arm und zog sie weg und zischelte Paps etwas zu, was ich nicht mitkriegte. Damals hatten wir all die Sachen über den sexuellen Mißbrauch von Kindern noch nicht gehört, aber wahrscheinlich dachte sie an so was.
Ich habe noch Erinnerungen an meine richtige Mutter. Sie war nicht mit meinem Vater verheiratet, auch das versteht sich eigentlich von selbst. Ich kann mich auf verschiedene Männer besinnen, einer von ihnen mag mein Vater gewesen sein. Der, der so viel rauchte und manchmal mit mir redete? Ich glaube nicht, daß mich meine Mutter jemals geschlagen hat oder so, aber sie sperrte mich den ganzen Tag in unserem Zimmer ein, während sie zur Arbeit ging, und zum Schluß bin ich dann von ihr [36] weggekommen. Joseph heiße ich, weil sie Irin war und katholisch. Tilly heißt eigentlich Matilda. Es war typisch für Mams und Paps, daß sie bei ihnen nicht Tilly heißen durfte, weil das die ungewöhnliche, die unübliche Abkürzung für Matilda war, und Unübliches war bei uns verpönt, man machte keine Sachen, mit denen man aufgefallen wäre. Und deshalb hatten die beiden sie Matty genannt, das heißt, Namen fielen bei uns so gut wie gar nicht, aber wenn es denn sein mußte, hieß sie eben Matty.
Als ich älter wurde und hörte, daß man sie zu Hause Tilly genannt hatte, nannte ich sie auch so. Mams hat mir das nie verziehen. Sie führte sich auf, als ob ich ein Ladendieb gewesen wäre oder ein Gotteslästerer oder als ob ich einer alten Frau eins über den Kopf gegeben hätte. Wenn ich Tilly zu Tilly sagte, fuhr Mams mich an, halt gefälligst den Rand, wehe, du sagst das noch mal, und dann redete sie stundenlang kein Wort mehr mit mir.
Wenn mich jemand fragt, wo ich geboren und aufgewachsen bin, sage ich London. Wenn du das zu einem Ausländer sagst, denkt er an den Hyde Park oder den Post Office Tower. Die meisten Leute, die in einem Vorort aufgewachsen sind, kennen London überhaupt nicht, sie kommen das ganze Jahr nicht hin. Das heißt, sie kommen einmal im Jahr kurz vor Weihnachten hin, sie gehen in eine Kinderrevue oder in die Mausefalle und zum Einkaufen in die Oxford Street.
Sandor zeigte mir London, wie es wirklich ist. Wir sahen uns alles mögliche an, nicht nur Kaufhäuser mit Parfümabteilungen, wir besichtigten Sachen, von denen ich gehört, die ich aber nie gesehen hatte, und manchmal [37] überlegte ich, ob wir wohl, weil es auf Weihnachten zuging, Mams begegnen würden, aber wir trafen sie nie. Auch Tilly liefen wir nicht über den Weg, obgleich ich immer darauf hoffte. Das flache Land, wo wir jetzt sind, war für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Landschaft kannte ich nur vom Fernsehen, aus den Tierfilmen. Die haben dich ganz irre gemacht, sagte Sandor. Wenn du über einen Landweg in Suffolk gehst, erwartest du jeden Augenblick, daß ein Rhinozeros aus den Büschen bricht, und eine Kuh, die über ein Gatter schaut, ist für dich die Vorhut einer flüchtenden Buffaloherde.
Inzwischen wohnen wir im Railway Arms, in einer Kleinstadt. Man sollte denken, daß ein Gasthaus, das nach der Eisenbahn genannt ist, am Bahnhof liegen müßte, aber der ist mindestens einen Kilometer weit weg. Vielleicht war hier früher mal ein Bahnhof. Wir gingen zu Fuß, mit all unseren Sachen. Er hat das Railway Arms ausgesucht, sagt Sandor, weil es so gar nichts Wohlanständiges an sich hat, und das ist eine der seltsamsten Begründungen, die ich je gehört habe. Wir waren an ein, zwei Häusern vorbeigekommen, die Bed and breakfast anboten, Bungalows mit hübschen Gärten und blanken Türklopfern aus Messing. Das mag hier zwar alles ländlich-sittlich sein, sagte Sandor, aber die Häuser könnten genausogut in irgendeinem öden Vorort stehen. Daß man in den Railway Arms auch wohnen kann, merkte man nur daran, daß im Fenster vom Schankraum ein Stück Pappe stand. Zimmer stand drauf. Nicht Zimmer zu vermieten oder Zimmer frei, wo man ja auch nie weiß, wie viele es sind, und als wir reingingen, stellte sich heraus, daß sie nur das eine Zimmer hatten.
[38] Es war spät geworden, und ich hatte Hunger. Sandor hielt sich an seine Zigaretten, von denen wird er satt, und ich ging nach unten und kaufte, was sie gerade hatten, zwei »Teigtaschen nach Hirtenart« – dabei gibt es hier bestimmt weit und breit keine Hirten –, zwei Tüten Kartoffelchips und ein getoastetes Sandwich, das schon so oft in der Mikrowelle gewesen war, daß es aussah, als hätte es schon einen Durchgang im Krematorium hinter sich. Als ich wieder nach oben kam, lag er auf dem Bett. Die Tagesdecke war wieder einer dieser gewebten Lappen in der bewußten Farbe, rosagrau, wie in Shepherd’s Bush.
»Vielleicht kriegt man sie in einem Laden zu kaufen«, sagte ich. »In einem Laden für behinderte Möbel. Spezialität Tische mit amputierten Beinen.«
Er lachte und sagte wieder was von meiner Phantasie. Aber es klang nett, nicht von oben herab. »Heute erzähl ich dir was von einem Laden ganz anderer Art«, sagte er. »Oder einer anderen Sorte von Ladenbesitzer.«
Die erste Fortsetzung von dem Fürsten und seiner Prinzessin also. Er klopfte aufs Bett, und ich setzte mich neben ihn und legte ein bißchen später auch die Füße hoch, aber dabei paßte ich auf, daß ich ihm nicht zu nahe kam, und noch mehr, daß meine Hände sich nicht selbständig machten. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, aber draußen war alles pechschwarz, ein schwarzer Himmel, darunter, noch schwärzer, ein Hang mit vielen kleinen Lichtpünktchen drauf. Ich breitete die Zeitung zwischen uns aus, als Unterlage für die Eßsachen, und machte die Chipstüten auf. Sandor zündete sich eine Zigarette an.
»Ihr Landhaus stand in einem Ort, der Rufina hieß«, [39] sagte er. »Eine Gegend mit lauter grünen, bewaldeten Hügeln. Nicht wie hier, ganz und gar nicht wie hier. Sie haben dort Oliven und Zypressen, und die Berge sind hohe, runde Kuppen. Im Tal liegt eine kleine Stadt mit einem Bahnhof, da kommt der Zug nach Florenz durch. Die Villa hieß I Falci, das bedeutet die Falken. Wenn in Florenz der Nebel hing und die Stadt grau und düster war, schien in I Falci, hoch über den Wolken, die Sonne.
Dort wohnte die Prinzessin, wenn der Alte in Rom und Mailand war. Sie hatte zwei Dienstboten zur Gesellschaft und den Trüffelhund. Der Trüffelhund war ein brauner Spaniel, den hielten sie zum Ausgraben von Trüffeln in den Wäldern.«
»Ich denke, Trüffel sind das Zeug, das in Pralinen ist«, sagte ich.
Diesmal hätte ich nicht unterbrechen dürfen. »Himmel noch mal, das darf ja nicht wahr sein…«, stieß er hervor. Ich sagte nichts. Ich lerne es schon noch, es dauert nur eine Weile. »Wo war ich stehengeblieben? Ja, richtig. Natürlich fuhr sie ab und zu weg. Nach Florenz eigentlich weniger. Mit Florenz ist das so eine Sache, die Leute, die dort in der Umgebung wohnen, können Florenz nicht ausstehen und fahren nie hin, während die Touristen aus aller Welt von der Stadt nicht genug kriegen können. Manchmal besuchte sie ihre Nachbarn, sie hatte Freunde in Rufina. Eines Tages fuhr sie den Hang herunter, auf dem die Villa steht, es ist eine kurvenreiche Straße, die sich um die Kuppe herumschlängelt, und plötzlich sah sie vor sich einen Wagen quer über der Fahrbahn stehen.
Ich weiß nicht, ob sie Verdacht schöpfte. Sie war keine [40] Italienerin, vielleicht hatte sie es noch nicht begriffen. Sie sah nur, daß sie nicht vorbeikam, und legte den Rückwärtsgang ein, um zu wenden und zurückzufahren, da tauchte ein zweiter Wagen hinter ihr auf und schnitt ihr den Weg ab. In dem vorderen Wagen saß ein Mann, in dem Wagen hinter ihm saßen zwei. Sie fesselten die Prinzessin, und einer meinte, man sollte sie in den Kofferraum stecken. Sie hatten eine lange Fahrt vor sich, sie wollten nach Rom, und die Prinzessin sollte ihre Gesichter nicht sehen. Bisher hatten sie deswegen die Pullover bis zu den Augen hochgezogen.
Es waren zwei Italiener und… ein Ausländer. Die Italiener waren Vater und Sohn, der Jüngere war Medizinstudent. Er löste das Problem, indem er der Prinzessin eine Spritze in den Arm gab, die sie für die nächsten vier Stunden außer Gefecht setzte. Sie waren alle keine Profi-Kidnapper, sondern Amateure, und Amateure sind viel gefährlicher, weil sie keine Erfahrung haben und nicht wissen, welche Lösegeldsummen in einem bestimmten Gebiet üblich sind, und weil sie viel leichter in Panik geraten, wenn was schiefgeht. Wenn Kidnapper in Panik geraten, bringen sie ihre Opfer um.
Sie waren, wie gesagt, keine Profis, aber sie hatten sich in Sachen Entführung sachkundig gemacht, sie hatten die Zeitung gelesen, einer hatte unter dem Vorwand, einen Artikel schreiben zu müssen, über Kidnapping recherchiert. Sie wußten beispielsweise, daß die Lösegeldsumme, die sie mit einiger Aussicht auf Erfolg würden fordern können, 800 bis 900Millionen Lire betrug.«
»Wieviel ist das in Pfund?« fragte ich.
[41] »Vier- bis fünfhunderttausend. Aber noch hatten die Verhandlungen gar nicht angefangen. Sie brachten die Prinzessin in ein Haus etwa 30km vor Rom, das hatten sie über eine Ferienhausagentur gemietet, im Wohnzimmer hatten sie ein Zelt aufgestellt. Sie hat das Haus, in dem sie festgehalten wurde, nie zu Gesicht bekommen, auch nicht das Zimmer. Sie sah nur die Innenseite des Zelts.«
Was sie daran gehindert hätte, vor das Zelt zu gehen, wollte ich wissen. Ein sonderbarer Ausdruck ging über sein Gesicht. Es war, als müßte er etwas sagen, was er nicht gerne sagte, was sich aber nicht verschweigen ließ. Er hielt mit den Zähnen die Unterlippe fest und hob ganz leicht die Schultern.
»Sie war an die Wand gekettet«, sagte er. Es gab eine kleine Pause, das mußte ich erst verdauen. »Es war eine lange Kette, ein Ende war an einem Fußring befestigt, das andere an einem senkrechten Balken am Kamin, sie lief unter der Zeltwand hindurch. Es war keine straffe Kette.« Sandor sah mich scharf an. Irgendwie schien ihm sehr viel daran zu liegen, daß ich ihm das mit der Kette abnahm. »Sie war gute drei Meter lang und nicht schwer, sie hat ihr nicht weh getan. Nach der Fahrt, auf der sie fast die ganze Zeit bewußtlos war, hat sie ihre italienischen Entführer nicht zu Gesicht bekommen, allerdings später oft sprechen hören. Gesehen hat sie nur den Ausländer, und eine Weile auch den nur in Maske und Kapuze.
Ehe sie wieder zu sich kam, schnitt ihr der ältere Italiener die Fingernägel ab. Sie hatte sehr lange, hellgolden lackierte Fingernägel. Er schnitt sie ihr so kurz, wie ein [42] Kind sie tragen würde oder ein sehr machomäßiger Mann, und schickte die Schnipsel dem Fürsten Piraneso.«
»War das die erste Nachricht, die er bekam?« fragte ich.
»Nein, natürlich nicht. Es wäre ja sinnlos gewesen, ihn in Unkenntnis zu lassen. Der jüngere Italiener hatte mit ihm telefoniert, er hatte ihm gesagt, daß sie seine Frau festhielten und daß er einen Beweis dafür bekommen würde. Das war also der Beweis. Natürlich kein Beweis dafür, daß sie noch lebte.« Er schwieg, und ich mochte nichts sagen. Ich sah, wie seine Finger seltsam mechanisch über die Bettdecke wanderten und nach einer Zigarette griffen. »Schluß für heute, Klein-Joe«, sagte er. »Ich bin müde, und morgen haben wir allerlei vor.«
Was das sein würde, darüber ließ er sich nicht aus, aber am nächsten Tag ging er allein los, und ich bekam einen Auftrag. Ich sollte in die Stadtbücherei gehen und nachsehen, ob sie ein Buch hatten, das Häuser in Suffolk hieß, den Namen von dem Mann, der es geschrieben hat, habe ich vergessen, aber es ist ein berühmter Architekt. Wenn ja, sollte ich mich in der Stadtbücherei als Leser anmelden, das Buch ausleihen und mitbringen und ein Haus namens Jareds darin suchen.
Ich fand das Buch, aber sie wollten mir keinen Leserausweis geben, weil ich keinen festen Wohnsitz am Ort hatte und auch nicht fest angestellt war. Ich setzte mich an einen Tisch und suchte in dem Buch nach Jareds, fand es aber nicht. Ich fing gerade noch einmal von vorn an, als die Pächterin von unserem Gasthaus, den Railway Arms, an den Tisch kam und mich begrüßte. Das Ende vom [43] Lied war, daß sie mir ihren Leserausweis lieh und ich das Buch mitnehmen durfte.
Um fünf war Sandor wieder da. Er war bei seiner Mutter gewesen und mit ihrem Wagen zurückgekommen. Mit einem ihrer Wagen, einem kleinen grauen Fiat.
»Den hat sie dir geschenkt?« fragte ich. Wenn jemand mir erzählt, daß seine Eltern ihm was geschenkt oder ihm sonst eine Freude gemacht haben, kann ich das nie so recht glauben – nicht mal Sandor.
Er warf mir einen seiner schrägen Blicke zu. »Ich hab ihn mir einfach genommen, Klein-Joe.«
»Sie weiß demnach gar nicht, daß du ihn hast?«
»Jetzt wird sie’s wohl wissen. Aber sie wird nichts unternehmen. Ich meine, vielleicht macht sie ein bißchen Theater, aber sie weiß ja nicht, wo ich bin. Sie denkt doch, ich bin noch in Shepherd’s Bush. Schau nicht so kläglich drein, sie hetzt mir schon nicht die Polizei auf den Hals. Immerhin bin ich ihr einziger Sohn.«
Er hatte wohl vergessen, daß ich nicht die angenehmsten Erinnerungen an das habe, was Eltern mit einzigen Söhnen anstellen können. Ich zeigte ihm das Buch. Jareds steht aber nicht drin, sagte ich. Er zündete sich eine Zigarette an. Dann blätterte er das Buch sehr sorgsam durch. Es waren große Farbphotos von riesigen alten Häusern drin und kleine Schwarzweißphotos von riesigen alten Häusern und Photos von Fenstern und Türen und dekorativem Schnickschnack. Sandor sah sich die Bilder an.
»Aha!« sagte er und schob mir das Buch hin.
Das Bild, auf das sein Daumen deutete, zeigte nicht eigentlich ein Haus, sondern den Weg zu einem Haus, eine [44] lange, gerade Auffahrt mit hohen Mauern auf beiden Seiten und dicken Bäumen dahinter. Die Bildunterschrift – mein neues Wort für den Tag – lautete: Die erstaunlichen Mauern und die Auffahrt zu Atherton Hall, die sogenannte Flintallee. Am Ende dieses Korridors ohne Dach konnte man gerade noch ein Haus erkennen, es sah ziemlich großartig aus, wie die Häuser in London an der Mall und im Regent’s Park, es hatte hohe Fenster und Säulen mit Schnörkeln und Blättern.
»Lies vor«, sagte Sandor. »Nicht die Bildunterschrift. Den Text.«