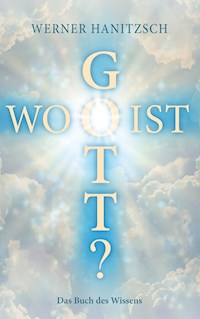Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Februar 1945: Wie durch ein Wunder überlebt Werner Hanitzsch als junger Mann von 16 Jahren den Luftangriff auf Dresden. In den letzten Monaten an der Front wird der beste Freund vor seinen Augen von einer Granate zerfetzt. Der Krieg selbst "heilt" den Autor vom Krieg und vom Glauben an die Nazi-Ideologie. In einem Flüchtlingszug kehrt er nach Dresden zurück. Nachkriegszeit: Zwei gescheiterte Fluchtversuche in den Westen und Gründung einer Firma fiir Schaltmontagen im Osten, Auslandsreisen nach Ägypten. Der Alltag des Autors ist geprägt von Spitzeleien, dem Kampf mit der Bürokratie, Unannehmlichkeiten aller Art. - Das Ende der DDR in den achtziger Jahren ist der Anfang eines "neuen" Lebens. Nach dem Mauerfall, der Währungsunion und der Vereinigung der "Deutschländer" zieht Hanitzsch mit seiner Familie nach Köln. Nun dokumentiert er seine Erfahrungen mit drei verschiedenen Gesellschaftssystemen. Werner Hanitzsch wurde 1929 in Dresden geboren. Seine Ausbildung und Erziehung fand im Nationalsozialismus des Dritten Reiches statt, was zunächst sein Verhalten im Zweiten Weltkrieg prägte. Mit 16 Jahren erlebte er als DRK-Helfer den Untergang seiner Heimatstadt und anschließend als Panzerjäger der Deutschen Wehrmacht den Untergang Hitler-Deutschlands. Nach den Wirren der Nachkriegszeit gründete er in der DDR zweimal einen eigenen Betrieb. Den ersten schluckte der Sozialismus, und der zweite ging mit der DDR unter. Die Ausbildung des Autors im Anschluß ein Studium an der Fachschule für Energie Zittau zu einem Hygiene- und Sterilisationstechniker erfolgte auf autodidaktischem Wege. Sein Leben führte ihn durch drei vollkommen unterschiedliche Gesellschaftssysteme mit allen nur denkbaren Höhen und Tiefen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1941 bis 1945 Meine ersten Berührungen mit dem Krieg
1945 Kriegsende
1945 bis 1949 Die Nachkriegszeit in der Ostzone und den Westzonen
1949 bis 1990 Mein Leben in der DDR
Abschnitt I – 1949 bis 1958
Abschnitt II – 1958 bis 1974
1990 bis 1993 Mein Leben in der Bundesrepublik Deutschland und Eintritt in den Ruhestand
Vorwort
Wie war das denn damals...? Oft wird man so oder ähnlich nach den Geschehnissen vergangener Zeiten gefragt.
Es gibt Ereignisse in den Zeitläuften, welche die Menschen, die sie erleben, nachhaltig prägen. Es ist sehr wichtig und auch sehr interessant, solche Ereignisse für alle Zeiten und für die Nachwelt festzuhalten.
Mein persönliches Leben ist auf Grund der Wirren in drei total unterschiedlichen Gesellschaftssystemen der Jahre von 1940 bis 1993 sehr turbulent verlaufen. Der Nationalsozialismus, der Krieg, der „real existierende Sozialismus der DDR" und der freiheitliche Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zusammenbruch der DDR haben mein Leben geprägt.
Ein Teil dieser Turbulenzen soll in diesem Buch zu neuem Leben erweckt werden, um den nachfolgenden Generationen aufzuzeigen, wie die Menschen in diesen Zeitabschnitten der Deutschen Geschichte lebten.
Ich wurde am 7.2.1929 in Dresden geboren. Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges im September 1939 hatte für mich als damals zehnjähriger Hitlerjunge keine Bedeutung. Dies änderte sich schlagartig, als ich mit den ersten Auswirkungen des Krieges konfrontiert wurde.
1941 bis 1945 Meine ersten Berührungen mit dem Krieg
Als im September 1939 der Krieg ausbrach, war ich gerade 10 Jahre alt. Ich war Hitlerjunge und im „Jungvolk" organisiert. Ich bekenne freimütig, daß ich ein begeisterter und überzeugter Hitlerjunge war. Hitler hatte Autobahnen gebaut, die Arbeitslosen so gut wie abgeschafft, und mein Vater hatte sich von seinem sehr bescheidenen Einkommen ein Auto kaufen können. Zuhause hatten wir ein Radio, einen Volksempfänger (im Volksmund „Goebbelsschnauze" genannt). Diese ersten Symbole eines gewissen bürgerlichen Wohlstandes sowie die entsprechende Erziehung in der Schule und der Jugendorganisationen Hitlers hatten ihren Einfluß auf mich und viele andere nicht verfehlt. Damit erhielt ich meine erste Prägung.
Ich mußte erst sehr schlimme persönliche Erfahrungen sammeln, bis mir klar wurde, wie schlimm eigentlich dieser Weg war und was Hitler für ein Verbrechen an der Menschheit begangen hat.
Als die Meldung vom Ausbruch des Krieges mit Lautsprecherwagen durch die Straßen Dresdens gefahren wurde, saß ich auf einer Strohfeime und aß geklaute Äpfel. Die Meldung berührte mich nicht im geringsten. Erstens war ich, wie schon erwähnt, ein ganz überzeugter Hitlerjunge, der nach dem Motto „Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und treu wie Gold" erzogen wurde, und zweitens hatte ich überhaupt keine Erfahrung oder Vorstellung, was Krieg eigentlich bedeutet.
Ich war das dritte Kind meiner Eltern Walther und Johanne Hanitzsch. Vater, ein gelernter Dreher, arbeitete als Handelsvertreter für Büroartikel bei der Fa. Hans Neuhaus in Hamburg. Mutter arbeitete als Lampenschirmnäherin zu Hause. Wir lebten in bescheidenen, aber glücklichen Verhältnissen in Dresden-Altstadt 27 (Plauen), auf der Planetastraße 9, in der dritten Etage.
Meine Eltern waren Mitglied des Naturheilvereins Dresden und hatten dadurch verbilligte Jahreskarten für das Luftbad Dölzschen, welches zum Naturheilverein gehörte. Dort besaßen wir eine kleine Umkleidekabine, etwa in der Größe 1,2 x 1,2 m. In diesem kleinen Raum bewahrte Mutter einen Petroleumkocher und diverses Küchengeschirr auf. Den ganzen Sommer über spielte sich unser Leben am Tage überwiegend im Luftbad ab. Von der Schule weg ging ich direkt dahin. Mutter hatte auf ihrem kleinen Kocher schon ein lekkeres Essen vorbereitet. Ich fühlte mich behütet und war sehr glücklich.
In den Wintermonaten verbrachte ich den überwiegenden Teil meiner freien Zeit auf Skiern im Bienertpark, welcher sich unmittelbar hinter unserem Haus befand.
Für diese sorglose Kindheit bin ich meinen Eltern mein ganzes Leben lang unendlich dankbar.
Animiert durch meinen gleichaltrigen Vetter Günter Baumgart, erlernte ich für die Hausmusik das Spiel der Konzertzither.
Mein Taschengeld, welches 10 bis 20 Pfennige pro Monat betrug, sowie kleine Entgelte für Dienstleistungen sparte ich fleißig auf, um mir von Zeit zu Zeit in dem Zauberladen „Manfredo" auf der Frauenstraße in der Nähe vom Altmarkt Dresden einen kleinen Zaubertrick zu kaufen. Es faszinierte mich, mit Gegenständen zu hantieren, welche der Zuschauer nicht sah, bzw. Gegenstände verschwinden und erscheinen zu lassen.
Es dauerte nicht lange und die ersten Folgen des Krieges wurden spürbar. Einzelne Rationierungen wurden vorgenommen, Lebensmittelmarken wurden eingeführt. 1941 wurde mein Vater im Alter von 40 Jahren eingezogen. Ein Jahr später, im Alter von 21 Jahren, mein Bruder Walter. Damit kamen die ersten Sorgen wegen des Krieges in unser Haus.
In unserer Schule wurden evakuierte Kinder aus Köln und Düsseldorf einquartiert, da dort bereits massive Luftangriffe stattfanden. Während dieser Zeit mußten wir eine andere Schule besuchen.
Da die Krankenhäuser und Kliniken mit Verwundeten ständig überfüllt waren, wurden größere Villen in provisorische Lazarette umfunktioniert. Durch Zuf all sah ich eines Tages vor einem solchen Lazarett die Ankunft von mehreren schwerverwundeten Soldaten. Der Anblick der leidenden Soldaten in ihren zerfetzten Uniformen hat mich sehr nachhaltig beeindruckt. Allerdings war ich noch nicht in der Lage, diese Erfahrung richtig einzuordnen und umzusetzen. Vielmehr entwickelte sich in mir ein sinnloser Haß gegen unsere „Feinde".
Mit meinem Vetter beriet ich, wie wir evtuell. helfen könnten. Was könnten wir tun, um die Situation zu entspannen? Mit unseren 12, 13 Jahren hatten wir nicht sehr viele Möglichkeiten. Schließlich entschlossen wir uns, unsere Helden, die verwundeten Soldaten, mit unseren bescheidenen Künsten zu unterhalten, um sie etwas aufzuheitern. So meldeten wir uns eines Tages einfach in dem Interimslazarett auf der Bernhardstraße in Dresden-Plauen und baten darum, vor den Verwundeten auftreten zu dürfen. Man bewilligte uns das sehr gern und sofort. Wir stellten uns ein kleines Programm zur Unterhaltung der Soldaten zusammen. Gemeinsam trugen wir ein kleines Zitherkonzert vor, und zwischendurch zeigte ich ein paar kleine Zaubertricks. Unser Vortrag wurde mit großer Begeisterung aufgenommen und mußte des öfteren wiederholt werden. Wir waren sehr stolz, einen kleinen, wenn auch sehr geringen Beitrag zur Stärkung unserer Soldaten erbringen zu können.
Nach meiner Konfirmation im April 1943 mußte ich Dresden vorübergehend verlassen. Ich war im Landdienst der HJ und lag in Miltitz-Roitzschen, in der Nähe von Meißen. Man wollte mich zu einem Wehrbauern ausbilden und in den eroberten Gebieten im Osten ansiedeln.
Damit war unsere Aktion „Verwundetenbetreuung" zu Ende.
Meine Jugendzeit
Gegen Ende 1943 gelang es mir aus gesundheitlichen Gründen, aus dem Landdienst der HJ herauszukommen. So konnte ich Anfang 1944 doch noch meine Lehre als Elektroinstallateur beginnen. In diesem Jahr fanden bereits mehrere kleinere Luftangriffe auf Dresden statt, bei welchen ich bei einigen Rettungs- und Aufräumaktionen mit eingesetzt wurde. Nebenher wurde ich in mehreren sogenannten Wehrertüchtigungslagern für den Einsatz an der Front als Panzerjäger ausgebildet. Diese Ausbildung war hart und gnadenlos. Die Schikanen, welchen wir dort ausgesetzt waren, wie z.B. das Reinigen der Toiletten mit der Zahnbürste, waren schier unerträglich.
Am 7. Februar 1945 wurde ich 16 Jahre alt. Mein Leben war inzwischen schon sehr viel ernster geworden. Vor allem machte ich mir Sorgen um meinen Vater und meinen Bruder. Mein Vater (Jahrgang 1901) befand sich irgendwo in Rußland. Mein Bruder Walter (Jahrgang 1921) war im karelischen Urwald in Finnland.
Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, sobald ich erwachsen bin, freiwillig zur Wehrmacht zu gehen und meinem Bruder sowie meinem Vater irgendwie zu helfen. Ich wollte mich einfach dorthin schicken lassen, wo sie sich gerade befinden. Für mich sah das alles sehr einfach aus.
Die Entwicklung des Krieges ließ nun bei mir die Befürchtung aufkommen, der Krieg könnte zu Ende gehen, ohne daß ich an der Front gewesen war.
Die elterliche Wohnung befand sich immer noch in Dresden-A 27, Planetastraße 9, III. Etage. Außer meiner Mutter und mir wohnten zu dieser Zeit noch meine Schwester Ursula (Jahrgang 1926) und unser Nesthäkchen, meine am 13. August 1944 geborene Schwester Elke, dort. Elke war der Nachzügler der Familie und das Resultat des letzten Heimaturlaubes unseres Vaters.
Seit 1944 war ich Elektroinstallateurlehrling bei der Fa. Nestler und Co. (Alarm-Nestler) in Dresden A 1, Kreuzstr. 6. Mein Einkommen betrug zu diesem Zeitpunkt 6,50 RM pro Woche.
Mutter konnte wegen des Kindes nur stundenweise arbeiten und brachte es auf die stolze Summe von 160,- RM pro Monat.
Meine Schwester Ursula arbeitete als ausgebildete Kindererzieherin in einem Kindergarten und hatte ein Gehalt von 240,– RM pro Monat.
So mußten wir versuchen, unser Leben zu bestreiten. Viel zu kaufen gab es ohnehin nicht. Alle Lebensmittel sowie Textilien und Schuhe waren streng rationiert. Eine Tagesration Brot für mich bestand aus 150 g, dies sind drei Scheiben. Bei der Lebensmittelzuteilung wurde differenziert nach: Nichtarbeiter, Arbeiter und Schwerstarbeiter.
Für Textilien gab es Punktkarten. Je nach Art des Kleidungsstückes benötigte man eine unterschiedliche Anzahl Punkte. Dies bedeutete, daß man z.B. für einen Mantel mehrere Monate Punkte sammeln mußte. Deshalb sind wir mit unserem Familieneinkommen einigermaßen zurecht gekommen.
1945 Kriegsende
13. Februar 1945 – Luftangriff auf Dresden
Der 13. Februar 1945 war ein Dienstag. Es war Fasching. Hitler hatte schon längst den „Totalen Krieg" proklamiert, und kein Mensch dachte daran, Fasching zu feiern.
Der Tag begann für mich wie jeder andere. Es war leicht bewölkt und relativ mild.
Im Gegensatz zu anderen Nächten, wo wir mitunter zweimal in den Luftschutzkeller mußten, war die vergangene Nacht sehr ruhig verlaufen. Es gab keinen Fliegeralarm. So fuhr ich ausgeruht und guter Dinge mit der Straßenbahn Linie 22 zum Heizkraftwerk Dresden Mitte, Wettiner Platz. Dort unterhielt mein Ausbildungsbetrieb eine Dauerbaustelle, auf welcher ich größtenteils eingesetzt war. Was ich jedoch noch nicht wußte: An diesem Tag sollte sich mein ganzes Leben einschneidend verändern.
Wie so oft trug ich auch an diesem Tag die Uniform der Hitlerjugend, da ich ursprünglich die Absicht hatte, nach der Arbeit reiten zu gehen. Ich war Mitglied der Reiter-HJ und verbrachte viele Abende sowie als Stallwache auch Nächte in dem Reitstall, welcher in einem der drei Lingner-Schlösser auf der Bautzener Landstraße in Dresden untergebracht war. Dort mußten wir natürlich grundsätzlich in Uniform erscheinen.
In der Hitlerjugend gab es mehrere Gattungen. Da war außer der Reiter-HJ, in welcher ich Mitglied war, noch die Flieger-HJ, die Motor-HJ und die Marine-HJ. Jeder konnte sich, seinen Neigungen entsprechend, eine Gattung aussuchen. Selbstverständlich war dies alles als vormilitärische Ausbildung angelegt, aber das interessierte keinen von uns.
Unser Baubüro im Heizkraftwerk befand sich in einem Kellerraum. In diesem Kellergang hatten auch russische Kriegsgefangene einen Aufenthaltsraum, in welchem sie sich zu den Pausen aufhielten, wenn sie im Werk zum Arbeitseinsatz waren. Während ihrer Pausen bastelten sie dort Kinderspielzeug aus Holz und verkauften es an die Arbeiter für Zigaretten und Brot. Sie bewegten sich innerhalb des Werkes vollkommen frei ohne Bewachung.
An diesem Morgen begegnete mir in diesem Kellergang eine kleine Gruppe Kriegsgefangener. Ich war noch nicht in Arbeitskleidung und trug noch die HJ-Uniform. Einer der Gefangenen hatte eine selbstgebastelte bewegliche Spielzeugente bei sich und wollte sie mir verkaufen. Ich hatte jedoch keinen Bedarf und lehnte deshalb ab. Nach diesem Gespräch zeigte er auf meine Armbinde mit dem Hakenkreuz und sagte: „Du Hitler? Hitler nicht gut, Hitler kaputt, Deutschland kaputt, bald." Mit den Worten: „Bist du verrückt?" bin ich davongerannt und war froh, daß uns niemand gehört hatte. Mir war natürlich klar, daß er für diese Worte sehr hart bestraft worden wäre. Da ich in meinem Inneren, trotz der gegenteiligen Entwicklung, immer noch sehr siegessicher war, trafen mich diese Worte wie ein Hammer.
Den ganzen Tag mußte ich daran denken. Nun war ich noch dazu mit Arbeiten der Schadenbeseitigung eines kleineren vorangegangenen Bombenangriffes beschäftigt, was meine Stimmung keinesfalls verbesserte.
So faßte ich den Entschluß, unbedingt etwas für mein Vaterland zu tun. Irgendwie wollte ich helfen. Deshalb gab ich meinen ursprünglichen Plan, reiten zu gehen, auf und begab mich unmittelbar nach Arbeitsschluß zur Hauptdienststelle des DRK Dresden auf der Tiergartenstraße. Dort bot ich meinen Dienst als ehrenamtlicher DRK-Helfer für die Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 auf dem Hauptbahnhof Dresden an. Ich wußte, daß dort immer Helfer benötigt wurden. Zu diesem Zeitpunkt kamen täglich mehrere Flüchtlingszüge aus dem Osten an, um Stunden oder auch Tage später Dresden wieder zu verlassen. In den Zügen befanden sich Tausende von Menschen, welche vor den heranrückenden Russen auf der Flucht waren. Teilweise waren sie schon wochenlang unterwegs und befanden sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Diesen Menschen wollte ich also in dieser Nacht helfen. Am Tage waren mir derartige Dinge nicht möglich, denn da mußte ich ja arbeiten.
So erhielt ich denn an diesem Nachmittag eine DRK-Armbinde und einen Einsatzbefehl, welchen ich bei der DRK-Dienststelle Hauptbahnhof abzugeben hatte. Eine Vergütung gab es für einen solchen freiwilligen Einsatz natürlich nicht. Ich konnte nicht ahnen, was in dieser Nacht geschehen würde.
In unserem Haus wohnte die Familie Georg Klengel, welche eine kleine Reparaturwerkstatt für Büromaschinen betrieb. Deshalb war in deren Wohnung ein Telefon vorhanden. Über dieses Telefon informierte ich meine Mutter, daß ich in dieser Nacht nicht nach Hause käme und was ich vorhatte. Verständlicherweise machte sich meine Mutter große Sorgen. Aber ich konnte sie mit dem Hinweis auf Gottes Schutz am Ende doch noch beruhigen.
Mit Stolz über den Einfall zur guten Tat meldete ich mich nun umgehend in der Dienststelle des DRK im Hauptbahnhof Dresden. Ich wurde sofort als Helfer einer DRK-Schwester zugeteilt.
Wir hatten die Aufgabe, schwerpunktmäßig auf verschiedenen Bahnsteigen die Flüchtlinge mit Speisen und Getränken, sowie mit kleinen medizinischen Hilfeleistungen zu versorgen.
Gegen 21.30 Uhr heulten die Sirenen. Es war wieder einmal Fliegeralarm. In den vergangenen Jahren hatte ich schon so viele Stunden bei Fliegeralarm nachts im Keller verbracht, daß ich mich schon daran gewöhnt hatte und gar nicht mehr ängstlich war. Allerdings, diese Nacht sollte mich das Fürchten lehren.
In aller Eile begaben wir uns in den am nächsten stehenden Zug und suchten als erstes die behinderten Menschen, um ihnen in den Luftschutzkeller zu helfen. Unsere Hilfestellung wurde verständlicherweise sehr stark erschwert durch die anderen Leute, die ja alle versuchten, so schnell wie möglich in den Keller zu kommen, und deshalb fast panikartig zu den Türen drängten. Alles schrie angsterfüllt durcheinander in dem Bestreben, seine nächsten Angehörigen entweder nicht zu verlieren oder wiederzufinden. Es war noch nichts geschehen, aber es herrschte bereits ein entsetzliches Chaos.
In der Mitte des Waggons saß ein etwa l0jähriges Mädchen. Sie weinte und rief: „Kann mir denn niemand helfen?" „Was ist mit dir?" fragte ich. Unter Tränen sagte sie mir, daß sie gelähmt sei und nicht laufen könne. Ich nahm sie sofort in meine Arme und trug sie in den Keller. Währenddessen fielen in nächster Nähe die ersten Bomben. Es pfiff, heulte, knallte und splitterte entsetzlich.
Als sich der Bombenhagel verschlimmerte, mußten wir dann selbst im Keller bleiben. Während dieses ersten Angriffs hatten wir sehr viel zu tun, um die Menschen im Keller zu versorgen und zu beruhigen. Obwohl das starke Kellergewölbe ein Gefühl der Sicherheit ausstrahlte, hatten die meisten Menschen eine wahnsinnige Angst. Sie hatten ja zum Teil noch nie einen Luftangriff erlebt.
Nach etwa 60 Minuten war die erste Angriffswelle vorüber, und es trat Ruhe ein. Von weitem hörte man auch ein paar Sirenen mit Entwarnung, aber sehr viele waren wohl nicht mehr in Betrieb.
Wir verließen sofort den Keller, um den Menschen auf den Bahnsteigen, welche den Zug nicht mehr verlassen konnten, zu helfen. Die Alten und Behinderten sollten zunächst im Keller bleiben.
Als wir auf den Bahnsteig kamen, bot sich uns ein Bild des Schreckens. Alles war übersät mit schweren Glasscherben vom Bahnhofsdach sowie mit Stahlteilen und Trümmern aller Art. Dazwischen lagen tote und verwundete schreiende Menschen. Zum Teil mit schwersten Verwundungen wie abgerissene Gliedmaßen, abgerissene Genitalien und aufgeschlitzte Bäuche, wo die Gedärme heraushingen. Es war ein Bild des Grauens. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Wir sind durch ein wahres Meer von Blut über die Scherben und Trümmer gestolpert und wußten vor Schreck nicht, was wir zuerst machen sollten. Wir versuchten dort, wo es noch möglich war, erste Hilfe zu leisten und vor allem die Schwerstverletzten auf Tragen in die Dienststelle des DRK zu transportieren. Dafür waren natürlich die Räumlichkeiten gar nicht eingerichtet. Wir mußten die Verwundeten von den Tragen herunternehmen und auf Decken auf den Fußboden legen.
Es dauerte auch gar nicht lange und der vorhandene Platz war total belegt. Nun mußten wir vor der Diensstelle in der Bahnhofshalle etwas Platz schaffen und die Verwundeten dort ablegen. Inzwischen waren schon die ersten verstorben, aber niemand konnte sich um sie kümmern. Die Verwundeten schrien entsetzlich.
In der Zwischenzeit waren schon längst mehrere Krankenwagen und Notärzte dringend angefordert worden. Aber nichts geschah. Da mir ohnehin speiübel war und ich etwas frische Luft brauchte, ging ich vor den Bahnhof, um nach den längst überfälligen Krankenwagen Ausschau zu halten. Dieser Gang vor den Bahnhof bewahrte mich vor dem sicheren Tod, wie wir etwas später hören werden.
Als ich ins Freie kam, stockte mir das Blut in den Adern. Die Prager Straße, die Geschäftsmetropole Dresdens, stand in Flammen. Trümmer auf den Straßen. Menschen liefen schreiend und gestikulierend durcheinander. Ich war wie benommen. Mir war sofort klar, daß an Krankenwagen oder ähnliches überhaupt nicht zu denken war. Überall brannte es, und kein Fahrzeug konnte den Bahnhof erreichen. Aber das Schlimmste war für mich das Schauspiel, welches sich am Himmel bot und mich das Gruseln lehrte. Der Himmel über ganz Dresden war erleuchtet von sogenannten „Christbäumen". Ansammlungen von Magnesiumfackeln, welche an Schirmen oder Ballons am Himmel hängen. Diese „Christbäume" dienen bei einem Luftangriff als Zielmarkierungen für die anfliegenden Bomberverbände. Es war taghell. Mir stockte der Atem. Die Luft roch, als würden tausend Wunderkerzen brennen.
Während ich noch herauszufinden versuchte, ob dies wohl die Markierungen für den vergangenen Angriff waren oder für einen neuen, rannten plötzlich alle Leute schreiend und schutzsuchend durcheinander. Einige Polizisten stürmten mit Handsirenen durch die Straßen und alles schrie: „Fliegeralarm!"
Seit dem ersten Alarm mögen etwa drei Stunden vergangen sein.
So schnell mich meine Beine trugen rannte ich durch die Bahnhofshalle und versuchte zunächst die DRK-Dienststelle zu erreichen. Als ich dort ankam, fielen schon die ersten Bomben. Also sofort kehrt! Richtung Luftschutzkeller! Schon von weitem sah ich eine Riesenmenschenmenge, welche sich vor dem Kellereingang staute. Sie versuchten alle in Panik dort Schutz zu finden. Sie schrien und quetschten sich fast zu Tode. Dazwischen das ohrenbetäubende Pfeifen und Detonieren der ersten Bomben. Mir war sofort klar, daß es vollkommen sinnlos war, zu versuchen in den Keller zu kommen, zumal der Bombenhagel an Intensität zunahm. Intuitiv rannte ich, so schnell ich konnte, durch den nächstgelegenen Ausgang aus dem Bahnhof. Ich dachte: „Nur raus hier" und überquerte die Bayrische Straße, um in das unmittelbar gegenüberliegende Hotel „Bayrischer Hof zu gelangen. Es war das nächstgelegene Gebäude, wo ich Schutz suchen konnte. Ich rannte um mein Leben. Die Luft war erfüllt vom Dröhnen der Flugzeugmotoren, von dem Pfeifen und Detonieren der Bomben sowie dem Pfeifen der umherfliegenden Splitter. Es war die Hölle.
Wie durch ein Wunder erreichte ich unverletzt das Hotel und stürmte sofort in den Keller. Die Wege zu und von den Schutzräumen waren überall gekennzeichnet.
Die Luftschutzräume in diesem Hotel waren bereits überfüllt, als ich hinkam. Ich fand gerade noch Platz in einem Durchgang zwischen zwei getrennten Räumen. Dicht gedrängt mit einem Paar, welches sich unentwegt küßte. Heute kann ich das verstehen. Damals fand ich das dumm und äußerst unangebracht. Ich stand direkt unter dem Durchgangsbogen und lehnte mit dem Rücken an der Stirnseite der Trennwand der beiden Räume. In diesen saßen die Menschen eng zusammengedrängt auf Bänken und Stühlen.
Der Raum zu meiner Rechten war etwa 4 m x 8 m groß. An seiner Stirnseite befand sich ein Notausstieg. Dieser war mit einer Stahlschotte verschlossen und hatte eine Größe von etwa 1,2 x 1,2 m. Dieser Ausstieg befand sich in der oberen Hälfte der Wand und war über eine davor stehende Stiege erreichbar.
Nach ca. 20 Minuten Bombenhagel brach die Stromversorgung zusammen, das Licht verlosch. Einige Not- und Taschenlampen leuchteten auf. Angst und Entsetzen stand auf allen Gesichtern. Die Intensität des Bombenhagels nahm ständig zu. Ich gewann den Eindruck, daß jetzt die Welt untergeht.
Mit ohrenbetäubendem Lärm gingen plötzlich Luftminen auf den Bahnhof nieder. Die Druckwellen waren auch bei uns noch sehr stark. O mein Gott, dachte ich bei mir, laß diesen Kelch an mir vorüber gehen. Ich wußte von meiner Ausbildung her, daß es dort, wo eine Luftmine niedergeht, keine Rettung gibt. Der entstehende Druck ist so stark, daß den Menschen die Lungen platzen.
Vom Treppenaufgang her kam die Meldung, daß das Gebäude über uns vermutlich zerstört sei. Der Eingang sei verschüttet, dort gab es kein Entkommen mehr. Einige Leute drängten darauf, sofort über die Notausstiege den Keller zu verlassen, bevor er einstürze. Andere wiederum hielten sich zurück, denn im Keller sei es z. Zt. immer noch sicherer als draußen im Bombenhagel. Ich war mir nicht im klaren, was besser war. Hatte aber fürchterliche Angst, in diesem Keller verschüttet und damit lebendig begraben zu werden.
Die Entscheidung sollte uns sehr schnell abgenommen werden. Plötzlich gab es eine wahnsinnige Detonation, welche alles bis dahin Erlebte übertraf. Im gleichen Moment wurde die Stahlschotte des Notausstieges zu meiner Rechten aus den Angeln gerissen und flog, total deformiert, wie ein Geschoß durch den Schutzraum. Die Wucht war so stark, daß sich diese Stahltüre in die 8 m entfernte gegenüberliegende Wand bohrte. Die Druckwelle der Detonation hatte alle stehenden Leute umgeworfen. Ich lag auf dem Boden und andere Leute auf mir. Plötzlich ertönte ein Schrei: „Phosphor". Phosphor ist eine Flüssigkeit, welche sofort brennt, wenn sie mit Sauerstoff in Berührung kommt. Sie fließt also brennend und entzündet alles, was ihr in den Weg kommt. Es ist sehr schwierig, Phosphor zu löschen. Gießt man Wasser darauf, brennt er um so schlimmer. Man kann ihn also nur mit Sand abdecken und ersticken.
Wer noch konnte, sprang auf. So auch ich. Im Keller bot sich mir ein Bild des Grauens. Mich packte das kalte Entsetzen. Selbst in meinen übelsten Alpträumen und Phantasien wurde ich noch nie mit ähnlichen Bildern konfrontiert. Die durch den Raum fliegende Stahltüre hatte auf ihrer Bahn den dort sitzenden Leuten den Kopf abgerissen. Diese entsetzliche Szene wurde beleuchtet von einigen Notlampen und von dem brennenden Phosphor, welches durch die Ausstiegsöffnung in den Keller strömte.
Der Schock lähmte in mir jeden klaren Gedanken. Was jetzt kam, waren Reflexe der Selbsterhaltung, welche ohne jede Überlegung abliefen.
Ich sprang durch die blutenden Menschen bzw. Menschenteile und drückte mich seitlich von dem brennenden Phosphorfluß durch den Notausstieg ins Freie. Dies gelang mir, ohne mit dem Phosphor in Kontakt zu kommen.
Ich erreichte den Hof des ehemaligen Hotels, welcher mit Trümmern verschüttet war. Ringsum brannte alles! Die Hitze versengte mir Kleidung und Haare.
Der einzige Weg zur Straße führte durch einen ca. 6 m langen Torweg, welcher zu dieser Zeit noch stand, aber allseitig brannte. Durch diesen brennenden Torweg rannte ich um mein Leben. Auf der Straße brannte der Asphalt! Der gesamte Hauptbahnhof beziehungsweise was davon noch übrig war stand in hellen Flammen. Ich wendete mich nach rechts, um den Bayrischen Platz zu erreichen.
Nach wenigen Metern kam mir ein Mann entgegen, drückte mir ein schreiendes Kind im Alter von etwa zwei Jahren in den Arm und rannte weiter. Mir blieb keine Zeit zum Nachdenken und Reagieren, ich stürmte mit dem Kind im Arm weiter. Nach etwa 50 m kam mir eine Frau entgegen, welcher ich ebenso das Kind im fliegenden Wechsel in den Arm drückte und weiterstürmte.
Der Bayrische Platz befindet sich unmittelbar neben dem Südteil des Hauptbahnhofes und existiert heute noch. Es ist ein ca 150 x 150 m großer freier Platz mit Wiesen und ein paar Wegen. Instinktiv rannte ich zu diesem Platz, um aus dem tobenden Flammenmeer herauszukommen. Es war die einzige Rettungsmöglichkeit.
Der Bombenhagel ließ nach, die Bomberverbände drehten ab. Nur hin und wieder detonierte ein Spätzünder.
Rings um den Platz war haushohes Feuer. Die Hitze war so groß, daß man es nur in der Mitte des Platzes einigermaßen aushalten konnte. Wir waren etwa 16 Personen, welche sich dorthin retten konnten.
Durch die enorme Hitze der riesigen Brände wurde ein entsetzlicher Feuersturm ausgelöst. Dieser verursachte nicht nur einen wahnsinnigen Funkenflug, sondern trieb faustgroße glühende Stücken wie Geschosse durch die Luft. Wir legten uns flach auf den Boden, um von möglichst wenigen dieser glühenden „Geschosse" getroffen zu werden. Außerdem war so die Hitze am ehesten zu ertragen. Jeder mußte auf seinen Nachbarn achtgeben. Sobald einer getroffen wurde, fing er an zu brennen. Sofort hat sich ein anderer auf ihn geworfen, um mit seinem Körper die Flammen zu ersticken.
Zeitweise lagen mehrere Personen übereinder, um sich gegenseitig zu schützen. Nur so konnten wir überleben.
Ich weiß nicht mehr, wieviel Stunden wir so gegen den Funkenflug kämpften. In einer solchen Situation geht jedes Gefühl für Zeit verloren, da man jede Sekunde mit äußerster Konzentration um das Überleben kämpft. Man spürt weder Schmerz noch Hunger. Alles läuft ab wie in einem üblen Traum.
Etwa zwischen 4 und 5 Uhr morgens setzte ein leichter Nieselregen ein, welcher uns etwas Erleichterung brachte.
Als es endlich hell wurde, bot sich uns ein unvorstellbares Chaos. Rings um uns herum, soweit wir sehen konnten, eine unendliche rauchende und brennende Trümmerwüste. Die Straßen waren meterhoch zugeschüttet und nur noch an einigen einzelnen, noch stehenden Fassaden zu erkennen.
Keiner von uns wußte so recht, wohin er sich nun wenden sollte. Jeder hatte nur wahnsinnige Angst um sein Zuhause und seine Angehörigen. Ich sagte zu meinem Nachbarn: „Auf alle Fälle muß ich erst noch in den Bahnhof, um nach meiner Dienststelle zu sehen und mich abzumelden."
„Komm zu dir, Junge", antwortete er, „schau zum Bahnhof, glaubst du wirklich, daß dort noch jemand lebt? Sei froh, daß du dort überhaupt noch rausgekommen bist. Versuch dein Zuhause zu erreichen." Nach diesen Worten wurde mir erst bewußt, daß dort wirklich keiner mehr am Leben sein konnte und daß nur der Umstand meines Verlassens des Bahnhofes vor dem Angriff mir das Leben gerettet hat.
So entschloß ich mich, in Richtung Süden über die Trümmerberge zu klettern. In dieser Richtung lag Dresden-Plauen.
Etwa nach 15 Minuten sah ich 50 m vor mir eine Gruppe von vielleicht 12-15 Personen, welche ebenfalls in meiner Richtung über die Trümmer kletterten. Plötzlich sah ich, wie sich eine neben der Gruppe hochragende Fassade eines vierstöckigen Hauses neigte. Mir blieb fast das Herz stehen. Ich habe wahnsinnig geschrien und mich, wie im Reflex, automatisch hinter einen Mauerbrocken in Deckung geworfen. Mein Schrei ging in dem Getöse, mit welchem die Wand herniederprasselte, unter. Die gesamte Gruppe wurde darunter begraben.
Als sich der Staub verzogen hatte, war nichts mehr zu sehen. Mir zitterten die Knie und ich brauchte eine geraume Zeit, bis ich in der Lage war, weiterzugehen.
Von da an habe ich genau alle Mauerreste vor mir beobachtet und versucht, größeren Fassaden auszuweichen. Es war gut, daß ich so vorsichtig war. Ich habe auf meinem Weg noch sechs Einstürze erlebt. Dies hatte natürlich zur Folge, daß ich kreuz und quer klettern mußte, um nicht erschlagen zu werden. So benötigte ich für einen Weg, welchen ich im Normalfall in 30 Minuten zurückgelegt hätte, etwa 6 Stunden. Auch hatte ich zeitweise die Orientierung verloren und wußte nicht, in welcher Richtung ich weiterklettern sollte. Die Luft war geschwängert mit beißendem Brandgeruch und Staub. Die Augen brannten mir wie Feuer und das Atmen fiel mir sehr schwer.
Endlich, gegen Mittag, erreichte ich Dresden-Plauen. Auf der Altplauen, eine Straße in der Nähe unserer Wohnung, kam mir meine Schwester Ursula entgegen. Sie hat mich nicht erkannt und lief an mir vorüber. Erst als ich sie ansprach, erkannte sie mich. Dies war auch nicht verwunderlich. Meine Kleidung war total zerrissen und versengt, die Haut rußgeschwärzt und zerschunden. Haare, Wimpern und Augenbrauen verbrannt. Die Augen waren rot unterlaufen und verquollen. So bot ich ein Bild wie von einem, der direkt aus der Hölle kam. Aber die Freude, daß wir noch alle am Leben waren, überdeckte alles andere.
Unser Haus stand zum Glück noch. Es hatte natürlich auch allerhand abbekommen. Die Fenster zertrümmert, das Dach abgedeckt und Brandschäden durch Stabbrandbomben im Dachstuhl.
Jedoch war dies alles reparabel.
Viele Menschen hatten sich während des Luftangriffes an die Elbwiesen gerettet. Dort sind sie am nächsten Tag von Tieffliegern wie die Hasen gejagt und abgeschossen worden. Ich konnte es nicht fassen. Das hatte nichts mehr mit Krieg zu tun. Das war ein Abschlachten unschuldiger Menschen. In mir entwickelte sich ein tiefes Haßgefühl und ich schwor mir, diese Menschen zu rächen.
Aus dem Hauptbahnhof und seinen Kellern ist niemand lebend herausgekommen. Die Toten, welche man in den nächsten Tagen aus dem Keller geholt hat, waren unversehrt. Sie hatten alle eine dunkelblaue Hautfarbe und ein Blutrinnsal am Mund. Ein Zeichen für die geplatzten Lungen durch die Luftminen.
Es wurden einige tausend solcher Leichen aus dem Bahnhof geholt und neben demselben auf der Bayrischen Straße auf einer Länge von etwa 200 m, einer Breite von 6 m und einer Höhe von etwa 4 m aufgeschichtet.
Tausende Tode lagen auf Dresdens Straßen herum. Die Luft war erfüllt von dem Gestank verwesender Leichen.
In der Folgezeit wurden dann mehrere tausend Leichen auf dem Altmarkt in Dresden von Spezialeinheiten mit Flammenwerfern verbrannt. Parallel dazu wurden einige tausend Tote auf dem Heide-Friedhof in Dresden in Massengräbern beigesetzt. Dies war die einzige Möglichkeit, um die akute Seuchengefahr zu beseitigen.
Aufgrund der vielen Flüchtlinge, welche sich zu diesem Zeitpunkt in Dresden befanden, war es bis zum heutigen Tag nicht möglich, die genaue Zahl der Todesopfer zu ermitteln. Die Schätzungen liegen bei etwa 60 000.
Die letzten Monate des Krieges an der Front
Wenige Tage nach dem Untergang der Stadt Dresden erhielt ich eine Einberufung in ein Wehrertüchtigungslager nach Altenberg im Erzgebirge. Normalerweise ist es überhaupt kein Problem, nach Altenberg zu fahren. Es sind ja auch nur40 km. Aber zu dieser Zeit war eine solche Reise ein Abenteuer.
Von der Brauerei „Zum Felsenkeller" am Stadtrand von Dresden pendelte ein einzelner Straßenbahnwagen nach Freital-Hainsberg und zurück. Die Fahrgäste wurden in diesen Tagen kostenlos befördert. Es waren ohnehin zumeist Ausgebombte, die nur noch ihr Leben gerettet hatten. Viele Freitaler Bürger standen an der Straße und verteilten kostenlos etwas Brot und Wasser an die landwärts ziehenden Menschen. So manche Familie fand dabei eine vorläufige Bleibe. Zwischen Freital-Hainsberg und Dippoldiswalde pendelte alle zwei bis drei Stunden ein normaler offener LKW. Auch dort wurden die Leute kostenlos befördert. Manchmal kam es dabei zu recht heiklen Momenten. Auch ich hatte mich auf meinem Weg nach Altenberg auf solch eine Ladefläche gesetzt. Eine ältere Frau kam mit einem kleinen Leiterwagen daher, welcher mit einigen geretteten Habseligkeiten bepackt war. Sie bat den Fahrer um Mitnahme nach Oelsa. Er willigte ein, half der Frau auf die Ladefläche und band den Wagen mit der Deichsel an seine Anhängerkupplung. Dann ging die Reise los. Die Sonne schien von einem strahlend blauen Himmel, als könnte es gar keinen Krieg geben. Der Berg von Hainsberg nach Rabenau steigt ziemlich steil an, deshalb mußte der LKW sehr langsam fahren. Da ging noch alles gut. Aber als wir die Gerade auf der Höhe erreichten und er die Geschwindigkeit erhöhte, begann das Wägelchen zu schleudern, daß man meinte, es müßte jeden Moment umkippen. Entweder hatte der Fahrer vergessen, daß er ein kleines Wägelchen als Anhänger im Schlepp hatte, oder er hat die Reaktion desselben unterschätzt. Das Schleudern verstärkte sich mit jedem Meter, den wir fuhren. Die Frau jammerte und weinte um ihre letzte Habe. Sie sagte mir, da seien Gläser mit Eingewecktem drin. Dies sei das einzige, was sie zu essen hätte. Sie tat mir unendlich leid und ich mußte ihr unter allen Umständen helfen. Deshalb stieg ich während der Fahrt nach hinten über die Bordwand, um das Wägelchen irgendwie zu stabilisieren. Mit dem linken Fuß stellte ich mich auf die Anhängerkupplung und mit dem rechten Fuß stemmte ich mich gegen das Wägelchen. So konnte ich den Wagen einigermaßen in der Spur halten. Wir erreichten unbeschadet Oelsa. Die Frau war mir unsagbar dankbar und hat mich zum Abschied sehr herzlich gedrückt.
In Oelsa, auf der Alten Straße 4, wohnte die Schwester meiner Mutter, also meine Tante, Erna Schneider mit ihrem Mann, dem Holzbildhauer Herbert Schneider. Dort machte ich auf meiner 40 km langen Reise erst einmal Zwischenstation. Auch meine Mutter hat mit meiner kleinen Schwester Elke nach der Zerstörung Dresdens einige Monate dort gewohnt.
Nachdem ich mich gestärkt und ausgeruht hatte, setzte ich meine Reise nach Altenberg per pedes und per Anhalter fort. Zu meinem größten Entsetzen traf ich Altenberg in einem ähnlichen Zustand wie Dresden an. Kurz vor meinem Eintreffen hat dort ein Luftangriff stattgefunden. Mehrere Teile der Stadt standen lichterloh in Flammen. Überall auf den Straßen lagen verstümmelte und verkohlte Leichen. Es war ein entsetzlicher Anblick. Trauer und eine unbändige Wut schnürten mir die Kehle zu. Ich war fassungslos und empfand eine hilflose Ohnmacht. So begab ich mich sofort zum Lager. In diesem Lager war ich schon in der Vergangenheit mehrere Male zur Ausbildung, zur sogenannten „Wehrertüchtigung". Es bestand aus mehreren Baracken, welche in Gruppen um einen Appellplatz angeordnet waren.
Als ich mich dort meldete, hatte ich den Eindruck, daß irgend etwas nicht stimmte. Alles war anders als sonst. Die Führerschaft schien aufgeregt zu sein, und es fand eine geheime Beratung nach der anderen statt. Man nahm keine Notiz von den Neuankömmlingen. Wir wurden nicht angeschnauzt und nicht anderweitig schikaniert. Es wurde überhaupt kein richtiger Dienst durchgeführt. Das war recht seltsam und absolut ungewöhnlich.
Am dritten Tag beobachteten wir eine hektische Betriebsamkeit in der Führerbaracke. Dann sahen wir dicken Rauch aus dem Schornstein des Sekretariats aufsteigen. Die ganze Nacht war dieser Rauch zu sehen, der wegen des niedrigen Schornsteins von den Flammen der Feuerstelle glutrot leuchtete. Die ersten Informationen sickerten hinter der vorgehaltenen Hand durch und gingen schlagartig durch das ganze Lager: Das Lager wird aufgelöst, alle Papiere und Unterlagen werden verbrannt. Die Stimmung war sehr zwiespältig. Einerseits freuten wir uns, daß keine „Wehrertüchtigung" stattfand und wir evtl. wieder nach Hause konnten, aber andererseits hatte diese Auflösung etwas Unheimliches und Furchterregendes an sich.
Am nächsten Morgen mußten wir alle auf dem Appellplatz antreten. Der Lagerleiter erschien mit großem Gefolge. Nach einer markigen Ansprache über den totalen Krieg, den Haß gegen unsere Feinde und unseren sicheren Sieg eröffnete er uns, daß wir sofort mit Waffen und Handgranaten ausgerüstet werden und uns in Richtung Front in Marsch zu setzen hätten. Vorher müßte sich jeder bei seinem zuständigen Wehrkreiskommando in seinem Heimatort melden, um einen Marschbefehl zu erhalten. Unser Einsatz an der Front sei erforderlich, da der Feind schon tief in unser Vaterland eingedrungen sei.
Mein Tatendrang war ungeheuer groß und ich freute mich, daß ich endlich gebraucht wurde, um die bösen Feinde zu verjagen. Die Verblendung und staatliche Erziehung hatten bei mir ihr Ziel erreicht. Ich war nicht in der Lage, die Wirklichkeit real einzuschätzen.
Mit stolzgeschwellter Brust und bewaffnet bis an die Zähne, zogen wir ab.
In Dresden angekommen, marschierte ich sofort ohne Aufenthalt zum Wehrkreiskommando. Als ich mit einer zackigen Meldung, wie es von uns verlangt wurde, das Büro betrat, traute ich meinen Augen nicht. Da saß hinter dem Schreibtisch, in Wehrmachtsuniform, mein Onkel Paul, der Bruder meiner Mutter. Paul Baumgart, der spätere Inhaber der Fa. Bürobedarf Baumgart, Dresden.
Er hat mich angeschaut wie ein Gespenst. Dieses entgeisterte Gesicht werde ich nie vergessen.
Er informierte sofort seinen Vorgesetzten, wer ich sei und daß ich für einen Fronteinsatz viel zu jung wäre. Er hat sich trotz meiner Proteste die allergrößte Mühe gegeben, meinen Einsatz zu verhindern.
Es wäre besser gewesen, er hätte sein Ziel erreicht. Aber dies wollte mir zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht in den Kopf.
Da nun die Situation an der Front so war, daß jede auch nur halbwegs wehrfähige Person bedingungslos gebraucht wurde, erhielt ich schließlich doch einen Marschbefehl.
Aufgrund meiner Spezialausbildung als Panzerjäger erhielt ich den Befehl, mich nach Meißen in Marsch zu setzen und mich dort in der Hindenburg-Kaserne für Panzergrenadiere bei Ritterkreuzträger Hauptmann Grünewald zu melden.
Also versuchte ich in einem Vorortbahnhof von Dresden, einen Zug Richtung Meißen zu erklimmen. Ja, zu erklimmen. Reisen war zu dieser Zeit nicht einfach. Alle Züge waren hoffnungslos überfüllt. Es gab keinerlei Verbote oder Einschränkungen. Man „reiste", wo man Platz fand. Auf den Dächern der Waggons, auf den Trittbrettern (die es damals noch gab ) oder zwischen den Wagen auf den Puffern. Nur mit Mühe fand ich gerade noch einen freien Puffer, auf welchem ich einigermaßen stehen konnte.
Von Dresden nach Meißen beträgt die Entfernung ca. 25 km. Für diese Strecke benötigte der Zug an diesem Tag etwa drei Stunden. Wir mußten einige Male auf freier Strecke halten und hatten einen Tieffliegerangriff. Die Tiefflieger jagten auch einzelne Personen auf der Straße oder auf dem Feld. Die meisten Leute von denen, die aus Angst vom Zug weggelaufen sind, wurden abgeschossen. Ich habe mich unter dem Zug verkrochen und hatte deshalb eine gute Deckung. Erst als der Spuk vorüber war, bin ich wieder auf meinen Puffer geklettert. Obwohl es auch im Zug Tote und Verletzte gab, fuhr der Zug dann weiter, als sei nichts geschehen. Was sollte man auch tun? Erst in Meißen wurden sie versorgt.
Endlich angekommen, meldete ich mich sofort erwartungsvoll in der genannten Kaserne. Es waren nur noch wenige Soldaten dort. Alles, was ganze Beine hatte, war an der Front. Diese war zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr so sehr weit entfernt und rückte immer näher. Ich erhielt meine Stube und wurde eingekleidet. Zunächst war ich ganz zufrieden. Jedoch eine Stunde später dachte ich, mich trifft der Schlag. Ich wurde vom OVD (Offizier vom Dienst) dem Hauptmann Grünewald als Putzer zugeteilt.
Es war niederschmetternd. Ich wollte an die Front und mußte statt dessen dem Herrn Hauptmann die Stiefel putzen.
Aber nach wenigen Tagen hat es dann doch noch geklappt. Es wurde ein Panzerjagdkommando aufgestellt. Dieses bestand aus einem Unteroffizier und drei Mann. Da dort hoch ein Mann fehlte, drängelte ich meinen Hauptmann solange, bis er widerwillig seinen gerade erst erhaltenen Putzer wieder abgab. So wurde ich Mitglied dieses Panzerjagdkommandos. Zu meiner großen Freude und Überraschung war einer meiner Kameraden in diesem Kommando mein gleichaltriger Freund Horst Sterzel aus Leipzig. Wir kannten uns aus unserer gemeinsamen Zeit im Landdienst der HJ, und er war genauso verrückt wie ich. Wir haben uns beide wahnsinnig gefreut und uns gegenseitigen Beistand bis in den Tod geschworen.
Dann ging es zunächst an die Vorbereitung unserer Kampfausrüstung. Wir erhielten einen beschlagnahmten PKW Adler Trumpf Junior. Der wurde vollgepackt mit Haftminen, Handgranaten, Waffen und Munition. Am Heck des Fahrzeuges wurden vier Panzerfäuste querliegend befestigt. (Eine Panzerfaust besteht aus einem ca. 1 m langen Rohr mit Zieleinrichtung und einem Sprengkopf. Das Rohr wird auf die eigene Schulter gelegt und der Sprengkopf auf den Panzer geschossen, wo er sich einschweißt und dann explodiert.)
Auf dem Dach unseres Fahrzeuges wurde ein LMG (leichtes Maschinengewehr) montiert.
Unser Kappo (Unteroffizier) hat uns dann eingewiesen und jedem seine Aufgaben zugeteilt. Er eröffnete uns, daß dies ein Himmelfahrtskommando sei und wir uns darüber im klaren sein sollten, daß wir da auf keinen Fall lebend rauskommen würden. Diese Mitteilung hat uns absolut nicht bewegt. Jeder dachte: „Noch ist es nicht soweit."
Ich wurde als MG-Schütze eingeteilt und stand während der Fahrt auf den Panzerfäusten. Wahrscheinlich weil ich der Kleinste und Leichteste war. Angst kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Wir hatten einen Sonderbefehl mit Sondervollmachten. Wir durften nach eigenem Ermessen operieren. Jede Einheit bzw. Dienststelle war verpflichtet, uns mit allem, was wir benötigten, zu versorgen. Dadurch gab es für uns keine Versorgungs- und Nachschubprobleme.
Die Rote Armee bewegte sich zu diesem Zeitpunkt im Raum zwischen Elsterwerda und Großenhain. Eine klare Front gab es meistens nicht mehr. Auf den Gedanken, daß es doch vollkommen sinnlos sei, in dieser Situation noch unser Leben einzusetzen, kam niemand von uns.
So verließen wir die Kaserne im wahrsten Sinne des Wortes mit unserem „Straßenkreuzer". Zunächst fuhren wir in Richtung Nordost mit der Absicht, die Lage der gegnerischen Standorte und Truppenstärke zu erkunden. Es war sehr kühl, und der Himmel hing voll dunkler bedrohlicher Wolken. Der Wind blies mir den Straßenstaub sehr unfreundlich ins Gesicht. Es sollte zunächst nur ein Aufklärungseinsatz sein, doch es kam anders.
Etwa bei Schwepnitz, zwischen Ortrand und Kamenz, trafen wir in einem Dorf plötzlich und unerwartet auf eine Gruppe sowjetischer Soldaten. Es schien eine Vorhut oder ein Spähtrupp zu sein. Bei unserem Anblick blieben sie verdutzt stehen. Sie hatten wohl nicht mit uns gerechnet. Diesen Überraschungseffekt nutzten wir aus. Unser Fahrer gab Vollgas und vom Kappo kam der Befehl: „Feuer". Ich schoß in Stößen, ständig nach beiden Seiten wechselnd. Die anderen Kameraden taten das gleiche mit ihren Maschinenpistolen aus den Fenstern heraus. Selbst der Fahrer schoß noch mit einer Hand mit seiner Pistole. Wir sind ohne einen Kratzer durchgekommen. Mich beschlich ein eigenartiges Gefühl. Auf der einen Seite war ich etwas stolz und auch erleichtert über die bestandene „Feuertaufe", aber auf der anderen Seite schnürte mir irgend etwas die Kehle zu. Ich hatte auf Menschen geschossen. Diese Tatsache ist mir viel härter angekommen, als ich vermutet hatte. Ich fing an zu zittern und hatte zu tun, mein Gleichgewicht wiederzufinden.
Aus der Ferne hörten wir das Dröhnen von Panzermotoren. Sicherheitshalber sind wir von der Straße runter und auf Schleichwegen in das nächste Waldgebiet reingefahren. Dort rollten wir unser Fahrzeug in ein Versteck und machten es mit Gestrüpp vollkommen unsichtbar. Anschließend verkrochen wir uns im Dickicht, um auf die Nacht zu warten.
Nach Einbruch der Dunkelheit haben wir uns „präpariert". Gesicht und Hände wurden mit Ruß, welchen wir bei uns führten, geschwärzt. Unsere Feldmützen wurden mit Zweigen bestückt. Wir waren nicht wiederzuerkennen und in der Dunkelheit kaum zu sehen.
Es war inzwischen März geworden.
Mehrere Stunden schlichen wir durch den nächtlichen Wald, um den Standort der dort versteckten Panzer zu erkunden. Immer bedacht, jedes Geräusch und Knacken von Zweigen zu vermeiden. Dieser Erkundungsgang war unbedingt notwendig, denn ohne genaue Kenntnis des Standortes und der Umfeldbedingungen wie Bewachung usw. war es sinnlos, die schweren Haftminen durch die Gegend zu schleppen. Wir wurden fündig.
Ich schätze, daß wir etwa 3 km durch den Wald geschlichen waren, als wir Stimmen hörten. Nun robbten wir nur noch auf dem Bauch weiter. Nach wenigen Metern kamen wir an eine Schneise, in welcher 8 Panzer der Roten Armee standen. Diese waren mit Tarnnetzen abgedeckt. Vor dem ersten und dem letzten Panzer stand je ein Posten. Die übrigen Besatzungsmitglieder schliefen wahrscheinlich in den Fahrzeugen. Sie rechneten wohl nicht damit, daß hier hinter der eigentlichen Front irgend etwas passieren könnte.
Als wir genug ausgekundschaftet hatten, zogen wir uns zurück.
Wir waren uns darüber im klaren, daß es sehr schwierig sein würde, an den Panzern Haftminen anzusetzen und dabei möglichst kein Geräusch zu machen. Deshalb beschlossen wir, die Minen auf den Ketten abzulegen. Dort konnten wir Holzstückchen unter die Minen legen, um so das Geräusch des Anklickens zu vermeiden.
Wir sind noch in der gleichen Nacht mit 4 Minen zurückgegangen. Es waren wieder nur die beiden Posten zu sehen.
Wir warteten noch auf die Ablösung, um dann mehr Zeit zum Handeln zu haben.
Um an die vorderen Fahrzeuge ranzukommen, mußte der vordere Posten ausgeschaltet werden.
Plötzlich waren meine Einsatzfreude und meine Zuversicht wie weggeblasen. Ich fing schon wieder an zu zittern und mir wurde übel. Die Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt. Ich hatte einfach Angst, entsetzliche Angst. Es gab jedoch kein Zurück.
Unser Fahrer, ein bärenstarker Kerl mit jahrelanger Front- und Nahkampferfahrung, erhielt den Befehl, diese Arbeit zu erledigen. Alles kam nun darauf an, jedes Geräusch zu vermeiden. Allerdings waren wir auch darauf vorbereitet, uns schießend zurückzuziehen, falls etwas schiefgehen sollte.
Ich hatte ja zu dem Luftangriff auf Dresden viele Menschen sterben sehen und irgendwie war ich dadurch abgestumpft. Aber dies hier war eine andere Dimension. Hier sah ich das erste Mal in natura, wie ein Mensch von einem anderen Menschen einfach umgebracht wird. Plötzlich verschwamm das Feindbild vor mir und ich sah nur noch den Menschen. Mir war fürchterlich zumute.
Der Posten wurde von hinten gefaßt und erstochen. Er hat nicht den geringsten Laut von sich gegeben, ich glaube auch vor Schreck. Ich war total erledigt.
Dann haben wir ganz langsam und lautlos die Minen mit den vorbereiteten Holzstückchen auf die Ketten gelegt und geschärft. Die Zünder waren auf 30 Minuten eingestellt.
Zunächst entfernten wir uns genauso lautlos, wie wir gekommen waren. Aber dann sind wir gelaufen, als hätten wir den Teufel im Nacken. Noch bevor wir unser Fahrzeug erreichten, hörten wir die Detonationen.
In Sekundenschnelle hatten wir unser Fahrzeug aus der Deckung und sind ohne jedes Licht davongebraust. Unser Kappo stammte aus dieser Gegend und kannte sich deshalb besonders gut aus. Nach seinen Anweisungen sind wir dann in ein anderes Waldgebiet gefahren, ohne Feindberührung zu haben. Dort tarnten und verkrochen wir uns genau wie vorher. In unserem Versteck schliefen wir fast den ganzen Tag. Unsere Ernährung bestand aus Kommißbrot und Konserven.
In dieser Art fuhren wir eine ganze Woche in dem schon von den Russen besetzten Gebiet herum. Dabei besuchten wir noch einige Panzerstandorte, mit recht unterschiedlichen Erfolgen.
Die Rote Armee konnte jedenfalls den Schaden, welchen wir ihr zufügten, verkraften.
Nach dieser Woche waren wir am Ende unserer physischen und psychischen Kräfte. Auf Um- und Schleichwegen sind wir dann über Weinböhla wieder nach Meißen gefahren.
Wir meldeten uns bei der Standortkommandantur Meißen, welche auf der Albrechtsburg untergebracht war. Wir hatten die Absicht, uns etwas auszuruhen, unsere Ausrüstung in Ordnung zu bringen, zu ergänzen und dann wieder zu starten. Aber es sollte anders laufen, als wir uns vorgenommen hatten.
Es war inzwischen Ende März geworden. Die Rote Armee war auf der anderen Elbseite schon bis kurz vor Meißen vorgedrungen.
Jeder Soldat, der sich auf der Burg befand, unterstand sofort der Befehlsgewalt der Kommandantur und wurde nach deren Erfordernissen eingesetzt. So erhielt ich den Befehl, den der Elbe zugewandten Turm zu besteigen, um zu erkunden, wo auf der anderen Seite die Truppen stehen. Ab einer bestimmten Höhe besteht der Turm jedoch aus Säulen und Öffnungen. Deshalb ist er in diesem Bereich durchsichtig. Ich hatte keinerlei Deckungsmöglichkeit und wurde deshalb schon während des Aufstieges vom Gegner entdeckt. Noch bevor ich selbst etwas sehen konnte, wurde der Turm mit einer Pak (Panzer-Abwehrkanone) beschossen. Ich hörte das Pfeifen der Geschosse, und dann knallte es schon. Mir flogen Gesteins- und Granatsplitter um die Ohren, daß ich dachte, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Vor Schreck bin ich die Wendeltreppe im Turm mehr hinuntergestürzt als gerannt. Der Beschuß wurde sofort eingestellt, als ich auf dem Turm nicht mehr zu sehen war.
Nur durch diesen Vorfall wurde der Dom zu Meißen beschädigt und mußte nach dem Krieg mit großem Aufwand restauriert werden.
Auch ich hatte ein paar kleine Kratzer abbekommen. Das linke Bein blutete und mußte verbunden werden.
Am gleichen Tag brachte eine Streife der Feldgendarmerie, welche von den Landsern nur „Kettenhunde" genannt wurde, da sie an einer Kette ein Schild „Streife" auf der Brust trugen, eine Gruppe von vier Männern, im Alter von 20 bis 25 Jahren, gefesselt auf den Burghof. Es waren desertierte deutsche Soldaten. Sie hatten sich in einem Vorort von Meißen versteckt und wollten dort das Kriegsende abwarten. Ob sie nur entdeckt oder aber verpfiffen worden waren, entzieht sich meiner Kenntnis.
Sie wurden vom Standortkommandanten sofort zum Tode verurteilt und sollten im Burggarten standrechtlich erschossen werden. Ich war entsetzt. In meinem Kopf ging plötzlich alles durcheinander. Obwohl ich wußte, daß auf Desertation schon immer und überall die Todesstrafe steht und ich selbst zur absoluten Treue und Standhaftigkeit erzogen worden bin, hat mich die Tatsache, daß hier vier junge Menschen erschossen werden sollen, sehr stark ergriffen. Noch viel größer wurde mein Entsetzten, als ich dem Exekutionskommando zugeteilt wurde. Dies war ein echter Schock für mich. Mein Kappo ist sofort zum Kommandanten und hat erreicht, daß ich wegen meiner Verletzungen und des Schrecks durch den verunglückten „Turmspaziergang" ausgetauscht wurde. Ich war ihm sehr zu Dank verpflichtet. Wäre ihm das nicht gelungen, ich weiß nicht, wie ich es überstanden hätte. Ich glaube, ich hätte geweint.
Noch in der gleichen Nacht erhielt die Ostfront Verstärkung durch Truppenteile der Westfront. In einer sofort gestarteten Offensive, mit welcher die Russen wahrscheinlich nicht gerechnet hatten, wurde die Rote Armee 60 bis 80 km zurückgeworfen.
Es war Anfang April.
Wir jubelten lautstark über diese Nachricht und glaubten allen Ernstes, daß es jetzt richtig los geht. Wir meinten, jetzt sind wir in der Offensive und werden den Feind wieder aus unserem Land rauswerfen. Denen werden wir es zeigen.
Wir mußten sofort ausrücken und hatten zunächst den Befehl, einen Teil des zurückeroberten Gebietes nach Versprengten oder Verwundeten zu durchsuchen.
Das erste, was wir in einer befreiten Ortschaft entdeckten, ließ uns die Haare zu Berge stehen und entfachte in mir wieder meinen bisherigen Zorn. An der Ecke einer Straßengabel befand sich ein kleiner freier Platz. Dort lagen die Leichen von 6 DRK-Schwestern und 3 Jugendlichen in HJ-Uniform. Alle durch Genickschuß umgebracht. Mir war plötzlich sehr kalt.
„Das blüht uns auch, wenn wir gefangen werden", meinte unser Kappo. Ich mußte mich abwenden. Eine tiefe Abscheu erfüllte mich. Wir schworen uns, jeden Verwundeten, den wir evtl. bei unserer Aktion finden würden, sofort zu erschießen. Um ehrlich zu sein, ich war froh, daß wir niemanden fanden. Ich glaube nicht, daß ich es fertiggebracht hätte.
Von der Bevölkerung erhielten wir die Information, daß sich in einem Haus in der Nähe der Bahngleise zwei Polen versteckt hielten. Diese seien bewaffnet und würden plündern. Sie hätten auch schon einige Deutsche erschossen. In diesem Haus befanden sich keine Einwohner mehr. Es war in der Nähe von Priestewitz, an der Bahnlinie Dresden–Elsterwerda. Das Gebäude bestand aus Erdgeschoß und einem Obergeschoß. Es war schon sehr alt, ziemlich verbaut und befand sich in einem verwahrlosten Zustand.
Der Flur nach der Haustüre und der Treppenaufgang zum Obergeschoß waren sehr schmal, deshalb konnten wir dort unsere Karabiner nicht gebrauchen und betraten das Haus nur mit der Pistole in der Hand. Im Haus war es dunkel und totenstill, nichts regte sich. Ich konnte mein Herz schlagen hören und traute mich kaum, Luft zu holen. Der Flur verlief von der Haustüre zur Mitte des Hauses. Von da führte eine Treppe in das obere Stockwerk. Vom Flur aus gingen mehrere Türen ab.
Unser Fahrer blieb zur Außensicherung vor dem Haus am Fahrzeug.
Wir nahmen uns jeder eine Tür vor und stießen sie gleichzeitig auf. Mit dem Ruf: „Hände hoch!" sind wir in die Zimmer gesprungen. Ich befand mich in einem Wohnraum und sah niemanden. Zunächst blieb ich an der Türe stehen und tastete jeden Winkel mit den Augen ab. Das Zimmer war durchwühlt worden und sah schlimm aus. Vom Nachbarraum her hörte ich ein Geräusch und anschließend einige Schüsse. Da meine Nerven zum Zerreißen gespannt waren, schoß ich ebenfalls. Aber in meinem Zimmer war niemand. Jedoch im Nachbarraum hatte mein Kamerad Horst Sterzel einen der beiden Polen aufgespürt und ihm in die Schulter geschossen. Er wurde gefesselt und notdürftig verbunden.
Nun war nur noch einer im Haus. Da bis jetzt alles gutging und wir uns etwas an diese eigenartige Situation gewöhnt hatten, wurde ich etwas ruhiger und selbstsicherer.
In einer Ecke des Wohnraumes, wo ich mich befand, führte eine Wendeltreppe in einen Raum im Obergeschoß. Die Klappe des Durchstieges war geöffnet. Ganz langsam und immer bedacht, kein Geräusch zu verursachen, stieg ich diese Treppe nach oben. Vorsichtig steckte ich meinen Kopf Zentimeter für Zentimeter durch die Luke. Es war ein Schlafzimmer und befand sich in einem verheerenden Zustand, noch weit schlimmer als das Wohnzimmer. Die Betten und Matratzen waren zerrissen oder aufgeschlitzt, Kästen und Schieber ausgekippt, die Schranktüren zerschlagen und die Wäsche herausgerissen. Wegen dieses Zustandes war es mir nicht möglich, unter den Betten nach der anderen Seite durchzusehen. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als das Zimmer zu betreten und zu durchsuchen. Also stieg ich sehr vorsichtig durch die Luke und hatte die Augen überall. Als ich am Schrank stand, um hinter die noch hängenden Sachen zu schauen, hörte ich hinter mir, von den Betten her, ein schabendes Geräusch. Da meine Nerven ohnehin zum Zerplatzen waren, drehte ich mich mit einem Ruck um und schoß intuitiv wie wild in diese Richtung. Hinter dem Bett hatte der zweite Mann gelegen. Er hatte eine Pistole in der Hand und war im Begriff, auf mich zu schießen. Jedoch, ich war schneller. Einer von meinen Schüssen traf ihn in den Kopf. Er war sofort tot. Erst hinterher, als sich die Spannung bei mir löste, zitterten mir Hände und Knie. Ich war kaum fähig, die Wendeltreppe wieder nach unten zu steigen. Da kamen auch schon meine Kameraden angestürzt.
„Mann, war das ein Schuß", meinte mein Freund Horst anerkennend, als er den Toten sah.
„Nein", antwortete ich ihm, „es war nur unwahrscheinliches Glück, sonst läge ich jetzt so hier."
In der Zwischenzeit hatte sich die Rote Armee von ihrem Schock des deutschen Gegenangriffs erholt und befand sich bereits wieder im Vormarsch. Alles, was irgendwie verfügbar war, wurde gegen diesen Vormarsch eingesetzt.
Einige Kilometer nördlich von unserem derzeitigen Standort hatte eine Polizeieinheit den Auftrag, eine strategisch wichtige Höhe in der Nähe der Bahnlinie Dresden–Elsterwerda zu besetzen und zu verteidigen. Diese Höhe lag inmitten des derzeitigen Kampfgebietes.
Es war Mitte April.
Wir erhielten den Befehl, uns mit unserem Kommando sofort dorthin in Marsch zu setzen und bei dem Sturmangriff der Polizeieinheit auf besagte Höhe die Flankensicherung zu übernehmen. Als wir dort ankamen, hatte sich die Polizeieinheit eben formiert und vorbereitet. In der hinter der Höhe liegenden weiten Talsenke war eine heftige Panzerschlacht im Gange. Es waren schätzungsweise 15 bis 18 Panzer auf jeder Seite beteiligt. Sie lieferten sich ein verbissenes Feuergefecht. Einige Fahrzeuge standen schon zerschossen und brennend im Gelände. Schon allein wegen der Kulisse dieser Panzerschlacht herrschte bei uns Hochspannung. Diese Spannung löste eine allgemeine Nervosität aus. Man hörte Worte wie: „Verdammte Scheiße" oder: „Ich hab die Schnauze restlos voll" und ähnliches.
Angeheizt wurde diese Stimmung noch, als plötzlich ein Schuß fiel und ein Offizier tot zusammenbrach. Es gab eine fürchterliche Aufregung. Wo kam der Schuß her? Alles suchte die Umgebung mit den Augen ab.
Da entdeckte jemand, wie sich oberhalb der Böschung, jenseits der Straße, ein Grasbüschel bewegte. Er gab sofort Alarm, und mehrere Soldaten eröffneten das Feuer. Sie stürmten auf die Böschung und fanden einen russischen Scharfschützen. Er war bereits tot.
Durch dieses Ereignis war natürlich ein mächtiges Durcheinander entstanden. Der Kommandeur der Polizeieinheit erteilte deshalb den Befehl zu erneuter Angriffsformation. Wir begaben uns wieder an den linken Flügel.
Der Sturmangriff verlief zunächst wie bei einer Übung. Die Angriffseinheit hatte sich weit auseinander gezogen, und wir konzentrierten uns auf die linke Flanke. Die Höhe, auf deren Gipfel sich ein kleines Wäldchen befand, wurde keilförmig gestürmt und im Handstreich eingenommen, ohne einen Schuß abzugeben. Es war vermutet worden, daß sich der Gegner in dem Wäldchen verschanzt hat und uns entsprechend empfangen wird. Aber die Höhe war unbesetzt.
Die Freude und die allgemeine Erleichterung war groß, als wir uns alle wohlbehalten auf einer Lichtung in diesem Gipfelwäldchen, wie nach einer Sportveranstaltung, wiedertrafen. Doch dieser Freude wurde schnell ein Ende bereitet.
Plötzlich schlug, etwa 200 m von uns entfernt, neben den Bahnschienen eine Granate ein. Nur wenige von uns bemerkten dies, da wir uns sehr sicher fühlten. Im nächsten Augenblick detonierte wieder eine Granate, diesmal rund 100 m näher. Die Einschläge wiederholten sich mit immer kürzer werdenden Abständen. Unser Kappo meinte:
„Die schießen sich mit Granatwerfer auf unsere Höhe ein."
Im nächsten Moment schlug schon eine Granate unmittelbar neben unserer Stellung ein. Drei Kameraden von der Polizeieinheit waren sofort tot. Das war ein echter Schock, denn damit hatte niemand gerechnet. Allen stand das Entsetzen im Gesicht geschrieben.
Da wir diesem Granatwerferbeschuß vollkommen deckungslos ausgeliefert waren, kam der Befehl zum sofortigen Rückzug. Unser Kommando jagte nunmehr an der rechten Flanke talwärts. Nachdem wir etwa 50 m im Laufschritt zurückgelegt hatten, wurden wir plötzlich von der Höhe, wo wir vor wenigen Augenblicken selbst noch waren, mit Maschinengewehren beschossen. Wir warfen uns sofort flach auf den Boden. Der Beschuß hörte auf!
Sobald wir uns jedoch bewegten, bellte das MG wieder los. Ich hörte die Kugeln über meinem Kopf pfeifen und sah etwa einen Meter vor mir die Erde aufspritzen, wo die Geschosse einschlugen.
Auf dem Feld, auf welchem wir lagen, war die Winteraussaat vielleicht 10 cm hoch. Wir trugen Tarnjacken, die uns wahrscheinlich das Leben retteten.
25 bis 30 m vor uns begann ein Kartoffelfeld, mit den Furchen quer zum Hang liegend.
Wir mußten versuchen, robbend dieses Feld zu erreichen, dann waren wir aus der Gefahrenzone. Jedoch jede Bewegung löste erneuten Beschuß aus. Zentimeter für Zentimeter schoben wir uns nach vorn. Neben mir lag mein Kamerad Horst Sterzel und rief mir besorgt zu:
„Baß off, Werner, lass' dich ni dodschießen." Er war ja schließlich aus Leipzig.
Diese ängstlichen Worte in der kindlichen Form werde ich nie vergessen. Einige Male war ich versucht, meinen Karabiner, welcher mich ja sehr behinderte, einfach liegenzulassen. Aber ich tat es nicht. Erstens hatte ich Angst vor einer Bestrafung und zweitens war ich überzeugt, daß ich den noch dringend brauchen werde.
Dann war auch die Versuchung sehr groß, einfach aufzuspringen und zu dem Kartoffelfeld zu laufen. Doch das wäre unser sicherer Tod gewesen. Es hieß also die Nerven behalten und zu hoffen, daß der Gegner weiterhin wegen der Hanglage immer wieder über uns hinwegschießen möge.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis wir unversehrt das rettende Kartoffelfeld erreichten. In den Furchen hatten wir ausreichend Deckung, um darin quer zur Schußrichtung wegrobben zu können. Als wir aus dem Sichtfeld des Gegners heraus waren, wurde das Feuer eingestellt.