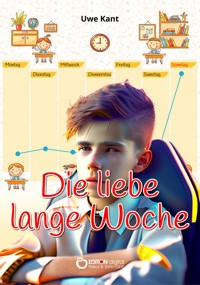7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Schüler Otto Hintz ist ein sympathischer Spinner. In seiner Phantasie springt er von einem lustigen Abenteuer zum anderen. Aber sein Zeugnis ist voller schlechter Noten. Die Versetzung ist gefährdet. Doch seine Lehrer wissen Rat. Als er zu der für seine Zukunft wichtigen Aussprache zu spät kommt, entschuldigt er sich damit, dass er den Kanarienvogel einer Nachbarin aus einem Baum retten musste. Für uns ist die Geschichte von Otto Hintz etwas ungewöhnlich, denn sie spielt in der DDR. In diesem Buch erfährt der Leser, wie junge Menschen in der DDR lebten: nicht besser, nicht schlechter als jetzt … aber anders. Das Buch von 1969 wurde 1971 von der DEFA unter dem Titel „Männer ohne Bart“ verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Uwe Kant
Das Klassenfest
ISBN 978-3-96521-894-9 (E-Book)
Das Buch erschien 1969 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
© 2023 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Für Leser von 13 Jahren an
1
Genau in dem Moment, als ich mir mein Fahrrad schnappte, dachte ich: Otto Hintz, es sieht haarscharf so aus, als ob du eine Flasche bist. Ich bin nicht so eine Art Marathonläufer, straßauf, straßab, zuletzt ins Grab, das Wandern ist des Müllers Lust, Hintz mit seinen meilenfressenden Wunderbeinen und so ähnlich, und wenn es nicht allzu kalt ist, fahre ich auch im Winter mit dem Rad. Das war also nichts Neues für mich und nichts Besonderes. Bloß die Idee mit der Flasche, die war mir neu. Nagelneu, eine Sekunde alt. Nickel, mein verehrungswürdiger Klassenlehrer Nickel, hat es allerdings schon immer gesagt. „Otto, mein kleiner Liebling, du bist ein Paarhufer, ein Fischauge, ein Bleisoldat, ein Schelmuffsky und eine große Flasche, du musst bedeutend mehr Gebrauch von den kleinen grauen Gehirnzellen machen, du hast genug davon!“
Aber darauf kann man noch nicht bauen, denn schließlich bin ich bestimmt kein Bleisoldat, wenn Nickel es auch gesagt hat. Deshalb muss ich wohl erzählen, wie ich ganz von alleine auf „Flasche“ gekommen bin. Bekannt gegeben habe ich es nun einmal, und da muss ich es auch begründen. Sonst denkt noch einer, dass ich so eine Art Margot Zeidler bin. Margot Zeidler kommt immer in die Klasse geschossen und erzählt den anderen Weibsbildern oder Jugendfreundinnen, dass ihre verrückte Haarfrisur heute wieder gar nicht sitzen will und dass sie sich schon gar nicht mehr sehen kann. Dann kommen gleich ihre sogenannten Freundinnen angerannt – sie hat immer vier bis sieben davon – und kreischen los, dass sie doch schau aussieht und so weiter. Also, ich bin nicht Margot Zeidler, das kann sich jeder notieren. Der Einfachheit wegen könnte ich natürlich darauf hinweisen, dass ich die schriftliche Begründung für meine mächtige Selbstkritik schon schwarz auf weiß mit mir rumgeschleppt habe, als ich mich in den Sattel schwingen wollte. „Auf Grund mangelnden Fleißes und starker Ablenkung durch außerschulische Interessen sind trotz vorhandener Begabung Ottos Leistungen derart gesunken, dass die Versetzung in die zehnte Klasse sehr ernsthaft in Frage gestellt ist.“ Dann kam noch eine ganze Menge unangenehmer Ausdrücke, die sich alle nach „Durchrasseln“ und „nur ein Wunder kann hier noch retten“ anhörten. Das Schönste waren die Zensuren: Physik und Mathe Vier, Russisch Fünf. Zweien nur in Deutsch und Sport. Margot Zeidler hätte bestimmt glatte vier Wochen darüber geheult. Aber ich, ich bin ein harter Mensch, ich kann eine ganz schöne Portion vertragen. Und ich glaube jedenfalls nicht, dass ich mit der Wimper gezuckt habe – oder höchstens ein bisschen –, als Nickel mir das wertvolle Dokument in die Hand gedrückt hat. Und darum kann ich auch nicht einfach dieses Papier umherzeigen und ausrufen: Seht nun selbst, liebe Freunde und Anwesende, was für eine Flasche Otto Hintz ist und was es überhaupt so mit ihm auf sich hat! Ich weiß nicht recht, wie ich mich ausdrücken soll, ich bin ja kein Philosoph. Jedenfalls bin ich erst so richtig verrückt geworden, als ich mir mein Fahrrad greifen wollte. Oder noch genauer gesagt, als ich den Lenker in die Hand genommen habe. An dem Lenker sind früher mal solche roten geriffelten Gummigriffe gewesen. Mit der Zeit werden die Dinger natürlich mürbe. Erst war der eine weg, dann der andere. Ich muss sie wohl verloren haben. So närrisch kann ja keiner sein, dass er solch altes mürbes Zeug klaut. Na schön, sie waren schon zwei oder drei Monate weg, und seitdem hatte ich mir dauernd vorgenommen, neue anzuschaffen. Das ist mir wieder eingefallen, als ich die nackten, bloßen Enden von dem Lenker gesehen habe. Tschjort wossmi, das sah vielleicht zum Kotzen aus oder meinetwegen: es machte einen durchaus unschönen Eindruck auf den Betrachter. Dabei hatte ich doch Dienstag hingehen wollen. Das war sowieso die ganze Geschichte, dass ich immer an irgendeinem Dienstag irgendwohin gehen wollte und irgendetwas erledigen. Aber dann kam mir plötzlich der Mittwoch viel passender vor, und dabei waren die verflixten Wochen rumgegangen, und nun hatte ich den Lenker in der Hand, und das Rad kam mir vor wie ein Haufen Blech, und ich war der Blechmajor. Dann hatte ich an mein elendes Zeugnis gedacht, und mir war klar geworden, dass ich tatsächlich eine Flasche sein musste. So war das. Es ging ganz schnell.
Meine Mutter war noch nicht zu Hause. Wenn sie Frühschicht gehabt hat, geht sie meistens erst einkaufen, ehe sie kommt. Aber nicht bloß zum Bäcker und zum Fleischer, sie streift auch durch das neue Kaufhaus und kauft „nützliche Sachen“. Man weiß ja gar nicht, wie viele „nützliche Sachen“ die HO-Menschen zusammengetragen haben. Meine Mutter tut, was sie kann, und findet trotzdem immer was Neues. Für das Geld, das die ganzen Fisimatenten uns schon gekostet haben, hätte ich bestimmt schon ein halbes Motorrad gehabt. Aber davon will sie nichts wissen. Wir sollen nämlich mal einen gewissen Onkel Bernhard in der Familie gehabt haben, der soll ein fürchterlich schlechter Mensch gewesen sein. Und zwar ein „Wüstling“, der immer sein ganzes Geld teils für Schnaps und teils für Benzin ausgegeben hat. Eines Tages hat er beides auf einmal gemacht und ist „in den Tod gerast“ – wie meine Mutter sagt. Ich habe mir das genauer erklären lassen und sage unter uns Kennern, dass das Ganze ein klarer Fall von Nichtbeachtung der ersten Vorfahrtsregel gewesen ist. Ich sage meiner Mutter immer, dass ich ja bekanntlich nicht der wüste Onkel Bernhard bin und ob sie mich schon Schnaps trinken gesehen hat (ich trinke wirklich keinen, höchstens helles Bier) und ob ich ihr an der Kreuzung bei der Post die Vorfahrt erklären soll. Aber da hört die gar nicht erst hin. „Nein, nein“, sagt sie, „der Führerschein geht voran dem Totenschein.“ Das muss ihr eine von den Tanten erzählt haben, mit denen sie Wäsche rollen geht. Meine Mutter kauft lieber „nützliche Sachen“. Sie hatte auch-römisch-ägyptischer Streitwagen in Kleinformat. Er war goldfarben eloxiert. Meistens erkenne ich gleich, wozu diese Sachen gedacht sind. Aber das Ding war mir noch schleierhafter als seinerzeit der Zwiebelschneider „Weine nicht“ und der Rillenglasöffner „Frauenlob“. Das musste ich mir erst erklären lassen. Also, die Räder waren mehr so zum Stehen da. Jedenfalls drehten sie sich nicht. Aber die Deichsel war wichtig, auf die sollte man nämlich Salzbrezeln hängen, und in die kleine Gondel, die für den Kutscher eingebaut ist, konnte man Salzstangen stellen. Natürlich kann man über so einen ulkigen Apparat eine ganze Menge ausgezeichneter Witze reißen. Ich lass das aber meistens. Meine Mutter sagt dann, dass sie schließlich auch was vom Leben haben will. Dagegen kann man nichts sagen. Mir war sowieso nicht nach Witzen, weil ich an meine Urkunde denken musste, an diesen Jagdschein. Ich war innerlich so verrückt, dass ich mir beinahe in ihrer Gegenwart eine Zigarette angesteckt hätte. Nickel steckt sich auch immer erst eine Zigarette an, wenn er mir im Lehrerzimmer oder auf dem Schulhof „eine Audienz gewährt“. „Nun, mein jugendlicher Freund“, fängt er an und bläst den Rauch durch die Nase und kneift die Augen zusammen, „ich höre viel, ich sehe viel.“ Aber ich weiß Bescheid. Das hat er auch bloß aus Kriminalfilmen, dem Verbrecher sollen erst einmal die Knie weich werden. Ich aber bin ein harter Mensch. Ich habe auch keine Angst vor meiner Mutter, das soll sich bloß keiner einbilden. Aber wenn sie sieht, dass ich mir eine anstecke, fängt sie doch nur an, mir was von Lungenkrebs und solchen schrecklichen Sachen zu erzählen. Sie kennt einen Haufen Fälle, und ich höre das nicht gern. Ich ließ mir also erst einmal den komischen Salzbrezelwagen erklären, und als sie sich am meisten gefreut hat, hab ich ihr das Zeugnis unterbreitet. Ich sagte: „Du musst hier mal unterschreiben.“ Ich glaube ja, ich hatte es fast so lässig hingekriegt wie ein Millionärssohn, der seinem Millionenvater die neueste Rechnung für einen Jaguar oder Maserati in die Hand drückt. Sie hätte also irgendwas von „alter Racker“ oder „noch mal mein Ruin“ brummeln müssen, meinetwegen hätte sie mich auch noch ein bisschen an den Haaren ziehen können; in dieser Art. Aber es kam anders, ich konnte leicht sehen, dass ihr die Sache mächtig an die Nieren ging. Sie fing an, Salzbrezeln auf die verdammte Deichsel zu hängen, bis der Wagen das Übergewicht bekam und die Hälfte wieder runterrutschte. Dann sagte sie: „Ach, Ottchen.“ Da wusste ich Bescheid; nun wurde es wirklich schlimm. Ich könnte krank werden, wenn meine Mutter in einem bestimmten Ton „ach, Ottchen“ zu mir sagt. Wer das nicht so kennt, denkt sich vielleicht, dass sich das ganz ulkig anhören muss. Ist aber ein Irrtum, das hört sich mehr an, als wenn sie die Glocken läuten für einen, der gestorben ist.
„Na ja“, sagte ich leise und vorsichtig. Aber weiter fiel mir nichts ein, und sie wollte auch gar nichts hören.
„Ach, Ottchen“, sagte sie, „wie kommt denn das bloß, ich weiß ja gar nicht, du warst doch früher immer so gut.“
Das war allerdings ein bisschen übertrieben, besonders gut war ich wahrhaftig schon lange nicht mehr. Ach du meine Güte, vielleicht damals bei Fräulein Nagel, die wir Drahtstift nannten, in der zweiten Klasse vielleicht, da hab ich in Heimatkunde eine Eins gehabt, da muss ich noch ein verteufelt schlaues Kerlchen gewesen sein. Dass sie nicht richtig Bescheid wusste, konnte allerdings stimmen. Meine Mutter hat so eine Art, in den Zeugnissen zu buchstabieren. Sie liest „Erdkunde befriedigend“ und denkt sich wer weiß was dabei. Vielleicht malt sie sich das so aus, dass der alte Wesnick unheimlich zufrieden mit mir sein muss, wenn im Zeugnis steht „Erdkunde befriedigend“. Aber dieses Mal waren ihr doch die vielen hohen Ziffern ins Auge gefallen. So viele waren es auch noch nie gewesen.
Sie fing wieder an: „Ach, Ottchen, warum bist du denn bloß mit einem Mal so schlecht? Du hast doch ...“
Ich bekam große Angst, dass Mutter anfangen würde zu weinen. Sie ist eine sehr kräftige Frau mit dicken Armen, und sie ist immer sehr ordentlich frisiert. Also, ich will nur sagen, das steht ihr nicht, das Heulen.
2
Ich stand im Lehrerzimmer hinter der Gardine und guckte noch ein bisschen auf den Hof. Die Gardine war so neu wie die ganze Schule, ein halbes Jahr alt; genauso neu wie ich als der Lehrer. Ganze sechs Monate vorher hatte ich hier zum ersten Mal gestanden und auf den Schulhof gesehen. Die Schüler waren zum Eröffnungsappell angetreten, sie bildeten ein noch unruhiges, hin und her wogendes Viereck um den Fahnenmast. Man konnte sehen, dass sie alle zuversichtliche junge Leute waren. Und man konnte hören, dass sie einander viel zu erzählen hatten, die Kleineren schubsten sich ein wenig herum dabei und versuchten einander mit gellenden Stimmen zu übertönen. Die Größeren pflegten mehr das Einzelgespräch, sie wirkten wie eine Schar würdiger Spezialisten während einer Pause der Tagung Deutscher Perlhuhnzüchter.
„Na, bitte, wunderbar, wunderbar, heiter kann das werden, außerordentlich heiter!“ Das war die Kollegin Schlehmann, die neben mir am Fenster gestanden hatte. „Da haben wir ja die liebe 3b“, sagte sie vorwurfsvoll und zeigte auf eine besonders unruhige Ansammlung kleiner Mädchen und Jungen am rechten Flügel.
„Ach, Ella, nun hör auf, du schaffst das schon, das weiß doch jeder, und dann kommen Sie mal, liebe Kollegen, wir müssen wohl“, sagte der Direktor.
Der Direktor war ein sehr kleiner Mann, aber kein Wiesel oder Zappelphilipp, er stand fest auf kurzen Beinen, und er sprach mit einer tiefen, ganz ruhigen Stimme. Mit dieser Stimme hatte er mich überredet, in einer sechsten Klasse vorläufig auch den Mathematikunterricht zu übernehmen, „das bisschen Bruchrechnung“, weil Not am Mann sei, und rechnen könnten ja wohl auch Deutschlehrer. Mit dieser Stimme hat er die Kollegin Schlehmann davon überzeugt, dass sie gerade die Richtige für die etwas zweifelhafte 3b sei. Mit dieser Stimme hatte er am Ende seiner Rede zum Eröffnungsappell gesagt: „Und nun geht in eure Klassenräume, schont Tische und Bänke, die sind nämlich neu, schont eure Lehrer ein bisschen, einige sind ja auch neu, aber schont euren Grips nicht, damit ich am Ende des Schuljahres, wenn wir wieder hier stehen, auch lauter angenehme Sachen sagen kann.“ Das war vor einem halben Jahr, die Gardine, hinter der ich jetzt stand, war seitdem schon ein bisschen gelb geworden. Von den Zigaretten der Kollegen Direktor Menschke, Mathematiklehrer Blaustock und Chemielehrer Vorgert, von der Pfeife des Physiklehrers Kreibel, von den Zigarren des Geografen Wesnick und den Zigarillos des alten Zeichenlehrers Hoffmann. Ja, sicher, auch der Rauch, den ich hier in die Luft geblasen hatte, hing schon in der Gardine. Schließlich war auch ich ein sorgenvoller Pädagoge geworden seitdem. Am Ende musst du aufpassen, dass du nicht auch gelb wirst wie das Dederonzeug vorm Fenster, dachte ich.
Auf dem Schulhof lag von vielen hundert Füßen zertrampelter Schnee, auf den Hügeln am Rande des Hofes, die von Erdarbeiten für die Schule übriggeblieben waren, versuchten sich noch ein paar Schüler aus unteren Klassen im Schlittern; ihre Mappen hatten sie in den Schnee geworfen, darinnen die Zeugnisse, die guten, die mittelmäßigen und die schlechten: „… muss seine schulischen Arbeiten mit größerer Sorgfalt erledigen“, „… seine rasche Auffassungsgabe verleitet ihn“ und „… neigt zur Überheblichkeit“, aber nein, das letzte ist aus einem anderen Zeugnis, lieber Nickel, dachte ich, aus einem der letzten Zeugnisse des Schülers Nickel ist das. Und dies erinnert uns daran, dass auch all die gestrengen und schlauen Lehrer einmal Schüler gewesen sind. Bei dir ist das noch gar nicht so lange her. Fünf Jahre, nein, fünfeinhalb.
Das einhalb war wichtig. In diesem halben Jahr hatte ich gründlich die Plätze getauscht, ich stand nun vorne, lehrte, ermahnte, hielt auf Ordnung. Und heute hatte ich zum ersten Mal selbst Zeugnisse ausgegeben, mit meiner Unterschrift und mit meinen Beurteilungen. Ich hatte sie nicht nach Qualität, sondern nach dem Alphabet verteilt. Von Carla Anton bis Margot Zeidler. Das erhöhte die Spannung und gab mir Gelegenheit zu allerlei vergleichenden Bemerkungen. Dem leuchtenden Beispiel der Irmtraud Harder stellte ich das ziemlich finstere des Otto Hintz gegenüber.
„Man kann sein Lebensschiff verschiedenen Kurs steuern“, sagte ich, „das fängt schon in der Schule an, man muss rechtzeitig auf den Kompass gucken, das heißt also, hm, Sinn und Ziel seines Lebens geradlinig ansteuern. Otto hingegen treibt mit einer schlechten Strömung und wird in gefährliche Klippen geraten, wenn er, hm, das Steuer, also das Ruder, nicht rechtzeitig herumreißt.“
Ich wollte in diesen seemännischen Vergleichen noch ein bisschen weitermachen, aber da meldete sich die ordnungsliebende Schülerin Helga Betke und sagte, sie habe nicht siebzehn, sondern nur sechzehn Tage entschuldigt gefehlt.
„Soso“, sagte ich, „nur sechzehn Tage, sieh einer an; wir können das natürlich korrigieren, aber es wird nicht besonders gut aussehen, weißt du, man müsste radieren, am besten, wir lassen das so, macht ja auch weiter nichts.“
Eigentlich hätte ich auf die winzige Differenz von nur einem Tag stolz sein können. Ich hatte einige Wochen vergessen, die Anwesenheitsliste im Klassenbuch zu führen, darum musste ich anhand der Entschuldigungszettel kalkulieren: „fiebrige Erkältung – vier Tage“, „leichtes Unwohlsein – ein Tag“. Aber es ärgerte mich nun, und ich hatte auch keine Lust mehr, die weiteren Irrfahrten von Otto Hintzens Lebensschiff auszumalen. Es kam mir allmählich auch etwas albern vor, was sollten sich diese Burschen schon unter dem Sinn des Lebens vorstellen, die hatten ihre Zensuren, und fertig. Obwohl, ein schlechter Junge war Otto Hintz eigentlich wirklich nicht. Vielleicht hätte ich ihm das sagen sollen: Du bist kein schlechter Junge, nur pass auf, dass du nicht einer wirst. Na ja, das sind alles so Albumsprüche. Die sollen einfach lernen, die sind doch nun alt genug, herrje!
„Herrje sagt man nicht“, murmelte Blaustock, der am langen Konferenztisch saß und den amtlichen Winterfahrplan der Deutschen Reichsbahn studierte, „herrje ist was aus dem Religionsunterricht, und dafür haben sie hier keine Kräfte, aber wenn du das vielleicht übernehmen würdest, Bruder Nickel?“ Er sah mich ernsthaft an und hielt den Fahrplan wie ein Gebetbuch.
„Ja“, sagte ich, „und wenn der Schulinspektor kommt, schmeiß ich ’n bisschen Weihwasser auf die Schwelle.“
„Nein“, sagte er, „Anschauungsmaterial haben die glaub ich nicht. – Aber mal was anderes, um vierzehnuhrnulleins fährt dein Zug D 71, und um vierzehnuhrsiebenundzwanzig fährt mein Zug P 112. Gehen wir zusammen?“
„Sicher“, sagte ich.
Blaustock war genauso lange Lehrer wie ich. Er war Mathematiker mit Leib und Seele und hielt mir manchmal Vorträge über Mengenlehre und natürliche Zahlen. Aber sonst war er schon in Ordnung. Manchmal gingen wir zusammen in die beste Gaststätte, bestellten das teuerste Essen und tranken Weißwein dazu, das fanden wir großartig. Wir hatten uns gemeinsam eine elektrische Eisenbahn gekauft, die wir an freien Nachmittagen durch sein Zimmer sausen ließen. Ihm war das immer ein bisschen peinlich, und als uns einmal ein Kollege dabei überraschte, sagte er, sie sei für seinen Neffen, und man müsse das Ding ja schließlich erproben.
Auf der Straße zwischen den langen gelben Neubaublöcken lag kein Schnee mehr, die schweren Tieflader, die vom Plattenwerk kamen, hatten ihn zerquetscht und weggeschleudert.
„Was hältst du denn von Hintz?“, fragte ich.
„Ach, das ist ein verfluchter Clown, der hat einfach keinen Sinn für mathematische Denkvorgänge.“
„Taugt er nichts?“
In diesem Augenblick rasselte ein mächtiger Kipper an uns vorbei, und Blaustock schrie aus Leibeskräften: „Quatsch, er kann nicht rechnen!“
3
Na klar, um sechs war ich hellwach. Das Kraftwerk machte einen Höllenlärm, der Überdruck donnerte durch die Ventile. Ich konnte mir wunderbar vorstellen, wie Christoph Höhnes Vater sich jetzt wieder aufregte. Christoph Höhnes Vater ist der Oberboss vom Kraftwerk, er wiegt zwei Zentner und hat ein rotes Gesicht. Er wird immer ganz wild, wenn der Dampf aus den Kesseln zischt, und abends wütet er dann furchtbar streng in Christoph Höhnes Schularbeiten rum. Aber deshalb war ich nicht so früh aufgewacht, sonst hätte man die Schlaferei gleich ganz sein lassen können oder man hätte in die Altstadt ziehen müssen. In der Neustadt gab’s immer was zu hören. Schwere Kipper fuhren mit großen Kiesbergen umher, Zugmaschinen schleppten vom Plattenwerk die Betonfertigteile für die neuen Blocks ran, vor unserem Block rasselte Tag und Nacht so eine elende Dieselbahn vorbei, und das Kraftwerk besorgte mit seiner Heulerei den Rest. Und dann noch das Gesinge von den Montagearbeitern, die nach der Schicht zu viel Bier getrunken hatten.
Meine Mutter sagte, das wären die schlechten, die ihr Geld nicht nach Hause schickten. Es gab welche, die saßen schon nachmittags auf der Zementumfassung von den Blumenrabatten vor der großen Kaufhalle und hatten einen Kasten Bier vor sich stehen. Sie wurden davon ziemlich musikalisch, und abends sangen sie dann dieses schöne Lied von Rooosemarie, nach der ihr Herz sieben Jahre lang schrie. Das Kraftwerk machte immer noch Krach, aber ich sage ja, davon war ich nicht aufgewacht. Es ist nämlich zum Verrücktwerden, ich wache immer sehr früh auf, wenn ich nicht zur Schule muss, sonntags oder zu Ostern und so. Ich kann nichts machen, kommt der erste Ferientag – rumms, bin ich ein ausgeschlafener Mensch. Das könnte mich aufregen. Ich kneif die Augen zu, zieh mir die Decke über den Kopf und zähle Schafe – das hab ich aus dem Film „In gewissen Nächten“ –, aber es hilft alles zusammen nichts.
Manchmal hab ich schon gedacht, die sollten die Feiertage mehr so auslosen und erst morgens bekannt geben. Der Lautsprecherwagen fährt rum, und einer ruft: „Einwohner von Luckenau! Der Rat der Stadt Luckenau gibt bekannt, dass auf unsere Stadt heute ein Feiertag entfällt! Einwohner von Luckenau! Bleibt alle in den Betten!“ Ich weiß selber, dass das nicht geht, aber ein Genuss wäre es bestimmt. Erst wollte ich mein Radio anmachen, ich hatte aber keine große Lust auf ihre Klingelingjuchhei-Musik, mit der sie einen morgens zwischen sechs und acht immer aus dem Bett kriegen wollen. Nicht dass ich nun wer weiß was für ein Schlagerfan bin und mich mit meinem „Stern“ auf der Straße abbuckle – aber solche Sachen wie „Mit siebzehn, da kann man noch hoffen, da sind die Wege noch offen“ finde ich ganz ordentlich. Wenn ich das gedichtet hätte, müssten die ja jetzt singen „kann man erst hoffen“. Ich meine, wenn man siebzehn ist, dann ist man ja auch bald achtzehn. Dann ist man ein volljähriger Mensch, die Schule hat man hinter sich, man sucht sich ’ne gute Stelle, Geld verdient man auch. Als wir mit Nickel zum Wandertag in Berlin waren, da habe ich an einem großen Hotel ein Schild gesehen, die suchten zum Beispiel einen Silberputzer. Ich glaube, darin wäre ich recht gut, das würde man so flutschen mit dem Silber. Natürlich hätte ich mir bald ein paar Geheimkniffe ausgedacht. Und eines Morgens kommt dann der Hoteldirektor in meine Silberputzerei reingeschneit und sagt: „Tja, mein lieber Kollege Hintz, Sie müssen mal für ein paar Tage nach Leipzig fliegen, da ist der König von Nepal zu Besuch, und diese Majestät ist ja sehr eigen in den Fragen des Silbers.“
„Gut, gut“, sage ich, „ich will bloß eben den Tortenheber noch ein bisschen nachpolieren, so geb ich den nicht weg.“
Na ja. Ich werde aber erst fünfzehn, und das ist der Haken. Und wenn ich wirklich sitzenbleibe, ist sowieso die ganze Laufbahn verpfuscht. Mein Lebensschiff droht in feindlichen Klippen zu zerschellen oder so ähnlich, hat Nickel gesagt. Vielleicht könnte ich später zur Fischereiflotte gehen, das muss ganz gut sein. Man liegt in der Hängematte und priemt, einer spielt auf dem Schifferklavier „Unser Kurs führt nach Norden in die Barentssee“, aber wenn der Hering in Sicht kommt, geht’s natürlich ran an die Netze.
Ich hörte im Badezimmer das Wasser laufen, klar, meine Mutter steht immer viel eher auf, als sie muss. Morgenstunde hat Gold im Munde, sagt sie. Nun wäre ich noch viel lieber wieder eingeschlafen. Was sollte ich schon sagen, wenn sie wieder anfing mich zu löchern: „Ach, Ottchen, Ottchen, wie kommt denn das bloß, du warst doch sonst nicht so schlecht!“ Ich hätte es ihr gern gesagt, aber woher soll ich das denn wissen. Es muss ja wohl mit meinem Gehirn zu tun haben. Ja, das ist es. Diese Furchen für Mathe und solche Sachen, die sind bei mir bestimmt nicht ganz richtig. Ich will ja auch nicht so ’ne Art Adam Riese werden wie Blaustock, aber darauf nehmen die gar keine Rücksicht. In Kreuzworträtselraten müssten die mich mal prüfen. Vor einem halben Jahr bin ich mit meiner Mutter verreist, da saß uns gegenüber so ein Dicker und hat in einem „Troll“ rumgemalt. Der Dicke sah ganz schön schlau aus, vorne hatte er eine Intelligenzglatze, und eine Brille mit Goldrahmen hatte er auch auf. Rechnen konnte der bestimmt, denn er war Buchhalter bei der GPG „Ewiges Blühen“ oder so ähnlich, das hat er meiner Mutter erzählt. Aber sonst war nicht viel mit ihm los. Er wusste nicht, wer dieses berühmte Gemälde „Kreuz im Gebirge“ gemalt hat, und pirschte immer um die leeren Felder rum. Ich hab das genau gesehen, weil ich immer einen langen Hals machen muss, wenn jemand in meiner Nähe Kreuzworträtsel löst. Und als er anfing, seinen schönen Buchhalterbleistift aufzuessen, da konnte ich mich nicht mehr bremsen, und ich habe ihm gesagt, wie der verflixte Maler heißt. Das hatte sich in einem Rätsel mal so ergeben, und derartige Sachen merk ich mir. Meistens werden diese Erwachsenen ja grantig, wenn man ihnen einen guten Rat geben will, und überhaupt er nun mit seiner Goldbrille. Aber das kann ich nicht anders sagen, der war ganz dankbar. Er hat gesagt, ich müsste eine ganz prima Allgemeinbildung haben, und meine Mutter war auch ziemlich stolz und hat gesagt, ja, die Kinder lernen ja jetzt schon allerhand in der Schule, und früher war das nicht so, nicht wahr?
Damit war ich ja dann erledigt. Wenn die alten Leutchen erst mit den früheren Zeiten loslegen, wie sie mit den sogenannten Igelitschuhen rumgelaufen sind und die Zuckermarken immer nicht gereicht haben, dann hat man erst mal Pause. Die müssen wohl denken, dass wir mitten im Schlaraffenland auf dem Sofa sitzen.
Wenn ein neues Schuljahr anfängt, lässt meine Mutter sich immer die neuen Lehrbücher zeigen und findet alles wunderbar. Dann sagt sie noch, ich soll man immer gut aufpassen, und fertig. Und wer muss das alles lernen, was da drin steht? Otto Hintz muss das alles lernen, das ist vielleicht prima eingerichtet. Da kannst du in Kreuzworträtseln noch so gut sein, da fragt dich bestimmt keiner nach.
Meine Mutter war jetzt mit der Wascherei fertig, ich hörte, dass sie auf meine Tür loskam, und machte die Augen zu. Sie zog die Tür auf und flüsterte: „Otto!“ Das ging noch, das war wenigstens besser als „Ottchen“. Ich würde es scharf finden, wenn ich Ben hieße oder Sascha. Aber gegen Ottchen ist Otto direkt noch gut. Deshalb machte ich die Augen ein bisschen auf und blinzelte vorsichtshalber furchtbar verschlafen in die Gegend. Meine Mutter hatte ihren geblümten Nylonmorgenmantel aus dem Westen an. Darin sieht sie immer aus wie Juliane, die Königin der Niederlande. Ich hab noch nie ’ne Königin gesehen, die meiner Mutter so ähnlich sieht wie diese Juliane. Gibt ja nun auch nicht mehr so viele Königinnen. Ich sagte „jaaa“ und gähnte wie ein Wüstenlöwe.
„Pass mal auf“, sagte meine Mutter, „ich habe schon immerzu darüber nachgegrübelt, am neunten Juli hab ich doch meinen fünfundvierzigsten Geburtstag, und da werden wir ja Besuch kriegen, Tante Kuhnert aus Schlate kommt mit ihrem Mann, und Spätzles aus Stuttgart werden wohl auch kommen, und dann kommt bestimmt jemand aus dem Betrieb, ich glaube, ich werde ausgezeichnet.“
Das glaubte ich auch. Meine Mutter wird andauernd ausgezeichnet. Sie muss bei der Arbeit schrecklich rangehen. Wir haben zu Hause eine Menge Urkunden. An der Wand überm Fernseher hängt so eine nachgemachte Grubenlampe mit eingravierter Inschrift „Der Kollegin Hintze für hervorragende Leistungen“; das „e“ im Namen ist ja eigentlich zu viel, aber der Eingravierer wird wohl gerade so in Fahrt gewesen sein. Und im Büfett liegt hinter Glas ein versilbertes Brikett mit der Aufschrift „Glückauf“, das haben sie ihr zum letzten Bergmannstag verehrt.
„Na ja“, sagte meine Mutter, „und da hab ich schon gedacht, das wäre ja nun nicht schön, wenn du dann so ein ganz schlechtes Zeugnis hast oder sogar sitzenbleibst, um Gottes willen, das mach bloß nicht, Junge, und das ist dann doch alles sehr peinlich, wenn die dann fragen, wie macht sich der Otto, wie geht’s in der Schule, was will er denn mal werden?“
Ach du meine Güte, dachte ich, wärst du bloß wieder eingeschlafen, jetzt sagt sie gleich, ich soll ihr ein gutes Zeugnis zum Geburtstag schenken, und sonst wünscht sie sich weiter überhaupt nichts. Das kenn ich von Margot Zeidler, die schenkt ihrem „Papsi“ und ihrer „Mamsi“ auch immer gute Zeugnisse zum Geburtstag. Sie hat Glück, dass ihr Papsi in den Winterferien und ihre Mamsi in den Sommerferien Geburtstag hat, sonst müsste die auch mal für ein Geschenk sparen, die Zeugnisse kriegt sie ja umsonst zusammen.
„Also“, sagte meine Mutter, „das kann doch nicht so weitergehen, deshalb hab ich auch schon immerzu darüber nachgegrübelt, was sollen die denn bloß von uns denken, nicht? Und da habe ich mir gedacht, wenn du zum Schuljahr keine einzige Vier oder Fünf auf dem Zeugnis hast, dann kauf ich dir so ein Moped. Aber bleib mir bloß nicht sitzen.“
Junge, Junge, das machte mich glatt sprachlos; meine Mutter kauft mir ein Moped! Sie musste wirklich lange nachgedacht haben, bis sie auf so eine gute Idee gekommen war.
Ich sagte: „Mensch, Mutter, das wäre vielleicht prima, wir kaufen natürlich einen ,Star‘ mit Fußschaltung, Fußschaltung ist in der Stadt besser, da ruiniert man sich das Handgelenk nicht so, und man fährt auch sicherer.“
„Hauptsache, du bleibst nicht sitzen“, sagte meine Mutter und ging raus.
Ich freute mich wie ein Schneekönig. Ich hopste aus dem Bett und holte mir aus meiner Kiste das „Lehrbuch für den Fahrschüler“. Dann fing ich wie ein Besessener an zu lesen: „Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme ...“
4
Mein D 71 nach Berlin war voll gewesen. Ich hatte im Abteil eingepfercht zwischen ein paar mürrischen Leuten gesessen, die alle, mich eingeschlossen, böse aufeinander waren, dass sie just diesen Zug benutzten. In der S-Bahn war es schon besser gewesen, und bei Weides war es am besten, bei Weides wurde gerade Grog getrunken, als ich kam. Mit dem Ehepaar Weide hatte ich zusammen studiert, und ich konnte bei ihnen wohnen, wenn ich in Berlin war.
Am anderen Tag waren wir zu einer Zusammenkunft der ehemaligen Studenten mit den Wissenschaftlern in unser altes Institut gegangen. Im Institut war alles beim alten. Der Fußboden in den dunklen Räumen, in denen es nach altem Papier und Bohnerwachs roch, knarrte noch immer bei jedem Schritt. Eine spitznasige Studentin mit Vogelnestfrisur blickte unwillig von ihrem Arbeitsplatz auf. Sie las in drei Büchern zugleich und übertrug die daraus gewonnenen Erkenntnisse in vier verschiedene Oktavhefte. Das war vielleicht doch eine neue Methode, wir hatten damals immer alles auf Karteikarten geschrieben. Das Mädchen erhob sich und holte aus einem der hohen, düsteren Regale ein viertes Buch. Na, Mädchen, hoffentlich kannst du auch noch ein bisschen Bruchrechnung, dachte ich. Nebenan erhob sich ein großes Stühlescharren und Tischerücken, die Tür ging auf, und inmitten einer Wolke von Studenten in dicken Pullovern und ausgebeulten Hosen erschien der behände weißhaarige Professor Sörnebeck. Ich drehte mich schnell um und nahm irgendein Buch aus dem nächsten Regal. Professor Sörnebeck legte sich immer mächtig für die Schönheit und Reinheit der deutschen Sprache ins Zeug. Einmal hatte er uns mit beschwörend erhobenen Armen zugerufen: „Und wenn Sie einst in Ihrem Schulamte wirken, so retten Sie den deutschen Konjunktiv!“ Vielleicht habe ich mich umgedreht, weil ich bis dahin in meinem Schulamte noch nicht viel zur Rettung des Konjunktivs hatte beitragen können. Als sie raus waren, stellte ich das Buch wieder hin. Dabei las ich den Titel: „Insel Felsenburg“ von Johann Gottfried Schnabel. Das war ja nun eigentlich auch etwas Neues, dass dieses Werk hier so mir nichts, dir nichts im Regal stand. Bei uns war es von Hand zu Hand gegangen, denn es war Pflichtlektüre und stand beim Lehrkörper in hohem Ansehen. Aber das Studienjahr war wohl noch nicht weit genug vorangeschritten. Als die Weides, die auf der Treppe jemanden getroffen hatten, in den Raum kamen, hielt ich ihnen das Buch entgegen und sagte: „Na?“
„Obwohl in dieser Gesellschaftsutopie aus dem barocken Ritterroman überkommene Elemente unverkennbar sind, handelt es sich doch um ein frühbürgerlich-realistisches Werk“, sagte Marion Weide mit piepsiger Stimme.
„Richtig, mein Goldschatz“, sagte ich, „ich sehe, du hast gelernt wie immer, wie immer, und das wärmt dem alten Herrn Nickel das Herz, und er wird dir wohl eine Eins in Literatur einschreiben müssen, wohlan.“
Das Vogelnestmädchen guckte böse von seinen Oktavheften hoch, und wir zogen uns in den Seminarraum zurück, in dem der Erfahrungsaustausch stattfinden sollte. Die Sache begann mit der üblichen Verspätung und wurde bald ziemlich peinlich. Die Anwesenden spalteten sich in zwei Lager, in das der erweiterten und das der polytechnischen Oberschullehrer. Die Erweiterten verstanden sich mit den Wissenschaftlern ja noch ganz gut. Sie unterhielten sich geläufig über das zu schaffende Klassikbild, über die Ringparabel und über programmierten Unterricht. Aber als ich einwarf, dass ich gegenwärtig für die Rettung des deutschen Dehnungs-h vor gewissenlosen Schülern kämpfte, zum Beispiel in hohl, lahm, kahl und Bahre, guckten sie mich erstaunt an, und ich flüchtete mich zu den polytechnischen Kollegen. Da erzählte ich mit großem Erfolg, wie ich einmal einen Schüler auf dem Hof hundert Pfiffe hatte ausstoßen lassen, weil er im Unterricht gepfiffen hatte. Die anderen hatten ähnliche Sachen auf Lager, und wir amüsierten uns königlich. Dann kamen wir auf die Sitzenbleiber zu sprechen. Sie fingen alle an zu zählen, und ich zählte in Gedanken die meinen. Schwolke – eins, Lehmann – zwei, Hintz, Hintz? Hintz – drei. „Drei wahrscheinlich“, sagte ich.