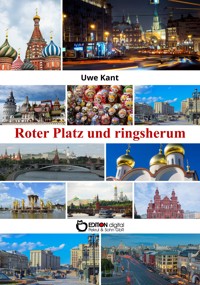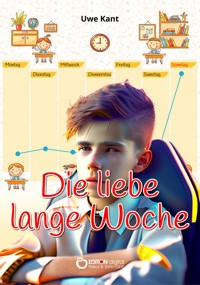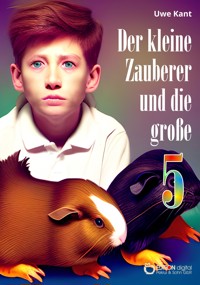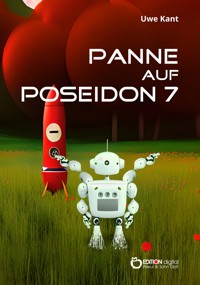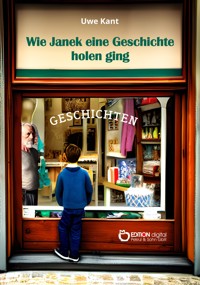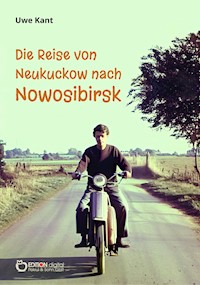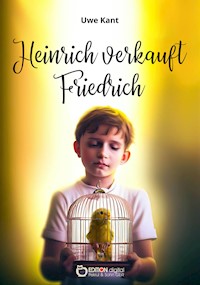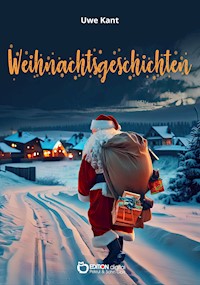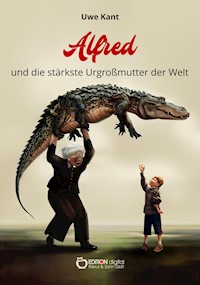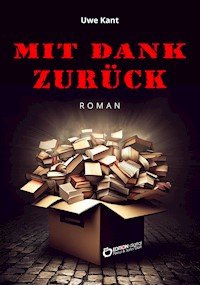
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist so etwas wie ein Sunnyboy der Literatur, der Schriftsteller Anton Mungk, Optimismus und frohe Zuversicht gelangen mühefrei in seine Zeilen. Nur manchmal, beim Blick in den Spiegel, weist er sich selbst zurecht: „He, alter Schönfärber!“ Bis er eines Tages, wir schreiben das Jahr 89, ein Paket erhält: „Früher haben mir Ihre Bücher immer gefallen, jetzt habe ich keine Verwendung mehr dafür. Mit Dank zurück.“ Mungk ist empört. Mungk ist belustigt, Mungk macht sich auf die Suche nach dem Absender und auf den Weg durch ein Land, in dem alles wie immer zu sein scheint und nichts mehr so ist, wie es mal war. Mungk kannte genug Leute, die sogar das Lesen von Romanen Arbeit nannten. Wie auch solche, die das Lesen von längst gehaltenen Reden als Studium bezeichneten. Das ist nämlich die allergrößte Idee - die Einheit von Glauben und maximaler Unwahrscheinlichkeit, wie sie schon an dem bedauernswerten Hiob vorexerziert wurde, und zwar mit jener gewissen rigorosen Ungerührtheit des Experimentators. Das funktioniert je besser und auch immer überzeugender, je länger es her ist, dass die Märchen wahr waren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Uwe Kant
Mit Dank zurück
Roman
ISBN 978-3-96521-896-3 (E-Book)
Das Buch erschien 2000 im Eulenspiegel Verlag. Das Neue Berlin.
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
© 2023 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Für Milenke
1
Es lagen aber nur noch wenige kleine blaue oder gelbe Splitter auf der Erde herum.
Und einer davon, ein winzigkleiner, fuhr ihm augenblicklich in sein Kinderherz und verwandelte sich dort in einen ebenso winzigen Eiszapfen, der nie mehr auftauen wollte.
Weil der so klein war, spürte er ihn selten, vergaß ihn über Jahre.
Aber er war immer da. Es kam vor, dass Mungk ein sehr kühles Herz hatte.
Mungk hatte sich oft für Optimismus ausgesprochen. In seine Bücher gelangte die frohe Zuversicht mühefrei zusammen mit den Geschichten, die ihm hin und wieder eingefallen waren.
Er hatte schon versucht, etwas zu verfassen, wenn er sich in übler Stimmung befand. Aber entweder verließen ihn mit der Laune auch alle brauchbaren Gedanken, oder sein Befinden besserte sich so rasch, dass wieder nichts Düsteres gelingen wollte.
Dies ließ ihn gelegentlich an seinem Künstlertum zweifeln, und er musterte sich finster im Spiegel und rief: He, alter Schönfärber!
Manchmal schrieb er in solchen Stunden einen lange aufgeschobenen Beschwerdebrief, den er anderntags bereute wie ein Saufgelage.
Auch in seinen Interviews kam er um Optimismus selten herum.
Seine Frau sagte, sie haben dich in ihrer Kartei unter geschwätzig und optimistisch.
Im Laufe der Zeit waren eine Menge Interviews zustande gekommen, weil er selten ein Herz oder die Stirn hatte zu dem Bescheid, keine Zeit zu haben. Er hatte nämlich Zeit, wie er fand.
So nahm er seine Zuflucht zu einer stets wirkungslosen Hinhaltetaktik. Im Januar angerufen sagte er einen Termin für den März zu. Noch jedes Mal war der nächste März gekommen, das Blatt war nicht eingegangen, der Sender nicht abgeschafft, der Redakteur nicht verunglückt. Und was für Gedächtnisse oder wenigstens Notizbücher sie alle besaßen.
Es musste wohl der Optimismus sein, der ihn immer frühmorgens, gleich nach dem Aufstehen, selbst bei Schnee noch ohne Socken, an den Briefkasten trieb, zu den Zeitungen hin.
Die Zeitungen rechtfertigten die Vorausfreude selten. Eine Funktion erfüllten sie aber in jedem Fall – sie verlängerten die Zeit am Frühstückstisch. Sie zögerten den Zeitpunkt hinaus, da Mungk anfangen musste, sich mit der optimistischen Prosa zu plagen.
Wenn aber die Furcht besonders groß war, ging Mungk auch noch zum Bahnhofskiosk hinüber und kaufte sonderbare Presserzeugnisse wie „Das Straßengeschehen“, „Der kulturvolle Heimgestalter“ oder „Die Katze“.
Einige Jahre hatte eine dicke alte Frau die Post mit dem Fahrrad gebracht; da kam er schon früh um sechs zu seinen Zeitungen. Dann geriet der Postzeitungsvertrieb in eine ernste Struktur- und Kaderkrise; denn die alte Frau hatte sich den Fuß gebrochen. Schließlich errichteten zwei Männer vorn an der Straße eine Batterie schmaler Blechfächer, die fortan von einem anderen Mann, der im postgrauen Trabant gefahren kam, mit Geschriebenem beschickt wurden.
Nun kamen die Zeitungen gegen halb neun; die Briefe so um zwölf herum.
Mungk las bis neun Uhr Zeitung, lachte dabei einmal schadenfroh über einen Kollegen, der von einer ungeschickten Rezensentin ungeschickt gelobt wurde, registrierte, dass sein eigener Name nirgends vorkam, verlegte sodann am Telefon eine Lesung in einem Strumpfwirkerklubhaus in den Herbst und machte sich endlich an diese heitere Geschichte, in der ein Minderjähriger eine ganze Torte ganz allein aufessen wollte, sich jedoch ständig gehindert sah an der Ausführung des Plans durch Menschen, die so gut oder so vernünftig waren, dass sie derart Verruchtes oder Unvernünftiges überhaupt nicht glauben mochten.
Zuletzt dachte Mungk noch eine Weile über einen großen Hund nach, der einen Part in der Tortengeschichte übernehmen sollte.
Aber zwei Minuten nach zwölf war er wieder am Postkasten. Man hatte ihm ein Schlüsselchen für den Paketcontainer zugeschickt.
Der Anblick des säuberlich geschnürten Pakets ließ Mungks Herz gleich höher schlagen: Vielleicht eine überraschende Übersetzung ins Flämische? Oder eine Nachauflage?
Oben in der Küche riss er eilig die Verpackung auf. Da waren ältere, sozusagen gebrauchte Exemplare seiner Bücher.
Und dann war da noch ein Brief.
Sehr geehrter Herr Mungk!
Früher haben mir Ihre lustigen Bücher immer wirklich gut gefallen. Jetzt habe ich keine Verwendung mehr dafür und schicke sie Ihnen deshalb mit Dank zurück.
Falko Pingel
Mungk erbleichte. Jedenfalls war ihm ganz so. Ja, sagte er, jetzt erbleichst du, was, Mungk? So, sagte er, aha, also keine Verwendung, mit Dank zurück. Er steckte sich eine Zigarette an und las den Brief noch einmal. Tatsächlich. Dann guckte er sich seine Bücher an. Sahen wirklich so aus, als hätte sie jemand gelesen und nicht direkt vor Wut hineingebissen.
Hatten also dem Herrn Pingel, blöder Name eigentlich, irgendwie Karneval, gut gefallen. Nicht etwa sehr gut. Nein, nein. Na ja. Mungk ging in den Korridor und musterte sich finster im Spiegel. Dann ging er in die Küche zurück und faltete das zerrissene und zerknautschte Packpapier auseinander.
Lustige Bücher, sagte er, ja gewiss, natürlich sind es lustige Bücher. Hat vielleicht einer was dagegen?
Immerhin wird darin ja zur Erzeugung von Lustigkeit nicht mit Torten geworfen. Wenn schon Torte, dann geht es darum, dass man nicht ganz allein eine ganze Torte aufessen kann, und zwar aus sittlich-ethisch-moralischen Gründen.
Der große Hund kam ihm wieder in den Sinn. Er dachte daran, einen großen, aber gottergebenen Hund während der ganzen Geschichte hinter dem Tortenbesitzer hergehen zu lassen, wodurch eine humoristische Mine gelegt war, die gelegentlich hochgehen konnte. Ach, du liebe Güte.
Auf dem Packpapier war ebenso wenig eine Absenderadresse zu finden wie auf dem Brief. Mungk dachte flüchtig an ein paar ulkige Namen für den Hund. Er hatte einmal einen Basset namens Kowalski gekannt, und ihm kam eine Geschichte von Hemingway in den Sinn, in der es einen Indianer gab, der Lokomotive Nummer Zweiundvierzig hieß. Oder so ähnlich.
Die Geschichte wollte ihm aber sonst nicht einfallen. Und dieser Pingel wohnte natürlich auch nirgendwo. Heckenschütz, anonymer!
Er schaffte noch das Telefonbuch und die „Neunundvierzig Stories“ in die Küche.
Kein Falko P. in der hauptstädtischen Telefonliste. Selbstverständlich, nur bei Mungk konnte alle Welt anrufen. Aber doch nicht bei Falko!
Mungk ging in den Korridor und stellte das Telefon auf Schnarrstufe. In der Küche schob er dann das Kaffeegeschirr beiseite und fing an, Hemingway zu lesen.
Einmal hörte er doch das Telefon röcheln. Er ging hin und breitete das Federbett seines Sohnes darüber aus.
Er saß eine Stunde oder auch zwei zwischen Kaffeetassen, Brotkrümeln, Marmeladengläsern und Eierschalen und las Hemingway. Dann beschloss er, sein Leben zu ändern.
Mungk konnte im Notfall Anhaltspunkte finden, sich für einen Schriftsteller zu halten. Manchmal nahm er einen Taschenrechner und rechnete aus, wie viel er mit seinen elf vorwiegend dünnen Büchern verdient hatte, die allesamt noch in eine größere Aktentasche passten.
Ein paar Jahre seines Lebens hatte er als eine Art Huckleberry Finn in einem Schulinternat gelebt und beim Abiturball ein drei Nummern zu großes Hemd mit eingestickter schwarzer Rose getragen. Das Hemd hatte vorher einem Reeder in Hamburg gehört. Der Reeder besaß nur ein einziges Schiff. In der Eingangshalle seiner Villa in Klein-Flottbek stand ein Modell davon. Es reichte aber zur Finanzierung täglichen Hemdenwechsels und auch dazu, Mungks nach Hamburg fortgelaufene Mutter, die sie in jenem Hause Luise riefen, als Hemdenwäscherin und Steakbräterin zu halten.
In den Ferien erlaubte der Reeder dem Sohn seines Dienstmädchens, seiner Magd, eines der Fahrräder zu benutzen, die im Heizungskeller herumstanden. Einmal ließ er sich vom bis an den Rand der Blödsinnigkeit verschüchterten Mungk das Schulwesen in der Ostzone erklären.
Zum Abschied hatte er jenes Hemd hergeschenkt.
Der Reeder, fiel Mungk später auf, war der einzige hamburgische Bekannte gewesen, der ihm nicht geraten hatte, in Hamburg zu bleiben, statt in das russisch-kommunistische Mecklenburg zurückzukehren.
Mungk hatte sogar Karrieren bei der Hochbahn, von denen ihm Verwandte sprachen, in den Wind geschlagen, und war jedes Mal getreu zurückgefahren, wie er es dem Kreispolizeimann, der die Stempel in die Interzonenpässe setzte oder nicht, mürrisch gelobt hatte. Der obere Polizist, ein dünner, schlecht rasierter und schon recht alter Mann mit hässlichem Husten hatte ihn rundheraus gefragt:
Und? Kommst du auch wieder?
Mungk, der ein jugendlicher Anhänger des Generalissimus Stalin war, hatte böse blickend geknurrt, dass er sich darauf aber einmal verlassen könne.
Allerdings betrachteten ihn die Lehrer mit Skepsis und gaben ihm vorsichtshalber eine Drei in Staatsbürgerkunde trotz guter Kenntnisse und geradezu vorbildlicher Ansichten. Und das Hemd des Reeders war das allerfeinste im Saal gewesen, bis Karl-Heinz Krüger mit Henkersblick auf Mungks dünnen Hals im faltenschlagenden Kragen ihn auf seine Huckleberry-Finn-Existenz zurückgeworfen hatte mit der kennerischen und kaltherzigen Verkündigung: Das Hemd ist ja drei Nummern zu groß!
Mungks Berechnungen hatten trotz Mikroelektronik nur ungefähren Charakter. Weil er einerseits nicht Ordnung und Überblick hielt, es ihm andererseits peinlich schien, im Verlag nachzufragen, musste er seine Auflagenhöhen aus vergangenen Jahren schätzen. Auch wusste er nicht mehr genau, wann er von der Zehn- über die Elfeinhalb bis in die Fünfzehn-Prozent-Klasse gehoben worden war. So wenig Mungk seine Briefe, seine Verträge, seine Fan-Post, seine Urkunden, seine Rezensionen sammelte, so wenig hatte er sein Geld gesammelt. Er hatte sich davon verschiedene Fahrräder, Radios, Jacken und Hosen und auch ein backsteinernes Bauernhaus gekauft.
Einmal gehörten ihm vierzehn Tage lang drei Autos auf einmal, denn er scheute die Mühen und Konfrontationen des Verkaufshandels. Das dritte, das eigentliche Auto parkte er zehn Fußminuten entfernt und schlich sich heimlich zu ihm hin und wieder davon fort (wegen der Sittenwidrigkeit in einem Land, in dem manch einer fünfzehn Jahre auf ein neues Auto wartete), bis kaltblütigere Freunde die erforderlichen Transaktionen für ihn besorgt hatten.
Nun aber saß Mungk der Reiche, der es von einer Dreiviertel-Waise in außerordentlich durchlöcherten Socken bis zum Träger des Sehr Großen Preises (SGPT) Dritter Art gebracht hatte, zwischen den Trümmern eines deutschen, DR-deutschen Drei-Personen-Frühstücks und fasste den Beschluss, sein Leben zu ändern.
Es war zwar wahrhaftig nicht das erste Mal, aber er erschrak doch merklich davor.
Zuerst stellte er die Verbindung zum Leben in den Büros und Sekretariaten wieder her, indem er das Telefon vom Bette befreite und den Schiebeschalter auf große Glocke rückte. Und schaltete den Abwaschboiler ein, trug den randvollen Mülleimer hinunter, schichtete Zeitungen, versammelte leere Flaschen in einem Korb, spülte Geschirr, fuhr mit dem Staubsauger durch die ganze Drei-Zimmer-Wohnung, wies zwei Einladungen in die Altmark freundlich von sich und zog ein paar Uhren auf. Zwischendurch kam Mungks dreizehnjähriger Sohn aus der Schule und fragte: Was machst du denn?
Ich ändere mein Leben, sagte Mungk.
Ach so, sagte der Sohn, na, ich muss gleich zum Training.
Als seine Frau nach Hause kam, saß Mungk vor der Schreibmaschine. Die Torten-und-Hund-Geschichte hatte er ausgespannt. Er besah ein paar Sätze über einen Jungen, den er einmal gekannt hatte und der auf dem Wege zum Sonntagsfußball immer in der katholischen Kirche Station machen musste, und sie hatten ihn gefragt, ob da drinnen eine Anwesenheitsliste geführt werde. Als das nicht der Fall war, hatten sie doch das Vorhandensein höherer Mächte kurz in Erwägung gezogen.
Was machst du, fragte seine Frau.
Memoiren, sagte Mungk, ich schreibe jetzt besser meine Memoiren. Der Zeitpunkt ist überraschend herangereift. Drum heraus gegen uns, wer sich traut! Und du? Was machst du?
Ich hätte da schon noch ein paar Aufsätze.
Will ich meinen, sagte Mungk, oho. Unsere islamischen Freunde und Genossen, die haben ihre Koranschulen. Wir hingegen haben unsere Aufsatzschulen. Warum, zum Teufel, lässt du nicht ein paar ausfallen. Diese Kinder schreiben heutzutage sowieso zu viel. Jetzt fangen sie schon mit anonymen Briefen an.
Was hast du, sagte seine Frau, hat dich wieder jemand gefragt, ob du’s auch für Erwachsene kannst?
Viel schlimmer, sagte Mungk, was das betrifft – viel schlimmer. Auch das jugendliche Publikum wendet sich von mir ab. Man wirft mir meine netten, lustigen, bunten Bücher, welche, wie du weißt, jedenfalls gestern noch gewusst haben wirst, in einem sehr frischen Stil gehalten sind, einfach vor die Tür. Im ganzen Land brechen meine Fanklubs zusammen, meine Ausstoßung aus den Verzeichnissen scheint unmittelbar bevorzustehen.
Himmel, sagte seine Frau, jetzt weiß ich, sie haben dich nicht unter den hundertzwanzig führenden Autoren des Landes genannt.
Ach du, sagte Mungk, hier, guck dir das an, Falko Pingel, unbekannter deutscher Briefschreiber. Er hat einen völlig eisigen Ton, merkst du das?
Er sah seiner Frau an, dass sie es nicht merkte, und riss ihr den Brief ärgerlich aus der Hand.
Gut, gut, sagte er, schön, vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist das alles für die Katz, für die Blaue Karthäuser Zucht oder dergleichen.
Wieso denn, sagte seine Frau, da sind doch deine Bücher, da liegen sie doch, was denn nun noch? Ich denke, du hast kein Sendungsbewusstsein?
Eben, eben, sagte Mungk, wenn ich doch bloß eins hätte. Da könnte mir Falko aber gleich mal den Buckel runter. Nein, ich bin auf Leser angewiesen. Ich bin nix ohne Leser, überhaupt nix!
Ja, ja, sagte seine Frau, ich weiß, du sitzt auf dem Markt – wenngleich ich manchmal denke, du sitzt mehr vor dem Fernsehapparat oder am Lenkrad …
Ich, sagte Mungk habe meinen Stand auf dem Markt, schon recht, genau so verhält es sich.
Um Theoretischem oder bloß Hochgestochenem aus dem Wege zu gehen, war er einst einer Interviewerin mit dem Marktplatz gekommen.
So wie im Orient, wissen Sie? So auf ’nem Teppich, verstehen Sie?
Ja, dachte er, bleib bloß auf dem Teppich, Freundchen.
Ich mach jetzt mal bisschen den Keller, sagte Mungk zu seiner Frau, bin die ganze Woche nicht dazu gekommen. Und du, Feinsliebchen, setz dich aufs Sofa, und nachher essen wir was von Chefkoch Mungk, und dabei betrinken wir uns ganz furchtbar mit diesem neuartigen Pappkartonwein, den die kleinen französischen Kinder immer zum Frühstück kriegen. Unsere Heimat, das sind nicht nur die Kreisbibliotheken und die Fische im Wasser, sondern auch all die Gläser im Schrank und die Dackel im Park, wenn Sie sich das einmal merken wollen ….
Hör auf, Dummkopf, sagte seine Frau, das ist so ein schönes Lied.
2
Am nächsten Morgen fand Mungk mit Hilfe einer Lupe heraus, dass die Pingelsche Sendung laut Poststempel in Badeneck aufgegeben worden war.
Na warte, Falko, dachte er. Kann natürlich sein, du wohnst gar nicht dort. Bist extra mit der S-Bahn bis Franzenshagen und noch vier Stationen mit dem Bus gefahren.
Kann ja sein. Aber wenn du doch da wohnst, dann wird ich dich schon kriegen, mein Junge.
Badeneck war ein alter Villenplatz zwischen der östlichen Ausfallstraße und dem Fluss, an die dreihundert Häuser im ständigen Wettbewerb „Schöner unsere Hecken und Terrassen“ begriffen, bewohnt von Professoren, Komponisten, dem Theaterdichter Redefin und freilich auch von der ohn Ansehn der Person historisch gewachsenen Klientel der Gemeinnützigen Wohnungsverwaltung, die hier und dort den Fuß in der Tür behalten hatte.
Mungk stellte sich vor, wie ein geduckter Falko, das Paket an die Brust gepresst gleich einem altmodischen Attentäter durch Ein- und Ausgänge öffentlicher Verkehrsmittel huschte, um endlich in der intimen Badenecker Posthalterei die Abschlusshandlungen vorzunehmen.
Nein, sagte Mungk, der bald nach Aufnahme der einsamen Prosatätigkeit die Gewohnheit angenommen hatte, des längeren vernehmlich mit sich selbst zu sprechen, nein, Abschlusshandlungen, das ist Armee. Oder Fußball. Die Fußballer wurden nicht mehr dafür kritisiert, dass sie nicht in das Tor trafen, sondern wegen gravierender Fehler, Mängel und Schwächen bei der Durchführung der Abschlusshandlungen. Die Armee wurde überhaupt nicht kritisiert (allenfalls wiederum in Gestalt ihres Fußballklubs), aber auch sie nahm der Presse zufolge Handlungen vor.
Auflieferung, sagte Mungk, bei der Post heißt es Auflieferung, auch sehr schön.
Vorher war er seltener dazu gekommen, mit sich selbst zu sprechen. Oder nicht darauf angewiesen. Als Literaturredakteur der Zeitschrift Almanach hatte er viel mit den anderen Dichtern gesprochen, und die übrige Zeit hatte die gefürchtete Tilda mit ihm gesprochen, die legendäre Chefredakteurin, die ihre Leute mit durchaus ungebrochenen Ausrufen wie: „Was sollen unsere Leser in Australien von uns denken!“ in schöpferischer Unrast hielt.
Mungk saß vor dem Blatt mit den Sätzen über den Jungen, den sie gefragt hatten, ob in der Kirche eine Anwesenheitsliste geführt werde. Aber der Satz bekam keinen Klang. Mungk hätte keine Lust gehabt, ihn jemandem vorzulesen.
Er konnte den Jungen auch nicht richtig sehen. Pingel drängte sich davor, und gleich noch dieser ganze Kram von Post, Armee, Fußball und Almanach samt jener energischen Tilda.
Klang ist nicht nötig, sagte er, du bist nicht St. Martin in the field, und auch nicht Herbert von bist du.
Doch, sagte er, bei mir muss es schon bisschen bimmeln, sonst kauft mir keiner was ab. Ich sitze nämlich auf dem Markt, auf dem Teppich, nicht wahr, und kein Mensch sieht mir meine Tiefen und Bedeutungen so ohne weiteres an. Wenn ich eine saure Miene mache, halten sie es nicht für beleidigte Kreatur und heiligen Zorn, sondern für Zahnreißen.
Ja, sagte er, nun reicht es so weit, nun fahr man lieber gleich nach Badeneck.
Aber er saß erst noch diszipliniert zwei Zigaretten lang vor dem unvollendeten Satz, ehe er zum Auto ging.
Hinterm Gartenzaun der Nachbarin stand der wesensschwache Deutsche Schäferhundrüde Rebell von den Rauchenden Steinen, praktischerweise umgangssprachlich auf den lautmalerischen Namen Bell reduziert, und blickte Mungk dem Marktschreier interessiert entgegen.
Der sagte, na, du Mausbock, geht gleich los, was?
Bell war riesengroß und von jenem schwarzgrauen Schlag, der besonders blutrünstig aussieht. Tagsüber wartete er im Garten auf seine Herrin und vertrieb sich die Zeit damit, ahnungslose Passanten mit Ausbrüchen von löwenhafter Lautstärke zu erschrecken.
Mungk mochte Hunde. Manchmal dachte er, es sei die beste Zeit seines Lebens gewesen, als ihm sieben oder zwölf oder auch neunzehn Hunde gehört hatten. Das war vor der Huckleberry-Finn-Zeit gewesen. Die Hunde gehörten in Wahrheit seinem Vater, der ein Züchter von dünnen Gänsen, dicken Hühnern, von Tauben, die nicht fliegen mochten, von Enten, denen man die Schwingen stutzen musste, von friesischen Schafen, Harzer Ziegen sowie Puten und Perlvögeln, vor allem aber von Dachs- und Fuchshunden gewesen war, so lange ihre Bekanntschaft gewährt hatte.
Das war nicht so besonders lange. Elf Jahre, nach den Geburts- und Sterbezetteln, wovon allerdings abzuziehen waren auf der einen und auf der anderen Seite Babyzeit, Soldatenzeit, erste Stunden, letzte Stunden. So blieben ihnen vielleicht fünf Jahre, wenn es hoch kam – sieben.
Es waren nicht strikt seine Hunde, und eigentlich konnte es auch nicht die beste Zeit gewesen sein. Nachts hatten sie in der Waschküche gesessen, während unbekannte Männer mit Bomben übers Haus flogen.
Der Vater war von Frankreich mit verbrannter Speiseröhre zurückgekommen. Im Bauch hatte er ein Loch. In das Loch führte ein roter Gummischlauch, auf dessen anderes Ende ein gläserner Trichter gesteckt wurde, den die Mutter mit dünnem Brei beschickte, der langsam durch den Schlauch rutschte. Eben solchen Brei löffelte der kleine Mungk aus einem tiefen Teller und beneidete den Vater, weil der das Gemisch aus Wasser, gemahlenen Roggenkörnern, wenig Ziegenmilch, etwas Rübensirup und einem Flöckchen Margarine nicht schmecken musste.
Science-Fiction hatte er damals noch nicht gekannt, sonst hätte er seinen Vater für ein Wesen von weit her nehmen können, nur notdürftig eingerichtet zu irdischer Nahrungsaufnahme. Aber der kam ja gar nicht von weit; der kam ja aus dem Krieg.
Mungks Schwestern kehrten immer seltener von ihren geheimnisvollen Fernschreibschränken nach Hause zurück.
Seinen Bruder ergriffen die Polen und ließen ihn sehr lange nicht wieder fort.
Seine Mutter ging morgens mit den anderen Frauen auf den Hof des Gaswerks und suchte mit einer Kartoffelhacke in den Schlackehaufen nach unverbrannten Koksstückchen.
Und er saß unterdessen in einer besonderen Gaswerks-Kammer, die sollte gut sein gegen Keuchhusten.
Die Familie war schon etwas abgewetzt. Aber die Fäden hielten noch, und die Hunde waren lustig wie eh und je.
Mungk mochte Hunde, auch verstand er es, sie anzusehen, sie zu berühren und mit ihnen zu sprechen.
Na, du Mausbock, gleich geht’s los, was?
Seine Beziehungen zu dem Rüden Rebell, genannt Bell, waren nicht ganz ohne Trübung.
Der Hund hatte die Gewohnheit entwickelt, imTakt mit den Anlassern der Mungkschen Autos anzuschlagen und hielt sich auch streng an die Pausen zur Erholung der Batterie, was nicht ganz leicht zu ertragen war im Misserfolgsfall. Auch meldete es der näheren Umgebung, dass der Künstler sich wieder einmal anschickte, spazieren zu fahren, statt wenigstens im Hause zu bleiben, wenn er schon nicht arbeiten ging. Solchen Eindruck versuchte Mungk gelegentlich dadurch zu mildern, dass er die Lampe auf seinem Schreibtisch am Fenster auch dann leuchten ließ, wenn er längst im Sessel Kriminalfilme betrachtete oder gar eingeschlafen war vor allzu unspannenden Fußballspielen.
Mungk rollte so langsam durch die Badenwinkler Straßen, wie die Vorschrift verlangte und wie erforderlich war, um pingelverdächtige Personen gleich an der frischen Luft zu ermitteln, im Glücksfall.
Aus einem Klinkerrotsteinkrüppelwalmdachhaus mit gerillten Fensterläden nach Gutsherrenart traten zwei wirrhaarige junge Männer in Kosakenblusen oder Ukrainerhemden oder Tschuktschenboleros mit kleinen goldenen Trompeten unterm Arm ins Freie. Die nicht, dachte Mungk vorurteilsvoll, die lesen nicht.
Und natürlich kam auch der korpulente König nicht in Frage, der vor seinem Tudorschlösschen eigenhändig den Rasen harkte.
Die sollten lieber tauschen, dachte Mungk, droben zwischen den Zinnen, da könnten sie aber mal tuten.
Er bog dann in Schrittgeschwindigkeit rechts ein und beobachtete den Theaterdichter Redefin beim Koksschippen.
Redefin hantierte hingebungsvoll mit einer breiten Koksforke und füllte eine noch nagelneu aussehende Schubkarre.
Spielt im Sand, der Kerl, dachte Mungk.
Er hielt das Auto gegenüber der Halde an und ging zu Redefin hinüber.
Glückauf, sagte er, wieso bist du nicht beim dritten Akt, warum treibst du den Konflikt nicht entschlossen voran? Gestaltest nicht den Weg vom Ich zum Wir und wieder zurück? Spielst du im Sand, treibst du Studien oder kannst du die freiwillige Zulage nicht mehr bezahlen?
Mann, Mensch, sagte Redefin, nee, nee, ich mach das bloß, ach, ich mach das mal selbst. Hab ja nun auch die schöne Schubkarre, guck mal hier, was denkst du, da gibt es so einen Laden in Herken, da gibt es unheimliche Schubkarren, ich finde die gar nicht so teuer, und Gießkannen und alles, schöne Säcke, Schläuche, GFG; das ist der Laden von der GFG, Garten- und Freilandgestaltung.
Ja, sagte Mungk, da hab ich schon mal einen Pinsel gekauft.
Ja, ja, sagte Redefin, dolle Auswahl haben die da. Sag mal, du darfst wohl kein Bier trinken? Oder wie verhält sich das oder wie hältst du das?
Trinkt man Bier zu Koks?
Gibt nichts Besseres, kannst ja immer mal reinkommen.
Sie gingen um das riesengroße Haus herum, das Redefin sich gekauft hatte, nachdem auch sein elftes Stück sich als Renner, Schlager, Knüller und Füller erwiesen hatte.
Redefin, der seit mehr als zwanzig Jahren endgültiges Versiegen seiner Einfälle als unmittelbar bevorstehend bezeichnete, hatte auch damals noch gezögert. Aber Mungk, der es sehr liebte, wenn sich im Leben anderer Leute Veränderungen zutrugen, hatte ihm mit dem Argument zugeredet, er könne doch notfalls auch als Taxifahrer Auskommen und Vergnügen haben.
Mungk guckte an dem Haus hoch, und Redefin guckte hinterher und seufzte.
Du schreibst natürlich wieder an einem Stück, fragte Mungk.
Ja, ja, Gott ja, sagte Redefin.
Wahrlich, ein Scheingenie bist du gerade nicht, sagte Mungk. Mozart war auch kein Scheingenie, aber Rilke war eins.
Gotteswillen, sagte Redefin.
Das ist nicht von mir, sagte Mungk. Das lese ich gerade. Aber wenn ich es ausgelesen hab, leihe ich es dir ganz gern. Dass du mal siehst.
Redefin machte eine der Kellertüren auf und winkte einladend. Der Raum war säuberlich gefegt. Unwillkürlich hielt Mungk Ausschau nach einem Dutzend nagelneuer Besen (aus der GFG). Die Mauern waren weißkalkgespritzt. Drei Ausflugslokalgartenstühle standen um einen sogenannten Nierentisch aus den Fünfzigerjahren herum wie drei Barsoi-Rüden um eine Basset-Hündin.
Oho, sagte Mungk, das wird die Bar.
Das ist die Bar, sagte Redefin.
Er zerrte einen halb vollen Bierkasten zur Sitzgruppe und öffnete geschickt zwei Flaschen mit dem Taschenmesser.
Redefin war schon ein landesbekannter Autor gewesen, als Mungk die letzten Schuljahre bewältigte. Mungk konnte sich gut erinnern, dass er nicht viel von Redefins heiteren Gedichten, durch die er zuerst bekannt geworden war, gehalten hatte.
Er dichtete damals gerade selbst. Genaugenommen ging er mit einem Gedicht um, präziser gesagt mit dessen erster Zeile mit dem zornigen Wortlaut „Jagt die Kaninchen aus den Lorbeerhainen!“, die einen sehr günstigen Eindruck auf ihn gemacht hatte, jedoch so dominierend war, dass Steigerung oder überhaupt Fortsetzung unmöglich schien. Die Zeit des einzeiligen Gedichts war jedoch noch nicht angebrochen. Man glaubte noch an den Erlkönig.
Auch Mungks erste Geschichten waren oft nicht über den ersten Satz hinausgekommen.
Einmal brachte er, nach mehrstündiger Bedenkzeit, klopfenden Herzens sodann, zu Papier: „Die graue, gekrümmte Landstraße blieb hinter dem Bus zurück wie ein ungeheurer, in den Staub getretener, tausendfach plattgewalzter Wurm.“ Er gab sich keine Rechenschaft darüber, welche ungeheuren Plattfüße da getreten haben mochten. Auf den armen Wurm.
Irritation kam aber von dem Umstand her, dass dies der Anfang einer Geschichte über ein Pionierlagerpraktikum sein sollte, welches vorwiegend heiter angefangen und auch so geendet hatte. Da wollte, schwante ihm, was nicht zusammenpassen. Andererseits mochte er von seinem Satz, an den er nicht ohne einen kleinen Schauer denken konnte, nicht lassen, und so hatte es sein Bewenden.
Viel später münzte er noch eine Tugend daraus, indem er bei öffentlicher Gelegenheit erklärte, seine ersten Geschichten lieber gar nicht erst geschrieben, Erstlingswerke strikt vermieden zu haben.
Es ist ein häufig zu beobachtender Fehler von Anfängern, sagte er, dass sie aus nichts als einer Stimmung, aus einer besonders euphorischen oder aus einer besonders depressiven, eine Geschichte keltern wollen. Aber das geht nicht, das reicht doch höchstens für einen Anfang.
Natürlich kann man eine Geschichte auch zu Ende quälen. Und da liegt es dann, das arme Tier.
Wisst ihr, sagte er zu Schülern, es ist selbstverständlich nicht richtig, faul zu sein, wie es auch verwerflich ist, Zigaretten zu rauchen, alles klar. Es macht auch überhaupt keinen Spaß, sitzenzubleiben, na, das kennt ihr nicht mehr so, das hatten wir früher, ich bin ja ein älterer Mensch, ich hab ja Täve Schur noch Rad fahren sehen, hinterher lachen natürlich welche drüber, sieh an, sitzengeblieben und doch noch was daraus geworden! Aber wem es gerade passiert, dem macht es auch nicht die geringste Freude, kann man sich wirklich sparen, schön, gut. Wenn ich an die ersten Geschichten denke, dann bin ich doch heilfroh, dass ich sozusagen zu faul gewesen bin, sie zu Ende zu schreiben. In denen war eben der Wurm drin, die waren eben so, dass sie einen faul machten zum Weiterschreiben. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt Lust gehabt hätte, von einer Redaktion in die nächste zu rennen und den Leuten mit meinen wundervollen Schöpfungen in den Ohren zu liegen. Oder immer nach Hause und ändern. Weiß gar nicht.
Er wusste es wirklich nicht. Die erste Geschichte, die er zu Ende geschrieben hatte, hatten sie bald gedruckt.
Und seither jede Geschichte, die er zu Ende geschrieben hatte.
Sogar die „Gedanken zu einem Bild“, die er für die Zeitschrift Freier Erdball geschrieben hatte, waren am Ende gedruckt worden, wenngleich ohne Bild und in der Zeitschrift Neuer Sonnabend.
Auf dem Bild blickte eine Frau in weißem Kittel in ein Mikroskop, und ein Mann in weißem Kittel stand ihr dabei wohlwollend zur Seite.
Mungk seinerseits hatte das Bild drei Tage lang betrachtet, sodann einen bedeutungsschwanger-lakonischen Text beigesteuert, der nichts weniger als die Geschichte der Geschlechterbeziehungen von der Neandertalerhorde bis zum sozialistischen Laborkollektiv beinhaltete.
Freier Erdball hatte die Arbeit abgelehnt, aber nur, wie Mungk bereit war, auf seinen Eid zu nehmen, weil er mit Schneematsch an den Schuhen quer über die auf dem Fußboden ausgebreiteten Umbruchbögen oder Andrucke an den Schreibtisch des seinerzeit recht bekannten Redakteurs Storch getreten war, welcher die Annäherung mit rasch anwachsenden Ausdruck des bassen Erstaunens verfolgte.
Es hatte ihm bei dem gestrengen Storch wenig geholfen, dass er sich damit entschuldigte, seine Mutter, zu Hause, früher, in der proletarischen Kindheit, habe immer, wenn sie den Fußboden gewischt hatte, Zeitungspapier darüber ausgebreitet, zum Schutze, zum Schutze, zum zeitweiligen.
Beim Neuen Sonnabend hingegen, wo ein vorwiegend vornehmer Chefredakteur waltete, der seine Leute machen ließ, druckte es eine Redakteurin, die eisern entschlossen war, Mungk als vielversprechendes junges Talent entdeckt zu haben.
Das hatte ihm über allerhand masochistische Vorstellungen hinweggeholfen, wie sie sich beim Erdball von ihm erzählten, täglich einmal dieses täppischen, schlecht rasierten Trampels und Tramplers gedenkend.
Allerdings stärkte es auch in verhängnisvoller Weise sein Zutrauen in den vielsagenden Stammel-Stil, den er viele Jahre später zu seiner Verblüffung in den sogenannten Kommentaren der sogenannten Bilder-Zeitung wieder entdeckte, damals aber erschrocken und für immer fallen ließ, nachdem eine Leserin der Jugendparade eines der knappen Prosastücke, es war der Verlobung einer Eiskunstläuferin mit einem Eiskunstläufer gewidmet, für ein reimloses Gedicht hielt und dieses in einem Leserbrief sehr lobend hervorhob.
Das hatte Mungk schon genügt. Aber das Unglück oder Glück führte ihm wenig später auch noch den für seine Derbheiten berühmten Feuilletonisten Grummtholz über den Weg, der ihm im Foyer eines Kinos zurief: Na, du Arsch, du dichtest ja wie die wilde Sau! Häng dich lieber auf! Scheiße, was?
Sag mal, sagte Mungk zu Redefin, wohnen hier welche, die Pingel heißen?
Wüsste ich jetzt nicht, sagte Redefin, aber wir wohnen ja erst knapp ein Jahr hier, da gehört man noch nicht dazu. Pingel? Nee, wüsste ich wirklich nicht. Ist aber ein schöner Name, den muss ich mir direkt merken.
Das lass man sein, sagte Mungk, den hab ich mir schon selber gemerkt. Aber wenn ich ihn nicht brauche, sage ich dir Bescheid.
Hinter Mungk ging die Tür auf und schrammte leicht über den Kellerboden, so dass er sich umdrehte und ein kräftiges, junges Mädchen mit schönen großen Brüsten im T-Shirt und mit vielen blonden Haaren zu sehen bekam.
Das Mädchen nickte ihm kühl zu und sagte über ihn hinweg: Also, Mutti lässt fragen, ob du den anderen Koks morgen reinholst, dann würde sie nämlich was zu essen machen oder so.
Mungk machte abwinkende Zeichen zu Redefin.
Redefin sagte: Nee, nee, mein Schönchen, wo denkt ihr hin, Koks vorm Haus bedeutet Sorgen am dritten Tag.
Ja, sagte Mungk, wird vom langen Stehen sauer, ausgetrunken muss er sein. Ich rauche nur noch diese, dann verschwinde ich, deshalb bin ich so beliebt als Besucher, weil ich immer gleich wieder gehe. Ach, kennen Sie hier jemanden namens Pingel?
Das Mädchen musterte ihn skeptisch, als verdächtige sie ihn eines schlecht getarnten Annäherungsversuches.
Nie gehört, sagte sie und verschwand auch schon durch die Tür.
War unsere Tochter, sagte Redefin, Angela. Müsstest du eigentlich doch kennen.
Ich hab sie schon mal gekannt, sagte Mungk, in meinem früheren Leben. Oder in ihrem früheren Leben. Da muss sie aber irgendwie … irgendwie kleiner gewesen sein oder so.
Ja, ja, sagte Redefin, o ja.
Wächst alles heran, sagte Mungk, man ist nicht mehr vierzig, verdammt, und was macht sie so?
Zicken. Oder vielleicht auch nicht. Sie ist vorgestern von der Uni weggelaufen. Und übermorgen bringe ich sie wieder hin, wollen mal sehen.
Und weswegen?
Wegen Rohrbruch, sagte Redefin, wegen Fotografieren und wegen Beleidigung der Arbeiterklasse.
Du liebe Güte, sagte Mungk, die letzten beiden Sachen magst du ja noch hinbekommen, wenn du deine Orden blank putzt, wobei ich natürlich nicht weiß, ob es sich da um einen schweren Fall von Fotografieren handelt. Aber Rohrbruch? Rohrbruch? Das ist ja bald schlimmer als Ehebruch und Einbruch, da braucht es Klempner, das sind ja Abgründe. Oh, diese Kinder. Wo studiert sie eigentlich?
In Kroonskoog, sagte Redefin, kennst ja die Neukuckower Straße in Kroonskoog.
Klar, sagte Mungk, Buchbasar.
Ja, sagte Redefin, und genau da war auch der Rohrbruch. Die halbe Woche ist das Wasser geflossen. Wie ein Bach, immer die Neukuckower Straße entlang. Da sind sie auf die Idee gekommen, weil auch gerade Fasching war. Das ganze erste Studienjahr Meeresbiologie, die teuersten Kader, haben sich alle ein bisschen verkleidet und sind in die Neukuckower Straße gezogen, gleich an der Uni, und haben angefangen, Wasserproben zu entnehmen und die Strömungs-, Brandungs- und Wellenverhältnisse zu messen, was weiß ich. Was sie da eben so lernen. Ja, kleine Schiffe haben sie auch schwimmen lassen und lauter solche Dinger. Na ja, und dann haben sie sich gegenseitig fotografiert dabei.
Ha, sagte Mungk, Schote, Schota Rustaweli!
Ja, sagte Redefin, das sagst du, aber die Sektionsleitung sagt was anderes. Die sagt: Schande. Die sind gerannt gekommen und haben gleich alle in ihre nette kleine Alma Mater zurückgetrieben. Die Filme sind bis Montag neun Uhr unentwickelt abzuliefern bei Gefahr der Exmatrikulation und so weiter.
Die sind wohl doof, sagte Mungk, jetzt werden sie wohl schon ganz und gar verrückt.
Weiß ich nicht, sagte Redefin, es befinden sich Doktoren und Professoren darunter. Der IQ liegt ganz schön hoch. Vielleicht, dass sie sich etwas dabei denken.
Mungk sagte: Na sicher, sie werden denken, ach, du lieber Gott, was wird die Bezirksführung sagen. Und warum sollen die Filme abgeliefert werden? Und worin besteht die Beleidigung? Wer ist beleidigt, der Oberbürgermeister?
Die Filme, sagte Redefin, sollen sie abliefern, damit sie nicht an UPI oder AFP gehen. Die Beleidigung? Na ja, also, die Arbeiter, weil es ja doch die Arbeit der Arbeiter ist oder … ach, das weiß ich doch nicht, Mann.
Nein, das weiß keiner, sagte Mungk, weil das alles Quatsch ist. Was hätten sie eigentlich tun sollen? Vorbeigehen an dem Bach wie all die anderen vernünftigen Menschen und Staatsbürger oder was?
Man hat ihnen gesagt, sie hätten eine Eingabe schreiben können.
Eine Eingabe gegen Wasserrohrbruch? Bei allen Heiligen, das lügst du, Redefin, du oller Dramatiker! Oder doch nicht? Doch nicht, was? Eine Eingabe, ja das ist so recht die stürmische Art der Jugend und Studenten. Setzt den Rohrbrüchen ein entschiedenes Halt entgegen. O Gott. Was soll nur aus uns werden? Was ist überhaupt aus dem Rohrbruch geworden?
Der war am nächsten Tag weg, sagte Redefin.
Siehste, sagte Mungk, da hat jemand den Arbeitern Bescheid gesagt, die konnten ja nicht einfach von sich aus die Straße aufreißen. Wer weiß, wer dann beleidigt gewesen wäre, gelle? Sag mal, das schreibst du doch? Das kommt doch in deinem nächsten Film vor? Das ist doch eine großartige Szene, Menschenskind. Greif zur Feder, Kumpel, aber hurtig!
Weiß nicht, sagte Redefin.
Wieso, sagte Mungk, das kannst du machen. Den will ich sehen, der dir das streicht.
Genau, sagte Redefin, deshalb ja.
Das verstehe ich eventuell nicht, sagte Mungk.
Überleg mal, sagte Redefin, für meine Tochter ist das überhaupt keine großartige Szene, sondern eine schlimme Geschichte. Nein, nein, du hast recht, das streicht mir keiner, darüber sind wir weg. Aber gerade deshalb frage ich mich wirklich, ob wir das Recht haben, einfach Papier daraus zu machen und uns zuzwinkern oder auch zuklatschen zu lassen. Überlege doch mal selbst. Wenn schon Szene, dann wird es natürlich eine komische Szene, egal jetzt, ob herzlich komisch oder satirisch, jedenfalls – wie sagst du – Schote! Und alle haben ihre Freude daran, und kein Aas hat was dagegen. Oder höchstens insgeheim, denn darüber sind wir ja weg. So humorlos sind wir heutzutage nicht mehr. Kein Lektor und Dramaturg, Verleger, Intendant, Minister, Sekretär. Loben werden sie mich, wenn ich es richtig hinbekomme. Einen brillanten Einfall werden sie es nennen. Aber, verstehst du, es ist gar kein Einfall. Es hat sich wirklich zugetragen, und keiner hat gelacht. Ich weiß nicht, sie müssen ihre Filme abliefern, und ich kriege meine Durchschläge bezahlt. Ich weiß nicht, nachher glauben die uns gar nichts mehr.
Mungk sagte: Warte mal, wieso denn, du prangerst das doch unheimlich an. Mit der scharfen Feder der Kritik. Kunst ist Waffe. Auf den Zinnen der Partei. Und so was alles. Du kannst doch nicht beigehen und welche erschießen. Denn siehe, deine Waffe ist Kunst. Und dass wir darüber weg sind, das kann doch nicht heißen, dass es dir nun keinen Spaß mehr macht. Stell dir vor, wir kämen noch über andere Sachen weg, und ringsum fallen die Dichter in Schweigen – aus Angst. Aus Angst vor Konformismus, nicht wahr? Ist es das, was dich quält?
Ach was, sagte Redefin, das ist auch bloß ein Kinderschreck. Wenn ich was richtig finde, gehe ich immer konform. Zur Not lass ich mich sogar verlogen nennen dafür, dass sich bei mir nicht immer alle Leute unentwegt aufhängen wollen oder wenigstens vollkommen eingeschüchtert herumwürmeln. Das kann ich nämlich nicht finden. Sie kleben RACINGTEAM aus dem InterMag an ihren Trabbi. Sie besorgen sich fliederfarbene Klobecken, sie errichten auf ihren Grundstücken Freiluftkamine mit integriertem Grillrost, sie feiern Jugendweihen wie die Fugger & Welser, sie gucken Millowitsch in Farbe … nein, ich kann mich ja nicht so besonders gut ausdrücken, aber nehmen wir mal ganz einfach Schiller.
Ganz einfach Schiller, sagte Mungk.
Ja, ja, nun lass doch. Also Kabale und Liebe. Erstens ist es sowieso tragisch, und zweitens ist der Schiller als Person auch auf der anderen Seite der Barrikade, und drittens konnte der Herzog mit ihm genauso umspringen wie mit der Familie Miller, verstehst du?
Mungk sagte: Du meinst, dir tut keiner was. Und wenn dir keiner was tut, dann war es auch nix?
Na, ich meine das eigentlich nicht, aber man hört jetzt immer so was.
Klar, sagte Mungk, das ist ja auch sehr praktisch. Kunst mit dem Staat schlechte Kunst. Gegen den Staat gute Kunst. Und so durch alle Schattierungen und dialektischen Verschränkungen. Schönes Land schlimme Oper und so weiter.
Ich weiß nicht, sagte Redefin, und wenn ich nun mal jedenfalls nicht auf die andere Seite der Barrikade übergehen will, dann werd ich wohl auch nicht jammern können, dass ich nicht an den Freuden teilhaben kann, die es da womöglich auch gibt. Mal abgesehen vom guten Gewissen.
Nix, sagte Mungk, nichts da. Sie gehen alle immerzu in Sack und Asche und im düstren Auge keine Träne.
Mach es dir nicht zu einfach, sagte Redefin.
Ich will es doch nur verstehen, sagte Mungk, und ich verstehe doch nur einfache Sachen. Warum einer nicht für Sozialismus ist, außer aus materiellen Gründen, verstehe ich nicht.
Vielleicht meinen sie, dass das kein Sozialismus ist, was wir hier machen, und vielleicht haben sie recht.
Ja, ja, sagte Mungk, die Macht. Die Macht ist immer hässlich, aber ohne Macht kann man doch gar nichts anfangen mit der Idee. Erinnere dich doch an Chile, da haben sie es ordentlich mit dem Stimmzettel versucht. Aber Pinocchio hatte die Macht.
Ich weiß nicht, sagte Redefin, vielleicht ist es so, wie wir es machen, von Anfang an und ganz und gar verkehrt. Weißt du, manchmal denke ich, es geht überhaupt nicht. Weil es nur mit Engeln geht, nicht mit Menschen. Jetzt haben sie sich außer den großen Volvos noch eine ganze Flotte kleiner Volvos zugelegt, damit die Schwiegertöchter oder Enkelsöhne bisschen unauffälliger ausfahren können oder so. Und die Leute fahren mit zwanzigjährigen Schabracken rum.
Aber …, sagte Mungk.
Ja, aber, sagte Redefin, vielleicht ist das, was du jetzt gerade vorbringen willst, den Leuten vollständig schnurzi und scheißegal. Die pfeifen dir was auf Nazis, Prostitution, Rauschgiftszene, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und wie unsere Schreckgespenster alle heißen. Das Risiko nehmen sie auf sich, wenn sie hinfahren können, wohin sie wollen, und kaufen, was sie bezahlen können. Ich weiß nicht. Vielleicht sind wir in eine elend lange Sackgasse gelaufen. Gibt Sackgassen, die sind so lang, dass man sie glatt für Durchgangsstraßen halten kann.
Unser Kurs führt nach Norden in die Barentssee, guten Morgen, du glücklicher junger Kapitän, sagte Mungk, was für eine Scheiße, mein Gott. Aber mit dem Risiko, also, dass sie das auf sich nehmen, das ist noch anders. Das ist mehr Mangel an Fantasie. Wenn du meinem Klempnergesellen, der mir nach mehreren formlosen Anträgen für hundert Mark die Badewanne aufgestellt hat, erzählen willst, ihm drohe Arbeitslosigkeit unter veränderten Umständen, dann lacht der sich schlicht kaputt.
3
An der Hauptstraße zögerte Mungk einen Augenblick, dann bekam die Schwäche die Oberhand, und er bog stadtauswärts ein. Ein paar Minuten später hielt er vor der langen, massiven Baracke der GFG Herken.
Eine Weile ging er unschlüssig mit dem Selbstbedienungskorb zwischen Sprühschläuchen, Kiessieben, Isolierbandrollen, Lötkolben, Fußabtretern und Türklinken umher.
Einem Mann mit einem in Folie eingeschweißten blauen Arbeitsanzug gelang es, die drei Verkäuferinnen, die gerade die Vor- und Nachteile ihrer Ehegatten erörterten, zum Beratungsgespräch heranzuziehen.
Ob das was Besonderes wäre, nämlich wegen dem Schild „Made in Switzerland“?
Nö, sagte die Verkäuferin, ’n Arbeitsanzug, Hose und Jacke, allerdings – Import.
Made in Switzerland, Import – der Kunde konnte nicht länger widerstehen und kaufte den Anzug.
Mungk wunderte sich ein bisschen darüber, dass sie in Herken schweizerische Arbeitsanzüge verkauften. Kurz und vergeblich hielt er Ausschau nach norwegischen Zollstöcken und portugiesischen Sensen. Dann drängte er, wobei er um ein Haar laut zu sich selbst gesprochen hätte, den Gedanken zurück, ebenfalls solchen weithergekommenen Arbeitsanzug zu erwerben.
Im Auto dann sagte er es doch noch laut: Was willst du mit einem Arbeitsanzug, alter Bummelant?
Er kicherte albern und schüttelte den Kopf, was die Gattin eines überholenden Citroen-Lenkers auf sich, ihren Mann oder ihr Auto bezog, denn sie gab ihm strafende Blicke herüber.
Als Mungks Sohn klein gewesen war, im Kindergarten, hatte er bei einer Rundfrage geantwortet, sein Vater arbeite überhaupt nicht.
Mungk erfuhr es von den Kindergärtnerinnen und lachte mit ihnen darüber.
Aber später überlegte er, ob es dem kleinen Menschen nicht ein ähnliches Maß an Herzdrücken bereitet haben mochte, wie ihm, als er für Klassenbücher oder Fragebögen, die für ordentliche Verhältnisse zubereitet waren, soziale Auffälligkeiten offenbaren musste.
Heimatanschrift?
Wie bitte?
Na ja doch, wo Sie her sind, wo Sie zu Hause sind.
Ach so, hm, hmm, also ja, Hirschfelder Straße 21 bis 43.
Nein, hören Sie mal, das ist doch das Studentenheim.
Ja. Ja, da wohn ich ja.
Herrgott, aber Ihre Eltern?!
Meine Eltern? Ja, also, meine Mutter, die wohnt jetzt in Hamburg. In Hamburg, ja. Und mein Vater ist gestorben. Verstorben. 1946. Oder, nein … 1947.
Warten Sie mal, haben Sie nicht angegeben, dass Ihre Mutter, nun mal republikflüchtig oder nicht, dass sie verheiratet ist?
Na ja, das stimmt auch.
Dann geben Sie doch einfach Namen und Adresse Ihres Stiefvaters an. Oder wohnt der auch in Hamburg?
Nein. Nein, eben nicht. Aber vielleicht … Es ist so, sie wollte sich ja scheiden lassen, vielleicht, dass schon die Scheidung … dass die Scheidung bereits …
Hören Sie mal, so genau wollen wir das gar nicht wissen. Es ist nur, dass wir hier keine Striche machen dürfen.
Ja, natürlich. Aber ich weiß wirklich nicht … es ist nämlich so: der ist ja im … im Strafvollzug. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch schon … schon entlassen. Und ich weiß nun aber die Adresse nicht …
Und er versuchte sich vorzustellen, wie sein Sohn den Kelch sich nähern sah und nach einigem Drucksen herausgebracht hatte: Mein Vater arbeitet überhaupt gar nix.
Wie mochte das sein, wenn einer fünf Jahre zählte?
Mungk kannte genug Leute, die sogar das Lesen von Romanen Arbeit nannten. Wie auch solche, die das Lesen von längst gehaltenen Reden als Studium bezeichneten.
So gesehen war er ein Schwerarbeiter und wenigstens doch auch ein Leichtstudent vor dem Herrn.
So gesehen, ach was. Mungk hielt seine Tätigkeit jedenfalls nicht für etwas einfacheres, aber doch für etwas anderes als Arbeit. Gegenüber anderen Leuten griff er zur Unter- oder Übertreibung, um tatsächliche Verlegenheit zu bemeistern. Muss noch bisschen was hinschreiben. Will noch ein wenig Hand an ein weiteres meiner Meisterwerke legen.
Man musste ihn schon sehr in die Enge treiben, um aus seinem Munde zu hören: Ich bin Schriftsteller. Dies und die ihn selbst befremdende Tatsache, dass er im Schriftlichen nicht vorsätzlich pfuschen konnte, sondern dabei augenblicklich von schwerster Bedenklichkeit befallen wurde, was ihn fast unfähig machte, ohne Zähneknirschen und Haareraufen einen Ansichtskartengruß oder eine Gästebucheintragung zu formulieren, hielt er für die besten unter seinen zahlreichen Eigenheiten. Und hatte wohl recht damit.
*** Ende der Demo-Version, siehe auch http://www.edition-digital.de/Kant/Dank/ ***
Uwe Kant
Geboren am 18. Mai 1936 in Hamburg-Lurup als viertes Kind eines Gärtners. Wegen der drohenden Bombenangriffe zog die Familie 1940 ins Haus seines Großvaters in Parchim. Dort legte er 1956 sein Abitur ab und studierte anschließend Germanistik und Geschichte in Rostock und Berlin. Von 1961 bis 1964 arbeitete er als Lehrer in Lübbenau und veröffentlichte gleichzeitig erste literarische Arbeiten. Von 1964 bis 1967 arbeitete er als Literaturredakteur der Zeitschrift „Magazin“. Seit 1967 ist er freischaffender Journalist und Schriftsteller. Er war in der DDR ein erfolgreicher Kinder- und Jugendbuchautor, seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Zwei Bücher wurden von der DEFA verfilmt: 1971 „Das Klassenfest“ unter dem Titel „Männer ohne Bärte“ und 1977 „Der kleine Zauberer und die große Fünf“.
1978 erhielt er den Nationalpreis III. Klasse für Kunst und Literatur, 1981 noch einmal, gemeinsam mit Winfried Junge und Hans-Eberhard Leupold. Von 1999 bis 2020 lebte er in Neu Ruthenbeck in der Gemeinde Friedrichsruhe, seit 2020 in Panketal.
Werke:
Das Klassenfest. Kinderbuchverlag, Berlin 1969. Illustriert von Volker Pfüller
Die liebe lange Woche. Kinderbuchverlag, Berlin 1971. Illustriert von Heinz Handschick
Der kleine Zauberer und die große 5. Kinderbuchverlag, Berlin 1974. Illustriert von Manfred Bofinger, in Westdeutschland zuerst unter dem Titel Der kleine Oliver und die große 5 mit Illustrationen von Brigitte Smith erschienen (F. Schneider, München 1975), dann als Rowohlt-Rotfuchs-Taschenbuch unter dem Originaltitel illustriert von Hans Poppel (Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1982).
Roter Platz und ringsherum. Von einer Putjowka nach Moskau. Kinderbuchverlag, Berlin 1977. Illustriert von Manfred Bofinger
Vor dem Frieden. Eine Bilderbuchgeschichte. Kinderbuchverlag, Berlin 1979. Illustriert von Steffi Bluhm
Die Reise von Neukuckow nach Nowosibirsk. Kinderbuchverlag, Berlin 1980. Illustriert von Volker Pfüller
Wie Janek eine Geschichte holen ging. Kinderbuchverlag, Berlin 1980. Illustriert von Egbert Herfurth
Das achte Geißlein. Geschichten von Meck Meckentosch. Kinderbuchverlag, Berlin 1983. Illustriert von Klaus Vonderwerth (geschrieben von Kant, Peter Abraham und Hannes Hüttner unter dem gemeinsamen Pseudonym Karl Georg von Löffelholz)
Panne auf Poseidon sieben. Kinderbuchverlag, Berlin 1987. Illustriert von Lothar Otto
Alfred und die stärkste Urgroßmutter der Welt. Kinderbuchverlag, Berlin 1988. Illustriert von Cleo-Petra Kurze
Hatschplatschmaxmux. Kinderbuchverlag, Berlin 1989. Illustriert von Manfred Bofinger
Heinrich verkauft Friedrich. elefanten press, Berlin 1993. Illustriert von Thomas Mattheus Müller
Wer hat den Bären gesehen? Beltz & Gelberg, Weinheim 1995. Illustriert von Gesa Denecke
Weihnachtsgeschichten. Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 1999. Illustriert von Rolf Bunse
Mit Dank zurück. Roman. Eulenspiegel-Verlag, Berlin 2000
Hörspiele
Die Nacht mit Mehlhose. 1972
Fahrt mit Persigehl. 1985
Der Mitnehmer – Ein Funkmonolog. 1986
Filmografie
1971: Männer ohne Bart (nach: Das Klassenfest)
1977: Der kleine Zauberer und die große Fünf (nach dem gleichnamigen Buch)
1987: Das Pflugwesen – es entwickelt sich (Text)
Inhaltsverzeichnis
Impressum
1
2
3
Uwe Kant