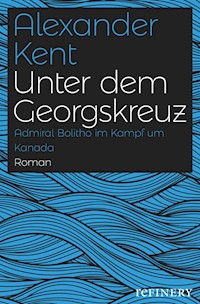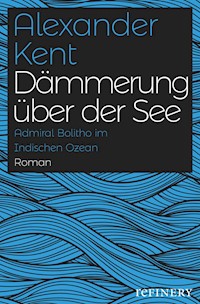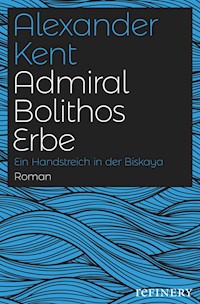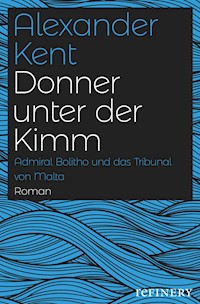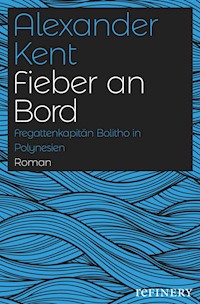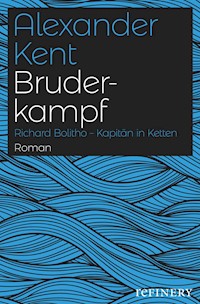6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
1814 - England zur Zeit der Napoleonischen Kriege: Napoleon ist siegreich geschlagen, doch Admiral Sir Richard Bolitho wird abermals nach Malta entsandt, wo schon einmal Ruhm und Tragödie sein Leben bestimmten. In den Gewässern von Malta wird sich sein Schicksal in einer unerbittlichen Seeschlacht entscheiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das letzte Gefecht von Alexander Kent, “Admiral Bolitho vor Malta” Roman, blau-schwarzer Welleneinband.
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester.Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
1814 - England zur Zeit der Napoleonischen Kriege: Napoleon ist siegreich geschlagen, doch Admiral Sir Richard Bolitho wird abermals nach Malta entsandt, wo schon einmal Ruhm und Tragödie sein Leben bestimmten. In den Gewässern von Malta wird sich sein Schicksal in einer unerbittlichen Seeschlacht entscheiden.
Alexander Kent
Das letzte Gefecht
Admiral Bolitho vor Malta
Aus dem Englischen vonDieter Bromund
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei RefineryRefinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010© der deutschen Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 1999© der englischen Originalausgabe: Bolitho Maritime Productions, 1998Titel der englischen Originalausgabe: Sword of HonourCovergestaltung: © Sabine Wimmer, BerlinE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-96048-105-8
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Entscheidungen
II Mehr als die Pflicht
III Adam
IV Der längste Tag
V Der Preis
VI Kenne deinen Feind
VII Keine Wahl
VIII Eine Hand für den König
IX Für Reue zu spät
X Ein Kriegsschiff
XI Die Frau eines Seemanns
XII Von Angesicht zu Angesicht
XIII Gespräche
XIV Am Rande der Dunkelheit
XV Der nächste Horizont
XVI Die Rettungsleine
XVII Bis die Hölle einfriert
XVIII Letzte Umarmung
Epilog
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
I Entscheidungen
Widmung
In Hochachtung für Chris Patten,den Ehrenmann
Motto
Segle nun weiter – auf die offene See hinaus,Tollkühn, meine Seele – du und ich zusammen.Denn wir fahren, wohin sich noch kein Seemann wagte.Und wir wagen das Schiff, uns selbst und alles.
Walt Whitman
I Entscheidungen
Vizeadmiral Sir Graham Bethune legte seine Feder auf den Schreibtisch und wartete, bis der ältliche Sekretär der Admiralität die eben Unterzeichneten Briefe eingesammelt hatte. Nachdem sich hinter ihm die großen Doppeltüren geschlossen hatten, stand Bethune auf und schaute zum nächstgelegenen Fenster. Die Sonne schien. Selbst durch den großen Raum hindurch konnte er ihre Wärme spüren. Der Himmel war durchsichtig, fast ganz ohne Färbung.
Bethune hörte eine Uhr schlagen und fragte sich, wie wohl die Besprechung in dem Raum am Ende des Flures ablief. Hohe Offiziere, Lords der Admiralität und bürgerliche Berater waren dorthin gebeten worden, um über den Zustand der Werften und die Bedürfnisse des Sanitätsdienstes zu beraten. Für die Admiralität war es ein gewöhnlicher Tag wie jeder andere.
Unruhig trat er ans Fenster und öffnete es. Von unten grüßten ihn der Lärm Londons, das Klappern von Hufen, das Klingeln von Zaumzeug und die Rufe eines Straßenhändlers, der den Passanten seine Waren anbot und dabei den Zorn der Türwächter der Admiralität riskierte.
Bethune sah sein Spiegelbild im Fenster und lächelte. Vor langer Zeit hatte er nicht einmal zu hoffen gewagt, dieses Amt zu bekleiden, jetzt konnte er sich ein Leben ohne diese würdevolle Position nicht mehr vorstellen. Nach den Jahren auf dem Meer war ihm das Amt zunächst ein wenig fremd erschienen. Er legte die Hand auf den Rock: Graham Bethune, Vizeadmiral der Blauen Flotte, einer der jüngsten Flaggoffiziere der Marine. Die Uniform paßte ihm jetzt so wie das Amt.
Er beugte sich aus dem Fenster und beobachtete die Vorübergehenden und Vorüberfahrenden. Viele Kutschen rollten im Sonnenschein mit zurückgekipptem Verdeck, und er entdeckte Frauen in feinen Kleidern und bunten Hüten. Doch im April 1814 war der Krieg leider noch immer von grausamer Aktualität.
Wie alle langgedienten Offiziere hatte auch Bethune sich an die übertriebenen Beteuerungen und die Versprechungen eines nahen Endsieges gewöhnt. Jeden Tag erreichten ihn Nachrichten, daß Wellingtons Armee eine nach der anderen von Napoleons Stellungen aufrollte; es hieß, der unbesiegbare Kaiser sei auf der Flucht, von allen verlassen – bis auf seine treuen Marschälle und seine alte Garde.
Bethune fragte sich, was das gewöhnliche Volk von all dem wohl wirklich glaubte. War der Friede, nach all den Kriegsjahren mit dem mittlerweile vertrauten Feind, nur noch ein Traum? Er trat ein paar Schritte vom Fenster zurück und starrte auf das Gemälde an der Wand. Es zeigte eine Fregatte im Kampf, ihre Segel waren von Kugeln durchlöchert, doch sie spie dem Gegner eine volle Breitseite entgegen. Das Motiv zeigte Bethunes letztes Kommando auf See. Er stand damals zwei großen spanischen Fregatten gegenüber, was selbst für einen solchen Draufgänger wie ihn eine ziemlich hoffnungslose Situation bedeutete. Doch nach einem kurzen Schußwechsel hatte er eine spanische Fregatte auf Grund laufen lassen und die andere erobert. Fast sofort war er daraufhin zum Flaggoffizier befördert worden.
Er schaute auf die Uhr mit ihren schwebenden Cherubinen und mußte an einen Mann denken, den er – wie keinen anderen – bewunderte, ja beneidete. Sir Richard Bolitho war wieder in England, war gerade aus diesem Krieg mit den Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Bethune hatte den Brief gelesen, den der Erste Lord der Admiralität Bolitho nach Cornwall geschickt hatte, um ihn nach London zurückzubeordern. Vor vielen, vielen Jahren war Bolitho sein Kommandant auf der Sloop Sparrow gewesen. Das war damals ein ganz anderer Krieg, obwohl er auch gegen die Amerikaner ging, die revoltiert hatten und eine eigene Nation gegründet hatten.
Der Befehl, nach London zurückzukehren, war ohne Begründung erteilt worden. Dabei hatte Sir Richard Bolitho doch sicherlich Ruhe verdient nach seinem aufopferungsvollen Dienst! Bethune mußte auch an die schöne Lady Catherine Somervell denken, die ihn zu einem Gespräch in diesem Büro aufgesucht hatte. Seine Gedanken liefen oft in diese Richtung.
Wenn das Unmögliche wirklich wahr werden und endlich Frieden herrschen würde, von Dauer oder auch nicht – was dann? Was würde aus Bolitho werden und aus all den anderen Männern, denen er auf seinem Weg vom Midshipman zum Admiral begegnet war? Und was wird aus mir? dachte er. Er kannte keine andere Lebensform, sie war seine Welt.
Häfen und Straßen waren voll von verkrüppelten und verstümmelten Überbleibseln des Krieges. Man hatte sie alle, deren Leben ruiniert war, einfach aus Heer und Marine ausgestoßen. Bethune war manchmal noch überrascht, wie sehr er sich darüber aufregen konnte. Vielleicht hatte er dieses Mitgefühl damals vom jugendlichen Kommandanten der Sparrow übernommen.
Aus dem Nebenraum, in dem sein Sekretär die ungebetenen Besucher warten ließ, hörte er Stimmen. Wieder sah er auf die Uhr. Es war noch zu früh für ein Glas. Bethune trank nicht zuviel und aß auch nicht übermäßig. Er hatte zu viele Zeitgenossen zugrunde gehen sehen. Er kümmerte sich um seine Gesundheit und machte Leibesübungen, wann immer er Gelegenheit dazu fand – ein Luxus nach der jahrelang erduldeten Enge auf Schiffen. Und er fand sein Vergnügen an Frauen, wie diese auch ihr Vergnügen an ihm fanden. Dabei ging er sehr diskret vor, oder bemühte sich jedenfalls darum. Er redete sich ein, das geschähe seiner Frau und seiner beiden Kinder wegen.
Der Diener stand in der Tür.
Bethune seufzte: »Was ist los, Tollen?«
»Kapitän MacLeod möchte Sie sprechen, Sir!«
Bethune sah zur Seite. »Bitten Sie ihn herein!«
Was beunruhigte ihn? Schuldgefühle? Dachte er an Bolithos Geliebte, die einen Skandal erduldet und als Siegerin daraus hervorgegangen war?
Der große Kapitän trat ein. Er schaute melancholisch und irgendwie starr aus. Bethune konnte sich nicht vorstellen, wie dieser Mann auf See einen Sturm abwetterte oder einen Gegner niederkämpfte.
»Neue Nachrichten?«
Der Kapitän drehte den Kopf hin und her. »Aus Portsmouth, Sir. Über den Telegraphen. Es kam eben an.« Er sah nach oben, als wolle er die Decke mit seinen Blicken durchbohren. Auf dem Dach darüber stand das Gerät, das das Gebäude der Admiralität mit der Südküste viel schneller verband als jeder berittene Bote. Dazu mußte allerdings das Wetter klar sein wie heute.
Bethune öffnete den Umschlag und zögerte. Die Schrift war rund wie die eines Schulkindes. Doch nachdem er die Seiten gelesen hatte, schien ihm, als sei jedes Wort mit Flammen geschrieben oder mit Blut.
Er ging an seinem Diener vorbei und an seinem Sekretär, der am Schreibtisch saß. Im leeren Korridor hallten seine Schritte ungewöhnlich laut. Er passierte die großen Ölgemälde an den Wänden. Sie zeigten Seeschlachten: Mut und Heldentum, doch nichts von dem Leiden der Menschen. Das sah man viel zu selten auf den Bildern.
Ein Leutnant sprang auf. »Es tut mir leid, Sir, aber die Besprechung ist noch nicht beendet.«
Bethune sah ihn nicht einmal an. Er stieß einfach die große Tür auf und blickte in überraschte, verärgerte, ja auch ängstliche Gesichter.
Der Erste Lord sah ihn stirnrunzelnd an: »Ist es so verdammt eilig, Graham?«
Bethune wollte sich die Lippen anfeuchten, wollte gleichzeitig lachen und weinen. So etwas wie jetzt hatte er noch nie erlebt.
»Vom Hafenadmiral in Portsmouth, Mylord. Die Nachricht traf gerade eben ein.«
Ganz ruhig meinte der Admiral: »Lassen Sie sich Zeit.«
Bethune nahm sich zusammen. Es war ein großer Augenblick, den er da erlebte. Und doch empfand er nichts als Trauer. »Die Armee von Marschall Soult ist bei Toulouse vom Herzog von Wellington geschlagen worden – vollständig. Napoleon ist abgedankt, hat sich den Alliierten ergeben – vor vier Tagen.«
Der Admiral erhob sich und blickte sehr langsam um den Tisch. »Das ist der Sieg, meine Herren.« Seine Worte schienen in der Luft schweben zu bleiben. »Wenn nur unser tapferer Nelson das noch erleben könnte.« Dann wandte er sich wieder an Bethune. »Ich werde sofort zum Prinzregenten gehen. Kümmern Sie sich bitte um das Weitere.« Er senkte seine Stimme, damit niemand von den anderen ihn hören konnte. »Das könnte heißen, daß Sie nach Paris müssen, Graham. Ich würde mich viel wohler fühlen, wenn Sie dort wären!«
Bethune fand sich in seinem eigenen Büro wieder, ohne sich an den Rückweg erinnern zu können.
Als er wieder aus dem Fenster blickte, hatte sich nichts verändert, weder die Leute noch die Kutschen oder Pferde. Selbst der Straßenhändler stand mit seinem Bauchladen noch an derselben Stelle.
Der ältliche Sekretär wartete gespannt an seinem Schreibtisch. »Sir?«
»Sagen Sie bitte dem Wachhabenden, er soll die Kutsche und die Eskorte für den Ersten Lord kommen lassen.«
»Sofort, Sir!« Der Mann zögerte. »Schwer zu begreifen, Sir. Zu glauben, daß jetzt …«
Bethune lächelte und legte ihm die Hand auf den Arm, so wie Bolitho es getan hätte.
Schwer zu begreifen? Es war unmöglich!
Leutnant George Avery brachte sein Mietpferd zum Stehen und lehnte sich im Sattel zurück, um den Blick zu genießen. Was für ein schönes Haus! Großartig ist der einzig passende Ausdruck dafür, dachte er. Und es war sicherlich größer als das Gebäude, in dem er die letzte Nacht verbracht hatte.
Der Ritt von der City von London zu diesem Haus am Ufer der Themse war angenehm gewesen. Er hatte Zeit gehabt, nachzudenken und sich auf das Gespräch mit seinem Onkel, Lord Sillitoe von Chiswick, vorzubereiten. Avery spürte die fröhliche Stimmung um sich herum, hatte das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen gesehen und ihr fröhliches Winken bemerkt, als er zwischen ihnen hindurch geritten war. Offensichtlich waren sie den Anblick eines Marineoffiziers zu Pferde nicht gewöhnt.
Aber das war natürlich nicht alles gewesen. Das Unmögliche war wahr geworden! Jeder Mann und jede Frau war in der Stadt auf der Straße, wie um sich zu vergewissern, daß das Ganze nicht nur wieder ein Gerücht war: Napoleon, der Tyrann, der Unterdrücker, der einen ganzen Erdteil versklaven wollte, war endlich geschlagen.
Heute morgen hatte die Frau seines Herzens ihm zugeschaut, wie er sich anzog und auf das Treffen vorbereitete. Avery spürte immer noch die Macht ihrer Leidenschaft. Würde diese Verbindung mehr als nur ein vorübergehender Traum bleiben?
Er sah zu der Kirchturmuhr hinauf. Er kam fünf Minuten zu früh. Sein Onkel würde das von ihm erwarten, obwohl er selber großen Wert darauf legte, zu seinen eigenen Verabredungen immer zu spät zu kommen.
Eigentlich kannte Avery seinen Onkel kaum. Sir Paul Sillitoe, wie er damals noch hieß, hatte seinem Neffen nahegelegt, sich als Flaggleutnant bei Sir Richard Bolitho zu bewerben. Als der Termin für das erste Gespräch kam, hätte Avery seine Bewerbung beinahe zurückgezogen, weil er wußte, daß sie wieder einmal in einer Enttäuschung enden würde. Er war bereits verwundet worden und in Kriegsgefangenschaft geraten. Nachdem man ihn ausgetauscht hatte, stellte man ihn wegen des Verlustes des Schiffes vor ein Kriegsgericht, obwohl es durch Fehler seines Kommandanten verloren gegangen war. Er selber – verwundet und hilflos – war nicht in der Lage gewesen, seine Männer daran zu hindern, die Fahne vor einem weit überlegenen Gegner zu streichen.
Noch immer erinnerte er sich lebhaft an dieses erste Treffen mit Bolitho, dem Helden, der Legende. Er würde es nie vergessen. Ihre Verbindung hatte ihn wieder aufgerichtet und aus ihm etwas gemacht, was er allein nie geschafft hätte.
Und sein Onkel? Der Mann, der schon lange über enorme Macht und großen Einfluß verfügte, war kürzlich zum persönlichen Berater des Prinzregenten ernannt worden. Jetzt fürchtete man ihn, wo man ihn nicht respektierte.
Avery klopfte dem Pferd die Flanke und wandte sich an den Stallburschen, der herbeigeeilt war, um die Zügel zu halten.
»Kümmere dich um die Stute. Ich werde sicher nicht lange bleiben!«
Türen öffneten sich, ehe er sie erreicht hatte, Sonnenlicht strömte durch das Fenster auf der Seite zur Themse, und er sah, wie sich Masten von kleinen örtlichen Handelsschiffen langsam in der Tide bewegten. Eine schöne Treppe, elegante Pfeiler, doch überall fehlten Ornamente und Gemälde – sein Onkel fand diese spartanische Umgebung sicher angenehm und passend.
In der großen Halle stand ein Diener mit unbewegtem Gesicht, die Livree mit Goldknöpfen geschmückt. Avery hatte irgendwo mal gehört, daß die meisten von Sillitoes Dienern wie Preisboxer aussahen. Auf diesen Mann traf das einwandfrei zu.
»Wenn Sie bitte in der Bibliothek warten würden, Sir!« Der Lakai senkte seinen Blick nicht, hielt die Augen auf den Besucher gerichtet wie ein Kämpfer, der einen hinterhältigen Angriff erwartet.
Avery nickte zustimmend. Der Mann fragte ihn nicht nach seinem Namen. Es gehörte zu seinen Pflichten, einen Besucher wie ihn zu erkennen.
Avery betrat die Bibliothek und blickte aus dem Fenster über den Fluß hinweg. Frieden! In seiner verwundeten Schulter meldete sich der Schmerz wieder, eine Erinnerung an den Krieg, falls er denn eine brauchte. Er dachte zurück an den Körper der Frau, der sich gegen seinen gepreßt hatte. Sie wollte seine tiefe Narbe sehen und hatte sie so sanft geküßt, daß er überrascht und gleichzeitig sehr bewegt war.
Er entdeckte sich in einem großen Spiegel und kam sich irgendwie fremd vor. An diese einzelne Epaulette auf seiner Schulter hatte er sich noch immer nicht gewöhnt. Er hatte bisher so viel erduldet. Doch als er versuchte, sich die Zukunft vorzustellen, über diesen Tag und über die Woche hinaus, fühlte er sich verloren wie in einem dichten Nebel.
Der Krieg war zu Ende. Kämpfe gab es nur noch an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada, doch auch die würden nicht mehr lange dauern.
Und was wird dann aus uns? dachte er.
»Einen Kreis verschworener Brüder« hatte Bolitho die Männer oft genannt. Adam Bolitho war immer noch in Halifax als Flaggkapitän von Konteradmiral Keen. Kapitän James Tyacke wartete auf ein neues Kommando, die Fregatte Indomitable war außer Dienst gestellt worden und sah ihrem Ende entgegen.
Avery starrte weiter auf sein Spiegelbild. Er war immer nur noch Leutnant. Graue Streifen im Haar zeigten, was ihn der Krieg gekostet hatte. Er war jetzt fünfunddreißig Jahre alt. Als er überrascht feststellte, daß er ein Leben ohne großartige Zukunft führen würde, wenn Richard Bolitho endgültig an Land gegangen war, mußte er grinsen. Er wußte, daß Bolitho ein Landleben anstrebte, und war stolz darauf, diesen Mann so genau zu kennen. Bolitho war mutig in seinen Entscheidungen und führte sie zielsicher aus. Aber wenn die Kanonen dann schwiegen und die Flagge des Feindes im Rauch niedersank, dann hatte Avery die andere Seite dieses Mannes entdeckt, den Mann voller Mitgefühl, der um die Gefallenen trauerte.
Avery blickte voller Unsicherheit nach vorne. Würde er ein eigenes Kommando übernehmen? Vielleicht so einen kleinen Schoner wie die einstige Jolie, obwohl das unwahrscheinlich war? Die Marine würde schnell Männer und Schiffe loswerden wollen, wenn die Bedingungen des Friedens zwischen den Verbündeten erst einmal fixiert worden waren. Unzählige Soldaten und Matrosen würde man auszahlen und alle, die man nicht mehr brauchte, sich selbst überlassen. So war es immer gewesen und so würde es immer bleiben.
»Wenn Sie mir bitte folgen würden, Sir!«
Avery verließ die Bibliothek und war sich der Stille im Haus sehr bewußt. Sie machte ihm klar, wie menschenleer es war. Nach einem lauten übervollen Schiff mußte er das wohl so empfinden. Doch auch verglichen mit Bolithos Besitz in Cornwall und dem ständigen Kommen und Gehen der Menschen, die zu dem Hof und dem Gut gehörten, von all den Nachbarn und Gratulanten, war dieses großartige Haus still wie ein Grab.
Sillitoe erhob sich bei Averys Eintritt und schloß eine umfangreiche Akte auf dem Schreibtisch, die er offenbar gerade studiert hatte. Doch Avery glaubte zu spüren, daß sein Onkel bereits eine Weile nur auf die Tür gestarrt hatte. Um sich zu sammeln? Das schien wenig wahrscheinlich. Wohl eher, um schnell mit der Angelegenheit hier fertig zu werden, basta, und das wäre es dann.
Sie schüttelten sich die Hand, und Sillitoe sagte: »Das ist im Augenblick alles, Marlow!«
Ein kleiner Mann, den Avery bisher nicht bemerkt hatte, erhob sich hinter einem zweiten Schreibtisch und eilte davon. Marlow war wahrscheinlich Sillitoes Sekretär, doch der Onkel hielt es bezeichnenderweise nicht für nötig, ihn vorzustellen.
Er sagte nur: »Ich habe einen guten Bordeaux, der dir gefallen wird.«
Wieder sah er ihn an, und Avery spürte die dunklen, zwingenden Blicke unter den halb geschlossenen Lidern, denen nichts entging. Er verstand jetzt, warum die Leute seinen Onkel fürchteten.
»Ich freue mich, daß du hier bist. Man hat immer weniger Zeit.« Er runzelte die Stirn, als ein anderer Diener mit Rotwein und Gläsern eintrat. »Wir hatten Glück, daß du in London warst und meine Nachricht sofort erhieltest.« Sein Blick ließ ihn nicht los, doch es lagen weder Triumph noch Verachtung darin. »Wie geht es übrigens Lady Mildmay?« fragte er scheinbar nebenher.
»Es geht ihr gut, Sir. Wie es scheint, gibt es in London keine Geheimnisse mehr!«
Sillitoe lächelte leicht. »Natürlich nicht. Aber du hast dir auch nicht viel Mühe gegeben, die Angelegenheit geheimzuhalten. Welche Sprachregelung wollen wir finden? Für eine Liaison mit einer Dame, die die Ehefrau deines letzten Kommandanten war? Natürlich wußte ich davon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Sache gutheißen soll. Und ob du dir aus meiner Meinung etwas machst!«
Avery setzte sich. Kam es darauf an? Diesem Mann schuldete er gar nichts.
Er dachte an Bolitho. Dem verdanke ich alles.
»Du wirst dies sicher noch nicht gehört haben.« Sillitoe nahm ein Glas und sah ihn ernst an. »Sir Richard Bolitho ist nach London zurückbeordert worden. Er wird gebraucht.«
Avery trank den Wein, ohne ihn zu schmecken. »Ich dachte, er solle aus dem aktiven Dienst entlassen werden, Sir!«
Sillitoe sah ihn über den Rand seines Glases an, schien durch die deutlichen Worte etwas irritiert. Er mochte seinen Neffen und fühlte sich veranlaßt, etwas für ihn zu tun, nachdem er aus französischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden war, um sofort vor ein Kriegsgericht zitiert zu werden. Eine schlimme, durchaus unnötige Angelegenheit.
Wie auch immer, Sillitoe hatte wenig Zeit, sich um die Gewohnheiten und Traditionen der Marine zu kümmern. Sein älterer Bruder war Kapitän gewesen und im Kampf gefallen. Er war der Mann gewesen, der den jungen Avery bewogen hatte, in die Marine einzutreten, und der ihn auch als jungen Midshipman gefördert hatte. Aber Averys Worte überraschten ihn nun, und Überraschungen liebte er nur, wenn sie von ihm ausgingen.
Avery sagte jetzt wie zu sich selbst: »Dann wird er mich immer noch brauchen.«
Sillitoe runzelte die Stirn. »Ich habe sehr viel Einfluß. Ich bin auch ein wohlhabender Mann, ja manche meinen, sogar ein sehr wohlhabender. Ich bin hier an Geschäften beteiligt und auch in Jamaika und Westindien. Ich brauche jemanden von untadeligem Charakter.« Er lächelte kurz. »Und wenn du so willst: einen Mann von Ehre.«
Avery setzte sein leeres Glas ab. »Bieten Sie mir eine solche Position an, Sir?«
Sillitoe schritt zum Fenster und zurück. »Ein neues Leben – das wäre die bessere Bezeichnung.«
Avery beobachtete ihn und spürte plötzlich, daß Sillitoe sich gar nicht wohl fühlte. Er war beunruhigt, und dieses Gefühl war ihm neu.
»Warum mir, Sir?«
Ärgerlich wandte sich Sillitoe ihm zu. »Weil du irgendeinen Ausgleich verdienst für dein gebrachtes Opfer und für die unfaire Behandlung, die man dir angetan hat.« Er schüttelte den Kopf, als wolle er eine innere Stimme zum Schweigen bringen. »Und weil ich vorhabe, dich zu meinem Erben zu machen.« Wieder sah er ihn an. »Mein Halbbruder stirbt gerade am Fieber und an einer Selbstzufriedenheit, die seinen Vater krank gemacht hätte, obwohl er ein harter Mann war.«
Die Tür öffnete sich einen Spalt breit.
»Die Kutsche steht in fünfzehn Minuten vor der Tür, Mylord.«
Sillitoe erklärte: »Ich muß zu Seiner Königlichen Hoheit. Ludwig von Frankreich kommt gerade durch London auf dem Weg nach Frankreich, wo er Rechte auf den Thron anmelden wird.« Dann grinste er. »Es gibt also weiter viel zu tun!«
Avery fand sich plötzlich an der Tür stehend wieder, den Hut in der Hand.
Sillitoe hielt die Hand schützend über die geblendeten Augen und schaute auf den Fluß. »Genieß deine Freiheit mit der schönen Susanna.« Dann packte er Averys Handgelenk wie in einer stählernen Klammer. »Und dann komm zurück und sag mir, wie du dich entschieden hast.«
Avery hörte, wie die Pferde unruhig stampften. Er war von seiner eigenen Ruhe überrascht. Es war wie damals, als die Indomitable im Duell von Kanone zu Kanone mit dem Gegner gelegen hatte und Männer keine Hand weit entfernt neben ihm starben. Bolitho hatte neben ihm gestanden, hatte sich auf ihn verlassen.
Und wenn Sillitoe Susanna falsch einschätzte? Vielleicht gab es zwischen ihnen doch mehr als das lodernde Feuer geschlechtlicher Freuden.
Er sagte: »Ich danke Ihnen, Sir, aber ich glaube nicht, daß ich Ihr Angebot verdient habe.« Er drückte dem Pferdeknecht eine Münze in die Hand. »Ich bin Sir Richard immer noch eng verbunden!«
Sillitoe sah ihn kühl an. »Dann bist du ein Narr!«
Avery rückte im Sattel zurecht und blickte auf ihn herab. »Wahrscheinlich haben Sie recht, Sir.«
Er hätte noch mehr sagen können, doch als er an den Zügeln zog, sah er seinen Onkel so wie nie zuvor: Es war ein Mann mit Macht und Einfluß. Ein Mann ganz und gar auf sich gestellt.
Bryan Ferguson sprang von seinem zweirädrigen Wägelchen und vergewisserte sich, daß das Pony das Wasser leicht erreichen konnte.
»Du bleibst hier, Poppy.« Er blickte auf den Futtersack und entschied sich dagegen. Das Pony wurde ohnehin schon zu dick.
Dann drehte er sich um und sah sich das weiße, niedrige Gasthaus an, das »Old Hyperion«. Das Wirtshausschild, das ein Schiff am Wind mit den Wellen kämpfend zeigt, bewegte sich zeigte, bewegte sich kaum. Weil es das einzige Gasthaus am Rande des Dorfes Fallowfield war, hatte es viele Stammgäste. Aber an diesem warmen Aprilabend würde das Gasthaus sicherlich leer sein, weil alle Männer noch spät auf ihren Höfen arbeiteten. Ferguson konnte durch die Bäume hindurch das Wasser des Flusses Helford glänzen sehen, was für ein angenehmes Fleckchen Erde.
Früh am Morgen war er in Falmouth gewesen. Ihm war aufgefallen, daß sich vieles geändert hatte, seit die Nachricht von Napoleons Ende das Land erreicht hatte. In den Straßen waren viel mehr junge Männer als sonst zu sehen, ein sicheres Zeichen, daß die gefürchteten Preßkommandos nicht mehr ausgeschickt wurden. Es würde dauern, bis man sich an die neue Lage gewöhnt hatte. Ferguson bewegte grimmig seinen einzigen Arm. Ihm war in letzter Zeit kaum noch bewußt geworden, daß er nur einen Arm hatte. Und er dachte auch kaum noch daran, daß er einst zusammen mit John Allday in die Marine gepreßt worden war.
Das Schicksal hatte so seine eigenen Wege. Jetzt war Allday Bootsführer und Freund von Sir Richard Bolitho, und Ferguson war der Verwalter des Bolithoschen Gutes. Bolitho war damals Kommandant des Schiffes gewesen, das sie am Strand aufgegriffen und zu Dienern des Königs gemacht hatte.
Er seufzte. Hoffentlich würde er seinen Auftrag gut erledigen. Man hatte sicherlich gehört, wie sein Wägelchen in den Hof gefahren kam.
Unis, Alldays Frau, erwartete ihn bereits und grüßte. »Ach, Bryan, das ist eine Überraschung. Du warst doch sicher heute auch auf dem Markt!«
Ferguson trat durch die Tür und bemerkte die sauber gescheuerten Tische, die Blumen und das glänzend polierte Messing – sauber und einladend wie die Frau.
»John ist irgendwo draußen, hat da wohl was zu tun.« Sie lächelte. »Ich spreche von meinem John!«
Der andere John war Unis Bruder, ein einbeiniger ehemaliger Soldat, ohne den sie das Haus nicht hätte führen können, während Allday auf See war. Sie fragte: »Du möchtest ihn sprechen? Ist auf dem Gut irgend etwas nicht in Ordnung?«
Er sagte nur: »Heute kam ein Bote, Unis.« Es hatte keinen Sinn, der Angelegenheit eine heitere Seite zu geben. »Von der Admiralität.«
Sie setzte sich auf eine Bank und sah auf ihre mehlbestäubten Arme. »Ich dachte, nachdem Napoleon sich ergeben hat, wär’ alles vorbei. Braucht man Sir Richard Bolitho wieder?« Sie wischte über das Mehl auf ihrer Haut. »Und meinen John?«
»Kann sein!« Ferguson mußte an Lady Catherine Somervells Gesicht denken, als der Bote wieder davon geritten war. Er hatte sie laut protestieren hören: »Es ist nicht gerecht! Und falsch!«
Er war erst ein paar Wochen hier, war zurück aus dem Krieg im fernen Amerika. Vielleicht wollte man ihn auf die eine oder andere Art ehren!
Er hörte, wie Allday seine Schuhe auf der Matte vor der Tür säuberte und sagte: »John muß nicht mit, Unis. Sir Richard würde das nie von ihm verlangen!«
Unis war wieder ganz ruhig und atmete wie immer. »Ich weiß das, Bryan. Aber du denkst nicht wie John, der immer die See und Sir Richard im Kopf hat!«
Allday trat ein. »Kate schläft wieder, wie ich sehe.« Er schüttelte dem Freund die Hand. »Die wird mal genauso schön wie ihre Mutter.«
Unis sagte: »Ich hole dir was zu trinken, Bryan.« Sie berührte im Vorbeigehen Alldays Schulter, und Bryan bemerkte den Schmerz in ihrem Blick. »Und dir natürlich auch.«
Allday sah ihn unbewegt an. »Sie hat uns allein gelassen. Also, was ist los? Schlimme Nachrichten?«
»Sir Richard muß nach London zurück. Zur Admiralität.«
Ferguson zuckte mit den Schultern. »Es ist immer dasselbe!«
»Viel Zeit haben die ihm nicht gegeben. Wann brechen wir auf?«
Ferguson war gerührt und gleichzeitig bekümmert. So war es schon beim letzten Mal gewesen und auch bei all den anderen Abschieden vorher.
»Er erwartet nicht, daß du mit ihm nach London gehst, Mann. Du hast hier schließlich ein paar Aufgaben, Unis und das kleine Mädchen, das da schläft. Der Kampf ist vorbei, jedenfalls der mit den Franzosen, und die Yankees werden nie bis hierher kommen.« Aber solche Worte halfen nicht. Was hatte er eigentlich erwartet?
Allday sagte nur: »Ich muß bei ihm bleiben, das weißt du genau. Er braucht mich jetzt mehr als sonst. Sein Auge ist nicht besser geworden.«
Ferguson blieb daraufhin stumm. Allday hatte ihn in das Geheimnis eingeweiht, wohl wissend, daß er sogar seiner Frau gegenüber verschwiegen war. Er liebte Grace aus vollem Herzen, doch er wußte auch, daß sie ein Schwätzchen hier und da sehr gern mochte.
Allday blickte auf seine Hände, schwere Pranken, auf denen Narben von den Jahren auf See erzählten. »Hat die Nachricht Sir Richard sehr getroffen?«
»Schwer zu sagen. Ich habe ihn und seine Dame beobachtet – genau wie du. Ich bin stolz, dazuzugehören, aber seine Gedanken behält er für sich.«
Unis kam mit zwei beschlagenen Krügen zurück. »Wenn mein Bruder wieder da ist, soll er ein neues Faß Bier anstechen. Ich glaube, wir werden heute abend viele Gäste haben.« Sie blickte zu Ferguson hinüber. »Du hast es ihm also gesagt?«
»Aye, aye.«
Allday starrte auf den Krug zwischen seinen Pranken, als wolle er ihn zerdrücken. »Könntest du dir vorstellen, daß Sir Richard jemand anderen nimmt? Es ist schwer, aber niemand ändert sich schnell, und schon gar nicht über Nacht.«
Sie berührte wieder seine Schulter. »Auch du änderst dich nicht. Ich will das auch nicht. Ich weiß, daß du dich dagegen wehrst – wegen mir und der kleinen Kate. Sie strahlt ja richtig, seit du wieder an Land bist!«
Unis sah zur Seite, erinnerte sich an seine Überraschung und seinen Schmerz, als das Kind zu ihrem Bruder John gelaufen war wie zu einem Vater, als Allday zurückgekommen war. Man brauchte Zeit für alles. Doch jetzt würde er schon wieder gehen. Damit mußte sie sich abfinden.
Sie dachte an Lady Catherine. Sie hatte sie beobachtet, als vor Tagen der kleine Schoner Pickle im Hafen von Falmouth vor Anker gegangen war und Bolitho heimbrachte. Lady Catherine hatte auf der Pier gewartet. Wie immer stand Allday neben Bolitho. Catherine, die so tapfer allen Skandal ausgehalten hatte und sich nichts aus dem Gerede machte, würde der neue Abschied sehr mitnehmen.
Im Hof waren Stimmen zu hören, und Unis sagte fröhlich: »Der Fischhändler. Ich habe ihm gesagt, er soll kommen.« Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Ich rede mit ihm.«
Wieder allein mit Allday sagte Ferguson: »Sie ist eine Perle, mein lieber John!«
»Das weiß ich wohl!« Allday sah sich suchend um. »Ich werde mal das neue Faß holen und anstechen. Das dauert nicht lange. Bleib hier und trink aus. Ich muß auch mal nachdenken.«
Ferguson seufzte. Er wußte, was als nächstes kam. Mit irgendeiner Ausrede würde John Allday oben im Gutshaus erscheinen, mit Sir Richard reden und ihm sagen, daß er bereit sei mitzukommen.
Ferguson drehte sich um, weil er ein Stürzen und ein Husten gehört hatte, und betrat den angrenzenden Raum, ein kühles Geviert, in dem die Fässer lagerten, ehe sie nach draußen getragen und angestochen wurden. Ein Faß, das vier und eine halbe Gallone faßte, war gegen die Wand gerollt. Allday saß mit dem Rücken dagegen und preßte sich die Hände auf die Brust. Er atmete laut und unregelmäßig wie jemand, den man gerade aus dem Wasser gezogen hatte. Ferguson kniete neben ihm und legte ihm den Arm um die Schulter. »Langsam, John. Diese verdammte Narbe!«
Er beobachtete besorgt, wie sein Freund nach Luft rang, und fragte sich, wie lange dieser Zustand schon dauerte. Als Allday sich umdrehte, war Ferguson über seine Blässe entsetzt, die auch durch die tiefe Bräunung nicht verborgen wurde.
»Ich hole Unis«, sagte er.
Allday schüttelte den Kopf und knirschte mit den Zähnen. »Nein! Bleib hier.« Er nickte schwer und holte tief Luft. »Es ist schon wieder vorbei. Mir geht es wieder gut!«
Ferguson sah, wie die Farbe in das verwitterte Gesicht zurückströmte. Auch der Atem ging gleichmäßiger.
Allday ließ sich auf die Beine helfen und sagte dann: »Kein Wort darüber. Sowas kommt und geht.« Er versuchte ein Grinsen. »Jetzt ist alles wieder in glänzender Ordnung.«
Ferguson schüttelte den Kopf und gab auf. Er war geschlagen, wie er es vorher geahnt hatte. Allday und Bolitho, wie Herr und Hund, hatte mal jemand gesagt. Jeder auf den anderen angewiesen.
Zusammen hoben sie das Faß auf den Bock. Und dann sagte Allday: »Ich brauch’ jetzt was Stärkeres als Bier, und das muß sein!«
Unis fand sie vor dem Kamin sitzend, in dem das Feuer noch nicht brannte. Ihr Mann hielt seinem Freund einen brennenden Fidibus an die Tonpfeife, als kümmere ihn sonst nichts auf der Welt. Sie biß sich auf die Lippe, um ihren Schmerz nicht zu zeigen. Man spielte ihr etwas vor. Wie schon mit dem Faß auf dem Bock. Den Rest konnte sie sich denken.
Ferguson sagte: »Ich muß zurück. Muß mich um die Bücher kümmern.«
Allday begleitete ihn auf den Hof und wartete, bis sein Freund auf den Sitz des Wägelchens geklettert war.
»Danke, Bryan«, sagte er dann nur. Er sah über die Felder und entdeckte zwischen den Bäumen den glitzernden Fluß. »Du bist nicht dabei gewesen, verstehst du. Sir Richard, Admiral, der beste, den die Flotte hat, führte unsere Entermannschaft auf das Deck des Gegners wie ein wild gewordener junger Leutnant! Du hättest dabei sein sollen. Mir nach, Männer von der Indom!«. Er schüttelte sein graues Haupt. »Da kann ich ihn doch jetzt nicht allein lassen.«
Er hob eine Hand und grinste. Es war einer der traurigsten Anblicke, an die Ferguson sich erinnerte.
Und einer der tapfersten.
Richard Bolitho lehnte sich in die Ecke der Kutsche und sah durch das Fenster auf die Leute und die Pferde. Kutschen jeder Größe suchten sich ihren Platz, ohne auf die anderen zu achten.
Trotz der warmen Abendluft trug er seinen Bootsmantel, um seine Uniform und seinen Rang nicht zu zeigen. In der wilden Feierei nach Napoleons Niederlage führte ein solcher Anblick zu Jubelschreien und Hochlebenlassen selbst von ganz normalen Leuten, die solche Gefühle bisher allenfalls einmal Nelson gezeigt hatten.
Ein langer Tag, ein sehr langer Tag. Erst Bethune und danach der Erste Lord und seine Senior-Berater. Napoleon war auf die Insel Elba ins Exil geschickt worden. Der Gigant, der einen ganzen Erdteil erschüttert hatte, war festgesetzt und würde vergessen werden. Doch bereits in dem Augenblick, als der Erste Lord das aussprach, fragte Bolitho sich, ob diese Entscheidung wohl weise gewesen war. Ihm schien, als wolle man einen Löwen in einem Vogelkäfig halten, der zudem noch viel zu nahe platziert war, wirklich viel zu nahe.
Der Erste Lord hatte sich gründlich über den amerikanischen Krieg ausgelassen und über den Anteil von Bolitho mit seinem Geschwader. Die Amerikaner wurden durch den darniederliegenden Handel ausgehungert, und das war das Verdienst der britischen Geschwader und der Befehlshaber zwischen Halifax und der Karibik. Schon fast tausend amerikanische Handelsschiffe waren aufgebracht worden, und da Frankreich die britische Flotte nicht länger band und schwächte, konnten immer mehr Schiffe über den Atlantik geschickt werden, um die letzten Löcher in der Blockade zu stopfen.
Der Erste Lord hatte seine Rede mit der Bemerkung geschlossen, daß kein Krieg durch eine Schachmatt-Situation beendet werden kann. Man mußte ein Exempel statuieren, eine deutliche Warnung für die Zukunft.
Bethune, der Bolitho beobachtete, hatte einige Bemerkungen eingeflochten, die den amerikanischen Angriff auf York betrafen.
Der Erste Lord war alt, aber kein Narr, und er hatte Bethunes Bemerkungen als Ablenkungsversuch erkannt.
»Was meinen Sie, Sir Richard? Ich weiß, daß Sie sehr fortschrittliche Vorstellungen vom Krieg auf See haben. Ich erinnere mich gut, wie Sie damals in diesen Räumen sagten, daß der Kampf in Linie eine Sache der Vergangenheit sei.«
Bolitho sah zur Seite auf die glänzende Themse. Das strahlende Leuchten versprach einen herrlichen Sonnenuntergang.
»Dazu stehe ich weiterhin, Mylord. Und ich glaube auch weiterhin nicht, daß der Wunsch nach Rache ein ausreichender Grund sein sollte, einen Krieg zu verlängern, den keine Seite zu gewinnen hoffen kann.«
In dem Augenblick war er davon ausgegangen, daß wieder ein Angriff geplant wurde. Jetzt, auf der langen Kutschfahrt von der Admiralität bis Chelsea, fand er Zeit zum Nachdenken und war sich seiner Sache ganz sicher. Sir Alexander Cochrane hatte sich in den Dienst seiner Aufgabe gestellt. Er war in jeder Hinsicht ein Draufgänger und ganz bestimmt kein Mann des Friedens.
Während Bolitho mit Bethune allein gewesen war, hatte er sich nach Valentine Keen und seinem Neffen erkundigt.
Sorgfältig abwägend hatte Bethune geantwortet: »Konteradmiral Keen wird noch in diesem Jahr nach England zurückkehren. Sein Flaggschiff wird höchstwahrscheinlich außer Dienst gestellt.«
Er hatte dabei von seinem Schreibtisch aufgeblickt, und einen Augenblick lang hatte Bolitho in dem Admiral wieder den Midshipman gesehen. Die Männer lagen schließlich nur ein paar Jahre auseinander, und Bethune war unter all seiner Liebenswürdigkeit und seiner Verläßlichkeit ganz der Alte geblieben. Er war vor allem grundehrlich und loyal.
»Ich bin sicher, daß Ihr Neffe weiter in der Marine bleiben wird, selbst wenn man die Flotte verkleinert, was sicher ist.«
»Er ist wahrscheinlich der beste Kommandant einer Fregatte, den wir haben. Ihn einfach an Land zu setzen, nach all dem, was er für sein Land getan und auf sich genommen hat, wäre inakzeptabel.«
In diesem Augenblick hatte Bethune sich wahrscheinlich entschieden. »Wir sind gute Freunde, Richard«, hatte er gesagt. »Ich bedauere nur, daß wir uns so selten begegnet sind.« Er hob leicht die Schultern. »Aber das ist so in unserem Beruf. Ich werde nie vergessen, daß ich Ihnen alles verdanke – von dem Augenblick an, als Sie auf der Sparrow das Kommando übernahmen. Und es gibt viele wie mich, die einer Begegnung mit Ihnen alles verdanken.«
»Aber es gibt auch viele, die daran zerbrachen, Graham!«
Doch Bethune hatte den Kopf geschüttelt, den Gedanken verdrängt. »Wir treffen den Ersten Lord gleich wieder nach seiner Besprechung mit dem Prinzregenten. Diese Konferenzen dauern gewöhnlich nicht lange.« Er hielt inne, und dann war sein Lächeln plötzlich verschwunden. »Ich habe Ihnen zu sagen, daß der Erste Lord Ihnen Malta anbieten wird. Er wird darauf bestehen, daß Sie der richtige Mann dafür sind. Bis die Verbündeten sich schließlich über die endgültigen Friedensbedingungen geeinigt haben, dient uns das Mittelmeer als Warnung an Freund und Feind gleichermaßen. Wir werden keine weiteren Ansprüche auf Länder oder Meere akzeptieren.« Schweigend hatte er dann Bolitho angesehen. »Ich dachte, ich sollte Ihnen das als erster mitteilen.«
»Das war freundlich von Ihnen, Graham.« Bolitho hatte sich in dem geräumigen Zimmer umgeschaut. »Hier lauern auch Gefahren, also seien Sie hier auch auf der Hut.« Er klopfte jetzt gegen das Kutschendach und rief: »Ich werde von hier aus zu Fuß gehen!«
Der Kutscher in der Livree der Admiralität sah von seinem Bock kaum nach unten. Wahrscheinlich war er zu sehr an die Launen höherer Offiziere gewöhnt, um sich noch Gedanken zu machen.
Dann ging Bolitho am Fluß entlang. Kates London. Sie hatte die Stadt auch zu seinem London gemacht, oder wenigstens einen Teil davon. Was soll ich sagen? Was muß ich ihr sagen? dachte er.
Der Erste Lord hatte keinerlei Zweifel gezeigt. »Seit Collingwood den Posten nicht mehr innehat, hat es dort kaum Stabilität und Führung gegeben. Ihr Ruf und Ihr Einverständnis sind dort wichtiger als in der Schlachtlinie.« Er hatte vorgezogen nicht zu erwähnen, daß Collingwood, Nelsons Stellvertreter bei Trafalgar, im Mittelmeer gestorben war, ohne je von dem Kommando abgelöst worden zu sein – trotz wiederholter Bitten, in die Heimat zurückkehren zu dürfen, und trotz der Krankheit, die ihn schließlich niedergestreckt hatte.
Bolitho ging mit unruhigen Gedanken weiter.
Es war schlimm genug, als Catherine und er Falmouth verlassen wollten. Allday war erschienen, angeblich nur, um zu prüfen, daß mit den Säbeln alles in Ordnung war. Doch dann war er sofort zur Sache gekommen. Er hatte nicht darum gebeten, sondern einfach auf seinem Recht beharrt, an Bolithos Seite zu bleiben, wo auch immer dessen Flagge wehte. Genauso Yovell, der Sekretär, ein Mann mit vielen Talenten, und der geheimnistuerische Ozzard. Sein Kreis verschworener Brüder. Dann mußte Bolitho auch an Avery denken. Bethune hatte Andeutungen gemacht, daß Avery etwas Großes angeboten worden war, eine Gelegenheit, in Sicherheit und Reichtum zu leben. Der würde also weiß Gott nicht mehr als kleiner Leutnant weiter dienen wollen.
Die Tür stand offen, und Catherine erwartete ihn oben auf der Treppenstufe. Das Haar war über ihren Ohren aufgesteckt und glänzte wie Seide im Kerzenlicht.
Sie legte Bolitho den Arm um die Taille. »Komm in den Garten, Richard. Dort wartet Wein auf uns. Ich habe dich kommen gehört.« Sie schien seine Anspannung zu spüren. »Ich hatte Besuch!«
Er drehte sich zu ihr. »Wen?«
Sein Gesicht konnte ihr nichts mehr verbergen.
»George Avery. Er kam mit einem Auftrag, mit einer Einladung zu einem Empfang.« Sie streichelte seine Hand. »Morgen. Danach werden wir nach Falmouth zurückkehren.«
Bolitho antwortete nichts, folgte ihr in den Garten in die dunkler werdenden Schatten. Er hörte, daß sie den Wein eingoß und dann fragte: »Es ist also Malta, Richard?«
Von dem Zorn, den sie in Falmouth gezeigt hatte, war nichts mehr zu spüren. Sie war die entschlossene Frau, die seinetwegen alles aufs Spiel gesetzt hatte, die mit ihm sogar die Leiden in einem offenen Boot vor der afrikanischen Küste geteilt hatte.
»Ich habe mich noch nicht entschieden, Kate!«
Sie legte ihm leicht einen Finger auf den Mund. »Aber du wirst es annehmen. Ich kenne dich gut genug, fast besser als du dich selbst. Alle Männer, die du geführt und begeistert hast, erwarten das von dir. Es geht um sie und um die Zukunft, für die ihr alle gekämpft habt. Du hast mir mal gesagt, daß sie niemals fragen oder anzweifeln durften, warum sie so große Opfer zu bringen hätten.« Sie schritten zusammen zur niedrigen Wand und sahen die Sonne hinter dem Fluß untergehen. Und dann sagte sie: »Du bist mein Mann, Richard. Ich werde immer zu dir stehen, wie unfair oder ungerecht man dich auch behandeln mag. Ich würde lieber sterben, als dich zu verlieren.« Sie streichelte sein Gesicht, die Wange unter seinem verletzten Auge. »Und was geschieht danach?«
»Danach, Kate? Danach ist ein schönes Wort, danach wird und kann uns nichts mehr trennen.«
Sie nahm seine Hand und drückte sie gegen die Brust. »Nimm mich, Richard. Nimm mich, wie du willst, aber liebe mich immer.«
Der Wein im Garten blieb unberührt.
II Mehr als die Pflicht
Kapitän James Tyacke saß in seinem Zimmer an einem kleinen Tisch und hörte aus dem Raum unter seinen Füßen undeutliche Stimmen. »Cross Keys« war ein kleines, doch gemütliches Landgasthaus an der Straße, die von Plymouth nördlich nach Tavistock führte. Wegen der Enge der Straße hielten hier nur wenige Kutschen, und er hatte sich schon manchmal gefragt, wovon die Besitzer lebten. Vielleicht hatten sie Verbindungen zu Schmugglern. Ihm war das sehr recht, denn es gab keine neugierigen Blicke und kein entsetztes Kopfabwenden, das nach Mitleid, Neugier und Ablehnung roch.
Es war schlimm, wenn nicht mehr, daß er das letzte Mal vor drei Jahren hier abgestiegen war. Damals hatte eine freundliche Frau das Haus geführt, Meg, die sich oft mit ihm unterhalten hatte. Sie konnte ihn ohne Entsetzen anschauen. Das war nun schon drei Jahre her. Als er beim letzten Mal das Gasthaus verlassen hatte, wußte er, daß sie sich nie wieder begegnen würden.
Auch der neue Wirt hatte ihn willkommen geheißen. Er war ein Wiesel von einem Mann, mit schnellen, überraschenden Bewegungen. Er hatte bestens dafür gesorgt, daß Tyacke nicht gestört wurde.
Drei Jahre. Ein ganzes Leben. Er sollte damals gerade das Kommando über die Indomitable übernehmen, Sir Richard Bolithos Flaggschiff vor dem Aufbruch in amerikanische Gewässer. Unendlich viele Meilen, zahllose neue Gesichter, einige waren schon aus seinem Gedächtnis gelöscht. Und nun lag ebendiese Indomitable in Plymouth, ausgemustert, ein leeres Schiff, das auf eine neue Zukunft wartete – oder auf gar nichts mehr.
Tyacke blickte auf die große Seekiste mit ihren Messingbeschlägen vor seinem Bett. Sie waren viele Meilen zusammen gereist, und seine ganze Welt lag in ihr beschlossen.
Er dachte an die letzten Wochen, die er zum größten Teil an Bord verbracht hatte, um sich um die tausendundein Details zu kümmern, die mit der Außerdienststellung einhergingen. Schlimmer waren die kurzen Abschiedsworte und das Schütteln rauher Hände von Männern, die er so gut wie sich selbst kennengelernt hatte und die ihm – dank seinem eigenen Vorbild – vertrauten und ihm ergeben waren.
Und dann Sir Richard Bolitho – das war der schlimmste Abschied gewesen. Als Admiral und Flaggkapitän hatten sie gegenseitig verläßliche Treue entwickelt und Bewunderung füreinander, die kein Außenstehender je ganz begreifen würde.
Napoleon war also geschlagen! Der Krieg mit dem alten Feind war vorüber. Tyacke sollte Erleichterung verspüren, aufatmen können. Doch als er Pickle, den Schoner der Flotte, beobachtete, der ablegte und in Richtung Land segelte, um Bolitho und Allday nach Falmouth zu bringen, hatte er nur Trauer und Leere gefühlt.
Der Hafenadmiral war ein Freund Bolithos und war deshalb dem Flaggkapitän freundlich und hilfreich begegnet. Doch zweifellos hatte er Tyackes Wunsch als bizarr empfunden. Er wollte wieder zur Anti-Sklaven-Patrouille vor Westafrika kommandiert werden, vom relativen Komfort eines großen Schiffes oder von einem wohlverdienten langen Urlaub an Land in die schreckliche Enge eines kleinen Schiffs mit der Aussicht auf Fieber und Tod. Bolithos schriftlicher Bericht hatte dem Wunsch einiges Gewicht gegeben. Dennoch mußte der Admiral ihm mitteilen, daß sein Antrag vielleicht erst in einem Jahr, wenn nicht noch später genehmigt werden würde.
Er erinnerte sich an die Indomitable, wie er sie zuletzt gesehen hatte. Die Rahen waren abgeschlagen, das sonst makellos saubere Deck lag voller Seile und Sparren, und ihre mächtigen Kanonen, die die amerikanische Retribution donnernd niedergekämpft hatten, schwiegen und waren vorläufig unbrauchbar gemacht worden. Sie wurde jetzt nicht mehr benötigt, ebenso wie die meisten Männer, die auf ihr so lange und so gut gedient hatten und die zum größten Teil in die Marine gepreßt worden waren.
Tyackes Mund verzog sich zu einem Lächeln. Auch Allday war eigentlich ein gepreßter Mann. Und was hatte man mit den Verwundeten vor? Sie wurden an Land gesetzt und sich selber überlassen in einer Welt, die sich längst nicht mehr an sie erinnerte. Sie mußten, so gut es eben ging, für sich selber sorgen, also in den Straßen Menschen anbetteln, die am liebsten den ganzen Krieg längst vergessen hätten.
Nicht so Sir Richard Bolitho, der Mann, der Held. Er konnte andere sogar dann begeistern, wenn schon alle Hoffnung verloren schien. Und er konnte sein Mitgefühl nicht verbergen, ebensowenig wie seine Trauer um die Gefallenen.
Wieder lächelte Tyacke. Bolitho hatte ihm seine Hoffnung und seinen Stolz wiedergegeben, als er beides für immer verloren glaubte. Tyacke berührte sein Gesicht an der Seite. Es war von Flammen versengt, sah nach der großen Schlacht bei Abukir nicht mehr menschlich aus, in der Nelson seine Schiffe an den Nil geführt hatte. Es war ein Wunder, daß auf dieser Seite das Auge unverletzt geblieben war. Irgendjemand hatte gemeint, er habe verdammt viel Glück gehabt. Was wußten die Menschen schon?
In all den Jahren hatte seine Entstellung ihn begleitet. Eine französische Breitseite hatte ihn niedergestreckt, die Männer um ihn herum waren getötet und verstümmelt worden, und auch der Kommandant der Majestic war in der blutigen Auseinandersetzung gefallen. Seine jungen Kameraden hatten die Blicke gesenkt, hatten an ihm vorbei geblickt, hatten irgendwohin gestarrt, um ihn bloß nicht anzusehen. »Der Teufel mit dem halben Gesicht«, hatten die Sklavenhändler ihn dann getauft.
Und jetzt hatte er darum gebeten, in diese einsame Welt der Patrouillen zurückzukehren, um sein Können an dem der Händler zu messen, bis er sie fand und verfolgen konnte. Es waren stinkende Schiffe, ihre Laderäume waren voll beladen mit angeketteten Sklaven, die in ihrem eigenen Dreck leben mußten. Sie wußten, daß sie bei der kleinsten Provokation getötet, ihre Körper den Haien zum Fraß vorgeworfen werden würden. Sklavenschiffe und Haie waren nie weit voneinander entfernt.
Nein, man wollte Bolitho nicht aus der Marine entlassen. Für viele, die an Bord gedient hatten, war er die Marine. Und Bolitho und seine Geliebte hatten sich einen Dreck um die Konventionen der Gesellschaft und deren Zensur gekümmert. Wieder berührte Tyacke sein Gesicht. Er erinnerte sich, wie die Lady in Falmouth die Lotsenleiter zur Indomitable hinaufgeklettert war und den Bootsmannsstuhl zurückgewiesen hatte. Als sie, mit Teerflecken auf den Strümpfen, an Deck angekommen war, hatte die ganze Mannschaft sie deswegen laut bejubelt. Die Seemannsbraut, die an Bord gekommen war, um ihnen allen gute Wünsche zu bringen. Männer, die Preßtrupps von Weib und Kind fortgerissen hatten, bestimmt für das andere Ende der Welt, ebenso wie die Schurken, die Richter freigelassen hatten, unter der Bedingung, daß sie an Bord eines Schiffs des Königs gingen.
Die junge Frau hatte das getan, weil sie diese Männer mochte. An jenem Tag in Falmouth hatte sie alle Formalitäten vergessen und hatte Tyacke bei der Begrüßung auf die Wange geküßt. »Sie sind hier sehr willkommen.« Diese Worte hörte er immer noch. Und dann hatte sie das dicht bestandene Deck genau gemustert, die neugierigen Matrosen und Seesoldaten, und hatte zu Bolitho gesagt: »Diese Männer lassen dich nicht im Stich.« Und das hatten sie auch nicht.
Vielleicht war sie die einzige, die Tyackes ganze Qual begriffen hatte, als er akzeptierte, Flaggkapitän von Sir Richard Bolitho zu werden. Man würde ihn beneiden, fürchten, respektieren, ja auch hassen, aber ein Kapitän, ganz besonders als Kommandant eines Flaggschiffes, mußte über alle Zweifel und über alles Zögern erhaben sein. Nur wenige begriffen, daß er mit diesen Gefühlen in Plymouth an Bord gestiegen war, um sich einzulesen und das Kommando zu übernehmen.
Seine Worte von damals meldeten sich in seinem Gedächtnis wieder, als habe er sie eben laut wiederholt: Ich werde keinem anderen dienen.
Er sah sich in seinem Zimmer um. Er würde es bald verlassen müssen, wenn auch nur, damit es gereinigt werden konnte. Was würde geschehen, wenn seine Kommandierung auf einen Sklavenjäger länger auf sich warten ließ, als der Hafenadmiral angenommen hatte, der ein Jahr schätzte? Was dann? Würde er sich weiter in Zimmern verstecken, nur nachts Spazierengehen und jeden menschlichen Kontakt vermeiden?
Er berührte seine Ausgehuniform, die über einem Stuhl hing. Sie trug die beiden Epauletten eines Kapitäns mit vollem Rang. Wie weit das doch von seinem vorherigen Kommando auf der kleinen Brigg Lame entfernt war.
Er ließ im Geist all die Jahre seit den Ereignissen am Nil vorüberziehen und das langsame Heilen seiner Wunden. Fünfzehn Jahre waren vergangen, seit die Hölle im unteren Kanonendeck der Majestic explodiert war und es in ein Inferno verwandelt hatte. Er hatte im Haslar-Lazarett in Portsmouth gelegen, aber die Hilfe, die man ihm gewährte, war unbedeutend. Marion hatte sich schließlich zusammengenommen und ihn besucht. Sie war damals jung und sehr schön gewesen, und er hatte gehofft, sie eines Tages zu heiraten.
Es war eine Qual für sie, wie für die meisten, die ins Haslar-Lazarett kamen, um Freunde oder Verwandte zu besuchen. Offiziere lagen da, die in einem Dutzend oder noch mehr Seegefechten verwundet worden waren, mit hoffnungsvollen Gesichtern und jedesmal Mitleid erheischend, wenn neue Besucher kamen. Es waren die Verbrannten, die Verstümmelten, die Männer ohne Beine und Arme und die Blinden – lebende Beweise für jeden Sieg. Doch wer sah sie schon?
Nach diesem Besuch hatte sie einen anderen geheiratet, einen älteren Mann, der ihr ein angenehmes Haus in Portsdown Hill bieten konnte, nicht weit von ebenjenem Lazarett entfernt. Zwei Kinder entstammten der Ehe, ein Junge und ein Mädchen.
Ihr Mann war schließlich gestorben. Tyacke hatte einen Brief von ihr bekommen, als die Indomitable in Halifax lag, die erste Nachricht von ihr seit fünfzehn Jahren. Der Brief war sehr sorgfältig verfaßt worden, er bot keine Entschuldigung, keinen Kompromiß – ein Stück Papier von einem reifen Menschen, der so ganz anders war als das junge Mädchen von einst.
Er hatte ihr eine Antwort geschrieben und sie im Tresor vor dem letzten Gefecht mit der Resolution verstaut. Sie hätte den Brief nur erhalten, wenn Tyacke an diesem Tag gefallen wäre. Nach dem Gefecht hatte er ihn in Schnipsel zerrissen und zugesehen, wie diese an der zerfetzten Schiffswand im Wasser vorbeitrieben. Als er das Mädchen gebraucht hatte und manchmal um den eigenen Tod gebetet hatte, da hatte Marion sich von ihm abgewandt. Er hatte sich zwar oft genug gesagt, daß das nur zu verständlich war. Aber sie war nie zurückgekommen. Warum hatte ihr Brief ihn also so beunruhigt? Die Jahre gehörten ebenso einem anderen Mann wie die beiden unbekannten Kinder. Diese Zeit würde er nie mit ihnen teilen können.
Ein leises Klopfen war an der Tür zu hören, die sich kurz darauf einen Spalt öffnete.
»In Ordnung, Jenny«, sagte Tyacke. »Ich mache gleich einen Spaziergang, da kannst du dich um das Zimmer kümmern.«
»Darum geht es nicht, Sir.« Sie schaute ihn ernst an. »Da ist ein Brief für Sie gekommen.«
Sie streckte ihm das Schreiben entgegen und sah, wie er an das Fenster trat. Sie stammte aus dieser Gegend und hatte sechs Schwestern. Im Gasthof sah sie häufig Marine- oder Heeresuniformen. So fühlte sie sich nicht ganz von Plymouth abgeschnitten, dem lebendigen Hafen, den ihre Schwestern nur allzu gern mit diesem Ort verglichen.
Doch sie hatte noch einen Mann wie diesen getroffen. Er selbst sprach nur das Nötigste, doch jeder wußte alles über ihn. Ein Held: Sir Richard Bolithos Freund und sein rechter Arm. So sagte man. Wahrscheinlich redeten sie noch mehr über ihn, wenn sie nicht dabei war.
Sie sah ihn sich jetzt genau an, während er den Brief ins Licht hielt. Er wandte die fürchterliche Verletzung immer von ihr weg. Er hatte ein starkes Gesicht, sogar ein schönes, und er war sehr höflich, ganz anders als viele Herren, die auf ein Gläschen vorbeikamen. Ihre Mutter hatte sie oft genug vor den Gefahren gewarnt, von anderen Mädchen erzählt, die in Umstände gekommen waren. Die Garnison von Tavistock lag ja so nahe.
Jenny errötete. Was auch immer …
Tyacke spürte nichts von ihren Blicken. Der Brief kam vom Hafenadmiral. Er habe sich, so schnell er könne, im Hafen zu melden. Selbst bei einem Kapitän mit vollem Rang hieß das: sofort.
»Ich brauche eine schnelle Kutsche, Jenny. Ich muß nach Plymouth.«
Sie lächelte ihn an. »Sofort, Sir!«
Tyacke nahm seine Jacke und fuhr mit seinen Fingern über die Armei. Der Spaziergang konnte warten.
Er sah sich in dem kleinen Zimmer um. Dann wurde ihm die Bedeutung der Nachricht klar. Er hatte genau das erwartet. Es war das einzige Leben, das er kannte.
Die Kutsche wurde langsamer, und Bolitho sah Bummler und Vorübergehende, die die Hand gegen die Abendsonne über die Augen hielten und in die Kutsche zu sehen versuchten. Einige winkten sogar mit dem Hut, obwohl sie ihn unmöglich erkannt haben konnten. Er spürte ihre Hand auf seinem Ärmel.
»So drücken diese Leute ihre Gefühle aus.«
Catherine winkte der nächsten Gruppe zu, und ein Mann rief: »Da ist Sir Richard, Männer, und seine Dame. Der gerechte Dick!«
Es gab Jubelrufe, und sie sagte: »Hörst du das? Du hast hier viele Freunde!«
Im Haus am Ufer leuchteten tausend Kerzen, und die Kandelaber waren noch heller als die untergehende Sonne.
Wie Sillitoe das alles wohl verabscheut, dachte Bolitho. Die reinste Verschwendung, wenn auch nötig. Nötig – das war der passende Ausdruck. Er kam aus jener anderen Welt.
»Ich habe gehört, ganz London gibt heute Empfänge, um den Sieg zu feiern.« Die junge Frau sah in sein Gesicht und wollte Bolitho am liebsten in die Arme nehmen, was auch immer die Menge davon halten würde.
Beunruhigt meinte er: »Ich wünschte, der junge Matthew säße da auf dem Bock und wir wären unterwegs nach Falmouth.« Er sah sie an und lächelte. »Für so eine schöne Frau bin ich ein schlechter Gesellschafter«, sagte er.
Seltsamerweise gab ihm diese Erkenntnis Kraft. Sie trug ein neues Seidenkleid in ihrem Lieblingsgrün, mit hoher Taille und nackten Schultern. Der Diamantanhänger lag zwischen ihren Brüsten. Schön und stolz und nach außen hin ganz ruhig erschien diese Frau, die sich ihm in ihrem Haus am Ufer in Chelsea, hinter der nächsten großen Biegung des Flusses, mit solcher Leidenschaft hingegeben hatte, bis sie gänzlich erschöpft waren.
»Es wird hier wenigstens nicht so schlimm werden wie bei dem Fest im Carlton House. Ich habe noch nie im Leben so viel gegessen.«
Sie sah, wie sich seine Mundwinkel hoben, wie immer, wenn er lächelte und sie sich gemeinsam an etwas erinnerten.
Sie achtete jetzt auf die anderen Kutschen, die in Sillitoes Einfahrt bogen, und auf die zahlreichen Diener und Pferdeknechte. Sillitoe hatte sicherlich keine Kosten gescheut.
Sie sah viele Frauen, doch kaum Ehefrauen, wie sie meinte. Sie vergaß nie, daß Sillitoe ihr geholfen hatte, als keine Hilfe in der Nähe war. Danach hatte er kein Geheimnis aus seinen Gefühlen für sie gemacht. Er hatte, seiner Art entsprechend, die Emotionen nur festgestellt, kühl und entschlossen, wie etwas, an dem es keine Zweifel gab.
Sie sah an ihrem Kleid hinab. Es war sicher eine gewagte Robe, aber das erwartete der eine oder andere auch von ihr. Sie hob das Kinn und fühlte den Anhänger auf ihrer Haut. Bolithos Frau, wie die ganze Welt sehen konnte.
Und dann waren sie da. Die Tür wurde aufgerissen, und Bolitho stieg als erster aus, um ihr aus der Kutsche zu helfen.
Diener verneigten sich höflich. Nur hier und da entdeckte Catherine Sillitoes eigene Männer, unbewegt und aufmerksam, und sie erinnerte sich an den letzten Besuch in Whitechapel. Einige von Sillitoes Männern hatten sie damals begleitet. Irgendwie schien immer eine Aura von Geheimnissen und Gefahren Sillitoe zu umgeben.
Bolitho gab seinen Hut einem zweiten Diener, während sie selbst ihren Seidenschal über ihren nackten Schultern behielt. Es gab keine offizielle Vorstellung der Gäste, kein Lakai überprüfte die Einladungen. Gespräche hingen in der Luft, und irgendwo in der Nähe erklang auch Musik. Sie war weder fröhlich noch kriegerisch, hielt sich im Hintergrund, und die Leute kannten sich hier, entweder persönlich oder wenigstens dem Namen nach.
»Sie sehen gut aus, Sir Richard!« Sillitoe erschien hinter einer Säule, seine tiefliegenden Augen schweiften durch den Raum. Er ergriff Catherines Hand und führte sie an seine Lippen. »Wie immer finde ich keine Worte für solche Schönheit, Mylady.«
Sie lächelte und spürte die Blicke der anderen Frauen.
Ungeduldig winkte Sillitoe einem Lakaien mit einem Tablett zu. Dann sagte er: »Rhodes ist hier. Ich dachte mir, Sie sollten ihn treffen, schon der nächsten Zukunft wegen.«
Bolitho wandte sich zu Catherine. »Der Ehrenwerte Lord Rhodes ist Admiral und in der Admiralität für die Finanzen verantwortlich. Aber man sagt auch, er liege gut im Rennen um den Posten als nächster Erster Lord der Admiralität.«
Er beobachtete sie und las aus ihren Augen. Sie mißtraute hochgestellten Offizieren, die sie nicht kannte, weil sie immer fürchtete, daß sie nichts Gutes für Richard im Schilde führten.
Sillitoe sagte: »Er wartet in einem Nebenzimmer. Es ist vielleicht klug, gleich mit ihm zu reden.«
»Ich werde auf der Terrasse warten, Richard«, bot Catherine an.
Aber Sillitoe unterbrach sie. »Dies ist mein Haus, und Sie sind meine Gäste. Es gibt keinen Anlaß, Sie zu trennen.« Leicht berührte er ihre Hand. »Soll man die Legende teilen?« Sein kleiner Sekretär hielt sich ganz in der Nähe auf, und Sillitoe sagte noch: »Ich komme dann bald dazu und werde Sie retten.«
Einer von Sillitoes Männern führte sie zur Bibliothek und dann in ein kleineres Vorzimmer. Vor dem Kamin stand ein Stuhl, an den Catherine sich plötzlich erinnerte. Es schien, als sei er seit jenem Tag nicht mehr bewegt worden, als sie dort gesessen und um Hilfe gebeten hatte. Sillitoe war so nahe an ihr vorbeigegangen, daß sie seinen Wunsch spürte, sie zu berühren, ihr die Hand auf die Schulter zu legen. Doch das hatte er nicht getan.
Admiral Lord James Rhodes war ein großer starker Mann, der früher einmal sehr attraktiv gewesen sein mußte. Eine starke gebogene Nase beherrschte sein Gesicht. Seine Augen waren überraschend klein, im Vergleich fast unscheinbar. Er musterte Catherine schnell, doch nichts verriet seine Gedanken. Er ist ein Mann, dachte sie, der gewohnt ist, seine Gefühle nicht zu zeigen.
Bolitho sagte: »Darf ich Ihnen die Viscountess Somervell vorstellen, Mylord?«
Er spürte, wie sie den Admiral anschaute, spürte ihre Vorbehalte, falls von ihm irgendeine Beleidigung oder eine spöttische Bemerkung käme.
Doch Rhodes verneigte sich nur steif und sagte: »Ich hatte bisher die Ehre noch nicht, Mylady.«
Er griff nicht nach ihrer Hand, und sie bot sie ihm auch nicht.
Catherine trat ans Fenster und beobachtete, wie eine Kutsche über das Pflaster rollte. Sie spürte, daß der Admiral ihr nachstarrte, doch seine Unsicherheit bereitete ihr kein Vergnügen.
Plötzlich mußte sie ganz intensiv an Falmouth denken. Wieder von Bolitho getrennt zu sein war ein zu brutaler Gedanke.