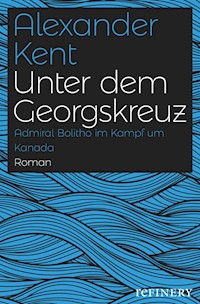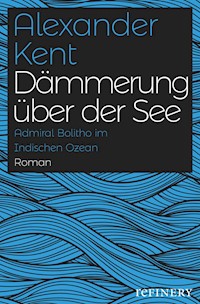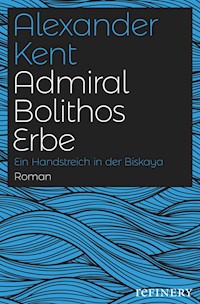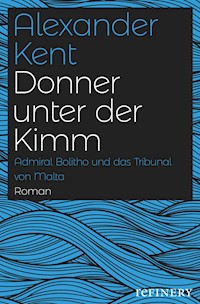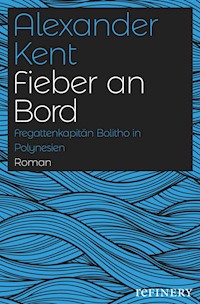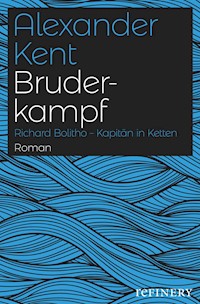6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
1808: Noch nie war Sir Richard Bolitho dem Tod so nahe wie jetzt. Mit seinem Stab hatte er sich auf die nach Kapstadt bestimmte Brigg Golden Plover eingeschifft. Am Kap der Guten Hoffnung soll der Vizeadmiral ein neues Geschwader übernehmen. Doch aus Goldgier meutert unterwegs die Besatzung, es kommt zu einem blutigen Kampf und das Schiff strandet. Während man in England bereits um den tapfersten Seehelden seit Nelson trauert, treibt er in einem kleinen Boot auf dem Atlantik, von Durst gequält, von Haien umkreist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das letzte Gefecht von Alexander Kent, “Admiral Bolitho vor Malta” Roman, blau-schwarzer Welleneinband.
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester.Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
1808: Noch nie war Sir Richard Bolitho dem Tod so nahe wie jetzt. Mit seinem Stab hatte er sich auf die nach Kapstadt bestimmte Brigg Golden Plover eingeschifft. Am Kap der Guten Hoffnung soll der Vizeadmiral ein neues Geschwader übernehmen. Doch aus Goldgier meutert unterwegs die Besatzung, es kommt zu einem blutigen Kampf und das Schiff strandet. Während man in England bereits um den tapfersten Seehelden seit Nelson trauert, treibt er in einem kleinen Boot auf dem Atlantik, von Durst gequält, von Haien umkreist ...
Alexander Kent
Das letzte Riff
Admiral Bolitho – Verschollen vor Westafrika
Roman
Aus dem Englischen vonDieter Bromund
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinSeptember 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009© der deutschen Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin 1992© der englischen Originalausgabe: Highseas Authors Ltd., 1992 Titel der englischen Originalausgabe: Beyond the ReefCovergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-106-5
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Brüder der See
II Kalte Herzen
III Vor strengen Richtern
IV Heimliche Rache
V Um die Hand einer Dame
VI Die Golden Plover
VII Gewissensbisse
VIII Brecher voraus!
IX Schiffbruch
X Ein armer Teufel
XI Ein Tag, an den man sich erinnert
XII Willkommen zu Hause
XIII Abschied
XIV Böses Blut
XV Auferstanden von den Toten
XVI Macht über Leben und Tod
XVII Schiffe, die vorüberziehen
XVIII Vor dem Gefecht
XIX Der beraubte Sieger
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
I Brüder der See
Widmung
Für mein Tahitimädchen Kim, in Liebe
I Brüder der See
Ein beißender Nordost, der seit zwölf Stunden wehte, wirbelte das Wasser im Hafen von Portsmouth auf. Er jagte Wellen mit weißen Kämmen in endloser Folge vor sich her. Die Kriegsschiffe mit ihren schwarz-weißen Rümpfen ruckten heftig an ihren Ankerketten.
Obwohl es schon später März war, zögerte der Winter seinen Abschied hinaus und zeigte noch einmal alle Kraft, die in ihm steckte.
Eines der größeren verankerten Schiffe war die Black Prince mit 94 Kanonen. Man hatte sie erst kürzlich aus der Werft auf ihren Ankerplatz verholt, nach einigen Reparaturen am Rumpf. Jetzt glänzten ihre frische Farbe und das frisch geteerte, stehende Gut wie Glas – selbst unter der wehenden Gischt und einem Regenschauer, der schräg zur Isle of Wight hinüberzog. Die Insel wirkte in dem schwachen Licht wie ein ferner Schatten.
Die Black Prince war eines der mächtigsten Schiffe ihrer Klasse. Für Landratten verkörperte sie das greifbare Symbol englischer Seemacht, einen sicheren Schutzschild. Doch erfahrene Teerjacken sahen sie anders.
Noch waren die Rahen leer, ohne die Segel, die ihr Kraft und Leben geben würden. Leichter und Barkassen umschwirrten sie. Zahlreiche Takler und Reepschläger arbeiteten eifrig an Deck. Hammerschläge und das Quietschen der Blöcke machten deutlich, daß auch tief im Schiff und in den Batteriedecks fleißig gearbeitet wurde.
An der Reling auf der Poop, vor den verstauten Hängematten, stand der Kommandant der Black Prince und beobachtete das Kommen und Gehen von Seeleuten und Handwerkern, die unter Aufsicht der Unteroffiziere arbeiteten. Diese bildeten das Rückgrat jedes Kriegsschiffs.
Kommandant Valentine Keen drückte den Hut fester auf sein helles Haar und scherte sich nicht um den Wind. Ihm war auch egal, daß ihm die Nässe durch den blauen Uniformmantel mit den verfärbten Epauletten bis auf die Haut drang. Ohne sich lange umzuschauen wußte er, daß die Wachhabenden, die in der Nähe des unbesetzten Doppelrads auf und ab gingen, sich seiner Gegenwart sehr bewußt waren. Ein Quartermaster, ein Bootsmannsgehilfe und ein kleiner Midshipman[1], der gelegentlich ein Teleskop ans Auge hob, beobachteten den Signalturm und ganz in der Nähe das Flaggschiff des Admirals, in dessen Großtopp eine nasse Fahne knallend auswehte.
Von der Besatzung waren viele, die mit Keen vor Dänemark gekämpft und beinahe einen gewaltigen französischen Dreidecker versenkt hätten, auf andere Schiffe versetzt worden. Das kurze Gefecht hatte die Black Prince schwer mitgenommen. Zwar waren einige aus der Mannschaft befördert worden, »doch alle anderen«, hatte der Hafenadmiral kurz bemerkt, »werden dringend gebraucht, Kapitän Keen. Also müssen Sie warten, bis Ihr Schiff wieder kampfbereit ist.«
Keen dachte an die Schlacht und an den furchtbaren Schrecken in der Morgendämmerung, als sie Konteradmiral Herricks Benbow zu Hilfe gekommen waren. Er hatte einen Konvoi von 21 Schiffen schützen sollen, der zur Eroberung von Kopenhagen ausgesandt worden war.
Zerstreut trieben die Schiffe als brennende Wracks in der See. Unter Deck schrieen eingepferchte Kavalleriepferde in Todesnot. Die Benbow dümpelte entmastet in der See, das zweite Begleitschiff war gekentert und verloren.
Sie hatten die Benbow zurück nach England in eine Werft geschleppt. Sie jeden Tag hier zu sehen, wäre auch zu quälend gewesen, besonders für Vizeadmiral Sir Richard Bolitho, dessen Flagge bald wieder am Fockmast der Black Prince auswehen würde. Herrick war Bolithos ältester Freund gewesen, doch sein Verhalten vor und nach der Schlacht hatte Keen entsetzt und betrübt. Möglicherweise war es Benbows letzte Schlacht gewesen. In Kopenhagen hatten sie so viele Schiffe beschlagnahmt, um die eigenen gelichteten Reihen wieder aufzufüllen, daß jede Werft sicher lange prüfen würde, ob sich die Reparatur eines so zerschossenen Schiffes wie der Benbow überhaupt lohnte.
Keen dachte an Bolitho, den er mehr als jeden anderen Menschen verehrte. Er hatte unter ihm schon als Midshipman und Leutnant gedient und war schließlich sein Flaggoffizier geworden. Es freute ihn, daß Bolitho endlich wieder Gelegenheit hatte, mit seiner geliebten Lady Catherine zusammen zu sein. Er fürchtete sich vor Vergleichen, und doch wünschte er Gleiches für sich. Bolithos offen bekannte Leidenschaft verstanden die einfachen Leute überall im Lande, nur die Londoner feine Gesellschaft überschüttete ihn und Catherine mit Wut und Verachtung. Einen Skandal nannten sie die Beziehung. Keen seufzte. Er selbst hätte alles geopfert, nur um eine ebensolche Liebe zu erleben.
Er ging zu dem kleinen Tisch im Schutz des überhängenden Poopdecks und schlug die Seite des Logbuchs auf, die ein glänzendes Stück Walknochen markierte. Sekundenlang starrte er auf das Datum, das die feuchte Seite zeigte: 25. März 1808. Genau zwei Monate zuvor hatte er seiner Braut in der kleinen Dorfkirche von Zennor den Ring über den Finger gestreift und sie zu seiner Frau gemacht.
Doch noch immer rätselte er: Liebte sie ihn – oder hatte sie ihn nur aus Dankbarkeit geheiratet? Er hatte sie von einem Sträflingsschiff gerettet, das sie deportieren sollte für ein Verbrechen, das sie nie begangen hatte. Oder beruhten seine Zweifel auf dem großen Altersunterschied? Er war fast doppelt so alt wie sie. Sie hätte doch jeden Jüngeren heiraten können!
Solche Gedanken bedrückten ihn. Er wagte Zenoria kaum zu berühren, und als sie sich ihm schließlich hingab, geschah es ohne Leidenschaft und ohne Sehnsucht. Sie hatte nur nachgegeben. Später in jener ersten Nacht hatte er sie unten vor der letzten Glut des Kamins gefunden, schluchzend, als wäre ihr Herz gebrochen.
Immer wieder zwang sich Keen, an Catherines Rat zu denken, den sie ihm bei einem Besuch in London gegeben hatte. Er hatte Catherine seine Zweifel an Zenorias wahren Gefühlen für ihn gestanden. Ruhig hatte Catherine geantwortet: »Denken Sie daran, was man mit ihr gemacht hat: mißbraucht, mißhandelt, ihr jede Hoffnung auf eine Zukunft genommen.«
Keen biß sich auf die Lippen, als er zurückdachte an ihre erste Begegnung. Fast nackt, mit bloßem Rücken, hatte sie vor den geifernden Mitgefangenen gestanden, die sich an ihr tierisch vergnügen wollten. Also war es wohl doch nur Dankbarkeit. Damit mußte er sich zufriedengeben. Sicherlich beneideten ihn viele Männer um seine schöne Frau. Aber er war nicht glücklich.
Keen sah James Sedgemore, den Ersten Offizier, auf sich zukommen. Der war mit seinem Schicksal ganz bestimmt mehr als zufrieden. Keen hatte ihn befördert nachdem eine Kugel an jenem fürchterlichen Morgen Cazalet, den zähen Ersten vom Tyne, zerrissen hatte. Das feindliche Schiff war die San Mateo gewesen, ein Spanier, der unter französischer Flagge segelte. Sie war über den Konvoi und seine Begleiter hergefallen wie ein Tiger über ein Gehege voller Kaninchen. Niemals zuvor hatte Keen Bolitho so wild entschlossen kämpfen sehen. Die San Mateo mußte besiegt werden, denn sie hatte Bolithos geliebte alte Hyperion versenkt. Das genügte als Stachel.
Keen fragte sich, ob Bolitho wohl weiter Breitseite auf Breitseite in den schwer angeschlagenen Spanier gejagt hätte. Gott sei Dank hatte irgendjemand in der Hölle aus Eisen und jaulenden Holzsplittern noch Verstand genug gehabt ihre Flagge niederzuholen. Ob Bolitho sonst gnadenlos weitergekämpft hätte? Er würde es nie erfahren.
Leutnant Sedgemore tippte grüßend an seinen Hut, das Gesicht rot vor Kälte. »Wir werden morgen die Segel anschlagen können, Sir.«
Keen sah die Marinesoldaten, die Posten an den Niedergängen und auf dem Vordeck. So nahe unter Land war mancher Matrose versucht zu desertieren. In einem Kriegshafen wie Portsmouth Leute zu bekommen, war auch ohne Deserteure schwer genug.
Keen empfand Mitgefühl für seine Männer. Man hielt sie an Bord fest oder verfrachtete sie als Ersatz auf ein anderes Schiff, ohne sie je an Land zu ihren Lieben zu lassen.
Auch er selbst hatte mehr Zeit als nötig an Bord verbracht. Aber er wollte seiner ausgedünnten Besatzung zeigen, daß er ihre Leiden teilte. Oder war das eine Lüge? War er an Bord geblieben aus Furcht vor Zenorias Zurückweisung?
»Alles in Ordnung, Sir?«
»Ja.«
Das klang viel zu heftig. »Vizeadmiral Bolitho kommt gegen Mittag an Bord.« Er musterte die Netze an den regenglänzenden Wänden der Werft die Hafenbatterie und die dichtgedrängten Gebäude am Portsmouth Point hinter dem das Fahrwasser und die offene See lockten. Irgendwo da drüben wartete Bolitho sicher schon. Vielleicht im »George Inn«.
Catherine war in diesem unfreundlichen Wetter vermutlich längst nicht mehr bei ihm.
Sedgemores Gesicht verriet nichts von seinen Gedanken. Seinen Vorgänger Cazalet hatte er nie gemocht. Nun ja, er war ein guter Seemann gewesen, aber so ruppig in seiner Sprache und so ungehobelt in seinen Manieren, daß man mit ihm nur schwer zusammenarbeiten konnte. Der Erste sah, wie die Männer an den Taljen schufteten, um Kästen und Ballen aus den Leichtern in die Black Prince zu hieven.
Nun, jetzt war er der Erste Offizier – und zwar auf einem der neuesten und kampfstärksten Dreidecker der Marine. Mit einem Admiral wie Sir Richard Bolitho und einem Kommandanten wie Kapitän Keen würde niemand sie aufhalten, wenn sie erst einmal auf See waren. Beförderungen, Prisengelder, Ruhm – das alles lockte ihn. So ist das Leben im Krieg, dachte er. Wenn man dir den Posten eines gefallenen Offiziers anbietet, darfst du nicht zögern.
Laut befahl Keen: »Sagen Sie meinem Bootssteuer, er soll die Barkasse vorbereiten und zu sechs Glasen seine Bootsgasten sammeln. Inspizieren Sie sie gründlich, obwohl ich kaum glaube, daß Tojohns etwas dem Zufall überlassen wird.«
Wieder blickte er auf das offene Logbuch und den Midshipman der Wache, der etwas darin eintrug. Das erinnerte ihn an ein anderes Bild: Tojohns, sein Bootssteurer, hatte am Hochzeitstag die Midshipmen und die Unteroffiziere des Schiffes zum Ziehen der Hochzeitskutsche eingeteilt, in der Keen und seine Braut saßen.
Er drehte sich um und suchte unter der Poop einen Platz, an dem er mit seinen Gedanken allein sein konnte.
Sedgemore beobachtete ihn und rieb sich das Kinn. Ein Vollkapitän und Kommandant eines Schiffes wie der Black Prince zu sein … Mehr wollte er im Leben nicht erreichen.
Er entdeckte den Midshipman, der ihn anstarrte, und fuhr ihn an: »Mr. M’Innes, Sie sollten Ihre Zeit nicht vergeuden, Sir!«
Solches Anbrüllen war natürlich unnötig. Aber er fühlte sich wohl dabei und genoß seine Rolle als Erster Offizier.
Leutnant Stephen Jenour hielt den Atem an, als er an den Stufen zum Anlegesteg vorbeischritt. Nach zwei Monaten auf dem Trocknen fühlte er sich wieder unsicher angesichts der See. Er hatte an Land für Vizeadmiral Bolitho gearbeitet und zwischendurch seine Eltern in Southampton besucht.
Er drückte die Tür zum George Inn auf und blickte in ein loderndes Feuer, das von der fernen Seite des Raums Wärme herüberschickte.
Kühl fragte ein uniformierter Diener: »Ihr Name, Sir?«
»Jenour.« Und dann schärfer: »Flaggoffizier von Sir Richard Bolitho!«
Der Mann verschwand mit einem Bückling, murmelte etwas von einem wärmenden Drink, und Jenour war stolz darauf, daß andere ihn sofort respektierten.
»Willkommen, Stephen!« Bolitho saß in einem großen Sessel, der Feuerschein brach sich im Gold der Litzen und der Schulterstücke seiner Uniform. »Wir haben noch ein bißchen Zeit.«
Jenour setzte sich und lächelte. Wie hatte sich doch sein Leben verändert seit seinem Treffen mit Bolitho! Seine Eltern hatten ihn ausgelacht, als er schwor, eines Tages würde er dem Mann dienen, der bis drei Jahre vor Nelsons Tod bei Trafalgar der zweitjüngste Admiral der Royal Navy gewesen war. Und nun war er der jüngste.
Jenour erinnerte sich an alle Einzelheiten, auch an den Augenblick, als die Black Prince Kopenhagen verlassen hatte, um Herrick zu finden. Bolitho hatte sich zu ihm umgedreht und seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt, als er bekannte: »Ich verliere meine Sehkraft, Stephen. Können Sie das Geheimnis für sich behalten? Niemand sonst darf es erfahren. Da draußen braucht man uns jetzt!«
Jenour nippte an dem heißen Drink und schmeckte Brandy und Gewürze; seine Augen wurden feucht, doch das lag mehr an den Erinnerungen. Er war einer der wenigen, die wußten, wie schlimm es um Bolithos linkes Auge stand. Daß der Vizeadmiral ihn an einem solchen Geheimnis teilhaben ließ, war ein größerer Vertrauensbeweis, als er ihn je für möglich gehalten hätte.
Bolitho stellte sein leeres Punschglas ab und dachte an Catherine, glaubte immer noch die Wärme ihres Körpers in seinen Armen zu fühlen. Erst an diesem Morgen hatten sie sich getrennt. Sie war jetzt auf dem Weg nach London, in ihr Haus im Stadtteil Chelsea, das sie kürzlich gekauft hatten. »Unsere geheime Höhle« hatte sie es genannt; es bot ihr Unterschlupf, wenn ihre Anwesenheit in der Hauptstadt vonnöten war.
Bolitho fühlte sich seltsam allein ohne Allday, seinen Bootssteurer – »seine Eiche«, wie er ihn gern nannte; seltsam allein auch ohne Yovell, seinen Sekretär, und ohne Ozzard, seinen schmächtigen Steward. Alle drei begleiteten Lady Catherine in der Kutsche nach London, und Bolitho beruhigte der Gedanke, daß Catherine von so verläßlichen Männern beschützt wurde.
Er dachte auch an das letzte Gespräch mit Lord Godschale in der Admiralität und an dessen Ersuche, ihn zu beschwichtigen, bevor es zu Kontroversen kam.
»Ihre Lordschaften bestehen darauf: Sie sind der beste Flaggoffizier für diese Aufgabe in Kapstadt. Sie haben damals entscheidend dazu beigetragen, daß die Stadt erobert wurde. Unsere Leute kennen Sie und vertrauen Ihnen. Lange wird es sicher nicht dauern, bis Sie regelmäßige Patrouillen da unten im Süden organisiert haben und endlich die großen Kriegsschiffe nach England auf den Weg bringen. Sobald Sie dort einen Vollkapitän etabliert haben – meinetwegen auch als Kommodore –, kehren Sie zurück. Ich stelle Ihnen eine schnelle Fregatte zur Verfügung und gebe Ihnen meine volle Unterstützung.« Godschale seufzte wie unter einer schweren Last. »Während Admiral Gambier und Ihr Geschwader den Konvoi der dänischen Schiffe nach England zusammenstellten, war Napoleon schon wieder mit anderen Absichten unterwegs, verdammt soll er sein. Zweimal hat er – vergeblich, Gott sei Dank – versucht sich die dänische Flotte anzueignen. Er hat die Türken bewogen, sich gegen ihren alten Verbündeten, den Zaren von Rußland, zu wenden. Wenn wir ein Loch stopfen, öffnet er zwei neue.«
Bolitho gestand sich eine gewisse Bewunderung für Napoleons überaus flexible Strategie ein. Kurz nach Herricks hoffnungslosem Kampf für den Konvoi war die französische Armee in Portugal einmarschiert, hatte im November Lissabon genommen und die königliche Familie auf ihre Besitzungen nach Brasilien vertrieben. In Whitehall hieß es, daß Spanien gegen seinen Willen der nächste Verbündete Napoleons werden würde. Wieder einmal würde der Korse einen ungeheuren Machtzuwachs erzielen und mit Spaniens Reichtümern im Rücken jeden bedrohen, der sich ihm in den Weg stellte.
»Diesmal überspannt er den Bogen«, hatte Bolitho geantwortet. »Er hat sich die Portugiesen zu Feinden gemacht und Spanien wird sich gegen ihn erheben. Was wir brauchen, ist eine Stelle, wo unsere Armee landen kann und als Freunde und Befreier begrüßt wird.«
Godschale hatte abweisend vor sich hin geschaut »Ja, ja. Vielleicht«
Auch das nächste Geheimnis kannten Jenour, Yovell und Allday: Bolitho hatte sich geweigert, mit einer Fregatte nach Süden zu segeln. Godschales volles Gesicht färbte sich fast purpurn vor Zorn, als er laut sagte: »Wollen Sie etwa Lady Catherine Somervell mit auf die Reise nach Kapstadt nehmen?«
Bolitho hatte kühl erwidert: »Ein Kriegsschiff ist nichts für eine Dame, Mylord. Obwohl ich sicher bin, daß Lady Catherine mit Freuden an Bord kommen würde.«
Godschale hatte sich den Schweiß vom Gesicht gewischt »Also ein schnelles Schiff im Auftrag der Admiralität. Sie sind ein Mann, der schwer von anderen Ideen zu überzeugen ist, Sir Richard. Was werden aber die Leute sagen, wenn sie entdecken, daß …«
»Wir müssen eben dafür sorgen, daß es niemand erfährt, Mylord.«
Als er die Neuigkeit Catherine mitteilte, hatte sie überrascht und erregt reagiert.
»Bei dir zu sein, Liebster, statt nur von deinen Unternehmungen in der ›Gazette‹ zu lesen, mehr kann ich mir nicht wünschen!«
Die Tür öffnete sich jetzt, der Diener steckte den Kopf ins Zimmer. »Verzeihen Sie, Sir Richard, aber es wurde eben gemeldet, daß Ihre Barkasse von der Black Prince abgelegt hat.«
Bolitho nickte und sagte zu Jenour: »Ich wette, Kapitän Keen wird überrascht sein, daß ich nicht an Bord bleibe.«
Jenour folgte ihm aus dem gemütlich warmen Raum, der ausschließlich für Flaggoffiziere eingerichtet war, ins Freie. Er wußte, daß Keen Bolitho genauso verehrte wie er selber. Würde er das Kommando über die Black Prince aufgeben, um einen dubiosen Posten in Kapstadt zu übernehmen? Zwar würde er dann den Wimpel eines Kommodore führen können und hätte sehr gute Aussichten, zum Vizeadmiral befördert zu werden. Aber das hieße auch, so kurz nach der Hochzeit seine junge Frau zu verlassen und später alle Verbindungen mit Bolitho zu kappen, der jetzt auf den nassen Stufen des Anlegers stand und über die glitzernden Wellen blickte.
Ich bin froh, daß ich solche Entscheidungen nicht fällen muß, dachte er. Noch nicht, jedenfalls …
Bolitho hüllte sich eng in seinen Bootsmantel und beobachtete die Barkasse. Sie tanzte in den kurzen Wellen, die Riemen hoben und senkten sich wie ein einziger, und die Bootsgasten sahen gut aus in ihren gewürfelten Hemden und den schwarzgeteerten Hüten. Keens Bootsteurer würde das Kommando führen; plötzlich fühlte sich Bolitho beunruhigt, daß Allday nicht hier war.
Doch dann dachte er an Catherines Freude über die bevorstehende gemeinsame Reise. Als ihnen in Falmouth gemeldet worden war, Lord Godschale habe seinem Wunsch nach einer gemeinsamen Seereise entsprochen, da hatte Catherine Bolitho umarmt wie in kindlicher Begeisterung. Zusammen zu bleiben – nur darauf kam es ihnen an. Er dachte an ihre letzte gemeinsame Nacht in einem kleinen, versteckten Gasthaus, das Allday empfohlen hatte. Auch als Jenour sich zurückgemeldet hatte, waren seine Gedanken in dem kleinen Zimmer gewesen, das er mit Catherine geteilt hatte, ohne an Schlaf zu denken. Dort hatte ebenfalls ein Kaminfeuer gebrannt.
Die Bootsgasten stellten die Riemen senkrecht und blickten gerade aufgerichtet nach achtern, während vorn der Bug festgemacht wurde. Der Erste Offizier sprang leichtfüßig über die nassen Stufen herauf, lüftete seinen Hut und hatte mit einem Blick erfaßt, daß eine Seekiste oder anderes Gepäck fehlte.
»Guten Tag, Mr. Sedgemore.« Bolitho lächelte. »Wie Sie sehen, wird es diesmal nur ein kurzer Besuch.«
Er und Jenour nahmen auf der Heckbank Platz; die Barkasse legte ab und schaufelte Wasser über den Bug, als sie aus dem Lee des Anlegers glitten.
»Läuft alles nach Plan mit den Reparaturen, Mr. Sedgemore?«
Der Erste Offizier schluckte. Er war solch freundliche Worte von Vizeadmirälen nicht gewohnt.
»Aye, aye, Sir Richard. Wir werden wohl noch einen Monat brauchen.«
Bolitho beobachtete die Boote, die von den Werften herüberkamen, und eine Jolle, die einen Mast schleppte. So viele Schiffe wurden hier wieder ausgerüstet. Aber wenn Napoleon wirklich in Spanien einmarschierte, mußte die Seeblockade noch enger werden. Mit Bedauern dachte er an Herrick. Selbst dessen arme, zusammengeschossene Benbow würde man sicher wieder in neue Seegefechte schicken.
In der Ferne peitschte ein Musketenschuß, und auf das Vordeck der Black Prince rannten Männer. Wahrscheinlich hatte ein Seesoldat auf jemanden geschossen, der desertieren wollte.
»Ich nehme an, den haben sie getroffen!« murmelte Sedgemore.
Ruhig sah ihn Bolitho an. »Wäre es nicht sinnvoller, wenn Sie Ihre Seesoldaten am Ufer postierten? Die würden die Männer festnehmen, wenn sie an Land schwimmen. Aber von einer Leiche hat niemand etwas.« Das klang ganz freundlich, doch Jenour sah, wie der Erste Offizier das Gesicht verzog, als habe ein Hieb ihn getroffen.
Die nächsten Augenblicke verlangten seine volle Aufmerksamkeit: das schlüpfrige Fallreep, das Trillern der Pfeifen, das Stampfen der Füße und das Knallen der Gewehrkolben, mit dem die Ehrenwache vor ihnen salutierte.
Dann trat Keen grüßend und mit lächelndem Gesicht auf sie zu. Sie schüttelten einander die Hände, und Keen begleitete sie nach achtern in die große Kajüte.
»Nun, Val?« Bolitho setzte sich und sah seinen Freund an. »Ich werde Ihnen heute nicht lange zur Last fallen.«
Keen schenkte Rotwein ein. Bolitho fielen die harten Linien um den Mund seines Flaggkapitäns auf, Spuren der Verantwortung und eines schweren Kommandos. Der Mann war ständig gefordert, um die zahllosen Schwierigkeiten der Reparatur zu meistern. Nicht die kleinste Spur der Schlacht durfte zurückbleiben. Er mußte fertigwerden mit einer zu kleinen Besatzung, mit dem Anbordnehmen und richtigen Stauen von Pulver und Kugeln. Er mußte neue Wachlisten aufstellen, um die wenigen erfahrenen Männer richtig unter die Freiwilligen und Gepreßten zu verteilen. Bolitho hatte all das selber kennengelernt, schon auf seinem ersten Kommando, einer kleinen Korvette der Royal Navy.
»Schön, Sie zu sehen.« Keen reichte ihm ein Glas. »Aber Ihre Worte klingen etwas rätselhaft.« Er lächelte, allerdings nicht mit den Augen.
»Wie geht es Zenoria? Sie vermißt Sie sehr, nicht wahr?« Keen drehte sich um und nestelte an seinen Schlüsseln. »Heute morgen kam eine Depesche für Sie an Bord, Sir. Mit reitendem Boten von der Admiralität.« Er öffnete eine Schublade und nahm den Umschlag heraus. »Tut mir leid, ich habe nicht sofort daran gedacht.«
Bolitho betrachtete das Siegel, Schlimmes ahnend. Auch Catherine hatte so eine Andeutung gemacht.
»Ich bin nach Kapstadt kommandiert worden, Val, um dafür zu sorgen, daß man dort nicht allzu träge wird. Wir brauchen da unten viel mehr Patrouillen. Vor allem jetzt, nachdem das Gesetz gegen die Sklaverei im Parlament verabschiedet worden ist. Sklavenhändler, Piraten und anderes Gesindel müssen aufgespürt werden.«
Keen sah ihn an, als habe er nicht verstanden.
Ruhig fügte Bolitho hinzu: »Für das Kommando in Kapstadt sucht man noch einen erfahrenen Kapitän. Er wird einen Kommodorewimpel setzen können. Ich werde nach dem Einsatz auf die Black Prince zurückkehren, aber falls Sie das Kommando übernehmen möchten, müssen Sie in Kapstadt bleiben.«
»Ich, Sir?« Perplex setzte Keen das Glas ab. »Ich soll das Kommando über die Black Prince aufgeben?« Ungläubig sah er Bolitho an. »Und Sie verlassen, Sir?«
Bolitho lächelte. »Der Krieg erreicht wieder mal einen Wendepunkt, Val. Wir müssen eine Armee auf dem Kontinent anlanden und brauchen dafür unsere besten Männer. Sie gehören dazu, haben längst eine Beförderung verdient. Die Flotte braucht erfahrene Offiziere wie Sie – gerade jetzt nach Nelsons Tod.«
Ihm fielen die Worte des Generals ein, den er kurz vor der Eroberung Kapstadts getroffen hatte: »Alle Triumphe auf See sind erst dann etwas wert, wenn die englische Infanterie den feindlichen Strand hinaufmarschiert«
Keen trat an ein Heckfenster, auf dem die Gischt eingetrocknet war, und blickte nach unten in das unruhige Wasser.
»Wann wäre das, Sir?« Er wirkte wie gelähmt von der unerwarteten Wendung.
»Bald. Die Black Prince wird sicher noch einige Wochen unter Obhut der Werft bleiben.«
»Welchen Rat würden Sie mir geben, Sir?« Keen drehte sich um.
Bolitho schlitzte den dicken Umschlag auf. »Ich weiß, was es bedeutet, von einer geliebten Frau getrennt zu sein. Aber es ist das Los aller Marineoffiziere. Und es ist die Pflicht eines Offiziers, jede Möglichkeit für eine Beförderung zu nutzen, damit er seinem Land mehr nutzen kann als vorher.«
Keen sah zur Seite. »Dann nehme ich an, Sir.« Das sagte er ohne jedes Zögern.
Bolitho überflog, was ihm da in sauberer Bürokratenschrift mitgeteilt wurde. Dann sagte er ernst: »Auf diesem Schiff haben Sie noch eine schwere Aufgabe, Val.« Er warf den Brief auf den Tisch. »Es wird hier in Portsmouth eine Untersuchung geben. Ihre Lordschaften haben entschieden, daß Konteradmiral Herrick sich vor einem Kriegsgericht verantworten muß – und zwar bald.«und zwar bald.«
Keen nahm den Brief auf. »Unehrenhaftes Verhalten und Pflichtverletzung.« Weiter las er nicht. »Lieber Gott, was soll das, Sir?«
»Lesen Sie weiter. Die Verhandlung wird auf der Black Prince stattfinden, über die Sie das Kommando führen. Auf meinem Flaggschiff.«
Keen verstand endlich. »Dann will ich schnell zum Kap, Sir!« Verbittert fügte er hinzu: »Für so etwas bin ich völlig ungeeignet!«
Bolitho erhob sich und nahm seinen Hut aus der Hand des Stewards entgegen. »Wenn Sie sich endgültig entschieden haben, Val, sagen Sie’s mir; sagen Sie’s uns. Das darf man von Freunden erwarten.«
Ebenezer Julyan, der Master, wartete draußen am Ruder – wohl mit voller Absicht wie es Bolitho schien, um ihn zu sprechen.
Als wäre alles erst gestern geschehen, erinnerte sich Bolitho an den Master. Der hatte diebisch gegrinst als sie mit der Black Prince auf die gewaltige San Mateo zugesegelt waren. Bolitho hatte ihm seinen goldbesetzten Dreispitz gegeben. Julyan sollte ihn aufsetzen, um den Feind glauben zu machen, die Black Prince sei eine dänische Prise.
»Haben Sie meinen Hut wirklich Ihrem Sohn geschenkt Mr. Julyan?« sprach er ihn an.
Der Mann lachte. »Weiß Gott, Sir. Das ganze Dorf stand Kopf. Schön, Sie wiederzusehen, Sir Richard!«
Bolitho schaute sich um, suchte andere bekannte Gesichter, die damals mit ihm dem Tod getrotzt hatten. Dann berührte er das silberne Amulett unter seinem Hemd. Catherine hatte es ihm morgens um den Hals gelegt wie immer, wenn sie sich trennten. »Möge das Glück dich immer leiten«, hatte sie gesagt. »Möge meine Liebe dich immer beschützen.«
Aber es war nicht richtig, an das Glück zu denken, das ihm Catherine geschenkt hatte, wenn Keen so niedergeschlagen war.
Lady Catherine Somervell trat an das Fenster mit dem schmalen eisernen Balkon und blickte auf das unruhige Wasser der Themse hinaus. Die Stadt war schon hellwach gewesen, als ihre von der langen Reise schmutzstarrende Kutsche endlich vor diesem kleinen eleganten Haus in Chelsea gehalten hatte. In den Straßen boten Händler, die von den vielen Märkten kamen, lauthals Fleisch, Fisch oder Gemüse an. Ja, das war die Stadt London, an die sie sich bis weit in ihre Kindheit zurück erinnerte. Und manche von diesen Erinnerungen hatte sie Bolitho gezeigt.
Auf der holprigen Landstraße war die Reise in der Kutsche anstrengend gewesen. Blattlose Bäume säumten im kalten Mondlicht die Straße, und immer wieder schütteten Wolken Regen über sie aus. Gelegentlich hatten sie angehalten, um sich zu stärken, doch ehe sie selbst ein Gasthaus betrat hatte Yovell, Bolithos pummeliger Sekretär aus Devon, es stets inspiziert. Mehrmals war er in die Kutsche zurückgeklettert und hatte mit bösem Kopfschütteln dem jungen Kutscher Matthew weiterzufahren befohlen: kein Gasthaus für eine Lady.
Die vier Männer hatten sie fabelhaft umsorgt, hatten die kupferne Wärmepfanne für ihre Füße bei jedem Halt mit heißem Wasser gefüllt und sie selbst gut in wärmende Decken und ihren langen Samtmantel gehüllt. Obwohl sie eine sehr selbständige Frau war, hatte sie diese Fürsorge genossen.
Trotzdem, nach Falmouth wirkte dieses Haus jetzt seltsam kühl und fremd. Catherine war dankbar, daß in den meisten Räumen ein Kaminfeuer brannte. Wehmütig dachte sie an Bolithos Haus unterhalb von Pendennis Castle und war überrascht wie sehr sie sich dorthin zurücksehnte. Sie hörte Allday in der Küche lachen; jemand anderer, wahrscheinlich Ozzard, der treue, stille, schmächtige Steward, legte polternd Holzscheite auf ein Feuer.
Während der langen Reise hatte sie, als Yovell schlief und Ozzard draußen neben dem Kutscher saß, lange mit Allday gesprochen, hatte ihm zugehört, als er von den frühen Jahren des Mannes erzählte, den sie liebte. Er hatte von den Schiffen gesprochen, auch von den Schlachten, obwohl er da sehr allgemein blieb und nicht versuchte, sie zu beeindrucken oder ihr Angst zu machen. Er sprach zu ihr fast wie ein alter Freund.
Als sie mehr über Herrick wissen wollte, war Allday ausgewichen.
»Ich habe ihn kennengelernt als einen der Leutnants unter Kapitän Bolitho auf der Phalarope – 1782 war das wohl.« Allday grinste. »Ich war nicht freiwillig an Bord, müssen Sie wissen.« Das schien ihn zu amüsieren. »Als der Kommandant damals von Bord ging, nahm er uns beide mit, Bryan Ferguson und mich. Später wurde ich sein Bootssteurer.« Er schüttelte den Kopf. »Viel ist passiert seit damals!«
Als sie weiterfragte, sah er ihr in die Augen. »Konteradmiral Herrick ist ein sturer Hund, wenn Sie das Wort verzeihen, Mylady. Ein ehrenwerter Gentleman, was ja selten ist heutzutage, aber …«
Catherine spürte seine Unsicherheit »Sir Richard macht sich um Herrick große Sorgen. Er ist sein ältester Freund, stimmt’s?«
»Ja, nach mir, Mylady. Aber die Leute ändern sich nicht, egal was kommt. Auch Sir Richard hat sich nie geändert. Jetzt mag er Admiral sein und für die meisten sogar ein Held. Aber ich erkenne in ihm immer noch den jungen Kapitän, der beim Tod eines Freundes weinte.«
»Erzähl’ mir davon, Allday. Es gibt so viele Lücken, die ich füllen muß.«
Die Kutsche war in eine tiefe Spur gerutscht und murrend war Yovell davon erwacht. »Wo sind wir?« fragte er benommen, und als man es ihm gesagt hatte, nickte er wieder ein.
Allday sah seine Herrin an wie seinerzeit in English Harbour, als ihr Mann noch lebte. Damals war Bolitho wieder ihr Geliebter geworden – nach einer dummen Trennung. »Ich rate Ihnen, Mylady, zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Auf der Reise zum Kap werden Sie ihn so kennenlernen, wie wir ihn kennen: nicht den Mann, der von See heimkehrt sondern den Offizier des Königs.«
Und jetzt stand sie allein in dem Raum, in dem sie einander so fordernd geliebt hatten, als ob sie die vielen Jahre der Trennung nachholen wollten.
Sie dachte an Valentine Keen, an sein besorgtes Gesicht, als er sich mit ihr über seine Ehe mit Zenoria unterhalten hatte. Wieder ein Geheimnis: Sie waren eine Gruppe enger Freunde – Oliver Brownes kleine Schar Auserwählter –, und doch herrschte zwischen Herrick und Keen eine seltsame Kühle. Wegen Zenoria??
Sie hatte Richard nie verraten, was sie in Adam Bolithos, seines Neffen, Gesicht gesehen hatte, als Keen und Zenoria in der Kirche getraut wurden. Vielleicht hatte sie sich ja geirrt? Aber sie wußte, daß das nicht der Fall war. Sie besaß genug Lebenserfahrung, um damals zu erkennen, daß Richards Neffe, den er wie einen Sohn liebte, Kapitän Keens Frau Zenoria begehrte.
Adam war jetzt selbst Kommandant, noch ein sehr junger, und seine erste Fregatte, die Anemone, kreuzte irgendwo auf See mit der Kanalflotte. Und das war gut so, solange sich die Lage nicht geklärt hatte.
Catherine warf ihren Mantel ab und musterte sich in einem hohen Spiegel: eine schöne Frau, beneidet, bewundert, gehaßt. Aber das alles ließ sie kühl. Sie sah nur die Frau, die Bolitho liebte. Lächelnd erinnerte sie sich an Alldays schlaue Bemerkung: ein Offizier des Königs. Nun ja …
Catherine war noch auf, als Bolitho abends ankam. Niemand hatte seine Ankunft angekündigt. Schnell schritt er durch die Türen auf sie zu, gab dem neuen Zimmermädchen Hut und Mantel und nahm Catherine in die Arme.
Sie küßten sich. Dann sah er sie an.
»Thomas Herrick wird vor ein Kriegsgericht gestellt!«
Sie legte ihm die Arme um den Hals. »Ich habe leider auch eine schlimme Nachricht für dich.«
Er hielt sie von sich ab, suchte in ihrem Gesicht. »Du bist doch nicht etwa krank, Kate? Was ist los?«
»Heute morgen kam eine Frau«, begann sie, »und hat eine Karte hiergelassen.« Ihre Stimme wurde brüchig. »Sie nahm wohl an, daß du hier bist.« Jetzt sah sie ihn direkt an. »Deiner Tochter geht es nicht gut. Die Botenfrau wollte nichts weiter sagen.«
Bolitho erwartete Bitterkeit oder Ablehnung in ihrem Blick, aber er fand nichts davon, nur Verständnis für etwas, das schon immer dagewesen war.
»Du wirst hingehen müssen, Richard«, sagte Catherine. »Ganz egal, was du von deiner Frau hältst oder von dem Komplott, das sie mit meinem verstorbenen Mann ausgeheckt hat. Weder du noch ich können einfach weglaufen.«
Sie berührte seine Wange unter dem verletzten Auge und sprach so leise weiter, daß er sie kaum verstehen konnte. »Manche nennen mich die Hure des Admirals, aber diese Leute tun mir eher leid, als daß ich sie verachte … Und wenn du mich so ansiehst wie jetzt kann ich dich kaum gehen lassen. Jedesmal, wenn wir uns umarmen, ist es wie beim ersten Mal.« Sie hob das Kinn, und er sah eine Ader an ihrem Hals pochen. »Was sollte also zwischen uns stehen, Liebster? Uns kann nur der Tod trennen.«
Sie drehte sich um und rief nach Allday, von dem sie ahnte, daß er in der Halle wartete. »Begleite ihn zu seiner Frau, Allday, dorthin kann ich nicht mitgehen. Es würde ihn nur belasten.«
Die Kutsche war wieder vors Portal gefahren. »Warte auf mich, Kate«, sagte Bolitho. Er wirkte bedrückt aber hellwach. Die Locke über seinem rechten Auge, jetzt fast weiß, bedeckte eine fürchterliche Narbe auf seiner Stirn. Abgesehen davon war es ein junges, mitfühlendes Gesicht. Ja, er hätte immer noch der Kapitän sein können, an den Allday sich erinnerte, einer, der Tränen über einen gefallenen Freund vergoß.
Sie schmiegte sich an ihn und berührte den alten Familiensäbel, den alle Bolithos auf den Porträts in Falmouth getragen hatten. »Wenn ich einen Wunsch frei hätte, möchte ich dir einen Sohn schenken, der eines Tages diesen Säbel tragen wird. Aber es geht nicht.«
Er hielt sie in seinen Armen und wußte, wenn sie jetzt die Fassung verlor, würde er sie nicht alleinlassen können, nie mehr.
»Du hast mal gesagt Kate, daß ich nach Liebe dürste wie die Wüste nach Regen. Daran hat sich nichts geändert. Ich will dich, der Rest ist Vergangenheit.«
Als die Tür zufiel, sah sie in die Diele hinunter, Yovell stand unten und polierte sorgfältig seine kleine, goldgeränderte Brille.
Laut sagte Catherine, als sei sie allein: »Wenn sie ihn wieder verletzt, bringe ich sie um!«
Yovell dachte an das, was vor ihnen lag: Herricks Kriegsgerichtsverhandlung, die Gerüchte um Kapitän Keens Ehe und jetzt dies. Vielleicht war es doch ganz gut, daß sie alle zum Kap segelten.
II Kalte Herzen
Selbst in der Dunkelheit erkannte Bolitho den Platz wieder, der still und exklusiv gelegen war: hohe, elegante Häuser, fast alle Fenster erleuchtet; die kahlen nassen Bäume reflektierten ihr Licht. In wenigen Wochen würden die Kindermädchen hier wieder ihre Wagen schieben oder die Kiemen beaufsichtigen und dabei über ihre Herrschaften klatschen.
Die Kutsche bremste scharf, und Bolitho sah im Licht der Lampen Allday sich nach vorn lehnen. Bolitho stieg aus und trat heftig auf, um das Blut in den Beinen wieder zirkulieren zu lassen; er ordnete seine Gedanken.
Am nächstliegenden Haus entdeckte er Stallungen. Dort glühte in einem Kübel ein Feuer, fast verdeckt von Kutschern und Knechten, die sicherlich die ganze Nacht auf die Lords und Ladies warten mußten, die späte Dinnerparties genossen oder das Glücksspiel in den Salons gegenüber. Dies war London, wie Bolitho es mittlerweile haßte, ein arrogantes, gedankenloses London ohne Mitgefühl.
»Warte irgendwo in der Nähe, Matthew.« Er bemerkte Alldays großen Schatten. »Du bleibst an meiner Seite, alter Freund.«
Die Tür schwang nach innen auf, noch ehe das Echo der Glocke ganz verhallt war. Ein Lakai wartete wie ein Schattenriß vor dem Licht »Sir?«
»Sir Richard Bolitho, du Dussel!« knurrte Allday.
Mit einer Verbeugung trat der Lakai rückwärts in die Halle. Sie war neu dekoriert und hatte jetzt rote Vorhänge. Die er bei seinem letzten Besuch gesehen hatte, waren andere gewesen, aber damals auch neu.
Bolitho hörte murmelnde Stimmen und Gelächter aus dem Eßzimmer im ersten Stock: ganz und gar nicht das, was er erwartet hatte.
»Wenn Sie hier bitte warten würden, Sir Richard?« Der Lakai hatte sein Selbstbewußtsein wiedererlangt »Ich werde Ihre Ankunft melden.«
Er öffnete eine Tür, und auch an dieses Zimmer erinnerte sich Bolitho, obwohl ebenfalls viel verändert worden war – auf teure Weise. Hier hatte er Belinda zur Rede gestellt über ihr Komplott mit Viscount Somervell, Catherines verstorbenem Mann. Sie hatten Catherine unter falschen Vorwürfen in den Schuldturm bringen lassen und schließlich deportieren wollen, um sie für immer loszuwerden. Nie würde er ihren Anblick in jenem dreckstarrenden Gefängnis vergessen, das voller Geisteskranker und Schuldner gewesen war. Catherine hätte niemand deportieren können, sie wäre eher gestorben. Nein, das würde er Belinda nie vergessen.
»Oh, Sir Richard!«
In der offenen Tür sah Bolitho eine Dame stehen und erkannte sie sofort: Lady Lucinda Manners gehörte zu Belindas engsten Freundinnen: blondes Haar, hochaufgetürmt und ein so tiefer Ausschnitt, daß er fast den ganzen Busen enthüllte. Sie beobachtete ihn mit einem Lächeln.
»Lady Manners?« Bolitho verbeugte sich kurz. »Ich habe Belindas Nachricht bei meiner Ankunft in London erhalten. Vielleicht …«
»Vielleicht, Sir Richard, darf ich Sie unterhalten, bis Lady Bolitho ihre Gäste alleinlassen kann?«
Da entdeckte sie Allday hinter der Tür. »Ich dachte, Sie sind allein gekommen …«
Bolitho blieb unbewegt »Das ist Mr. Allday, mein Begleiter. Ein Freund.«
In der großen Halle stand ein Sessel mit hoher Rückenlehne.
Vorsichtig ließ Allday sich darin nieder. »Ich bleibe in der Nähe, Sir Richard. Wenn Sie mich brauchen …«
Das Licht einer Kerze spiegelte sich kurz im Messingknauf der Pistole, die Allday unter seiner Jacke trug.
Auch Lady Manners hatte das Blitzen bemerkt und sagte etwas zu heiter: »Sie haben in diesem Haus nichts zu befürchten, Sir Richard.«
Er antwortete ruhig: »Gut zu wissen, Madam. Wenn Sie jetzt bitte das Gespräch arrangieren würden?«
Lady Manners ging, und oben verstummte alles Reden, als lausche das Haus selber; Bolitho hörte Belindas Rock am Geländer entlangstreifen, als sie die schöne Treppe herabstieg. Auf der zweiten Stufe blieb sie stehen und schaute ihn so prüfend an, als suche sie nach etwas Verlorenem.
»Endlich kommst du, Richard!« Sie streckte ihre Hand aus, aber er blieb stehen.
»Laß uns nicht Theater spielen. Ich kam wegen des Kindes. Das ist schließlich meine …«
»Pflicht, meinst du? Das wolltest du doch sagen. Sicherlich kamst du nicht aus Sorge.«
Bolitho schaute sich kritisch in dem reichdekorierten Raum um. »Meine Fürsorge für euch ist offenbar mehr als ausreichend und sicherlich erheblich größer als verdient.«
»Ich möchte das nicht vor der Dienerschaft diskutieren«, sagte sie hart. »Weder vor deiner noch vor meiner.«
»Darunter verstehen wir Verschiedenes.« Bolitho stellte fest, daß er sie ohne Haß anschauen konnte, sogar ohne jedes Gefühl. Er hatte sie nur aus einem einzigen Grund geheiratet: weil sie ihn so sehr an seine erste Frau erinnert hatte, an Cheney. Das hatte Belinda ihm oft genug vorgeworfen.
»Allday hat alle Gefahren dieses verdammten Krieges mit mir geteilt. Er ist einer von den Männern, die jeden Tag ihr Leben riskieren, damit ihr hier herrlich und in Freuden leben könnt.« Plötzlich ungeduldig, fragte er: »Also, wie geht es Elizabeth?«
Einen Augenblick schien es, als wolle sie kontern, doch dann gab sie auf. »Komm mit!«
Allday beugte sich so weit vor, daß er erkennen konnte, wo sie oben auf der Treppe verschwanden. Hier mußte man sich nicht allzu viele Sorgen machen, entschied er. Bolitho hatte wirklich genug andere Probleme, aber er hatte Belinda die Zähne gezeigt und auch dieser anderen Dame mit den nackten Schultern und dem Blick einer Hafenhure.
Er dachte an ihre bevorstehende Reise nach Kapstadt: ein ganz neues Erlebnis. Mit Lady Catherine, Kapitän Keen und dem jungen Jenour an Bord würde es mehr eine Vergnügungsreise werden als ein Einsatz im Auftrag des Königs.
Lady Catherine war so ganz anders als die Dämchen, die er in diesem Haus gesehen hatte. Groß und schön, eine richtige Seemannsbraut. Sie konnte das Herz eines Mannes in Wasser verwandeln oder es hell entflammen – nur mit ihren Blicken. Und sie kümmerte sich um Bolithos Besitz in Falmouth. Inspektor Ferguson, Alldays Freund, hatte erzählt, daß sie wahre Wunder bewirkte. Mit ihren Vorschlägen und ihrem Rat hatte sie dafür gesorgt, daß wieder Geld in die Kasse des Guts kam. Bolithos Vater hatte seinerzeit viel Land verkaufen müssen, um für die Spielschulden seines zweiten Sohnes Hugh aufzukommen.
Jetzt waren beide tot. Außer Hughs unehelichem Sohn Adam, dem Sir Richard seinen Namen gegeben hatte, lebte kein Bolitho mehr. Allday beunruhigte der Gedanke, daß eines Tags niemand mehr von See in das leere graue Haus zurückkehren würde. Bolitho dachte manchmal genauso – und beide wußten es. Eine Kugel, ein Splitter konnte sie beide eines Tages trennen. Wie Herr und Hund fürchtete jeder, den anderen allein zurücklassen zu müssen.
Oben im Speisezimmer wurden die Stimmen wieder lauter. Bolitho blieb vor einer reich vergoldeten Tür stehen. Kühl musterte ihn Belinda. »Ich dachte, als Elizabeths Vater solltest du Bescheid wissen. Wenn du auf See gewesen wärst, hätte ich es allein entschieden. Aber ich wußte, du warst hier mit — mit ihr zusammen.«
»Richtig.« Er sah sie genauso kühl an. »Hätte meine Catherine sich bei der armen Dulcie Herrick angesteckt, wäre das auch mein Ende gewesen.« Das saß. »Doch vorher hätte ich dich erledigt!«
Er stieß die Tür auf. Drinnen erhob sich hastig eine Frau in einem einfachen schwarzen Kleid, sicherlich die Kinderfrau. Er nickte ihr zu und sah das Kind auf dem Bett liegen, vollständig angezogen, leicht bedeckt mit einem Schal. »Sie schläft jetzt«, flüsterte die Kinderfrau und blickte Belinda an, nicht ihn.
Elizabeth war sechs Jahre alt und zur Welt gekommen, als Bolitho mit der Achates, einem Linienschiff von 64 Kanonen, in San Felipe gelegen hatte. Damals hatte Allday in der Schlacht von einem Säbelhieb seine schwere Brustwunde erhalten, die ihn fast getötet hätte. Allday klagte nie über sie, aber manchmal preßte sie den Atem aus seiner Lunge, dann stand er bewegungslos mit rasenden Schmerzen da.
Belinda sagte: »Sie ist gestürzt.«
Schon beim letzten Treffen war Bolitho aufgefallen, daß seine Tochter nichts Kindliches an sich hatte. Sie war eine kleine Erwachsene und trug all die aufwendigen Kleider, die sie später als Lady auch tragen würde.
Er dachte bei ihrem Anblick oft an seine eigene Kindheit in Falmouth, wo er mit seinem Bruder Hugh, seinen Schwestern und allen anderen Kindern zwischen den Booten auf dem Strand gespielt hatte – ohne die Grenzen, die eine Kinderfrau setzte oder eine ferne Mutter, die ihr Kind vermutlich nur einmal am Tag sah.
»Was war das für ein Sturz?« fragte er knapp.
Belinda zuckte mit den Schultern. »Sie fiel von ihrem Pony. Ihr Lehrer hatte sie im Blick, aber sie wollte angeben, denke ich. Sie hat sich den Rücken verknackst.«
Bolitho merkte plötzlich, daß seine Tochter ihn mit offenen Augen anstarrte. Als er sich über sie beugte, um ihre Hand zu streicheln, versuchte sie sich wegzudrehen, die Kinderfrau an sich zu ziehen.
Leise sagte Belinda: »Für sie bist du ein Fremder.«
»Hier sind wir alle Fremde«, antwortete Bolitho. Er hatte die Schmerzen im Gesicht des Kindes gesehen. »Hast du einen Arzt kommen lassen, einen guten?«
»Ja.« Das klang wie: ›Ja, natürlich. Was fragst du so dumm?‹
»Wie lange nach dem Unfall?« Die Kinderfrau blickte von einem zum anderen wie ein unerfahrener Sekundant beim Duell.
»Ich war zu der Zeit nicht da. Wie konnte ich also etwas tun?«
»Ich verstehe.«
»Wirklich?« Belinda verbarg ihren Ärger nicht länger. »Dir ist selbst der Skandal mit jener Frau egal, wie kannst du dann dies hier verstehen?«
»Ich werde dafür sorgen, daß ein erfahrener Arzt Elizabeth untersucht.«
Belinda hatte Dulcie Herrick allein sterben lassen, obwohl sie vorgab, mit ihr befreundet zu sein. Geschickt hatte sie Herricks Empörung über die Verbindung zwischen Catherine und Bolitho genutzt, hatte Catherine schließlich in dem fieberverseuchten Haus mit Herricks sterbender Frau alleingelassen. Nun würde auch sein alter Freund Herrick sterben oder in Unehre fallen, wenn das Kriegsgericht gegen ihn entschied.
»Denk’ doch wenigstens einmal im Leben auch an andere, nicht nur an dich selbst«, sagte er.
Als er zur Tür ging, fiel ihm auf, daß er Belinda kein einziges Mal mit Namen angeredet hatte.
Neugierig blickte jemand aus dem Speisezimmer.
»Deine Freunde warten schon auf dich.«
Sie folgte ihm nur bis zur Treppe. »Einmal wird’s mit deinem Glück vorbei sein, Richard! Ich wünschte nur, ich könnte das miterleben!«
Als Bolitho in die Halle trat, sprang Allday auf.
»Zurück nach Chelsea, Allday. Matthew soll einen Brief von mir zu Sir Piers Blachford am College of Surgeons bringen. Er ist sicher der beste Arzt.«
Vor der Kutsche hielt er inne, musterte das Feuer und die Männer drumherum. »Hier draußen ist die Luft viel sauberer!«
Allday stieg schweigend hinter ihm ein. Neuer Ärger kam auf sie zu, er kannte die Anzeichen. Belinda würde alles tun, um Bolitho zurückzuholen. Oder ihn tot zu sehen. Er lächelte böse und dachte: Dazu müßte sie erst mich umbringen, bei Gott!
Admiral Lord Godschale füllte zwei Gläser mit Brandy und beobachtete Bolitho, der am Fenster stand und auf die Straße schaute. Ärgerlich fragte er sich, warum er diesen Mann immer wieder beneidete, der nicht älter zu werden schien. Abgesehen von der weißen Locke über der tiefen Stirnwunde glänzte sein Haar dunkel wie eh und je, und seine Figur blieb schlank wie in jungen Jahren. Im Gegensatz zu ihm selbst. Als junge Fregattenkapitäne hatten sie zusammen gegen die Amerikaner gekämpft waren sogar am selben Tag zum Vollkapitän befördert worden. Doch jetzt war Godschales Gesicht so aufgedunsen wie sein Körper und glänzte rot vom üppigen Leben.
Hier von der Admiralität aus reichte seine Macht bis in den fernsten Winkel der Welt bis zum kleinsten Schiff in seiner Britannischen Majestät Kriegsmarine. Er lächelte etwas verkniffen. Dieser König kannte vermutlich keinen einzigen seiner Offiziere mit Namen, doch das wurde natürlich öffentlich nie zugegeben.
»Sie sehen müde aus, Sir Richard.« Er merkte, wie Bolitho seine Gedanken in das Zimmer zurückholte.
»Ein bißchen.« Bolitho nahm das angebotene Glas, das der Admiral über dem Kaminfeuer etwas angewärmt hatte. Zwar war es noch nicht Mittag, doch er konnte jetzt einen Schluck Brandy brauchen.
»Ich hörte, Sie waren gestern aus. Ich hoffe immer noch …«
Bolithos graue Augen blitzten. »Darf ich fragen, wer Ihnen gesagt hat, daß ich im Haus meiner Frau war?«
Godschale runzelte die Stirn. »Ich hoffe immer noch, daß Sie zu ihr zurückkehren.« Aber sein Selbstbewußtsein schmolz unter Bolithos verärgertem Blick. »Nun ja, es war Ihre Schwester, Mrs. Vincent. Sie schrieb mir kürzlich wegen ihres Sohnes Miles, den Sie entlassen haben, als er Midshipman auf der Black Prince war. Das war nicht leicht für den Jungen, nachdem er gerade seinen Vater verloren hatte.«
Bolitho trank Brandy und wartete, bis er ihn ruhiger machte. »Genau genommen, Mylord, war es sogar eine Vergünstigung.«
Godschales Augenbrauen hoben sich zweifelnd.
»Der Junge war völlig ungeeignet«, fuhr Bolitho fort. »Hätte ich ihn nicht entlassen, hätte ich meinem Flaggkapitän befehlen müssen, ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen – wegen Feigheit vor dem Feind. Meine Schwester setzt skandalöse Gerüchte in die Welt, übersieht aber die wahren Fakten.«
Godschale suchte nach Worten, was selten vorkam. Neid, das war es. Er besaß viel Macht und war reich. Im Gegensatz zu seinen Kommandanten würde ihn nie eine Kugel töten oder verstümmeln. Er hatte eine fade Frau, fand aber Trost in den Armen anderer. Wieder dachte er an die schöne Lady Somervell. Weiß Gott, um sie beneidete er diesen unmöglichen Mann.
Grimmig hakte er nach: »Aber Sie waren bei Lady Bolitho?«
Bolitho zuckte mit den Schultern. »Meiner Tochter geht es nicht gut.« Warum sage ich ihm das? fragte er sich. Es interessiert ihn doch gar nicht.
Er kannte Godschale und seinen Ruf lange genug. Er fragte meistens, ohne auf die Antwort zu hören, wie bei der Frage nach Midshipman Vincent. Aber wehe dem, der seine Ruhe und Bequemlichkeit hier in der Admiralität ernsthaft gefährdete! Den würde er hängen oder auspeitschen lassen. Aber am Schicksal der Männer, die draußen Monat für Monat Stürme abritten, Windstillen erduldeten und wahrscheinlich eines Tages einen gräßlichen Tod sterben mußten, nahm er keinen Anteil.
»Oh, das tut mir leid. Kann ich irgendwie helfen?«
»Lady Catherine spricht gerade mit einem Arzt den sie gut kennt.« Bolitho fühlte einen stechenden Schmerz in seinem verletzten Auge. Er wußte, der wahre Grund von Catherines Besuch bei Sir Piers Blachford war ihre Hoffnung, mehr über seine Sehkraft zu erfahren.
Godschale nickte, wunderte sich aber, daß Bolithos Frau sich die Einmischung gefallen ließ.
Bolitho konnte die Gedanken des Admirals lesen, als seien sie laut geäußert worden. Er dachte an Catherines Stimme in der Nacht. Sie hatten lange wach gelegen und viel geredet. Und wie immer hatte sie alles sehr viel klarer gesehen als er selber.
»Du machst dir Sorgen, Richard, weil du dich immer noch verantwortlich fühlst«, hatte sie gesagt. »Aber du bist es nicht mehr. Belinda hat das Kind so erzogen, wie sie wollte. Ich habe das kommen sehen. Aber ich werde mit Sir Piers Blachford reden, er ist einer der wenigen in London, denen man trauen kann. Er wird Elizabeth sicherlich helfen oder jemanden finden, der das kann. Doch ich werde nicht zulassen, daß du dich quälst, indem du wieder ihr Haus betrittst Ich weiß, was sie vorhat Als ob sie dir nicht schon genug weggenommen hätte …«
Bolitho kehrte in die Gegenwart zurück. »Sie haben mich doch sicher nicht kommen lassen, Mylord, um mit mir meine persönlichen Angelegenheiten zu besprechen?« fragte er.
Überraschenderweise wechselte Godschale das Thema. Bis zum nächsten Mal.
»Nein, natürlich nicht. Sie haben recht. Ich habe die Befehle für Ihre Reise nach Kapstadt ausstellen lassen. Mein Adjutant wird Ihnen alles mitgeben.« Er räusperte sich. »Aber da ist noch das Kriegsgericht. Die Verhandlung gegen Herrick ist für Ende nächster Woche angesetzt. Ich habe Ihren Flaggkapitän in Portsmouth entsprechend informieren lassen.« Lauernd sah er ihn an. »Ich habe die Black Prince mit Bedacht als Gerichtsort gewählt. Man ist auf ihr ein bißchen mehr unter sich. Die Werftarbeiten können ja wegen dieser gräßlichen Angelegenheit kurz unterbrochen werden.«
»Wer hat den Vorsitz?« fragte Bolitho ruhig.
Godschale schob auf seinem prächtigen Schreibtisch ein paar Papiere hin und her, als könne er sich nicht erinnern. Dann räusperte er sich wieder. »Admiral Sir James Hamett-Parker.«
Vor Bolithos Augen drehte sich das Zimmer. Er kannte den Mann: bullig, keinen freundlichen Zug im Gesicht dünne Lippen. Dieser Admiral wurde mehr gehaßt als respektiert.
»Ich werde als Zeuge auftreten, Mylord.«
»Nur wenn Sie dazu aufgefordert werden. Und als Zeuge nach dem Ereignis, das wissen Sie.«
Man hörte unten das Klappern von Hufen, Dragoner ritten durch die Straße. Bolitho verließ das Fenster.
»Dann ist Herrick schon so gut wie verurteilt.« Scharf sagte er, selber überrascht über seine Offenheit: »Er ist mein Freund. Ich muß etwas für ihn tun!«
»Wirklich?« Godschale füllte die Kristallgläser nach. »Da ist noch etwas anderes. Das Gericht war einverstanden, daß Sie ihn verteidigen sollten. Es war meine Idee, genaugenommen. Die ganze Angelegenheit kann in der Flotte sehr viel Schaden anrichten, bei allen Kommandanten, die fern jeder Hilfe sind und sich nur auf ihre eigene Entschlußkraft verlassen müssen. Unser Heer ist bereit für eine Invasion des Kontinents – da brauchen wir die unbedingte Loyalität und das Vertrauen jedes einzelnen Kommandanten, vom Admiral bis zum Leutnant. Sonst haben wir keinen Erfolg. Eine zweite Chance werden wir nie bekommen!«
Bei ihrem letzten Treffen hat er das genaue Gegenteil geäußert, erinnerte sich Bolitho, aber das war jetzt auch egal.
»Wollen Sie damit sagen, daß Konteradmiral Herrick mich als Verteidiger abgelehnt hat?« Klar sah er Herricks Gesicht vor sich, den starren Blick der blauen Augen, verletzt verbittert. »Wen hat er statt meiner genommen?«
Godschale sah auf die Uhr. Es war besser, wenn Bolitho gegangen war, ehe seine Schwester Mrs. Vincent eintraf. Sie würde alles noch schlimmer machen.
»Das ist ja so seltsam, Sir Richard. Er will keinen Verteidiger.« Godschale fragte sich, ob er mit diesen Worten etwas von seiner Macht und seinem Einfluß verschenkt hatte. Strahlte Bolitho wirklich soviel aus, daß es auf ihm übersprang? »Aber etwas können Sie noch für ihn tun.«
Bolitho sah Bewegung im Gesicht des Admirals. So hatte er den Mann noch nie erlebt. »Alles!«
Schweiß bildete sich auf Godschales Stirn, doch weder von der Hitze noch vom Brandy. »Konteradmiral Herrick hält sich im Augenblick in Southwark auf. Der Profoß wird ihn dort übermorgen abholen und in der Kutsche nach Portsmouth bringen. Falls Sie ihn besuchen wollen … Aber Vorsicht! Viele Offiziere fahren von dort mit der Eilkutsche nach Portsmouth und könnten Sie erkennen, was Ihre Aufgabe noch schwerer machen würde. Man würde Ihnen abgekartetes Spiel vorwerfen.«
Bolitho streckte seine Hand aus. »Ich danke Ihnen, Mylord. Sie wissen nicht, was mir diese Information bedeutet. Eines Tages kann ich mich hoffentlich dafür revanchieren. Seien Sie unbesorgt, ich habe von Ihnen nichts erfahren.«
Godschale versuchte ein schiefes Grinsen. »Das würde auch niemand glauben – jedenfalls nicht von mir!« Das Grinsen verschwand sofort wieder.
Noch lange, nachdem die Tür hinter Bolitho zugefallen war, starrte Godschale zum Fenster, an dem sein Besucher gestanden hatte. Eigentlich hätte er seine Indiskretion bedauern müssen. Doch er fühlte sich seltsam wohl. »Meine Kutsche, bitte!«
Überrascht von diesem Wunsch des Admirals, sah der Sekretär auf die Uhr. »Aber Mrs. Vincent kommt in einer Stunde, Mylord!«
»Muß ich alles zweimal sagen? Lassen Sie die Kutsche kommen!«
Der Mann eilte davon, und Godschale goß sich ein drittes Glas ein. Laut sagte er in den leeren Raum: »Du machst mir das Leben schwer, Bolitho. Je früher du wieder auf See bist, desto besser für uns alle.«
Es war schon dunkel, als Bolithos Kutsche vor dem Gasthof in Southwark hielt. Als sie über die London Bridge zum Südufer der Themse gerattert waren, hatte Bolitho geglaubt, die See zu riechen und die vielen ankernden Schiffe. Wieder dachte er an die Reise nach Kapstadt. Er hörte Matthew auf dem Kutschbock fluchen, als die Räder über einen großen Stein holperten. Matthew war der beste Kutscher, den es gab, er fluchte wirklich selten. Aber Pferde und Kutsche waren für diese Fahrt geliehen. Nichts hätte geheim bleiben können, wenn man das Wappen der Bolithos auf seiner eigenen Kutsche erkannt hätte.
Langsam fuhren sie an einer großen Postkutsche vorbei, die vor dem berühmten George Inn hielt, dem Gasthaus, von dem aus so viele Marineoffiziere ihre lange, ungemütliche Reise nach Portsmouth begannen. Sie war noch ohne Pferde, doch Kutscher und Knechte luden bereits Kisten und Koffer auf das Dach. Ihre Passagiere tafelten wohl noch bei reichlich Madeira oder Bier. In diesem Gasthaus hätte Bolitho mit Sicherheit jemanden getroffen, der ihn kannte.
Etwas weiter lag der kleine Swan Inn, ebenfalls eine Haltestelle für Postkutschen und mit einer ähnlichen Fassade wie der »George«. Doch während dort Marineoffiziere abstiegen, wurde der Swan hauptsächlich von Kaufleuten benutzt. Im Hof liefen schemenhafte Figuren herum und versorgten die Pferde; irgendwo wurde ein Vorhang gehoben. Jemand interessierte sich für die Neuankömmlinge.
Allday knurrte: »Ich rieche was zu essen, Sir Richard!« Bolitho berührte seinen Arm. »Hol’ mir den Gastwirt und dann geh' essen.«
Er kletterte aus der Kutsche und spürte die bitterkalte Luft, die vom Wasser heraufstrich. Weiter flußaufwärts würde Catherine im Haus in Chelsea jetzt auf die Themse schauen und an ihn denken.
Ein kräftiger Mann tauchte im Licht der offenen Haustür auf. »Oh, Sie sind es, Sir Richard! Das ist wirklich eine Überraschung!«
Jack Thornborough hatte während der amerikanischen Revolution auf einem britischen Schiff als Zahlmeistergehilfe gedient und nach seiner Entlassung Arbeit im Verpflegungsdepot der Marine gefunden. Man sagte ihm nach, er habe mit Hilfe der Zahlmeister soviel aus dem Depot unterschlagen und auf eigene Rechnung verkauft, daß er den Swan Inn hatte erstehen können.
»Sie können sich gewiß vorstellen, warum ich hier bin, Jack.«
Der kahle Kopf des Mannes glänzte im Licht einer Laterne, als er verschwörerisch nickte. »Er ist in seinem Zimmer, Sir Richard. Übermorgen wollen sie ihn abholen, vielleicht auch früher.«
»Ich muß ihn sprechen. Aber davon darf niemand erfahren.«
Thornborough führte ihn durch eine Tür, die er hinter sich verriegelte, und grinste über den einfachen Mantel und den schmucklosen schwarzen Hut, die Bolitho zu diesem Anlaß trug. »Sie sehen mehr aus wie ein Straßenräuber, wenn Sie gestatten, Sir Richard.«
Bolitho spürte, wie sich sein Magen zusammenzog, und machte sich klar, daß er wie Allday seit dem Morgengrauen nichts mehr gegessen hatte. »Kümmern Sie sich um meine Leute, Jack.«
Wie der Seemann von einst tippte Thornborough grüßend an seine Stirn. »Verlassen Sie sich darauf, Sir Richard.« Und dann ernster: »Gehen Sie die Treppe ganz hinauf. Niemand wird Sie sehen.«
Ein versteckter Raum also. Vielleicht trafen sich hier sonst Straßenräuber oder Liebesleute, die keiner erkennen durfte.
Und da hauste zur Zeit der Mann, den er seit fünfundzwanzig Jahren kannte und der bald Ungnade oder den Tod zu erwarten hatte.
Überrascht stellte er fest, daß er nicht außer Atem war, als er die knarrenden Treppen erklommen hatte. Das lag wohl an den vielen Spaziergängen mit Catherine in den Klippen bei Falmouth oder durch die Felder. Ihre Bewirtschaftung des Gutes hatte die Bewunderung von Squire Roxby erregt, der mit Nancy, Bolithos Lieblingsschwester, verheiratet war. Bolitho war dankbar, daß Nancy sich mit Catherine angefreundet hatte, ganz anders als Felicity Vincent, die nur Haß verströmte.
Er klopfte gegen die fleckige, dunkle Tür. Der Rauch von den vielen offenen Feuern im Haus hatte sie gebeizt.
Jack Thornborough würde ihn nicht verraten – er hatte auf derselben Fregatte wie Bolithos gefallener Bruder Hugh gedient und die Marine war eine große Familie.
Wieder klopfte Bolitho. Einen Augenblick lang fürchtete er, die Reise sei umsonst gewesen und der Raum leer.
»Hau ab!« sagte drinnen eine Stimme.
Bolitho seufzte. Das war Herrick.
»Thomas, ich bin’s. Richard!«