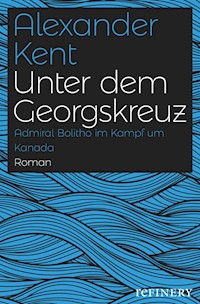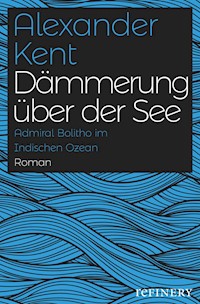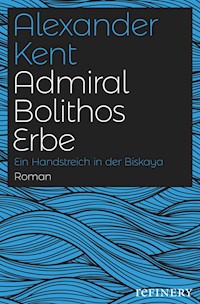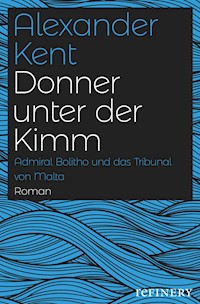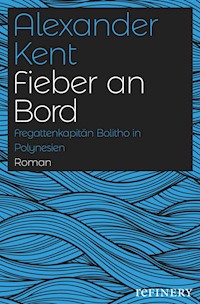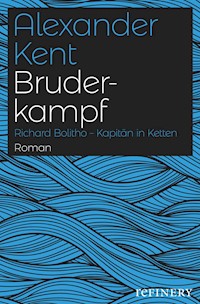6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
1795 in der Biskaya: Kurz nach seiner Hochzeit mit Cheney muss Richard Bolitho mit seiner Hyperion und einer noch unerprobten Mannschaft auslaufen, um die britische Blockade der Seehäfen Frankreichs zu verstärken. Ein grausames Verbrechen, dem Kapitän Bolitho nur untätig zusehen kann, macht ihn zum Todfeind des französischen Generals Lequiller; über Tausende von Seemeilen jagt er ihn bis nach Westindien und wieder zurück in die Biskaya, ehe er ihn in einem dramatischen Seegefecht bezwingen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben G.S. Forester.Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
1795 in der Biskaya: Kurz nach seiner Hochzeit mit Cheney muss Richard Bolitho mit seiner Hyperion und einer noch unerprobten Mannschaft auslaufen, um die britische Blockade der Seehäfen Frankreichs zu verstärken. Ein grausames Verbrechen, dem Kapitän Bolitho nur untätig zusehen kann, macht ihn zum Todfeind des französischen Generals Lequiller; über Tausende von Seemeilen jagt er ihn bis nach Westindien und wieder zurück in die Biskaya, ehe er ihn in einem dramatischen Seegefecht bezwingen kann.
Alexander Kent
Feind in Sicht
Kommandant Bolithos Zweikampf im Atlantik
Aus dem Englischen von Wilm W. Elwenspoek Frank Barton
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei RefineryRefinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Juli 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2007© für die deutsche Ausgabe: Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M. – Berlin 1979© 1970 by Alexander Kent Titel der englischen Originalausgabe: Enemy in SightCovergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-144-7
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Abschied
II Unter dem Kommodorestander
III Täuschungsmanöver
IV Ein Schandname
V Die Jagd beginnt
VI Ein Offizier des Königs
VII Ungleicher Kampf
VIII Neuigkeiten für den Kommodore
IX Rückzug
X Ehrensache
XI Angriff im Morgengrauen
XII Mr. Selby
XIII Rückkehr der
Spartan
XIV Für die achtern die Ehre …
XV Hiobsbotschaft
XVI Eine Privatangelegenheit
XVII Einer für alle
XVIII Endlich: das Signal
XIX Letztes Ringen
Epilog
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
I Abschied
Motto
Kein Kommandant geht fehl,wenn er sein Schiff neben dasdes Feindes legt.
Horatio Nelson
I Abschied
Die hohen Fenster des Golden Lion Inn,die nach Süden auf den Plymouth Sound gingen, zitterten heftig in den Rahmen, als in einer starken Böe der Regen wieder gegen die Scheiben prasselte.
Kapitän Richard Bolitho stand vor einem lodernden Holzfeuer, die Hände auf dem Rücken zusammengelegt, und blickte, ohne etwas zu sehen, vor sich auf den Teppich. Der plötzliche Windstoß ließ ihn aufsehen. Auf ihm lastete ein ungewisser Druck, daneben aber auch eine ihm neue, befremdliche Furcht, das Land zu verlassen.
Schnell ging er zum Fenster und sah auf die leeren Straßen hinaus, auf das vor Nässe glänzende Pflaster und die kabbelige, graue See dahinter. Es war acht Uhr morgens, doch an diesem 1. November war es um diese Zeit fast noch zu dunkel, um durch die fleckigen Scheiben mehr als ein verschwommenes, graues Panorama zu erkennen. Er vernahm Stimmen vor seiner Tür, vom Hof drang das Klappern von Hufen und das Knarren von Rädern herauf, und ihm wurde bewußt, daß der Augenblick des Abschieds kurz bevorstand. Er beugte sich über das lange Messingteleskop, das auf einem Dreibein neben dem Fenster stand, zweifellos als Dienstleistung für die Gäste des Gasthofs gedacht oder zur Unterhaltung jener, für die der Anblick eines vorüberziehenden Kriegsschiffs nicht mehr als ein schönes Bild oder eine flüchtige Ablenkung bedeutete.
Es war merkwürdig, wenn man sich vor Augen hielt, daß das Jahr 1794 seinem Ende entgegenging und England seit annähernd zwei Jahren mit dem revolutionären Frankreich Krieg führte, es aber immer noch viele Leute gab, die der Gefahr, in der sie sich befanden, völlig gleichgültig gegenüberstanden oder sie überhaupt noch nicht erkannt hatten. Vielleicht waren die Nachrichten zu günstig, überlegte er. Denn zweifellos war der Seekrieg in diesem Jahr erfolgreich verlaufen. Howes Seesieg, der »glorreiche 1. Juni«, wie er jetzt genannt wurde, die Besetzung der französischen Inseln in Westindien durch Jarvis und auch die Einnahme von Korsika im Mittelmeer mußten doch ankündigen, daß der Weg zum Gesamtsieg offenstand. Aber Bolitho wußte zu gut Bescheid, um ein derart vorschnelles Urteil zu übernehmen. Der Krieg weitete sich nach allen Richtungen aus, und es hatte den Anschein, als würde er schließlich die ganze Welt erfassen. Und trotz seiner Flotte wurde England gezwungen, sich mehr und mehr auf seine eigenen Hilfsquellen zu beschränken.
Vorsichtig schwenkte Bolitho das Fernrohr nach einer Seite, betrachtete die Reihen der Schaumkronen, die den Sund überquerten, die keilförmige Halbinsel, die rasch vorbeiziehenden, bleigrauen Wolkenbänke. Der Wind frischte aus Nordwest auf, und es lag ein Hauch von Schnee in der Luft.
Er hielt den Atem an und richtete das Glas auf ein weit draußen liegendes, vereinzeltes Schiff, das anscheinend bewegungslos lag und den einzigen Farbfleck vor der düsteren See bildete.
Die Hyperion, sein Schiff, wartete dort auf ihn. Es war schwer, eigentlich unmöglich, sich den zerschlagenen, von Einschlägen zernarbten Zweidecker vorzustellen, den er vor sechs Monaten nach Plymouth gebracht hatte, nach dem verzweifelten Kampf im Mittelmeer, nach Hoods vergeblichem Bemühen, Toulon zu besetzen und zu halten. Sechs Monate hatte er betteln und bestechen, Dockarbeiter einschüchtern und jede Phase der Reparatur und Neuausstattung des alten Schiffs überwachen müssen. Und die Hyperion war wirklich alt. Zweiundzwanzig Jahre waren vergangen, seit ihr solides Eichenholz aus Kent zum erstenmal Salzwasser geschmeckt hatte, und fast die ganze Zeit über war sie ständig im Einsatz gewesen: von der beißenden Eiseskälte des Nordatlantiks bis zu den quälenden Flauten im Indischen Ozean; von den Gefechten im Mittelmeer bis zum geduldigen Blockadedienst vor dem einen oder anderen feindlichen Hafen.
Als das Schiff im Dock lag, hatte Bolitho gesehen, wie fast sechs Fuß langes Seegras von seinem bauchigen Rumpf gekratzt wurde. Kein Wunder, daß die Hyperion so langsam gewesen war. Jetzt sah sie zumindest äußerlich wie ein neues Schiff aus.
Das seltsam silbrige Licht spielte auf der hohen Bordwand, als das Schiff vor Anker stark schwojte. Selbst aus dieser Entfernung konnte er das straffe schwarze Spinnennetz der Takelage erkennen, die Doppelreihe der Stückpforten, das kleine, scharlachrote Viereck der Flagge, die steif im auffrischenden Wind stand.
Einmal hatte es fast schon so ausgesehen, als ob die Wiederherstellung, die Arbeiten und die Verzögerungen nie ein Ende nehmen würden. In den letzten Wochen war die Hyperion dann der wartenden See zurückgegeben worden, das Rigg wurde aufgerichtet, die vierundsiebzig Geschütze wurden ersetzt, der tiefliegende Rumpf mit Vorräten, Lebensmitteln, Pulver und Geschossen gefüllt. Und mit Menschen.
Bolitho richtete sich auf. Sechs Monate fern von seinem natürlichen Element waren für das Schiff eine lange Zeit. Dieses Mal lief es nicht mit einer erfahrenen, wohldisziplinierten Besatzung aus, über die er vor sechzehn Monaten das Kommando übernommen hatte und von der die meisten schon seit vier Jahren an Bord gewesen waren. Innerhalb dieser Zeit konnte man auch von der stursten Landratte erwarten, daß sie ihren Platz gefunden und sich eingeordnet hatte. Aber diese Leute waren abgemustert worden, nicht für eine wohlverdiente Ruhepause, sondern um – den Bedürfnissen der ständig wachsenden Flotte entsprechend – anders verteilt zu werden. Und ihm waren nur einige Altgediente geblieben, die gebraucht wurden, um sich der schwierigen Reparaturarbeiten anzunehmen. In den vergangenen Wochen war die neue Besatzung aus jeder denkbaren Quelle zusammengestellt worden: von anderen Schiffen, dem Hafenadmiral und selbst den örtlichen Gerichtsgefängnissen. Auf eigene Kosten, wenn auch mit wenig Hoffnung, hatte Bolitho Handzettel verteilen lassen und zwei Rekrutierungskommandos auf die Suche nach neuen Leuten ausgeschickt. Und zu seiner großen Verwunderung waren über vierzig Männer aus Cornwall an Bord gekommen, meist Leute vom Land, von Bauernhöfen und aus Bergwerken, aber alle freiwillig.
Der Leutnant, der sie auf das Schiff brachte, war voller Komplimente und fast schon Ehrfurcht gewesen, denn es war wirklich selten, daß jemand das Leben an Land aufgab, um es gegen die strenge Disziplin und die Gefahren auf einem Kriegsschiff einzutauschen.
Bolitho konnte es noch nicht glauben, daß diese Männer tatsächlich unter ihm dienen wollten, einem Landsmann aus Cornwall, dessen Name in ihrer heimatlichen Umgebung bekannt war und bewundert wurde. Es hatte ihn verblüfft und nicht wenig gerührt.
Jetzt war dies alles schon Vergangenheit. Seine neue Besatzung, eingepfercht in den hundertachtzig Fuß langen Rumpf, wartete auf ihn, den Mann, der – gleich nach Gott – über ihr Leben bestimmen würde. Sein Urteil und sein Können, seine Tapferkeit und was sonst immer würden darüber entscheiden, ob sie lebten oder starben. Der Hyperion fehlten zu ihrer vollständigen Besatzung von sechshundert Mann immer noch fünfzig, aber das war in diesen schweren Zeiten nicht sehr viel. Die wirkliche Schwierigkeit stand in unmittelbarer Zukunft bevor, wenn er jeden einzelnen antreiben mußte, um sie alle zu einer disziplinierten Einheit zu verschmelzen.
Er wurde aus seinem Brüten aufgestört, weil die Tür hinter ihm aufging. Als er sich umdrehte, sah er seine Frau im Türrahmen stehen. Sie trug einen langen grünen Samtmantel, dessen Kapuze das volle, kastanienbraune Haar unverhüllt ließ, und ihre Augen glänzten so hell, daß er befürchtete, sie halte ihre Tränen gerade noch zurück.
Er ging auf sie zu und faßte sie bei den Händen. Es fiel ihm immer noch schwer, die glückliche Fügung zu fassen, die Cheney zu seiner Frau gemacht hatte. Sie war schön und zehn Jahre jünger als er, und als er jetzt auf sie niedersah, war ihm bewußt, daß der Abschied von ihr das Schwerste war, was ihm je bevorgestanden hatte. Bolitho war siebenunddreißig Jahre alt und fuhr seit seinem zwölften Lebensjahr zur See. In dieser Zeit hatte er sowohl Strapazen als auch Gefahren überlebt, und er empfand eine gewisse Verachtung für jene, die lieber sicher zu Hause blieben, statt auf einem Schiff des Königs zur See zu fahren. Seit fünf Monaten war er mit Cheney verheiratet, aber jetzt erst begriff er, wie schmerzlich ein solcher Abschied war.
Während der langwierigen Überholung seines Schiffes war Cheney nie weit von ihm entfernt gewesen. Das war für ihn neu und eine überwältigend glückliche Zeit gewesen, trotz der Sorge um das Schiff und der Arbeit, die ihn täglich in die Werft führte. Meistens hatte er die Nächte mit ihr im Gasthaus verbracht, und manchmal hatten sie weite Spaziergänge auf der Steilküste unternommen oder waren mit gemieteten Pferden bis tief ins Land nach Dartmoor geritten. Das ging so, bis sie ihm sagte, daß sie ein Kind erwartete; sie hatte über seine sofort bekundete, ritterliche Fürsorge gelacht.
»Deine Hände sind eiskalt«, sagte er.
Sie lächelte. »Ich war unten am Hafen und habe Allday gesagt, er soll die Sachen abladen, die ich für dich besorgt habe.« Wieder zitterten ihre Lippen leicht. »Denk daran, daß du jetzt verheiratet bist, Richard. Ich will nicht, daß mein Kapitän zur Bohnenstange abmagert, weil er nichts Gutes zu essen bekommt.«
Von der Treppe her hörte Bolitho Alldays diskretes Hüsteln. Wenigstens er würde bei ihm sein: sein Bootsführer, der Mann, der ihn besser als jeder andere kannte, ausgenommen sein Freund Herrick.
Schnell sagte er: »Und wirst auch du vorsichtig sein und auf dich aufpassen, Cheney?« Er drückte fest ihre Hände. »Wenn du nach Falmouth zurückkommst, wirst du dort viele Freunde haben, falls du etwas brauchst.«
Sie nickte, streckte die Hände aus und berührte die weißen Aufschläge seines Uniformrocks, ließ dann die Finger auf dem Knauf seines Säbels ruhen. »Ich warte auf dich, mein lieber Richard.« Sie schlug die Augen nieder. »Und auch falls du auf See bist, wenn unser Kind geboren wird, wirst du trotzdem bei mir sein.«
Alldays stämmmige Gestalt erschien neben der Türöffnung. »Das Boot wartet, Captain. Ich habe alles so verstaut, wie Ma’am befohlen hat.« Erblickte sie bewundernd an. »Und machen Sie sich keine Sorgen, Ma’am. Ich werde gut auf ihn aufpassen.«
Sie klammerte sich an Bolithos Arm und flüsterte: »Tue du das auch; ich bete zu Gott, daß er euch beide beschützt.«
Bolitho löste ihre Finger von seinem Arm und küßte sie sanft. Er fühlte sich elend und hätte gern Worte gefunden, die den Abschied leichter machten. Aber er wußte auch, daß es diese Worte nicht gab und nie gegeben hatte.
Er griff nach seinem goldbetreßten Hut und drückte ihn sich in die Stirn. Dann hielt er Cheney noch einmal für einige Sekunden mit seinem Blick fest, spürte ihren Schmerz, begriff ihren Verlust, und wandte sich dann ohne ein weiteres Wort ab und schritt zur Treppe.
Der Wirt verneigte sich, als Bolitho zur Haustür ging, sein rundes Gesicht war feierlich, als er intonierte: »Viel Glück, Captain, und bringen Sie ein paar Froschfesser für uns um.«
Bolitho nickte nur knapp und ließ sich von Allday den schweren Bootsmantel um die Schultern legen. Die Worte des Wirts waren bedeutungslos; wahrscheinlich sagte er dasselbe zu der endlosen Prozession der Kommandanten und Offiziere, die sich kurz unter seinem Dach aufhielten, ehe sie auf ihre Schiffe zurückkehrten, manche von ihnen zum letzten Mal.
Er erblickte sich in dem Wandspiegel neben der Glocke für den Hausdiener und sah, daß er die Stirn runzelte. Doch welch ein Unterschied zu dem Bild von vor sechs Monaten! Diese Erkenntnis veranlaßte ihn, sich ein paar Augenblicke zu betrachten. Die tiefen Falten um seinen Mund waren verschwunden, und seine große Gestalt wirkte entspannter, als er es in Erinnerung hatte. Sein schwarzes Haar war ohne eine Spur von Grau, trotz des Fiebers, das ihn zwischen den Kriegen beinahe umgebracht hatte, und die eine Locke, die ihm rebellisch über das rechte Auge hing, ließ ihn jünger erscheinen, als er war. Er bemerkte, daß Allday ihn beobachtete, und zwang sich zu einem Lächeln.
Allday stieß die Tür auf und griff grüßend an seinen Hut. »Mir kommt es sehr lange vor, seit wir auf See waren, Captain.« Er grinste. »Aber mir tut es nicht leid, daß wir auslaufen. Die Mädchen in Plymouth sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.«
Bolitho ging an ihm vorbei und spürte, daß der Regen ihm wie Eiskörner ins Gesicht schlug. Er beschleunigte seinen Schritt, während Allday ihm unbekümmert folgte. Das Schiff lag gut zwei Meilen vom Ufer entfernt, sowohl um den günstigen Wind und die Tide auszunutzen, aber auch um jeden, der Neigung dazu verspürte, vom Desertieren abzuhalten. Der Bootsbesatzung stand eine mühsame Arbeit bevor.
Oben an der Ufertreppe blieb Bolitho stehen, spürte den Wind, den festen Boden unter den Füßen, und wußte wie jedesmal, daß er vielleicht nie wieder Land betreten würde. Oder – schlimmer noch –, daß er auch als hilfloser Krüppel zurückkehren konnte wie so viele, die man in den Kneipen der Küstenstriche antraf, Mahner an einen Krieg, der ständig weiterging, auch wenn man nichts davon sah.
Bolitho drehte sich um und sah zu dem Gasthaus zurück, bildete sich ein, er könne Cheney hinter einem Fenster erkennen.
Dann sagte er: »Nun gut, Allday, rufen Sie das Boot längsseit.«
Sobald das Boot sich von der Pier gelöst hatte, schienen die Männer an den Riemen ihr Bestes zu geben, um die flach anlaufenden, schaumgekrönten Wellen rasch zu überwinden; Bolitho, fest in seinen Mantel gehüllt, wünschte sich, die gesamte Besatzung eines Schiffes sei so gut wie die Rudergasten in diesem Boot. Denn es war Bolithos ursprüngliche Bootsbesatzung; und in ihren weißen Hosen und karierten Hemden, mit ihren sauber geflochtenen Zöpfen und gebräunten Gesichtern entsprachen sie ganz der Vorstellung, die sich eine Landratte von britischen Seeleuten machte.
Das Boot arbeitete stärker im Seegang, je weiter es sich vom Land entfernte; Bolitho lehnte sich zurück, um sein Schiff zu beobachten, das langsam hinter sprühender Gischt und Nieselregen auftauchte, bis es mit aufragenden Masten und Rahen und den sauber festgemachten Segeln fast den Horizont verdeckte. Es war ein normaler Anblick, aber immer wieder wurde Bolitho davon beeindruckt. Früher einmal, als er – fast noch ein Kind – auf sein erstes Schiff kam, das etwa ebenso groß gewesen war wie die Hyperion, hatte es ihm weit mehr als nur gelinde Furcht eingeflößt. Jetzt mußte es den neu angemusterten Männern so erscheinen, dachte er, sowohl den Freiwilligen wie auch den aus einem gesicherten Leben an Land zur Marine gepreßten.
Allday schwang die Ruderpinne herum und steuerte das Boot unter dem hohen Bug des Schiffes durch, so daß die vergoldete Galionsfigur, der Sonnengott, seinen Dreizack unmittelbar über ihre Köpfe zu strecken schien.
Bolitho hörte das Trillern der Pfeifen und sah die bei der Schanzpforte bereits angetretenen Marinesoldaten in ihren scharlachroten Röcken, das Blau und Weiß der Offiziere und dahinter das Gedränge ihm noch unbekannter Gestalten.
Er fragte sich, was Inch, sein Erster Offizier, über diesen Augenblick vor dem Auslaufen denken mochte. Er fragte sich auch, was ihn veranlaßt haben mochte, diesen jungen Offizier zu behalten, da doch zahlreiche dienstältere Leutnants bereit waren, ein so begehrtes Kommando zu übernehmen. Der nach dem Kommandanten ranghöchste Offizier hatte immer eine Chance, konnte sogar hoffen, nach dem plötzlichen Tod seines Kommandanten oder dessen Aufstieg befördert zu werden.
Als Bolitho das Kommando über sein altes, mit vierundsiebzig Kanonen bestücktes Schiff übernommen hatte, fand er Inch als Fünften und jüngsten Offizier vor. Der Dienst auf See, fern vom Land und oft auch fern von der Flotte, hatte den jungen Leutnant Sprosse um Sprosse die Karriereleiter hinaufgeführt, als ein Offizier nach dem anderen gefallen war. Als der Erste Offizier sich das Leben nahm, hatte Bolithos Freund Herrick bereitgestanden, dessen Posten zu übernehmen; doch dann hatte Thomas Herrick im Rang eines Kapitäns das Schiff verlassen und ein eigenes Kommando bekommen. Damit hatte sich Leutnant Francis Inch – schlaksig, mit einem Pferdegesicht und immer einsatzwillig – eine Chance geboten. Aus Gründen, die Bolitho selbst nicht richtig durchschaute, war es ihm ermöglicht worden, sie wahrzunehmen. Doch bei dem Gedanken, zum erstenmal als Stellvertreter des Kommandanten das Schiff in Fahrt zu bringen, mochte ihn sein neuer Status mit Unbehagen und nicht geringer Besorgnis erfüllen.
»Boot ahoi?« Der übliche Anruf klang von der Bordwand des Schiffes herab.
Allday legte die Hände an den Mund. »Hyperion.«
Als die Riemen gehoben waren und der Buggast das Boot an der Kette anhakte, schüttelte Bolitho den Mantel ab, preßte seinen Säbel an die Hüfte und sprang schnell zur Schanzpforte hinauf. Ihm wurde nicht einmal die Luft knapp, und er fand sogar Zeit, bewundernd daran zu denken, was gute Ernährung und regelmäßiger körperlicher Einsatz für jemanden bewirken konnten, der sich an das bewegungsarme, beengte Bordleben gewöhnt hatte.
Als sein Kopf über dem Schanzkleid auftauchte, brachen die Pfeifen in ein schrilles Trillern aus, und er sah die zackige Bewegung der Musketen, als die angetretenen Marinesoldaten präsentierten.
Inch salutierte nervös. Seine Uniform war vom Regen durchnäßt, so daß Bolitho annahm, er hätte das Achterdeck seit Tagesanbruch nicht mehr verlassen. Der Lärm verebbte, und Inch sagte: »Willkommen an Bord, Sir.«
Bolitho lächelte. »Danke, Mr. Inch.« Er sah sich nach den zuschauenden Männern um. »Sie sind fleißig gewesen.«
Inch blickte zu der Bootsbesatzung hinunter und wollte sie schon anrufen, als Bolitho gedämpft sagte: »Nein, Mr. Inch. Das ist nicht mehr ihre Aufgabe.« Er bemerkte, wie Inch ihn überrascht ansah. »Überlassen Sie das Ihren Untergebenen. Wenn Sie Vertrauen zu ihnen haben, werden sie auch Ihnen vertrauen.«
Er hörte hinter sich schwere Schritte auf den feuchten Planken und drehte sich um. Gossett, der Steuermann, trat auf ihn zu. Gott sei Dank diente wenigstens der schon seit einigen Jahren an Bord.
Gossett war riesig und wuchtig wie eine Tonne und besaß ein Paar der hellsten Augen, die Bolitho je gesehen hatte, obwohl sie meist in seinem gefurchten und wettergegerbten Gesicht halb verborgen blieben.
»Keine Klagen, Mr. Gossett?«
Der Steuermann schüttelte den Kopf. »Keine, Sir. Ich habe immer gesagt, daß die alte Lady fliegen kann, wenn sie erst mal den Bewuchs los ist.« Er rieb die kräftigen roten Pranken aneinander. »Und fliegen wird sie, wenn ich was zu sagen habe.«
Die versammelte Besatzung drängte sich noch auf den Gangways und dem freien Raum an Deck. Die Gesichter waren blaß im Vergleich zu Gossett und Allday.
Dies hätte der Augenblick zu einer anfeuernden Ansprache sein sollen, die Gelegenheit, diese Männer, die ihm und untereinander noch fremd waren, zu einem Hurraruf zu bringen. Er hob die Stimme, um den Wind zu übertönen. »Wir wollen weiter keine Zeit verlieren. Unsere Befehle besagen, daß wir uns unverzüglich dem Blockadegeschwader vor Lorient anschließen sollen. Wir haben ein gutausgerüstetes Schiff mit einer ehrenvollen Geschichte und einer großen Tradition, und gemeinsam werden wir unser Bestes tun, um den Feind in seinen Häfen einzuschließen oder ihn zu vernichten, wenn er so verwegen sein sollte, sich herauszuwagen.«
Bolitho beugte sich vor und stützte die Hände auf die Achterdecksreling, als das Schiff sich schwerfällig hob. Es überraschte ihn, daß einige Männer sich einander tatsächlich bei seinen abgenutzten Worten grinsend in die Rippen stießen. In wenigen Monaten würden sie das wahre Elend des Blockadedienstes kennenlernen: Schutzlos und ohne frische Lebensmittel jedes Wetter durchzustehen, während die Franzosen es sich in ihren Häfen wohl sein ließen und gelassen auf eine Lücke in der Kette britischer Schiffe warteten, durch die sie ausbrechen, hart zuschlagen und sich wieder zurückziehen konnten, ehe es zu einem Gegenschlag kam.
Gelegentlich wurde ein Schiff abgelöst, um mit neuem Proviant versorgt zu werden oder wichtige Reparaturen vornehmen zu lassen; dann wurde sein Platz von einem anderen übernommen, wie jetzt durch die Hyperion.
In forschem Ton fügte Bolitho hinzu: »Es gilt, vieles zu vollbringen, und ich erwarte von jedem, daß er sein Bestes gibt, jede Aufgabe erfolgreich erfüllt, vor die er gestellt wird.« Hier schnitt ein Teil der älteren Leute Grimassen. Sie wußten, das bedeutete Geschützexerzieren und Segeldrill unter Aufsicht eines Offiziers mit der Uhr in der Hand, bis der Kommandant zufrieden war. Bei dieser Art Wetter keine angenehme Aufgabe, besonders nicht für Männer, die noch nie zur See gefahren waren.
Bolitho ließ den Blick zur anderen Seite des Achterdecks schweifen, wo Inch und die anderen vier Leutnants in einer Reihe an der Reling standen. In den hektischen Tagen bis zur Wiederindienststellung der Hyperion und danach hatte er zuwenig Zeit gefunden, seine neuen Offiziere kennenzulernen. Die drei jüngeren erschienen durchaus willig, sie waren aber noch sehr jung und besaßen wenig Erfahrung. Ihre Uniformen strahlten vor Neuheit, und ihre Gesichter waren so rosig wie die von Midshipmen[1]. Der Zweite Offizier jedoch, ein Mann namens Stepkyne, hatte sich als Steuermannsmaat an Bord eines Ostindienfahrers bewährt und den Weg in den Dienst des Königs gefunden, als er einem schwerfälligen Versorgungsschiff zugeteilt worden war. Es mußte ihn angestrengte Arbeit und viele bittere Erfahrungen gekostet haben, sein Offizierspatent zu erwerben; als er jetzt, gelassen mit dem Schiff schwankend, auf dem Achterdeck der Hyperion stand, konnte Bolitho die scharfen Linien um seinen Mund erkennen und einen Ausdruck, der an Mißgunst grenzte, als er den jungen Inch von der Seite ansah.
Hinter den Leutnants standen die sechs Midshipmen des Schiffes, auch alle sehr jung und offensichtlich aufgeregt über die Aussicht auf eine Reise, die für die meisten ihre erste war.
Hauptmann Dawson stand bei seinen Marinesoldaten, ein Mann mit wuchtigem Kinn und ohne Lächeln. An seiner Seite Leutnant Hicks, ein wendiger, aber ausdruckslos wirkender junger Mann. Bolitho biß sich auf die Lippen. Die Marinesoldaten waren ausgezeichnet bei Vorstößen an Land oder wenn es um Hauen und Stechen im Nahkampf ging, boten jedoch nur geringe Hilfe bei der Aufgabe, ein Linienschiff unter vollen Segeln in Fahrt zu halten.
Er spürte den Wind, der ihm um die Beine wehte, und fügte knapp hinzu: »Das ist einstweilen alles.« Er nickte Inch zu. »Treffen Sie Vorbereitungen zum Auslaufen.«
Bolitho entdeckte neben der Schanzpforte Joshua Tomlin, den Bootsmann, dessen scharfe Augen schnell die Männer in seiner Nähe musterten. Auch Tomlin gehörte zur ursprünglichen Besatzung: ein untersetzter, kräftig gebauter Mann, fast so breit wie groß und ungewöhnlich stark behaart. Wenn er lächelte, was er oft tat, zeigte er ein furchterregendes, fast irrsinniges Grinsen, da ihm die Vorderzähne vor vielen Jahren von einem herabstürzenden Block ausgeschlagen worden waren. Er war bekannt für seine Geduld und seine derbe gute Laune, selten bei Leuten in seiner Position. Aber es mußte selbst seine Duldsamkeit überfordern, bei dieser zusammengewürfelten neuen Besatzung die Ruhe zu bewahren, dachte Bolitho grimmig.
Wieder schrillten die Pfeifen, und die Decks erbebten unter stampfenden Füßen, als die Männer auf ihre Stationen rannten, angetrieben von den Tritten und Flüchen der ungeduldigen Unteroffiziere, die noch nicht einmal Zeit gefunden hatten, die Namen der Männer in ihren eigenen Gruppen zu lernen.
Bolitho griff nach Inchs Arm und zog ihn beiseite. »Der Wind hat um einen Strich gedreht.« Er sah vielsagend zum Wimpel im Masttopp auf. »Lassen Sie sofort Anker lichten, und schicken Sie Leute nach oben.« Seine Worte lösten auf Inchs Gesicht Erschrecken aus, deshalb fügte er ruhig hinzu: »Es ist besser, die neuen Leute jetzt nach oben zu schicken und auf den Rahen zu verteilen, ehe Sie weitere Befehle geben. Wir wollen doch nicht, daß die Hälfte von oben kommt, solange der Hafenadmiral uns noch durchs Fernrohr beobachtet, oder?« Er lächelte über Inchs Nicken.
Bolitho wandte sich ab, während Inch zur Achterdecksreling eilte und sein Sprachrohr schwenkte. Er hätte Inch gern geholfen, wußte aber, wenn dieser nicht von einem weiten und gefahrlosen Ankerplatz auslaufen konnte, würde er später nie das Selbstvertrauen aufbringen, selbständig zu handeln.
»Ankerspill bemannen!«
Gossett trat an Bolithos Seite und sagte gelassen: »Wir bekommen Schnee, ehe die Woche vorbei ist, Sir.« Er knurrte ungehalten, als einer der Männer im Vorschiff ausglitt und mit Armen und Beinen um sich schlagend hinstürzte. Ein Unteroffizier schlug mit seinem Tampen zu, und Bolitho sah, daß der verantwortliche Leutnant sich verlegen abwandte.
Er legte die Hände an den Mund. »Mr. Beauclerk! Die Leute halten viel besser Takt, wenn Sie ihnen ein Shanty vorspielen lassen.«
Gossett unterdrückte ein Grinsen. »Arme Kerle. Das muß ihnen alles sehr fremd sein, Sir.«
Bolitho atmete gepreßt aus. Inch hätte früher daran denken sollen. Bei den rund sechzehnhundert Tonnen der Hyperion, die am Ankerkabel zerrten, gehörte mehr als nur Muskelkraft dazu, das Ankerspill zu drehen. Die klagenden Töne der Fidel gingen im Wind fast verloren, doch als die Sperrklinke am Spill klickend faßte, rief Tomlin dröhnend: »Recht so, Leute! Wir wollen den Schlappschwänzen in Plymouth mal was zeigen, das sie so bald nicht vergessen sollen!«
Er warf den Kopf zurück und öffnete den Mund so weit, daß einer der dabeistehenden Midshipmen vor Schreck verstört keuchte, und stimmte dann ein wohlerprobtes Shanty an.
Bolitho blickte nach oben, um die Männer zu beobachten, die sich auf den dicken Rahen verteilten und sich schwarz und winzig wie Äffchen vom Himmel abhoben.
Er nahm von Gascoigne, dem für die Signale zuständigen Midshipman, ein Glas entgegen und richtete es aufs Ufer. Er spürte einen Kloß in der Kehle, als er in der Ferne ihren grünen Mantel erkannte und einen Flecken Weiß, mit dem sie dem Schiff zuwinkte. In Gedanken hatte er das Bild vor Augen, das Cheney sah: der Zweidecker, der an der bereits kürzer werdenden Ankertrosse schwojte, die Gestalten, die sich an die Rahen klammerten, die rege Tätigkeit auf dem Vorschiff, wo schon weitere Leute bei den Vorsegeln bereitstanden.
»Anker kurzstag, Sir.«
Bolitho fing Inchs Blick auf und nickte. Inch hob sein Sprachrohr. »Vorsegel setzen!«
Ein schneller Blick zu Gossett, aber dort gab es keinen Grund zur Sorge. Der Steuermann stand bei dem großen Doppelrad. Seine Augen wanderten zwischen den Rudergängern und den ersten Streifen Leinwand, die bereits im Wind knatterten, hin und her.
»Setzen Sie einen Kurs unter der Landzunge ab, Mr. Gossett. Wir wollen so hoch am Wind bleiben, wie es geht, für den Fall, daß er wieder umspringt.«
»Auf und nieder, Sir.« Der Zuruf ging im Wind beinahe unter.
Inch nickte und murmelte vor sich hin, während er auf dem Achterdeck hin und her ging.
»Marssegel setzen!« rief er gellend.
Die großen Segel blähten sich und donnerten wild, als vom Vorschiff der Ruf kam: »Anker ist los, Sir.«
Bolitho suchte Halt an einer Drehbasse, als die Hyperion, vom Land befreit, wie trunken durch ein tiefes Wellental glitt. Von oben ertönten ängstliche Schreie, aber keiner fiel herab.
»Achtung bei Leebrassen!« Das war Stepkynes Stimme, die mühelos das Brausen des Windes und Rauschen der Segel übertönte. »Der Mann da, halten Sie sich ran!« Er deutete wütend. »Notieren Sie seinen Namen.«
Klank, klank, klank ging das Ankerspill. Der noch unsichtbare Anker mußte unter der Wasseroberfläche wie ein Pendel hin- und herschwingen. Aber die Hyperion schien das Durcheinander und die wilden Bemühungen an Deck und in den Rahen nicht zu beachten. Sie zeigte einen Streifen blankes Kupfer, als sie im rauhen Seegang stark krängte, und schleuderte Gischt so hoch übers Vordeck, daß der funkelnde Titan aus der See selbst aufzutauchen schien.
Inch kam nach achtern und wischte sich das Gesicht. »Sir?«
Bolitho sah ihn ernst an. »Bringen Sie das Schiff auf Kurs.« Er blickte zu dem Wimpel auf, der steif wie eine Lanze fast querab wehte. »Wir werden die Bramsegel voll setzen, sobald wir Rame Head hinter uns haben.«
Der Rudergänger rief aus: »Südwest zu Süd, voll und bei, Sir!«
Bolitho spürte, wie das Deck sich stark neigte, als das alte Schiff den Wind voll aufnahm. Jetzt muß die Hyperion einen schönen Anblick bieten, ging es ihm flüchtig durch den Kopf: Marssegel und Großsegel prall gefüllt im trüben Licht, die Rahen rundgebraßt, um den Wind, der das verschwommene Grün der Halbinsel aufwühlte, mit größtmöglichem Vorteil zu nutzen.
Der Anker war jetzt aus dem Wasser und wurde bereits zum Kranbalken gehievt. Die Männer am Spill sangen noch immer; manche blickten über die Schulter zum Land zurück, das jetzt schnell im Dunst verschwand.
Wie viele Seeleute hatten schon so gesungen, während ihre Schiffe in den Kanal hinausglitten, wie viele an Land hatten ihnen nachgesehen, mit feuchten Augen oder hoffnungsvoll oder einfach nur dankbar, daß ihnen ein gleiches Geschick erspart geblieben war.
Als Bolitho sein Glas wieder aufs Land richtete, hatte es jede Individualität verloren. Wie Erinnerung und Hoffnung, die ihm galten, war es jetzt fern, so gut wie unerreichbar. Er sah einige der jüngeren Leute zum Ufer zurückstarren, einer winkte sogar, obwohl das Schiff von Land aus jetzt nahezu unsichtbar sein mußte.
Plötzlich dachte er an Herrick, der sein Erster Offizier auf der kleinen Fregatte Phalarope gewesen war. Bolitho runzelte die Stirn. Wann war das gewesen? Vor zehn, nein vor zwölf Jahren. Langsam schritt er an der Luvseite entlang, während seine Gedanken über die Jahre zurückwanderten. Thomas Herrick, der beste Untergebene, den er je gehabt hatte, und der beste Freund. Damals hatte er sich mehr als alles andere ein eigenes Kommando gewünscht – bis es Wirklichkeit geworden war. Bolitho lächelte bei der Erinnerung, und zwei Midshipmen, die ihn beobachteten, tauschten einen erstaunten Blick, weil ihr Kommandant anscheinend achtlos oder gleichgültig gegenüber Lärm und Hast auf und ab schritt.
Jetzt kommandierte Herrick sein eigenes Schiff. Besser spät als nie, und mehr als reichlich verdient, obwohl es nur die alte Impulsive mit vierundsechzig Geschützen war. Auch Herrick sollte zu dem Geschwader stoßen, sobald sein Schiff in Portsmouth überholt worden war.
Bolitho hörte Inch schimpfen, als ein neuer Mann mit dem Fuß an einem Lukensüll hängenblieb, gegen einen Steuermannsmaat taumelte und krachend auf das schwankende Deck stürzte.
Es fiel ihm schwer, sich vorzustellen, daß alles anders sein würde, wenn er Herrick wiedertraf. Dann waren sie zwei Kapitäne mit eigenen Problemen und ohne die verbindende Aufgabe, ein Schiff gemeinsam am Leben zu erhalten. Herrick hatte immer einen forschenden Verstand und ein intuitives Verständnis für Bolitho besessen.
Dieser schob die Gedanken nun von sich. Es war pure Selbstsucht, zu wünschen, daß Herrick bei ihm wäre. Er sah Inch an und fragte mild: »Sind Sie zufrieden?«
Inch blickte besorgt. »Ich – ich glaube schon, Sir.«
»Gut. Nun setzen Sie mehr Leute ein, um die Boote festzuzurren. Ich will verhindern, daß sie sich jammernd am Schanzkleid herumdrücken, solange England noch in Sicht ist.«
Inch nickte und grinste verlegen. »Es hat doch nicht schlecht geklappt, Sir, oder?« Unter Bolithos Blick schlug er die Augen nieder. »Ich – ich meine …«
»Sie wollen also wissen, was ich von Ihrer Leistung halte, Mr. Inch?« Bolitho bemerkte Gossetts zur Maske erstarrtes Gesicht. »Gut: In Anbetracht der Tatsachen, daß nur die Hälfte der Toppsgasten sich in Todesangst an die Rahen geklammert hat und daß die Masten im Fünfminutenabstand fertig wurden, würde ich sagen, für den Anfang mag es hingehen.« Er runzelte die Stirn. »Können Sie dem zustimmen, Mr. Inch?«
Inch nickte ergeben. »Aye, Sir.«
Bolitho grinste. »Nun, das ist schon etwas, Mr. Inch.«
Gossett rief: »Klar zur Kursänderung, Sir.«
Die Landzunge und auch der größte Teil der Küste war bereits im grauen Dunst verschwunden; der Wind wehte so stetig wie zuvor, fegte die Schaumkronen von den Wellen und überschüttete das Luvschanzkleid mit Sprühwasser.
»Bringen Sie das Schiff einen Strich höher an den Wind, Mr. Gossett. In vier Stunden wollen wir abfallen und mit achterlichem Wind segeln.« Er sah Gossetts Gesicht und nickte gutgelaunt. »Wir werden wohl bald reffen müssen, aber ich nehme an, Sie wollen erst sehen, wie das Schiff unter Vollzeug läuft.«
Bolitho drehte sich zu Inch um. »Ich gehe in meine Kajüte. Ich bin sicher, daß Sie mich im Augenblick nicht brauchen, wie?« Er wendete sich ab und ging schnell auf die Kampanje zu, ehe sein Erster Offizier antworten konnte. Inch hatte den ersten Teil recht gut hinter sich gebracht, und es war nur fair, ihm in offenem Wasser freie Hand zu lassen, ohne daß sein Kommandant über jede seiner Maßnahmen und Entscheidungen wachte. Und Gossett würde schnell eingreifen, wenn sich etwas Ernsthaftes ereignen sollte.
Er bemerkte, daß einige unbeschäftigte Matrosen ihn beobachteten, als er sich unter der Kampanje bückte und schnell zu seiner Kajüte ging. Erste Eindrücke waren von entscheidender Bedeutung, und er mußte völlig unbesorgt erscheinen, obwohl er seine Ohren anstrengte, um auf das Knarren der Wanten und Stage zu lauschen, während das Schiff sich fast gegen den Wind seinen Weg durch die Wogen bahnte. Gedämpft hörte er Tomlin bellen: »Nicht diese Hand! Deine rechte Hand, habe ich gesagt. Die, mit der du dir das Futter in den Mund stopfst!« Eine Pause. »Komm, laß es dir zeigen, du ungeschickter Tölpel!« Bolitho lächelte schief. Der arme Tomlin, für ihn hatte es schon angefangen.
Für den Rest des Vormittags und weit bis in die Nachmittagswache hinein lief die Hyperion stetig in den Kanal hinaus, die Rahen durchgebogen von dem stürmischen Landwind, in dem sie stark krängte. Bolitho verbrachte mehr Zeit auf dem Achterdeck, als er zunächst beabsichtigt hatte, da eine kritische Situation nach der anderen ihn aus seiner Kabine rief. Inch war es gelungen, die Bramsegel zu setzen, und unter der hohen Pyramide der geblähten Segel lag das Schiff in einem fast ständig gleichbleibenden Winkel, so daß die Arbeit in den Masten den Männern auf der Leeseite noch gefährlicher erscheinen mußte als vorher. Von der schwindelerregenden Höhe aus gesehen, schien das Schiff geschrumpft zu sein, und unter ihnen befand sich nichts als die zornig schäumenden und Gischt sprühenden Bugwellen von dem stampfenden Rumpf. Ein Mann hatte sich an die Bramrahe des Vormastes geklammert und war nicht dazu zu bringen, sich von der Stelle zu rühren. Oder richtiger, er konnte es nicht, denn seine Todesangst war größer als die Furcht vor dem wütenden Bootsmannsmaaten, der vom Mast her fluchte und drohte und nur zu deutlich die Beschimpfungen seines ranggleichen Kameraden vom Hauptmast mitbekam, die der zum Entzücken seiner verwegen balancierenden Toppsgasten über ihn ergoß.
Schließlich schickte Inch einen Midshipman nach oben, der schon mehrmals große Behendigkeit im Mast bewiesen hatte, um den unglücklichen Neuling herunterzuholen, und Boltiho kam gerade aus seiner Kabine, als die beiden, vor Erschöpfung keuchend, das Deck erreichten.
Leutnant Stepkyne brüllte wütend: »Dafür werde ich Sie auspeitschen lassen, Sie feiger Wicht!«
Bolitho rief: »Bringen Sie den Mann nach achtern.« Dann zu Inch: »Ich lasse nicht zu, daß ein Mann sinn- und zwecklos terrorisiert wird. Bestimmen Sie einen erfahrenen Mann, der sofort wieder mit ihm hinaufgeht.«
Als der Matrose unten an der Achterdecksleiter stand, fragte Bolitho: »Wie heißen Sie?«
Mit heiserer Stimme antwortete der Mann: »Good, Sir.«
Stepkyne hatte ungeduldig an seinem Gürtel gezerrt und schnell eingeworfen: »Das ist ein Tölpel, Sir.«
Gelassen fuhr Bolitho fort: »Hören Sie zu, Good. Sie müssen sofort wieder hinauf in den Mast, verstehen Sie?«
Verstört sah der Mann zu der Rahe am Vormast hinauf. Sie war mehr als dreißig Meter über Deck.
Bolitho fuhr fort: »Es ist keine Schande, Angst zu haben, aber es ist gefährlich, sie zu zeigen.« Er beobachtete die widerstreitenden Gefühle auf dem Gesicht des Matrosen. »Und jetzt hinauf mit Ihnen.«
Der Mann ging, und Inch sagte bewundernd: »Also, das war wirklich was, Sir.«
Bolitho hatte sich abgewendet, als der verängstigte Matrose in die vibrierenden Wanten hinaufkletterte. »Man muß Menschen führen, Mr. Inch. Es zahlt sich niemals aus, sie zu quälen.« Und zu Stepkyne hatte er hinzugefügt: »Uns fehlen immer noch Leute, und wir brauchen jeden einsatzfähigen Mann, den wir finden können. Diesen Mann bis zur Bewußtlosigkeit auspeitschen zu lassen, wäre doch sinnlos. Meinen Sie nicht auch?«
Stepkyne hatte die Hand an den Hut gelegt und war wieder nach vorn gegangen, um seine Leute zu überwachen.
Zu Inch hatte Bolitho hinzugefügt: »Es gibt keinen leichten Weg, hat es nie gegeben.«
Um sechs Glasen war es wieder an der Zeit zu halsen, und die ganze Geschichte begann von neuem. Benommen und zerschrammt, mit blutenden Fingern und von der Anstrengung gezeichneten Gesichtern wurden die neuen Leute auf die Rahen hinaus geführt oder gezerrt, um Segel zu reffen, denn der Wind frischte mit jeder Minute mehr auf, und obwohl das Land nur zehn Meilen querab lag, war es in Dunst und Gischt verborgen.
Bolitho zwang sich, schweigend an Deck zu stehen, während er die krampfhaften Bemühungen beobachtete, mit denen seine Befehle befolgt wurden. Immer wieder mußte manchen der Leute gezeigt werden, was sie tun sollten, mußten ihnen Leinen und Brassen in die Hände gedrückt werden, während Tomlin und seine Gehilfen von einem Durcheinander zum nächsten hasteten.
Schließlich schien dann sogar Gossett zufrieden zu sein, und während sich die Matrosen an den Brassen abmühten, wendete die Hyperion den Bug nach Süden; der Wind fegte jetzt mit solcher Gewalt über das Achterdeck, daß zwei zusätzliche Rudergänger eingesetzt werden mußten.
Aber das Schiff schien es zu genießen; obwohl nur noch die Marssegel gesetzt waren, neigte es sich, stieß seinen Bug in weit ausholenden Stößen dem unsichtbaren Horizont entgegen, während Woge um Woge gegen seine bauchigen Flanken anlief und sich hoch über seinem schwankenden Deck in einem Schauer wirkungsloser Gischt brach.
Bolitho griff in das ausgespannte Netz und blickte nach achtern, obwohl er wußte, daß es dort nichts zu sehen gab. Doch irgendwo hinter ihnen lagen die rauhe Küste von Cornwall und sein Heimatort Falmouth, knapp zwanzig Meilen entfernt im Westen. Das große Haus unterhalb des massigen Pendennis Castle würde auf Cheneys Rückkehr warten. Auf die Geburt ihres ersten Kindes, das er nun lange nicht zu Gesicht bekommen würde.
Wieder zischte und dröhnte eine Woge über die Luvgangway, und er hörte Gossett murmeln: »Bald werden wir ein zweites Reff brauchen, meine ich.«
Pfeifen schrillten, als die Wache schließlich unter Deck entlassen wurde, und Bolitho sagte: »Halten Sie mich informiert.« Dann verließ er selbst das Deck.
Die große Achterkajüte wirkte warm und freundlich nach dem windgepeitschten Deck. Die Lampen schwangen im Takt hin und her und warfen fremdartige Schatten über die grünen Ledersessel und die Sitzbank unter den Heckfenstern, den alten, polierten Schreibtisch und den Tisch, die im Lampenlicht wie neue Kastanien schimmerten. Er stand vor den breiten Fenstern und starrte hinaus auf das wildbewegte Panorama hochgehender Wellen und gespenstischer Gebilde aus Gischt. Dann setzte er sich seufzend an den Schreibtisch und blickte auf den Stapel Papiere, den ihm sein Schreiber zur Durchsicht vorgelegt hatte. Doch diesmal empfand er einen Widerwillen dagegen, und der Gedanke beunruhigte ihn.
Leise öffnete sich die Tür, und Allday kam in die Kajüte, seine stämmige Gestalt hielt sich in einem grotesken Winkel zum schrägen Deck.
Allday sah ihn bedrückt an. »Bitte um Entschuldigung, Captain, aber Petch, Ihr Diener, hat gesagt, Sie hätten noch nichts gegessen, seit Sie heute an Bord gekommen sind.« Er ignorierte Bolithos Stirnrunzeln. »Ich habe mir deshalb erlaubt, Ihnen etwas Wildpastete zu bringen.« Er hob eine Platte hoch, die mit einem silbernen Deckel bedeckt war. »Mrs. Bolitho hat sie mir extra für Sie gegeben, Captain.«
Bolitho protestierte nicht, als Allday die Platte auf den sich neigenden Schreibtisch stellte und sich um ein Besteck kümmerte. Wildpastete. Cheney mußte sie für ihn verpackt haben, als er sich morgens anzog.
Allday tat so, als ob er den Ausdruck auf Bolithos Gesicht nicht wahrnähme, und nutzte die Gelegenheit, Bolithos Säbel von einem Sessel zu nehmen und ihn an seinen Platz an der Schottwand zu hängen. Er schimmerte stumpf im Licht der schwankenden Lampen, und Allday sagte leise: »Ohne ihn wäre es nicht mehr so wie früher.«
Aber Bolitho antwortete nicht. Der Säbel, die Waffe seines Vaters und früher seines Großvaters, war so etwas wie ein Talisman und ein vieldiskutiertes Thema unter den Decks, wenn dort das Gespräch auf Bolithos Taten gebracht wurde. Der Säbel war ein Teil seiner Person, seines Herkommens und seiner Tradition, doch in diesem Augenblick konnte er an nichts anderes denken als an das, was er hinter sich zurückließ. Gerade jetzt würden die Pferde über die Straße nach Plymouth traben. Fünfzig Meilen bis Falmouth, wo sein Hausmeister und Diener Ferguson, der einen Arm vor den Saintes verloren hatte, darauf warteten, sie zu begrüßen. Über dem Klatschen der Gischt gegen die Scheiben der Fenster, dem Knarren der Planken und Balken und dem alles übertönenden Rauschen der Leinwand glaubte er, Cheneys Lachen zu hören. Vielleicht war es Einbildung, aber er spürte ihre Berührung, hatte den Geschmack ihrer Frische auf den Lippen.
Ohne auf Allday zu achten, knöpfte er sein Hemd auf und betrachtete das kleine Medaillon, das er um den Hals trug. Es enthielt eine Locke ihres Haars, war ein Talisman, besser als jede Waffe.
Die Tür öffnete sich, und ein durchnäßter Midshipman sagte atemlos: »Mr. Inchs Respekt, Sir, und er bittet um Erlaubnis, ein zweites Reff einzustecken.«
Bolitho erhob sich. Sein Körper übernahm das stetige Schwanken des Schiffs. »Ich komme sofort.« Dann sah er Allday an und lächelte flüchtig. »Wir haben wenig Zeit für Träume, wie es scheint.« Er folgte dem begierigen Blick des Midshipman und fügte hinzu. »Und auch keine für Wildpastete.«
Allday blickte ihm nach und setzte dann den silbernen Deckel wieder auf die Platte.
So wie jetzt hatte er den Kommandanten noch nie erlebt und war darüber beunruhigt. Er sah zu dem Säbel hinüber, der an seinem Haken pendelte, hatte wieder vor Augen, wie die Klinge im Sonnenlicht funkelte, als Bolitho die französische Batterie bei Cozar erstürmte, auf den blutbedeckten Planken eines feindlichen Schiffes angriff, so viele Taten so viele Male begangen hatte. Doch jetzt schien Bolitho verändert zu sein, und Allday verfluchte den Mann, der die Hyperion bei der Blockade eingesetzt und nicht an einen Ort geschickt hatte, wo gekämpft wurde.
Er dachte auch an die Frau, die Bolitho geheiratet hatte. Zum erstenmal waren die beiden sich an Bord dieses Schiffes begegnet. Er blickte sich um, und es fiel ihm schwer, es zu glauben. Vielleicht war es das, was fehlte. Cheney Seton war ein Teil des Schiffes gewesen, hatte die Gefahren und die Schrecken gekannt, wenn der alte Rumpf unter einer Breitseite erbebte und dem alles niedermähenden Wind des Todes. Auch Bolitho würde daran denken, davon war er überzeugt. Daran denken und sich daran erinnern, und das war schlecht.
Allday schüttelte den Kopf und ging auf die Tür zu. Es war schlecht einfach deswegen, weil sie alle mehr denn je zuvor von ihm abhingen. Ein Kommandant hatte niemanden, der ihm seine Schuld abnahm, wenn er versagte.
Er ging an dem Wachposten vorbei und kletterte durch eine enge Luke. Eine Plauderei und ein Glas mit dem Segelmacher könnte ihm über seine Befürchtungen hinweghelfen, hoffte er. Aber er war sich dessen nicht sicher.
II Unter dem Kommodorestander
Richard Bolitho beendete die Eintragung ins Logbuch und lehnte sich müde in seinem Sessel zurück. Selbst in der geschützten Kajüte war die Luft kalt und feucht, und der Lederbezug seines Schreibtischstuhls fühlte sich klamm an. Das Schiff hob sich, hielt inne und taumelte dann in einer ungestümen, korkenzieherartigen Bewegung vorwärts, bei der selbst Nachdenken zu einer bewußten Willensanstrengung wurde. Er wußte aber, wenn er wieder auf das vom Wind überfegte Achterdeck zurückging, würde er für nicht mehr als nur wenige Minuten Frieden finden.
Er starrte durch die dicken Scheiben der Heckfenster. Sie waren aber so von Salz verkrustet und mit herabrinnendem Sprühwasser bedeckt, daß man nur gerade noch den Tag von der Nacht unterscheiden konnte. Es war kurz vor der Mittagsstunde, aber es konnte jede andere Tageszeit sein. Der Himmel war entweder schwarz und zeigte keine Sterne oder war schiefergrau wie jetzt. Und so war es Tag für Tag gewesen, während die Hyperion weiter und weiter nach Südosten segelte und tiefer in die Biskaya vorstieß.
Er war auf die Beschwerlichkeiten und die Langeweile des Blockadedienstes durchaus vorbereitet, und als am zweiten Tag nach dem Auslaufen von Plymouth der Ausguck im Mast die Schiffe des Geschwaders gesichtet hatte, war er bereits entschlossen, aus allem das Beste zu machen. Aber wie er nach fast fünfundzwanzig Dienstjahren auf See hätte wissen müssen: bei der Marine konnte man sich auf nichts mit Sicherheit verlassen.
Seine Befehle besagten, daß er sich dem Kommando von Vizeadmiral Sir Manley Cavendish unterstellen und seinen Platz mit all den anderen wettererprobten Schiffen bei der ständigen Bewachung einnehmen sollte, die über das Geschick von England und damit der gesamten Welt entscheiden konnte. Vor jedem französischen Hafen überstanden diese Schiffe Stürme oder kreuzten unermüdlich in ihrer kein Ende nehmenden Patrouille auf und ab, während dichter unter der Küste und manchmal sogar in Reichweite feindlicher Batterien schlanke Fregatten, die Augen der Flotte, jede Schiffsbewegung meldeten. Sie sammelten Informationen von aufgebrachten Küstenfahrzeugen oder segelten bei ihrer unaufhörlichen Suche nach Nachrichten verwegen fast in die französischen Häfen selbst hinein.
Seit Howes Sieg an jenem glorreichen 1. Juni hatten die Franzosen wenig Neigung zu einem weiteren großen Zusammenstoß gezeigt, aber wie jeder andere denkende Offizier hatte Bolitho erkannt, daß diese bedrückende Tatenlosigkeit nicht ewig dauern konnte. Nur der Kanal trennte den Feind von einer Invasion Englands, doch bis die Franzosen eine starke Invasionsflotte aufgestellt hatten, war dieser Wasserstreifen so gut wie ein Ozean.
In den großen Kriegshäfen Brest und Lorient konnten sich die französischen Linienschiffe nicht regen, ohne von den kreuzenden Fregatten beobachtet und gemeldet zu werden, während in jedem anderen Hafen an der Westküste bis hinunter nach Bordeaux andere Schiffe warteten und auf eine Chance lauerten, sich davonzuschleichen und sich schnell den anderen Streitkräften im Norden anzuschließen. Bald würde es soweit sein, daß sie einen Ausbruch versuchten. Wenn das geschah, war es lebenswichtig, daß die Nachrichten über die Bewegungen des Feindes schnell die schweren Geschwader erreichten und, wichtiger noch, richtig gedeutet wurden, damit Maßnahmen ergriffen wurden, sie zu stellen und zu vernichten.
Schweigend hatte Bolitho in Lee des Flaggschiffes verharrt und beobachtet, wie die Flaggen zur Rah des mächtigen Dreideckers aufstiegen und Midshipman Gascoigne mit seinen Signalgasten sich verzweifelt abmühte, mit den Bestätigungen nachzukommen. Bei dieser Gelegenheit hatte er den ersten Hinweis darauf erhalten, daß nicht alles so war wie erwartet.
Gascoigne hatte geschrien: »Flaggschiff an Hyperion: Halten Sie sich bereit, Befehle und Depeschen zu übernehmen!«
Inch schien eine Frage stellen zu wollen, zog es aber dann vor, zu schweigen. Die beiden ersten Tage nach dem Auslaufen von Plymouth waren schwer für ihn gewesen. Innerhalb weniger Stunden nachdem sie nach Süden abgedreht hatten, war der Wind zu annähernd Sturmstärke angewachsen. Unter gerefften Marssegeln und bei einer wilden, achterlich anlaufenden See, die das Schiff schwanken und wie betrunken von einem Wellental ins nächste taumeln ließ, war Inch einem Chaos von Fragen und Forderungen von allen Seiten ausgesetzt gewesen. Viele der neuen Leute waren seekrank und fast hilflos, und die meisten anderen waren ständig bei der Arbeit, Tauwerk zu spleißen, das wie alles neue Tauwerk die erste wirkliche Belastungsprobe nur schlecht bestand, und die übrigen wurden ständig hin und her geführt oder getrieben, entweder zum Trimmen der Segel oder zu der knochenbrechenden Arbeit an den Lenzpumpen.
Mehr als einmal hatte es Bolithos ganze Selbstbeherrschung erfordert, nicht in Inchs Tätigkeit einzugreifen, aber es war ihm auch nur zu klar bewußt, daß die Schuld allein bei ihm selbst zu suchen war. Für diese Arbeit war Inch noch zu unerfahren, das war jetzt ganz unverkennbar, doch wenn Bolitho jetzt sein Mißfallen zeigte, mochte es Inch völlig fertigmachen. Nicht, daß Bolitho auch nur ein Wort zu sagen brauchte. Inchs unglückliches Gesicht verriet, daß er sich seiner Unzulänglichkeit selbst nur zu bewußt war.
Das nächste Signal vom Flaggschiff war kurz gewesen: »Halten Sie sich bereit, den Flaggkapitän zu empfangen.«
Das übliche war, daß Kommandanten sich persönlich meldeten, um neue Befehle zu empfangen, wenn sie zu einem Geschwader stießen, obwohl in Fällen von wirklich schlechtem Wetter es vorkam, daß der wasserdicht versiegelte Beutel an einer Wurfleine von Schiff zu Schiff befördert wurde. Doch diesmal schickte der Admiral seinen Kapitän.
Das Boot, das den Kommandanten des Flaggschiffs über das kabbelige Wasser brachte, war beinahe vollgelaufen, als es schließlich an den Ketten festmachte. Der untersetzte Offizier in seinem durchnäßten Bootsmantel gönnte dem Empfangskommando und den salutierenden Marinesoldaten kaum einen Blick, als er Bolithos ausgestreckte Hand ergriff und grollend sagte: »Gehen wir um Gottes willen unter Deck.«
Sobald der Besuch die große Kajüte betreten hatte, kam er sofort zur Sache.
»Ich bringe Ihnen neue Befehle, Bolitho. Sie werden weiter nach Südost segeln und sich dem vor der Küste operierenden Geschwader von Kommodore Mathias Pelham-Martin anschließen. Der Admiral hat ihn mit seinen Schiffen vor einigen Wochen zum Dienst vor der Gironde-Mündung detachiert. In Ihren neuen Befehlen werden Sie eine vollständige Liste der Schiffe und ihrer Aufgaben finden.«
Er hatte schnell, beinahe beiläufig gesprochen, aber Bolitho fühlte sich instinktiv gewarnt. Pelham-Martin. Der Name war ihm zwar durchaus vertraut, dennoch vermochte er sich an keinen Marineoffizier zu erinnern, sei es ein Kommodore oder ein anderer Rang, der sich so sehr ausgezeichnet oder auch blamiert hatte, um diesen besonderen Besuch des Flaggkapitäns zu rechtfertigen.
Unvermittelt sagte der Besucher: »Ich täusche nicht gern jemanden, schon gar nicht einen Kameraden im gleichen Rang. Das Verhältnis zwischen dem Admiral und dem Kommodore ist sehr gespannt. Wie Sie feststellen werden, ist Pelham-Martin ein Mann, unter dem zu dienen in gewisser Weise schwierig ist.«
»Und wie ist es zu diesen Spannungen gekommen?«
»Das liegt wirklich schon sehr lange zurück. Während der amerikanischen Revolution …«
Bolitho hatte es plötzlich alles klar vor Augen. »Jetzt erinnere ich mich. Ein britischer Infanterieoberst ergab sich mit all seinen Leuten den Amerikanern, und als einige unserer Schiffe mit Verstärkung eintrafen, liefen sie direkt in eine Falle.«
Der Flaggkapitän schnitt eine Grimasse. »Dieser Oberst war der Bruder von Pelham-Martin. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wer der Offizier war, der die Schiffe befehligte, oder?«
In diesem Augenblick erschien ein Midshipman. »Signal vom Flaggschiff, Sir: Kommandant sofort zurück an Bord.«
Bolitho verstand in diesem Augenblick vollkommen, was dieser Besuch für ihn und sein Schiff bedeutete. Kein Admiral konnte gegenüber einem Kommandanten, der seinem Geschwader neu zugeteilt worden war, sein Mißtrauen laut werden lassen. Aber durch einen gleichrangigen Kameraden konnte er Unbehagen und Unsicherheit zu erkennen geben.
Der Flaggkapitän blieb unter der Kajütentür stehen. Sein Blick war forschend.
»Ich kenne Ihre Karriere, Bolitho, und Sir Manley Cavendish kennt sie auch. Als die Nachricht eintraf, daß Sie zu dem Geschwader stoßen würden, sagte er zu mir, daß Sie in den Abschnitt von Pelham-Martin im Südosten geschickt werden sollten. Die Rolle, die Sie im vergangenen Jahr bei der Invasion von St. Clar gespielt haben, ist in guter Erinnerung, wenn Sie dafür auch nur denkbar wenig Anerkennung gefunden haben. Das Geschwader des Kommodore ist klein, aber seine Leistungen und seine Wachsamkeit könnten sich als lebenswichtig erweisen. Ihre Einsicht und Ihre Anwesenheit könnten dazu beitragen, daß diese dumme Fehde ein Ende findet.« Er hob zweifelnd die Schultern. »Das bleibt selbstverständlich unter uns. Falls mir auch nur ein Wort zu Ohren kommen sollte, daß eine Andeutung von Mißtrauen oder Unfähigkeit erfolgt sei, werde ich das natürlich mit allem Nachdruck bestreiten.« Und dann verließ er nach einem weiteren kurzen Händedruck das Schiff.
Als Bolitho später an seinem von Papieren bedeckten Schreibtisch saß, fiel es ihm schwer zu glauben, daß durch diese persönlichen Spannungen die Leistungsfähigkeit der hart bedrängten Schiffe und ihrer erschöpften Besatzungen Gefahr lief, beeinträchtigt zu werden. Diese Begegnung mit dem Flaggschiff lag nun vier Tage zurück, und während die Hyperion weiter nach Südosten vordrang und ihre Besatzung halbherzig gegen Seekrankheit und schlechtes Wetter ankämpfte, hatte Bolitho seine Befehle sorgfältig studiert und bei seinen einsamen Gängen auf dem Achterdeck versucht, ihre wahre Bedeutung zu ergründen.
Offenbar standen drei Linienschiffe und drei Fregatten unter Pelham-Martins Kommando sowie zwei kleine Schaluppen. Eins der Linienschiffe sollte zur Überholung und Reparatur nach England geschickt werden, sobald die Hyperion seinen Platz übernehmen konnte. Es war wirklich eine sehr kleine Streitmacht.
Doch wenn sie in der richtigen Position eingesetzt wurde, konnte sie sehr gut jede plötzlich erfolgende Bewegung feindlicher Fahrzeuge überwachen. Es war bekannt, daß mehrere große französische Schiffe Gibraltar unbemerkt passiert und bereits den Weg in die Biskaya gefunden hatten. Ebenso war bekannt, daß Spanien gegenwärtig zwar ein Verbündeter Englands war, es aber mehr dem Zwang der Notwendigkeit als echter Freundschaft oder Bereitschaft zur Kooperation folgte. Viele dieser Schiffe mußten dicht unter der Küste Spanien umsegelt oder manche mochten sich sogar in spanischen Häfen verborgen haben, um dem Angriff durch britische Patrouillen zu entgehen. Um sich dem Gros der französischen Flotte anzuschließen, würden diese Schiffe wahrscheinlich versuchen, die Gironde oder La Rochelle zu erreichen, um dort ihre Befehle auf dem Landweg zu erhalten, und dann die erste Gelegenheit wahrnehmen, um dicht unter der Küste nach Lorient oder Brest zu gelangen.
An die Tür wurde geklopft, und Midshipman Gascoigne trat über die Schwelle. »Mr. Stepkynes Respekt, Sir, und wir haben gerade ostwärts ein Segel gesichtet.«
»Sehr gut. Ich komme sofort.«
Bolitho sah, wie die Tür sich wieder schloß, und rieb sich nachdenklich das Kinn. Wie immer die Dinge auch liegen mochten, er würde jetzt nicht mehr lange auf eine Aufklärung zu warten haben.
Langsam stand er auf und griff nach seinem Hut. Er spürte das Amulett unter dem Hemd an seiner Brust, und plötzlich dachte er an Cheney. Er hatte ihr einen Brief geschrieben und ihn dem Flaggkapitän mitgegeben, zur Weiterleitung mit dem nächsten Schiff, das einen Heimathafen anlief. Er hatte keine Zeit mehr gehabt, irgend etwas darin zu ändern, und sie würde glauben, daß er unverändert vor Lorient kreuzte. Aber zweihundert Meilen mehr oder weniger spielten auch keine Rolle, ging ihm flüchtig durch den Kopf.
Als er auf das Achterdeck hinaustrat, bemerkte er, daß die Offiziere in steifer Verlegenheit Haltung annahmen, und vermutete, daß sie vor seinem Erscheinen wahrscheinlich in eine heftige Diskussion über das ferne Schiff vertieft gewesen waren.
Bolitho blickte zu den straff geblähten Segeln und der flatternden Zunge des Wimpels an der Mastspitze hinauf. Das Leinen war steif vor Nässe und Salz, und einen Augenblick empfand er Mitleid mit den Männern, die hoch oben über dem schwankenden Rumpf arbeiteten. Der Wind kam beinahe unmittelbar von achtern, und die See hatte sich zu einem zornigen Panorama kurzer steiler Wogen verändert, deren Schaumköpfe in dem grellen Licht wie gierig gebleckte Raubtierfänge wirkten. Der Horizont war kaum auszumachen, und obwohl sie sich nach seiner Schätzung etwa zwanzig Meilen vor der Küste befanden, war von ihr nichts zu sehen.
Von einem Midshipman nahm er ein Glas entgegen und stützte es gelassen auf das ausgespannte Netzwerk. Er wußte, daß die anderen ihn genau beobachteten, um seine Reaktionen zu erkennen und daraus vielleicht ihr eigenes Geschick zu erraten, aber sein Gesicht blieb ausdruckslos, als er die erste verschwommene Segelpyramide ins Blickfeld bekam. Er bewegte das Glas ein wenig und wartete, als die Hyperion in ein tiefes Wellental glitt und gleich darauf unbeeindruckt in eine weitere anrollende, schaumgekrönte Woge stieß. Dort war ein zweites Schiff und womöglich ein drittes.
Mit einem Schnappen schob er das Glas zusammen. »Legen Sie das Schiff auf Steuerbordbug und machen Sie sich zum Segelreffen bereit, Mr. Stepkyne.«
Stepkyne griff an seinen Hut. »Aye, aye, Sir.« Er sagte selten viel, es sei denn, er konnte einen ungeschickten oder unaufmerksamen Matrosen heruntermachen. Er schien nicht willens oder unfähig zu sein, ein vertrauliches oder beiläufiges Gespräch mit seinen Offizierskameraden zu führen, doch Bolitho wußte jetzt ebensowenig von ihm wie bei ihrer ersten Begegnung. Trotz allem war er ein sehr fähiger Seemann, und Bolitho war es nicht möglich gewesen, bei irgendeiner Arbeit, die er ausgeführt hatte, einen Mangel festzustellen.
Selbst jetzt, als er mit lauter Stimme Befehle austeilte und mit in die Hüften gestemmten Händen beobachtete, wie die Leute wieder einmal angetrieben wurden, die Brassen und Fallen zu bemannen.
Bolitho vertrieb Stepkynes kalte Tüchtigkeit und Inchs krampfhafte Bemühungen aus seinen Gedanken. Sobald das Wetter besser wurde, wenn auch nur für wenige Tage, würde Inch die Chance bekommen, die Leute zu drillen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Er sagte knapp: »Kurs Ost zu Süd, Mr. Gossett.«
Die Stimme des Ausgucks im Mast drang schwach über das Rauschen der Leinwand. »Drei Linienschiffe unter Vollzeug, Sir.« Es folgte eine Pause, während der jeder nicht Beschäftigte zu der winzigen Gestalt hinaufspähte, die sich vor den ziehenden Wolken abhob. »Das vorderste Schiff führt einen Kommodorestander, Sir.«
Ein Schuh scharrte auf dem Deck, und Bolitho sah Inch auf sich zueilen, dem ein paar Zwiebackkrümel auf dem Rock hingen.
Inch griff an seinen Hut. »Tut mir leid, daß ich so spät komme, Sir.« Er blickte sich besorgt nach allen Seiten um. »Ich muß einen Augenblick eingeschlafen sein.«
Bolitho betrachtete ihn ernst. Wegen Inch mußte er etwas unternehmen, dachte er. Er sah völlig übermüdet aus und hatte dunkle Ringe unter den Augen.
Ruhig sagte er: »Rufen Sie alle Mann an Deck, Mr. Inch. Wir werden gleich das Geschwader erreichen und müssen vielleicht wenden oder beidrehen.« Er lächelte. »Ein Kommodore ist nicht anders als ein Admiral, wenn es um seemännisches Können geht.«
Aber Inch nickte nur düster. »Aye, aye, Sir.«
Langsam, aber unaufhaltsam tauchten die Schiffe aus dem wogenden Dunkel auf, bis sie in einer Reihe sichtbar waren. Die Rümpfe glänzten vor Nässe, die gerefften Marssegel schimmerten wie Stahl in dem böigen Wind. Sie waren alle Vierundsiebziger wie die Hyperion, und in den Augen einer Landratte mochten sie sich wie ein Ei dem anderen gleichen. Aber Bolitho wußte aus mühsam erworbener Erfahrung, daß selbst Schiffe, die nebeneinander auf derselben Werft vom Stapel gelaufen waren, einander so unähnlich sein konnten wie Wasser und Wein, ganz wie es ihren jeweiligen Kommandanten in den Sinn kam.
Gossett, der den führenden Zweidecker prüfend betrachtete, sagte nachdenklich: »Das Schiff des Kommodore kenne ich, Sir. Es ist die Indomitable unter Kapitän Winstanley. Anno 1881 habe ich neben ihr gekämpft.« Er blickte Midshipman Gascoigne streng an.
»Sie hätten sie früher entdecken und melden müssen, junger Mann.«
Mit zusammengekniffenen Augen studierte Bolitho das führende Schiff, während sich unter dessen Signalrahe weitere Flaggen entfalteten; anscheinend nur Sekunden später setzte die ganze Formation zu einer Wende an, bis die Indomitable beinahe parallel, mit kaum zwei Kabellängen Abstand, neben der Hyperion herlief. Selbst ohne Glas waren die breiten Streifen von verkrustetem Salz und abgelagertem Schlick an Vorschiff und Bug zu erkennen, als sich das Schiff gewichtig in ein flaches Wellental senkte, wobei die unteren Geschützpforten einen Augenblick überspült wurden. Hinter sich hörte Bolitho Gossett vor sich hin murmeln: »Captain Winstanley hat die alte Dame gut im Griff, das muß man ihm lassen.« Aus seinem Mund war das ein Lob höchster Ordnung.
Diesmal war Gascoigne auf der Hut. Als weitere Signale zur Rah der Indomitable aufstiegen und sich im Wind entfalteten, schrie er gleich: »Flaggschiff an Hyperion: Kommandant ohne Verzug an Bord melden.«
Bolitho lächelte grimmig. Zweifellos wartete der Kommodore ungeduldig darauf, was sein alter Widersacher zu sagen hatte.