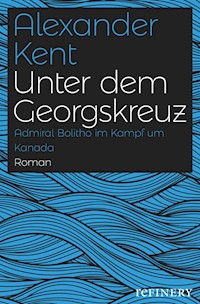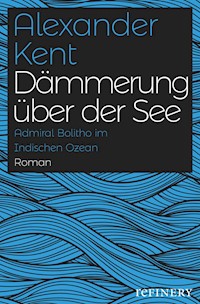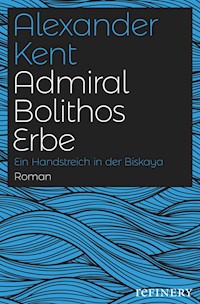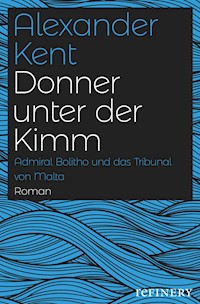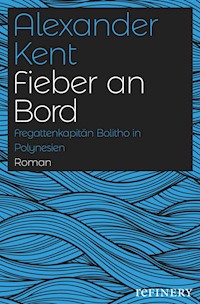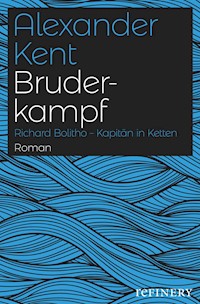6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
September 1800: England führt mittlerweile im siebten Jahr Krieg gegen Napoleon und dessen Verbündete. In unzähligen Auseinandersetzungen auf See hat sich Richard Bolitho längst einen legendären Ruf erkämpft. Zum Konteradmiral befördert, soll er deshalb nun als Flaggoffizier mit seinem Geschwader in der Ostsee gleichzeitig gegen die Dänen, Russen sowie die Franzosen operieren. Für ihn die härteste Bewährungsprobe seines bisherigen Dienstes in der Royal Navy …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
„Alexander Kent’s ‚Galeeren in der Ostsee‘ - A historical novel about Bolitho’s naval conflict with Copenhagen.“
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester.Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
September 1800: England führt mittlerweile im siebten Jahr Krieg gegen Napoleon und dessen Verbündete. In unzähligen Auseinandersetzungen auf See hat sich Richard Bolitho längst einen legendären Ruf erkämpft. Zum Konteradmiral befördert, soll er deshalb nun als Flaggoffizier mit seinem Geschwader in der Ostsee gleichzeitig gegen die Dänen, Russen sowie die Franzosen operieren. Für ihn die härteste Bewährungsprobe seines bisherigen Dienstes in der Royal Navy …
Alexander Kent
Galeeren in der Ostsee
Konteradmiral Bolitho vor Kopenhagen
Roman
Aus dem Englischen vonFritz Wentzel
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei RefineryRefinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin August 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© der deutschen Erstausgabe: Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1980© Bolitho Maritime Productions Ltd., 1978Titel der englischen Originalausgabe: The Inshore Squadron Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Die Auserwählten
II Das Flaggschiff
III Der Brief
IV Die
Ajax
V Zuversicht
VI Schnell geschafft
VII Klar Schiff zum Gefecht
VIII Ausgetrickst
IX Banges Warten
X Traumgebilde
XI Eine alte Rechnung
XII Liebe und Haß
XIII Noch drei Minuten zu leben
XIV Belinda
XV Gebannte Geister
XVI »Alle anderen sind tot!«
XVII Das Hauptziel
Epilog
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
I Die Auserwählten
Widmung
Für Winifred in Liebe
Motto
Ein nebliger Morgen im frühen April;gespenstisch gleiten die Schiffe voran.Da schlägt eine Glocke vier Glasen an.Auf einmal ist’s rundherum totenstill,und auch der Kühnste hält einen Augenblick den Atem an.
The Battle of the Baltic
von Thomas Campbell
I Die Auserwählten
Admiral Sir George Beauchamp streckte seine dürren Hände dem prasselnden Kaminfeuer entgegen und rieb die Innenflächen langsam gegeneinander, um die Blutzirkulation zu beleben.
Seine kleine, etwas gebückte Gestalt wirkte in dem schweren Uniformrock mit den großen goldenen Epauletten zerbrechlich, aber in seinem Wesen und dem Ausdruck seiner Augen war keine Schwäche zu entdecken.
Die Fahrt von London nach Portsmouth im Herbstregen und auf tief ausgefahrenen Straßen war lang und ermüdend gewesen. Und die eine Nacht, die Beauchamp sich im George Inn am Portsmouth Point ausruhen wollte, war durch einen heftigen Sturm gestört worden, der selbst den Solent mit weißen Wellenköpfen bedeckt hatte und alle Schiffe – mit Ausnahme der größten – irgendwo unter Land Schutz suchen ließ.
Beauchamp wandte dem Feuer den Rücken zu und musterte seinen Privatraum, denselben, den er immer bezog, wenn er nach Portsmouth kam, wie viele bedeutende Admirale vor ihm. Der Sturm hatte nachgelassen, und die dicken Glasfenster glänzten wie Metall im warmen Sonnenlicht, eine Täuschung, denn auf der anderen Seite der soliden Wände war es kalt und nahezu schon winterlich.
Der kleine Admiral stieß einen tiefen Seufzer aus, was er sich nie erlaubt hätte, wenn jemand bei ihm gewesen wäre. Es war Ende September des Jahres 1800 und England im siebten Kriegsjahr mit Frankreich und dessen Verbündeten.
Manchmal schon hatte Beauchamp seine Altersgenossen beneidet, die sich auf allen Weltmeeren mit ihren Flotten, Geschwadern, Flottillen herumtrieben. Aber bei einem Wetter wie diesem war er mehr als zufrieden mit seinem Posten in der Admiralität, wo sein scharfer Verstand ihm viel Anerkennung als Planer und Stratege eingebracht hatte. Beauchamp hatte mehr als einen Flaggoffizier seines Postens enthoben und anderen, jungen Leuten, deren Fähigkeiten und Erfahrungen bisher übersehen worden waren, sein Vertrauen geschenkt.
Sieben Jahre Krieg. Er wendete den Gedanken im Geiste noch einmal hin und her. Es hatte Siege und Niederlagen gegeben, tapfere Männer und Narren, Meutereien und Triumphe. Gute Schiffe hatte man nahezu verschrotten lassen, bis der Feind unmittelbar vor den Toren stand. Beauchamp hatte es alles miterlebt. Und er hatte neue Führergestalten emporsteigen gesehen, die die Stelle der Versager und Tyrannen einnahmen: Collingwood und Troubridge, Hardy und Saumarez, und Horatio Nelson natürlich, der Liebling des Volkes.
Beauchamp gedachte seiner mit einem dünnen Lächeln. Nelson – das war ein Mann, wie das Land ihn brauchte, die Personifikation des Sieges. Aber er konnte sich nicht vorstellen, daß der Held vom Nil es am Schreibtisch in der Admiralität aushalten würde, so wie er: bei endlosen Sitzungen, die Ängste des Königs und der Parlamentarier zerstreuend, die Zaghaften zu entschlossenem Handeln antreibend. Nein, entschied er, Nelson würde keinen Monat in Whitehall durchhalten, nicht länger jedenfalls als er, Beauchamp, an Bord eines Flaggschiffs. Beauchamp war über sechzig und sah auch so aus. Manchmal fühlte er sich noch viel älter.
Es klopfte diskret an die Tür, und sein Sekretär schaute vorsichtig herein. »Sind Sie bereit, Sir George?«
»Ja.« Es klang wie ›selbstverständlich‹. »Er soll heraufkommen.«
Beauchamp hörte nie auf zu arbeiten, und von Zeit zu Zeit freute es ihn zu beobachten, wie seine Planungen Früchte trugen, wie die von ihm zu Führerschaft und Befehlsgewalt Auserwählten sich entwickelten und seinen eigenen strengen Maßstäben gerecht wurden.
Wie sein Besucher zum Beispiel. Beauchamp sah zur polierten Tür hinüber, die das Sonnenlicht auf eine Karaffe mit Rotwein und zwei schön geschliffene Gläser zurückwarf.
Richard Bolitho, manchmal halsstarrig, andererseits aber unorthodox, war einer von Beauchamps Erfolgen. Erst vor drei Jahren hatte er ihn zum Kommodore einer Hand voll Schiffe ernannt und ins Mittelmeer geschickt, um die Absichten der Franzosen auszukundschaften. Das Ergebnis war inzwischen schon Geschichte: Bolithos entschlossenes Handeln und das spätere Erscheinen von Nelson mit einer ganzen Flotte hatte zur »Battle of the Nile«[1] geführt, bei der die französischen Geschwader und Napoleons Hoffnungen auf eine Eroberung Ägyptens und Indiens zerstört worden waren.
Jetzt war Bolitho hier, als frisch beförderter Konteradmiral, ein Flaggoffizier mit großer Verantwortung, aber auch mit vielen Zweifeln belastet.
Der Sekretär öffnete die Tür.
»Konteradmiral Richard Bolitho, Sir.«
Beauchamp streckte die Hand aus und lächelte. Dabei empfand er wieder die übliche Mischung von Freude und Neid. Bolitho sah blendend aus in seinem neuen goldbestickten Rock, dachte er, doch der schnelle Aufstieg hatte den Menschen Bolitho nicht verändert. Das gleiche schwarze Haar mit der rebellischen Locke über dem rechten Auge, der gerade Blick und gesammelte Gesichtsausdruck, der den Abenteurer verbarg und die Bescheidenheit des Mannes, die Beauchamp erkannt hatte.
Bolitho bemerkte den prüfenden Blick und lächelte.
»Schön, Sie wiederzusehen, Sir.«
Beauchamp machte eine Geste zum Tisch hin.
»Schenken Sie uns bitte ein Glas ein. Ich bin etwas zu steif dazu.«
Bolitho beobachtete seine Hand, als er die Karaffe über die Gläser hielt. Sie war ruhig und fest, obwohl sie angesichts der inneren Erregung, die er im Augenblick spürte, hätte zittern können. Als er sich vor kurzem im Spiegel betrachtet hatte, war es ihm geradezu unwahrscheinlich vorgekommen, daß er den großen und entscheidenden Schritt vom Stabs- zum Flaggoffizier getan hatte. Jetzt war er Konteradmiral, einer der jüngsten, die es je gegeben hatte, aber abgesehen von der Uniform mit ihren glitzernden Schulterstücken und dem einen Stern darauf, fühlte er sich nicht anders als bisher. Hätte nicht etwas Besonderes mit ihm geschehen müssen? Er hatte immer angenommen, daß schon der Aufstieg von der Offiziersmesse zur Kommandantenkajüte einen Mann veränderte. Wieviel mehr noch der Schritt von dort bis zu dem Anrecht, seine eigene Flagge setzen zu können. Dazwischen lagen doch Welten!
Aber nur im Verhalten anderer hatte er eine Veränderung bemerkt. John Allday, sein Bootssteurer, hörte gar nicht mehr auf, vor Freude zu strahlen. Und wenn er früher bei Besuchen in der Admiralität die Belustigung seiner Vorgesetzten gesehen hatte, sobald er seine Pläne entwickelte, so hörten sie jetzt aufmerksam zu, anstatt ihm – wie früher – brüsk über den Mund zu fahren. Sie stimmten zwar nicht immer mit ihm überein, aber sie ließen ihn ausreden. Das war wirklich eine Veränderung.
Beauchamp schaute ihn über das Glas hinweg an. »Nun, Bolitho, Sie haben erreicht, was Sie wollten, und ich auch.« Er warf einen flüchtigen Blick auf das nächstliegende Fenster, das sich durch die Wärme im Raum beschlagen hatte. »Ein eigenes Geschwader. Vier Linienschiffe, zwei Fregatten und eine Korvette. Sie werden Ihre Befehle von Ihrem Vorgesetzten Admiral bekommen, aber es wird Ihre Sache sein, wie Sie diese Befehle in die Tat umsetzen.«
Sie stießen mit ihren Gläsern an, jeder plötzlich in Gedanken versunken.
Für Beauchamp war es ein neues Geschwader, eine Waffe, die sich in das Gesamtkonzept der Kriegsführung einfügen ließ. Für Bolitho bedeutete es unendlich viel mehr. Beauchamp hatte alles getan, um ihm zu helfen; selbst bei der Auswahl seiner Kommandanten. Mit einer Ausnahme kannte er sie alle, die meisten hatten schon mit ihm zusammen oder unter ihm gedient. Mit einigen war er seit Jahren befreundet.
Bolitho schaute sich flüchtig im Raum um. Es war dasselbe Zimmer, in dem er vor neunzehn Jahren sein erstes selbständiges Kommando erhalten hatte, und in mancher Beziehung war das der Tag in seinem Leben, an den er sich am besten erinnern konnte. Hier hatte er Thomas Herrick kennengelernt, der sein Erster Offizier und getreuer Freund geworden war. Auf demselben Schiff hatte er John Neale angetroffen, damals ein zwölf Jahre alter Seekadett. Neale gehörte jetzt seinem Geschwader an, als Kommandant einer Fregatte.
»Erinnerungen, Bolitho?«
»Aye, Sir. An Schiffe und Gesichter.«
Das enthielt alles. Bolitho war – wie Neale – als Zwölfjähriger zur See gegangen. Nun war er Konteradmiral – ein Traum hatte sich erfüllt. Zu oft hatte er dem Tod ins Auge geschaut, zu oft waren andere neben ihm gefallen, da gewöhnte man es sich ab, über den nächsten Monat, das nächste Jahr hinaus Pläne zu schmieden.
»Ihre Schiffe sind alle versammelt, Bolitho.« Es war eine Feststellung. »Also wollen wir keine Zeit verlieren. Gehen Sie in See mit ihnen, exerzieren Sie, wie Sie es gelernt haben, und so lange, bis die Leute Sie zum Teufel wünschen. Aber eisenhart müssen die Kerle dabei geworden sein.«
Bolitho lächelte zustimmend. Er wäre lieber heute als morgen ausgelaufen. An Land hielt ihn nichts mehr. Er war in Falmouth gewesen, hatte sein Haus und sein Gut besucht. Es hatte ihn – wie jedesmal – innerlich bewegt, daß das Haus auf irgend etwas zu warten schien. Mehrmals hatte er im Schlafzimmer vor ihrem Porträt gestanden. Er hatte ihre Stimme vernommen, ihr Lachen gehört. Und er hatte sich nach dem Mädchen gesehnt, das er geheiratet und kurz darauf durch einen tragischen Unfall verloren hatte: Cheney, Er hatte ihren Namen ausgesprochen, als ob er ihr Bild damit lebendig machen könnte. Und als er weggegangen war, um nach London zu fahren, hatte er sich in der Tür noch einmal umgedreht, um ein letztes Mal ihr Gesicht zu sehen: ihre meergrünen Augen, die der See unterhalb von Pendennis Castle glichen, ihr wehendes Haar, das die Farbe junger Kastanien hatte. Und es war, als hätte auch sie ihm nachgeschaut.
Er schüttelte die wehmütigen Gedanken ab und erinnerte sich des einzigen erfreulichen Erlebnisses während dieser Tage, als Herrick mit seiner alten Lysander nach England zurückgekehrt war. Herrick hatte, ohne lange zu zögern, die Witwe Dulcie Boswell geheiratet, die er am Mittelmeer kennengelernt hatte.
Bolitho hatte die Reise zu der kleinen normannischen Kirche am Wege nach Canterbury bereitwillig unternommen. Die Kirchenbänke waren mit Herricks Freunden und Nachbarn gefüllt gewesen, dazwischen leuchtete viel Blau und Weiß von den Uniformen seiner Marinekameraden.
Bolitho hatte sich irgendwie ausgeschlossen gefühlt; dies Gefühl lastete noch schwerer auf ihm, als er sich seiner eigenen Hochzeit in Falmouth erinnerte, bei der Herrick sein Trauzeuge gewesen war.
Als die Kirchenglocken zu läuten begannen, als Herrick sich vom Altar abwandte und – die Hand seiner Braut auf dem goldbestickten Ärmelaufschlag – dem Ausgang zuschritt, war er bei Bolitho kurz stehengeblieben und hatte schlicht gesagt: »Daß Sie hier sind, hat diesen Tag für mich vollkommen gemacht.«
Nun drängte sich Beauchamps Stimme wieder dazwischen. »Ich hätte gerne noch mit Ihnen gegessen, aber ich muß mit dem Hafenadmiral reden. Außerdem haben auch Sie sicher noch viel zu tun. Ich bin Ihnen aus vielen Gründen zu Dank verpflichtet, Bolitho.« Dabei zog ein scheues Lächeln über sein Gesicht.
»Nicht zuletzt dafür, daß Sie meinen Vorschlag für Ihren Flaggleutnant angenommen haben. Ich bin seiner hier in London etwas überdrüssig.«
Bolitho dachte, daß es wohl noch einige Gründe mehr für diese Bitte gegeben hatte, aber er äußerte sich nicht dazu. Statt dessen sagte er: »Ich verabschiede mich also, Sir. Und vielen Dank, daß Sie mich gerufen haben.« Beauchamp antwortete nur mit einem Achselzucken. Es schien, als koste ihn schon das eine physische Anstrengung. »Es war das mindeste, was ich für Sie tun konnte. Sie kennen Ihre Befehle. Wir haben Ihnen keine bequeme Seereise ausgesucht, aber dafür hätten Sie sich auch kaum bedankt, eh?« Er lachte in sich hinein. »Halten Sie die Augen offen, es könnte Verdruß geben.« Damit sah er Bolitho fest an. »Mehr sage ich nicht. Aber Ihre Taten, Ihre Auszeichnungen, so wohlverdient sie waren, haben Ihnen auch einige Feinde gemacht. Ich warne Sie.« Er streckte die Hand aus. »Nun hinaus mit Ihnen, und beherzigen Sie, was ich gesagt habe.«
Bolitho verließ den Raum und ging an einer ganzen Reihe Leute vorbei, die darauf warteten, bei dem grimmigen kleinen Admiral vorgelassen zu werden, um sich Rat zu holen, Unterstützung zu erbitten oder auch nur, um neue Hoffnung zu schöpfen.
Am Fuß der Treppe, nahe einer überfüllten Kaffeestube, wartete Allday auf ihn. Wie immer. Er würde sich nie ändern. Mit demselben breiten Grinsen auf dem biederen Gesicht, wie stets, wenn er vergnügt war. Er hatte etwas zugenommen in letzter Zeit, dachte Bolitho, aber er stand wie ein Fels. Bolitho lachte in sich hinein. In jedem anderen Fall hätte der Hausdiener einen einfachen Bootssteurer nach hinten in die Küche oder – wahrscheinlicher noch – in die Kälte hinausgeschickt. Nicht jedoch Allday. Der sah in seinem blauen Rock mit den vergoldeten Knöpfen, den neuen Kniebundhosen und blanken Lederstiefeln Zoll für Zoll wie der Bootssteurer eines Admirals aus.
Allday hatte drei Jahre gebraucht, um sich an die Anrede ›Sir‹ zu gewöhnen. Vorher hatte er Bolitho einfach mit ›Captain‹ angeredet. Nun mußte er sich an einen Konteradmiral gewöhnen. Erst am Morgen, als sie vom Hause eines Freundes, bei dem Bolitho ein paar Tage zu Besuch gewesen war, nach Portsmouth aufgebrochen waren, hatte Allday fröhlich gesagt: »Macht nichts, Sir. Bald werden Sie ›Sir Richard‹ sein, und auch daran werde ich mich gewöhnen!«
Nun half ihm Allday in seinen langen Bootsmantel und sah zu, wie er sich den Dreispitz fest auf das schwarze Haar drückte.
»Dies ist ein großer Augenblick, nicht wahr, Sir?« Er wiegte den Kopf. »Wir haben einen langen Weg zurückgelegt.«
Bolitho sah ihn mit Wärme an. Allday fand stets das treffende Wort. Wann und wo auch immer, bei Sturm oder Raute. In schwierigen Lagen und Todesgefahr: Allday war immer da. Bereit zu helfen, seinen Witz ebenso wie seinen Mut einzusetzen. Er war ein wirklicher Freund, wenn er es auch manchmal darauf anlegte, Bolitho zu reizen.
»Aye. Irgendwie kommt es mir vor, als beginne alles noch einmal von vorne.«
Bolitho betrachtete sich kurz im Wandspiegel neben dem Eingang, genau wie damals, als er als frisch gebackener Kommandant der Fregatte Phalarope hier herausgekommen war. Damals war er jünger gewesen als der jüngste Kommandant seines jetzigen Geschwaders.
Er dachte plötzlich an das Landhaus, in dem er zu Besuch gewesen war, und erinnerte sich an eines der Dienstmädchen, ein hübsches Mädchen mit flachsblonden Haaren und schmucker Figur. Er hatte Allday mehrmals mit ihr zusammen gesehen, und der Gedanke beunruhigte ihn. Allday hatte sein Leben oft genug riskiert und Bolithos mehr als einmal gerettet. Nun ging es wieder hinaus, und Allday mußte wegen seiner hartnäckigen Anhänglichkeit mit.
Bolitho spielte mit dem Gedanken, ihm eine Chance zu geben, ihn nach Falmouth zu schicken, wo er in Frieden leben, am Ufer Spazierengehen und mit anderen ehemaligen Seeleuten sein Bier trinken konnte. Allday hatte mehr als seine Pflicht für England getan. Es gab unzählige andere, die nie ihr Leben riskiert hatten, die nie bei Sturm oben in einem Mast herumgeklettert waren oder an den Kanonen gestanden hatten, wenn die Luft voll Eisen war.
Er schaute in Alldays Gesicht und entschied sich anders. Es würde ihn verletzen und ärgern. Er selber hätte genauso empfunden. Bolitho sagte: »Manche Väter werden auf den Seemann scharf sein, der ihren Töchtern zu nahegetreten ist, nicht wahr, Allday?« Ihre Blicke trafen sich. Es war ein Spiel, das beide sehr gut beherrschten.
Allday grinste. »Ganz meine Meinung, Sir. Es wird Zeit für eine kleine Veränderung.«
Kapitän Thomas Herrick trat unter dem Überhang der Hütte hervor und blieb – die Hände auf dem Rücken verschränkt – stehen, um sich in dem feuchten kalten Wind, der die Decks übersprühte, wieder seelisch und körperlich an das Schiff zu gewöhnen.
Der Vormittag war fast vorüber, und mit geübtem Blick sah Herrick, daß die Seeleute, die an Deck, auf den Laufbrücken oder oben auf den Rahen bei der Arbeit waren, sich langsamer als sonst bewegten. Sicher waren sie in Gedanken schon beim Mittagessen, bei ihrer Rum-Ration, bei der kurzen Erholungspause, die sie mit ihren Kameraden in den vollgefüllten unteren Decks verbringen würden.
Herrick ließ seinen Blick über das breite Achterdeck schweifen, über den stocksteif dastehenden Midshipman der Wache, der sich der Anwesenheit seines Kommandanten offenbar bewußt war, über die sauber ausgerichteten Kanonen, überall hin. Er hatte sich noch immer nicht an das neue Schiff gewöhnt. Sein altes Schiff, die Lysander; 74 Kanonen, hatte er nach vielen Monaten ununterbrochenen Dienstes heimgebracht. Die Jahre, Sturmschäden und schwere Wunden aus vielen Gefechten hatten ihre tiefen Spuren in dem alten Schiff hinterlassen. Herrick war nicht überrascht gewesen, als er den Befehl erhielt, seine Besatzung auszuzahlen und seine Lysander bei der Marinewerft abzuliefern. Er hatte viel erlebt und durchgemacht auf diesem Schiff, und bei vielen Gelegenheiten hatte er auch etwas über sich selber dabei gelernt, über seine Möglichkeiten und seine Grenzen. Als Flaggkapitän von Kommodore Richard Bolitho hatte er mehr Arten der Pflichterfüllung kennengelernt, als er für möglich gehalten hatte.
Die Lysander würde nie wieder in einer Schlachtlinie stehen. Zu viele Beschädigungen hatten ihren Tribut gefordert, aber ihre vielen Dienstjahre würden wahrscheinlich ohne Lohn bleiben. Sie mochte ihre Tage als Vorratsschiff oder – schlimmer noch – als schwimmendes Gefängnis beenden.
Ihre Besatzung war nun über die ganze Flotte verteilt und stillte den nie endenden Bedarf an guten Leuten. Herrick hatte es vorausgesehen und sich mehr als einmal gefragt, wie seine eigene Zukunft wohl aussehen werde. Zu seiner Überraschung hatte man ihm dieses Schiff gegeben: Seiner Britischen Majestät Linienschiff Benbow, 74 Kanonen, funkelnagelneu aus der Hauptmarinewerft in Devonport. Es war das erstemal, daß Herrick auf einem Neubau Dienst tat, ihn sogar befehligte.
Seit Monaten war er nun schon an Bord, arbeitend und sich sorgend, während die Werft ihren Teil tat, und die Benbow wuchs und wuchs, bis sie schließlich ihren gegenwärtigen Zustand erreicht hatte.
Alles war noch neu und unerprobt: dies galt nicht zuletzt für die Männer, die sich in ihrem Achtzehnhundert-Tonnen-Rumpf zusammengefunden hatten. Herrick hatte jede Unze Erfahrung gesegnet, die er seinem langsamen Emporklettern auf der Leiter des Erfolges und der Beförderung verdankte.
Glücklicherweise war es ihm möglich gewesen, einige seiner alten Recken von der Lysander bei sich zu behalten, einige vom Stamm der erfahrenen Maate und Deckoffiziere, die man sogar jetzt, nach der gerade hinter ihnen liegenden Sturmnacht, auf dem Oberdeck herumbrüllen hören konnte, weil sie sich – genau wie der Kommandant – ihrer Verantwortung und dessen, was die nächste Stunde bringen würde, bewußt waren.
Herrick schaute zur Spitze des Besanmastes empor und fühlte, wie ihm dabei der Gischt ins Gesicht sprühte. Sogar vor Anker konnte es in Spithead sehr bewegt sein. Bald würde die Flagge eines Konteradmirals vom Besan wehen. Sie würden wieder zusammen sein. Mit anderen Aufgaben, mit größerer Verantwortung, aber sie hatten sich bestimmt nicht verändert.
Herrick trat an die Finknetze[2] und schaute zur verschwommenen Uferlinie hinüber. Sogar ohne Fernglas konnte er den Portsmouth Point sehen, seine Gebäude, die so eng zusammengerückt waren, als fürchteten sie, über die Felskante in die See zu stürzen. Da war die Kirche von Thomas à Beckett, und irgendwo weiter links der alte George Inn.
Er kletterte auf einen Poller und schaute hinab auf das gurgelnde Wasser, das an der kräftigen, schwarz und gelb gemusterten Bordwand vorbeiströmte. Boote tanzten auf und nieder, Ladegeschirr hob und senkte sich, um in letzter Minute noch Vorräte an Bord zu hieven, Brandy für den Schiffsarzt, Wein für die Offiziere der Seesoldaten – kleine Annehmlichkeiten, von denen man nicht wußte, wie lange sie vorhalten mußten.
Die letzten Monate hatten Herrick nicht nur viel abgefordert, sondern ihn auch vielfältig belohnt. Von einem kleinen Seeoffizier ohne Beziehung oder Vermögen hatte er sich zu einem Mann entwickelt, der Wurzeln geschlagen hatte. Mit Dulcie hatte er Geborgenheit und ein Glück gefunden, wie er es sich nicht einmal erträumt hatte, und zu seiner größten Überraschung – das war typisch für ihn – hatte er eines Tages entdeckt, daß er mit einer Frau lebte, die, wenn auch nicht gerade reich, so doch recht wohlhabend war.
Dulcie hatte in der Nähe des Schiffes gewohnt, so lange die letzten Ausrüstungsarbeiten noch dauerten: Rahen aufbringen, das stehende Gut teeren und durchsetzen, Segel anschlagen, Kanonen an Bord hieven, vierundsiebzig Stück, und viele Meilen langes Tauwerk, Hunderte von Blöcken und Taljen, von Körben, Fässern und sonstigen Gegenständen, die einen nackten Schiffsleib in die modernste, am meisten begehrte und wahrscheinlich schönste Schöpfung des Menschen verwandelte. Die Benbow war jetzt ein Kriegsschiff, ja mehr als das, sie war das Flaggschiff dieses kleinen Geschwaders, das hier auf Spithead-Reede lag.
»Ihr Glas, bitte, Mr. Aggett!« rief er scharf.
Herrick hatte sich Namen schon immer gut merken können. Den Charakter ihrer Träger kennenzulernen, dazu brauchte er länger.
Der Midshipman der Wache flitzte über das Achterdeck und überreichte ihm das große Teleskop des Signaloffiziers. Herrick richtete es durch die Steuerbordnetze und über die anderen Schiffe hinweg auf die nebligen Buckel der Insel Wight. Dann studierte er mit fachkundigem Blick sorgsam jedes Schiff. Die anderen drei Zweidecker glänzten fast im trüben Licht, und ihre geschlossenen Stückpforten hoben sich wie Schachbrettmuster von der kabbeligen See ab. Indomitable, Kapitän Charles Keverne. Bei jedem Schiffsnamen trat sein Kommandant vor Herricks geistiges Auge. Keverne war Bolithos Erster Offizier auf der großen Prise Euryalus gewesen. Nicator, Kapitän Valentine Keen. Sie hatten zusammen auf einem Schiff irgendwo auf den Weltmeeren gedient.
Die Odin, ein kleinerer Zweidecker mit nur vierundsechzig Kanonen. Herrick lächelte trotz seiner vielen Sorgen. Ihr Kommandant war Francis Inch. Er hätte nie geglaubt, daß der eifrige Inch mit seinem Pferdegesicht es so weit bringen würde. Noch weniger, als er das für sich selber erwartet hatte.
Die beiden Fregatten, Relentless und Styx, ankerten weiter achteraus, und die kleine Korvette Lookout zeigte ihre kupferbeschlagene Unterseite, als sie vor ihrer Ankertrosse heftig hin- und herdümpelte.
Insgesamt war es ein gutes Geschwader. Den meisten Offizieren und Mannschaften fehlte zwar Erfahrung, aber ihr jugendlicher Eifer würde das bald wettmachen. Herrick seufzte. Er war dreiundvierzig und alt für seinen Dienstgrad, aber er war zufrieden, wenn er auch gerne ein paar Jahre von seinem Lebensalter abgestrichen hätte.
Füße stampften über das Achterdeck, und er sah Henry Wolfe, den Ersten Offizier, mit großen Schritten auf sich zukommen. Herrick konnte sich nicht vorstellen, wie er in den letzten Monaten der Ausrüstung der Benbow ohne Wolfe hätte zurechtkommen sollen. Wolfe sah außergewöhnlich aus: sehr groß, über sechs Fuß, schien er Schwierigkeiten zu haben, seine langen Arme und Beine unter Kontrolle zu halten. Sie waren genauso lebhaft in Bewegung wie der ganze Mann. Er hatte Fäuste wie Schmiedehämmer und Füße so groß wie Drehbassen. Das Ganze wurde gekrönt von einem leuchtend roten Haarschopf, der unter seinem Dreispitz wie zwei Vogelschwingen hervorflatterte.
Wolfe bremste ab und berührte kurz seinen Hut. Er holte mehrmals tief Luft, als könne er seine Energie, die nicht unbeträchtlich war, nur auf diese Weise zügeln.
»Alles klar, Sir!« Er hatte eine rauhe, tonlose Stimme, die den nahe dabeistehenden Midshipman zusammenzucken ließ. »Ich habe alles an seinen Ort gebracht und für alles auch einen Platz gefunden. Geben Sie uns noch ein paar Leute, und wir werden mit jedem Wetter fertig.«
»Wieviel mehr?« fragte Herrick.
»Zwanzig gute Seeleute oder fünfzig Idioten!«
Herrick hakte da ein. »Sind die Leute, die gestern von den Preßkommandos gebracht wurden, brauchbar?«
Wolfe rieb sich das Kinn und beobachtete einen Matrosen, der an einem Backstag herunterglitt.
»Das übliche, Sir. Ein paar Lümmel und ein paar Galgenvögel, aber auch einige gute Leute. Sie werden hineinpassen, wenn der Bootsmann sie sich erst vorgenommen hat.«
Eine Talje quietschte, und einige in Segeltuch eingeschlagene Kisten wurden angehievt und über die Laufbrücke an Deck geschwenkt. Herrick sah, wie Ozzard, Bolithos Diener, die Kisten in Empfang nahm und mit Hilfe einiger Seeleute nach achtern brachte.
Wolfe folgte seinem Blick und bemerkte: »Keine Bange, Sir. Die Benbow wird Sie nicht enttäuschen.« In seiner unverblümten Art setzte er hinzu: »Es ist für mich was Neues, unter einer Admiralsflagge zu fahren, Sir. Ich nehme gern jeden Rat an, den Sie für angebracht halten.«
Herrick musterte ihn ruhig und sagte nur: »Admiral Bolitho duldet keine Nachlässigkeiten, Mr. Wolfe, genausowenig wie ich. Aber ein anständigerer Mann ist mir nie begegnet, und auch kein tapferer.« Er ging wieder nach achtern und fügte in anderem Ton hinzu: »Rufen Sie mich bitte, sowie Sie das Admiralsboot sichten.«
Wolfe blickte ihm nach und bemerkte zu sich selber: »Und es gibt auch keinen besseren Freund für dich, möchte ich wetten.«
Herrick begab sich in seine Kajüte und registrierte auf dem Weg dahin viele geschäftige Gestalten, wie auch Essensdüfte und den starken Geruch nach jungem Holz, Teer, frischen Farben und neuem Tauwerk. Alles war neu auf diesem Schiff, vom Kiel bis zu den Mastspitzen. Und es war seines.
Vor dem Türvorhang hielt er kurz an und beobachtete seine Frau, die am Tisch in der Kajüte saß. Sie hatte ein angenehmes, ebenmäßiges Gesicht und Haare im gleichen Braun wie er selber. Sie war Mitte Dreißig, aber Herrick hatte ihr sein Herz geschenkt wie ein Jüngling einem Engel.
Der Offizier, mit dem sie gerade gesprochen hatte, stand auf und schaute zur Tür.
Herrick nickte ihm zu. »Keine Eile, Adam, Sie werden jetzt noch nicht an Deck benötigt.«
Adam Pascoe, Dritter Offizier der Benbow, war froh über die Unterbrechung. Nicht, daß es ihm unangenehm gewesen wäre, mit der Frau seines Kommandanten zu plaudern, ganz und gar nicht. Aber er war sich, genau wie Herrick, an diesem Tage besonders bewußt, was es für ihn und sie alle heute und in Zukunft bedeutete, wenn die Flagge seines Onkels hier an Bord gesetzt wurde.
Pascoe hatte schon auf der Lysander unter Herrick gedient. Er hatte als Unterleutnant angefangen und war dann, durch Beförderung oder Tod seiner Vorgesetzten, zum Vierten Offizier aufgestiegen. Jetzt, als Dritter Offizier der Benbow, war er immer noch sehr jung, gerade zwanzig. Innerlich war er hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, bei Richard Bolitho zu bleiben oder sich auf ein kleineres, unabhängiges Schiff, eine Fregatte oder Korvette, versetzen zu lassen.
Herrick beobachtete ihn und erriet, was Pascoe dachte.
Ein gutaussehender Junge, dachte er selbst, schlank und sehr dunkel, Bolitho ähnlich, mit der Unruhe eines noch nicht eingerittenen Jungpferdes. Sein Vater, wenn er noch lebte, wäre stolz auf ihn gewesen.
Pascoe sagte: »Ich gehe jetzt lieber zu meiner Division, Sir. Ich möchte nicht, daß heute was schiefläuft.« Er verbeugte sich leicht zu der Dame hin. »Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen, Ma’am.«
Allein mit seiner Frau, sagte Herrick nachdenklich: »Ich mache mir manchmal Sorgen um ihn. Er ist noch ein Knabe und hat doch schon mehr Blutvergießen und Scheußlichkeiten gesehen als die meisten in diesem Geschwader.«
Sie antwortete: »Wir sprachen gerade über seinen Onkel. Er hält sehr viel von ihm.«
Herrick ging hinter ihrem Stuhl vorbei und legte ihr die Hand auf die Schulter. ›Großer Gott, ich muß dich bald verlassen‹ dachte er. Laut sagte er: »Die Wertschätzung ist gegenseitig, Liebste. Aber im Krieg hat ein Offizier des Königs seine Pflichten.«
Sie griff nach seiner Hand und drückte sie gegen ihre Wange.
»Unsinn, Thomas! Du sprichst mit mir und nicht mit einem deiner Seeleute!«
Er beugte sich über sie und fühlte sich zur gleichen Zeit unbeholfen und als ihr Beschützer. »Du wirst gut auf dich aufpassen, wenn wir fort sind, nicht wahr, Dulcie?«
Sie nickte kräftig. »Ich gebe auf alles acht. Und ich sehe auch darauf, daß deine Schwester bis zu ihrer Hochzeit mit allem versorgt ist. Wir werden bis zu deiner Rückkehr eine Menge zu besprechen haben.« Sie stockte. »Wann mag das sein?«
Durch sein neues Kommando und seine unerwartete Heirat hatte Herrick den Kopf so voll gehabt, daß er kaum weiter über den Tag hinaus gedacht hatte, an dem er sein Schiff von Plymouth nach Spithead zum Treffpunkt mit dem übrigen Geschwader bringen sollte.
»Es geht nordwärts, glaube ich. Mag ein paar Monate dauern.« Liebevoll drückte er ihre Hand. »Keine Angst, Dulcie, mit der Flagge unseres Dick im Masttopp sind wir in guter Hut.«
Eine Stimme gellte über ihnen: »Klar Deck überall! Ehrenwache antreten!«
Pfiffe und Kommandolaute schrillten durch die Decks, und Füße stampften über Holzplanken, als die Seesoldaten nach oben stürzten und sich an der Fallreepspforte aufstellten.
Es klopfte kräftig an die Tür, und Midshipman Aggett meldete atemlos, während seine vom Wind geröteten Augen sich auf das halb aufgegessene Stück Kuchen auf dem Tisch richteten: »Meldung vom Ersten Offizier, Sir: Das Admiralsboot hat eben von der Pier abgelegt.«
»Sehr gut, ich komme.«
Herrick wartete, bis der Junge gegangen war. »Gleich werden wir mehr wissen, Liebste.«
Er nahm seinen Säbel aus der Wandhalterung und befestigte ihn am Gürtel. Dann stand er auf und marschierte durch die Kajüte, wobei er das Halstuch und seinen Rock mit den weißen Aufschlägen zurechtzupfte.
»Thomas, Liebster, ich bin stolz auf dich.«
Herrick war kein großer Mann, aber als er jetzt die Kajüte verließ, um seinen Admiral zu empfangen, fühlte er sich wie ein Gigant.
Richard Bolitho saß kerzengerade auf dem Hecksitz seines Admiralsbootes und beobachtete die vor Anker liegenden Schiffe, die mit jedem Schlag der Riemen näher kamen, ohne daß er sich bewußt wurde, was jetzt auf seinem Flaggschiff oder gar auf dem übrigen Geschwader vorging.
Als er in das Boot eingestiegen war, hatte er unter den Kuttergästen einige seiner alten Leute von der Lysander wiedererkannt. Für sie ging es jetzt abermals hinaus, wahrscheinlich hatten sie in der Zwischenzeit nicht einmal Familie und Heimat gesehen.
Allday saß dicht neben Bolitho und beobachtete aufmerksam, wie die weiß gemalten Riemen sich hoben und senkten wie blankpolierte Spinnenbeine. Ein Leutnant führte das Kommando im Boot, der jüngste Offizier der Benbow, und er fühlte sich unter Alldays kritischem Blick ebenso unbehaglich wie wegen der Anwesenheit des Admirals.
Bolitho war fest in seinen Bootsmantel eingewickelt, der sogar noch seinen Hut umhüllte, damit er nicht über Bord geweht wurde.
Er musterte den an der Spitze liegenden Zweidecker; als das Schiff langsam im überkommenden Gischt Umriß und Gestalt annahm, rief er sich in Erinnerung, was er von ihm wußte.
Ein Linienschiff dritter Klasse[3], etwas größer als die Lysander. Sieht blendend aus, dachte er und schätzte, daß Herrick ebenso beeindruckt hatte sein müssen. Er sah die Galionsfigur aus dem Schiffsleib ragen; es schien, als wolle sie mit ihrem erhobenen Säbel seinem Boot ein Zeichen geben. Sie trug den Namen von Vizeadmiral Sir John Benbow, gestorben 1702, nachdem er sein Bein durch ein Kettengeschoß verloren hatte, aber nicht eher, bis er der Hinrichtung seiner Kommandanten beigewohnt hatte, die in der Schlacht feige gekniffen hatten. Es war eine schöne Galionsfigur, dem toten Admiral sicher ähnlich. Würdevoll blickend, mit wehendem Haar und einem schimmernden Brustharnisch, wie man ihn zu jener Zeit getragen hatte. Der alte Izod Lambe aus Plymouth, einer der Besten seines Faches, hatte sie geschnitzt, obwohl er – wie es hieß – blind war.
Wie viele Male hatte es Bolitho in dieser Zeit gereizt, schnell einmal von Falmouth herüberzukommen, um Herrick bei den letzten Arbeiten zuzuschauen. Aber Herrick hätte das vielleicht als einen Mangel an Vertrauen gedeutet. Mehr als einmal hatte Bolitho jetzt schon zur Kenntnis nehmen müssen, daß das einzelne Schiff ihn direkt nichts mehr anging. Er schwebte darüber wie seine Flagge. Ein freudiger Schauer lief ihm über den Rücken, als er die übrigen Einheiten seines Geschwaders musterte; vier Linienschiffe, zwei Fregatten und eine Korvette. Insgesamt fast dreitausend Offiziere, Seeleute und Soldaten, und alles, was darin inbegriffen war.
Das Geschwader mochte neu sein, aber von den Gesichtern waren ihm viele altvertraut. Er dachte an Keverne und Inch, an Neale und Keen, und an den jungen Kommandanten der Korvette, Matthew Veitch. Er war Herricks Erster Offizier gewesen. Admiral Sir George Beauchamp hatte sein Versprechen gehalten. Jetzt war es an ihm, sich zu bewähren.
Mit Männern, die er kannte und denen er vertraute, mit denen er so viel erlebt und geteilt hatte.
Trotz der augenblicklichen Erregung lächelte er bei dem Gedanken an die Reaktion seines neuen Flaggleutnants, als er versucht hatte, ihm seine Gefühle deutlich zu machen.
Der Leutnant hatte gesagt: »Aus Ihrem Mund klingt es sehr bedeutend. Wie schon der Dichter sagt: ›Wir Auserwählten‹.«
Vielleicht war er damit der Wahrheit näher gewesen, als er ahnte.
Das Admiralsboot drehte auf, fiel in ein Wellental hinab und wurde wieder hochgehoben, als der Leutnant auf die glitzernde Bordwand des Flaggschiffs zuhielt.
Dann waren sie längsseits. Rote Uniformröcke und weiße Kreuzbänder, das Blau und Weiß der Offiziersröcke, die Menge der Seeleute dahinter. Und über ihnen, wie um sie zu beschützen und einzuhüllen, die drei großen Masten und die Rahen, die Masse der Wanten, Stage und des laufenden Guts, ein unfaßbares Gewirr für jede Landratte, aber Bürge der Geschwindigkeit und Beweglichkeit eines Schiffes. Mit der Benbow war jedenfalls zu rechnen.
Die Riemen federten wie auf einen Schlag in die Senkrechte, und der Bugmann hakte in die Kette des Rüsteisens ein.
Bolitho übergab Allday seinen Mantel und drückte den Hut fest in die Stirn.
Alles ging ganz ruhig vonstatten; abgesehen von dem Tidenstrom zwischen dem Schiff und dem dümpelnden Boot wirkte die Szene fast friedlich.
Auch Allday war aufgestanden und hatte seinen Hut abgenommen. Nun stand er wartend da, bereit Bolitho zu helfen, wenn er den Absprung aufs Fallreep verpassen sollte.
Bolitho faßte Fuß und zog sich zur Einlaßpforte hoch.
In diesem Augenblick nahm er laute Befehle war, die Geräusche präsentierter Waffen und den Einsatz der Spielleute, die das ›Heart of Oak‹ intonierten.
Wie durch einen Schleier sah er Gesichter, die auftauchten und sich näherten, als er das Deck betrat. Und während die Bootsmannsmaatenpfeifen und die Kommandorufe verstummten, nahm Bolitho seinen Hut ab und salutierte nach achtern, zur Flagge hin, und dann vor dem Kommandanten des Schiffes, als er auf ihn zuschritt, um ihn zu begrüßen.
Herrick nahm ebenfalls seinen Hut ab und schluckte heftig. »Willkommen an Bord, Sir!«
Beide schauten nach oben, als die Flaggleine vom Signalgasten straff geholt wurde.
Da war es, Symbol und Aussage: Bolithos eigene Flagge wehte nun vom Besanmast wie ein Banner.
Die Nächststehenden hätten gern ein besonderes Zeichen gesehen, als der jugendliche Admiral seinen Hut wieder aufsetzte und ihrem Kommandanten die Hand reichte.
Aber das war alles, was sie zu sehen bekamen. Denn was Bolitho und Herrick in diesem Augenblick miteinander verband, war für jeden anderen unsichtbar.
II Das Flaggschiff
Bei Anbruch des nächsten Tages hatte der Wind abermals beträchtlich zugenommen, und der Solent war wieder mit zornigen Wellenkämmen bedeckt. An Bord des Flaggschiffes, wie auch auf den übrigen Schiffen von Bolithos kleinem Geschwader, war es recht ungemütlich, denn die Fahrzeuge dümpelten stark und zerrten an ihren Ankertrossen, als wären sie entschlossen, auf Grund zu treiben.
Als das erste schwache Licht den glitzernden Schiffsleibern Farbe verlieh, saß Bolitho in seinem Arbeitsraum im Heck der Benbow und las noch einmal seine sorgfältig formulierten Instruktionen durch. Gleichzeitig versuchte er, die Gedanken von den bei Tagesanbruch an Deck üblichen Geräuschen loszureißen. Er wußte, daß Herrick seit Beginn der Dämmerung oben war und daß es die Vorbereitungen zum Ankerlichten auf der Benbow und den anderen Schiffen nur durcheinandergebracht hätte, wenn er hinaufgegangen und sich zu ihnen gesellt hätte.
Die Lage konnte sich jeden Augenblick verschlechtern. Der Krieg hatte schlimme Lücken unter Schiffen, Material und erfahrenen Leuten hinterlassen. Am meisten aber fehlte es an geübten Mannschaften. Auf einem neuen Schiff, in einem neugebildeten Geschwader, war dieser Mangel für Bolithos Kommandanten und Offiziere besonders schlimm.
Bolitho mußte einfach an Deck gehen. Um einen klaren Kopf zu bekommen, um das Fluidum seiner Schiffe zu spüren, um ein Teil des Ganzen zu sein.
Ozzard schaute nach ihm und glitt leise über den mit schwarzweiß gewürfeltem Segeltuch bespannten Fußboden, um ihm Kaffee nachzuschenken.
Bolitho wußte noch immer nicht viel mehr über seinen Diener als damals, da er ihn auf Herricks Lysander kennengelernt hatte. Selbst in seiner adretten blauen Jacke und der gestreiften Hose ähnelte er eher dem Sekretär eines Anwaltbüros als einem Seefahrer. Es hieß, er sei nur dadurch dem Galgen entronnen, daß er sich zur Flotte gemeldet hatte, aber hier hatte er sich durch Zuverlässigkeit und seine zurückhaltende Intelligenz vielfach bewährt.
Die andere Seite seiner Fähigkeiten war zutage getreten, als Bolitho ihn mit auf seinen Besitz in Falmouth genommen hatte. Die Fülle der Gesetze und Steuervorschriften war mit jedem Kriegsjahr komplizierter geworden, und Ferguson, Bolithos einarmiger Verwalter, hatte zugeben müssen, daß die Bücher nie besser in Ordnung gewesen waren, als nachdem Ozzard sich ihrer angenommen hatte.
Der Ehrenposten vor dem Kajütvorhang stieß seine Muskete kurz aufs Deck und meldete: »Ihr Schreiber, Sir!«
Ozzard flitzte zur Tür, um Bolithos Neuerwerbung, Daniel Yovell, einzulassen. Ein munterer Mann mit einem roten Gesicht und dem breiten Dialekt der Leute von Devon, ähnelte er mehr einem Bauern als einem Schiffsschreiber, aber seine Handschrift, rund wie der ganze Mann, war gut; außerdem war er unermüdlich gewesen, als Bolitho ihm seine Befehle bei der Übernahme des Geschwaders diktiert hatte.
Der Schreiber legte seine Papiere auf den Tisch und schaute unauffällig auf die beiden Heckfenster. Sie waren mit Wasserspritzern und angetrocknetem Salz bedeckt und ließen die anderen Schiffe wie Schemen erscheinen, unwirklich und verzerrt.
Bolitho blätterte in den Papieren. Schiffe und Männer, Kanonen und Pulver, Lebensmittel und sonstige Vorräte, die für Wochen, vielleicht für Monate reichen mußten.
Yovell sagte bedächtig: »Ihr Flaggleutnant ist an Bord gekommen, Sir, in der kleinen Jolle.« Er verbarg ein Grinsen. »Nun muß er sich erst etwas Trockenes anziehen, bevor er nach achtern kommt.« Das schien ihn zu amüsieren.
Bolitho lehnte sich im Stuhl zurück und starrte zu den Decksbalken auf. Es kostete viel Papier, ein Geschwader in Marsch zu bringen. Taljen knarrten auf dem Hüttendeck über ihm, und Blöcke quietschten im Gleichklang mit trampelnden Füßen. Verzweifelte Maate drohten und fluchten im Flüsterton, wohl wissend, daß das Oberlicht der Admiralskajüte offenstand.
Die andere Tür zur Kajüte öffnete sich lautlos, und Bolithos Flaggleutnant trat leichtfüßig über das Süll. Nur ein feuchter Schimmer auf seinem braunen Haar zeugte noch von seiner bewegten Überfahrt, ansonsten war er – wie stets – untadelig gekleidet.
Er war sechsundzwanzig Jahre alt, hatte trügerisch sanfte Augen und einen Gesichtsausdruck, der zwischen Leere und leichter Verwirrung wechselte.
Der Ehrenwerte Leutnant Oliver Brown, den ihm abzunehmen Admiral Beauchamp Bolitho gebeten hatte, besaß das Aussehen eines Aristrokraten, der eine gehobene Lebensart gewohnt war. Er war nicht der Typ eines Offiziers, den man an Bord eines Kriegsschiffes erwartet hätte.
Yovell machte eine flüchtige Verbeugung. »Guten Morgen, Sir. Ich habe Ihren Namen schon auf die Liste der Offiziersmesse gesetzt.«
Der Flaggleutnant warf einen kurzen Blick auf das Abrechnungsbuch und sagte ruhig: »Aber Browne mit einem ›e‹ hinten.«
Bolitho lächelte. »Mögen Sie eine Tasse Kaffee?« Er beobachtete, wie Browne seine Kuriertasche auf den Tisch legte, und setzte hinzu: »Was Neues?«
»Nein, Sir. Sie können in See gehen, sobald Sie soweit sind. Keine weiteren Befehle von der Admiralität.« Er setzte sich vorsichtig hin. »Ich wünschte, wir kämen in wärmeres Klima.«
Bolitho nickte. Seine Befehle lauteten, daß er sein Geschwader einige fünfhundert Seemeilen nordwärts an die Westküste Dänemarks führen und sich dort mit jenem Teil der Kanalflotte treffen sollte, der vor dem Eingang zur Ostsee patrouillierte, und das bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen. Sobald er mit dem Admiral dieses Verbandes Verbindung aufgenommen hatte, würde er weitere Befehle erhalten. Er hoffte, genügend Zeit zu haben, um sein Geschwader in Form zu bringen, bevor er seinen neuen Vorgesetzten traf.
Gerne hätte er gewußt, wie seine Offiziere darüber dachten. Sicherlich ähnlich wie Browne, nur daß sie mehr Grund hatten zu murren. Die meisten von ihnen waren seit Jahren im Mittelmeer oder angrenzenden Gewässern gewesen. Für sie mußte Dänemark und die Ostsee im Winter ein schlimmer Tausch sein.
Yovell schob Bolitho die Papiere mit der Geduld eines Dorfschulmeisters zur Unterschrift hin. Dazu sagte er: »Die anderen Abschriften werde ich bis zum Auslaufen fertig haben, Sir.« Dann ging er, wobei sich seine rundliche Gestalt den Schiffsbewegungen wie eine große Kugel anpaßte.
»Ich denke, damit läuft alles.« Bolitho schaute in Brownes ausdrucksloses Gesicht. »Oder?« Er war es noch nicht gewohnt, Gedanken wie Zuversicht oder Zweifel mit anderen zu teilen.
Browne lächelte höflich. »Wir haben heute vormittag Kommandantensitzung, Sir. Wenn der Wind so bleibt, können wir danach jederzeit auslaufen, hat mir der Master[4] versichert.«
Bolitho stand auf und lehnte sich auf die Brüstung der hohen Fenster. Es war beruhigend, daß sie den alten Grubb an Bord hatten. Als Sailing Master der Lysander war er so etwas wie eine legendäre Figur gewesen. Allein mit Signalen aus seiner Batteriepfeife hatte er – während um ihn herum Blut über das Deck strömte – das Schiff so dirigiert, daß es die feindliche Schlachtlinie durchbrach. Ein Brocken von einem Mann, so breit wie drei andere, mit ziegelrotem, vom Wind wie vom Alkohol gegerbtem Gesicht. Was er nicht von seemännischen Erfahrungen in tropischen Orkanen oder im Eismeer wußte, das brauchte man nicht zu wissen.
Herrick war beglückt gewesen, als er Grubb wieder als Navigator bekam. Er hatte gesagt: »Ich bezweifle jedoch, daß er davon Notiz genommen hätte, wenn die Entscheidung anders ausgefallen wäre.«
»Gut«, sagte Bolitho nun. »Machen Sie ein entsprechendes Signal für das Geschwader. Bei vier Glasen zur mir an Bord.« Er lächelte. »Sie warten sowieso darauf.«
Browne raffte seine Sammlung verschiedener Papiere und Signale zusammen und zögerte, als Bolitho ihn plötzlich fragte: »Dieser Admiral, mit dem wir Zusammentreffen sollen. Kennen Sie ihn?«
Er war erstaunt, wie leicht ihm das von den Lippen ging. Früher hätte er eher nackend einen Tanz auf der Hütte aufgeführt, als einen Untergebenen nach dessen Ansichten über einen Vorgesetzten zu fragen. Aber man hatte ihm gesagt, er müsse einen Flaggleutnant haben, der in der Marine-Diplomatie bewandert war, also wollte er das nutzen.
»Admiral Sir Samuel Damerum ist lange Jahre als Flaggoffizier in Indien gewesen und zuletzt in Westindien, Sir. Man hatte erwartet, daß er in ein höheres Amt in Whitehall berufen würde, sogar Sir George Beauchamps Posten wurde genannt.«
Bolitho sah ihn mit großen Augen an. Das war eine andere Welt als die seinige.
»Und das hat Ihnen Sir George Beauchamp alles erzählt!«
Doch Sarkasmus war an Browne verschwendet. »Natürlich, Sir. Als Flaggleutnant muß ich solche Dinge wissen.« Er machte eine wegwerfende Gebärde. »Statt dessen bekam Admiral Damerum sein jetziges Kommando. Er ist gut beschlagen in Angelegenheiten des Handels und seines Schutzes. Ich weiß allerdings nicht, was diese Kenntnisse mit Dänemark zu tun haben.«
»Machen Sie bitte weiter.«
Bolitho setzte sich wieder und wartete, daß Browne den Raum verließ. Er bewegte sich leicht und elegant wie ein Tänzer. Oder mehr noch: wie ein Fechter, ein Duellant, dachte Bolitho grimmig. Es war ganz Beauchamp, ihm einen erfahrenen Adjutanten zu geben und diesen Mann damit gleichzeitig vor unerfreulichen Nachforschungen zu retten.
Er dachte über Damerum nach. Den Namen hatte er langsam auf der jährlichen Beförderungsliste der Marine aufsteigen sehen; ein einflußreicher Mann, aber offenbar immer am Rande der Ereignisse, nie da, wo gekämpft und gesiegt wurde.
Vielleicht waren seine Kenntnisse des Handels der Grund für sein jetziges Kommando. Seit Beginn dieses Jahres hatte es unerwartete Spannungen zwischen Britannien und Dänemark gegeben.
Sechs dänische Handelsschiffe, begleitet von der Freya, einer Fregatte mit vierzig Kanonen, hatten es abgelehnt, sich von einem britischen Geschwader anhalten und nach Konterbande durchsuchen zu lassen.
Dänemark war in einer schwierigen Lage. Nach außen hin galt es als neutral, aber es hing nichtsdestoweniger von seinem Handel ab. Vom Handel mit seinen mächtigen Nachbarn, Rußland und Schweden, ebenso wie mit Britanniens Feinden.
Das Ergebnis dieses Zusammentreffens war hart und ärgerlich gewesen. Die dänische Fregatte hatte Warnschüsse auf die britischen Schiffe abgefeuert, aber nach einer halben Stunde harten Kampfes hatte sie die Flagge streichen müssen. Die Freya und ihre sechs Schützlinge waren in die Downs eingebracht worden, aber nach eiligen diplomatischen Verhandlungen hatten die Briten sich der demütigenden Aufgabe gegenübergesehen, die Freya auf ihre Kosten ausbessern zu lassen und mit ihrem Konvoi nach Dänemark zurückzuschicken.
Der Friede zwischen Britannien und Dänemark, zwei seit jeher befreundeten Nationen, war bewahrt worden.
Vielleicht hatte Damerum seine Hand bei der ursprünglichen Konfrontation im Spiel gehabt und wurde nun mit seinem Geschwader zur Strafe in See gehalten. Oder vielleicht glaubte die Admiralität auch, daß die ständige Anwesenheit ihrer Schiffe vor den Ostseezugängen, Bonapartes Hintertür, wie die Gazette sie genannt hatte, weitere Pannen verhindern würde.
Es klopfte kurz an die Tür, und Herrick trat, seinen Hut unter den Arm geklemmt, in die Kajüte. »Setzen Sie sich, Thomas.«
Bolitho betrachtete seinen Freund mit Wärme. Dasselbe derbe, runde Gesicht, dieselben klaren blauen Augen wie damals, als sie hier in Spithead einander auf ihrem ersten Schiff begegnet waren. Es gab wohl schon ein paar graue Tupfer auf seinem Haar, die aussahen wie Rauhreif auf einem Gebüsch, aber sonst war es immer noch der alte Herrick.
Herrick seufzte tief. »Die brauchen anscheinend immer länger, um fertig zu werden, Sir.« Er schüttelte den Kopf. »Einige haben offenbar zwei linke Hände. Da wird mit viel zu vielen Verordnungen und Verboten vor den Preßkommandos herumgewedelt. Wir brauchen gute Seeleute, aber dann heißt es: ›Hände weg von Indienfahrern, Küstenschiffern und Bootsleuten‹. Verdammt noch mal, Sir, es ist doch auch deren Krieg.«
Bolitho lächelte. »Das haben wir schon ein paarmal festgestellt, Thomas.« Er deutete mit weit ausholender Gebärde auf den Raum mit seinen grünen Lederstühlen und dem soliden Mobiliar. »Hier ist alles sehr behaglich. Sie haben an der Benbow ein schönes Schiff.«
Herrick war störrisch wie immer. »Es sind die Männer, die Schlachten gewinnen, Sir. Nicht die Schiffe.« Verbindlicher fügte er hinzu: »Aber es ist ein stolzer Augenblick, das muß ich zugeben. Die Benbow ist ein gutes Schiff und schnell für ihre Größe. Wenn wir das nächste Mal in See gehen, werde ich mehr Munition nach achtern stauen lassen und damit vielleicht noch einen Knoten mehr herausholen.« Seine Blicke schweiften weit weg, verloren in die ständigen Überlegungen eines Kommandanten, wie er sein Schiff am besten trimmen konnte.
»Was macht Ihre Frau? Wird sie direkt nach Kent fahren?«
Herrick sah ihn an. »Aye, Sir. Sobald wir außer Sicht sind, sagt sie.« Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. »Bei Gott, ich bin ein Glückspilz.«
Bolitho nickte. »Ich auch, Thomas, daß ich Sie wieder als Flaggkapitän habe.« Er beobachtete eine Unsicherheit auf Herricks Gesicht und erriet, was kam.
»Es mag ungebührlich klingen, Sir, aber haben Sie nie daran gedacht … Ich meine, wollen Sie nicht überlegen …«
Bolitho hielt seinem Blick stand und antwortete ruhig: »Wenn ich Cheney zurückholen könnte, mein Lieber, würde ich den rechten Arm dafür geben. Aber eine andere heiraten?« Er schaute zur Seite, denn es gab ihm einen schmerzhaften Stich, als er sich an Herricks Gesicht erinnerte, wie der ihm damals die Nachricht von Cheneys Tod überbracht hatte. »Ich dachte, ich würde darüber hinwegkommen, mich von ihr lösen. Der Himmel weiß, Thomas, daß Sie alles getan haben, mir zu helfen. Manchmal bin ich nahezu daran, zu verzweifeln …« Er unterbrach sich. Was war mit ihm los? Aber als er Herrick anschaute, sah er nur Verständnis in dessen Zügen. Und Stolz, etwas mit ihm teilen zu können, das er wahrscheinlich länger als jeder andere gewußt hatte.
Herrick stand auf und stellte seine Kaffeetasse auf den Tisch. »Ich gehe jetzt besser wieder an Deck. Mr. Wolfe ist ein guter Seemann, aber es fehlt ihm die leichte Hand im Umgang mit den neuen Leuten.« Er zog eine Grimasse. »Weiß Gott, er jagt sogar mir manchmal Angst ein.«
»Wir sehen uns bei vier Glasen wieder, Thomas.« Bolitho drehte sich um und sah eine Möwe pfeilschnell am Fenster vorbeistreichen. »Was ist mit Adam? Ich habe ihn nur kurz gesprochen, als ich an Bord kam. Überhaupt gibt es noch viele Fragen.«
Herrick nickte. »Aye, Sir. Hoher Rang stellte höhere Anforderungen. Wenn Sie den jungen Adam gestern eingeladen hätten, hätten die anderen in der Masse etwas über Bevorzugung gemunkelt, was Sie selber nicht mögen. Aber er hat Sie vermißt. Ich glaube, er sehnt sich nach einer Fregatte, doch fürchtet er, uns beide damit zu kränken. Sie besonders.«
»Ich werde ihn bald zu mir rufen. Wenn alle an Bord so beschäftigt sind, daß sie keine Zeit mehr zum Tratschen haben.«
Herrick grinste. »Das ist bestimmt sehr bald der Fall. Nach der ersten richtigen Nordsee-Brise sind sie dazu viel zu erschöpft.«
Noch lange, nachdem Herrick gegangen war, saß Bolitho still auf der grünen Lederbank unter dem Heckfenster. So machte er sich mit dem Schiff vertraut, obwohl er nicht direkt an dem teilnehmen konnte, was über ihm und vor der Tür geschah, Füße stampften und Blöcke quietschten. Er wurde unruhig, sobald er die Geräusche als das Aufheißen eines Bootes, sein Einschwenken über die Laufbrücke und Abfieren auf das Bootsrack neben den anderen Booten erkannte.
Viele Leute waren an der Arbeit, von ihren Deckoffizieren und Maaten angeleitet und vorangetrieben. Es fehlte an erfahrenen Matrosen. Auf jede Wache und auf den Gefechtsstationen waren nur einige davon verteilt. Sie konnten allenfalls dafür sorgen, daß die neuen und unerfahrenen Leuten keine allzugroßen Gefahren heraufbeschworen.
Freiwillige waren in Devonport an Bord gekommen und einige sogar hier in Portsmouth: ehemalige Seeleute, die genug vom Leben an Land hatten, Männer, die vor dem Gericht, vor Gläubigern oder gar vor dem Galgen davongelaufen waren.
Der Rest, von den Preßkommandos an Bord geschleppt, war noch verstört, deprimiert, zu plötzlich eingefangen in eine Welt, die sie kaum kannten, allenfalls aus der Entfernung. Dies also war es, was sie sich unter einem Schiff des Königs, das unter vollen Segeln stolz aufs weite Meer hinausfuhr, vorgestellt hatten. Und das war die harte Wirklichkeit: überfüllte Wohndecks und der Stock des Bootsmanns.
Es war Herricks Aufgabe, sie mit seinen eigenen Methoden zu einer Mannschaft zusammenzuschweißen. Zu einer Besatzung, die tapfer ihren Mann stand und sich – wenn nötig – mit einem Hurra auf den Feind stürzte.
Bolitho sah sein Spiegelbild in den nassen Scheiben. ›Und meine Aufgabe ist es, das Geschwader zu führen.‹
Allday trat ein und betrachtete ihn nachdenklich. »Ich habe Ozzard gesagt, daß er Ihren besten Uniformrock bereitlegt, Sir.« Er lehnte sich nach Luv, als das Deck sich plötzlich schieflegte.
»Endlich ›mal‹ ’ne Abwechslung, anstatt immer mit Franzmännern zu kämpfen. Ich denke, es werden demnächst die Russen oder Schweden sein.«
Bolitho sah ihn zornig an. »›Mal ’ne Abwechslung‹? Ist das Ihr einziger Kommentar?«
Allday strahlte. »Politik ist natürlich wichtig, Sir. Für die Admirale, für das Parlament und so weiter. Aber für den armen Seemann?« Er schüttelte den Kopf. »Alles, was er sieht, sind die Mündungen der feindlichen Kanonen, die ihm ihr Feuer entgegenspeien, ihm mit eisernem Kamm einen Scheitel ziehen. Es kümmert ihn nicht groß, welche Flagge sie führen.«
Bolitho mußte erst einmal tief Luft holen. »Kein Wunder, daß die Mädchen auf Ihre Überredungskünste hereinfallen, Allday. Fast hätten Sie mich überzeugt.«
Allday lachte in sich hinein. »Ich bringe Ihre Frisur noch einmal in Ordnung, Sir. Wir werden uns überhaupt künftig etwas zusammennehmen müssen, mit einem Mr. Browne an Bord.«