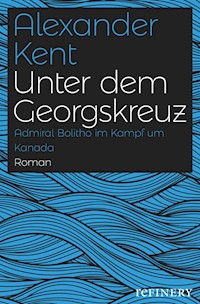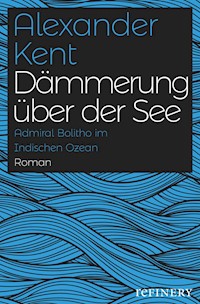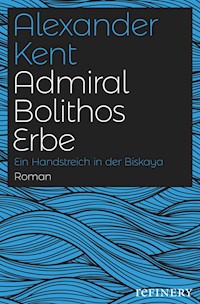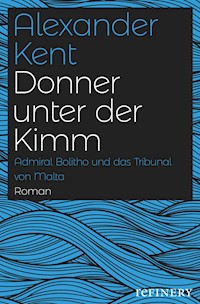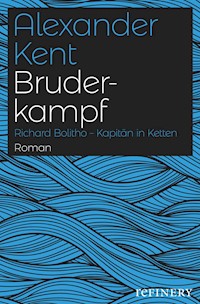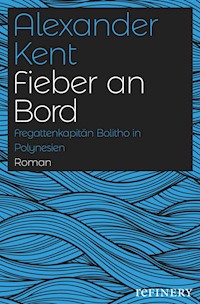
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
1789 – Auf Befehl des Gouverneurs der jungen britischen Kolonie Neusüdwales läuft Kapitän Richard Bolitho mit seiner Fregatte Tempest in den Südpazifik aus. Ganz auf sich allein gestellt, soll er mit seinem Schiff in Polynesien patrouillieren und die bedrohten Versorgungsrouten zwischen den einsamen Handelsposten sichern. Doch in dem scheinbaren Inselparadies grassieren Fieberseuchen, unter der Mannschaft kommt es zu einer Meuterei, und von Piraten aufgewiegelte Eingeborene bilden eine weitere Bedrohung. Richard Bolitho ist in jeder Hinsicht gefordert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben G.S. Forester.Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
1789 – Auf Befehl des Gouverneurs der jungen britischen Kolonie Neusüdwales läuft Kapitän Richard Bolitho mit seiner Fregatte Tempest in den Südpazifik aus. Ganz auf sich allein gestellt, soll er mit seinem Schiff in Polynesien patrouillieren und die bedrohten Versorgungsrouten zwischen den einsamen Handelsposten sichern. Doch in dem scheinbaren Inselparadies grassieren Fieberseuchen, unter der Mannschaft kommt es zu einer Meuterei, und von Piraten aufgewiegelte Eingeborene bilden eine weitere Bedrohung. Richard Bolitho ist in jeder Hinsicht gefordert …
Alexander Kent
Fieber an Bord
Fregattenkapitän Bolitho in Polynesien
Aus dem Englischen von Wilm W. Elwenspoek
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei RefineryRefinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Juli 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009© der deutschen Ausgabe: Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M. – Berlin 1978© der Originalausgabe: Bolitho Maritime Productions Ltd., 1976 Titel der englischen Originalausgabe: Passage to MutinyCovergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-145-4
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Erinnerungen
II Isolation
III Eine seltsame Nachricht
IV Nach dem Sturm
V Jetzt oder nie
VI Revanche
VII Die
Narval
VIII Kurzer Aufschub
IX Hinterhalt
X Zuviel Mut
XI »Macht das Beste daraus!«
XII Der schlimmste Feind
XIII Freiwillige
XIV Wenn, nicht falls
XV Eine Quelle der Kraft
XVI Kein Rückzug
XVII Ein eigensinniger Mann
XVIII Das ist der Tag
Epilog
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
I Erinnerungen
Widmung
Für Winifred in Liebe
Motto
Wo liegt das Land,nach dem sie Segel hissen?Weit, weit, voraus,ist alles, was sie wissen.Und wo das Land,woher ihr Schiff gekommen?Weit, weit zurück,mehr hat man nicht vernommen.
Arthur Hugh Clough
I Erinnerungen
Es war nahezu Mittag, und die Sonne brannte mit erbarmungsloser Intensität auf den Hafen von Sydney herab. Der Himmel über der jungen Kolonie hätte strahlend blau sein müssen, aber er war von Schleiern durchzogen, wie durch roh gegossenes Glas betrachtet, und die Luft um die Gebäude an der Kaimauer und dem Ankerplatz war gleichzeitig staubig und feucht.
Abseits der Ansammlung örtlicher Küstenfahrzeuge und größerer Kauffahrteifahrer lag für sich ein Kriegsschiff über seinem Spiegelbild, als ob es dort festgewachsen wäre und sich nie wieder fortbewegen würde. Seine Nationalflagge über dem hohen Achterdeck flatterte nur gelegentlich, und der breite Stander des Kommodore im Großtopp zeigte nur wenig mehr Leben.
Doch trotz der Hitze und des Unbehagens waren die Decks schon seit einiger Zeit von beobachtenden Gestalten bevölkert, da ein anderes britisches Kriegsschiff gemeldet worden war, das sich dem Hafen näherte.
Der Kommodore stützte sich auf die Fensterbank seiner Kajüte, zog die Hände aber hastig wieder zurück. Das trockene Holz fühlte sich an wie ein heißgeschossener Kanonenlauf. Aber er beobachtete weiter, war sich der ungewöhnlichen Stille auf seinem Schiff bewußt, während der Neuankömmling über das schimmernde Wasser langsam näher kroch und seine Masten und Rahen, dann auch der geschwungene Bug mit der Galionsfigur im Dunst klarere Formen annahmen.
Das Flaggschiff des Kommodore war die alte Hebrus, ein kleiner Zweidecker mit vierundsechzig Geschützen, die nach annähernd dreißig Jahren Dienst zur Ausmusterung bereit gewesen wäre. Doch dem Schiff und seinem Kommodore war eine weitere Mission aufgetragen worden, und jetzt, an einem Oktobertag des Jahres 1789, ankerte es als ranghöchstes britisches Kriegsschiff im Hafen von Sydney; man erwartete von ihm, daß es sich mit gewohnter Tüchtigkeit und altem Elan nach wie vor bewähren würde, obwohl viele seiner Offiziere insgeheim daran zweifelten, daß es England je wieder erreichen würde.
Das näher kommende Schiff war eine Fregatte, nichts Ungewöhnliches in Kriegszeiten und an jedem anderen Ort, wo der Einsatz ihrer Beweglichkeit und Schnelligkeit kurzfristig erforderlich sein konnte. Doch hier draußen, Tausende Meilen von der Heimat, von bekannten Gesichtern und vertrauten Sitten entfernt, war ein Schiff des Königs selten und um so willkommener.
Seine Anwesenheit war der Grund für die Stille an Bord der Hebrus. Jeder beobachtete ihr mühseliges Einlaufen bei schwächster Brise, und jeder sah in ihr etwas anderes: eine Stadt in England; eine Stimme; Kinder, an die man sich kaum erinnerte …
Seufzend richtete der Kommodore sich auf, und die Mühe verursachte einen neuen Schweißausbruch. Eigentlich absurd, das Ganze: Der Ankömmling war die Fregatte Tempest[1], sechsunddreißig Geschütze, und sie hatte England noch nie gesehen.
Er wartete, während sein Diener mit Galauniform und Degen, den Abzeichen seines Dienstranges, um ihn herumtappte; er erinnerte sich an das, was er von der Tempest gehört hatte.
Sechs Jahre zuvor, als der Krieg mit den amerikanischen Kolonien und der französisch-spanischen Allianz zu Ende ging, wurden Schiffe, die im Kampf ihr Gewicht in Gold wert gewesen waren, wie auch die meisten ihrer Besatzungen nicht länger benötigt. Ein Land vergaß schnell, wer für es gekämpft und gestorben war. Da wog der Weiterbestand eines Schiffes noch weniger. Doch der Friede zwischen den großen Mächten schien nie sehr dauerhaft, wenigstens nicht für jene, die an dem Preis für jeden blutigen Sieg beteiligt gewesen waren.
Und nun bestanden neue Spannungen mit Spanien, die leicht zu Schlimmerem ausarten konnten. Es ging um rivalisierende Ansprüche auf verschiedene Territorien, die jeder durch Handel und Besiedlung auszubeuten hoffte. Wieder einmal war die Admiralität angewiesen worden, mehr Fregatten einzusetzen, diese Lebensnerven jeder Flotte.
Die Tempest war auf der Werft der Honourable East India Company in Bombay erst vor vier Jahren gebaut worden. Wie bei den meisten Schiffen der Ostindischen Handelsgesellschaft waren beim Bau das beste Teakholz aus Malabar und die besten verfügbaren Pläne verwendet worden. Im Gegensatz zur Navy baute die Gesellschaft ihre Schiffe für langjährige Verwendung und mit einiger Rücksicht auf jene, die sie bemannen sollten.
Die Vertreter der Admiralität in Bombay hatten das Schiff dann für den Dienst des Königs gekauft, bevor es unter der Flagge der Handelsgesellschaft eingesetzt worden war. Es hatte sie achtzehntausend Pfund gekostet. Die Admiralität mußte in einer verzweifelten Lage gewesen sein, um einen so fürstlichen Preis zu bezahlen, überlegte der Kommodore; oder – und das war ebensogut möglich – ein paar zusätzliche Goldstücke hatten in anderer Richtung den Besitzer gewechselt.
Er winkte seinem Diener, ihm das Fernrohr zur reichen, und richtete das Glas auf das langsam manövrierende Schiff.
Wie die meisten Marineoffiziere war er vom Anblick einer Fregatte immer wieder beeindruckt. Diese hier war schwerer als üblich, verfügte aber dennoch über die anmutigen Proportionen, bot das gleiche Bild latenter Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit, die diese Schiffe zum Wunschtraum jedes jungen Seeoffiziers machten.
Trotz des Dunstes konnte der Kommodore auf dem Vorschiff der Fregatte eine Ansammlung von Gestalten ausmachen. Ein Anker war gekattet und zum Fallenlassen bereit, während das Schiff zielstrebig über seinem Spiegelbild dahinglitt, wobei sein Bug kaum die blaue Wasserfläche riffelte. Nur unter Marssegeln und Klüver fahrend, ging sie über Stag, um die schwache Brise zu nutzen; er konnte beinahe die Erregung jenseits des Wassers spüren. Der Anblick eines Hafens, jedes Hafens, verwischte immer die Erinnerung an die Mühsal und mitunter brutalen Bedingungen der Fahrt.
Der Kommodore hatte die Tempest schon vor zwei Wochen oder früher aus Madras erwartet. Depeschen, die er bereits durch eine Kurierbrigg erhalten hatte, hatten ihn nicht daran zweifeln lassen, daß die Tempest pünktlich eintreffen würde.
Als sich ihr Einlaufen verzögerte, war er nicht beunruhigt, wie er es bei einem anderen Schiff gewesen wäre. Die Tempest stand unter dem Befehl von Kapitän Richard Bolitho, nicht gerade einem persönlichen Freund, aber doch einem Landsmann aus Cornwall, und das war unter den üblen Verhältnissen dieser Strafkolonie beinahe genausoviel wert.
Er hob das Glas wieder ans Auge. Jetzt konnte er die Galionsfigur der Fregatte erkennen, eine Frauengestalt mit wilden Augen, wehendem Haar und vorspringenden Brüsten, die ein großes Muschelhorn an die Lippen hielt. Haar und Körper waren blank vergoldet, nur die Augen leuchteten in einem intensiven Blau und blickten weit in die Ferne, als folgten sie dem Weg ihrer Kinder, der Stürme. Die Vergoldungen der Galionsfigur und der Verzierungen rings um den Kajütaufbau mußten Bolitho ein kleines Vermögen gekostet haben. Aber in diesen Gewässern gab es wenig, wofür man sonst sein Geld verwenden konnte. Er zuckte unwillkürlich zusammen, als er seine Marinesoldaten zur Schanzpforte stampfen hörte. Schon ihre Stiefeltritte schienen ihm schwer genug, die alte Hebrus zu zertrampeln.
Ein Leutnant blickte respektvoll durch den Türvorhang.
Der Kommodore nickte knapp. Er wollte seinen Untergebenen nicht erkennen lassen, daß er sich so sehr für das andere Schiff interessierte. »Ja, ja, ich weiß. Ich komme hinauf.«
Noch als er nach seinem Hut griff, hallte der erste Salutschuß über den Hafen und scheuchte die dösenden Vögel vom Wasser auf, die kreischend durcheinanderflatterten, wie um den Neuankömmling dafür zu beschimpfen, daß er ihre Ruhe störte.
Auf dem Achterdeck war es trotz des ausgespannten Sonnensegels heiß wie in einem Backofen.
Der Flaggkapitän legte die Hand an seinen Hut und versuchte, die Stimmung seines Vorgesetzten zu ergründen. Er meldete: »Tempest, sechsunddreißig Geschütze, Kommandant Fregattenkapitän Richard Bolitho.«
Geschütz um Geschütz feuerte weiter Salut; der dunkle Qualm sank auf das Wasser hinab, als ob er eine schwere Masse wäre.
Der Kommodore legte die Hände auf dem Rücken zusammen.
»Signalisieren Sie, sobald sie Anker geworfen hat: Kommandant zu mir an Bord!«
Der Flaggkapitän unterdrückte ein Lächeln. Die Laune war also gut. Er hatte schon erlebt, daß er mitten in die letzten Manöver anderer Schiffe ein Dutzend Signale hatte geben müssen; als ob der Kommodore Vergnügen an der Verwirrung fände, die er damit stiftete. Dies muß ein Sonderfall sein, dachte er.
Mit Marssegeln, die noch unter dem für einen Kommodore vorgeschriebenen Salut von elf Schüssen vibrierten, setzte Seiner Britannischen Majestät Fregatte Tempest ihre langsame Fahrt durch den Hafen fort. Die Wasseroberfläche gleißte so grell, daß es schmerzhaft war, über Takelage oder Gangway[2] hinauszusehen.
Richard Bolitho stand an der Reling des Achterdecks, die Hände lose auf dem Rücken zusammengelegt, und versuchte, trotz der üblichen Spannung beim Anlaufen eines unbekannten Ankergrunds gelassen zu erscheinen.
Wie still es war. Er musterte sein Schiff und fragte sich, wie wohl der Kommodore es beurteilen würde. Er hatte das Kommando über die Tempest vor zwei Jahren in Bombay übernommen, als sie von der Marine in Dienst gestellt worden war.
Beim Gedanken an dieses Datum lächelte er, und sein ernstes Gesicht wirkte dadurch jugendlicher. Wie heute, war auch damals sein Geburtstag gewesen. Denn an diesem 7. Oktober 1789, der ihm ein weiteres Einlaufen unter vielen, längst vergessenen brachte, wurde Richard Bolitho aus Falmouth im County Cornwall dreiunddreißig Jahre alt.
Schnell warf er einen Blick zur anderen Seite hinüber, wo Thomas Herrick, der Erste Offizier der Tempest und sein bester Freund, mit einer Hand die Augen beschattend, die Stellung der Rahen und die perspektivisch verkürzten, halbnackten Seeleute im Topp kontrollierte. Er fragte sich, ob Herrick an seinen Geburtstag denken würde. Hoffentlich nicht. In diesen Gewässern, wo Woche auf Woche feindseliges Klima und hartnäckige Windstillen einander folgten, war man sich der Vergänglichkeit der Zeit nur zu bewußt.
»Noch fünf Minuten, Sir.«
»Gut, Mr. Lakey.«
Bolitho brauchte sich nicht umzusehen. In den zwei Jahren seines Kommandos auf der Tempest hatte er die Stimmen und das Temperament aller länger unter ihm Dienenden kennengelernt. Tobias Lakey war der hagere, schweigsame Steuermann, geboren und aufgewachsen auf den rauhen Scilly-Inseln, die seiner eigenen Heimat Cornwall vorgelagert waren. Im Alter von acht Jahren war Lakey zur See gegangen; jetzt war er etwa vierzig. Nach all diesen Jahren auf Schiffen jedes Typs, vom Fischerboot bis zum Linienschiff, hatte die See ihm nur noch wenig Neues beizubringen.
Bolitho versuchte, sich an die anderen Gesichter zu erinnern, die in den zwei Jahren von Bord verschwunden waren: durch Tod oder Verletzung, Krankheit oder Desertation; die Männer waren gekommen und gegangen wie die Gezeiten.
Die jetzige Besatzung der Tempest glich der anderer Schiffe, die nie einen britischen Hafen angelaufen hatten, und war so vielfältig wie die Küsten, die sie auf ihren Reisen sahen. Manche darunter waren Männer, die bei der Marine wirklich ihren Beruf gesucht hatten. Meist hatten sie auf Schiffen in England angeheuert und waren dann auf ein beliebiges anderes versetzt worden. Besser als die meisten anderen kannten sie die Verhältnisse in England, wo die sechs Jahre seit dem Krieg in manchem schlimmer gewesen waren als das Leben an Bord. Unter einem fairen Kommandanten und mit einer großen Portion Glück konnten sie ihren Weg machen. In ihrer Heimat dagegen, für die viele so lange und hart gekämpft hatten, gab es kaum Arbeit, und die Häfen waren nur zu oft von Kriegsversehrten und menschlichem Strandgut überfüllt.
Aber im übrigen war die Besatzung der Tempest ein Schmelztiegel, der Franzosen und Dänen, mehrere Neger, einen Amerikaner und viele andere vereinte.
Während Bolitho die Männer an Brassen und Fallen musterte, die Bootsbesatzung, die darauf wartete, seine Gig zu Wasser zu lassen, die Reihe der schwitzenden Marinesoldaten, die auf dem Hüttendeck angetreten waren, sagte er sich, daß er zufrieden sein sollte. Wäre er in England gewesen, hätte er sich gegrämt und bemüht, wieder auf See zu kommen, ein neues Schiff zu erhalten, irgendein Schiff. So war die Situation nach dem Krieg gewesen. Seither hatte er bereits zwei Kommandos innegehabt, eine Korvette und seine geliebte Fregatte Phalarope.
Als ihm die Undine überantwortet und er nach Madras am anderen Ende der Welt geschickt worden war, empfand er Dankbarkeit, daß ihm das Schicksal der vielen Kapitäne erspart blieb, die sich täglich in den Gängen der Admiralität drängten oder in den Cafés warteten, in der Hoffnung auf eben die Chance, die er bekommen hatte.
Das lag fünf Jahre zurück; von einem kurzen Besuch in England abgesehen, war er seitdem den heimischen Gewässern fern geblieben. Als er das Kommando über die Tempest erhielt, hatte er erwartet, zum Befehlsempfang nach England gerufen zu werden. Vielleicht wurde er nach Westindien geschickt, zur Kanalflotte oder in die Gebiete, um die man sich mit Spanien stritt?
Wieder blickte er zu Herrick hinüber und überlegte. Herrick äußerte seine Ansichten jetzt kaum noch, obwohl er sie einmal deutlich genug ausgesprochen hatte. Bis auf seinen Bootsführer John Allday kannte Bolitho sonst niemanden, der es wagte, durch offene Worte seinen Zorn herauszufordern.
Alte Erinnerungen wurden wach, als die Tempest vor zwei Monaten in Madras geankert hatte. Während seine Bootsmannschaft sich verzweifelt bemühte, ihren Kommandanten durch die wilde Brandung zu rudern, ohne daß er bis auf die Haut durchnäßt wurde, hatte er sich an seinen ersten Besuch erinnert. Damals hatte er Viola Raymond, die Frau des Beraters der britischen Regierung bei der East India Company, als Passagier an Bord gehabt.[3] Herrick hatte ihn damals offen vor den Gefahren einer Affäre gewarnt, vor dem Risiko für seinen guten Namen und seine Karriere in einem Beruf, den er liebte.
Automatisch tastete er nach der Uhr in seiner Tasche: Viola hatte sie ihm als Ersatz für jene geschenkt, die in einem Gefecht zerschossen worden war.
Wo mochte Viola jetzt sein?
Bei seinem kurzen Aufenthalt in England war er auch nach London gefahren. Zwar hatte er sich gesagt, er wolle nicht wirklich versuchen, sie wiederzusehen, wolle nur an ihrem Haus vorbeigehen und sehen, wo sie lebte. Doch er hatte genau gewußt, daß das Selbstbetrug war. Dabei hätte er sich ebensogut mit der Erinnerung begnügen können. Denn das Haus war, von der Dienerschaft abgesehen, leer. James Raymond und seine Frau weilten im Auftrag der Regierung im Ausland, wie ihm Raymonds Hauswart, abweisend bis zur Beleidigung, verkündete. An Bord mochte ein Kommandant zwar gleich nach Gott kommen, doch in den Straßen von St. James hatte er gar keine Bedeutung.
Bolitho hörte Herrick rufen: »Klar zum Ankern, Mr. Jury?«
Jury, der Bootsmann mit der breiten Brust, brauchte keinen Hinweis auf seine Pflichten bei den Ankergasten; folglich mußte Herrick Bolithos Stimmung erraten haben und versuchte nun, ihn herauszureißen.
Bolitho lächelte wehmütig. Herrick kannte er schon, seit er das Kommando der Phalarope übernommen hatte, und seither waren sie selten getrennt gewesen. Herrick hatte sich nicht sehr verändert. Vielleicht war er nun etwas breiter, aber das runde, offene Gesicht mit diesen leuchtendblauen Augen, die so vieles mit ihm gemeinsam gesehen hatten, war sich gleichgeblieben. Wenn, wie Bolitho jetzt vermutete, seine kurze Affäre mit Viola Raymond höheren Orts aufgefallen war, dann mußte auch Herrick darunter leiden, und das ohne jeden Grund. Dieser Gedanke wurmte Bolitho und stimmte ihn traurig. Vielleicht würde der Kommodore etwas Licht in die Dinge bringen. Aber diesmal wollte er nicht hoffen; er wagte es nicht.
Bolitho dachte an seine Depeschen, an die zusätzlichen Nachrichten, die er Kommodore James Sayer überbrachte. An Sayer erinnerte er sich gut, er war ihm ein- oder zweimal in Cornwall begegnet. Vorher hatten sie im selben Geschwader in Amerika gedient, beide als Leutnants.
Während der letzte Salutschuß noch in der Luft widerhallte, glitt die Tempest die letzte halbe Kabellänge[4] zu ihrem Ankerplatz.
Bolitho sagte knapp: »Wenn Sie soweit sind, Mr. Herrick?«
Herrick hob das Sprachrohr, seine Antwort war ebenso förmlich. »Aye, aye, Sir.« Dann rief er: »An die Leebrassen! Klar zum Aufschießen!«
Die reglosen Matrosen erwachten zum Leben.
»Marsbrassen los!«
Bolitho sah Thomas Gwyther, den Schiffsarzt, die Backbordgangway entlangkommen, wobei er versuchte, den geschäftigen Matrosen auszuweichen. Wie wenig war er mit dem letzten Arzt zu vergleichen, den Bolitho an Bord gehabt hatte. Das war ein gewalttätiger, herrschsüchtiger Trunkenbold gewesen, der es zugelassen hatte, daß seine Leidenschaft für den Alkohol, aber auch die Erinnerungen, die er damit hatte auslöschen wollen, ihn völlig zerstörten. Gwyther nun war ein gebeugter, ausgemergelter, kleiner Mann mit zottigem, grauem Haar, dessen gebrechliche Erscheinung seiner offenkundigen Zähigkeit und Ausdauer keineswegs entsprach. Er erfüllte bereitwillig seine Pflichten, zeigte aber an Land jedesmal weit mehr Interesse für die Vegetation als für die Menschen.
»Gei auf die Marssegel!«
Der Steuermann befahl mit seiner trockenen, nüchternen Stimme: »Ruder hart Backbord!«
Die Tempest gehorchte dem Ruder und der abflauenden Brise, drehte sich langsam über ihrem Spiegelbild und verlor an Fahrt. Auf den Decks wurde es noch heißer als zuvor, als auch das letzte Segeltuch aufgegeit und festgezurrt wurde.
»Laß fallen Anker!«
Bolitho hörte das vertraute Klatschen am Bug und hatte dabei vor Augen, wie der schwere Anker durch das stille, einladende Wasser brach. Doch als er sich an die beiden Haie erinnerte, die das Schiff mehrere Tage und fast bis in den Hafen hinein verfolgt hatten, mußte er ein Schaudern unterdrücken.
»Signal vom Flaggschiff, Sir: ›Bitten Kommandant an Bord.‹«
Bolitho wandte sich Midshipman[5] Swift zu. Dem Siebzehnjährigen unterstanden die Signalgasten, und zweifellos wartete er voller Ungeduld und Hoffnung auf eine Chance, befördert zu werden. Sein Blick wanderte weiter zu Keen, dem Dritten Offizier, und er fragte sich flüchtig, ob dieser sich noch an die Zeit erinnerte, als er selbst Swifts jetzigen Rang auf der Undine innehatte. Keen war zweiundzwanzig, braun wie eine Nuß und so adrett und hübsch, daß ihm die Mädchenherzen zufliegen mußten. Er hatte auf seinem ersten Schiff angemustert, weil sein Vater wünschte, daß er »sich selbst finde«, ehe er in das Londoner Familienunternehmen eintrat; doch dann war er bei der Marine geblieben, weil er dieses Leben liebte. Und das trotz eines fußlangen Holzsplitters, der bei einem Gefecht aus den Decksplanken gerissen worden war und seinen Körper in der Leistengegend durchbohrt hatte. Selbst jetzt noch verzog er das Gesicht, wenn der Vorfall nur erwähnt wurde. Allday, der jedem Schiffsarzt – und dem der Undine besonders – mißtraute, hatte den Splitter aus dem Körper des Jungen entfernt und Bolitho wieder einmal mit einem unerwarteten Talent überrascht.
»Gig zu Wasser!« rief Herrick durch die trichterförmig gehaltenen Hände. »Mr. Jury, mehr Leute an die Taljen, aber mit Beeilung!«
Allday verfolgte das hastige Manöver mit kritischen Blicken, als das Boot über die Finknetze gehievt wurde. In der blauen Jacke und der weiten weißen Hose, das Haar in seinem kräftigen Nacken sauber zusammengebunden, wirkte er so solide und zuverlässig wie immer.
Gelassen sagte er: »Ein neuer Ort, Captain, und zweifellos eine neue Aufgabe.« Dann schnauzte er: »Daß mir der Lack keinen Kratzer abkriegt, ihr Tölpel! Das Boot gehört dem Captain, nicht dem Koch!«
Manche der Altgedienten grinsten bei dem Ausbruch; jüngere oder jene, die sich mit diesem Umgangston noch nicht abgefunden hatten, duckten sich unwillkürlich.
Allday murrte: »Bei Gott, wenn wir nicht bald richtig zu tun kriegen, dann weiß ich nicht, was aus den Leuten wird!« Er schüttelte den Kopf. »Das sollen Seeleute sein?«
Was Allday unter »richtig zu tun« verstand, wußte Bolitho nicht. Sie unternahmen regelmäßige Patrouillen zwischen den sich ausbreitenden Handelsniederlassungen, die in dem Gebiet zwischen Sumatra und Neuguinea verstreut lagen. Auch waren sie viele hundert Meilen westwärts gesegelt, um wertvollen Handelsschiffen auf der Fahrt von Europa Begleitschutz zu bieten. Die Tempest war ständig im Einsatz gewesen. Denn mit der Ausbreitung des Handels, der Ausweitung von Niederlassungen zu Kolonien, kamen auch jene, die davon profitieren wollten: Piraten, selbsternannte Herrscher oder alte Gegner, die jetzt unter dem Schutz von Kaperbriefen segelten. Das Leben war auch ohne die zusätzliche Bedrohung durch feindselige Eingeborene und Tropenstürme gefährlich genug.
Vielleicht meinte er damit, wie Herrick, der Hitze und dem Durst zu entkommen, der täglichen Gefahr durch nicht kartographierte Riffe oder Überfälle kriegerischer Wilder.
Die Entdecker und großen Seefahrer hatten viel getan, um die Geheimnisse und Gefahren dieser Gewässer zu mildern, aber jene, die in ihrem Kielwasser kamen, hatten weniger edle Motive. Für eine Handvoll Nägel, ein paar Äxte und Perlenschnüre konnte ein Kapitän beinahe alles und jeden kaufen.
Zum Nutzen ihres Handels und ihrer Besitzungen übernahmen Großbritannien, Frankreich und Holland den Schutz weiter Seegebiete, damit die gefährdeten Handelsschiffe ihre Aufträge erfüllen konnten. Unglücklicherweise waren die Ozeane zu groß und die eingesetzten Kräfte zu gering, als daß dies mehr hätte darstellen können als eine Geste. Auch trauten die Länder, die das meiste in Indien und der Südsee investiert hatten, einander nicht; zudem hatten sie alte Kriege und unbezahlte Schulden nicht vergessen.
Bolitho hörte die Bootsmannschaft in die Gig klettern und sah, daß das Spalier der Marinesoldaten und die Bootsmannsmaaten für die Zeremonie seines Vonbordgehens bereitstanden.
Er blickte zu dem schlaffen Wimpel im Masttopp auf und dann über das schimmernde Wasser zu den beiden großen Transportern hinüber, die ein gutes Stück vom Land entfernt ankerten.
Hier lag eine zusätzliche Verantwortung: die wachsende Kolonie Neusüdwales. Er suchte auf den großen Transportern nach Lebenszeichen. Wie viele bedauernswerte Existenzen waren auf diesen Sträflingsschiffen hierhergebracht worden, um Arbeitskräfte für die Erschließung des Landes und die Gründung einer Nation zu stellen? Er versuchte, sich auszumalen, wie es auf einem solchen Schiff aussehen mochte, wenn es sich um das Kap der Guten Hoffnung oder, schlimmer noch, um das gefürchtete Kap Hoorn kämpfte, mit Männern, Frauen und Kindern an Bord.
Herrick griff an seinen Hut. »Boot ist klar, Sir.«
Bolitho nickte ernst und blickte zu den rotröckigen Marinesoldaten und ihrem Hauptmann Jasper Prideaux hinüber. Gerüchte wollten wissen, Prideaux diene nur bei den Marinesoldaten, weil er im Duell zwei Männer getötet hatte und fliehen mußte. Bolitho hatte mehr Anlaß als mancher andere, das zu verstehen.
Zwei Jahre lang hatte er versucht, seine Antipathie gegen Prideaux zu unterdrücken. Trotz Sonne und Seeluft war der Hauptmann der Marinesoldaten blaß geblieben und sah ungesund aus. Er hatte scharfe, fast spitze Züge – wie ein Fuchs. Wie einer, der sich mit Freunden duellierte und dabei gewann. Bolitho war es nicht gelungen, seine Abneigung zu überwinden.
»Achtung im Boot!«
Allday stand an der Pinne, mit einem Auge auf Bolithos Degen, während sein Kapitän, begleitet vom Klang der Bootsmannsmaatenpfeifen und präsentierten Musketen, ins Boot hinunterkletterte.
»Absetzen! Riemen bei! Rudert an!«
Bolitho schützte mit der Hand die Augen, als das Boot schnell um den Bug und unter der blauäugigen Galionsfigur hindurchglitt.
Die Tempest war ein gutgebautes Schiff, aber wie Lakey oft genug gesagt hatte, eben ein Schiff der Company, gleichgültig, welche Flagge von ihrer Gaffel wehte. Mit sechsunddreißig Geschützen, darunter achtundzwanzig Zwölfpfündern, war sie stärker als jedes andere Schiff, das er bisher befehligt hatte. Aber sie war aus Teakholz und so schwer gebaut, mit entsprechend massiven Stengen und Spieren, daß ihr die schnelle Beweglichkeit fehlte, die von einem Schiff des Königs im Gefecht auf kurze Distanz gefordert wurde. Sie war gebaut worden, um schwerfällige Indienfahrer vor Piraten zu schützen und in deren Schlupfwinkeln Furcht zu verbreiten.
Gleich zu Anfang hatte Herrick bemerkt, falls sie von einem wirklich kriegstüchtigen Schiff angegriffen werden sollten, mußten sie auf kurze Distanz bedacht sein und sie halten. Täuschungs- oder Überraschungsmanöver in letzter Minute kamen nicht in Betracht.
Auf der anderen Seite mußten selbst die größten Zweifler einräumen, daß die Tempest unter günstigen Bedingungen ein guter Segler war. Schon mit ihrer Grundausstattung an Segeln, und sie verfügte über siebzehntausend Quadratfuß, schaffte sie fünfzehn Knoten, also fünfzehn Seemeilen in der Stunde. Aber Lakey, nüchtern wie immer, hatte gesagt: »Das Ärgerliche ist, daß man nicht immer günstige Bedingungen hat.«
Bolitho vergewisserte sich, daß seine Depeschen und sein eigener Bericht unter der Ducht sicher verstaut waren, und wandte dann seine Aufmerksamkeit der Hebrus zu.
Auch so ein halbes Wrack. Vielleicht ging in Europa alles so schnell, daß man sie darüber vergessen hatte. Rings um die Erde kreuzten einzelne, verlassene Schiffe wie seines und das des Kommodore in völliger Unkenntnis dessen, was in den Ländern geschah, wo über ihr Schicksal entschieden wurde.
»Laß laufen!« Allday legte Ruder und kniff in der grellen Sonne die Augen zusammen, bis sie in den Schatten des Flaggschiffs glitten. »Anhaken, Buggast!«
Bolitho stand auf und atmete tief ein. Bei solchen Gelegenheiten mußte er stets an einen Kapitän denken, unter dem er einmal gedient hatte. Als jener zum ersten Mal an Bord seines Schiffes ging, hatte er sich mit den Beinen im Degengehänge verfangen und war der Länge nach zu Füßen seiner verblüfften Marinesoldaten hingeschlagen.
An der Schanzpforte nahm er seinen Hut ab und wartete, bis der Lärm der Befehle und das Klatschen der Musketen beim Präsentieren verklungen war.
Mit ausgestreckter Hand kam der Kommodore ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte Bolitho, sich geirrt zu haben. Das war nicht Leutnant James Sayer aus den amerikanischen Kolonien oder auch nur aus Cornwall. Das war ein ganz anderer Mann.
Der Kommodore sagte: »Freut mich sehr, Sie wiederzusehen, Richard. Kommen Sie nach achtern und berichten Sie.«
Erschüttert erwiderte Bolitho den Händedruck. Sayer war ein gutgebauter, lebhafter Mann gewesen. Jetzt hatte er Hängeschultern und ein von tiefen Furchen durchzogenes Gesicht; das Schlimmste aber war seine Haut: wie altes, unbrauchbares Pergament. Und doch zählte er nur zwei oder drei Jahre mehr als Bolitho.
In der verhältnismäßigen Kühle der Kommandantenkajüte warf Sayer den schweren Rock seiner Paradeuniform ab und ließ sich in einen Sessel sinken.
»Ich habe nach Wein geschickt. Mein Diener lagert ihn an einer besonders kühlen Stelle in der Bilge. Nur Rheinwein, aber man hat ja schon Glück, wenn man hier draußen so etwas bekommt.« Er schloß die Augen und stöhnte: »Was für ein Land! Eine Insel der Verbrecher in einem Meer von Korruption.«
Er wurde erst munterer, als der Diener mit Flaschen und Gläsern eintrat.
»Nun zu Ihren Depeschen, Richard.« Er sah Bolithos Gesicht. »Was gibt es?«
Bolitho wartete, bis der Diener eingeschenkt und die Kajüte wieder verlassen hatte.
»Ich wurde auf dem Weg hierher aufgehalten, Sir. Drei Tage nach Madras gerieten wir in Schlechtwetter, und zwei meiner Leute wurden schwer verletzt, als sie von oben kamen. Zwei weitere gingen über Bord.«
Von der Erinnerung bedrückt, senkte er den Blick. Mitten in der Nacht war blitzschnell Sturm aufgekommen und ebenso schnell wieder abgeflaut. Das Resultat: zwei Tote und zwei permanent Verkrüppelte.
»Ich entschloß mich, Timor anzulaufen und die Verletzten dort an Land zu setzen. Mit dem holländischen Gouverneur in Coupang hatte ich bereits zu tun gehabt, und er war immer sehr hilfsbereit gewesen.«
Der Kommodore beobachtete ihn über den Rand seines Pokals. »Ja. Sie haben sich in diesem Gebiet gegen Piraten und Kaperer erfolgreich behauptet.«
Bolitho fuhr fort: »Ohne diesen unvorhergesehenen Besuch hätte ich folgendes nicht erfahren: Auf einem Schiff, einem Kriegsschiff, hat es eine Meuterei gegeben. Vor sechs Monaten, dem Gouverneur zufolge, auf der Rückfahrt von Tahiti. Ich bin mir über die Gründe nicht im klaren, aber eines steht fest: Die Meuterer setzten die Offiziere und die loyal gebliebene Mannschaft in einem Boot aus. Ohne ihren Kommandanten – wie ich hörte, heißt er Bligh – wären sie umgekommen. Aber er schaffte es bis Timor, über dreitausendsechshundert Meilen weit, wo er Hilfe fand. Das Schiff war ein bewaffneter Transporter, die Bounty.«
Sayer blickte ihn ernst an. »Davon wußte ich nichts.« Er trat an die breiten Heckfenster. »Jetzt werden die Meuterer vermutlich ein Piratenschiff aus ihr machen. Außer dem Strick haben sie keine andere Wahl.«
Bolitho nickte, er fühlte sich beunruhigt. Meuterei …
Schon das Wort war wie der Kontakt mit einer schrecklichen Krankheit. Ähnliches hatte er an Bord seiner ersten Fregatte Phalarope erlebt, und die Erinnerung war fest haftengeblieben.[6]
Als der Kommodore nur schwieg und weiter aus dem Fenster blickte, fuhr Bolitho fort: »Ich lichtete Anker, nahm Kurs nach Südwesten und dann an der Südküste der Kolonie entlang. Ich lief die Adventure Bay von Van Diemen’s Land an, weil ich glaubte, die Meuterer hätten sich dorthin flüchten können, ehe die Nachricht von ihrem Verbrechen bekannt wurde.« Er hob die Schultern. »Aber sie waren verschwunden. Jetzt glaube ich, daß sie gar nicht die Absicht haben, in ein zivilisiertes Land zurückzukehren, wo sie belangt werden könnten. Sie werden in der Großen Südsee bleiben wie so viele Abtrünnige und Mörder, die auf Kosten unseres Handels und der Eingeborenen leben. Aber ein Schiff des Königs? Der Gedanke ist unerträglich.«
Sayer drehte sich mit einem trüben Lächeln zu ihm um. »Sie haben ja auch Grund, das Wort Meuterei zu hassen. Aber ich bin froh über Ihre Entdeckung. Höhere Stellen als wir werden jedoch darüber entscheiden, was als nächstes geschehen soll, zweifeln Sie nicht daran.« Er trank aus seinem Pokal. »Bligh, haben Sie gesagt?« Er schüttelte den Kopf. »Er muß ein sehr willensstarker Mann sein, wenn er eine solche Fahrt überlebt hat.«
Bolitho spürte, wie er sich entspannte. Seit er mit dem holländischen Gouverneur gesprochen hatte, war ihm diese Meuterei nicht aus dem Kopf gegangen, aber unter Sayers Einfluß sah er sie jetzt in der richtigen Perspektive. Er hatte wie die meisten Kapitäne reagiert: sich selbst in der gleichen verzweifelten Situation vorgestellt. Doch ohne das Schiff, die Mannschaft oder die Umstände zu kennen, war es das gleiche, wie den Mond anzubellen, er solle heller scheinen.
Mit plötzlichem Mitgefühl beobachtete er Sayer. Seine wenig beneidenswerte Aufgabe hatte ihn erschöpft, ein überstandenes Fieber hatte ihn ausgelaugt, aber er war nichtsdestoweniger der ihm Vorgesetzte Offizier. Genauso war Bolitho der einzige Repräsentant der größten Seemacht der Welt gewesen, als er auf der Suche nach Piraten und Eingeborenenhäuptlingen, die ihnen Schutz boten, viele hundert Meilen zurückgelegt hatte. Eines Tages würde vielleicht auch sein Schiff den breiten Stander des Kommodore führen, aber er bezweifelte, daß ihn die gleiche Selbstsicherheit wie Sayers auszeichnen würde.
Der Kommodore sagte: »Ich werde unverzüglich den Gouverneur aufsuchen. Und Ihnen empfehle ich, auf Ihr Schiff zurückzukehren und Wasser und sonstige Vorräte zu übernehmen.« Er musterte ihn gelassen. »Ich fürchte, ich werde Sie bald wieder auf See schicken müssen. Das hätte ich ohnehin getan, aber Ihre Nachrichten beschleunigen es noch.« Als Bolitho sich erhob, fügte er hinzu: »Falls Sie zusätzliche Leute brauchen, läßt sich das wahrscheinlich regeln. Nach zwei Jahren in der Botany Bay ist nur schwer festzustellen, wo ein abgeschobener Sträfling aufhört und der ehrliche Mann anfängt.« Er zwinkerte. »Ich werde an Land mit dem Einbürgerungsoffizier sprechen.«
An der Schanzkleidpforte blieb Sayer neben Bolitho stehen und blickte zur Tempest hinüber. In dem grellen Licht wirkte ihr laufendes Gut wie aus schwarzem Glas.
»Ein schönes Schiff.« Es klang sehnsüchtig.
»Ich nehme an, daß Sie bald nach England zurückkehren werden, Sir«, tröstete Bolitho.
Der Kommodore hob die Schultern. »Ich würde Cornwall gern Wiedersehen.« Er streckte die Hand aus und berührte die abgegriffene Reling. »Aber wahrscheinlich werde ich hier draußen sterben wie meine gute alte Hebrus.« Das sagte er ohne Groll oder Bitterkeit.
Bolitho trat zurück und grüßte die Flagge.
Während die Marinesoldaten wieder vor ihm präsentierten und er zu seiner Gig hinunterkletterte, ertappte er sich dabei, daß er an die schönen Häuser in St. James dachte. Würde es dort jemanden treffen, wenn man las, daß Sayer tot war?
Er glaubte, die Antwort zu kennen; sein Gesicht war finster, als Allday den Befehl zum Ablegen gab.
Als er schweigend im Boot saß, das aus dem Schatten des Flaggschiffs in die sengende Hitze hinausglitt, betrachtete er die Gesichter der rudernden Matrosen. Was wußte er schon von diesen Männern? Da war es im Krieg ganz anders. Der Feind war klar definiert, und die Sache, um die es ging, immer gerecht, denn es war ja die eigene. Zusammenhalten, Hurra rufen und Zurückschlagen, das kennzeichnete jene desperate Welt. Doch hier, meilenweit von jeder Zivilisation entfernt, was würden Männer wie sie empfinden, wenn man sie zu weit trieb?
Allday blickte auf Bolithos hochgezogene Schultern hinab, auf das schwarze Haar, das über dem goldbestickten Kragen ordentlich zusammengebunden war. Der Kommandant grübelte wieder einmal, wie üblich, machte sich Sorgen um andere. Er wußte genau, was Bolitho in erster Linie beschäftigte, denn er war während der Meuterei auf Bolithos Schiff gewesen, ein zum Dienst gepreßter Mann. Auch er konnte es nicht vergessen. Wie der Rest der Crew hatten auch die von ihm ausgesuchten und ausgebildeten Rudergasten von der Meuterei auf der Bounty erfahren; bis Sonnenuntergang würde auch jeder Bewohner und Sträfling der Kolonie Bescheid wissen.
Allday hatte seine Eltern nie gekannt und konnte sich nicht erinnern, in welchem Alter er zum erstenmal auf ein Schiff gekommen war. Er hatte sein ganzes Leben auf See verbracht, von einer kurzen Unterbrechung in Falmouth abgesehen, wo er von einem Preßkommando auf Bolithos Schiff entführt worden war.[7]
Vor jener Zeit hatte er mehrere Kapitäne kennengelernt, unter denen eine Meuterei gerechtfertigt gewesen wäre: grausame, brutale Männer, die offenbar Freude daran hatten, ihre Leute leiden zu sehen. Selbst die geringste freundliche Geste von Männern dieser Art konnte in der überfüllten Welt zwischen den Decks wie ein Wunder wirken. Das war wie Hohn, solange es andere wie Bolitho gab, die ihre Verantwortung ernst nahmen.
»Wenn Sie nicht auf Ihre Arbeit achten, Allday«, schnauzte Bolitho, »kommen wir noch durch eine Stückpforte an Bord.«
Allday legte Ruder und grinste Bolithos Rücken an.
So gefiel er ihm schon besser.
Wie ein verführerischer Samtvorhang hüllte die Dämmerung schnell den Hafen ein. Sie half, die Hitze des Tages zu vergessen und die Anstrengungen bei der Ergänzung des Proviants, den Benjamin Bynoe, der Zahlmeister mit den harten Augen, zu günstigsten Bedingungen eingehandelt hatte.
Bolitho lehnte sich auf der Bank unter dem geöffneten Heckfenster zurück und sah die Lichter der Stadt herüberwinken. Es war der zweite Abend, an dem sie in Sydney vor Anker lagen, aber sein erster an Bord. Kommodore Sayer hatte ihn völlig in Anspruch genommen, vorwiegend an Land, wo er dem stellvertretenden Gouverneur begegnet war, dessen Vorgesetzter sich irgendwo in der Kolonie mit einer Eingabe »dieser verdammten Farmer«, wie er sie nannte, beschäftigte.
Bolitho war auch mit den Offizieren der Garnison zusammengekommen. Dabei hatte er den deutlichen Eindruck gewonnen, daß sie ihre Angelegenheiten nicht gern mit Fremden besprachen. In diesem Sinne hatte er sich auch Sayer gegenüber geäußert, der über seine Vermutung gelächelt hatte.
»Sie haben ganz recht, Bolitho«, hatte der Kommodore gesagt. »Zuerst ließ der Gouverneur von Marinesoldaten die öffentliche Ordnung sichern und die deportierten Sträflinge bewachen. Aber dann wurden sie in England gebraucht und zurückgeschickt. Diese ›Soldaten‹, mit denen Sie jetzt gesprochen haben, gehören dem New South Wales Corps an. Sie wurden mit hohen Kosten eigens angeworben, und in vielen Fällen sind sie noch unehrlicher als jene, die sie bewachen sollen. Auch für einen Sack voll Gold möchte ich nicht in den Schuhen des Gouverneurs stecken.«
Bolithos Eindrücke von Sydney waren ebenso gemischt. Die Gebäude waren primitiv, aber günstig gelegen, mit leichtem Zugang zum Wasser. Manche standen – wie die riesigen Windmühlen hinter der Stadt – gleich hageren Zaungästen auf den Anhöhen und verrieten den holländischen Einfluß, praktisch und gut entworfen.
Bolitho war von den Häfen vieler Länder an Rohheit und Trunksucht gewöhnt, aber Sydneys Überfluß an Hafenkneipen und Schlimmerem ließ manches, was er gesehen hatte, als zahm erscheinen. Sayer hatte ihm erzählt, daß viele Wirte sogar im Sold der Offiziere standen, die den Verkehr ihrer Leute mit den deportierten Schankmädchen offen förderten. Dabei hatte er die Männer, die nur aus Habgier ins Corps eingetreten waren, voller Verachtung als Schwindler und Halunken bezeichnet.
Wieder an Bord, gelang es Bolitho, sich von dem hektischen Treiben an Land zu lösen und etwas Ruhe zu finden. Sayer hatte über neue Aufgaben für die Tempest noch nichts in Erfahrung gebracht; das würde sich erst ergeben, wenn der Gouverneur zurückkehrte.
Bolitho gegenüber lehnte Herrick in einem Sessel. Sie hatten eine ausgezeichnete Hammelpastete gegessen, die Noddall, der Kabinensteward, aus unbekannten Quellen an Land beschafft hatte: seit Monaten das erste Fleisch, das nicht aus einem Pökelfaß kam.
»Was halten Sie von einem Glas Rotwein, Thomas?« meinte Bolitho.
Herrick grinste; seine Zähne schimmerten schwach im Licht der einzigen Lampe. Sie hatten schnell entdeckt, daß mehr Beleuchtung nur Schwärme summender Insekten anzog, die die Wohltat der kühleren Luft sofort zunichte machten.
»Nicht viel, Sir«, antwortete er und winkte Noddall aus dem Schatten. »Ich habe mir erlaubt, beim Quartiermeister der Kaserne guten französischen Wein zu beschaffen.« Er lachte verhalten. »Als Soldaten mögen sie nicht viel wert sein, aber sie verstehen zu leben.«
Noddall machte sich am Tisch mit seinem Weinkühler zu schaffen.
Bolitho beobachtete ihn; er kannte jede seiner Bewegungen. Noddall war klein und flink wie ein Wiesel, hielt sogar die Hände, wenn sie nicht beschäftigt waren, wie Pfoten vor seinen Körper. Ein guter und williger Diener, war er wie mancher andere von Bolithos Undine mit auf dieses Schiff gekommen.
Herrick stand auf. Sein Kopf reichte nicht bis an die Decksbalken der Kajüte, was ein Beweis für die großzügigen Abmessungen der Tempest war. Er hob sein Glas.
»Auf ihr Wohl, Sir, und auf Ihren Geburtstag.« Er grinste. »Ich weiß, daß er eigentlich gestern war, aber ich brauchte einen Tag, um den Wein zu entdecken.«
Wortkarg saßen sie zusammen, rauchten ihre langen Pfeifen, und ihre Gläser wurden von dem aufmerksamen Noddall bereitwillig nachgefüllt.
Durch das Oberlicht konnten sie die Sterne sehen, sehr groß und nahe, und die regelmäßigen Schritte des Steuermannsmaaten der Wache hören, dazwischen das gelegentliche Scharren der Stiefel des Marinesoldaten, der jenseits des Schotts Posten stand.
Bolitho sagte: »In Cornwall ist es jetzt Spätherbst.« Er wußte nicht, warum er das sagte, vielleicht hatte er an Sayer gedacht. Sofort sah er es vor sich: goldenes und braunes Laub, jede Morgendämmerung eine Spur kälter, aber immer noch frisch und klar. Das hielt den Winter auf. Er versuchte, sich an die üblichen Geräusche zu erinnern: den Ton der klingenden Hämmer, wenn die Landarbeiter die Zeit nutzten, um die typischen Stein- und Schieferwälle zu bauen oder zu reparieren, die ihre Felder und Häuser voneinander trennten. Das Blöken der Schafe und Stampfen der Fischer, die am Abend von Falmouth zu ihren kleinen Weilern heraufwanderten.
Er dachte an sein eigenes Haus unterhalb von Pendennis Castle: kantig und grau, seit Generationen das Heim der Bolithos. Jetzt wohnte dort niemand – von Ferguson, dem Verwalter, und der Dienerschaft abgesehen. Alle waren entweder tot oder fortgezogen wie seine beiden verheirateten Schwestern, die ihr eigenes Leben führten. Er erinnerte sich seiner ersten Begegnung mit dem Hauptmann der Marineinfanterie, Prideaux. Dessen Ruf als Duellant hatte ihn an seinen Bruder Hugh erinnert. Hugh hatte wegen einer Spielschuld einen Offizierskameraden im Duell getötet und war nach Amerika geflohen. Daß er von seinem Schiff desertierte, war für ihren Vater schon ein schwerer Schock gewesen, doch als Hugh in die Marine der amerikanischen Revolutionäre eintrat und ein Kaperschiff gegen seine alten Freunde und Waffenbrüder führte, hatte das den Tod des alten Mannes vollends beschleunigt. Nun lebte auch Hugh nicht mehr, war angeblich von einem durchgehenden Pferd in Boston getötet worden.
Herrick spürte die Veränderung in Bolithos Stimmung.
»Ich glaube, es wird Zeit für mich, Sir. Ich ahne, daß uns morgen einiges bevorsteht. Zwei Tage im Hafen?
›Aber, aber!‹ wird oben bestimmt jemand sagen, ›dazu ist die Tempest nicht da.‹ Und das stimmt auch.« Er grinste breit. »Ich glaube wirklich, wenn wir alle Leute hätten an Land gehen lassen, dann hätten wir sie nie zurückbekommen. Nicht in diesem Hafen.«
Bolitho blieb noch lange am Heckfenster sitzen, nachdem Herrick zu seiner Koje gegangen war – oder wahrscheinlicher in die Messe zu einem letzten Drink mit den anderen Offizieren.
Herrick schien immer zu ahnen, wann sein Kommandant allein sein wollte, um nachzudenken; wie er auch verstand, daß die Bindung zwischen ihnen dadurch nur stärker wurde.
Bolitho beobachtete den Rauch, der von seiner Pfeife aufstieg und langsam hinaus über das schwarze Wasser zog. Es tat nicht gut, zu oft an zu Hause zu denken. Doch er war jetzt schon so lange fort, und wenn er hier verbannt bleiben sollte, dann mußte er etwas dagegen unternehmen.
Er hörte seltsam trauriges Geigenspiel vom Vordeck; vermutlich Owston, der Seiler, der für die Ankerwache aufspielte und auch die anderen Leute der Hundewache unterhielt.
Die Tempest mußte vom Ufer her einen schönen Anblick bieten: Die offenen Stückpforten, von innen beleuchtet, wirkten wie gelbe Augen. Dazu das Ankerlicht und eine Laterne an der Steuerbordgangway, damit sich der Wachoffizier an Bord bewegen konnte, ohne in der Dunkelheit zu straucheln.
Bolitho dachte an einige der Deportierten, die er gesehen hatte. Gewiß war keiner von ihnen wegen schwerer Vergehen hier, sonst hätte man sie gehenkt. Es beschämte ihn, daß er eben noch finster über seine eigene Trennung von der Heimat gebrütet hatte. Was mußten dagegen diese Verbannten leiden, wenn sie sein Schiff sahen, das schließlich Anker lichten und vielleicht nach England segeln würde. Wogegen sie …
Er blickte überrascht auf, als an die Außentür geklopft wurde. Es war Borlase, der Zweite Offizier. Als Wachführer war er zweifellos der einzige Offizier an Bord in voller Uniform. Er war sechsundzwanzig Jahre alt, groß und kräftig gebaut, und doch waren seine Züge weich, sogar sanft, und sein Gesicht wirkte im allgemeinen leicht überrascht. Bolitho vermutete, daß das ursprünglich eine Tarnung für seine Empfindungen gewesen, jetzt aber zur ständigen Gewohnheit geworden war.
Borlase war Erster Offizier auf einer kleinen Fregatte gewesen, die in der Nähe der Philippinen auf Grund gelaufen und verlorengegangen war. Zum Glück hatte sich ein Ostindienfahrer in der Nähe befunden und die gesamte Besatzung bis auf drei Mann gerettet. Von einem hastig eingesetzten Kriegsgericht wurde der Kommandant der Fregatte wegen Nachlässigkeit im Dienst unehrenhaft entlassen. Borlase war zu der Zeit wachhabender Offizier gewesen, und seine Aussage hatte dazu beigetragen, daß sein Kommandant in der Versenkung verschwand.
Bolitho fragte: »Was gibt es, Mr. Borlase?«
Der Leutnant trat in den Lichtschein der Lampe.
»Das Wachboot hat diese Depesche für Sie gebracht, Sir.« Er leckte sich die Lippen, eine weitere kindliche Angewohnheit. »Vom Gouverneur.«
Hastig tauchte Noddall mit einer weiteren Lampe aus der Pantry auf. Sein kleiner Schatten tanzte gigantisch über die weißgetünchte Zwischenwand.
Bolitho schlitzte den Leinwandumschlag auf und fragte sich dabei, ob Borlase vor dem Kriegsgericht sich nicht ebensosehr hatte entlasten wie seinen Kapitän zu Fall bringen wollen.
Doch als er hastig das sauber geschriebene Papier überflog, verblaßten mit einem Mal die Strapazen und Sorgen der vergangenen Monate, und selbst Borlase, der ihn mit einem sanften Lächeln beobachtete, schien zu verschwinden.
Scharf sagte er: »Kompliment an den Ersten Offizier, Mr. Borlase, und ich möchte ihn sofort sprechen.«
Der Leutnant öffnete den Mund, um eine Frage zu stellen, schloß ihn aber wieder.
Bolitho ging zum Heckfenster, beugte sich so weit hinaus, wie er konnte, und ließ sich die Seeluft über Kehle und Brust streichen. Jetzt wünschte er, er hätte nicht so viel getrunken und gegessen.
Er versuchte, seine Gedanken zu ordnen, sich auf die Depesche zu konzentrieren. Die Tempest sollte bei erster Gelegenheit Anker lichten und auslaufen. Er spürte, wie die Luft ihm Kopf und Gesicht kühlte, und fühlte sich kräftiger; noch während er seine rasenden Gedanken sammelte, betrat Herrick die Kabine.
»Sir?«
»Wir haben Befehl zum Auslaufen, Thomas. Ein Transporter ist überfällig, obwohl von einem Postschiff gemeldet wurde, daß er vor drei Wochen noch sicher unterwegs war. Der Kapitän des Postschiffs hatte südöstlich von Tongatapu Signalkontakt mit ihm gehabt.«
Herrick schob sich das Hemd in die Hose und sagte nachdenklich: »Aber das ist über zweitausend Meilen entfernt, Sir.«
Bolitho nickte. »Andererseits war das Schiff, die Eurotas, hier ein regelmäßiger Besucher. Sie belieferte die Kolonie und einige Inseln, ihr Kapitän ist mit diesen Gewässern gut vertraut. Es hat keinen Sinn, sich etwas vorzumachen. Sie hätten schon vor Tagen eintreffen müssen.« Er dachte an die Kneipen und die Mädchen mit den frechen Augen. »Der Gouverneur hielt die Verspätung geheim, selbst vor seinen Untergebenen, denn die Eurotas hat Kanonen, Pulver und Nachschub geladen. Und sie bringt den Sold für Militär und Beamte.«
»Glauben Sie, daß sich die Meuterer der Bounty in diesem Gebiet aufhalten könnten, Sir?«
Bolitho dachte an die dringlichen Anweisungen des Gouverneurs, an seinen Zorn. Am stärksten hatte ihn der letzte Absatz betroffen: neben ihrer wertvollen Ladung brachte die Eurotas weitere Deportierte, und vor allem – er konnte es fast vor Augen sehen – den neuernannten Berater und amtierenden Gouverneur für eine weitere Kolonie, James Raymond, mit seiner Frau.
Bolitho wandte sich von den schimmernden Lichtern ab; ihr Glanz war trübe geworden.
»Wecken Sie den Steuermann, Thomas, und stellen Sie den frühestmöglichen Augenblick zum Auslaufen fest; notfalls lasse ich das Schiff mit Booten freiwarpen. Andererseits – vielleicht ist es ein blinder Alarm. Die Eurotas kann eine Insel angelaufen haben, um Wasser oder Holz zu übernehmen. Oder sie kann in eine Flaute geraten sein, wie es uns oft genug passiert ist.«
Herrick studierte ihn mit sehr stillen Augen. »Unwahrscheinlich«, sagte er.
Bolitho ging an ihm vorbei, berührte die Stühle, ohne sie zu spüren, und den alten Degen an der Schottwand, den Allday wie ein Gralshüter bewachte.
Er fuhr fort: »Sayer wird die Kurierbrigg ausschicken, wenn sie erst wieder da ist, und der Gouverneur will zwei kleine Schoner nach Norden und Osten abkommandieren.«
»Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, Sir.«
Bolitho drehte sich auf dem Absatz um. »Das weiß ich, verdammt noch mal! Aber wir müssen etwas tun.«
Er bemerkte Herricks überraschten und gekränkten Ausdruck und fügte hinzu: »Tut mir leid. Der Wein ist schuld.« Bolitho schob die Papiere über den Tisch, denn Herrick mußte es früher oder später erfahren. »Lesen Sie selbst.« Damit ging er zur Tür und sagte zu dem Wachtposten: »Benachrichtigen Sie den Midshipman der Wache, ich wünsche alle Offiziere unverzüglich zu sprechen.« Er merkte, daß Herrick ihn beobachtete, und sagte nüchtern: »Ich weiß, Thomas, ich weiß, was Sie denken. Aber das liegt fünf Jahre zurück. Eine lange Zeit für Erinnerungen.«
Herrick sah ihn grimmig an. »Jawohl, Sir – wenn Sie meinen? Ich sammle die Offiziere draußen und bringe sie zusammen herein.« Damit verließ er die Kabine.
Bolitho setzte sich und zog nach kurzem Zögern seine Uhr aus der Tasche. Sie hatte ein sehr gutes Werk von Mudge and Dutton und ein festes, luftdichtes Gehäuse. Geistesabwesend klappte er den Deckel auf, um die Widmung auf der Innenseite zu lesen:
Conquered, on a couch alone I lie,Once in dreams deceit you came to me,All dreams outstripped, if only thou were nigh![8]
Er schloß den Deckel und steckte die Uhr wieder in die Tasche. Sein Kopf war jetzt ganz klar, und als seine Offiziere eintraten, fiel ihnen keine Veränderung an ihm auf. Außer Herrick, und der konnte nichts dagegen unternehmen.
II Isolation
Bolitho hielt im Niedergang inne und ließ seinen Augen Zeit, sich an den grellen Glanz zu gewöhnen.
Es war beinahe acht Glasen,[9] und die Männer der Vormittagswache hatten sich zur Ablösung bereits lustlos unter der Achterdecksreling versammelt.
Bolitho war schon vor zwei Stunden an Deck gewesen, wie es seine Gewohnheit war. Trotz der Gewißheit, daß ein weiterer sengend heißer Tag bevorstand, war ihm zu dieser Stunde alles frisch und lebendig erschienen. Der Tau auf Segeln und Leinen hatte diese Illusion noch verstärkt. Doch jetzt stand die Sonne bereits hoch, und als Bolitho zum Achterdeck hinaufstieg, fragte er sich unwillkürlich, wie lange sie noch nach der Eurotas suchen mußten.
Seit Sydney hatten sie gut zweitausendfünfhundert Meilen gesegelt – oder eher dreitausend, alle Kreuzschläge[10] und Launen des Windes mitgerechnet. Herrick hatte bemerkt, ihm käme es zwanzigmal länger vor.
Drei Wochen sengender Hitze und grenzenloser, leerer See.
Bolitho kniff die Augen zusammen und versuchte, über den leicht dippenden Bugsprit hinauszuspähen, aber das Licht war schon so grell, daß die See wie poliertes Silber blendete; übergangslos verschmolz sie mit dem Himmel.
Nach und nach prüfte er die Stellung der Segel. Sie zogen noch, aber nur schwach; die vollgebraßten Rahen hielten das Schiff auf Steuerbordbug.
Er hörte den Steuermannsmaat Leutnant Borlase melden: »Die Wache ist angetreten, Sir.«
Dann quietschten Borlases Schritte auf Deck, seine Sohlen klebten wohl an dem heißen Pech fest.
Er, wie auch Keen, der ihn ablöste, waren sich der Anwesenheit ihres Kommandanten bewußt, kannten ihn aber auch gut genug, um zu wissen, daß er in die Routine eines Wachwechsels nicht eingreifen würde.
Bolitho hörte Keen sagen: »Aye, Sir. Kurs Ostnordost … Liegt an.«
Darauf Borlase, kurz und ungeduldig: »Wie üblich keine besonderen Vorkommnisse. Nur Peterson wurde wegen Unbotmäßigkeit ins Logbuch eingetragen. Der Erste Offizier kann sich später mit ihm befassen.« Er wischte sich das schweißnasse Gesicht und den Nacken. »Lösen Sie die Rudergänger ab, bitte.« Dann verschwand er mit einem Nicken im Niedergang.
Die Leute nahmen den Dienst auf, vier lange Stunden einer weiteren Wache.
Bolitho hatte Herrick mit dem Bootsmann und einigen Helfern auf dem Vorschiff gesehen. Die Arbeit nahm kein Ende. Wie jedes Schiff glich auch die Tempest einem feingestimmten Instrument, bei dem jeder Zoll der Takelage so entworfen und angeordnet war, daß er eine bestimmte Aufgabe erfüllte. Spleißen und Nähen, Malen und Kalfatern verlangten auf der Tempest viel Schweiß und knochenbrechende Mühe.
Herrick sah ihn und kam über die Gangway nach achtern. Seine untersetzte Gestalt bewegte sich fast senkrecht auf den ausgedörrten Planken. Das war kaum überraschend, denn obgleich alle Segel gesetzt waren, wies das Deck kaum Krängung auf.
Herrick bemerkte: »Das wird wieder ein harter Tag, Sir.« Er sah prüfend zu den Masten auf. »Ich habe die Leute frühzeitig rangenommen, das erspart ihnen das Schlimmste. Mr. Jury plant für heute nachmittag ein paar schwerere Arbeiten im Orlopdeck.«
Bolitho nickte. Er beobachtete Keen, der rastlos um Ruder und Kompaß wanderte. Wie die anderen Offiziere war er nur mit Hemd und Breecheshose bekleidet, und sein blondes Haar klebte ihm schweißnaß an der Stirn.
»Gut, Thomas«, sagte Bolitho. »Die Leute werden uns zwar wegen der schweren Arbeit verfluchen, aber das erspart ihnen anderen Ärger.«
Wie jeder andere Offizier wußte Herrick, daß zuviel Freizeit bei den herrschenden Verhältnissen zu Streitigkeiten und Schlimmerem führen konnte. In der Messe und den Offizierskammern war es schon schlimm genug. Aber im überfüllten Mannschaftslogis des Unterdecks mußte es die Hölle sein.
Herrick beobachtete ihn und wartete auf den richtigen Augenblick.
»Wie lange noch, Sir?« Bolitho drehte sich zu ihm um, aber Herrick hielt seinem scharfen Blick stand. »Ich meine, wir haben doch die volle Distanz zurückgelegt. Das Postschiff hat die Eurotas wohlbehalten und auf Kurs in diesen Gewässern gesichtet. Sie muß danach in Schwierigkeiten geraten sein. Und bei diesem Schneckentempo können wir sie kaum verpaßt haben.«
Bolitho packte die Reling mit beiden Händen. Das heiße Holz half ihm, seine Gedanken zu sammeln, seine Nervosität zu verbergen.
Unter sich sah er Jacob Twig, den Koch, im Schatten eines Laufgangs zielbewußt davoneilen, zweifellos zum Zahlmeister. Die frischen Lebensmittel und Sondervorräte, die sie in Sydney übernommen hatten, mußten mit dem üblichen Pökelfleisch gestreckt werden: mit gesalzenem Rind- oder Schweinefleisch, das manchmal so hart war wie das Teakholz der Schiffsplanken. Twig war sehr dunkel und ungewöhnlich groß. In seiner übelriechenden Kombüse stand er meist über seine Töpfe und Kasserollen gebeugt wie ein Zauberer, der magische Tränke braute.
Bolitho sagte langsam: »Zugegeben, wir haben die volle Strecke zurückgelegt.« Er versuchte, sich das vermißte Schiff vorzustellen, zu erraten, was ihm zugestoßen sein mochte.
Während der ganzen drei Wochen hatten sie nur zwei andere Schiffe in Rufweite passiert, zwei kleine holländische Schoner. Die Begegnungen hatten eine Woche auseinandergelegen, aber keiner der beiden Kapitäne hatte etwas anderes gesehen als die üblichen Eingeborenenflottillen zwischen den vielen Inseln. Und es war immer klug, um sie einen weiten Bogen zu machen.
Bolitho fügte hinzu: »Unsere Position ist wieder im Süden von Tongatapu. Wenn wir wenden und der Wind so günstig bleibt, könnten wir morgen früh Land sichten.«
Herrick wartete, er erriet seine Gedanken.
Bolitho sagte: »Ich will das Schiff nicht mitten zwischen die Riffe setzen, aber wir können Boote an Land schicken. Der Häuptling dort ist uns angeblich freundlich gesonnen. Unsere Schiffe sind ihm nicht unbekannt, wie Mr. Lakey sagt.«
Herrick schnitt eine Grimasse. »Ich nehme trotzdem ein paar geladene Pistolen mit, Sir! Zu viele brave Seeleute sind schon hinterrücks niedergemacht worden.«
Bolitho drehte sich nach einer Bewegung im Wasser um: ein Hai, der einen kleineren Fisch überfiel. In Sekunden war die Wasseroberfläche wieder glatt, und nur das gelegentliche Auftauchen der Schwanzflosse verriet, daß sie einen geduldigen Begleiter hatten.
»Manche Eingeborene haben guten Grund, uns zu hassen«, erwiderte er und berührte unwillkürlich die Haarsträhne, die sein rechtes Auge halb verdeckte.
Herrick bemerkte die Bewegung, sie war ihm so vertraut wie Bolithos ruhige graue Augen. Die Strähne verbarg eine tiefe, grausame Narbe an der Stirn. Als junger Leutnant war Bolitho von einem Eingeborenen niedergeschlagen und beinahe getötet worden, als er mit einer Gruppe Matrosen auf einer Insel Frischwasser beschaffen wollte.
Herrick blieb ungerührt. »Trotzdem werde ich zuerst schießen, Sir! Ich bin zu weit herumgekommen, um mir mit einer Keule den Schädel einschlagen zu lassen.«
Bolitho wurde plötzlich ungeduldig. Der Gedanke, daß die Eurotas von kriegerischen Eingeborenen überwältigt worden sein könnte, entsetzte ihn.
»Rufen Sie den Steuermann, Thomas. Wir werden einen neuen Kurs abstecken und beschließen, was wir unternehmen sollen.«
Herrick sah ihm nach, wie er mit versonnenem Gesicht zur Kampanje schritt. Er sagte zu Keen: »Achten Sie auf Ihre Wache. Spätestens in einer Stunde brauchen wir alle Mann.«
Keen antwortete nicht. Auch er erinnerte sich an Viola Raymond, sie hatte ihn gepflegt, nachdem er verwundet an Land gebracht worden war. Wie manchen anderen war ihm ihre Beziehung zum Kommandanten bekannt und auch, was Herrick davon hielt. Keen mochte sie beide, besonders aber Bolitho. Wenn der Viola Raymond suchen und damit neue Gefahren heraufbeschwören wollte, so war das seine Angelegenheit. Er beobachtete Herricks besorgtes Gesicht. Oder etwa nicht?
In dem kleinen Kartenraum unter der Kampanje, neben der Steuermannskajüte, beugte Bolitho sich über den Tisch und sah zu, wie Lakey sich mit Zirkel und Lineal zu schaffen machte.
»Wenn der Wind so bleibt, morgen mittag.« Lakey blickte auf, sein hageres Gesicht hob sich nur als Silhouette vor einem offenen Bullauge ab.
Dahinter schimmerte das Meer schmerzhaft in den Augen. Wieviel schlimmer mußte es auf einem großen, mit Deportierten überladenen Frachter sein. Wenn die Eurotas irgendwo auf Grund saß, konnte ihre Lage schnell wirklich kritisch werden. Der Wunsch zu entkommen, für die geringste Überlebenschance frei zu sein, konnte Menschen zum Äußersten treiben.
»Wenn der Wind so bleibt.« Das muß sich jedem Seeoffizier mit der Zeit ins Herz eingraben, dachte Bolitho.
Er sah Lakey nachdenklich an. »Dann bleibt es dabei. Hundertvierzig Meilen bis Tongatapu. Wenn wir nach der Kursänderung fünf Knoten schaffen, halte ich Ihre Schätzung für angemessen.«
Lakey hob die Schultern. Lob oder Kritik berührten ihn nur selten. »Mir wird wohler sein, wenn ich das Mittagsbesteck gesehen habe, Sir.«
Bolitho lächelte. »Also gut.«
Er drehte sich auf dem Absatz um und eilte aufs Achterdeck zurück, denn er wußte, Lakey würde bereit sein, sobald er benötigt wurde.
»Also, Thomas, wir wenden zur halben Stunde und gehen auf Nordwestkurs. Das gibt uns Seeraum, wenn wir uns den Riffen nähern. Außerdem sind wir dann in besserer Position, um eine andere Insel anzulaufen, sollte der Wind umspringen.«
Als ein Schiffsjunge das Halbstundenglas neben dem Kompaß umdrehte, hatten die Matrosen schon die Brassen besetzt und holten keuchend die großen Rahen der Fregatte herum.
Die Tempest gehorchte dem Ruder und wälzte sich schwerfällig auf den anderen Bug. Bolitho verfolgte genau, wie lange das Manöver dauerte. Trotz des schwachen Windes hatte er jeden verfügbaren Mann an Deck und in der Takelage eingesetzt, denn er hielt es für töricht, bei Routinemanövern Nachlässigkeiten und Flüchtigkeit zuzulassen. In der Schlacht, wenn der größte Teil der Besatzung an den Geschützen und mit Reparaturen beschäftigt war, mußte das Schiff von viel weniger Leuten bedient werden. Dennoch hatte die Tempest soeben eher mit der gelassenen Würde eines Linienschiffs als mit der Behändigkeit einer Fregatte reagiert.
Stets war die Gefahr groß, selbstzufrieden zu werden und den knochenbrechenden und undankbaren Geschütz- und Segeldrill unter Gefechtsbedingungen zu verschieben. Hier draußen, wo man manchmal monatelang kein anderes Kriegsschiff zu Gesicht bekam, fiel der nötige Exerziereifer schwer, besonders, wenn man selbst ihn nur zu gern vergaß.
Bolitho verfügte über eigene bittere Erfahrung. Als Kommandant der Undine war er seinerzeit zum offenen Kampf mit einer starken französischen Fregatte gezwungen worden, der Argus unter dem Befehl von Le Chaumareys, einem der erfahrensten und fähigsten Kommandanten des Admirals Suffren. Le Chaumareys verfügte über einen Kaperbrief des Eingeborenenherrschers Muljadi, war aber im besten Sinn des Wortes französischer Offizier geblieben. Er hatte Bolitho sogar davor gewarnt, es zur gleichen Zeit mit der Argus, mit Muljadis Piratenflotte und der lähmenden Inkompetenz der Regierungen am anderen Ende der Welt aufzunehmen. Doch konnte gerade die Machtprobe zwischen ihren beiden Schiffen über das Geschick eines großen Teils Indiens entscheiden.
Wie jetzt auf der Tempest, war Bolitho mit einer bunt zusammengewürfelten Besatzung gesegnet, und alles, was er dem Franzosen und seiner gutgedrillten Mannschaft entgegenzusetzen hatte, waren Jugend und frische Ideen. Le Chaumareys hatte seine Heimat schon vor Jahren verlassen. Sein jetziges Kommando unter einer fremden Flagge sollte sein letztes sein, ehe er sich ehrenvoll nach seinem geliebten Frankreich zurückzog. Doch es waren gerade seine Vorliebe für Routine, sein Vertrauen zu bewährten Methoden und Manövern gewesen, die ihn ein Sieg und das Leben gekostet hatten.[11]
Bolitho fragte sich, wie lange es dauern würde, bis er zu selbstzufrieden oder zu erschöpft sein würde, einer wirklichen Herausforderung entgegenzutreten. Oder ob er auch künftig die Schwächen würde erkennen können, wenn kein anderer da war, um ihn darauf hinzuweisen.
»Kurs Nordwest, Sir. Voll und bei.« Herrick wischte sich mit dem Handgelenk über die Stirn. »Und auf diesem Bug ist es auch nicht kühler.«
Bolitho nahm das Teleskop von Midshipman Swift entgegen und richtete es nach vorn. Er blickte durch die straffen Wanten und Stage, über die goldene Schulter der Galionsfigur hinweg, und weiter ins Nichts.
»Gut. Schicken Sie die Freiwache unter Deck.« Er hielt Herrick zurück, der schon davoneilen wollte. »Wie ich hörte, wünscht Mr. Borlase, daß Sie heute einen Seemann bestrafen?«
Herrick sah ihn ernst an. »Ja, Sir: Peterson. Wegen Unbotmäßigkeit. Er beschimpfte einen Bootsmannsmaat.«
»Verstehe. Dann verwarnen Sie den Mann selbst, Thomas. Ihn für eine solche Geringfügigkeit auszupeitschen, würde nichts besser machen. Und dann sprechen Sie mit Mr. Borlase. Ich dulde nicht, daß er oder ein anderer Offizier in dieser Weise seine Verantwortung von sich schiebt. Er war Wachführer und hätte den Fall sofort bereinigen müssen.«
Herrick sah Bolitho nach, der das Deck verließ, und verfluchte sich, daß er die Sache nicht früher bereinigt hatte. Daß er es Borlase hatte durchgehen lassen wie schon so oft. Wenn man müde und von der Sonne ausgedörrt war, schien es oft einfacher, etwas selbst zu tun, als den üblichen Dienstweg einzuhalten.
Das ist auch der Grund, weshalb ich es nie weiter als bis zum Leutnant bringen werde, dachte er.
Während Herrick in Luv auf und ab ging, wurde er fast ständig von Keen und Midshipman Swift beobachtet.
Vom Midshipman auf der Undine zum Dritten Offizier der Tempesk.