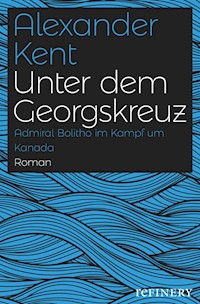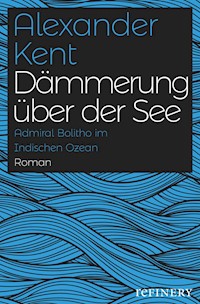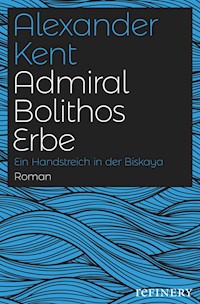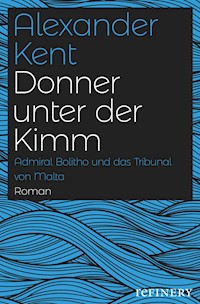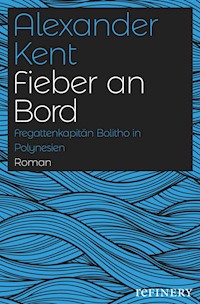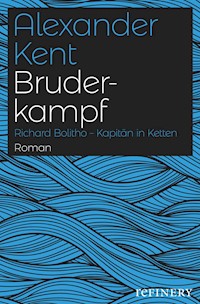6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
Der Friedensschluß von Amiens hat die beiden Erzfeinde England und Frankreich keineswegs versöhnt. Vizeadmiral Richard Bolitho, der auf seinem leichten Linienschiffm it Kurs auf die Karibik unterwegs ist, merkt schnell, dass er in einen unerklärten Krieg segelt. Bereits im Atlantik wird die Achates von einem mysteriösen Gegner beschossen, und auch die von ihm vorausgeschickte Fregatte Sparrowhawk verschwindet spurlos mit 200 Mann an Bord. Doch die größte seemännische Herausforderung erwartet ihn erst noch bei Erreichen der Insel San Felipe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Brander von Alexander Kent, Admiral Bolithos karibisches Abenteuer, TEFINERY.
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester.Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
1802: Der Friedensschluß von Amiens hat die beiden Erzfeinde England und Frankreich keineswegs versöhnt. Vizeadmiral Richard Bolitho, der auf seinem leichten Linienschiffm it Kurs auf die Karibik unterwegs ist, merkt schnell, dass er in einen unerklärten Krieg segelt. Bereits im Atlantik wird die Achates von einem mysteriösen Gegner beschossen, und auch die von ihm vorausgeschickte Fregatte Sparrowhawk verschwindet spurlos mit 200 Mann an Bord. Doch die größte seemännische Herausforderung erwartet ihn erst noch bei Erreichen der Insel San Felipe ...
Alexander Kent
Der Brander
Admiral Bolitho im Kampf um die Karibik
Roman
Aus dem Englischen von Klaus D. Kurtz
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe bei RefineryRefinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin August 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005© der deutschen Ausgabe: Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt a. M./Berlin© 1983 by Highseas Authors Ltd.Titel der englischen Originalausgabe: Success to the Brave Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-109-6
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Die Flagge im Fockmast
II Der neue Bolitho
III Das Schiff ohne Namen
IV Alte Feinde – neue Freunde
V Der Schlächter
VI Abschied von Boston
VII Vor dem Angriff
VIII Überrannt
IX Knapp davongekommen
X Verkörperung der Treue
XI Späte Rache
XII Der Brief
XIII Ein Feiertag
XIV Ein Schluck Rum
XV Heimatkurs
XVI Das Geheimnis
XVII Mit Vorwarnung
XVIII Ruhe den Tapferen
Epilog
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
I Die Flagge im Fockmast
Widmung
Für Winifred in Liebe,bis wir uns wiedersehen
I Die Flagge im Fockmast
Richard Bolitho stand am offenen Fenster und starrte hinaus in den Hof, hinter dessen Mauer das Meer blinkte.
Es hätte ein wunderschöner Maientag sein können; in diesem Licht wirkte selbst der gedrungene Umriß von Pendennis Castle, der alten Burg, die den Schifffahrtsweg nach Falmouth und den Zugang zur Reede von Carrick beherrschte, weniger bedrohlich. England genoß den Frieden – nach neun Jahren Krieg mit Frankreich und seinen Verbündeten. Trotzdem, so schnell konnte man sich nicht umgewöhnen. In Falmouth mußten die jungen Männer nicht mehr nach ihren Waffen greifen, wenn ein fremdes Segel vor der Küste auftauchte und damit ein Überfall des Feindes drohte; sie liefen auch nicht mehr erschrocken davon, wenn sich der Ankömmling als britisches Kriegsschiff entpuppte. Letzteres hatte bedeutet, daß bald die verhaßten Preßpatrouillen die Häuser durchsuchen würden, um Männer unter Zwang für den Dienst auf See anzuwerben, vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Kaum zu glauben, daß dies alles jetzt der Vergangenheit angehörte.
Bolitho sah die Kutsche im Schatten neben der Remise warten. Nun war es bald soweit. Gleich mußten die Pferde herausgeführt und vorgespannt werden. Jetzt hieß es nicht mehr: nächste Woche – oder wenigstens morgen. Der Augenblick war gekommen.
Er wandte sich vom Fenster ab und wartete, bis seine von der Sonne geblendeten Augen sich an das schattige Zimmer gewöhnt hatten. Das große graue Steinhaus, das seine Familie seit Generationen bewohnte, war so still, als hielte es den Atem an, um das Unausweichliche noch etwas hinauszuschieben.
Sieben Monate waren nun vergangen, seit Bolitho heimgekehrt war nach der Schlacht, die alle feindlichen Invasionspläne durchkreuzt und die französische Position bei den Friedensverhandlungen so geschwächt hatte. Sieben Monate, seit er Belinda geheiratet hatte und zu einem glücklichen Mann geworden war.
Er schritt zum Fuß der breiten Innentreppe und blickte zu den Porträts seiner Vorfahren auf, die da im Halbdunkel hingen. Auch sie mußten solche Augenblicke gekannt haben, dachte er. Mußten sich gefragt haben, wann und ob sie dieses Haus je wieder betreten würden. Sein Ururgroßvater, Kapitän Daniel Bolitho, stand auf dem Bild an Deck seines brennenden Schiffes; er war im Krieg der protestantischen Allianz gegen Spanien gefallen. Sein Gesicht trug deutlich die Familienzüge der Bolithos, ebenso das von Bolithos Vater und seines Bruders Hugh; alle waren sie tot.
[1]
27. 3. 1802 ↑
Für Flaggoffiziere niedrigeren Dienstgrades waren die Posten selten geworden und wurden von den Lords der Admiralität je nach Gunst verteilt. So hatte es Bolitho erstaunt, als er den Befehl erhielt, ohne Verzug zunächst nach Amerika und dann in die Karibik zu segeln. Zumal ihm nicht ein neues Geschwader, sondern ein kleiner Zweidecker unterstellt wurde, dazu lediglich eine Fregatte als Geleit und Kurier.
Sein Empfang durch Admiral Sir Hayward Sheaffe, den Nachfolger des alten Admirals Beauchamp, war höflich, aber formell gewesen. Sir Hayward schien Bolitho ganz die neue Zeit zu verkörpern. Der von schwerer Krankheit gezeichnete Beauchamp war an seinem Schreibtisch gestorben, ohne je zu erfahren, daß sein letzter Schlachtplan zur Vernichtung der französischen Invasionsflotte von Bolitho siegreich ausgeführt worden war. Sheaffe dagegen war ein kühler Kopf, ein pragmatischer, perfekter Verwaltungsmensch. Bolitho konnte sich kaum vorstellen, daß sich dieser Mann von einem kleinen Seekadetten zu seinem jetzigen hohen Rang hinaufgedient hatte.
In der Stille des Hauses hörte Bolitho wieder Sheaffes Worte, als seien sie eben erst gefallen:
»Ich weiß, daß Ihnen diese Entscheidung ungebührlich hart erscheinen muß, Bolitho. Nach Ihrer Flucht aus französischer Gefangenschaft und Ihrem anschließenden Sieg über Admiral Remond haben Sie wahrscheinlich – mit Recht, würden viele sagen – eine gesicherte Bestallung erwartet. Jedoch …«, er dehnte das letzte Wort bedeutungsvoll, »ein Krieg endet nicht mit dem letzten Schuß. Ihre Lordschaften benötigen für diese Aufgabe einen Mann, der ebenso taktvoll wie tapfer handeln kann. Außerdem hat sie auch ihre guten Seiten: Sie werden hiermit zum Vizeadmiral befördert.« Sein Blick forschte in Bolithos Gesicht nach einer Reaktion. »Damit sind Sie dem Dienstalter nach der jüngste Vizeadmiral in der Navy.« Trocken fügte er hinzu: »Abgesehen natürlich von Nelson, dem Liebling der Nation.«
So war das also, dachte Bolitho. Sheaffe war eifersüchtig auf jene Männer, die sich die Bewunderung von Freund und Feind errungen hatten. Trotz seines Rangs und seiner Befugnisse beneidete er sie immer noch.
Vielleicht hatte ihm Bolitho deshalb verschwiegen, daß der wirkliche Grund für sein Zögern die Sorge um Belinda gewesen war, die in wenigen Wochen ihr erstes Kind erwartete. Sheaffe mußte es ohnedies wissen, denn sogar in Londoner Zeitungen waren Artikel erschienen über ihre Hochzeit im Oktober 1801, bei der Bolithos Kameraden die kleine Kirche in Falmouth bis zum Bersten gefüllt hatten. Aber vielleicht war Sheaffe auch darauf neidisch?
So hatte Bolitho geschwiegen. Wenn Sheaffe von ihm erwartete, daß er ihn beschwor, um einen Aufschub bat, dann hatte er den Mann vor sich noch immer nicht begriffen.
Bolitho hörte ihre Schritte auf dem gefliesten Boden draußen und straffte die Schultern.
Sie stand im Gegenlicht, das Gesicht überschattet, aber trotzdem war ihre Schönheit nicht zu übersehen. Niemals würde er sich sattsehen können an ihr, nie die Sehnsucht nach ihr verlieren. Sonnenschein setzte rötliche Lichter in ihr kastanienbraunes Haar und streichelte den schlanken, gebogenen Nacken.
»Es wird Zeit«, sagte Belinda.
Ihre Stimme war leise und beherrscht, aber Bolitho wußte, wie schwer ihr dieser Ton fiel.
Fast wie Hohn wirkten dagegen das muntere Pferdegetrappel draußen auf den Pflastersteinen, die sorglosen Stimmen der Reitknechte.
Belinda trat zu ihm und legte ihm beide Hände auf die Schultern. »Ich bin so stolz auf dich, Liebster«, sagte sie. »Mein Mann, der Vizeadmiral …« Ihre Lippen zitterten, ein feuchter Glanz in ihren Augen strafte ihre Worte Lügen.
Er drückte ihren einst schlanken Körper sanft an sich und spürte das Kind, als sei es schon bei ihnen.
»Gib gut auf dich acht, wenn ich weg bin, Belinda.«
Sie lehnte sich in seinen Armen zurück und sah ihm so eindringlich ins Gesicht, als wolle sie sich jeden Zug einprägen.
»Du bist es, der achtgeben muß. Für mich ist hier gut gesorgt. Alle sind freundlich zu mir, bieten mir Beistand und Hilfe an. Dabei brauche ich nur dich.« Sie schüttelte den Kopf, als er zum Sprechen ansetzte. »Keine Sorge, ich werde nicht schwach. Obwohl du mich verlassen mußt, bin ich glücklich, verstehst du? Jeder Tag der letzten Monate war für mich wie unser erster. Wenn du mich umarmst, spüre ich das wie beim ersten Mal. Ich liebe dich über alles, aber ich wäre eine Närrin, wenn ich mich zwischen dich und die Welt stellen wollte, in der du lebst. Ich kenne doch den Blick, mit dem du die Schiffe beobachtest, wenn sie in die Reede von Carrick einlaufen, dein Gesicht, wenn Thomas oder Allday ein Erlebnis erwähnen, das ich niemals mit dir teilen kann. Bei deiner Heimkehr werde ich dich erwarten, aber bis dahin werden wir uns immer nahe sein.«
Es klopfte, und Allday trat durch die Tür; seine sonst so leutselige Miene war ernst und unsicher.
»Alles bereit, Sir.«
Knorrig wie Eichenholz, verkörperte Allday für Bolitho viel von jener anderen Welt, die Belinda erwähnt hatte. In seinem besten blauen Rock und den Nanking Breeches war er das Urbild eines Seemanns, jeder Zoll Bootsführer eines Vizeadmirals. Er diente Bolitho, seit dieser ein junger Kapitän gewesen war. Gemeinsam hatten sie Schönes und Schreckliches erlebt, hatten zu gleichen Teilen Leid und Triumph erfahren.
Als Allday von Bolithos unerwartet früher Beförderung gehört hatte, war sein Kommentar nur gewesen: »Gibt man Ihnen endlich die Flagge im Fockmast, Sir? Wird auch Zeit.«
»Danke, Allday.«
Der Bootsführer hielt Bolitho den neuen Uniformrock zum Hineinschlüpfen hin. Da war er, der einst unerreichbare Wunschtraum des kleinen geplagten Leutnants auf Wache, ja selbst noch des jungen Kommandanten auf seinem ersten Schiff.
Belinda beobachtete ihn, um Haltung bemüht und mit verschränkten Fingern, als hielte sie dahinter ihre Gedanken und Gefühle im Zaum.
»Du siehst stattlich aus, Richard.«
»Sehr stattlich, Madam.« Allday klopfte die Rockaufschläge glatt und vergewisserte sich, daß beide Epauletten mit den silbernen Zwillingssternen richtig saßen. Wenn sie erst auf See waren, würde sich das ändern, dachte er. Aber hier gehörte er zur Familie dieses Hauses, in dem er eine neue Heimat gefunden hatte. Jedenfalls fast zur Familie.
Leise sagte Belinda: »Ich könnte dich bis Hampshire begleiten, Richard.«
Bolitho zog sie an sich. »Nein. Die Fahrt zum Beaulieufluß würde dich überanstrengen. Und denk an den Rückweg. Ich würde krank vor Sorge.«
Sie widersprach ihm nicht. Obwohl keiner es erwähnte, dachten beide an die verunglückte Kutsche, in der schon einmal Bolithos Glück ein Ende gefunden hatte, an den Unfall seiner ersten Frau, dessen Schrecken erst durch ihr neues gemeinsames Leben getilgt worden war.
Bolitho war dankbar dafür, daß der Weg zu seinem neuen Schiff zu weit war, als daß sie ihn begleiten und das Leben ihres ersten Kindes aufs Spiel setzen konnte. Es war schon schlimm genug, daß er sie jetzt verlassen mußte, obwohl sie ihn so dringend gebraucht hätte. Zwar blieb sein verläßlicher alter Steward Ferguson bei ihr im Haus zurück, auch der Arzt wohnte ganz in der Nähe. Bolithos Schwester Nancy hielt sich öfter bei ihnen auf als in der palastähnlichen Residenz ihres Mannes, des Richters, der weit und breit nur der »König von Cornwall« genannt wurde. Und nächste Woche wurde Dulcie erwartet, Herricks Frau, die den weiten Weg von Kent auf sich nahm, um Belinda bei der Geburt beizustehen.
Herrick, den seine Beförderung zum Konteradmiral fast in Verlegenheit gebracht hatte, war ein kleines Geschwader unterstellt worden. Er befand sich schon unterwegs nach Gibraltar, wo ihn neue Befehle erreichen würden.
Diesmal erwarteten Bolitho an Bord kaum vertraute Gesichter. Vielleicht war das auch besser so, überlegte er: nichts, was ihn an die Vergangenheit erinnern konnte, an frühere Erfolge und Skrupel.
Belinda sagte in seine Gedanken hinein: »Sei vorsichtig um meinetwillen, Richard. Es fällt mir furchtbar schwer, dich ziehen zu lassen, aber ich weiß ja, daß es nicht anders geht.«
Bolitho hielt sie an sich gepreßt. Warum fand man die rechten Worte immer erst dann, wenn es zu spät war?
Seit er mit seinem Geheimauftrag von der Admiralität zurückgekehrt war, hatte sie es irgendwie geschafft, ihre Enttäuschung, ihren Kummer zu verbergen. Nur einmal, nachts, hatte sie aufgestöhnt. »Warum gerade du? Mußt du denn wirklich fort?« Und dann war sie wieder in einen unruhigen Schlaf gefallen, als wüßte sie, daß es auf ihre Frage keine Antwort gab.
Draußen erklang Alldays Stimme, der das Verladen der letzten Gepäckstücke beaufsichtigte. Armer Allday, dachte Bolitho. So bald nach den Strapazen der französischen Gefangenschaft mußte er nun wieder hinaus. Aber er war stets da, wenn er gebraucht wurde, ein Freund und guter Zuhörer, dem Bolitho sich anvertrauen konnte, falls er einen Gesprächspartner suchte, der außerhalb der Hierarchie stand und offen seine Meinung sagen konnte.
Alldays Loyalität hatte Bolitho schon manches Mal beschämt. Sein Lebensinhalt bestand darin, ihm zu dienen, er besaß weder eine Frau, die auf ihn wartete, noch ein Zuhause. Irgendwie kam es ihm unfair vor, daß er Allday schon wieder mit hinaus schleppte, obwohl er sich ein geruhsames Leben an Land wahrhaftig verdient hatte. Doch Bolitho wußte, daß ihn der Vorschlag, diesmal zu Hause zu bleiben, verletzt und aufgebracht hätte.
Aber jetzt mußte er endlich aufbrechen.
Gemeinsam schritten sie zum Portal, entschlossen, den Augenblick, den sie fürchteten, gefaßt zu bestehen.
Grelles Sonnenlicht überfiel sie, und Bolitho mußte sich zwingen, zu der verhaßten Kutsche hinüberzusehen. Von allen anderen Bewohnern des Hauses hatte er sich schon verabschiedet, auch von seiner Schwester und dem einarmigen Ferguson.
Er sagte: »Ich sende dir eine Nachricht mit dem ersten Kurierschiff, das uns begegnet. Wenn ich in Amerika eingetroffen bin, wird man mir wahrscheinlich die umgehende Rückkehr befehlen.«
Er spürte, wie sich ihr Arm unwillkürlich verkrampfte, und zürnte sich selbst, daß er ihr falsche Hoffnungen machte.
Admiral Sheaffe hatte Bolithos Zweifel an der Bedeutung seiner Mission nicht ausräumen können. Er sollte Boston anlaufen, »neutralen Boden«, wie er es nannte, und dort mit französischen und amerikanischen Beamten die formelle Übergabe einer Insel vollziehen, wie es im Frieden von Amiens vorgesehen war.
Bolitho hielt das alles für einen großen Fehler. Hier wurde dem Erzfeind Englands eine Insel überlassen, deren Eroberung das Leben so vieler Landsleute gekostet hatte. Deshalb hatte er sich einen Protest dem Admiral gegenüber nicht versagen können.
»Wir haben einen Friedensvertrag unterzeichnet, Sir Hayward, keine Kapitulation!«
Aber in dem kühlen Amtszimmer hatte die Bemerkung seltsam kindisch geklungen. Sheaffe antwortete denn auch ungerührt: »Richtig. Und wir wünschen nicht, daß Sie einen neuen Krieg auslösen, Sir!«
Als wollten sie den Abschied beschleunigen, scharrten die Pferde ungeduldig auf dem Kopfsteinpflaster.
Bolitho küßte Belinda lange und schmeckte Salz auf ihren Lippen.
»Ich komme wieder, Belinda.«
Sanft löste er sich von ihr und schritt die ausgetretenen Stufen zur wartenden Kutsche hinunter. Allday stand hinten bei dem Burschen, aber Bolitho winkte ihn herbei.
»Setz dich zu mir, Allday.«
Dann wandte er sich ein letztes Mal nach Belinda um. Vor der grauen Wand des Hauses wirkte sie seltsam verwundbar, und er hätte sie gern tröstend umfaßt.
Mit einem Ruck wandte er sich ab. Im nächsten Augenblick saß er in der Kutsche, und die Räder ratterten über das Pflaster und durchs Tor hinaus.
Es war vorbei.
Allday preßte die Hände zusammen und ließ Bolithos düsteres Gesicht nicht aus den Augen. Die sieben Monate an Land waren ihm wie eine Ewigkeit vorgekommen. Natürlich hatte er sich gehütet, Bolitho das merken zu lassen. Seit Allday sich hier in Cornwall als Schafhirte durchgeschlagen hatte, war er noch nie so lange an Land gewesen. Damals hatte die Preßpatrouille eines vor der Küste ankernden Kriegsschiffes mehrere Männer der Umgebung zwangsrekrutiert. Allday war unter ihnen gewesen, auch Ferguson. In der Schlacht bei den Saintes hatte der Pechvogel dann seinen Arm verloren, war aber wie Allday in Bolithos Diensten geblieben.
Die warme Frühlingsluft und der schwere Duft der Wiesen machten Allday schläfrig; er wußte, daß Bolitho zwar nicht allein sein wollte, aber ebensowenig in gesprächiger Stimmung war. Zum Schwatzen blieb noch genug Zeit auf ihrer langen Reise nach Hampshire zum Fluß Beaulieu, wo ihr neues Schiff wartete. Außerdem lagen einsame Wochen und Monate vor ihnen, in denen sie auf Gesprächsstoff angewiesen waren.
Das neue Schiff – wie mochte es sein? Allday war selbst erstaunt über seine Neugier. Sein Posten als Bootsführer des Vizeadmirals machte ihn zwar unangreifbar, aber er war doch zu sehr Seemann, um nicht auf das neue Schiff gespannt zu sein.
Kein Linienschiff ersten Ranges, mit hundert oder mehr Kanonen, nicht mal eines mit 74 Kanonen wie die Benbow, Bolithos letztes Flaggschiff; nein, eines der kleinsten Linienschiffe, die noch im Dienst standen.
Seiner Britannischen Majestät Schiff Achates verfügte nur über 64 Kanonen und gehörte zu einer aussterbenden Klasse. Es war eher eine zu groß geratene Fregatte als eines jener schweren Linienschiffe, die auch den mörderischen Breitseiten des Nahkampfes widerstehen konnten.
Mit ihren 21 Jahren war sie ein Veteran und hatte alle möglichen Schlachten und Gefechte erlebt. Meist war sie in der Karibik stationiert gewesen und unzählige Male von ihrem Heimathafen auf Antigua zum südamerikanischen Festland und zurück gesegelt.
Etwas unbehaglich fragte sich Allday, warum gerade sie zu Bolithos Flaggschiff bestimmt worden war. Wahrscheinlich bloß wieder so eine Hirnverbranntheit von oben, sagte ihm sein gradliniger Verstand. Für seine Verdienste und Leiden um England hätte Bolitho längst der Adelstitel gebührt, war Alldays Meinung. Aber an höherer Stelle schienen nur zu oft Haß und Mißgunst dem Mann entgegenzuschlagen, für den Allday jederzeit sein Leben geopfert hätte.
Dann dachte er an den Abschied, dessen Zeuge er gerade geworden war. Ein schönes Paar, diese beiden: die bezaubernde Lady mit den langen, kastanienbraunen Flechten, und der junge Vizeadmiral, dessen rabenschwarzes Haar noch keine weiße Strähne aufwies.
Auf dem Sitz gegenüber sah Bolitho zu, wie Alldays Kopf langsam auf die Brust sank; er spürte die Kraft des Schlummernden und war dankbar, daß er ihm schweigend Gesellschaft leistete. An Land hatte Allday einige Pfunde zugenommen und wirkte jetzt so, als könne nichts und niemand ihn umwerfen. Trotz seines Kummers mußte Bolitho lächeln. Er hatte Allday erlebt, wie er sich mit löwenhaftem Mut über das blutige Deck zu ihm durchschlug, aber auch, wie er mit Tränen in den Augen seinen verwundeten Kommandanten nach unten ins Lazarett trug. Nein, ein Schiff ohne Allday konnte er sich nicht vorstellen.
Wenigstens war der Kommandant ein alter Freund: Valentine Keen, vor langer Zeit einer von Bolithos Seekadetten, der seither bei den verschiedensten Gelegenheiten Freud und Leid mit ihm geteilt hatte. Der letzte Kommandant der Achates war am Fieber gestorben, unterwegs von Antigua zu der Werft, wo sie gebaut worden war und die längst fällige Überholung erhalten sollte.
Bolitho war froh, daß er Keen als Flaggkapitän bekommen hatte. Er warf einen Blick auf den schlummernden Allday und erinnerte sich daran, wie sein Bootsführer einst Keen das Leben gerettet hatte, als er ihm mit eigener Hand einen langen Holzsplitter aus dem Leib schnitt, weil der Schiffsarzt zu betrunken gewesen war.
Sie fuhren an einer Gruppe Feldarbeiter vorbei, die an einem Gatter lehnten und Apfelwein aus groben irdenen Krügen tranken. Bolitho sah, daß einige zur Kutsche aufblickten, einer hob sogar grüßend die Hand. Bald mußte man es in und um Falmouth wissen: Wieder war ein Bolitho ausgezogen. Ob er wohl zurückkehren würde?
Abermals dachte er an Belinda, die er in dem weitläufigen alten Steinhaus allein zurücklassen mußte. Hoffentlich …
Aber er war nicht der erste Marineoffizier, der fort mußte, wenn ihn seine Frau oder seine Familie am meisten brauchte. Bolitho strich über die neue Goldlitze ein seinem Rock und setzte sich gerade. Genausowenig wie er der letzte war, dem dies geschah.
Der Friede konnte nicht dauern, mochten die Politiker das auch überall herumposaunen. Zu viele Leben waren geopfert worden, zu viele Ungerechtigkeiten nicht gesühnt.
Wenn England sechzig von seinen hundert Linienschiffen außer Dienst stellte und gut vierzigtausend Matrosen und Seesoldaten nach Hause entließ, dann hätte Frankreich doch mit Blindheit geschlagen sein müssen, um nicht seinen Vorteil aus solcher Vertrauensseligkeit zu ziehen.
Aber es war besser, über Achates’ Bestimmungsort nachzudenken, sagte sich Bolitho: die kleine Insel San Felipe, die wie ein verwitterter Wachtposten die Enge zwischen Kuba und Haiti beherrschte. Wie andere Inseln in der Karibik blickte sie auf ein bewegtes und blutiges Schicksal zurück. Ursprünglich in spanischem Besitz, war sie von Frankreich erobert und bis zur Amerikanischen Revolution gehalten worden. Dann hatte England sie nach harten Kämpfen und unter dem Verlust vieler Menschenleben an sich gebracht.
Und jetzt, so wollte es die Übereinkunft mit Frankreich, sollte diese Insel als Geste des guten Willens zurückgegeben werden. Aber es war nicht mehr die gleiche Insel. Als Admiral Rodneys Schiffe sie 1782 erobert hatten, nur ein Jahr nach Achates ’ Stapellauf, war sie ein ödes, menschenfeindliches Stück Land gewesen. Während sie jetzt, so hatte Bolitho bei der Admiralität erfahren, vor Wohlstand und Fruchtbarkeit strotzte.
Als Gouverneur regierte dort zur Zeit ein pensionierter Vizeadmiral, Sir Humphrey Rivers, Ritter des Bath-Ordens. Er hatte San Felipe zu seiner Lebensaufgabe gemacht und den Hafen in Georgetown umbenannt, was die endgültige Zugehörigkeit der Insel zum britischen Weltreich noch unterstreichen sollte.
Georgetown besaß einen geschützten Naturhafen, und der Handel mit Rohrzucker, Kaffee und Melasse blühte. Der wachsende Wohlstand war vor allem der Sekundärbevölkerung aus afrikanischen Sklaven zu danken.
Admiral Sheaffe hatte Bolitho erklärt, daß San Felipe während des Krieges zwar ein wichtiger Stützpunkt gewesen war, von wo aus die Seewege nach Jamaika kontrolliert und feindliche Freibeuter bekämpft werden konnten, daß die Insel aber im Frieden nur eine Belastung darstelle und nicht mehr gebraucht werde.
Schon damals hatte Bolitho das nicht eingeleuchtet, und jetzt, als die Kutsche bergab fuhr und in der Ferne sich der Blick auf die See öffnete, kam ihm das Ganze noch absurder vor.
War die Insel so wichtig gewesen, daß viele für sie sterben mußten, dann war sie es doch gewiß wert, daß man sie behielt?
Bolitho empfand die Übergabe als einen Verrat, der mehr Indolenz verriet, als er seinem Land jemals zugetraut hätte. Und warum hatte man damit, ihn beauftragt, nicht einen jener wendigen Politiker?
Sie brauchten einen Mann, der ebenso taktvoll wie tapfer handeln konnte, hatte Sheaffe gesagt.
Das entlockte Bolitho nur ein grimmiges Lächeln. Solche und ähnliche Begründungen hatte er schon oft gehört. Wenn die Sache gut ausging, heimsten andere die Ehre ein. Aber machte er auch nur einen falschen Zug, fiel die volle Verantwortung auf ihn zurück.
Am besten gab er das Grübeln über seine Order ganz auf. Er hatte sie schwarz auf weiß, und darüber hinaus konnte er nicht planen. Bis sein Schiff den Anker fallen ließ, mochte sich die Lage grundlegend geändert haben.
Aber Browne als Flaggleutnant würde er vermissen. Seit Browne ihm als Adjutant beigegeben worden war, hatte er diesen intelligenten und im Umgang mit Admiralität und Regierung geschulten Mann schätzen gelernt. Doch vor einigen Monaten war sein Vater gestorben, und Browne war jetzt Herr über einen Landbesitz, dessen Ausmaß Bolithos Vorstellungsvermögen fast überstieg.
Zum Abschied war Browne allerdings noch einmal nach Cornwall gekommen. Für beide war es eine schmerzliche Trennung gewesen, und Bolitho hatte sich damals entschlossen, seinen Neffen Adam Pascoe als neuen Adjutanten anzufordern. Auch wenn es Bolitho widerstrebte, seine Befugnisse für eine private Gunst zu benutzen, glaubte er, ihm diesen Dienst schuldig zu sein; zu viele junge Offiziere saßen ohne Aufgabe und Sold an Land. Schließlich liebte er seinen Neffen wie einen Sohn, und sie hatten manchen Kampf gemeinsam bestanden. Die neue Erfahrung konnte ihm nützlich sein.
Browne jedoch hatte nur ein skeptisches Stirnrunzeln für Bolithos Adjutantenwahl. Vielleicht wollte er ihn damit warnen, einen nahen Verwandten auf einen Posten zu setzen, dessen Inhaber im Notfall unparteiisch beiseitestehen mußte. Aber es schien Bolitho wichtiger, daß Adam mit seinen 21 Jahren jetzt, da er diese Chance für seine Karriere am dringendsten brauchte, nicht ohne neue Kommandierung auf ein Schiff blieb.
Bolitho lehnte den Kopf ans warme Leder der Sitzbank.
Also Valentine Keen, Adam und Allday. Zusammen mochten die drei noch über sich hinauswachsen. Aber andere vertraute Gesichter erwarteten ihn wohl nicht an Bord.
Achates war ursprünglich in der Themsemündung in Dienst gestellt worden, während Bolitho eher die Schiffe aus Westengland oder von Spithead kannte. Mit gemischten Gefühlen machte er sich klar, daß Achates fast ein Schwesterschiff von Nelsons berühmter Agamemnon war, in derselben Werft auf Kiel gelegt und gebaut wie sie, der Werft von Henry Adam in Bucklers Hard am Beaulieu.
Die schwindende Schar der 64er hatte jedenfalls einen großen Vorzug: Sie waren größer als alle schnelleren Schiffe und schneller als alle größeren. Kein Wunder, daß die Kommandanten mächtiger Dreidecker sie mit widerwilliger Bewunderung beäugten.
Nelson hatte jedenfalls einmal behauptet, daß seine kleine Agamemnon ein hervorragender Segler sei und selbst am Wind und unter Sturmbesegelung mit jeder Fregatte mithalten könne.
Bolitho fragte sich, ob Keen von Achates wohl ebenso angetan war. Sein letztes Schiff war ein mächtiger 74er gewesen, und vielleicht bedauerte er schon seinen Entschluß, Bolithos Flaggkapitän zu werden.
Die Pferde fielen in Schritt, weil vor ihnen eine Schafherde die schmale Landstraße überquerte. Eine junge Frau, ihr Kind auf der Hüfte und den Mittagsimbiß für ihren Mann in einem Bündel in der anderen Hand, starrte die vorbeifahrende Kutsche an. Sie nickte Bolitho durchs Fenster zu und lächelte mit blitzenden Zähnen.
Bolithos Gedanken kehrten zu Belinda zurück und dem Kind, das sie erwartete. Würde es ein Sohn werden, der – getreu der Familientradition – einst an Deck eines Schiffes der neuen Generation stehen sollte? Oder eine Tochter, die heranwachsen und das Herz eines Mannes gewinnen würde – Garanten einer Zukunft, die er vielleicht nie erleben durfte? Belinda hatte er von seiner Mission nur wenig erzählt. Der Anlaß hätte sie vielleicht verbittert, wenn sie erst Zeit fand, darüber nachzudenken.
Dabei fiel ihm wieder der Gouverneur von San Felipe ein, der sein kleines Reich bald dem alten Feind übergeben mußte. Allday, der ihm gegenüber nun fest schlief, hatte über Sir Humphrey Rivers, Ritter des Bath-Ordens, einiges beisteuern können. Denn Allday sammelte und hortete Informationen über das Gehen und Kommen bei der Flotte wie eine Elster glitzernde Glasperlen.
Während der Amerikanischen Revolution hatte Rivers eine Fregatte namens Crusader befehligt, etwa zur gleichen Zeit, als Bolitho sein erstes Schiff bekam, die kleine Korvette Sparrow.
Rivers hatte französische Freibeuter gejagt, Prisen aller Art und Größen erbeutet und sich damit bald einen Namen gemacht. Doch vor der Chesapeake Bay hatte er in seinem Eifer, eine amerikanische Brigg zu stellen, die Gefahr unterschätzt und war mit seiner Crusader auf einer Untiefe gestrandet. Das Schiff wurde ein Totalverlust. Rivers war in Gefangenschaft geraten, aber nach dem Krieg an England ausgeliefert worden.
Es hieß, er hätte als Gefangener einflußreiche Freunde gewonnen; ebenso später, als er befördert wurde und ein Geschwader in Westindien befehligte. Er sollte viel Geld auf Londoner Banken haben und Grundbesitz in Jamaika. Das alles deutete nicht auf einen Charakter hin, der sich mit den Plänen von Whitehall leicht abfinden würde.
Bolitho verzog das Gesicht. Nicht einmal dann, wenn ihm diese Pläne von einem im Rang ebenbürtigen Offizier unterbreitet wurden.
Die Räder holperten durch tiefe Schlaglöcher, und Bolitho unterdrückte ein Aufstöhnen, als die Erschütterung wie eine glühende Kralle durch seine alte Schenkelwunde fuhr.
Vor ihrer Ehe hatte er deshalb an Hemmungen gelitten, aber Belinda hatte ihm auch hierbei geholfen. Gelegentlich zwang ihn der Schmerz zu einem leichten Hinken, und er hatte sich vor ihr wie ein Krüppel gefühlt.
Er wurde unruhig, als er an ihre nächtliche Berührung dachte, an die Wärme ihrer weichen Haut. Zärtliche Worte murmelnd, hatte sie sich über ihn gebeugt und die häßliche Narbe geküßt, die eine Musketenkugel und das Skalpell des Chirurgen hinterlassen hatten. Für sie war die Verletzung eher ein Grund zum Stolz als eine grausame Demütigung.
All das und mehr blieb nun mit jeder Umdrehung der Räder weiter hinter ihm zurück. Er fürchtete die Nacht, wenn die Kutsche für den ersten Pferdewechsel in Torbay halten würde. Nein, dann ging er doch lieber gleich an Bord und lief mit der ersten günstigen Tide aus, das ließ keine Zeit für Gram und Sehnsucht.
Wie dachte wohl Allday insgeheim darüber, daß es mit dem Landleben vorbei war und er wieder einer ungewissen Zukunft entgegenfuhr?
Die Flagge im Fockmast … Allday schien ehrlich stolz darauf zu sein. Aber das würden Männer wie Admiral Sheaffe wohl nie begreifen.
II Der neue Bolitho
Kapitän Valentine Keen trat aus dem Schatten des Hüttendecks und schlenderte zu den Backbordwanten hinüber. Wohin er sah, war alles eifrig bei der Arbeit, auf dem Achterdeck, dem Batteriedeck und hoch oben in den Masten und Rahen.
Der wachhabende Offizier tippte grüßend an seinen Hut und schritt dann taktvoll zur anderen Decksseite hinüber. Wie alle an Bord bemühte er sich, einen stark beschäftigten Eindruck zu machen und sich vom Erscheinen des Kommandanten nicht über Gebühr ablenken zu lassen.
Keens Blicke wanderten über sein neues Schiff. Er hatte sich in seiner Gig schon rund um die Achates pullen lassen, hatte ihre Linien studiert und den Trimm, wie sie da so gelassen über ihrem schwarz-beige gestreiften Spiegelbild im Wasser ritt.
Seeklar. Es war die ureigenste Entscheidung des Kommandanten, ab wann dieser Zustand galt. Danach, wenn der Anker eingeschwungen und der Bug seewärts gerichtet war, gab es kein Zurück mehr.
Das Wetter war warm und feucht für Mai, und die schützenden Landzungen hüllten sich in leichten Dunst. Keen hoffte, daß trotzdem ein leichter Wind aufkommen würde. Denn Bolitho drängte bestimmt ungeduldig aufs Auslaufen, wollte dem Land den Rücken kehren, wenn auch aus anderen Gründen als Keen.
Er beschattete die Augen und spähte zum Fockmasttopp hinauf. Achates war noch nie unter Admiralsflagge gesegelt. Ob es das Schiff irgendwie verwandeln würde?
Keen trat zurück in den Schatten neben der Treppe zum Hüttendeck und beobachtete zufrieden das Treiben an Bord. Das Schiff machte einen guten Eindruck: solide, dauerhaft und in langen Jahren erprobt. Einige Offiziere hatten darauf schon als Kadetten gedient, und der harte Kern ihrer Unteroffiziere – sie bildeten das Rückgrat jedes Kriegsschiffes – gehörte seit Jahren zur Stammbesatzung.
Das Schiff strahlte Selbstvertrauen aus und den spürbaren Eifer, bald wieder in See zu stechen, bevor es das Schicksal so vieler anderer, stillgelegter Artgenossen teilen mußte. Keens altes Schiff, die Nicator mit 74 Kanonen, die sich vor Kopenhagen und später in der Biskaya ausgezeichnet hatte, war schon außer Dienst gestellt: überflüssig und unerwünscht geworden wie ihre Mannschaft, die sich so tapfer geschlagen hatte, als die Trommeln zur Schlacht riefen.
Achates’ früherer Kommandant hatte sie sieben Jahre lang befehligt. Seltsam, daß er trotz dieser langen Zeit seinem Quartier keinen persönlichen Stempel aufgeprägt hatte. Vielleicht hatte er alles in die Mannschaft investiert. Die Leute machten einen zufriedenen Eindruck, auch wenn während der Überholung die übliche Zahl an Deserteuren zu verzeichnen gewesen war. Schließlich gab es Frauen, Kinder und Freundinnen an Land, die nach der langen Trennung fast nicht mehr wiederzuerkennen waren. Keen vermochte die Leute nur schwer dafür zu tadeln, daß einige dem Lockruf des Landes erlegen waren.
Mit einem Finger lockerte er sein Halstuch und beobachtete, wie ein Beiboot über das Schanzkleid geschwenkt und zu Wasser gelassen wurde. Wenn der Tag so warm blieb, mußten sie alle aussetzen und wässern, damit das Holz quoll und die Boote nicht undicht wurden.
Allmählich wurde sich Keen über seine Empfindungen klar. Er war froh, daß er auslaufen, mit Bolitho auslaufen konnte. Schon bei zwei Gelegenheiten hatte er auf anderen Schiffen unter ihm gedient, erst als Fähnrich, später als Dritter Offizier. Beide hatten sie geliebte Menschen verloren, aber während Bolitho nun geheiratet hatte, war Keen immer noch allein.
Er begann, über die Befehle nachzudenken, die ihm Bolitho vorab übersandt hatte.
Eine seltsame Mission. Einmalig und ungewöhnlich.
Sein Blick streifte die schwarze Reihe der Achtzehnpfünder an Steuerbord, deren Rohre wie vor einer Schlacht ausgefahren waren, damit die Segelmacher möglichst viel freie Decksfläche für ihre Arbeit bekamen.
Ob Krieg oder Frieden, ein Schiff mußte immer funktionstüchtig sein. Keen hatte auch zwischen den Kriegen unter Bolitho gedient und erfahren müssen, daß nur Toren einem Unterzeichneten Friedensvertrag blind vertrauten.
Da hörte er Schritte im Niedergang und sah Leutnant Adam Pascoe an Deck kommen.
Immer wieder von neuem überrascht, stellte Keen fest, daß Pascoe Bolitho ähnelte wie ein jüngerer Bruder. Das gleiche schwarze Haar, auch wenn Pascoe es nach der neuen Marinemode kurzgeschnitten trug, nicht in einem Nackenzopf. Die gleiche Rastlosigkeit: eben noch ernst und in sich gekehrt, und gleich darauf voll jugendlichem Feuer. Kein Wunder mit 21 Jahren, dachte Keen. Trotzdem – ohne einen Krieg, der seinen Zoll an Menschenleben und Schiffen forderte, konnte Pascoe nur mit viel Glück auf Beförderung oder ein eigenes Kommando hoffen.
Er begrüßte den Flaggleutnant. »Nun, Mr. Pascoe, fanden Sie in der Admiralskajüte alles zu Ihrer Zufriedenheit?«
Pascoe lächelte. »Aye, Sir. Wir haben vier der achteren Achtzehnpfünder abgebaut und durch Rohrattrappen ersetzt, damit er reichlich Platz findet.«
Keen warf einen Blick zum Hüttendeck hinauf. »Wie ich ihn kenne, wäre er auch mit zehn Schritten Auslauf zufrieden. Hauptsache, er kann irgendwo auf und ab marschieren, um sich beim Nachdenken Bewegung zu verschaffen.«
Scheinbar zusammenhanglos sagte Pascoe: »Ich sehe nicht ein, welchen Sinn unsere Mission hat, Sir. Wir haben gekämpft, bis der Feind eine Atempause brauchte, um sich zu erholen, und trotzdem hält es unsere Regierung für richtig, jetzt fast alle Besitzungen zurückzugeben, die wir den Franzosen abgerungen haben. Mit Ausnahme von Ceylon und Trinidad haben wir auf alles verzichtet und können uns nicht einmal dazu durchringen, Malta endgültig zu behalten. Jetzt geht auch San Felipe zum Teufel, und der Admiral muß diese schmutzige Arbeit sogar eigenhändig besorgen.«
Keen musterte den jungen Mann ernst. »Ein guter Rat, Mr. Pascoe.« Er sah Pascoe trotzig den Kopf heben, gewahrte das vertraute Aufbegehren in seinen Augen. Doch unbeirrt fuhr er fort: »In der Messe können Offiziere ihre privaten Ansichten frei diskutieren, vorausgesetzt, nichts davon kommt der Mannschaft zu Ohren. Aber das gilt nicht für den Kommandanten und den Flaggleutnant; wir müssen Zurückhaltung üben. Ich vermute, Ihr Wunsch, Ihrem Onkel zu dienen, war so stark, daß Sie diesen Posten eher um seinet- als um Ihretwillen übernommen haben?«
Keen sah an Pascoes Gesicht, daß er ins Schwarze getroffen hatte. Er setzte hinzu: »Der Auftrag eines Marineoffiziers unterscheidet sich gründlich von dem eines Adjutanten. Sie müssen diskret sein, sogar vorsichtig, denn es wird immer Zuhörer geben, die sich Ihr Vertrauen erschleichen wollen.« Er zögerte, sprach dann aber weiter, weil er es für wichtig hielt. »Manche könnten Ihrem Onkel übelwollen. Fällen Sie deshalb kein Urteil in Dingen, die Sie nicht ändern können. Andernfalls wäre es besser für Sie beide, wenn Sie sich umgehend an Land bringen ließen und den Hafenadmiral von Spithead um Ihre Versetzung bäten.«
Wieder lächelte Pascoe: »Ich danke Ihnen, Sir. Das habe ich verdient. Aber ich würde meinen Onkel niemals im Stich lassen, weder jetzt noch in Zukunft. Er bedeutet mir viel.«
Keen nahm den ungewöhnlichen Gefühlsausbruch des jungen Leutnants gelassen auf. Pascoes Geschichte war ihm größtenteils bekannt: unehelich geboren, war er der Sohn von Bolithos totem Bruder Hugh, einem Abtrünnigen und Verräter, der sich auf die Seite der amerikanischen Rebellen geschlagen und einen feindlichen Freibeuter befehligt hatte – mindestens ebenso kühn wie John Paul Jones. Für Bolitho mußte das eine große Belastung sein, und auch für diesen jungen Offizier, den seine sterbende Mutter ausgeschickt hatte, seinen einzigen Onkel zu suchen, als letzte Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Leise sagte Keen: »Ich verstehe schon. Vielleicht besser, als Sie glauben.«
[2]
Seekadett oder Fähnrich zur See ↑
Keen spähte durch das Gitter der Webeleinen.
Ein werfteigenes Boot pullte bereits auf den verankerten Zweidecker zu. Keen sah Sonnenlicht von Goldepauletten und Zweispitz reflektieren und wurde von Panik gepackt. Typisch Bolitho, daß er es nicht abwarten konnte, bis ihn sein eigenes Boot abholen kam. Also hatte er es eilig, den Auftrag anzupacken, ob der ihm nun behagte oder nicht.
Mit unbewegtem Gesicht sagte er zu dem Jungen: »Empfehlung an den Offizier der Wache, Mr. – äh …«
»Puxley, Sir.«
»Also, Mr. Puxley, pfeifen Sie die Ehrenwache an die Pforte.« Er packte den Jungen, der zur Achterdecksleiter rennen wollte, und fügte hinzu: »Gehen, Mr. Puxley, nicht rennen!«
Pascoe wandte sich ab, um ein Grinsen zu verbergen. Genau das hatte Bolitho wahrscheinlich zu Keen gesagt, als dieser noch ein kleiner Kadett gewesen war. Er selbst hatte es oft genug zu hören bekommen.
Als die Bootsmannsgehilfen durch die Decks eilten und ihre Pfeifen zwitschern ließen, stapften die Marinesoldaten zur Eingangspforte; ihre roten Uniformröcke mit den gekreuzten weißen Brustriemen leuchteten bunt aus dem Gewühl der Matrosen.
Keen winkte den wachhabenden Offizier heran und sagte unwirsch: »Vielleicht, Mr. Mountsteven, machen Sie sich künftig die Mühe, rechtzeitig nach Ihren Vorgesetzten Ausschau zu halten.«
Pascoe drückte den Hut fester auf sein rebellisches Haar. Auch das hätte Bolitho genauso gesagt.
Keen schritt zur Pforte und blickte dem Boot entgegen. Im Heck konnte er Bolitho sitzen sehen, den alten Säbel zwischen den Knien. Wenn er ohne die ehrwürdige Familienwaffe an Bord gekommen wäre, hätte Keen das als Sakrileg empfunden.
Und da war auch Allday; vierschrötig und wachsam, musterte er die Bootscrew mit angewidertem Blick. Wie hatte der Ehrenwerte Oliver Browne, Pascoes Vorgänger, ihr altes Geschwader bezeichnet? Als »happy few«, eine kleine Schar Auserwählter. Klein war die Schar gewiß geworden. Keen sah zu der großen roten Nationalflagge am Heck zurück, die nur hin und wieder auswehte. Aber die wenigen waren genug.
Auch der Erste Offizier der Achates, ein hochgewachsener breitgesichtiger Mann von der Insel Man, beobachtete das Boot. »Alles klar zum Empfang, Sir«, sagte er.
»Danke, Mr. Quantock.«
Keen hatte sich in seinen ersten Wochen an Bord, während das Schiff überholt wurde, mit Vorsicht durch die Listen, Stammrollen und Logbücher gearbeitet. Zwar unterstand nicht zum erstenmal ein Schiff seinem Befehl, aber für diese Mannschaft war er ein unbeschriebenes Blatt. Ehe er sich nicht ihre Achtung errungen hatte, setzte er nichts als selbstverständlich voraus.
Der Erste Offizier sah kurz nach vorn zum Signalfähnrich am Fuß des Fockmasts und sagte leise, wie zu sich selbst: »Ich wette, das alte Käthchen hat nie damit gerechnet, noch einmal Flaggschiff zu werden.«
Keen mußte lächeln. Da hatte er etwas Neues erfahren. Das alte Käthchen? Ein Schiff, dem seine Leute einen solchen Kosenamen gaben, mußte ein gutes Schiff sein.
[3]
Seesoldaten, Marine-Infanterie ↑
Noch einmal musterte der Kommandant sein Schiff. Alle Freiwächter waren vom Schanzkleid zurückgewichen, und selbst die Toppgasten, die oben in den Rahen arbeiteten, hielten inne und starrten zur Pforte hinunter.
Die kleinen Trommelbuben der Marine-Infanterie hoben ihre Schlagstöcke, die Bootsmannsgehilfen befeuchteten die Lippen für ihre Signalpfeifen.
Ebenso stolz wie nervös trat Keen nach vorn; das Ganze war unwichtig – und doch entscheidend.
Bolithos Zweispitz erschien oberhalb der geschrubbten Gräting, die Pfeifen schrillten und zwitscherten, und Hauptmann Dewar bellte: »Royal Marines – präsentiert das Gewehr!«
Beim letzten Wort, als die weißen Tonwölkchen von den hochgerissenen Musketenriemen aufstiegen, intonierten die Querpfeifen die alte Weise vom Heart of Oak, dem Herz aus Eiche.
Bolitho lüpfte grüßend den Hut zur Flagge am Heck, dann lächelte er Keen an.
Gemeinsam machten sie Front nach vorn, wo die Admiralsflagge schneidig zum Fockmasttopp aufstieg und auswehte.
Bolitho und Keen tauschten einen Händedruck. »Das Schiff macht Ihnen alle Ehre«, sagte der Vizeadmiral.
»Unsere Ehre sind Sie, Sir«, erwiderte Keen.
Bolitho musterte die starren Mienen der Seesoldaten, die nervösen, wachsamen Kadetten. Mit der Zeit würde er sie kennenlernen, so wie sie ihn. Er stand wieder an Deck eines Schiffes, und der grüne Schatten jenseits der Bucht, das Land, war nur noch Erinnerung.
Bolitho zupfte an seinem feuchten Hemd, dann setzte er abermals seine Unterschrift unter einen der vielen Briefe, die Yovell, sein pummeliger Sekretär, säuberlich aufgesetzt hatte.
Er sah sich in der geräumigen Achterkajüte um, die viel größer war, als er in einem Schiff von dreizehnhundert Tonnen erwartet hätte.
Ozzard, sein schmächtiger Steward, schenkte ihm frischen Kaffee nach und huschte wieder davon, nach nebenan in seine Pantry. Falls er es bedauerte, die Sicherheit des Herrenhauses in Falmouth verlassen zu müssen, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. Ozzard war ein Sonderling und ursprünglich Gehilfe in einer Anwaltskanzlei gewesen, ehe er das gefährliche Leben bei der Kriegsmarine gewählt hatte – nicht ganz freiwillig, wie manche behaupteten. Aber mochte er auch knapp dem Kerker entronnen sein, für Bolitho war er Gold wert.
Dann wandte sich Bolitho zu Keen um, der an den offenen Heckfenstern stand; sein gutes Aussehen und geschliffenes Benehmen täuschten leicht darüber hinweg, daß er ein erfahrener, tüchtiger Marineoffizier war.
»Also, Val, was halten Sie davon?«
Keen drehte sich um, doch sein Gesicht blieb im Schatten.
»Ich habe die Seekarte studiert und bin mir jetzt darüber klar, welche Bedeutung die Insel San Felipe während des Krieges hatte. Wer sie besitzt, ist fast unangreifbar.« Er zuckte die Schultern. »Eine weite Bucht schützt die Festung, die von ihrem erhöhten Standort alle Zufahrten beherrscht, nötigenfalls auch die Stadt selbst. Mir ist unbegreiflich, warum wir sie den Franzosen zurückgeben.« Dann dachte er an Pascoe und fügte hinzu: »Aber ich nehme an, Ihre Lordschaften sind besser informiert als ich.«
Bolitho schmunzelte. »Darauf würde ich mich nicht verlassen, Val.«
Der Kaffee schmeckte gut. Bolitho fühlte sich nach seiner ersten Nacht an Bord überraschend frisch und ausgeruht. Die Reise mit der Kutsche war anstrengend gewesen, und die vielen Aufenthalte in Landgasthäusern oder zum Pferdewechsel hatten ihm zu viel Zeit gelassen, an Belinda zu denken und sie zu vermissen.
Jetzt stellte das Schiff seine Ansprüche, und das belebte ihn. Den Geruch nach frischer Farbe und Pech, nach Hanf und den fünfhundert Offizieren, Matrosen und Soldaten auf engem Raum konnte er nicht ignorieren; er wollte es auch gar nicht.
Mit Achates schien er Glück gehabt zu haben; jede neue Information verstärkte seine Gewißheit, daß sie keinen Vergleich zu scheuen hatte. Vielleicht war Admiral Sheaffes Wahl doch richtig gewesen: ein kleiner 64er statt eines bombastischen Geschwaders, das Amerikaner ebenso wie Franzosen möglicherweise nur eingeschüchtert hätte.
Bolitho sagte zu Keen: »Ich habe Kapitän Duncan in Plymouth schon benachrichtigen lassen. Er läuft mit seiner Sparrowhawk umgehend nach San Felipe aus, auf dem direkten Weg.«
Wie gut konnte er sich Duncans rotes, gegerbtes Gesicht vorstellen, wenn er seine Order las! Auch er mußte froh sein, mit seiner Fregatte in See gehen zu können, bevor sie ihm unter den Füßen weg eingemottet wurde. Duncan hatte ebenso wie Keen zu seinem alten Geschwader gehört. Die beiden waren wie verlängerte Arme für ihn.
Aber an eines konnte er sich nur schwer gewöhnen: daß er nicht mehr auf die schriftlichen Befehle seines Vorgesetzten Flaggoffiziers zu warten brauchte. Uber die Ungewißheit seiner Rolle oder die Unfairness seiner Aufgabe mußte er sich nicht mehr grämen. Jetzt lag die Entscheidung allein bei ihm, wann und wie zu handeln war. Und mit der Entscheidung auch die volle Verantwortung.
Er fügte hinzu: »Duncans Anwesenheit könnte den Schock der Bewohner von San Felipe etwas mildern. Ich bezweifle, daß der Gouverneur derselben Meinung ist wie das Parlament.«
Ozzard kam herbeigetrippelt und wartete, bis Bolitho ihn zur Kenntnis nahm. Er erinnerte an einen eifrigen Maulwurf, wie er so seine Hände vor der Brust baumeln ließ.
»Bitte um Entschuldigung, Captain«, sagte er zu Keen, »doch der Erste Offizier läßt sich empfehlen und Ihnen melden, daß der Wind umgesprungen, aber immer noch sehr leicht ist.«
Keen grinste zu Bolitho hinüber. »Ich habe ihm gesagt, er soll mich gleich verständigen. Es ist nur ein Hauch, aber wenigstens können wir jetzt den Anker ausbrechen. Mit Ihrer Erlaubnis, Sir?«
Bolitho nickte, von der Erregung angesteckt. »Yovell, bringen Sie meine Depeschen zum Werftboot, das längsseits liegt.«
[4]
Kap Lizard, südlichster Punkt Englands ↑
Durch das offene Skylight konnte er Keens Stimme hören, das Trillern der Bootsmannspfeifen und das Klatschen nackter Füße auf trockenen Planken; die Seeleute hasteten auf Stationen.
Bolitho zwang sich, weiter ruhig sitzen zu bleiben und Kaffee zu schlürfen. Keen hatte genug am Hals, wenn er das für ihn neue Schiff zum erstenmal in Fahrt brachte, weg vom bedrohlichen Land. Dabei konnte er keinen Admiral brauchen, der ihm über die Schulter sah.
Wie oft hatte er selbst an der Querreling des Hüttendecks gestanden, voll Hoffnung und mit erregt klopfendem Herzen, während er sich den Kopf zermarterte, ob er nicht etwas vergessen hatte, für das es jetzt ohnehin zu spät war.
Keuchend kam Yovell zurück. »Alle Depeschen unterwegs zur Küste, Sir«, meldete er mit seinem weichen Devon-Akzent.
Auch Keen trat wieder ein, den Hut unter den Arm geklemmt.
»Anker ist kurzstag, Sir. Würden Sie mir vielleicht an Deck Gesellschaft leisten? Es täte den Leuten gut, Sie jetzt in ihrer Mitte zu sehen.«
Bolitho dankte ihm lächelnd, und dann fiel Keens Blick auf Pascoe.
»Eines verstehe ich nicht, Sir. Gerade eben wurde durch Kurier dieser Brief für den Flaggleutnant gebracht. Er kam gerade noch rechtzeitig.«
Auch Bolitho sah jetzt seinen Neffen an. Der Augenblick war da, den er bisher aufgeschoben hatte, aber sie mußten die leichte Brise zum Auslaufen nutzen. Er merkte, daß Yovell ihn anstrahlte, und begann sich plötzlich zu fragen, ob er das Richtige tat.
Zu Keen sagte er: »Ich komme gleich an Deck, Kapitän Keen.«
Dann nahm er den versiegelten Brief zur Hand und vergewisserte sich, daß es der richtige war. Ein Griff nach seinem Hut, den Ozzard ihm hinhielt, und er schritt mit Keen zur Tür.
»Wahrscheinlich ein dummes Versehen, Sir«, meinte Keen.
Doch im Vorbeigehen drückte Bolitho seinem Neffen den Brief in die Hand. »Ich bin oben, wenn du mich brauchst«, sagte er dabei.
Verwirrt begleitete Keen seinen Vizeadmiral aus dem Schatten des Hüttendecks hinaus und an dem großen Doppelrad vorbei, wo die Rudergänger und der Steuermannsmaat gespannt darauf warteten, daß der Anker ausbrach.
Überall wimmelte es von Matrosen und Soldaten. Die Toppgasten waren längst aufgeentert und hingen wie Affen auf den oberen Rahen, um die lose aufgegeiten Segel fallen zu lassen. Alle Brassen waren bemannt, und die Decksoffiziere und Maaten beobachteten ihre Abteilungen mit Argusaugen, während das Ankerspill klickte, begleitet vom Wimmern der Fiedel. Der Admiralsflagge im Fockmast war sich auch der letzte Mann bewußt.
Allday stand neben einem der Zwölfpfünder auf dem Achterdeck, als ihm plötzlich auffiel, daß Ozzard vergessen hatte, Bolitho den alten Familiensäbel umzuschnallen. Mit einem lautlosen Fluch rannte er davon und stürzte an dem verblüfften Wachposten vorbei in die Heckkajüte.
Doch er erstarrte, als er Pascoe mitten im Raum stehen sah, ein geöffnetes Schriftstück wie vergessen in der herabhängenden Hand.
Wie Yovell, der fast alle Briefe für den Vizeadmiral schrieb, wußte auch Allday, was in dem Schriftstück stand. Es hatte ihn tief bewegt, daß er zu den wenigen Eingeweihten gehörte.
»Alles in Ordnung, Sir?« fragte er.
Als sich der junge Leutnant ihm zuwandte, gewahrte Allday mit Schrecken, daß seine Wangen tränennaß waren.
»Nicht doch, Sir! Er wollte Ihnen eine Freude machen!«
»Eine Freude?« So geistesabwesend, als begreife er die Welt nicht mehr, machte Pascoe ein paar Schritte zur Wand und zurück. »Und Sie wußten davon, Allday?«
»Aye, Sir. Gewissermaßen.«
Allday war in seinem Leben weit herumgekommen, und Bolitho hatte schon öfter erklärt, daß er es mit einer ordentlichen Erziehung zu sehr viel mehr gebracht hätte als bis zum Seemann. Aber er mußte gar nicht lesen können, um zu verstehen, warum Kapitän Keen über den Titel auf dem Umschlag so erstaunt gewesen war.
Der Brief war adressiert an: »Seine Hochwohlgeboren Adam Bolitho, Flaggleutnant auf Seiner Britannischen Majestät Kriegsschiff Achates.«
Mit schwimmenden Augen starrte Adam den Inhalt an, ohne weiterlesen zu können. Die schweren Wachssiegel des Anwalts, das Erbrecht auf Bolithos Besitztum in Falmouth, mehr sah er nicht.
Allday führte ihn zu der Polsterbank unter den Heckfenstern.
»Ich hole Ihnen etwas zu trinken, Sir. Und dann bringen wir ihm gemeinsam seinen alten Säbel.« Er sah Adam nicken und setzte leise hinzu: »Schließlich sind Sie jetzt ein echter Bolitho. Genau wie er.«
Wie aus einer anderen Welt klang der Ruf zu ihnen herab: »Anker ist frei, Sir!«
Das Getrappel zahlloser Füße und das rauhe Geschrei der Decksoffiziere schienen von weit her zu kommen.
Allday goß Brandy in ein Glas und brachte es dem Leutnant, den er kannte, seit er mit vierzehn Jahren als Kadett auf Bolithos alter Hyperion angemustert hatte.
»Hier bitte, Sir.«
Adam faßte sich allmählich. »Sie wollen wissen, ob ich mich freue«, sagte er leise. »Meine Empfindungen lassen sich nicht in Worte fassen. Er mußte doch nicht …«
Allday hätte gern ebenfalls einen Schluck getrunken. »Aber es war sein Wunsch. Schon lange.«
Das Deck unter ihren Füßen krängte leicht, als das Schiff unter Mars- und Vorsegel in der schwachen Brise Fahrt aufnahm.
Allday hob den abgewetzten alten Säbel von seinen Haken an der Wand und betrachtete ihn. Beim letzten Mal hätten sie ihn beinahe für immer verloren. Eines Tages würde er also diesem jungen Mann gehören, dem Ebenbild des anderen oben an Deck.
Leutnant Adam Bolitho wischte sich die Augen mit der Manschette trocken. »Dann wollen wir mal, Allday.« Aber ganz hatte er sich noch nicht wieder gefangen. Er ergriff den Bootsmann am Arm und murmelte: »Bin ich froh, daß Sie eben hier waren.«
Grinsend folgte ihm Allday aus der Kajüte.
Der junge Spund freute sich also wirklich, dachte er. Das mochte er ihm auch geraten haben. Anderenfalls hätte er ihn trotz seines Offiziersranges übers Knie gelegt und versohlt.
Adam trat in den Sonnenschein hinaus. Er sah nicht die erstaunten Blicke, die ihm folgten, hörte auch nicht den unterdrückten Fluch eines vorbeihastenden Matrosen, der fast mit seinem Flaggleutnant zusammengestoßen wäre. Er nahm Allday den Säbel aus der Hand und schnallte das Gehenk um Bolithos Mitte.
Bolitho sah ihm dabei zu. »Danke, Adam«, sagte er mit Wärme.
Der Leutnant nickte und suchte nach Worten, aber Bolitho nahm seinen Arm und führte ihn beiseite, wandte sich mit ihm der welligen Küstenlinie zu, die querab vorbeizog und zurückblieb, während das Schiff in tieferes Wasser glitt.
»Später, Adam. Wir haben noch viel Zeit.«
Der Erste Offizier hob sein Sprachrohr und spähte durch das Gewirr der Takelage nach oben. »Los Bramsegel!«
Er warf einen Blick zu der Gruppe, die im Luv stand: der noch jugendliche Vizeadmiral mit seinem Adjutanten; er wollte wohl sehen, ob das Schiff gut genug für ihn war.
Allday war der Blick nicht entgangen. Ein Grinsen unterdrückend, dachte er: Junge, du hast noch eine Menge zu lernen. Du weißt gar nicht, wieviel.
III Das Schiff ohne Namen
Die ganze erste Woche nach ihrem Auslaufen hatte Achates mit schwachen und umspringenden Winden zu kämpfen. Kaum eine Stunde verging, ohne daß die Segel neu getrimmt werden mußten, damit sie Ruder im Schiff behielten und beim Kreuzen nicht auf den alten Kurs zurückgedrückt wurden.
Die nervtötende Eintönigkeit wirkte sich auf die Stimmung an Bord aus. Nach dem Zeitdruck und der Aufregung des Aufbruchs führte die plötzliche Untätigkeit des öfteren dazu, daß Aufsässigkeit und Streitsucht mit Auspeitschungen an der Gräting geahndet werden mußten.
Bei einem solchen Strafvollzug hatte Bolitho Keens Miene genau beobachtet. Manche Kommandanten hätten sich davon nicht weiter erschüttern lassen, schließlich gehörte auch das zur Bordroutine; aber Keen war da anders. Bezeichnenderweise kam Bolitho gar nicht auf den Gedanken, daß er Keen auch darin in langen Dienstjahren selbst geprägt hatte.