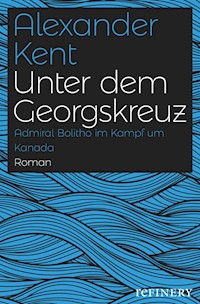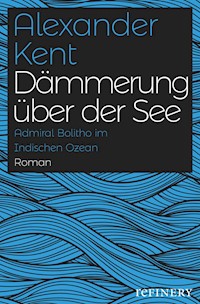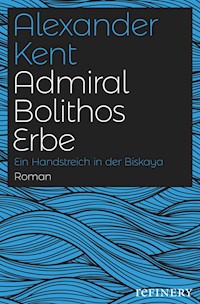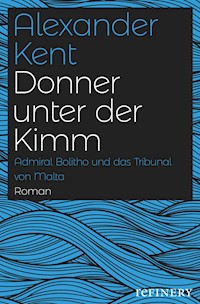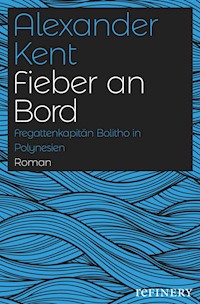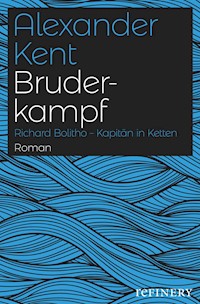6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Richard-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
1798 – vor Korfu und Alexandria: Niemand außer Kommodore Richard Bolitho ahnt, dass sich die französische Flotte unter Admiral de Brueys vor Korfu sammelt. Die Briten unter Nelson liegen dagegen weit entfernt bei Sizilien. Geführt vom Flaggschiff Lysander, spürt Bolithos Geschwader verräterische Helfershelfer auf, bis sich ihm die ganze Tragweite des französischen Ziels enthüllt: die Eroberung Ägyptens und damit der Zugang zum reichen Indien. In verzweifelten Gefechten kämpft sich der junge Kommodore zu Nelson durch und schont dabei weder sich selbst noch sein Schiff …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buchumschlag: Eine letzte Breitseite von Alexander Kent. Dunkelblauer gewellter Hintergrund. Roman über Commodore Bolitho auf See."
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben C.S. Forester.Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Das Buch
1798 – vor Korfu und Alexandria: Niemand außer Kommodore Richard Bolitho ahnt, dass sich die französische Flotte unter Admiral de Brueys vor Korfu sammelt. Die Briten unter Nelson liegen dagegen weit entfernt bei Sizilien. Geführt vom Flaggschiff Lysander, spürt Bolithos Geschwader verräterische Helfershelfer auf, bis sich ihm die ganze Tragweite des französischen Ziels enthüllt: die Eroberung Ägyptens und damit der Zugang zum reichen Indien. In verzweifelten Gefechten kämpft sich der junge Kommodore zu Nelson durch und schont dabei weder sich selbst noch sein Schiff …
Alexander Kent
Eine letzte Breitseite
Kommodore Bolitho im östlichen Mittelmeer
Aus dem Englischen vonKarl H. Kosmehl
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Neuausgabe bei RefineryRefinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin August 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011© der deutschen Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin 1979© Bolitho Maritime Productions Ltd., 1974 Titel der englischen Originalausgabe: Signal – Close Action! Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-143-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Das Geschwader
II Ein bescheidener Anfang
III Allein
IV In Gefangenschaft
V Der einzige Ausweg
VI Angriff im Morgengrauen
VII Alle in einer Mannschaft
VIII Nachwirkungen
IX Wein und Käse
X Schwierige Entscheidung
XI Der Brief
XII Treue und Pflicht
XIII Verfolgung
XIV Am Ziel
XV Die Katastrophe
XVI Der Kommandantenbericht
XVII Sturmwolken
XVIII Im Schlachtgetöse
Epilog
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
I Das Geschwader
Motto
Wie Seeungeheuerteilten die Rümpfe die Wogen,während turmhoch über Deckdie britische Kriegsflagge wehte.
Campbell
Motto
Wie Seeungeheuerteilten die Rümpfe die Wogen,während turmhoch über Deckdie britische Kriegsflagge wehte.
Campbell
I Das Geschwader
Im Schutze des hochragenden, zerklüfteten Felsens von Gibraltar zerrten Kriegsschiffe verschiedener Art und Größe an ihren Trossen und warteten darauf, daß die plötzliche Bö abflaute. Trotz gelegentlicher blaßblauer Streifen zwischen den jagenden Wolken war es so kühl, daß man meinen konnte, man sei in der Biskaya und nicht im Mittelmeer.
In Anbetracht ihrer strategischen Wichtigkeit wirkte die Reede von Gibraltar erstaunlich leer. Hauptsächlich Versorgungsschiffe, Briggs und Schoner, hatten hier entweder Zuflucht gesucht oder warteten auf Orders. Nur drei größere Kriegsschiffe lagen vor Anker, und zwar in beträchtlicher Entfernung von den in Gibraltar beheimateten Fahrzeugen. Es waren drei Linienschiffe mit je vierundsiebzig Geschützen, zu dieser Zeit, im Januar 1798, die beliebtesten und am besten verwendbaren Kriegsschiffe.
Das dem Lande am nächsten liegende Schiff trug den Namen Lysander quer über dem breiten, gedrungenen Heck; ein Name, wie er der Galionsfigur entsprach, die böse vom Bugspriet über die See starrte: der schwarzbärtige Feldherr der Spartaner, in Brustpanzer und mit Helmbusch, geschnitzt von Henry Callaway in Deptford, gab eine prachtvolle Galionsfigur ab. Wie der ganze Zweidecker war auch sie frisch gestrichen; es schien kaum glaubhaft, daß dieses Schiff elf lange Jahre in des Königs Diensten hinter sich hatte.
Der Kommandant, Kapitän Thomas Herrick, wanderte auf dem breiten Achterdeck auf und ab und warf dabei kaum einmal einen Blick zur Küste. Dachte er an Zustand und Aussehen seines Schiffes, so empfand er eher Besorgnis als Stolz. Monatelang hatte er in England pausenlos daran gearbeitet, die Lysander segelfertig zu machen, sie neu auszurüsten und die Besatzung – fast alle Landratten – anzumustern, Ersatzteile, Wasser, Proviant, Geschütze und Geschützbedienungen heranzuschaffen. Mehr als einmal hatte Herrick mit dem Schicksal gehadert, das ihm dieses neue Kommando beschert hatte. Und doch, trotz aller Verzögerungen und der empörenden Schludrigkeit von Werftarbeitern und Händlern, war aus diesem hoffnungslosen Chaos eine lebensfähige, starke Einheit geworden.
Verängstigte, von den unermüdlichen Preßkommandos1 Pressen: gewaltsame Rekrutierung für die Kriegsmarine (Anm. d. Ü.) ↑ an Bord geschleppte Männer und auch Freiwillige, deren Motive vom Patriotismus bis zur Flucht vor dem Henker reichten, waren schließlich langsam und mühevoll zu einer Art Besatzung zusammengeschweißt worden, die zwar alles andere als perfekt war, jedoch für die Zukunft einiges erhoffen ließ. Sobald sich die Lysander mit Kurs auf Portugal mühsam durch die Biskaya quälte, brachte der erste Sturm allerlei Schwächen ans Licht: zu viele erfahrene Matrosen in der einen Wache, zu viele Neulinge in der anderen. Aber unter Herricks sorgfältiger Führung und mit Hilfe einer Stammannschaft von Deckoffizieren, die alle Berufsseeleute waren, wurden sie einigermaßen fertig mit dem verwirrenden Labyrinth der Takelage, mit der widerspenstigen, tückischen Leinwand, die nun einmal zum Alltag auf See gehören.
Jetzt lag Herrick unter dem Gibraltarfelsen vor Anker und hatte mit wachsender Nervosität auf diesen Tag gewartet.
Weitere Schiffe waren eingelaufen und hatten in der Nähe geankert: die beiden anderen Vierundsiebziger, Osiris und Nicator, die Fregatte Buzzard und die kleine Schaluppe Harebell; sie waren jetzt nicht mehr selbständige Einheiten, sondern laut Order der Admiralität Teile des Geschwaders, in dem Herricks Schiff den breiten Kommodorestander fahren würde; und Geschwaderkommodore sollte, von der Admiralität dazu ernannt, nun Richard Bolitho werden, in guten und in schlechten Tagen. Jeden Moment mußte er eintreffen.
Merkwürdig, daß Herrick sich scheute, darüber nachzudenken. Erst vor vier Monaten waren er und Bolitho aus dem Mittelmeer zurückgekehrt. Nach einer blutigen Seeschlacht, in der Herricks Schiff versenkt und ein französisches Geschwader zum Teil kampfunfähig gemacht, zum Teil gekapert worden war, waren sie beide in London auf die Admiralität befohlen worden. Es kam ihm immer noch wie ein Traum, wie ein Ereignis aus Märchen- und Sagenzeiten vor.
Diese Vorsprache hatte weitreichende Folgen gehabt: für Bolitho die sofortige Beförderung zum Kommodore, für Herrick den Rang eines Flaggkapitäns. Ihr Admiral hatte weniger Glück gehabt. Man hatte ihn auf einen Gouverneursposten in New South Wales abgeschoben; sein schneller Sturz bewies, wie kurz der Weg vom privilegierten Günstling zum vergessenen Mann sein konnte.
Zunächst hatte sich Herrick über seine Ernennung zum Flaggkapitän in Bolithos Geschwader mächtig gefreut. Aber diese Freude wurde durch eine andere Entscheidung der Admiralität leicht getrübt: Bolitho hatte sein Schiff, die Euryalus, den großen Dreidecker mit hundert Kanonen, den er seinerzeit selbst von den Franzosen erobert hatte, nicht behalten, sondern die Lysander bekommen. Sie mochte sich leichter segeln als der große Dreidecker; aber Herrick hegte den Verdacht, daß ein Dienstälterer den Ex-Franzosen für sich beansprucht hatte.
Er hielt in seinem Schreiten inne und überschaute die geschäftigen Decks. Auf den Laufbrücken, an den Bootsgestellen, überall arbeiteten Matrosen. Andere balancierten hoch oben im schwarzen Gewirr der Wanten, Stage, Schoten, Fallen und Brassen und sorgten dafür, daß kein schamfieltes Tau, kein gebrochenes Stag das Auge des neuen Kommodore beleidigen würde, wenn er durch die Fallreepspforte trat. Die Marine-Infanteristen waren bereits angetreten. Wegen Leroux, ihrem Major, brauchte Herrick sich keine Sorgen zu machen. Eben sprach er mit seinem Leutnant, einem etwas zerstreuten jungen Mann namens Nepean; ein Sergeant inspizierte Musketen und Uniformen.
Dem Midshipman2 Seekadett oder Fähnrich zur See (Anm. d. Ü.) ↑ der Wache mußte schon der Arm weh tun. Er hatte, seit Herrick an Deck war, ausdrücklichen Befehl, ständig das schwere Teleskop am Auge zu halten, um es sofort melden zu können, wenn das Boot des Kommodore von der Mole ablegte.
Herrick sah zu den anderen Schiffen hinüber. Bis jetzt hatte er wenig mit ihren Kommandanten zu tun gehabt, doch wußte er bereits eine ganze Menge über sie. Von der kleinen Schaluppe, die im heftigen Wind so ungemütlich dümpelte, daß sich der Kupferbeschlag ihres Unterwasserschiffs in regelmäßigen Abständen aus dem Wasser hob, bis zum äußersten Zweidecker, Osiris, bestanden zwischen den Kommandanten die verschiedensten Verbindungen. Der Kommandant der Nicator zum Beispiel:
Herrick hatte herausbekommen, daß er während der amerikanischen Revolution zusammen mit Bolitho als Leutnant auf demselben Schiff gedient hatte. Daß sie jetzt wieder zusammentrafen, mochte sich günstig auswirken oder auch nicht. Der Kommandant der Harebell, Kapitän Inch, hatte seinerzeit beim alten Geschwader ein Granatwerferschiff befehligt. Den Kommandanten der Buzzard, Raymond Javal, kannte Herrick nur vom Hörensagen: er galt als unbeherrscht und gierig nach Prisengeld. Ein typischer, wenn auch etwas problematischer Fregattenkapitän.
Wieder blieb Herricks Blick auf der Osiris haften; er versuchte, seine Verärgerung zu unterdrücken. Sie war fast ein Schwesterschiff der Lysander und wurde befehligt von Kapitän Charles Farquhar, einem alten Bekannten. Das Schicksal hatte sie wieder zusammengeführt, und zwar abermals unter dem Kommando von Richard Bolitho. Damals war es auf der Fregatte Phalarope gewesen, während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Bolitho war Kommandant gewesen, Herrick Erster Offizier und Farquhar Midshipman. Ständig hatte sich Herrick über den aus vornehmer Familie stammenden, arroganten Farquhar geärgert. Wenn er jetzt die Osiris ansah, ging es ihm nicht viel anders. Das reiche Schnitzwerk an Kampanje3 hinterer Aufbau des Schiffs, auch »Hütte«, »Pupp« (poop) (Anm. d. Ü.) ↑ und Bug war mit echter Goldfarbe bemalt, ein äußeres Zeichen für den hohen gesellschaftlichen und finanziellen Status ihres Kommandanten. Bis jetzt hatte Herrick ein Zusammentreffen vermeiden können, abgesehen von Farquhars Meldung, als er in Gibraltar zum Geschwader stieß. Doch schon bei dieser Gelegenheit welkten Herricks beste Vorsätze, als Farquhar näselte: »Hören Sie mal, viel Geld haben Sie wohl nicht in Ihren alten Kasten gesteckt, eh?« Wieder dieses irritierende Lächeln. »Das wird aber unserem Herrn und Meister nicht gefallen, wissen Sie.«
Plötzlich öffnete sich die unterste Reihe der Stückpforten in der abgeschrägten Bordwand der Osiris, und die schwarzen Rohre der Zweiunddreißigpfünder glitten gleichzeitig in das schwächliche Sonnenlicht. Präzise wie stets.
Herrick bekam einen Schreck. Farquhar ließ sich den ehrgeizigen Kopf nie von dummen Erinnerungen oder Abneigungen vernebeln. Er scherte sich nur um das, was ihm gerade am wichtigsten war, und jetzt hieß das: einen guten Eindruck beim Kommodore zu machen. Nur war dieser Kommodore ausgerechnet Richard Bolitho, ein Mann, der Herrick teurer war als jeder andere lebende Mensch. Farquhar jedoch hätte sich auch vom Teufel persönlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Zu allem Unglück erklang erst jetzt die Stimme des Midshipman der Wache: »Boot legt von der Mole ab, Sir!«
Herrick leckte sich die Lippen. Sie waren trocken wie Asche. »Schön, Mr. Saxby. Mein Kompliment an den Ersten Offizier, und er kann jetzt zur Begrüßung antreten lassen.«
Richard Bolitho schritt zum Heckfenster seiner geräumigen Tageskajüte und sah zu den anderen Schiffen hinüber. So folgenreich das Ereignis auch war, daß er zum erstenmal an Bord seines eigenen Flaggschiffs feierlich empfangen worden war – er konnte seinen Übermut kaum zügeln. Wie Wein und Gelächter sprudelte es in ihm, und nur mit letzter Kraft wahrte er die Form.
Er wandte sich um: da stand Herrick neben der Tür und sah ihn an. Ein paar Matrosen stellten sorgfältig allerlei Kästen und Kisten auf, die aus dem Boot an Bord gehievt worden waren; irgendwo schimpfte Allday, sein Bootsführer, mit jemandem, der nicht aufgepaßt hatte.
»Danke, Thomas, das war ein schöner Empfang.«
Bolitho schritt über die schwarz-weißen Karos des Fußbodenbelags auf Herrick zu und ergriff dessen Hand. Oben hörte er das Getrampel der abrückenden Marineinfanterie und die sonstigen wohlbekannten Geräusche des Borddienstes.
Herrick lächelte verlegen und deutete auf das Gepäck. »Danke, Sir. Ich hoffe, Sie haben alles mitgebracht, was Sie brauchen. Es wird wohl eine ziemlich lange Fahrt werden.«
Bolitho musterte ihn nachdenklich. Herricks untersetzte Gestalt, sein schlichtes, volles Gesicht und die leuchtendblauen Augen waren ihm fast so vertraut wie die Alldays. Aber irgendwie kam ihm Herrick verändert vor. Es war nur vier Monate her, und doch …
Was hatte sich alles ereignet, seit sie zusammen auf der Admiralität gewesen waren! Die zahlreichen Unterredungen mit Männern, die so viel ranghöher und mächtiger waren als er, daß es ihn immer noch verblüffte, was eine Beförderung wie die seinige bewirken konnte. Jedesmal, wenn er die Befürchtung äußerte, die Ausrüstung seines neuen Flaggschiffs ginge nicht schnell genug voran, hatte er ihnen angesehen, daß sie sich leise über ihn amüsierten.
Sir George Beauchamp, der Admiral, der seine Beförderung ausgesprochen hatte, drückte es schließlich so aus: »Diese Details müssen Sie jetzt vergessen, Bolitho. Um das Schiff kümmert sich sein Kommandant, Sie haben Wichtigeres zu tun.«
Schließlich war Bolitho mit einer schnellen Fregatte nach Gibraltar gesegelt. In der Tejomündung hatten sie Station gemacht, weil er Depeschen für das Flaggschiff der Blockadeflotte brachte. Dort war er vom Admiral, dem Earl of St. Vincent, empfangen worden, der diesen Titel nach seinem großen Sieg vor elf Monaten erhalten hatte. Der Admiral, den manche seiner Untergebenen immer noch liebevoll »Old Jarvy« nannten (aber nur, wenn er es nicht hörte), hatte ihn munter begrüßt.
»Also, Sie haben jetzt Ihre Befehle«, hatte er gesagt. »Sehen Sie zu, daß Sie sie ausführen! Seit Monaten wissen wir nicht mehr, was die Franzosen vorhaben. Unsere Agenten in den Kanalhäfen berichten lediglich, daß Bonaparte mehrmals an der Küste gewesen ist, um Pläne für eine Invasion Englands auszuarbeiten.« Ein kurzes, trockenes Auflachen, typisch für ihn. »Aber was ich ihm bei Kap St. Vincent zu schlucken gegeben habe, wird ihn wohl gelehrt haben, zur See ein bißchen vorsichtiger zu manövrieren. Bonaparte ist ein Landmensch. Ein Planer. Unglücklicherweise haben wir niemanden, der ihm gewachsen ist. Zu Lande, meine ich.«
Im Rückblick fand Bolitho es erstaunlich, was der Admiral in dieser kurzen Unterredung alles klargestellt hatte. Fast pausenlos war er auf See gewesen, und doch besaß er über die Lage sowohl in den heimischen Gewässern wie auch im Mittelmeer einen besseren Überblick als mancher von der Admiralität.
Beim Auf- und Abgehen auf dem Achterdeck hatte der Admiral gelassen gesagt: »Beauchamp ist der Richtige, um so ein Unternehmen zu planen. Aber zur Ausführung sind erfahrene Seeoffiziere nötig. Dank Ihrer vorjährigen Aktionen im Mittelmeer wissen wir einiges mehr über die Absichten der Franzosen. Broughton, Ihr damaliger Admiral, hat vielleicht die wahre Bedeutung erst begriffen, als es zu spät war. Zu spät für ihn, meine ich.« Dabei hatte er Bolitho grimmig angestarrt. »Wir müssen wissen, ob es sich lohnt, wieder eine Flotte in diese Gewässer zu schicken. Wenn wir aber unsere Geschwader sinnlos aufsplittern, werden die Franzosen unsere Schwächen bald ausnutzen. Ihre Order sagt Ihnen nur, was Sie zu tun haben. Wie Sie es machen, können nur Sie entscheiden.« Wieder dieses trockene Auflachen. »Ich wollte eigentlich Nelson dafür, aber der ist nach dem Verlust seines Armes noch zu geschwächt. Beauchamp hat Sie ausgesucht, damit Sie Bonaparte am Bauch kitzeln. Um unser aller willen hoffe ich, daß er eine gute Wahl getroffen hat.«
Und nun, nach all diesen Besprechungen, dem Wühlen in Agentenberichten, dem Sondieren, was von den zahllosen Vermutungen über Absichten und Motive des Feindes wirklich wichtig war, befand sich Bolitho endlich an Bord seines Flaggschiffes. Jenseits der dicken Fensterscheiben lagen andere Schiffe, die ihm sämtlich durch den breiten, gespaltenen Wimpel verbunden waren, der im Masttopp flatterte, seit er unter dem Knallen der präsentierten Musketen, dem Spiel der Pfeifen und Trommeln an Bord geklettert war.
Immer noch konnte er es nicht glauben. Er war doch derselbe wie vorher: voller Ungeduld, mit seinem neuen Schiff in See zu gehen.
Aber der Unterschied würde bald überall deutlich werden. Als sein Erster Offizier hatte Herrick bisher zwischen Kommandant und Mannschaft gestanden, Bindeglied und Schranke zugleich. Jetzt, als Flaggkapitän, stand Herrick zwischen ihm und den anderen Offizieren, zwischen dem kleinen Geschwader und jedem einzelnen Mann auf jedem einzelnen Schiff: fünf Schiffe mit insgesamt über zweitausend Mann. Daran zeigte sich die Bedeutung seiner Stellung als Geschwaderkommodore und die gestiegene Aufgabe Herricks.
»Was macht der junge Adam Pascoe?« fragte Bolitho. »Ich habe ihn beim Anbordkommen nicht gesehen.« Schon als er fragte, sah er, daß Herrick plötzlich ein Dienstgesicht bekam.
»Ich wollte es Ihnen gerade erzählen, Sir. Er liegt im Krankenrevier. Ein kleiner Zwischenfall, aber Gott sei Dank nichts Ernstes.«
»Die Wahrheit, Thomas!« verlangte Bolitho. »Ist mein Neffe krank?«
Herrick sah auf, seine blauen Augen blitzten auf einmal ärgerlich. »Ein dummer Streit mit dem Sechsten Offizier der Osiris, Sir, der ihn irgendwie beleidigte. Sie hatten beide dienstlich an Land zu tun, und bei der Gelegenheit trugen sie die Sache aus.«
Bolitho zwang sich, langsam ans Heckfenster zu treten und die Wasserwirbel am Ruder zu betrachten.
»Ein Duell?«
Schon beim bloßen Klang des Wortes wurde ihm übel. Zum Verzweifeln war das! Sollte Adam nach seinem Vater Hugh Bolitho schlagen? Nur das nicht!
»Reiner Übermut wahrscheinlich«, antwortete Herrick, aber es klang nicht sehr überzeugt. »Jedenfalls ist keiner ernstlich verletzt. Immerhin hat der andere wohl mehr abbekommen als Adam.«
Bolitho wandte sich um. »Ich will ihn sofort sprechen«, sagte er leise.
Herrick schluckte. »Mit Ihrer Erlaubnis, Sir, möchte ich die Sache selbst regeln.«
Bolitho spürte, daß sich eine große Kluft zwischen ihm und seinem Freund auftat. Langsam nickte er.
»Gewiß, Thomas. Adam Pascoe ist zwar mein Neffe, aber jetzt vor allem einer Ihrer Offiziere.«
Herrick sprach nun wieder etwas weniger förmlich. »Tut mir leid, daß ich Ihnen schon in der ersten Stunde an Bord Ärger bereiten muß, Sir. Um alles in der Welt hätte ich das lieber vermieden.«
Bolitho lächelte ernst. »Ich weiß. Dumm von mir, mich da einmischen zu wollen. Ich war schließlich selbst Flaggkapitän und habe mich oft geärgert, wenn mein Vorgesetzter mir dazwischenredete.«
Herrick wollte das Thema wechseln; er sah sich in der geräumigen Kajüte um.
»Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen, Sir. Ihr Steward macht gerade das Dinner zurecht, und ich habe ein paar Matrosen abgestellt, Ihre Kisten wegzustauen.«
»Danke. Ich bin durchaus zufrieden.« Er hielt inne: da war er wieder, der dienstliche Ton zwischen Vorgesetztem und Untergebenem. Sonst hatten sie immer alles miteinander geteilt, hatten sich verstanden.
»Gehen wir bald in See, Sir?« fragte Herrick unvermittelt.
»Aye, Thomas. Morgen vormittag, wenn der Wind günstig ist.« Er zog die Uhr und ließ den Deckel aufschnappen. »Ich würde gerne meine Offizier …« Er zuckte zusammen: Selbst das war jetzt anders. »Ich möchte die Kommandanten des Geschwaders sprechen, so bald es geht. Vom hiesigen Gouverneur habe ich noch Depeschen bekommen, und wenn ich sie gelesen habe, werde ich dem Geschwader mitteilen, um was es geht.« Er lächelte. »Machen Sie kein so bekümmertes Gesicht, Thomas, für mich ist es ebenso schwer wie für Sie.«
Eine Sekunde lang blitzte die alte Wärme in Herricks Augen auf; die Kameradschaft, das Vertrauen, die jetzt so leicht zu zerstören waren. »Ich komme mir vor«, entgegnete er, »wie ein alter Fuß in einem neuen Schuh.« Jetzt lächelte er ebenfalls. »Aber ich lasse Sie bestimmt nicht im Stich.«
Er wandte sich um und ging hinaus; nach einer diskreten Pause schleppten Allday und zwei Matrosen eine große Kiste herein. Allday blickte sich rasch in der Kajüte um – anscheinend gefiel sie ihm.
Langsam wich Bolithos Spannung. Allday blieb immer der gleiche, Gott sei Dank. Selbst das blaue Jackett mit den großen vergoldeten Knöpfen, die neue Nankinghose und die Schnallenschuhe, die Bolitho ihm gekauft hatte, um seinen neuen Status als Bootsführer des Kommodore zu unterstreichen, vermochten nicht, seine kraftvolle, rauhe Persönlichkeit zu verbergen.
Bolitho schnallte den Degen ab und reichte ihn Allday.
»Na, Allday, was halten Sie von der Lysander?«
Allday sah ihn gelassen an. »Ein gutgebautes Schiff …« Das Wort »Sir« wollte ihm nicht über die Lippen. Sonst hatte er Bolitho immer »Captain« genannt, das hatte sich zwischen ihnen so ergeben. Seit dem neuen Rang stimmte nun auch das nicht mehr.
Allday erriet Bolithos Gedanken und grinste betreten. »Entschuldigung, Sir.« Böse starrte er die beiden Matrosen an, die noch mit einer Kiste in Händen dastanden. »Aber ich kann warten. Es wird nicht mehr lange dauern, dann heißt es sowieso ›Sir Richard‹!»
Er wartete, bis die beiden Matrosen draußen waren, und sagte dann leise: »Sie möchten jetzt wohl gern allein sein, Sir. Ich werde Ihrem Steward Bescheid sagen, wie Sie alles haben wollen.«
Bolitho nickte. »Sie kennen mich gut.«
Allday schloß die Tür hinter sich. »Besser, als du dich jemals selber kennen wirst«, murmelte er und warf dem Posten vor der Tür einen kalten Blick zu.
Draußen auf dem Achterdeck trat Herrick langsam an die Netze und starrte zu den anderen Schiffen hinüber. Das war ein schlechter Anfang gewesen, für sie beide. Aber vielleicht war alles auch nur Einbildung, sogar seine Abneigung gegen Farquhar. Farquhar seinerseits teilte diese Abneigung bestimmt nicht, dem war er völlig gleichgültig. Warum regte er sich also bei jeder Gelegenheit auf?
Bolitho war doch der alte geblieben. Dieselbe Ernsthaftigkeit, die jederzeit in jugendlichen Übermut umschlagen konnte. Sein Haar war so schwarz wie eh und je. Er war auch immer noch so schlank und beweglich, nur seine rechte Schulter wirkte etwas steif. Wie lange war es her, daß ihn die Musketenkugel verwundet hatte? Fast sieben Monate mußten es schon sein. Die Linien um seine Mundwinkel waren ein bißchen tiefer geworden. Wegen der Schmerzen oder der neuen Verantwortung? Wohl beides zu gleichen Teilen.
Herrick sah, daß der Wachoffizier ihn neugierig musterte, und rief: »Mr. Kipling, Signal an Geschwader: Alle Kommandanten auf Abruf an Bord des Flaggschiffs!«
Auf dieses Signal hin würden sie jetzt ihre besten Uniformen anlegen, Inch in seiner winzigen Kajüte, Farquhar in seinem luxuriösen Quartier. Aber alle würden ebenso neugierig sein wie er: wo es hinging, was sie zu erwarten hatten – und was es sie kosten würde.
Über sich an Deck hörte Bolitho das Trappeln von Füßen; nach kurzem Zögern legte er seinen Galarock mit dem einzelnen Goldstreifen ab und setzte sich an seinen Arbeitstisch. Er schnitt das große Leinwandkuvert auf, konnte sich jedoch nicht gleich dazu entschließen, die sauber geschriebene Depesche zu lesen.
Immer noch hatte er Herricks besorgtes Gesicht vor Augen. Sie waren fast gleich an Jahren, und doch kam ihm Herrick sehr gealtert vor; sein braunes Haar war hier und da grau bereift. Bolitho fiel es schwer, etwas anderes in ihm zu sehen als seinen besten Freund. Aber er mußte in ihm den Kommandanten sehen, den Flaggkapitän eines neuen Geschwaders, das noch nie als selbständiger Verband zusammengewirkt hatte. Eine schwere Aufgabe für jeden, auch für einen Thomas Herrick … Bolitho versuchte, die plötzlich aufsteigenden Zweifel zurückzudrängen. Herrick war von bescheidener Herkunft, Sohn eines Schreibers; doch gerade seine unbedingte Ehrenhaftigkeit, die ihn zu einem Mann machte, auf den unter allen Umständen Verlaß war, konnte ihm hinderlich sein, wenn es galt, Entscheidungen von größerer Tragweite zu treffen. Herrick war ein Mann, der jeden rechtmäßigen Befehl ohne Fragen und ohne Rücksicht auf persönliches Risiko ausführen würde. Aber war er der Mann, in einer Seeschlacht den Oberbefehl zu übernehmen, wenn der Kommodore ausfiel?
Merkwürdig: die vorigen beiden Ranghöchsten auf der Lysander waren bei St. Vincent ausgefallen. Der Kommodore, George Twyford, war bei der ersten Breitseite ums Leben gekommen; und der Flaggkapitän, John Dyke, durchlitt zur Zeit Höllenqualen im Marinehospital Haslar, war so schwer verstümmelt, daß er nicht einmal selbständig essen konnte. Das Schiff hatte beide überlebt – und noch viele andere. Bolitho blickte sich in der sauberen Kajüte mit den schön geschnitzten Möbeln um. Beinahe hatte er das Gefühl, sie beobachteten ihn lauernd.
Mit einem ärgerlichen Seufzer begann er, die Depesche zu lesen.
Grüßend nickte Bolitho den fünf Offizieren zu, die den Tisch in der Kajüte umstanden. »Bitte nehmen Sie Platz, Gentlemen.«
Während sie ihre Stühle heranrückten, beobachtete er ihre Gesichter – freudige, angeregte, neugierige. Es war schließlich ein besonderer Moment; vermutlich empfanden sie ebenso, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Farquhar hatte sich nicht verändert, war geschmeidig, elegant und so selbstbewußt geblieben, wie er schon als Midshipman gewesen war. Jetzt war er zweiunddreißig und planmäßiger Fregattenkapitän; vor Ehrgeiz leuchteten seine Augen fast so wie die blanken goldenen Epauletten.
Francis Inch konnte kaum das Strahlen auf seinem diensteifrigen Pferdegesicht verbergen. Die Schaluppe war unentbehrlich für die Rekognoszierung und als Vorhut des Geschwaders, und als ihr Kommandant war Inch ein hochwichtiger Mann.
Raymond Javal, der Kommandant der Fregatte, sah eher einem Franzosen ähnlich als einem britischen Marineoffizier. Er war tiefbrünett und hatte starkes, fettiges Haar; sein Gesicht war so schmal, daß es von den tiefliegenden Augen ganz und gar beherrscht wurde.
Mit einem kurzen Lächeln begrüßte Bolitho auch Kapitän George Probyn von der Nicator. Mit ihm war er auf der alten Trojan gefahren, als die amerikanische Revolution ausgebrochen war und die ganze Welt verändert hatte. Aber Probyn sah ganz anders aus als damals: wie ein riesiger, schäbiger Kneipenwirt hockte er gebeugt am Tisch. Nur ein Jahr älter als Bolitho, hatte er die Trojan auf die gleiche Weise verlassen, nämlich als Prisenkommandant auf einem gekaperten Blockadebrecher, den er zum nächsten alliierten Hafen segeln sollte. Im Gegensatz zu Bolitho, der auf diese Art zu seinem ersten selbständigen Kommando gekommen war, hatte Probyn das Pech gehabt, von einem amerikanischen Freibeuter geschnappt zu werden; er hatte den größten Teil des Krieges in Gefangenschaft verbracht, bis er schließlich gegen einen französischen Offizier ausgetauscht worden war. Diese in der wichtigsten Phase seiner Laufbahn verlorenen Jahre waren Probyn offenbar teuer zu stehen gekommen. Er wirkte unsicher und hatte eine merkwürdige Art, schnelle, verstohlene Blicke auf seine Kameraden zu werfen und dann wieder auf seine verschlungenen Hände hinunterzusehen.
»Alle vollzählig, Sir«, meldete Herrick.
Bolitho blickte auf den Tisch nieder. Im Geiste las er wieder seine Segelorder: Sie werden hiermit bevollmächtigt und beauftragt, mit Ihrem Geschwader und allen Ihnen zur Verfügung stehenden Kräften Anwesenheit und Absichten größerer feindlicher Einheiten zu erkunden …
Ruhig und eindringlich begann er zu sprechen: »Wie Ihnen bekannt sein wird, hat der Feind eine Menge Zeit daran gewandt, Schwachstellen in unserer Verteidigung aufzuspüren. Abgesehen von unseren Siegen zur See, haben wir wenig erreicht, um das Vordringen und den wachsenden Einfluß Frankreichs zu stoppen. Meiner Ansicht nach ist Bonaparte niemals von seinem ursprünglichen Plan abgewichen, der immer noch und notwendigerweise darin besteht, Indien zu erreichen und unsere Handelswege zu blockieren. Dem französischen Admiral Suffren wäre das im letzten Kriege beinahe geglückt.« Bolitho fing Herricks Blick auf; zweifellos dachte er daran, wie sie zusammen in Ostindien gekämpft und selbst erlebt hatten, wie erpicht der Feind darauf war, die Gebiete wiederzuerobern, die er in jenem unstabilen Frieden verloren hatte. »Bonaparte muß wissen, daß jede Verzögerung seiner Vorbereitungen uns nur Zeit gibt, unsere Kräfte zu verstärken«, fuhr Bolitho fort.
Alle Köpfe wandten sich Inch zu, der unbekümmert dazwischenrief: »Wir werden’s ihnen schon zeigen, Sir! Genau wie damals!« Und er grinste die anderen vergnügt an.
Bolitho mußte lächeln. Schön, daß Inch, wenn er auch keine Ahnung von den Fakten hatte, immer noch wie früher war. Und sein munterer Kommentar hatte wenigstens die Distanz zwischen ihm und den Geschwaderoffizieren etwas gemindert.
»Danke, Commander Inch. Ihr Optimismus macht Ihnen Ehre.«
Errötend vor Freude verbeugte sich Inch.
»Dennoch – wir haben keine verläßlichen Nachrichten darüber, in welche Richtung die Franzosen vorstoßen werden. Das Gros unserer Flotte operiert vom Tejo aus, um einen Keil zwischen die Franzosen und ihre spanischen Verbündeten zu treiben. Einerseits könnte der Feind Portugal angreifen, wegen unserer dortigen Präsenz, oder er könnte auch nochmals eine Invasion Irlands versuchen.« Bolitho konnte seine Erbitterung nicht verbergen. »So wie im vorigen Jahr, als in unserer Flotte Zustände herrschten, die zu den großen Meutereien bei Spithead und in der Themseflotte führten4 siehe Kent: Der Stolz der Flotte (Anm. d. Ü.) ↑.«
Farquhar sah auf seine Manschetten nieder: »Sie hätten tausend von diesen Teufeln hängen sollen, nicht bloß ’ne Handvoll!«
Bolitho warf ihm einen kalten Blick zu. »Wenn man vorher etwas mehr an die berechtigten Bedürfnisse der Matrosen gedacht hätte, dann wären vielleicht überhaupt keine Strafen nötig gewesen!«
Farquhar lächelte unbekümmert. »Verstehe, was Sie meinen, Sir.«
Bolitho blickte auf seine durcheinandergeratenen Papiere nieder, um sich nichts anmerken zu lassen. Er hätte gar nicht auf Farquhars Scharfmacherei eingehen sollen.
»Unsere Aufgabe ist zunächst«, fuhr er fort, »zu erkunden, wie die Vorbereitungen der Franzosen im Golfe du Lyon vorangehen. Und zwar in Toulon, Marseille und anderen Häfen, in denen wir Feindtätigkeit beobachten können.« Er blickte jedem einzelnen ins Gesicht. »Unsere Flotte ist weit auseinandergezogen. Auf keinen Fall darf der Feind eine Möglichkeit erhalten, sie so zu zerstreuen, daß er sie Schiff um Schiff vernichten kann. Andererseits wäre es sinnlos, eine große Flotte am einen Ende des Ozeans zu stationieren, während der Feind sich am anderen aufhält. Aufspüren, stellen, in ein Gefecht verwickeln – anders geht es nicht.«
»Mein Schiff ist unsere einzige Fregatte, Sir«, warf Javal düster dazwischen.
»Ist das eine Feststellung oder eine Beschwerde?«
Javal zuckte die Achseln. »Ein chronisches Übel, Sir.«
Probyn sah erst ihn und dann Farquhar auf seine schnelle, verstohlene Art an. »Ein großes Risiko. Und wenn wir auf überlegene Verbände stoßen, haben wir keine Unterstützung.«
»Aber zumindest wissen wir dann, wo sie sind, mein lieber George«, erwiderte Farquhar kühl.
»Die Lage ist ernst«, mahnte Herrick.
»Offenbar«, erwiderte Farquhar mit blitzenden Augen. »Also wollen wir sie auch ernsthaft angehen.«
»Eins ist jedenfalls sicher«, sagte Bolitho, und aller Augen wandten sich ihm wieder zu, »wir müssen gut abgestimmt operieren. Wie Sie über den Sinn dieser Befehle denken, ist mir gleich, wir müssen sie jedenfalls in Taten umsetzen. Und sie so ausführen, daß die Flotte und das Land den größtmöglichen Nutzen davon haben.«
»Der Ansicht bin ich auch, Sir«, nickte Farquhar.
Die anderen blieben stumm.
»Nun gehen Sie bitte wieder an Bord Ihrer Schiffe und unterrichten Sie Ihre Leute über unsere Aufgabe. Und heute abend bitte ich Sie, bei mir zu speisen.«
Im Aufstehen überlegten bereits alle, wie sie seine Worte ihren Untergebenen beibringen konnten. Wie Bolitho würde jeder von ihnen, mit Ausnahme von Inch, erst einmal an Bord allein sein wollen, um sich auf das einzustellen, was auf ihn zukam. Aber viel Zeit blieb ihnen nicht. Er mußte jeden einzelnen besser kennenlernen; wenn die Lysander ein Signal setzte, mußte jeder Kommandant die Gedanken des Mannes lesen können, von dem es kam.
Einer nach dem anderen verabschiedete sich. Probyn ging als letzter; das hatte Bolitho vorher gewußt.
»Schön, Sie wiederzusehen, Sir«, sagte er verlegen. »Damals, das waren tolle Zeiten. Ich habe immer gewußt, daß Sie Erfolg haben, berühmt werden.« Seine Blicke schossen in der Kajüte umher. »Ich hatte weniger Glück, aber meine Schuld war es nicht. Wenn man keine Verbindungen hat …« Er vollendete den Satz nicht.
»Es macht mir meine Aufgabe leichter, daß ich alte Freunde um mich habe«, antwortete Bolitho lächelnd.
Als die Tür sich geschlossen hatte, schritt Bolitho langsam zu dem Weinschrank aus massivem Mahagoni, den er aus London mitgebracht hatte. Es war ein sehr schönes Stück, ein Meisterwerk des Tischlers, wovon jede Fläche und jede Fuge zeugte.
Er starrte den Schrank immer noch an, als Herrick, der die anderen Kommandanten zur Fallreepspforte begleitet hatte, zurückkam.
»Das ging ja ganz gut«, sagte der Flaggkapitän mit einem kleinen Seufzer. Dann sah er den Schrank und stieß einen leisen Pfiff aus. »Das ist aber ein wunderschönes Stück!«
»Ein Geschenk«, lächelte Bolitho, »und oft nützlicher als viele andere Geschenke, Thomas.«
Herrick sah sich den Schrank genau an. »Ihr Neffe ist draußen, Sir«, sagte er dann. »Ich habe die Geschichte bereinigt. Er macht Extradienst, damit er nicht wieder auf dumme Gedanken kommt. Aber ich dachte, Sie würden ihn sprechen wollen.« Bewundernd strich Herrick über das polierte Holz. »Von wem haben Sie dieses schöne Stück, wenn ich fragen darf?«
»Von Mrs. Pareja«, antwortete Bolitho. »Sie werden sich noch an sie erinnern.«
Erstaunt sah er, wie ein Schleier über Herricks Augen fiel.
»Jawohl, Sir«, erwiderte er knapp. »Sehr gut sogar.«
»Was ist denn, Mann?«
Herrick sah ihm offen ins Gesicht. »Jedesmal, wenn ein Schiff aus England kam, gab es Gerede – Klatsch, wenn Sie wollen. Zum Beispiel darüber, daß Sie mit dieser Dame in London eine Affäre hatten.«
Verblüfft starrte Bolitho ihn an. »Mein Gott, Thomas, das sieht Ihnen aber gar nicht ähnlich.«
Doch Herrick gab nicht auf. »Das war nämlich der Grund, weshalb Ihr Neffe mit dem anderen Leutnant die Waffen kreuzte. Einen Ehrenhandel nennt man das wohl.«
Bolitho sah zur Seite. Und er hatte gedacht, es hätte etwas mit Adam Pascoes Herkunft zu tun gehabt, mit seinem toten Vater, dem Verräter und Renegaten.
»Danke, daß Sie es mir gesagt haben.«
»Einer mußte es ja tun, Sir.« Herricks blaue Augen blickten beschwörend. »Sie haben so viel für uns alle getan; ich will nicht, daß wegen einer …«
»Ich habe Ihnen dafür gedankt, daß Sie es mir gesagt haben, Thomas. Nicht für Ihre Meinung über die Dame.«
Herrick öffnete die Tür. »Ich rufe ihn herein, Sir.« Er sah sich nicht um.
Bolitho setzte sich auf die Bank vor den Heckfenstern und beobachtete ein Fischerboot, das unter dem überhängenden Heck des Zweideckers durchfuhr. Mit ausdruckslosem Gesicht blickte der Fischer zu ihm empor. Wahrscheinlich stand er im Sold des spanischen Kommandeurs drüben in Algeciras, notierte die Namen der Schiffe und sammelte Bruchstücke von Informationen, aus denen sich etwas machen ließ.
Die Tür ging auf; Adam Pascoe, den Hut vorschriftsmäßig unterm Arm, stand in der Kajüte.
Bolitho erhob sich und schritt auf ihn zu; fast verspürte er selbst Schmerz, als er sah, daß der junge Mann den Arm etwas von den Rippen abhielt. Noch in der Leutnantsuniform sah Adam wie der schmächtige Junge aus, als der er zum erstenmal zu Bolitho an Bord gekommen war.
»Willkommen an Bord, Sir«, sagte er.
Bolitho vergaß die Last seiner neuen Verantwortung, seinen unseligen Zusammenstoß mit Herrick – alles außer diesem Jungen, der ihm so lieb geworden war wie ein Sohn.
Er umarmte ihn und sagte: »Du hast Ärger gehabt, Adam. Tut mir leid, daß es meinetwegen war.«
Pascoe sah ihn ernsthaft an. »Ich hätte ihn schon nicht getötet, Onkel.«
Bolitho trat zurück und lächelte melancholisch. »Nein, Adam, aber vielleicht er dich. Achtzehn Jahre – das ist der Anfang, noch nicht das Ende.«
Achselzuckend strich sich Pascoe das schwarze Haar aus der Stirn. »Der Kommandant hat mir genügend Extradienst dafür aufgebrummt. Was macht deine Verwundung, Onkel?«
»Vergessen.« Bolitho führte ihn zu einem Stuhl. »Deine auch – eh?«
Sie lächelten sich wie Verschwörer an, und Bolitho schenkte zwei Gläser Rotwein ein. Er bemerkte, daß Pascoes Haar nach der neuen Mode geschnitten war, ohne den Zopf im Nacken, wie ihn die meisten Seeoffiziere trugen. Wie mochte die Marine wohl erst aussehen, wenn sein Neffe eines Tages den Kommodorestander hißte?
Pascoe nippte am Wein. »Es heißt, Nelson hätte den Befehl über dieses Geschwader gekriegt, wenn er nicht den Arm verloren hätte.«
»Möglich«, lächelte Bolitho. In der Flotte gab es wenig Geheimnisse.
Nachdenklich entgegnete Pascoe: »Eine große Ehre für dich, Onkel, aber …«
»Aber was?«
»Auch eine große Verantwortung.«
Herrick erschien wieder in der Tür. »Darf ich fragen, Sir, wann die Kommandanten zum Essen an Bord kommen sollen?« Er blickte von einem zum anderen und war seltsam gerührt. Ungefähr zwanzig Jahre Altersunterschied, und doch sahen sie wie Brüder aus.
»Das überlasse ich Ihnen«, antwortete Bolitho.
Als Herrick gegangen war, fragte Adam unverblümt: »Stimmt etwas nicht zwischen dir und Kapitän Herrick, Onkel?«
Bolitho legte ihm die Hand auf den Arm. »Nichts kann unsere Freundschaft trüben, Adam.«
»Das freut mich«, sagte Pascoe erleichtert.
Bolitho griff nach der Karaffe. »Und jetzt erzähl mir, was du inzwischen gemacht hast.«
II Ein bescheidener Anfang
Ruhelos die ihm noch ungewohnten Möbelstücke betastend, wanderte Bolitho in der Kajüte umher. Um ihn und über ihm knarrten und stöhnten die siebzehnhundert Tonnen Planken und Spieren, Kanonen und Menschen unter dem Druck des auffrischenden Nordwestwindes.
Widerstrebend versagte er es sich, mit einem Blick aus dem Fenster zu kontrollieren, wie weit die anderen Schiffe des Geschwaders mit den Vorbereitungen zum Ankerlichten waren. Er hörte ab und zu einen Ruf, dem das Trappeln nackter Füße folgte – Matrosen rannten hierhin und dorthin, um im letzten Augenblick noch etwas in Ordnung zu bringen. Er konnte sich vorstellen, daß sich Herrick ebenso über jede Verzögerung ärgerte. Dennoch blieb ihm nichts weiter übrig, als ihn auf seinem Achterdeck in Ruhe zu lassen.
Als Kommandant war Bolitho mit Schiffen aller Art und unter den verschiedensten Bedingungen ankerauf gegangen. Von der flinken Schaluppe bis zum turmhohen Dreidecker Euryalus, auf dem er Flaggkapitän gewesen war, hatte er auf jedem Schiffstyp die spannungsgeladenen Minuten vor dem Loskommen des Ankers durchlebt.
Für Herrick mußte es ebenso schlimm sein, wenn nicht noch schlimmer. Wenn der Kommandant auf dem Achterdeck stand, hoch über dem ganzen Getriebe, vor jeder Kritik durch seine Autorität und seine glänzenden Epauletten geschützt, mochte ein unbeteiligter Zuschauer irrtümlicherweise glauben, er stünde über allen menschlichen Ängsten und Gefühlen.
So war es Bolitho als Midshipman vorgekommen, auch noch als jungem Leutnant: Ein Kommandant mußte ein gottähnliches Wesen sein. Er lebte unerreichbar in seiner Heck-Kajüte, und vor seinem Stirnrunzeln zitterte jeder gewöhnliche Offizier oder Matrose.
Aber jetzt wußte Bolitho es besser, genau wie Herrick. Je größer die Verantwortung, um so größer zwar die Ehre. Aber wenn etwas schiefging, dann fiel man um so tiefer, je höher man stand.
Allday kam herein, sich die großen Hände reibend. Auf seinem blauen Jackett glänzten Tropfen von Sprühwasser, und die Erregung leuchtete ihm aus den Augen. Bolitho spürte es auch selbst: Endlich ließen sie das Land hinter sich – wie ein Jäger, der aufbricht, sich mit dem Unbekannten zu messen, weil er muß, der aber nie weiß, ob es nicht das letzte Mal ist.
»Die Mannschaft arbeitet ganz gut, Sir«, grinste der Bootsführer. »Ich war eben oben und habe Ihre Gig kontrolliert. Ganz nette Brise aus Nordwest. Großartig werden wir aussehen, wenn das Geschwader erst vom Felsen klarkommt.«
Nervös fuhr Bolitho zusammen und horchte mit schiefem Kopf: ein Rasseln oben an Deck, etwas schleifte über die Planken, und eine grobe Stimme brüllte: »Beleg die Leine da, du Saukerl!«
Er biß sich auf die Lippen. Da ging doch alles mögliche schief!
Allday musterte ihn nachdenklich. »Captain Herrick kommt schon klar, Sir.«
»Weiß ich.« Bolitho nickte, als wolle er seine Überzeugung besiegeln. »Das weiß ich doch.«
»Auf ihn können Sie sich verlassen.«
Allday nahm den Degen von der Schottwand und wartete darauf, daß Bolitho die Arme hob, damit er ihm das Koppel umschnallen konnte. »Immer noch der alte«, sagte er leise und berührte den abgewetzten Griff. »Wir sind schon einige Meilen zusammen gesegelt.«
»Aye«, stimmte Bolitho ernst zu und ließ die Finger über die Parierstange gleiten. »Ich glaube, der macht’s noch länger als wir beide.«
Allday grinste übers ganze Gesicht. »So ist’s schon besser, Sir! Jetzt reden Sie wieder, wie es sich für einen Flaggoffizier gehört.«
Lautlos ging die Tür auf, und Herrick, Hut unterm Arm, trat ein. »Geschwader klar zum Ankerlichten, Sir.« Er sprach ganz gelassen. »Alle Anker sind kurzstag gehievt.«
»Danke, Captain Herrick«, antwortete Bolitho in dienstlichem Ton. »Ich komme gleich an Deck.«
Herrick eilte wieder hinaus; man hörte ihn die Leiter zur Kampanje über der Achterkajüte hinaufsteigen. Er mußte den Schiffsverkehr in der Straße von Gibraltar in Betracht ziehen, der jedoch Gott sei Dank spärlich war; auch die Windstärke und die nahen Untiefen. Herrick mußte sich auch darüber klar sein, daß er an diesem Vormittag noch von anderen Augen als von Bolithos beobachtet wurde. Die Kommandanten, die am Vorabend beim Dinner so gelöst und kameradschaftlich getan hatten, würden seine Seemannschaft, den Ausbildungsstand der Lysander, die Schnelligkeit ihres Auslaufens sehr kritisch beurteilen. Auch auf den zur Garnison gehörigen Schiffen, sogar von der Festung im feindlichen Algeciras aus würden Teleskope auf die Lysander gerichtet sein.
»Wir wollen gehen, Allday«, sagte Bolitho gelassen.
Unter dem Skylight blieb Allday stehen und deutete nach oben. »Sehen Sie mal, Sir.«
Bolitho starrte hinauf in das schwarze Gewirr der Wanten, auf den himmelhohen Großmast dahinter, in dessen Topp der Kommodorestander peitschend auswehte.
»Ja, ich sehe ihn.«
Allday musterte Bolitho ernst und eingehend. »Der gehört Ihnen von rechtswegen, Sir. Mancher, der ihn dieser Tage sieht, möchte ihn runterholen, wenn er könnte. Aber solange er weht, werden sie Ihnen gehorchen. Also machen Sie sich keine Sorgen, überlassen Sie die anderen. Sie haben Besseres zu tun.«
Bolitho sah Allday überrascht an. »Admiral Beauchamp hat mir etwa dasselbe gesagt, wenn auch nicht mit den gleichen Worten.« Er schlug Allday auf den Arm. »Danke.«
Als er unter der Kampanje heraustrat und am großen Doppelrad vorbeikam, war er sich durchaus darüber klar, daß ihn alle in Sichtweite genau beobachteten. Draußen, vom Achterdeck aus, wo der Wind Gischtfetzen über Netze und Laufbrücken wehte, sah er, daß sich die Matrosen bereits an den Brassen und Fallen drängten; dahinter standen die Marine-Infanteristen in ihren scharlachroten Röcken, um die Matrosen zu unterstützen, wenn es so weit war.
»Achterdeck – Achtung!«
Das war Gilchrist, der Erste Offizier, Herricks rechte Hand. Lang und dürr, die Stirn ständig in Falten, sah er aus wie ein mißgelaunter Schulmeister. Hinter ihm standen einige Leutnants, der Midshipman der Wache und allerlei namenloses Schiffsvolk.
Bolitho tippte grüßend an seinen Hut, was dem Achterdeck im allgemeinen galt, und verglich, eigentlich gegen seine Absicht, das, was er sah, mit dem, was ihm als Kommandant selbst vertraut und lieb geworden war. Er hätte sich so schnell wie möglich Gesicht und Namen jedes einzelnen Offiziers eingeprägt und sich diesen Ersten Offizier besonders genau angesehen. Er warf einen raschen Blick auf Herricks untersetzte Gestalt an der Reling – ob auch er wohl jetzt Vergleiche anstellte?
Dicht neben sich hörte er eine rauhe Stimme: »Wunderschöner Tag, Sir, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.«
Bolitho fuhr herum und sah einen mächtigen, rotgesichtigen Mann von, wie ihm schien, dreifacher Raumbeanspruchung, nicht so sehr in der Höhe wie in der Breite. Die dicken Beine gespreizt, um eine plötzliche Bö abzufangen, stand er da und starrte Bolitho aus schwerlidrigen, melancholischen Augen mit unverhohlener Neugier an. »Mein Name ist Grubb, Sir. Ich bin der Master5 Auch Segelmeister genannt; etwa einem Navigationsoffizier vergleichbar. Einer der wichtigsten Männer an Bord, obwohl nur im Deckoffiziersrang. (Anm. d. Ü.) ↑.«
»Danke, Mr. Grubb«, lächelte Bolitho. Das hätte er sich denken können. Über Ben Grubb, den Master der Lysander bei St. Vincent, existierten bereits viele Legenden. Er hatte, so wurde erzählt, persönlich die Querflöte geblasen, als der Vierundsiebziger die Feindformation durchbrach und alle Trommeljungen der Marine-Infanterie von Schrapnellgeschossen niedergemäht worden waren.
Diesem mächtigen, unordentlich gekleideten Mann war das schon zuzutrauen, fand Bolitho. Eine merkwürdige Mischung. So wie das Gesicht war der ganze Mann: offenbar von schweren Stürmen gezeichnet; und ein schwerer Trinker war er auch, das sah man ihm an. Von jetzt an würde Grubb einer der wichtigsten Männer im Geschwader sein.
Grubb zog eine apfelgroße Taschenuhr, sah nach der Zeit und sagte: »Ungefähr jetzt, würde ich meinen, Sir.«
Bolitho nickte und drehte sich nach Herrick um. Pascoe stand mit einem Midshipman und den Signalgasten in der Nähe, ein Deckoffizier kritzelte etwas auf seine Tafel.
»Also bitte, Captain. Wir wollen auslaufen.«
Absichtlich langsam schritt Bolitho über das unaufgeklärte Deck und versuchte, nicht auf die vielen Blöcke und Taljen hinunterzublicken, an denen die Achterdeckwache seit Morgengrauen gearbeitet hatte. Das wäre ein schöner Anblick für die Crew der Lysander, wenn er mit dem Fuß hängenbliebe und der Länge nach auf die Planken fiele! Seltsamerweise wurde er gerade bei dieser gräßlichen Vorstellung ruhiger und konnte sich auf die anderen Schiffe konzentrieren, auf denen nacheinander die Bestätigungen für Herricks Signal Anker auf hochgingen.
»Von allen bestätigt, Sir!« hörte er den Midshipman rufen.
Und dann ertönte Pascoes vor verhaltener Erregung zitternde Stimme: »Achterdeck – klar zum Manöver!«
Gilchrist rannte polternd über die Planken, und selbst noch durch die Sprechtrompete klang seine Stimme mißbilligend: »Mr. Yeo! Mehr Leute ans Gangspill! Verdammte Bummelei!«
Bolitho wandte sich nicht um. Yeo war der Bootsmann, er würde ihn schon noch kennenlernen. Drüben rollte die kleine Harebell wie betrunken, die Rahen voll geschäftiger Matrosen. Ihr Ankertau stand auf und nieder; er glaubte, Inchs vogelscheuchenähnliche Gestalt an der Achterdeckreling zu erkennen, wie er über die Reede deutete, die mit ihren zahllosen weißmützigen Wellen aussah wie ein Miniaturozean.
Bolitho nahm dem Midshipman der Wache das Teleskop aus der Hand, stellte es auf den anderen Zweidecker ein und fragte dabei: »Und wie heißen Sie?«
Der Midshipman starrte ihn perplex an. »Saxby, Sir.«
Auf den Decksgängen der Nicator rannten jetzt die Matrosen eilig nach achtern. Saxby war etwa dreizehn und hatte ein rundes, unschuldiges Gesicht. Sein sonst recht nettes Aussehen wurde beeinträchtigt, wenn er den Mund aufmachte, denn ihm fehlten zwei Vorderzähne.
Bolitho fixierte das Glas und versuchte, nicht auf Gilchrists blecherne Stimme zu achten. Es dauerte alles viel zu lange. Vorsicht – schön und gut, aber das hier war ein ängstliches Kriechen.
»Das geht zu langsam, Captain Herrick!« sagte er scharf.
»Sir?« Herrick hatte anscheinend nicht aufgepaßt.
»Setzen Sie Dringlichkeitssignal, bitte!« Es war ihm unangenehm, aber hier stand mehr auf dem Spiel als privates Gefühl.
Er hörte laute Befehle, die verwischten Rufe der Toppsgasten, die sich auf den Fußpferden der vibrierenden Rahen hinausarbeiteten.
Und dann wurde das alte Signal mit einem Ruck niedergeholt, und vom Vorschiff kam der Ruf: »Anker ist los!«
Schwer legte sich die Lysander auf die Seite, der Anker kam aus dem Wasser, der Wind füllte bereits die Marssegel; langsam drehte sie durch die kabbelige See.
»An die Brassen!«
Nackte Füße schlidderten über die nassen Planken; vom Ankerspill rannten Männer herbei.
Eins nach dem anderen, wie mächtige Tiere gingen die drei Linienschiffe vor den Wind; weiter draußen setzten die Fregatte Buzzard und Inchs Schaluppe bereits mehr Segel, um sich von den großen Schiffen freizuhalten.
Ein »Starter«, der kurze Tampen eines Maaten, klatschte auf einen nackten Rücken, und der Mann schrie auf.
Hoch über Deck wetteiferten die Toppsgasten miteinander, um die anderen Schiffe des Geschwaders zu übertreffen. »Setzen Sie die Breitfock, Mr. Gilchrist!« befahl Herrick. »Und sagen Sie diesem Bootsmannsmaaten, er soll sparsamer mit seinem Tampen umgehen!«
Bolitho ging auf die andere Seite, wo soeben die Osiris das Kielwasser der Nicator kreuzte. Sie bot einen schönen Anblick mit ihren steif und voll stehenden Marssegeln, unter denen sie so stark überholte, daß die Bugsee beinahe über die unteren Stückpforten wusch. Fock und Großsegel schlugen einmal und füllten sich dann; hart glänzten sie im Sonnenlicht wie Silber.
»Die Nicator fällt zurück«, sagte Bolitho. »Signalisieren Sie ihr, mehr Segel zu setzen!«
Vielleicht hatte Kapitän Probyn so viel zu tun, daß er nicht merkte, wie sein Schiff bereits aus der Formation der Vierundsiebziger ausbrach. Es konnte aber auch sein, daß er testen wollte, ob sein Kommodore ein gutes Auge hatte und schnell in die Schiffsführung eingriff.
»Nicator bestätigt, Sir!« rief der Signalgast.
Probyns Leute setzten bereits das Vorbramsegel. Das ging fast zu schnell, fand Bolitho. Probyn hatte ihn also testen wollen.
Grubb sah nach oben in die Takelage, dann auf den Kompaß und nach seinen Rudergasten, ohne daß sich ein Muskel seines Gesichts bewegte. Nur die Augen huschten auf und nieder, nach vorn und nach achtern, wie zwei Leuchtfeuer auf einer verwitterten roten Steilküste.
Nach einer knappen Stunde war das Geschwader klar von den Ansteuerungstonnen, und die drei Linienschiffe boten unter etwas reduzierter Leinwand einen stolzen Anblick, als sie von Land wegstrebten. In Lee kreuzten Buzzard und Harebell hastig unter vollen Segeln, deren bleiche Pyramiden bereits im Dunst verschwammen, um ihre Stationen weit vor dem Geschwader einzunehmen.
»Also gut, Mr. Grubb«, rief Herrick, »Kurs Ostsüdost.« Dann kam er zu den Netzen hinüber, wo Bolitho stand, einen Fuß auf die Lafette eines Achterdeck-Neunpfünders gestützt.
Leise lächelnd blickte Bolitho ihm entgegen. »Na, Thomas, wie fühlen Sie sich?«
Die Falten in Herricks Gesicht glätteten sich etwas. Als ob eine Wolke abzieht, dachte Bolitho.
»Besser, Sir«, antwortete Herrick und atmete tief aus. »Ein ganzes Ende besser!«
Bolitho beschattete die Augen mit der Hand und sah zum Land hinüber. Wahrscheinlich ritten schon in dieser Minute Kuriere in gestrecktem Galopp über die Küstenstraßen. Aber es hätte keinen Sinn gehabt, wie Strauchdiebe im Schutz der Dunkelheit durch die Straße von Gibraltar zu schleichen. Zwar hatte er seine Befehle, doch der Earl of St. Vincent hatte ihm auch klargemacht, daß es seine Sache war, wie er sie interpretierte und ausführte. Es konnte gar nichts schaden, wenn der Feind wußte, daß wieder ein starker britischer Verband ins Mittelmeer segelte. Bolitho blickte zum Großmasttopp hinauf, zu dem langen, gespaltenen Wimpel, der jetzt steif wie ein Brett im steten Wind stand. Seine Flagge. Dann ließ er den Blick über das von Menschen wimmelnde Deck schweifen, über die emsigen Matrosen, die in großen Duchten aufgeschossenen Taue, die dem Binnenländer wie ein hoffnungsloses Gewirr vorkommen mußten. Und dann weiter vor zum Klüverbaum, unter dem er gerade noch eine der breiten Schultern des spartanischen Heerführers sehen konnte. Inchs Schaluppe, ihre ganze Vorhut, war nur noch ein weißes Federchen an der dunstigen Kimm. Bolitho lächelte in sich hinein. Genauso hatte auch er damals mit seinem ersten Schiff operiert, in der Chesapeake Bay. Doch nun: ein anderes Schiff – ein anderer Krieg.6 siehe Kent: Zerfetzte Flaggen (Anm. d. Ü.) ↑
»Irgendwelche Instruktionen, Sir?« fragte Herrick. Drüben an der Leereling stand Pascoe, eine Hand in die Hüfte gestützt, und sah zu ihnen herüber.
»Es ist Ihr Schiff, Thomas. Was haben Sie vor?«
Herrick versuchte, sich etwas zu lockern. »Ich würde gern Geschützexerzieren ansetzen. Mit der Segelausbildung bin ich soweit zufrieden.«
»Also bitte«, lächelte Bolitho. Da sich Gilchrist in der Nähe herumdrückte, sagte er abschließend: »Ich bin in meiner Kajüte.«
Unterwegs, beim Kompaß, hörte er Gilchrists kalte Meldung an den Kommandanten: »Zwei Mann zur Bestrafung, Sir. Nachlässigkeit im Dienst und Frechheit gegenüber einem Bootsmannsmaaten.«
Bolitho hielt inne. Eine Auspeitschung schon zu Beginn der Reise – das wäre auch unter normalen Umständen ein schlechter Anfang gewesen. Hier bei dem kleinen Geschwader, in feindlichen Gewässern, wo beinahe jedes auftauchende Segel ein Franzose oder Spanier sein mußte, vertrug es sich um so schlechter mit seiner heiklen Mission. Herrick sagte etwas zu Gilchrist, das Bolitho nicht verstand, aber der Leutnant erwiderte rasch: »Mir genügt seine Aussage, Sir.«
Bolitho schritt nach achtern unter die dicken Decksbalken. Er durfte sich nicht einmischen.
Am Abend des zweiten Tages auf See gab es nach dem zunächst schnellen Start zur Reise in den Golfe du Lyon einen Rückschlag. Unberechenbar wie immer, flaute der Wind zu einer schwachen Brise ab, so daß die Lysander auch unter Vollzeug nur knapp drei Knoten schaffte.
Das Geschwader segelte nicht mehr in seiner ursprünglichen Formation, sondern war zerstreut; und alle drei Zweidecker schlichen über ihrem eigenen Spiegelbild langsam und lustlos dahin.
Bolitho hatte die Fregatte losgeschickt, um weit voraus zu rekognoszieren; nun, bei seinem ruhelosen Auf- und Abgehen auf der Kampanje, war er froh, daß er wenigstens diese kleine Vorsichtsmaßnahme ergriffen hatte. Der Kommandant, Kapitän Javal, würde so den Landwind hoffentlich mit einigem Erfolg ausnutzen können. Trotz seiner Ungeduld mußte Bolitho lächeln. Er selbst und auch Farquhar waren im Herzen immer noch Fregattenkapitäne; der Gedanke an Javals Unabhängigkeit, das Operieren außer Reichweite jedes Signals, mußte den Neid eines Kommandanten erregen, der an einen gewichtigen Vierundsiebziger gebunden war.
Er hörte, daß Herrick mit seinem Ersten sprach, und dabei fiel ihm die Auspeitschung des Vortags wieder ein. Das wohlbekannte, gräßliche Ritual der körperlichen Züchtigung hatte bei der versammelten Mannschaft keine sonderliche Aufregung verursacht. Doch als Bolitho auf der Kampanje dem Verlesen der Kriegsartikel durch Herrick beiwohnte, hatte er so etwas wie Triumph auf Gilchrists schmalem Gesicht beobachtet. Er hatte eigentlich erwartet, daß Herrick Gilchrist beiseite nahm und ihn auf die Gefahren überflüssiger Bestrafungen hinwies.
Gedankenlose Härte konnte Folgen haben, die schlimmer waren als eine unabsichtliche Disziplinlosigkeit. Die Meutereien vor Spithead und bei der Themseflotte hätten eigentlich genügend Warnung sogar für einen Blinden sein sollen. Doch als Bolitho auf das Achterdeck hinuntersah, konnte er an der Unterhaltung der beiden nichts ablesen. Sie sprachen ganz normal miteinander; dann tippte Gilchrist an den Hut und ging weiter nach Luv. Er hatte einen merkwürdig hüpfenden Gang, bei dem seine Sohlen laut auf die Planken schlugen.
Nach kurzer Überlegung stieg Bolitho leichtfüßig die Stufen hinunter und trat neben Herrick an die Luvnetze. »Ein Schneckentempo«, sagte er. »Der Himmel möge uns den Wind wiederfinden lassen.«
Herrick sah ihn mißtrauisch an. »Unser Unterwasserschiff ist sauber, Sir. Und ich habe jedes Segel persönlich kontrolliert – wir könnten auch beim besten Willen nicht einen halben Knoten mehr machen.«
Überrascht von seinem vorwurfsvollen Ton, wandte Bolitho sich um. »Das sollte keine Kritik sein, Thomas. Ich weiß, ein Kommandant kann allerhand, aber den Elementen befehlen kann er nicht.«
Herrick lächelte gezwungen. »Entschuldigung, Sir. Aber mich bedrückt das ziemlich. Von uns wird so viel erwartet. Wenn es schiefgeht, ehe wir richtig angefangen haben …« Er zuckte hilflos die Achseln. »Die ganze Flotte müßte vielleicht darunter leiden.«
Bolitho stieg auf einen Poller und hielt sich an den Netzen, während er nach achtern zur Nicator spähte, die lethargisch auf dem gleichen Bug lag. Ihre Marssegel waren kaum gefüllt, und ihr Masttoppwimpel hob sich nur gelegentlich in den leeren Himmel.
Von Land war nichts zu sehen, obwohl der Ausguck, der winzig wie ein Äffchen turmhoch über Deck hockte, es als purpurnen Dunststreifen erkennen mußte: die Südküste von Spanien. Bolitho schauerte trotz der feuchten Hitze, als er daran dachte, daß er diese Strecke schon einmal gesegelt war. Übrigens – warum stellte sich Herrick so an? Es sah ihm gar nicht ähnlich, über das »Vielleicht« nachzugrübeln. Wieder kamen Bolitho bohrende Zweifel. War diese Verantwortung eine zu schwere Bürde für Herrick? Ohne ihn anzusehen, fragte er: »Ihr Erster, Thomas – was wissen Sie von ihm?«
»Mr. Gilchrist?« erwiderte Herrick zurückhaltend. »Sehr tüchtig im Dienst. Bei St. Vincent war er Zweiter auf der Lysander.«
Bolitho biß sich auf die Lippe. Es ärgerte ihn, daß er bereits am zweiten Tag auf See den Mund nicht mehr halten konnte. Mehr noch: er war verletzt und wußte selbst nicht, warum. Thomas Herrick war sein Freund, und in all den Jahren, in denen sie Schulter an Schulter gegen den Tod gekämpft, Fieber und Durst gelitten, Angst und Verzweiflung durchgemacht hatten, wäre eine solche Kluft zwischen ihnen unvorstellbar gewesen.
»Ich habe nicht nach seiner Führung gefragt«, entgegnete er schroffer als beabsichtigt. »Ich will etwas über den Menschen Gilchrist wissen.«
»Kann nicht klagen, Sir. Er ist ein guter Seemann.«
»Und das genügt«
»Es muß mir genügen, Sir. Sonst weiß ich nichts über ihn«, antwortete Herrick gepreßt.
Bolitho trat vom Poller herunter und zog seine Uhr. »Aha.«
»Sehen Sie, Sir«, sagte Herrick mit einer unsicheren Handbewegung, »die Dinge ändern sich eben. Ich fühle eine solche Distanz zu meinem Schiff und meinen Leuten, als lebte ich auf einer Insel. Immer wenn ich versuche, alles so zu machen wie früher, kommen mir Geschwaderangelegenheiten dazwischen. Meine Offiziere sind fast alle junge Leute; manche haben noch nie einen ernstgemeinten Kanonenschuß gehört. Pascoe, der jüngste Leutnant an Bord, hat mehr Gefechtserfahrung als alle anderen zusammen.« Herrick sprach jetzt rasch, die Worte flossen unaufhaltsam. »Ich habe ausgezeichnete Deckoffiziere, zum Teil die besten, mit denen ich je gesegelt bin. Aber Sie wissen selbst, wie das ist, Sir: die Befehle müssen vom Achterdeck kommen.«
Bolitho durfte sich nichts anmerken lassen. Wie gern hätte er Herrick beiseite genommen, mit in seine Kajüte, aus dem Bannkreis der neugierigen Augen, ihm gesagt, wie gut er ihn verstand. Aber dann wäre alles genauso geworden wie früher: Bolitho hätte sich wieder mit dem Schiffsalltag und den gedrängt vollen unteren Decks befaßt, und Herrick hätte nur darauf gewartet, seine Gedanken in Handlungen umzusetzen: ganz der ausgezeichnete Untergebene, der er immer gewesen war.
»Ja«, sagte Bolitho endlich, »so muß es auch sein. Das Schiff verläßt sich auf seinen Kommandanten. Und ich auch.«
Herrick seufzte. »Ich mußte das einmal ansprechen.«
»Ich habe Ihre Ernennung zu meinem Flaggkapitän nicht aus alter Freundschaft befürwortet, sondern weil ich glaubte, daß Sie der richtige Mann sind.« Bolitho sah, daß seine Worte Herrick wie ein Schlag ins Gesicht trafen, und fuhr fort: »Und dieser Meinung bin ich immer noch.«
Aus dem Augenwinkel sah er die massige Gestalt des Masters die beflissenen Midshipmen mit ihren Sextanten für das tägliche Ritual der Standortbestimmung um sich versammeln. An der Reling stand Leutnant Fitz-Clarence, Offizier der Wache, und tat ziemlich überzeugend so, als beobachte er aufmerksam die im Großmast arbeitenden Matrosen; doch verrieten seine angespannten Schultern, daß er versuchte, der Unterhaltung seiner Vorgesetzten zu lauschen.
»Also wollen wir nicht mehr so düster in die Zukunft sehen, ja? Wenn wir erst Feindberührung bekommen, haben wir Sorgen genug. Daran hat sich bestimmt nichts geändert.«
Herrick trat einen Schritt zurück. »Aye, Sir.« Sein Gesicht war grimmig. »Tut mir leid, wenn ich Sie enttäuschte.« Er sah Bolitho nach, der sich zur Kampanjeleiter gewandt hatte, und schloß: »Es wird nicht wieder vorkommen.«
Bolitho schritt zur Heckreling und packte verzweifelt das vergoldete Schnitzwerk. Er konnte versuchen, was er wollte, sie fanden nicht mehr zueinander; die Kluft zwischen ihnen war nicht zu überbrücken.
»An Deck!« hallte der heisere Ruf des Ausgucks, und Bolitho fuhr herum. »Die Harebell signalisiert!«
Bolitho wartete ungeduldig, bis Mr. Fitz-Clarence, Zweiter Offizier der Lysander, aus tiefem Sinnen erwachte und rief: »Mr. Faulkner! In die Wanten mit Ihrem Teleskop! Ich will wissen, was sie meldet, und zwar gleich!«
Der Midshipman der Wache, der eben noch bei den Netzen gedöst hatte, froh darüber, daß er sich Mr. Grubbs tiefschürfende Ausführungen über Navigation nicht mitanhören mußte, rannte zu den Leewanten und enterte rasch zum Großmast auf.
Fitz-Clarence sah ihm nach, Hände in die Hüften gestemmt, als erwarte er jeden Moment, daß der Junge abrutschte und fiel. Anscheinend hatte er eine Vorliebe für eindrucksvolle Posen. Er war ein eifriger, schneidiger Offizier, und was ihm an Körpergröße fehlte, pflegte er durch ständige Betonung seiner Autorität zu ersetzen.
Herrick stand dicht neben ihm, die Hände auf dem Rücken. Bolitho bemerkte, daß er sie nicht stillhalten konnte, was seine äußerliche Ruhe Lügen strafte.
Endlich kam die schrille Knabenstimme von oben: »Harebell an Flaggschiff, Sir: Buzzard im Nordosten gesichtet!«
Bolitho stieß die Hände in die Taschen und griff nach seiner Uhr, um seine plötzliche Erregung zu beherrschen. Kapitän Javal war also auf Gegenkurs gegangen und kam zum Geschwader zurück. Folglich hatte er entweder feindliche Kräfte gesichtet, die für ihn zu stark waren; oder er wollte seinem Kommodore melden, daß der Gegner bereits hinter ihm hersegelte.
Bolitho sah Herrick zur Leiter eilen, und im nächsten Moment stand er neben ihm an der Reling.
»Signal an Geschwader«, sagte Bolitho. »›Zum Flaggschiff aufschließen!‹ Und wir kürzen Segel, damit sie es leichter haben.«
Herrick starrte mit seinen klaren blauen Augen nach achtern über die glitzernde See. »Die Osiris kommt bereits auf. Kapitän Farquhar muß Augen haben wie ein Luchs.« Das klang so bitter, daß Bolitho ihn überrascht und wortlos von der Seite ansah. Er wußte, was Herrick dachte, so genau, als hätte er es herausgeschrien: Wäre Farquhar Bolithos Flaggkapitän gewesen, so hätte es keine Verzögerung gegeben. Ihm hätte der Kommodore nicht erst sagen müssen, was sich von selbst verstand.
Herrick faßte an den Hut und ging wieder zur Leiter.
Doch Gilchrist war bereits auf dem Achterdeck, Sprechtrompete in der Hand, und blaffte: »Bootsmannsmaat! Pfeifen Sie ›Alle Mann zum Segelkürzen !‹ Den letzten, der oben ist, schreiben Sie auf!«
Dann wandte er sich zu Herrick um. »Lagebesprechung, Sir?« Es klang irgendwie herausfordernd.
Herrick nickte. »Aye, Mr. Gilchrist.« Und nach kurzem Zögern: »Geben Sie Signal: ›Kommandanten an Bord‹!«
Bolitho wandte den Blick ab. Herrick hätte Gilchrist zurechtstauchen sollen, um ihm seine Arroganz ein für allemal auszutreiben.
Eilig rannten die Matrosen von ihren Arbeiten unter Deck herbei und sahen sich kaum an, während sie auf ihre Stationen rannten. Bolitho sah Pascoe, der sich im Laufen den Rock zuknöpfte, aufs Achterdeck eilen und vor Gilchrist den Hut lüften. Dieser wies ihn an: »Seien Sie schärfer zu Ihren Leuten, Mr. Pascoe!«
Pascoe sah ihn fragend an, seine Augen glitzerten im Sonnenlicht. Schließlich nickte er. »Jawohl, Mr. Gilchrist, das will ich sein.«
»Das bitte ich mir auch aus, zum Donnerwetter!« sagte Gilchrist so laut, daß mehrere Matrosen stehenblieben und hinaufschauten. »Auf meinem Schiff gibt es keine Günstlinge!«
Pascoe blickte kurz zur Kampagne hinauf, wo Bolitho noch stand, und drehte sich dann auf dem Absatz um; seine Leute scharten sich um Pascoe wie ein Schutzwall. Bolitho sah sich nach Herrick um, doch der stand an der Luvseite, weit entfernt von allem.