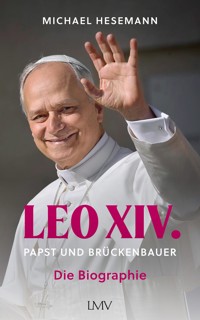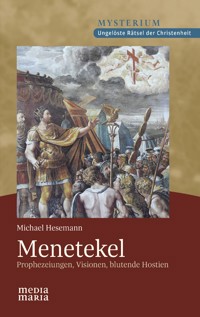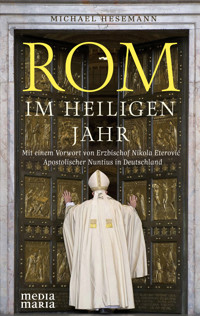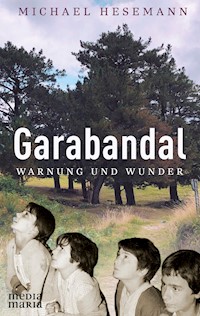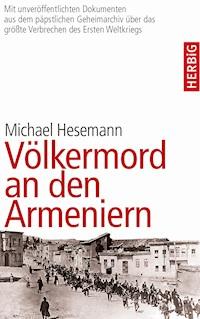8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich.«
Papst Benedikt XVI., 13. Mai 2010
Als der Vatikan im Juni 2000 das »Dritte Geheimnis von Fatima« veröffentlichte, wollte jeder glauben, dass es sich auf die Vergangenheit bezieht. Gerne sah man in der Vision der drei Seherkinder von einem alternden Papst, der »von Schmerz und Sorge gebeugt« durch »eine große Stadt ging, die halb zerstört war«, um schließlich selbst ermordet zu werden, eine symbolische Darstellung der schrecklichen Kriege und Christenverfolgungen des 20. Jahrhunderts, gipfelnd in dem Attentatsversuch des Türken Ali Agca am 13. Mai 1981, dem 74. Jahrestag der ersten Erscheinung von Fatima, auf Papst Johannes Paul II.
Doch zum 100. Jahrestag der Erscheinungen, der 2017 begangen wird, ist man sich auch im Vatikan nicht mehr sicher. Längst hat der »Islamische Staat« mit seiner internationalen Terrorarmee nicht nur der Zivilisation an sich, sondern auch ganz speziell dem Christentum und seinem Zentrum »Rom« den Krieg erklärt. Immer lauter werden die Warnungen aus Geheimdienstkreisen vor einem islamistischen Terroranschlag auf den Vatikan und den Papst. Wollte uns davor die Gottesmutter vor 100 Jahren warnen?
Tatsache ist: Bei den Erscheinungen von Fatima, gipfelnd in einem großen Sonnenwunder mit 70000 Augenzeugen, handelte es sich um den machtvollsten Eingriff Gottes in die Geschichte der Gegenwart. Präzise sagte die Gottesmutter den drei Seherkindern den Aufstieg und Fall der Sowjetunion, den Zweiten Weltkrieg und die an ein Wunder grenzende Bekehrung Russlands voraus. Wie kein anderes mystisches Ereignis prägte Fatima seitdem aber auch die Geheimpolitik der Päpste, bis hin zu Johannes Paul II., der überzeugt war, mit einer von der Gottesmutter erbetenen Weihe den Kommunismus besiegt und die Spaltung Europas überwunden zu haben.
Papst Franziskus, der am Fatima-Tag gewählt wurde, weihte der Gottesmutter sein Pontifikat - und betonte damit die Aktualität der marianischen Botschaft auch und gerade in den Krisen unserer Zeit. Noch ist es möglich, die prophezeite Katastrophe zu verhindern. Den Schlüssel dazu aber liefert, so glaubt er, das letzte Geheimnis von Fatima.
Das erfolgreichste Fatima-Buch in deutscher Sprache jetzt mit einer aktuellen Neuinterpretation des »Dritten Geheimnisses« zum 100. Jahrestag der Erscheinungen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
1. Auflage Oktober 2016 2. Auflage September 2021 Copyright © 2021, 2016 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Jürgen Welte Umschlaggestaltung: Angewandte Grafik/Peter Hofstätter, München Satz und Layout: Agentur Pegasus, Zella-Mehlis ISBN E-Book 978-3-86445-383-0 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Hl. Johannes Paul II. (1978–2005), dem Fatima-Papst, in memoriam gewidmet
Vorwort
Von Joachim Kardinal Meisner,
Erzbischof emeritus von Köln
Seine Eminenz Joachim Kardinal Meisner hielt diese Predigt auf seiner ersten Wallfahrt nach Fatima am 13. Mai 1990. Sie spiegelt wie kein anderer Text wider, welche Bedeutung er, nachdem er als ehemaliger Bischof von Berlin und Erzbischof von Köln zum Zeugen der Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands und Europas wurde, dem Wirken Gottes und Mariens in diesem Prozess beimisst. Am 22. Juni 2001 übersandte er mir den Text als Vorwort zur ersten Auflage dieses Buches (das damals noch im Humboldt-Verlag erscheinen sollte), wofür ich ihm zu tiefem Dank verpflichtet bin.
Predigt zur Wallfahrt in Fatima am 13. Mai 1990
1. Gott hat den Menschen am Schöpfungsmorgen erschaffen, ohne ihn zu fragen. Am Erlösungsmorgen ist er in Jesus Christus Mensch geworden, aber diesmal nicht, ohne den Menschen eigens zu fragen. Er schickte den Engel zu Maria, damit sie ihre Einwilligung gebe, dass sein Sohn aus ihr Mensch werden könne.
Maria ermöglicht mit ihrem »fiat«, mit ihrem Ja-Wort, Gottes Mensch-werdung. Er kam in sein Eigentum, und die Seinige – Maria – nahm ihn wirklich auf. Maria ist die Platzhalterin Gottes in der Welt geworden und geblieben.
Nun gibt aber auch Christus Maria in seiner Kirche Raum, indem er vom Kreuz herab zu Maria im Hinblick auf Johannes sagt: »Frau, siehe deinen Sohn!« Und von Johannes heißt es dann in der Heiligen Schrift: »Er nahm Maria in das Seinige auf.« Wie Maria Christus in das Ihrige aufgenommen und ihm Raum gegeben hat, so hat die Kirche Maria in das Ihrige aufgenommen und ihr Raum gegeben. Maria bringt immer Christus mit in die Kirche und damit in die Welt.
2. In unserem alten Europa, das einmal die Heimat des Christentums war, kommt Jesus Christus in der Öffentlichkeit kaum noch vor. Maria – und damit die Kirche – ist an den Rand der europäischen Gesellschaften gedrängt. Portugal aber nahm vor 73 Jahren Maria – wie Johannes unter dem Kreuz – in das Seinige auf. In Fatima hat diese berühmte Nation Maria Raum und Heimat gegeben. Von Fatima aus konnte Maria ihren Weg beginnen, um Christus wieder nach Europa zu tragen. In Russland und den übrigen osteuropäischen Staaten war der Christus-Glaube fast verboten. Die Völker Osteuropas, die Maria hoch verehren, konnten ihr wenig Raum geben, da der Atheismus alle Lebensräume besetzt hatte. Deshalb kam Maria von Fatima aus den bedrängten Jüngern ihres Sohnes in den kommunistischen Staaten Osteuropas zu Hilfe. Fatima ist gleichsam der Brückenkopf Mariens, von dem aus Maria die osteuropäischen Völker unterwandert hat, um ihnen Christus zu bringen, der die Menschen wirklich frei macht. Das darf Europa Portugal nie vergessen, dass dieses Land Maria die Tore geöffnet hat, sodass sie von hier aus die gottlosen Staaten im Osten unseres Kontinents bekehren konnte.
3. Zum ersten Mal bin ich heute in Fatima. Als Erzbischof von Köln, der vorher Bischof von Berlin war und selbst 40 Jahre in einem sozialistischen Land lebte, bewegt mich dieser Tag in Fatima zutiefst. Bis 1989 war der staatlich verordnete Atheismus in der Deutschen Demokratischen Republik der dunkle Schatten, unter dem wir leben mussten. Wir wussten uns dabei mit den Christen in den anderen atheistischen Ländern Osteuropas aufs Engste verbunden und verwandt.
Ich möchte heute, gleichsam im Namen aller katholischen Christen in dieser Region Europas, Maria danken, dass sie von Fatima aus den einstigen christlichen Osten unter ihren besonderen Schutz genommen hat. Und ich bin gekommen, um den Portugiesen zu danken, dass sie Maria für dieses Bekehrungswerk in Fatima Aufnahme gewährt haben.
Die Journalisten registrieren meistens nur das äußere Tun der Politiker und der Menschen, die auf die Straßen und Plätze der osteuropäischen Hauptstädte gegangen sind, um gegen die gottlosen und damit unmenschlichen Systeme zu protestieren. Sie nehmen aber kaum wahr, aus welchen verborgenen Quellen sich dieser Protest und dieser Widerstand gespeist haben – und zwar trotz aller marxistischen Vertröstungen, Versprechungen und Bedrohungen. Von außen nimmt man nicht wahr, wo die verborgenen Kraftreserven lagen, aus denen die Menschen über 40 Jahre – ja in Russland über 70 Jahre – in dieser gottlosen und unmenschlichen Wüste gelebt haben.
Maria war in diesen Jahren die unauffälligste, aber überall gegenwärtige Leidensgefährtin und Helferin der Bedrängten. Wie bei der Hochzeit zu Kana war und ist sie bei den Menschen die Mutter mit den guten Augen, die den Mangel entdeckte und die den Sohn darauf aufmerksam machte und den Menschen heute wie damals den guten Rat gab: »Was er euch sagt, das tut!«
So sind die Menschen nicht Karl Marx gefolgt, sondern Jesus Christus. Sie haben nicht dem Kommunistischen Manifest geglaubt, sondern eher ihrem Magnifikat. Nicht Marx hat den Menschen Größe und Würde gebracht, wohl aber Maria. Sie bezeugt es in ihrem Magnifikat, indem sie sagt: »Großes hat an mir getan der Mächtige.«
Dass die äußerlich errungene Freiheit auch die Menschen innerlich freimachen möge, ist heute unsere Bitte an Maria. Denn wenn der Mensch vom Ausbeuter frei geworden ist, dann ist er noch lange nicht von sich selbst frei. Erst, indem der Mensch von sich selbst frei wird, findet er Christus und seine Berufung in Kirche und Welt. Den Herrn zu suchen und zu finden ist die gemeinsame Aufgabe in West- und Osteuropa. Maria suchte damals Christus bei der Wallfahrt nach Jerusalem und fand ihn im Tempel. Maria möge die Europäer auf der Suche nach Christus heute begleiten, und dabei werden sie mit ihr in die Kirche ihres Sohnes gelangen.
Deshalb beten wir zu Maria:
»Und zeige uns nach diesem Elende Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.« Amen.
Joachim Kardinal Meisner
Einführung
Die Offenbarung
»Die Botschaft von Fatima ist das stärkste Eingreifen Gottes durch Maria in der Geschichte der Kirche und Menschheit seit dem Tod der Apostel.«
Papst Pius XII.
Eine dichte Wolkendecke hing am 30. Dezember 2012 über dem Norden Portugals. Es war ein ungewöhnlich kühler Tag mit vereinzelten Regenschauern, und so waren nicht viele Pilger nach Fatima gekommen. Das war eher ungewöhnlich, handelte es sich doch um einen Sonntag, den letzten im Kalenderjahr und damit das Fest der Heiligen Familie. Aber auch in Portugal siegt oft die Bequemlichkeit über den guten Willen, ist Weihnachten längst zu einem Hochfest des Konsums, der Geschenke und der farbenfrohen Lichtermeere verkommen. Zudem steckten auch die Portugiesen bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für die Silvesternacht, in der sie, als wollten sie der wirtschaftlichen Krise trotzen, mit Böllern und Leuchtraketen, vor allem aber mit einem gepflegten Vielgängemenü das neue Jahr begrüßen würden.
So waren die wenigen Gläubigen unter sich, die allen Widrigkeiten zum Trotz an diesem Abend in das Heiligtum in der Cova da Iria gekommen waren. Eine überschaubare Menge, die sich auf der riesigen Esplanade zwischen der alten Wallfahrtsbasilika mit ihren weit ausholenden Kolonnaden, dem Petersplatz in Rom nachempfunden, und der neuen »Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit« fast verlor. Am 12. Oktober 2007, einen Tag vor dem 90. Jahrestag des Sonnenwunders von Fatima, eingeweiht, ist sie mit einem umbauten Volumen von 130000 Kubikmetern und 9000 Sitzplätzen die viertgrößte katholische Kirche der Welt1› Hinweis und die größte, die im 3. Jahrtausend errichtet wurde. Ihr Grundstein, am Dreifaltigkeitssonntag des Jahres 2004 gelegt, wurde zuvor dem historischen Petrus-Grab unter dem Petersdom in Rom entnommen und war das letzte Geschenk Johannes Pauls II. an das Heiligtum von Fatima. Ausgerechnet am 9. März 2004, also gut 13 Monate vor seinem Tod und auf den Tag genau 13 Monate vor dem Beginn seiner Trauernovene, hatte er ihn dem Rektor des Schreins von Fatima übergeben. Man findet ihn heute direkt vor dem Hauptaltar der Basilika. Ihr Bauplan ist ein Werk des griechischen Architekten Alexandros Tombazis, was wiederum die ökumenische Bedeutung von Fatima unterstreicht. Die kreisrunde Form des Monumentalbaus sollte das Neue Jerusalem, seine 13 Eingänge Jesus und die zwölf Apostel, aber auch die »Fatima-Zahl« 13 symbolisieren. Dabei wirkt er von außen eher wie eine moderne Kongresshalle. Sein Inneres vereinigt neobyzantinische Goldmosaiken mit postsowjetischer Betonästhetik; nur ein riesiges eisernes Kruzifix, eine marmorne Marienstatue und – zur Weihnachtszeit – eine monumental dimensionierte und minimalistisch ausgestaltete Krippe erinnern daran, dass man sich in der – jetzt – Hauptkirche eines der heiligsten Orte der westlichen Christenheit befindet. Doch anfängliche Befürchtungen, hier könne ein neuheidnischer Freimaurertempel als interreligiöses Heiligtum entstehen, erwiesen sich trotzdem als Unfug; man mag die lichtdurchflutete Kälte der Betonrotunde schätzen oder nicht, doch sie dient allein als Beichtkirche und zur Feier der heiligen Eucharistie. Sechs Heilige Messen werden hier täglich gelesen, sieben an Sonn- und Feiertagen, so auch an diesem 30. Dezember 2012, dem Fest der Heiligen Familie.
Ich war an diesem Sonntag nach Fatima gefahren, weil mich meine Intuition dorthin geführt hatte, weil ich einfach nicht anders konnte. Zwölf Jahre waren seit meinem letzten Besuch der Erscheinungsstätte vergangen, und so wollte ich mir endlich ein eigenes Bild von den Neuerungen im Heiligtum machen. Gemeinsam mit einer guten Freundin, die zeitweise meine Verlobte war, würde ich den Jahreswechsel in Lissabon feiern, nicht ohne zuvor den Segen der Gottesmutter für das neue Jahr zu erbitten, das immerhin, schon durch die Zahl 13, auf Fatima verwies. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich freilich noch nicht, welche Änderungen es für die Kirche und die Welt mit sich bringen würde, dass in ihm vielleicht das letzte Geheimnis enthüllt, die ersten Zeilen des letzten Kapitels der Geschichte von Fatima geschrieben würden. Und so schweiften meine Gedanken eher zurück in die Vergangenheit als in die Zukunft. In jenes bedeutungsschwere »Heilige Jahr« 2000, als ich das letzte Mal nach Fatima gekommen war, um dabei zu sein, als der größte Papst des 20. Jahrhunderts an das Schlüsselereignis seines Pontifikats erinnerte. Damals war ich fast unerwartet zum Zeugen einer Enthüllung von welthistorischer Dimension geworden.
Fatima, Portugal, 12. Mai 2000. Die Straßen rund um den portugiesischen Wallfahrtsort waren verstopft wie nie zuvor. Nichts ging mehr. Über 600000 Menschen waren unterwegs, um einem denkwürdigen Ereignis beizuwohnen. Der Papst kam zum dritten Mal nach Fatima. Der offizielle Anlass war die Seligsprechung der beiden 1919 und 1920 verstorbenen Seherkinder Francisco und Jacinta de Marto. Ihnen und ihrer im Jahre 2000 93-jährigen Cousine Lucia war zwischen dem 13. Mai 1917 und dem 13. Oktober 1917 sechsmal die Gottesmutter erschienen, ihnen hatte sie am 13. Juli eine dreiteilige Botschaft verkündet, deren letzter Teil, das sogenannte »Dritte Geheimnis«, beim Vatikan noch immer unter Verschluss lag. Als über 70000 Zeugen am Tag der letzten Erscheinung einen »Tanz der Sonne« am Himmel erlebten, war selbst für Skeptiker klar, dass sich in Fatima etwas Übernatürliches ereignet hatte. 13 Jahre später wurden die Erscheinungen offiziell von der Kirche anerkannt. Das Leben der Seherkinder war in ihren letzten Jahren von Buße und Gebet geprägt. Doch ausschlaggebend für die Seligsprechung war ein Wunder, das von der vatikanischen »Kongregation für die Causa der Heiligen« dokumentiert wurde. Die 69-jährige Portugiesin Maria Emilia Santos, die 22 Jahre lang bettlägerig und gelähmt war, konnte wieder gehen, nachdem sie die beiden im Alter von neun beziehungsweise zehn Jahren verstorbenen Kinder um ihre Fürsprache angerufen hatte. Der Fall wurde durch eine medizinische Kommission unter Leitung von Prof. Raffaello Cortesini untersucht. Die Ärzte hatten dafür keine Erklärung, für die Kirche war die Heilung übernatürlich, ein Zeichen des Himmels. Damit war der Weg zur Seligsprechung frei. Im Dezember 1998 wurde die Akte dem Papst vorgelegt, der sofort (am 19. Dezember) sein »nihil obstat«, seine Zustimmung, erteilte. Am 16. April 1999 gab Pater Paolo Molinari SJ, der Postulator der Kongregation, die bevorstehende Seligsprechung offiziell bekannt, ohne einen Zeitpunkt oder Ort für die feierliche Zeremonie zu nennen. In den meisten Fällen finden Seligsprechungen in Rom auf dem Petersplatz statt, allemal im dichten Terminkalender des »Heiligen Jahres« 2000. So hieß es dann auch noch im Oktober 1999, sie sei für den 9. April in Rom geplant. Dass Johannes Paul II. stattdessen dann doch eigens nach Portugal reiste, musste ganz besondere Gründe haben. Darin zeigte sich die große Bedeutung, die der Papst den Ereignissen von Fatima zubilligte, seit er das Attentat durch den Türken Ali Agca am 13. Mai 1981, dem Jahrestag der ersten Erscheinung, überlebte. Das war für den Wojtyla-Papst kein Zufall. »Eine Hand hat den Schuss abgefeuert, und eine andere Hand hat das Geschoss gelenkt«, erklärte er später. Nach seiner Überzeugung war diese »andere Hand« die der Gottesmutter selbst. Sie wollte ihm ein Zeichen geben, ihm, der schon bei seiner überraschenden Wahl im Oktober 1978 den Wahlspruch »Totus Tuus«, »Ganz dein«, annahm und das »M« Mariens unter dem Kreuz auf sein Wappen schreiben ließ. Er war davon überzeugt, dass sie ihm sagen wollte, dass es an ihm sei, ihre Forderungen und Wünsche aus der Botschaft von Fatima zu erfüllen, damit auch ihr Versprechen an die Menschheit wahr würde. Das machte ihn zum »Fatima-Papst«, zum Protagonisten der Prophezeiungen Mariens.
Und so erfüllte sich eine andere Voraussage. »Du wirst die Kirche in das 3. Jahrtausend führen«, hatte ihm sein langjähriger Freund, der Primas von Polen, Kardinal Wyszynski, nach dem Konklave im Oktober 1978 erklärt. Das »Heilige Jahr« 2000, das große Jubiläum, war in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts das große Ziel des Papstes. Er wollte Zeichen setzen, aber auch Ballast abwerfen, für die Fehler der Vergangenheit um Vergebung bitten und einen neuen Anfang wagen. Dazu bedurfte es des Segens der Gottesmutter, der »Mutter der Kirche«. So kristallisierte sich immer mehr heraus, dass Fatima im »Heiligen Jahr« eine zentrale Rolle spielen würde. Als die portugiesischen Bischöfe im November 1999 zu einem »ad limina«-Besuch nach Rom kamen, verabschiedete sich der Papst von ihnen mit den Worten »Arrividerci a Fatima«, »Auf Wiedersehen in Fatima!«. Das jedenfalls hatte Serafim da Silva, Bischof von Leiria und Fatima, der Presse am 26. November 1999 mitgeteilt. Doch offiziell hüllte sich der Vatikan damals noch in Schweigen. Zu besorgniserregend erschien der Gesundheitszustand des 79-jährigen Pontifex, zu dicht gedrängt der Terminkalender im »Heiligen Jahr«. Erst nach der historischen Pilgerreise in das Heilige Land im März 2000 wurde es offiziell bekannt gegeben: Der Papst reist wieder nach Fatima! Es war sein Herzenswunsch, dort, vor Ort, die Gottesmutter um ihren Schutz für die Christenheit im 3. Jahrtausend anzurufen. Und schließlich wollte er, nur fünf Tage vor seinem 80. Geburtstag, der Madonna danken, dass sie ihm 19 Jahre geschenkt hatte. Würde er dort auch das lang gehütete »Dritte Geheimnis« enthüllen? »Der Papst wird der Welt in Fatima etwas Wichtiges verkünden«, deutete der Bischof von Leiria und Fatima kurz darauf an, gefolgt vom Dementi des Patriarchen von Lissabon: Das Geheimnis sei damit natürlich nicht gemeint. Oder vielleicht doch? Die Gerüchteküche brodelte, doch nichts war sicher. »Der Papst ist immer für eine Überraschung gut«, orakelte Kardinal Joseph Ratzinger nur wenige Tage zuvor. Er hatte die Veröffentlichung der Marienoffenbarung bislang abgelehnt, weil er Sensationsmacherei befürchtete.
So lagen die Erwartungen in der Luft, als der Papst am Abend des 12. Mai 2000 in dem Erscheinungsort eintraf. Sichtlich erschöpft von dem Flug, stieg er aus dem Militärhubschrauber, der ihn von Lissabon nach Fatima gebracht hatte. Am Flughafen von Lissabon war er zuvor mit dem portugiesischen Staatspräsidenten Jorge Sampaio zusammengetroffen. Etwa 100 Kinder, einige davon aus dem Krankenhaus, in dem Jacinta 80 Jahre zuvor gestorben war, hatten ihn mit »Viva«-Rufen empfangen und Fähnchen im Weißgelb des Vatikans geschwenkt. Müde winkend passierte er jetzt in dem gepanzerten »Papamobil« die Massen, die sich auf dem großen Platz des Heiligtums von Fatima versammelt hatten. Dabei passierte er auch ein Fragment der Berliner Mauer, das auf dem weiträumigen Gelände vor der Basilika aufgestellt wurde, als sichtbares Zeichen der Überzeugung, dass von hier der Impuls ausging, der schließlich zur Wiedervereinigung Deutschlands und Europas führte. Der Platz, der dreimal so groß ist wie der Petersplatz in Rom, war bis zum Bersten gefüllt. Eine halbe Million Menschen, jubelnd, Fähnchen oder weiße Taschentücher schwenkend, beobachtete, wie er langsam aus dem Fahrzeug stieg, die wenigen Treppen hinauf, die zu der Kapelle führen, die am Ort der Erscheinungen auf Anweisung der Madonna errichtet worden war und vor der das Gnadenbild, die Statue Mariens, steht. Dann, von einem Augenblick auf den anderen, ergriffenes Schweigen. Der Papst kniete nieder, minutenlang versunken in tiefes Gebet, um schließlich der Gottesmutter ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen: den Ring, den ihm Kardinal Wyszynski bei seiner Wahl zum Papst geschenkt hatte. »Es ist das wertvollste persönliche Eigentum, das der Papst besitzt«, erklärte später der Vatikansprecher Dr. Joaquin Navarro-Valls: Symbol für das erfüllte Versprechen, die Kirche in das 3. Jahrtausend zu führen, der Weihe seines Pontifikats an die Madonna und auch eine Geste des Abschieds; es sollte sein letzter Besuch in Portugal sein. Dieses Geschenk zeugte mehr als alles andere davon, wie sehr das Pontifikat von Johannes Paul II. im Zeichen der Erscheinungen von Fatima stand. Dann, nach einer kurzen Segnung der Menge, verließ er die Erscheinungsstätte wieder. Die nachfolgende feierliche Messe mit einer anschließenden Lichterprozession fand ohne ihn statt. Der Papst musste Kraft schöpfen, denn einer der Höhepunkte des »Heiligen Jahres«, die Krönung seines Pontifikats, lag vor ihm …
Auch ich stand damals dort in der Menge, war nach Fatima gekommen, um teilzunehmen an einem Ereignis, das, so spürte ich, historisch sein würde.
Denn in der Geschichte der Kirche nimmt Fatima spätestens durch Johannes Paul II. eine Sonderrolle ein. Gewiss, Marienerscheinungen gab es zu allen Zeiten, andere Erscheinungsorte wie Lourdes in Frankreich und Guadalupe in Mexiko ziehen zahlenmäßig sogar noch mehr Pilger an als das Dorf in den Bergen von Portugal (in das immerhin jedes Jahr rund fünf Millionen Gläubige kommen). Doch keine andere Erscheinung hat so tiefe Nachwirkungen gehabt, keiner himmlischen Manifestation der Neuzeit fühlten sich die Päpste seit Pius XII. so eng verbunden, keine andere Marienbotschaft hat sich so stark in die Geschichte eines Jahrhunderts eingeprägt und diese beeinflusst. »Fatima war der beste Ort, den der Papst wählen konnte, ein symbolischer Ort in dem Augenblick, in dem ein Jahrtausend, speziell ein Jahrhundert so voller Leiden, endet«, erklärte Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano, der »Außenminister« des Vatikans. Durch Fatima war das große Wunder des 20. Jahrhunderts, die friedliche Öffnung des Eisernen Vorhangs, das Ende des Kalten Krieges, der Fall des atheistischen Kommunismus, erst möglich geworden. Davon jedenfalls war Papst Johannes Paul II. fest überzeugt.
Schon deshalb, weil sie der Schlüssel zum Verständnis seines Handelns sind, lohnt es sich, die Ereignisse von Fatima genauer unter die Lupe zu nehmen. So habe ich mich seit vielen Jahren intensiv mit den Geschehnissen von Fatima befasst. Was ereignete sich tatsächlich im Jahre 1917 in der Serra de Aire, dem Bergland Portugals? Ist es wirklich möglich, dass eine höhere, spirituelle Macht, ja Gott selbst durch Maria, intervenierte, in diesem Schicksalsjahr der Menschheit in die Geschichte eingriff? Welche Erklärungen existieren für den Umstand, mit welcher Präzision simple, des Lesens und Schreibens unkundige Hirtenkinder geschichtliche Ereignisse voraussahen, die sich, als würden sie einem göttlichen Drehbuch folgen, in den kommenden acht Jahrzehnten entfalteten? Diesen Fragen versuche ich in diesem Buch auf den Grund zu gehen.
Das Faszinierende an den Ereignissen von Fatima ist nicht nur, dass sie nach Meinung vieler Christen einen höheren Plan zu offenbaren scheinen, sondern auch, dass dies im Kontext einer fast 2000-jährigen Prophezeiung geschieht. Wir finden diese heute als »Offenbarung des Johannes« in jeder Bibel. Der Tradition nach ist ihr Autor der Lieblingsjünger Jesu, jener Johannes, der unter dem Kreuz stand und dem der sterbende Messias seine Mutter anvertraute (Joh. 19, 26–27). »Von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich«, fährt der Verfasser des vierten Evangeliums fort. Er berichtete ihr persönlich, als Petrus und er das Grab Christi leer vorfanden. Als zwölf Jahre später König Herodes Agrippa die Christen in Jerusalem verfolgte, floh er, zusammen mit ihr, nach Ephesus in Kleinasien. Im Jahre 49 kamen beide zu dem großen Apostelkonzil noch einmal nach Jerusalem, als Maria, von den Strapazen der langen Reise erschöpft, im Kreise der Jünger verschied. Sie wurde in einer Grabhöhle am Hange des Ölbergs, unweit des Gartens Gethsemane, beigesetzt. Als drei Tage später die Jünger das Grab besuchten, war es leer, ganz wie einst das des Herrn. Noch am selben Tag, so die Legende, erschien ihnen die Gottesmutter in strahlendem Lichtglanz und versprach: »Ich werde immer bei euch bleiben.« Erschüttert und gleichermaßen beglückt kehrte Johannes allein nach Kleinasien zurück, um schließlich, während der Verfolgung der Christen durch Kaiser Domitian (81–96 n. Chr.), auf die Insel Patmos verbannt zu werden. Dort lebte er, hochbetagt, als Einsiedler, dort hatte er seine große Vision von der Endzeit:
»Ein großes Zeichen erschien am Himmel:
Eine Frau, mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen.
Sie war gesegneten Leibes und schrie in Wehen und Schmerzen des Gebärens.
Und ein anderes Zeichen erschien am Himmel: Siehe, ein großer, roter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde.
Der Drache stellte sich vor die Frau, die daran war, zu gebären, damit er ihr Kind verschlinge, wenn sie gebären würde. Und sie gebar ein Kind, einen Knaben, der alle Völker lenken wird mit ehernem Zepter. Doch es wurde ihr Kind entrückt zu Gott und zu seinem Thron.
Die Frau aber floh in die Wüste, wo sie einen Platz erhielt, der von Gott da bereitet war, damit man ihr dort Unterhalt gebe zwölfhundertsechzig Tage.
Da entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und auch der Drache und seine Engel kämpften. Doch sie richteten nichts aus, und es blieb kein Platz mehr für sie im Himmel. Gestürzt wurde der große Drache, die alte Schlange, die den Namen Teufel und Satan trägt, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde hinabgestürzt auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm gestürzt.« (Offb. 12, 1–9)
Kurz darauf reiste Miriam zu ihrer Tante Elisabeth, die, verheiratet mit dem Priester Zacharias, in Ein Karem bei Jerusalem, im Bergland von Juda, lebte. Auch Elisabeth war, obwohl schon in hohem Alter, schwanger, auch ihrem Mann war die Geburt eines Sohnes von einem Engel angekündigt worden; er sollte später als Johannes der Täufer zum Vorboten Jesu werden. Als Miriam ihre Tante begrüßte, hüpfte das Kind in ihrem Leib vor Freude, und es entfuhr ihr: »Gebenedeit bist du unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes!« (Luk. 1, 42) Die schwangere Jungfrau antwortete mit dem Magnifikat, das später zu einem der schönsten Gebete der Kirche wurde: »Hoch preiset meine Seele den Herrn, und mein Geist frohlockt über Gott, meinen Heiland; er schaut gnädig herab auf die Niedrigkeit seiner Magd; denn siehe, von nun an werden mich selig preisen die Geschlechter …« (Luk. 1, 46–48)
Die Theologie der christlichen Kirche machte sie später zur »Neuen Eva«, zur »Mutter des Neuen Bundes«. Auf dem Konzil von Ephesus im Jahre 431 wurde ihr offiziell der Titel »Theotokos«, »Gottesgebärerin« (woraus später »Gottesmutter« wurde), verliehen, das erste marianische Dogma entstand. Miriam, deren Name zu »Maria« latinisiert wurde, galt als Modell für den bedingungslosen Glauben und die selbstlose Aufopferung. Der Kirchenvater Augustinus war überzeugt, dass Gott die Mutter seines Sohnes rein von aller Sünde gehalten hatte, und verglich ihren Körper mit der Bundeslade des Alten Testamentes, dem Gnadenthron Gottes auf Erden. Auf dem 3. Konzil von Konstantinopel im Jahre 681 wurde sie zur »immerwährenden Jungfrau« erklärt. Der Glaube an ihre »Unbefleckte Empfängnis« (Immaculata Conceptio) fand erst in der Ostkirche, dann auch im Westen seine Anhänger. Doch erst durch Papst Pius IX. wurde die Lehre, dass Maria »vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an wegen ihrer Erwählung zur Mutter des Gottessohnes vor der Erbsünde bewahrt geblieben ist«, 1854 zum Dogma. Auch die »Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel« wurde als »Mariä Himmelfahrt« (am 15. August) seit dem 7. Jahrhundert gefeiert, aber erst 1950 von Papst Pius XII. als Dogma definiert.
Marienerscheinungen gab es die gesamte Geschichte der Christenheit hindurch. Im August 363, so die Legende, erschien die Gottesmutter dem römischen Kaufmann Johannes und seiner Frau und bat um den Bau einer Kirche dort, wo man am nächsten Morgen Schnee finden würde – in der Hitze des italienischen Sommers wahrlich ein Wunder. Der Schnee wurde gefunden, die Kirche, heute »Santa Maria Maggiore«, zu einem der bedeutendsten Heiligtümern der Ewigen Stadt. Im Jahre 1026 erschien Maria dem heiligen Fulbert, dem späteren Erbauer der berühmten Kathedrale von Chartres/Frankreich. 1465 lehrte eine Marienerscheinung Alanus de Rupe in Paris den Rosenkranz, 1531 führten die Erscheinungen auf dem Tepeyac-Hügel in Mexiko zu Massenbekehrungen der Indios. Doch das eigentliche Zeitalter der Madonna begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieser Zeitpunkt ist äußerst relevant und scheint in unmittelbarer Beziehung zu der Offenbarung des Johannes zu stehen. Denn seit der Französischen Revolution von 1789, durch die die Lehren des Rationalismus und Materialismus, der »Vernunft«, in alle Welt verbreitet wurden, war die Kirche in ihre ärgste Bedrängnis seit der Zeit der römischen Christenverfolgungen geraten. 1799 verschleppte Kaiser Napoleon I., der glorreichste Sohn des revolutionären Frankreich, Papst Pius VI. nach Valence, wo er im Exil verstarb. Auch sein Nachfolger Pius VII. wurde 1812 festgenommen und nach Fontainebleau in Frankreich gebracht, konnte aber zwei Jahre später wieder in die Ewige Stadt zurückkehren. Doch die Welt, die er nach dem Wiener Kongress vorfand, war nicht mehr dieselbe. Die Staaten des neuen Europas waren allesamt säkularisiert, die Kirche an allen Fronten auf dem Rückzug. Alles befand sich im Umbruch. Die Industrialisierung veränderte tief greifend die sozialen Strukturen, der Materialismus ließ die Wissenschaft als einzig legitime Methode der Wahrheitsfindung an die Stelle der Religion treten. Für die Kirche wurde der neue Geist zum Feindbild, zur letzten Versuchung Luzifers, des »Herren der Welt«. Doch bald, so schien es, trat ihm die »Frau, mit der Sonne bekleidet« entgegen. Eine Reihe von Erscheinungen in ganz Europa begründete eine neue Form der alten marianischen Volksfrömmigkeit, die sich jetzt als Gegenrevolution verstand.
Ausgerechnet in Paris, jener Stadt, in der die Revolution der »Vernunft« ihren Ausgang genommen hatte, soll die Madonna im Jahre 1830 erschienen sein. Eine Novizin des Ordens der Vinzentinerinnen, Catherine Laboure, erklärte, sie hätte ihr den Auftrag erteilt, eine Medaille zu prägen. Ihr Motiv war Programm für die folgenden zwei Jahrhunderte. Sie zeigte die Heilige Jungfrau in ihrer ganzen Pracht, wie sie auf einer weißen Kugel stand, der Erde, um die sich eine grüne Schlange gewunden hatte. Aus ihren Händen strömte Licht, während um das Bild herum die Schrift erschien: »O Maria, ohne Sünde empfangen, bete für uns, die wir in dir Zuflucht nehmen.« 16 Jahre später, im Jahre 1846, wollen die beiden Hirtenkinder Melanie und Maximin aus dem französischen Alpendorf La Salette von der Madonna eine apokalyptische Botschaft empfangen haben. 1858 kam es zu einer Reihe von Erscheinungen in dem Pyrenäendorf Lourdes. Als Beweis für die Zweifler, so hieß es, ließ die »weiße Dame« eine Quelle entspringen. Seitdem strömen die Kranken der Welt an die heilige Stätte, kam es zu über 5000 spektakulären Heilungen.
Doch all das war nur der Auftakt, ganz wie das 19. Jahrhundert nur die Weichen stellte für die Zeit der Wirren, die das 20. Jahrhundert zum blutigsten der Geschichte werden ließen. Mit der Zeit nahm die Zahl der Marienerscheinungen zu. Waren es im 18. Jahrhundert nur 31, so wurden es 105 im 19. Jahrhundert und sogar an die 500 im 20. Jahrhundert. Beides, die Schrecken der Kriege und Revolutionen und die himmlischen Botschaften, kulminierten in einem Jahr, das zum Schicksalsjahr der Menschheit in diesem letzten Jahrhundert des 2. Jahrtausends werden sollte, dem Jahre 1917. Die Schauplätze des Geschehens hätten verschiedener kaum sein können. Hier die Metropole des Ostens, die Zarenstadt Sankt Petersburg, in der die Zeichen auf Sturm standen, eine gottlose Diktatur des Schreckens nach der Macht griff. Dort ein friedliches Dorf in den Bergen Portugals, das zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand kannte, eine kleine, heile Welt fernab aller Zeit. Hier lebten drei Kinder, Hirten wie so viele in ihrem Dorf, die langsam darauf vorbereitet wurden, zu Sprachrohren einer Offenbarung zu werden. Durch ihr selbstloses Opfer, durch ihren bedingungslosen Dienst, konnte vielleicht die Prophezeiung des Johannes erfüllt werden, die Frau den Drachen besiegen.
Kapitel 1
Der Engel von Portugal
Lucia war ein Kind wie jedes andere in dieser dörflichen Einöde im Bergland von Portugal, ein derbes Bauernmädchen, das gerne tanzte, spielte, Unfug trieb. Sie war eitel, liebte es, sich aufzuputzen mit vergoldeten Ketten aus der Schmuckschatulle ihrer Mutter, großen Ohrringen und bunten Schals. Sie prahlte damit, dass sie auf Volksfesten die farbenprächtigste Erscheinung war, immer im Mittelpunkt, immer im Zentrum des Klatsches, zu dem sie, von Natur aus mit einem nicht zu stoppenden Mundwerk ausgestattet, den ihren und nicht unbeträchtlichen Teil dazutat. Dabei war sie kein hübsches Mädchen, im Gegenteil. Ihr Körperbau war robust und stämmig und ging schon früh in die Breite, ihre Züge waren derb, die Nase flach, die Lippen wulstig und der Mund zu groß, alles inmitten von schweren, dicken schwarzen Haaren, die, in der Mitte gescheitelt, ihre dichten Augenbrauen und großen, tiefschwarzen Augen umrahmten.
Lucia wurde am 22. März 1907 geboren, als letztes der sieben Kinder von Antonio und Maria Rosa dos Santos aus Aljustrel, einem Weiler aus vielleicht 18 Häusern, der wie eine grüne Oase inmitten des kargen Felslandes der Serra de Aire liegt.
Ihre Eltern, einfache Bauern, waren ehrbare und tiefgläubige Leute. Sie lehrten ihre Tochter, den Rosenkranz und das Tischgebet zu beten, und als der Ortspfarrer in einer Predigt das Tanzen zum »teuflischen Vergnügen« erklärte, durfte Lucia von heute auf morgen keine Tanzveranstaltungen und Feste mehr besuchen.
Ihr Cousin Francisco, das sechste Kind von Manuel Pedro Ti Marto und seiner Frau Olimpia, war ein kräftiger Junge mit einem runden, plumpen Bauerngesicht, gelblicher Haut und schmalen Lippen. Er war ein eher ruhiges, gutmütiges, ja duldsames Kind mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und stets einem Lächeln auf den Lippen. War er alleine, entwickelte er ein überraschendes Temperament und spielte gerne Streiche, doch in Gegenwart seiner abgöttisch geliebten Cousine Lucia erschien er still und willensschwach. »Er ist ein Träumer wie sein Vater«, pflegte man im Dorf zu sagen. Auch Francisco, der am 11. Juni 1908 geboren wurde, genoss eine intensive religiöse Erziehung, die er sehr ernst nahm und die er sich tief verinnerlichte. Stundenlang konnte er in den Nachthimmel starren und die Schönheit des Mondes und der Sterne bestaunen, die für ihn »die Lampe unserer lieben Frau« und »die Engel« waren. Und wenn es Tag wurde und sich die Sonne in Abertausenden Tautropfen widerspiegelte, pflegte er entzückt zu sagen: »Kein Lämpchen ist so schön wie die Lampe unseres Herrn«, wie er unser Zentralgestirn nannte.
Seine Schwester Jacinta wurde exakt 21 Monate später, am 11. März 1910, geboren. Die Leute im Dorf nannten sie »den kleinen Engel«, für ihren Vater war sie »von Natur aus gut und das süßeste unter unseren Kindern«. Sie hatte ein feines, kleines, rundes Gesicht, war schmal und zierlich und hoch sensibel. Sie war immer ordentlich frisiert, trug meist eine kleine Jacke und einen Baumwollrock. Sie liebte und pflückte oft Blumen, steckte sie in ihr Haar oder wand Girlanden für ihre Cousine Lucia. Als Naturkind bestaunte sie die Pflanzen und Berge und verbrachte Nächte damit, mit ihrem Bruder gemeinsam den Sternenhimmel zu studieren. Wenn die Schafe ihrer Eltern Lämmer bekamen, pflegte Jacinta sie stundenlang zu liebkosen und gab ihnen spezielle Namen wie »Taube«, »Stern«, »Schönheit«, »Schnee« – die schönsten Worte ihres Vokabulars. Wenn sie im Religionsunterricht oder durch die Erzählungen ihrer Eltern vom Leiden Christi hörte, musste sie vor Mitleid weinen. »Unser armer Heiland«, meinte sie, »ich werde nie mehr eine Sünde begehen, denn ich möchte nicht, dass unser Heiland leidet.« Trotzdem war sie keine kleine Frömmlerin. Sie liebte Spiele und das Tanzen, sie war selbstsüchtig und schnell beleidigt. Als sie alt genug war, schickten ihre Eltern sie und ihren Bruder Francisco oft genug zu ihrer Cousine Lucia, die die Schafe ihrer Eltern hütete. Lucia sollte auf die Kinder aufpassen, mit ihnen spielen und sie in ihre künftigen Aufgaben im Landleben einweisen. Als sie etwas reifer waren, übertrugen ihre Eltern den Kindern auch die Verantwortung für die eigene Herde, und gemeinsam ließen die drei die beiden Herden grasen, meist auf den Grundstücken der Familien bei Fatima und Moita.
Es ist oft darüber spekuliert worden, was diese drei Hirtenkinder auszeichnete, weshalb sie dazu auserwählt waren, Zeugen des Übernatürlichen, eines Wunders, zu werden. Die Antwort mag enttäuschen: Es war rein gar nichts Besonderes an ihnen. Sie waren ganz bestimmt nicht mehr und nicht weniger religiös als andere portugiesische Bauernkinder ihrer Zeit in ihrem Alter. Sie folgten zwar den Anweisungen ihrer Eltern, täglich den Rosenkranz zu beten, aber sie leierten ihn eher herunter, ließen die Perlen durch die Finger gleiten und beließen es bei den Worten »Ave Maria« und »Vater unser«, ohne zu Ende zu beten, sodass sie schneller wieder mit dem Spielen beginnen konnten. »Kinder in diesem Alter ermüden schnell beim Beten«, pflegte ihre Mutter diese Nachlässigkeit zu entschuldigen.
Der Tag von Francisco und Jacinta begann frühmorgens noch vor Sonnenaufgang, als sie von ihrer Mutter Olimpia geweckt wurden und das Morgengebet murmelten. Zum Frühstück gab es Gemüse oder Reissuppe mit etwas Olivenöl und hausgemachtem Brot. Ihre Mutter band dann die Schafe los, versorgte die Kinder mit Vesperpaketen – meist Brot, Oliven, Sardinen oder getrocknetem Fisch. Dann trieben sie die Herde aus dem Stall auf die Weide, wo sie sich mit Lucia oder anderen Hirtenkindern trafen, die ebenfalls die Herden ihrer Eltern weideten. Während die Schafe grasten, tanzten und spielten sie und waren fröhlich, unterbrochen nur durch das Mittagessen und den Rosenkranz, bis die Sonne hinter den Bergen versank. Anschließend trieb jeder seine Herde zusammen und machte sich auf den Heimweg, wo das Abendessen wartete. Nach einem letzten gemurmelten Rosenkranz legten sich die Kinder müde, aber glücklich schlafen auf Matratzen aus Maisstroh, in dem festen Glauben, dass ihr Schutzengel über sie wacht.
In dieser heilen Welt ahnten sie nicht, was um sie herum geschah, dass in Europa einer der längsten und blutigsten Kriege der Geschichte tobte und dass ihr eigenes Land, Portugal, politische Wirren und Chaos erlebte.
Als das 20. Jahrhundert seinen Anfang nahm, war die jahrhundertealte portugiesische Monarchie bereits durch ein Jahrhundert politischer Wirren und republikanischer Ambitionen geschwächt. Die katholischen Monarchisten zersplitterten sich in verschiedene Interessengruppen, während die Republikaner sich zu einer geballten Kraft formierten, unterstützt durch die Humanisten, Freidenker und Freimaurer, die nur darauf warteten, ein neues Portugal zu begründen und der Übermacht der Aristokratie und des mit ihr verbündeten Klerus ein Ende zu machen. 1907 errichtete Ministerpräsident Joao Fernando Pinto Franco zur Stützung der Krone eine Diktatur, was die Spannungen nur verstärkte und die Opposition in die Enge – und Radikalität – drängte. Es kam zur Katastrophe: Am 1. Februar 1908 ermordeten zwei Terroristen aus dem radikaldemokratischen Lager, Buica und Costa, König Karl I. und seinen Sohn und Thronfolger Ludwig Philipp auf dem Lissaboner Marktplatz durch Karabinerschüsse. Sein Nachfolger wurde der 18-jährige Emanuel, der sich um eine Verständigung mit den Republikanern bemühte und schließlich Joao Franco und seine Regierung entmachtete. Die Nachgiebigkeit des jungen Königs führte zum Ende der Monarchie. In der Nacht des 3. Oktober 1910 stürmten 20 Mitglieder der republikanischen »Carbonari« die Baracken des 16. Infanterieregimentes – ein Überraschungsangriff, in dessen Verlauf das gesamte Waffenlager der Elitetruppe in die Hände der Revolutionäre fiel. Nach einer blutigen Nacht wurde am 5. Oktober im Rathaus von Lissabon die Republik ausgerufen. Eine provisorische Regierung, bestehend aus kirchenfeindlichen Freimaurern, übernahm die Macht, während die königliche Familie nach Gibraltar floh. Das erste Ziel der Republikaner war die völlige Entmachtung des Klerus.
Schon nach drei Tagen, am 8. Oktober, setzte die Revolutionsregierung die »Gesetze von Pombal« aus dem 18. Jahrhundert, deren Ziel die Unterdrückung der religiösen Orden und die Ausweisung der Jesuiten gewesen war, wieder in Kraft. Am 18. Oktober wurde der religiöse Eid vor Gericht abgeschafft, am 25. Oktober der traditionelle Eid für Professoren und Studenten, der sie verpflichtete, das Dogma der Unbefleckten Empfängnis zu verteidigen. Drei Tage später wurden sämtliche kirchlichen Feiertage aufgehoben. Zu Weihnachten wurde die Ehe zu einem rein zivilen Vertrag erklärt, und am letzten Tag des Jahres wurde den Priestern unter Androhung von Gefängnisstrafe untersagt, Religionsunterricht zu erteilen oder in der Öffentlichkeit Priesterkleidung zu tragen. Mit dem »Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat« vom 20. April 1911 hatte die antiklerikale Revolution ihr Endziel erreicht: Der Kirche wurden Unsummen Geldes abgefordert und Kirchen und Klöster in Kasernen und Ställe, Regierungsgebäude und Parteiinstitutionen umgewandelt. Die Tage des portugiesischen Katholizismus waren gezählt, frohlockte man in Kreisen der Revolutionsregierung und ihrer Verbündeten, den Freimaurern und Humanistenverbänden. »In einigen wenigen Jahren wird es in Portugal keinen einzigen Menschen mehr geben, der den Wunsch hat, Priester zu werden«, erklärte triumphierend der Großmeister der portugiesischen Logen, Magalhaes Lima, und Justizminister Alfonso Costa glaubte sogar, dass »die katholische Religion, die Hauptursache für die miserable Lage des Volkes, innerhalb von zwei Generationen in Portugal ausgemerzt sein wird.«
Der Heilige Stuhl protestierte, Papst Pius X. verdammte öffentlich und ausgerechnet am 24. Mai 1911, dem Festtag Mariens, der Patronin Portugals, »das unmenschliche Gesetz« und »seine monströse Absurdität« und erklärte es »für null und nichtig, da es im Widerspruch zu dem unverletzlichen Recht der Kirche« stehe. Die Reaktion der portugiesischen Revolutionsregierung war die Ausweisung der meisten katholischen Bischöfe und die Inhaftierung aller Priester, die sich öffentlich dem vatikanischen Protest anschlossen.
Doch die Geschehnisse in Portugal waren nur die Ouvertüre zu einem Jahrzehnt, das ganz Europa in den Krieg stürzen und das Ende für drei der größten europäischen Monarchien bringen sollte.
Als am 28. Juni 1914 der österreichischungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo von einem 19-jährigen Gymnasiasten erschossen wurde, ahnte noch niemand, dass diese Bluttat, als »Racheakt für die Unterdrückung der Serben« gedacht, das Angesicht der Alten Welt so völlig verändern sollte. Sie war der Funke, der das Pulverfass Europa zur Explosion bringen sollte. Imperialismus und Nationalismus bestimmten den Zeitgeist, Jahrzehnte des Wettrüstens hatten die Staatsfinanzen der großen europäischen Mächte ruiniert, aus Mißtrauen vor den Nachbarn wurden Bündnisse und Achsen gebildet, die nunmehr eine Kettenreaktion auslösten. Als Österreich, gedrängt durch den deutschen Kaiser Wilhelm II., den Serben am 28. Juli den Krieg erklärte, konnte Russland, das Serbiens Verbündeter war, nicht schweigend zusehen. Der Zar befahl die Mobilmachung – ein Schritt, auf den das Deutsche Reich nur wartete, das argwöhnisch die Aufrüstung der Zarenmacht beobachtet und längst einen Präventivschlag erwogen hatte. Russland wiederum war mit Frankreich und Großbritannien verbündet, und zu den politischen Zielen Frankreichs gehörte die Rückgewinnung von Elsass-Lothringen, das die Deutschen seit dem Jahre 1870 besetzt hielten. Am 31. Juli 1914 informierte der bayerische Gesandte Hugo Graf von Lerchenfeld die Regierung in München:
»Es laufen zurzeit zwei Ultimata: Petersburg zwölf Stunden; Paris 18 Stunden. Petersburg: Anfrage nach Grund der Mobilmachung; Paris: Anfrage, ob es neutral bleibt. Beide werden selbstverständlich ablehnend beantwortet werden. Also Mobilmachung spätestens Sonntag, den 1. August, um Mitternacht. Preußischer Generalstab sieht Krieg mit Frankreich mit großer Zuversicht entgegen, rechnet damit, Frankreich in vier Wochen niederzuwerfen.«
Noch am selben Tag verkündeten die Abendzeitungen im Reich den »allgemeinen Kriegszustand«.
Als deutsche Truppen durch das neutrale Belgien gegen Frankreich zogen, erklärte England dem Reich den Krieg. Den miteinander verbündeten Truppen Frankreichs und Englands gelang es, den deutschen Vormarsch nach vier Wochen zu stoppen, während die riesige russische Narew-Armee von Generaloberst Paul von Hindenburg bei Tannenberg vernichtend geschlagen wurde. Erst 1916 gelang den Russen nach einer Reihe von Niederlagen ein erster Sieg gegen die ebenfalls geschwächte österreichische Armee. Die Verdun-Offensive und eine monatelange Materialschlacht an der Somme schwächten die deutsche Westfront entscheidend, 335000 Soldaten verloren auf deutscher Seite ihr Leben, 360000 aufseiten der Franzosen. Nach dem Tod des österreichischen Kaisers am 21. November 1916 erwog Österreich-Ungarn eine Sonderfriedenspolitik, am 12. Dezember erklärte das Deutsche Reich, dass es zu Friedensverhandlungen bereit sei. Die Kriegsgegner lehnten ab. Ihr Ziel war jetzt die Ausmerzung des preußischen Militarismus, der so viel Unheil über Europa gebracht hatte. Den Briten gelang es, die USA zum Kriegseintritt zu bewegen, die am 6. April 1917 dem Deutschen Reich offiziell den Krieg erklärten. Nur einen Monat zuvor, am 8. März 1917, war Russland durch innere Unruhen in seinen Grundfesten erschüttert worden.
Auch das kam keineswegs überraschend. Seit der Niederschlagung einer friedlichen Demonstration vor dem Winterpalais in St. Petersburg an jenem 22. Januar 1905, der als »Blutiger Sonntag« in die Geschichte eingehen sollte, brodelte es in Russland. In dem ganzen Riesenreich, das von Polen bis zum Pazifik reichte, war es immer wieder zu Streiks, Kundgebungen und Attentaten der verschiedensten revolutionären Gruppen gekommen, unter denen sich eine immer deutlicher als die radikalste herauskristallisierte: die Bolschewiki, deren Anführer der im Schweizer Exil lebende Wladimir Iljitsch Lenin war, und die eine »Diktatur des Proletariats« auf ihre roten Fahnen geschrieben hatten. Der Eintritt Russlands in den Ersten Weltkrieg hatte das Schicksal des Zarenreiches besiegelt. Eine Reihe militärischer Niederlagen, die schlechte Versorgung der Truppen, die zunehmende Lebensmittelknappheit im Lande selbst erschütterten das Vertrauen in den Zaren und führten den lautstarken Parolen der Bolschewisten immer breitere Bevölkerungsgruppen zu. Als Zar Nikolaus II. schließlich den Befehl erteilte, auf sich erhebende Truppenteile zu schießen, unterschrieb er, ohne es zu wissen, sein eigenes Todesurteil. Am 8. März 1917 kam es zu Streiks und Unruhen in St. Petersburg. Statt dem Befehl des Zaren zu folgen, verbündete sich die St. Petersburger Garnison mit den Arbeitern zur »Februarrevolution«, die am 12. März eine »provisorische Regierung« an die Macht brachte und den Zaren am 15. März zur Abdankung zwang. Zusammen mit seiner Familie wurde Nikolaus II. gefangen genommen. Am 16. April kehrte Lenin aus dem Exil zurück – unter tatkräftiger Hilfe der Deutschen, die dabei ganz nach dem Motto »Der Feind meines Feindes ist mein Freund« handelten –, und durch flammende Reden gelang es ihm, genügend Unterstützung für den entscheidenden Schritt zur Macht zu gewinnen. Am 6./7. November 1917 putschten die Bolschewisten mit dem Militär auf ihrer Seite in St. Petersburg, ihre Arbeiter- und Soldatenräte (Sowjets) übernahmen die Macht. Ihr erster Schritt: Abschluss des Waffenstillstandes zwischen dem Deutschen Reich und Russland. An der Westfront tobte zwischenzeitlich nach wie vor ein zermürbender Stellungskrieg, den keine Seite gewinnen konnte. Während die deutsche Reichsregierung versuchte, einen Waffenstillstand mit US-Präsident Wilson auszuhandeln, kam es am 28. Oktober 1918 zu einer Meuterei der deutschen Hochseeflotte, gefolgt von einem Matrosenaufstand in Kiel, der bald auch auf andere Städte übergriff. Eine Woche später tobte die Revolution in München und Berlin: Kaiser Wilhelm II. war gezwungen, abzudanken, der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann rief die Republik aus. Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand von der neuen deutschen Regierung unterzeichnet. Der Krieg, der acht Millionen Todesopfer gefordert hatte, war zu Ende.
In Portugal herrschte währenddessen auch weiterhin politisches Chaos. Zwischen den Jahren 1911 und 1926 erlebte es acht Präsidenten, 44 Regierungen sowie 20 Revolutionen und Staatsstreiche. 1916 trat das Land, das zuerst neutral bleiben wollte, auf Drängen seines Verbündeten Großbritanniens – dessen Unterstützung die republikanischen Freimaurer erst an die Macht gebracht hatte – in den Ersten Weltkrieg ein. Nach einem Militäraufstand übernahm Sidonio Pais 1917 die Regierung, um ein Jahr später ermordet zu werden.
Von all dem bekamen die einfachen Menschen in der Serra de Aire nur wenig mit. Sie wussten, dass in Europa ein grausamer Krieg wütete, sie fürchteten um das Leben ihrer Söhne, die in die Armee einberufen wurden, und sie erhofften sich nichts sehnlicher als den Frieden. Die Kinder spürten zwar die Sorgen und Ängste ihrer Eltern, doch für sie war die Bedrohung des Krieges zu fern, zu abstrakt, um ihren Alltag zu trüben. Ihr Leben bestand aus den Freuden des Spielens und den Pflichten, die ihre Familien ihnen auferlegt hatten, den kleinen Arbeiten, die sie übernehmen mussten, dem Hüten der Schafe und den regelmäßigen Gebeten und Kirchgängen, ein Leben in Harmonie mit der Natur, das vom Wechsel der Jahreszeiten geprägt war und von den religiösen Festen, die ihre einzigen Fixpunkte in einem sonst fließenden Dasein waren.
Es war ein heißer Sommertag des Jahres 1915, die Sonne stand hoch am Himmel, als Lucia und drei kleine Mädchen in ihrem Alter, Maria und Teresa Matias und Maria Justino, ihren mittäglichen Rosenkranz an den Hängen des Cabeco-Berges beteten. Es war das erste Jahr, in dem ihre Eltern Lucia die Schafe anvertrauten, eine Aufgabe, der das Mädchen stolz und gewissenhaft nachging und die ihr die Gelegenheit gab, sich täglich mit Gleichaltrigen und ihren Herden zu treffen.
Während des Gebetes streifte Lucias Blick über die Landschaft und erfüllte sie mit einem Gefühl der Ehrfurcht vor der Schöpfung Gottes, der Natur. Vor ihr lag das Tal mit seinen blassgrünen Bäumen, darüber eine weiße Wolke, die – Lucia stockte – weißer als Schnee und durchsichtig die Gestalt eines Menschen anzunehmen schien, bevor sie sich buchstäblich wieder in Luft auflöste. »Habt ihr das auch gesehen?«, fragte sie ihre Gefährtinnen. Sie hatten. »Was war das?«, wollte sie wissen. Niemand wusste eine Antwort. Als die Mädchen abends ihren Eltern davon erzählten, nahm niemand sie ernst. »Vielleicht ist irgendwo Rauch aufgestiegen« – oder die Mädchen hatten sich alles nur eingebildet. Doch das Phänomen wiederholte sich noch zweimal an den folgenden Tagen, jedes Mal beim Mittagsgebet. »Seltsam«, dachten die Kinder, »warum hat die Wolke jedes Mal Menschenform?« Doch sie erzählten niemandem mehr davon – der Spott der Verwandten und Dorfbewohner hatte sie zu tief verletzt.
Mit Sicherheit hätte Lucia das Phänomen vergessen, wenn es nicht der Auftakt zu einer Reihe von Erscheinungen gewesen wäre, die ihr ganzes Leben verändern und letztendlich Weltgeschichte schreiben sollten. Ein gutes Dreivierteljahr später, irgendwann im Frühling des Jahres 1916, zog Lucia – nicht zum ersten Mal, aber nur kurze Zeit, nachdem ihre Eltern ihnen die Schafe anvertraut hatten – mit Francisco und Jacinta auf das Grundstück »Chousa Velha« ihrer Eltern am Osthang der Loca do Cabeco. Es war ein kühler, feuchter Morgen, es nieselte, und so stiegen die Kinder den Berghang hinauf, auf der Suche nach einem Felsen, der ihnen und den Schafen Schutz bieten konnte. Sie wussten von einer Höhle, die sich inmitten eines Olivenhaines befand, der Lucias Patenonkel Anastacio gehörte. Von dort aus hatte man einen guten Blick auf Aljustrel, den Weiler, in dem die Geburtshäuser der Kinder standen. Irgendwie gefiel es ihnen in der Höhle, und so entschieden sie, dort zu bleiben, auch als der Nieselregen längst aufgehört hatte. Es kam sogar die Sonne durch, die hell und kräftig wie eh und je leuchtete, als die Kinder ihr Mittagessen einnahmen, schnell den Rosenkranz herunterbeteten und sich wieder ihrer eigentlichen Leidenschaft, dem Spiel mit Steinen, widmeten. Was dann geschah, schilderte Lucia später wie folgt:
»Wir hatten schon ein Weilchen gespielt, als plötzlich, obwohl es sonst ein ruhiger Tag war, ein starker Wind die Bäume schüttelte. Wir blickten nach oben und sahen dann jene Gestalt: (…) Ein Jüngling von 14 bis 15 Jahren, weißer als der Schnee. Die Sonne machte ihn durchsichtig, als wäre er aus Kristall. Er war von großer Schönheit. (…) Je näher er kam, umso besser konnten wir seine Gesichtszüge erkennen. Wir waren sehr überrascht und ganz hingerissen. Wir sagten kein Wort. Als er bei uns anlangte, sagte er: ›Habt keine Angst, ich bin der Engel des Friedens! Betet mit mir.‹
Er kniete sich auf die Erde und beugte seine Stirn bis zum Boden. Durch einen übernatürlichen Zwang mitgerissen, taten wir das Gleiche und wiederholten die Worte, die wir ihn sprechen hörten:
›Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die an dich nicht glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und dich nicht lieben.‹
Nachdem wir das dreimal wiederholt hatten, erhob er sich und sagte: ›So sollt ihr beten. Die Herzen Jesu und Mariens erwarten eure flehentlichen Bitten.‹ Und er verschwand.«
Etwas Übernatürliches, Numinoses lag in der Luft, lange nachdem die leuchtende Gestalt verschwunden war. Minutenlang verharrten die Kinder in andächtigem Staunen, als seien sie selbst in eine andere Welt entrückt worden, in eine Welt, in der weder Zeit noch Raum existieren. Erst langsam wurden sie sich wieder ihrer Existenz in dieser materiellen Daseinsform bewusst, während ihre Gedanken noch immer um die Worte des Engels kreisten, die sie unaufhörlich wiederholten, um sicherzugehen, ja kein Wort zu vergessen. »Wir fühlten die Gegenwart Gottes so gewaltig und innerlich, dass wir nicht einmal miteinander zu sprechen wagten«, sollte Lucia später schreiben. Auch als sie am nächsten Tag an die Stelle zurückkehrten, lag immer noch ein Zauber über ihr, als hätte die Erscheinung ein Tor geöffnet zu einer anderen Dimension, zur Welt des Göttlichen. Und noch etwas wussten die Kinder tief in ihrem Innersten: Was sie erlebt hatten, musste ihr süßes Geheimnis bleiben, durfte nicht profanisiert werden durch Klatsch und Tratsch und Misstrauen, jene üblen Gewohnheiten, die auch einige ihrer Spielkameraden bereits aus der Welt der Erwachsenen übernommen hatten. Doch alles, jede noch so schöne Erinnerung, verliert einmal ihren Zauber, und bald kehrte der Alltag in das Leben der vom Himmel berührten Kinder zurück. Wieder spielten und lärmten sie, tanzten und lachten, unbekümmert, als sei nichts geschehen.
Der Sommer kam, immer heißer und trockener wurde es in der Serra, man stand noch früher auf, damit die Schafe das vom Tau benetzte Gras fressen konnten, um in der Mittagssonne Schutz zu finden unter dem dichten Schatten der Feigenbäume oder der lichteren Oliven- und Mandelbäume. Wieder suchten Lucia, Jacinta und Francisco den Olivenhain ihres Onkels auf, weil er kühlenden Schatten bot und weil er sie doch an ihre so geheimnisvolle Begegnung erinnerte.
Es war zur Zeit der Siesta, die sengende Sonne stand hoch am Himmel, als der Engel ihnen wieder erschien:
»Plötzlich sahen wir denselben Engel vor uns«, erinnert sich Lucia. »Er sagte: ›Was tut ihr? Betet! Betet viel! Die Herzen Jesu und Mariens haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar.‹
›Wie sollen wir Opfer bringen?‹, fragte ich (Lucia).
›Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer zur Sühne für die Sünden, durch die Er beleidigt wird, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder. So werdet ihr den Frieden für euer Vaterland herabziehen. Ich bin sein Schutzengel, der Schutzengel Portugals. Vor allem nehmt die Leiden, die euch der Herr schicken wird, in Ergebung an und tragt sie geduldig.‹«
Nur Lucia und Jacinta hörten diese Worte, nicht aber Francisco, der bloß die Erscheinung sah. Doch die Kinder waren so gebannt, dass er es erst am nächsten Tag wagte, Lucia zu fragen. Sie konnte nicht darüber sprechen, schickte ihn zu Jacinta, die ebenso wenig in der Lage war, etwas zu sagen. Erst am übernächsten Tag schilderte Lucia dem Jungen die Botschaft, die er aber nicht verstand.
»Wer ist der Allerhöchste?«, fragte er. »Und was soll das heißen: Die Herzen Jesu und Mariä werden auf eure Bitten hören?« Lucia fiel es schwer, Francisco diese und viele andere Fragen zu beantworten, und irgendwann wies sie ihn zurecht: »Hör zu!, von diesen Dingen spricht man nur wenig.«
Stattdessen prägten sich die Worte des Engels tief in die Herzen und Köpfe der Kinder ein. »Gott liebt uns und will von uns wiedergeliebt werden«, das war für sie der Kern der Botschaft. Ihre Realisierung war hart. Sie versuchten es mit Abtötungen und Bußübungen, verzichteten auf Dinge, die ihnen zuvor Freude gemacht hatten, und beteten stattdessen stundenlang, auf die Erde niedergeworfen, das »Gebet des Engels«. Es wurde Herbst, die Weinlese in der Serra war bereits beendet, als sich der Engel zum dritten (beziehungsweise sechsten, rechnet man die »Wolkenmanifestationen« mit) Mal zeigte. Die Kinder gingen vom Preguiera zur Lapa de Cabeco, den Berghang entlang auf der Seite von Aljustrel und Casa Velha, wo sie, weil es Mittag war, wieder einmal den Rosenkranz – mittlerweile andächtig – und das Gebet des Engels beteten. »Während wir dort beteten, erschien der Engel«, schreibt Lucia, »er hielt einen Kelch in der Hand, darüber eine Hostie, aus der Blutstropfen in den Kelch fielen. Er ließ den Kelch und die Hostie in der Luft schweben, kniete sich auf die Erde nieder und wiederholte dreimal das Gebet:
›Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste Seines Heiligen Herzens und des Unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder.‹
Dann erhob er sich und ergriff wieder Kelch und Hostie. Die Hostie reichte er mir, den Inhalt des Kelches gab er Jacinta und Francisco zu trinken mit den Worten: ›Empfangt den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden, tröstet euren Gott.‹ Dann kniete er sich erneut auf den Boden und sprach mit uns dreimal dasselbe Gebet: Allerheiligste Dreifaltigkeit usw., und verschwand.«
Auch diesmal dauerte es einige Zeit, bis sich die Kinder ihrer physischen Sinne langsam wieder bewusst wurden. Eine starke Müdigkeit und Erschöpfung breitete sich in ihnen aus, verbunden mit einem tiefen Gefühl der inneren Erfüllung, ja Glückseligkeit. Es war, als seien Lucia, Jacinta und Francisco aus einer mystischen Ekstase, einem Zustand geistiger Entrücktheit und Gottesnähe, zurückgekehrt. Auch wenn die Erscheinung des Engels ihren Anfang ganz in der Realität ihres Wachbewusstseins nahm, so führte sie doch die drei Hirtenkinder in ganz andere Bereiche des Bewusstseins, in die Welt der Mystik, der Visionen und Offenbarungen.
Es ist viel spekuliert worden, was »wirklich« hinter den Erscheinungen von Fatima stehen könnte. War es Hysterie, waren es schizoide Schübe? Dagegen sprechen die tiefe innere Erfülltheit der Kinder nach der Erscheinung, die Übereinstimmung ihrer Beschreibungen, die tiefe Aussagekraft ihrer Symbolik. War es religiös motiviertes Wunschdenken? Was man so gerne mystisch veranlagten Mönchen und Nonnen nachsagt, trifft ganz gewiss nicht auf unsere drei bodenständigen Hirtenkinder zu, die viel lieber spielten, als den Rosenkranz zu rezitieren, und die auch die erste Erscheinung eigentlich eher vergessen wollten. Waren es, wie besonders fantasiebegabte Autoren mutmaßen, holografische Bilder, projiziert von einer außerirdischen Intelligenz? Auch das ist auszuschließen, denn diese Hypothese erklärt weder die Bewusstseinsveränderung noch die tiefe geistige Erfüllung der Visionäre oder die Unterschiede in der Wahrnehmung der Erscheinung (Francisco sah sie nur reden, hörte aber ihre Stimme nicht). Es gibt nur eine plausible Erklärung für das, was die Kinder erlebt haben: Sie hatten eine genuine Vision. »Etwas« manifestierte sich in ihrem Bewusstsein, »etwas«, dessen Heimat eine andere Welt jenseits des Irdischen ist.
Bald zog der Winter über das Land, und wieder kehrte der Alltag im Leben der Kinder von Aljustrel ein. Immer verschwommener wurden das Bild des Engels und seine Empfehlungen in ihrer Erinnerung, immer weniger dachten sie darüber nach, was er ihnen gesagt hatte, mehr und mehr verhallten seine Empfehlungen in der Weite eines einfachen, sorgenfreien und erlebnisreichen Kinderlebens. Dann kam der Frühling. Die kalten Winterstürme wichen dem warmen April-Regen, der unzählige junge Pflanzen aus der regenerierten Erde sprießen ließ, sattgrüne Gräser und farbenprächtige Blumen und Blüten und frischgrüne Blätter an den knorrigen Ästen der grauen, winterkahlen Bäume. Die felsigen Hänge der Serra erfüllten sich mit Leben, und wieder war es an der Zeit, die Schafe in die Natur zu treiben, wo sie Lämmer zur Welt brachten, die vorsichtig und neugierig zugleich auf ihren staksigen, dünnen Hufen die frische, feuchte Weide erkundeten. Wie neugeboren fühlten sich auch Lucia, Francisco und Jacinta. Endlich, der Winter war vorbei, sie konnten wieder in die geliebte Natur, sich wieder ihren Spielen und Kinderfreuden widmen. Sie sollten nicht ahnen, dass dieses Jahr, das Jahr 1917, zu ihrem Schicksalsjahr werden sollte – und durch sie zum Schicksalsjahr der Menschheit in diesem von Wirren und Irrungen gekennzeichneten Jahrhundert. Denn während im fernen Russland Wladimir Iljitsch Lenin die Machtergreifung der Proletarier und eine atheistisch-materialistisch orientierte Sowjetherrschaft vorbereitete, manifestierte sich im ländlichen Hochland Portugals eine ganz andere, ganz und gar nicht materielle Macht, die zur Gegenrevolution aufrief. Es war die Macht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.
Kapitel 2
Eine Frau, mit der Sonne bekleidet
Der Weiler Aljustrel, in dem Lucia, Jacinta und Francisco lebten, gehört zu der Gemeinde des Dorfes Fatima, das seinen Namen einer Legende verdankt. Im 8. Jahrhundert eroberten die Araber die Iberische Halbinsel, um in den folgenden sechs Jahrhunderten schrittweise von den christlichen Heeren zurückgedrängt zu werden.
Im 11. Jahrhundert war der Norden Portugals bereits in christlicher Hand, während das Land südlich des Flusses Tagus zum Kalifat gehörte. Das Grenzland war unsicher, immer wieder attackierten christliche Untergrundkämpfer in bester Guerillataktik die verhassten Muslime. Einer der Widerständler war Goncalo Hermingues, der »Schrecken der Mauren«, der eine Horde christlicher Ritter anführte.