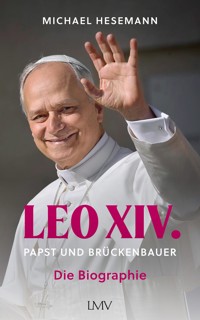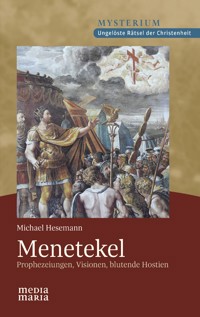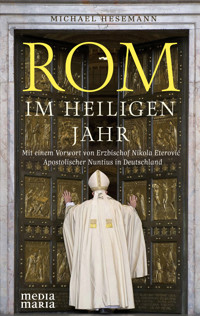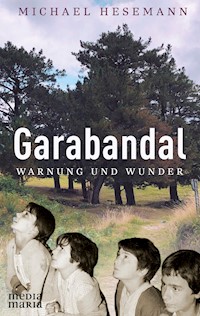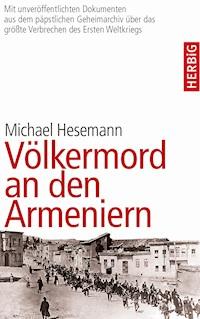Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie ist auf jedem Bild des Gekreuzigten zu sehen: Die Inschrift I.N.R.I. – Jesus von Nazareth, König der Juden. Nur wenige wissen, dass die Tafel über dem Kreuz Christi die Jahrhunderte überlebt hat und noch heute verehrt wird: In der römischen Basilika Santa Croce gibt die Kreuzesinschrift Zeugnis von der Hinrichtung Jesu. Michael Hesemann, der Historiker mit Zugang zu den Vatikanischen Geheimarchiven, nimmt den Leser mit auf eine packende Forschungsreise vom Orient bis nach Italien und beantwortet die spannende Frage: Ist die Tafel ein authentisches Relikt des Erlösers – oder eine trickreiche Fälschung?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Hesemann
Die Jesus-Tafel
Die Entdeckung der Kreuzinschrift
Ich widme dieses Buch allen Pilgern,
die in Jerusalem und Rom
auf den Spuren des Erlösers
und der frühen Kirche wandeln.
Im Gedenken an meinen Vater
Henner Hesemann (1917–1998)
Aktualisierte Neuausgabe 2019
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 1999
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Die Bibeltexte sind entnommen aus:
Die Bibel. Die Heilige Schrift
des Alten und Neuen Bundes.
Vollständige deutsche Ausgabe
© Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005
Umschlaggestaltung: Finken und Bumiller, Stuttgart
Bildquelle: Verlagsarchiv Herder
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN E-Book 978-3-451-81628-4
Inhalt
Einleitung: Jesus – der Beweis?
1. Auf der Suche nach dem historischen Jesus
2. Der König der Juden
3. Im Zeichen des Kreuzes
4. Operation Heiliges Grab
5. Der Jahrtausendfund
6. Ein Jerusalem in Rom
7. Wer stand unter dem Kreuz?
Bibliographie
Danksagung
Der Autor
Einleitung: Jesus – der Beweis?
Rom, 19. Mai 1997: Die traditionellen Feiern zum Pfingstfest waren vorüber, und wie jedes Jahr hatte Papst Johannes Paul II. pünktlich um 12.00 Uhr die Gläubigen dem Petersplatz vom Fenster seiner Residenz aus gesegnet. Es war ein besonderes Jahr, das erste der letzten drei Jahre des zweiten Jahrtausends, die der Pontifex der Heiligen Dreifaltigkeit des Christentums geweiht hatte. Auch sonst warf das Heilige Jahr 2000 seine Schatten voraus. Ganz Rom war eine Baustelle, überall wurde renoviert und restauriert, Fassaden wurden verkleidet und Straßen aufgerissen, man putzte die Stadt heraus für das Jubeljahr, in dem bis zu 30 Millionen Besucher in Rom erwartet wurden. Dann, so scheint es, führen tatsächlich alle Wege nach Rom, während die Einheimischen das große Chaos befürchteten, weil der Verkehr schon damals regelmäßig kollabierte und es an Hotelbetten mangelte.
Durch breite, aber meist verstopfte Straßen führt auch der Weg zur Basilika zum Heiligen Kreuz. Noch heute hat die Bebauung und Straßenführung im Südosten Roms etwas von der einstigen Großzügigkeit dieses Viertels der Gärten und Paläste. Auch vor S. Croce befindet sich ein ausgedehnter Platz mit einer breiten Rasenfläche, vereinzelten Palmen und zahlreichen Parkplätzen für Kirchenbesucher und Pilgerbusse. Die Basilica di S. Croce di Gerusalemme – so ihr vollständiger Name – gilt seit dem Mittelalter als eine der sieben Hauptkirchen Roms, ja als eines der bedeutendsten Heiligtümer der gesamten Christenheit. Diesen Ruf hat die Kirche unbestreitbar ihren kostbaren Reliquien zu verdanken, die zu besichtigen auch ich gekommen war.
Trotzdem war es mir, als ich die Stufen zum Portal der Basilika emporstieg, noch nicht bewusst, dass dieser Kirchenbesuch mein Leben verändern sollte. So ließ ich den Kiosk der Kirche, den es damals noch gab, links liegen und trat durch den Haupteingang ein, um überwältigt zu werden von den großartigen Deckenfresken über dem Hochaltar. Sie zeigen, rund um den thronenden Christus, Szenen der Auffindung des Heiligen Kreuzes in Jerusalem, jener Legende, der die ehrwürdige Basilika ihren Ruf und Rang verdankte.
Denn nach altchristlicher Überlieferung brachte die heilige Helena, Mutter des römischen Kaisers Konstantin des Großen, die Reliquie des Kreuzes Christi von Jerusalem nach Rom. Dort soll sie diese in ihrer Palastkapelle aufgestellt haben, in der sie Erdreich vom Golgotahügel ausstreute. Aus diesem Heiligtum entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte die Basilika vom Heiligen Kreuz in Jerusalem.
Noch heute werden die angeblichen Passionsreliquien Christi den Gläubigen gezeigt, in einer eigens für sie errichteten Reliquienkapelle, deren Eingang sich auf der linken Seite des Kirchenschiffes befindet. Als ich dort eintrat, fiel mein Blick zuerst auf einen riesigen, hölzernen Balken, angeblich einem Teil vom Kreuz des guten Schächers, einem der beiden Männer, die zusammen mit Jesus an diesem finstersten aller Freitage auf dem Kalvarienberg gekreuzigt wurden. Eher ungläubig und irritiert von so viel Gewissheit – wer wollte wissen, ob er, wenn überhaupt, nicht vom Kreuz seines spottenden Kollegen stammte? – passierte ich das Ausstellungsstück und stieg dreimal drei Treppenstufen zur eigentlichen Reliquienkapelle hinauf. Dieser marmorne Aufgang, gesäumt von bronzenen Kreuzwegstationen, schien eine moderne Reminiszenz an den Kalvarienberg zu sein. Im Zentrum der Kapelle, zu der er führte, befand sich ein Altar, überragt von einem kuppelbekrönten Baldachin auf vier marmornen Säulen. Hinter ihm befanden sich die Passionsreliquien Christi.
Ich umging den Altar, um an die Reliquien heranzugelangen. So genau wie möglich wollte ich sehen, was sich in den fünf prachtvollen Silberreliquiaren aus dem 19. Jahrhundert befand, die von einem herrlichen, goldverzierten Kreuzreliquiar überragt wurden. Den Beschreibungen nach handelte es sich um drei Kreuzpartikel, einen Nagel, zwei Dornen der Dornenkrone, Steinchen aus Betlehem bzw. Jerusalem, einen Finger des Apostels Thomas sowie ein Fragment der Kreuzesinschrift – DIE JESUS-TAFEL!
Es gibt immer wieder Situationen im Leben, in denen Herz und Verstand, Seele und Intellekt miteinander im Konflikt stehen, und so erging es mir auch in diesem Augenblick. Der Christ in mir stand von Respekt erfüllt vor den möglicherweise authentischen stummen Zeugen der Passion des Herrn, der Wissenschaftler war skeptisch und wollte Beweise. Und ich wusste: Diesem menschlich-allzumenschlichen Verlangen nach Beweisen, nach physischen Bestätigungen für die Wahrheiten des Glaubens, entsprang überhaupt erst die Verehrung von Reliquien. Umso mehr war sie, das wusste ich seit meinem Studium der Mittelalterlichen und Neuen Geschichte und Europäischen Ethnologie an der Universität Göttingen, mit größter Vorsicht zu genießen. Denn das gesamte Mittelalter hindurch trieb der Reliquienkult geradezu absurde Blüten, wurde zum Nährboden für die Produktion der absonderlichsten Fälschungen, die jeweils nur ein Ziel hatten: Gutgläubige und Wundersüchtige an einen Wallfahrtsort zu locken, zu dessen aufblühendem Wohlstand sie tatkräftig beizutragen hatten. So jedenfalls stand es in den Geschichtsbüchern, so wurde es uns als Studenten gelehrt.
Reliquien waren für den Menschen des Mittelalters Träger göttlicher Kraft und Gnade. Das wurde auch politisch genutzt: In die Krone der Langobarden – heute im Domschatz zu Monza – war ein (angeblicher) Nagel vom Kreuz Christi eingearbeitet, zu den Reichsinsignien deutscher Kaiser gehörten das Reichskreuz mit einer eingelassenen Partikel vom wahren Kreuz und die heilige Lanze. Zuerst galt sie als Lanze des Reichsheiligen Mauritius, dann machten Wunschdenken und Volksglaube aus ihr den Speer, mit dem der Legionär in die Seite des Gekreuzigten stach. Tatsächlich jedoch handelt es sich bei dem Wiener Reichskleinod um eine karolingische Flügellanze aus dem 8. Jahrhundert. Die eigentliche – angebliche – heilige Lanze befand sich dagegen im Reliquienschatz der byzantinischen Kaiser. Erst nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken ging ihre Spitze als Geschenk des Sultans an Papst Innozenz VIII. (1484–1492), seitdem wird sie im Petersdom zu Rom verwahrt. Ihr Schaft war bereits im 13. Jahrhundert von den lateinischen Kaisern von Byzanz an den französischen König verkauft worden, in dessen Privatkapelle, der Sainte Chapelle zu Paris, sie sich seitdem befand. Gleich zweimal führte das Rom des Ostens Kriege um Reliquien: um ein Fragment des wahren Kreuzes, das die Perser bei der Eroberung von Jerusalem in ihren Besitz gebracht hatten, und um das mysteriöse, nicht von Menschenhand geschaffene Christusbild der Stadt Edessa. Nicht Gold oder andere irdische Schätze, sondern die Reliquien der Drei Könige aus Mailand waren die bedeutendste Beute aus dem Italienfeldzug Kaiser Friedrichs I. Barbarossa. Er ließ sie von seinem Reichskanzler Reinald von Dassel auf abenteuerlichen Wegen nach Köln bringen, das sofort an die Spitze der nordeuropäischen Wallfahrtsorte hochschnellte. Durch die Kreuzzüge und die Eroberung von Konstantinopel (1204) wurde Europa schließlich von echten und falschen Reliquien geradezu überschwemmt, was ihre Verehrung nur noch populärer werden ließ.1
An der wichtigen Rolle, die Reliquien in der europäischen Kultur- und Religionsgeschichte gespielt haben,2 kann also kein Zweifel bestehen. Dass es im Mittelalter auch zu grobem Missbrauch der Reliquienfrömmigkeit kam, dass es eine ganze Flut von Fälschungen gab – sogar Tierknochen wurden als Heiligengebein ausgegeben –, ist unbestreitbar und wurde zuallererst von der Kirche selbst erkannt: Schon auf dem 4. Laterankonzil (1215) unternahm man alles, um dem Handel und Schwindel mit Reliquien Einhalt zu gebieten. Fortan war ihr Kauf und Verkauf nach kanonischem Recht untersagt, war ein kirchlicher Echtheitsnachweis erforderlich und bedurfte es bischöflicher Genehmigung, um Wallfahrten durchzuführen.3
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass es auch echte Reliquien gibt. Damit sind, um kirchlichen Sprachgebrauch zu zitieren, nur Reliquien erster Ordnung gemeint, also Körperreliquien der Heiligen und Märtyrer und solche, die Zeugnis des Wirkens Jesu waren; Reliquien zweiter Ordnung sind Kleidungsstücke und religiöse Gegenstände, die ein Heiliger zu Lebzeiten benutzte, oder jene, die einer Herrenreliquie nachgebildet und von dieser berührt worden sind; zur dritten Ordnung schließlich rechnet man Berührungsreliquien im weiteren Sinne, z. B. Tücher, die Heiligengräber anrührten. Schon früh, nachweisbar seit dem 2. Jahrhundert, verehrte die Kirche die Gebeine ihrer Märtyrer, die als »kostbarer als Edelsteine und wertvoller als Gold«4galten. Im selben Zeitraum fanden die ersten, wenn auch vereinzelten, Pilgerfahrten zu den Gräbern der Apostel und den Stätten des Wirkens Jesu statt. Die drei synoptischen Evangelien erzählen die Geschichte von einer Frau, die unter Blutungen litt, und »sie dachte: Wenn ich auch nur seine Kleider berühre, werde ich geheilt« (Mk 5,28) – und liefern damit ein biblisches Zeugnis vom Glauben an die Wirkungskraft von Berührungsreliquien. Die Apostelgeschichte bestätigt dies: »Sogar die Schweiß- und Lendentücher nahm man ihm vom Körper weg und legte sie den Kranken auf; da wichen die Krankheiten von ihnen und die bösen Geister fuhren aus« (Apg 19,12). Dabei ist, wohlgemerkt, von Kleidungsstücken des heiligen Paulus die Rede. Um wie viel wertvoller müssen Dinge gewesen sein, die mit dem Leib und dem Blut des menschgewordenen Gottes in Berührung gekommen sind. Schon daher können wir ziemlich sicher sein, dass sich die junge Christengemeinde eifrig darum bemühte, alle Relikte des Lebens und Leidens Jesu in ihren Besitz zu bekommen.
Wie aber trennt man die Spreu vom Weizen, mit welchen Mitteln lassen sich unter der Flut falscher Reliquien die wenigen echten identifizieren? Das entscheidende Kriterium ist zunächst einmal der Stammbaum einer Reliquie. Wie weit lässt sich ihr Weg zurückverfolgen, wie gelangte sie an ihren derzeitigen Aufbewahrungsort, wie gut ist ihr Fund dokumentiert, unter welchen Begleitumständen fand er statt? Ebenso wichtig ist ihre wissenschaftliche Verifizierbarkeit: Wie alt ist die Reliquie wirklich? Könnte sie aus dem fraglichen Zeitraum, bei Herrenreliquien aus der Zeit Jesu, stammen?
All diese Fragen gingen mir durch den Kopf, als ich in der Reliquienkapelle von S. Croce andächtig wie aufmerksam die dort ausgestellten Passionsreliquien betrachtete. Ich wusste: Das Kreuzfragment, der Titulus Crucis (die Kreuzinschrift) und der Heilige Nagel wurden bereits in zeitgenössischen Kirchengeschichten erwähnt, in Berichten aus dem Jahrhundert nach dem Tod der heiligen Helena, von denen einige möglicherweise auf Erzählungen von Augenzeugen zurückgehen. Damit unterscheiden sie sich von den zahlreichen anderen Reliquien, deren Auffindung und Überführung ebenfalls der Kaisermutter zugeschrieben werden – etwa der Scala Santa (der Heiligen Treppe) von Rom, den Heiligen Drei Königen von Mailand/Köln oder der Tunica Christi, dem Heiligen Rock von Trier –, die jedoch kein zeitgenössischer Autor erwähnt; hier stammen die Traditionen erst aus dem Mittelalter. Auch die Dornen von der Dornenkrone und der Finger des heiligen Thomas werden in keiner der frühen Quellen erwähnt und sind daher dubiosen – da undokumentierten – Ursprungs. Die Existenz der eigentlichen Passionsreliquien von S. Croce – Kreuz, Nagel, Titulus – und der Umstand, dass sie von Helena in ihren Palast in Rom gebracht wurden, ist dagegen seit über 1600 Jahren bezeugt, womit ihre Tradition sehr viel älter ist als die der meisten anderen Reliquien der Christenheit. Das allein schließt natürlich noch nicht aus, dass es sich ebensogut um Fälschungen aus dem 4. Jahrhundert oder dem Mittelalter handeln könnte, letztere vielleicht als Reliquien zweiter Ordnung in Anklang an die Helena-Tradition angefertigt; es macht aber zumindest auch ihre Echtheit denkbar.
An eben diesem Punkt muss die Methodik der Wissenschaft zum Einsatz kommen, die Aufschluss über ihr Alter und ihre Herkunft geben könnte. Doch ich wusste: Das Metall des Heiligen Nagels lässt sich nicht datieren, und obgleich zumindest sein Zentralteil sehr wohl dem Typus römischer Schreinernägel entspricht, besagt dies allein noch gar nichts über seine Herkunft oder Verwendung. Holz, auch das der Kreuzfragmente, lässt sich sehr wohl datieren, sogar seine geographische Herkunft ist bestimmbar; doch wie weist man nach, dass es tatsächlich vom Kreuz Christi stammt? Auch hier kann eine Untersuchung keine auch nur irgendwie zufriedenstellende Antwort erbringen.
Nur eine der Passionsreliquien von S. Croce ist so einzigartig, dass ihre Verifizierung nicht nur die Berichte von der Kreuzauffindung bestätigen, sondern zudem die historische Korrektheit der Evangelien und ihrer Schilderung des Lebens und Leidens Jesu unterstreichen würde: die Kreuzinschrift, die Jesus-Tafel.
Ich betrachtete sie gründlich, studierte jeden einzelnen Splitter ihres braunen, vom Zahn der Zeit zerfressenen Holzes. Tatsächlich trug sie, wie uns Johannes überlieferte, »auf hebräisch, lateinisch und griechisch« die Aufschrift: »Jesus der Nazoräer, der König der Juden« (Joh 19,19–20), zumindest einen Teil dieser Aufschrift. Wie eine plumpe Fälschung sah mir die Jesus-Tafel nicht aus. Ist sie also echt, von einem der Henker des Pilatus kurz vor der spektakulärsten Hinrichtung der Weltgeschichte niedergeschrieben worden? Handelt es sich dabei um das einzige zu seinen Lebzeiten entstandene schriftliche Zeugnis von der Existenz Jesu, um ein juristisches Dokument von seiner Verurteilung durch den römischen Präfekten? Oder bloß um eine gute, wenngleich äußerst clevere Fälschung? Nur eines stand für mich fest: Ich musste mehr über die Kreuzinschrift erfahren. Denn sollte sie authentisch sein, dann ginge dies die gesamte Christenheit an.
Keine andere historische Persönlichkeit hat über die letzten 2000 Jahre hinweg so viele Menschen in ihren Bann gezogen wie Jesus von Nazaret. Von seinen Gegnern als falscher Prophet verachtet, schon zu Lebzeiten verfolgt, gefangen genommen und als Aufwiegler zum Tode verurteilt, von seinen Anhängern als Messias und Sohn Gottes verehrt, ist er bis in unsere Zeit ein Stein des Anstoßes geblieben. In seinem Namen litten Verfolgte und starben Märtyrer, wurden Staaten gegründet, Völker evangelisiert, Kriege geführt, Ketzer verbrannt und eine Weltorganisation mit heute über einer Milliarde Mitgliedern, die katholische Kirche, aufgebaut. In der Ikonographie der byzantinischen Christen als Pantokrator, als Allherrscher auf dem Himmelsthron dargestellt, beherrschte er tatsächlich zumindest die abendländische Geschichte der letzten 1700 Jahre. Nachdem Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion gemacht hatte, überlebte es das Römische Reich, die Völkerwanderung, das Mittelalter, den Dreißigjährigen Krieg, ja sogar die Aufklärung und die antichristliche Französische Revolution, den Kommunismus und den Hitlerfaschismus. Keine noch so attraktive oder aggressive Fremdreligion oder geistige Modeströmung konnte je für längere Zeit das christliche Antlitz Europas verändern.
Trotz dieser offensichtlichen Kraft der Verheißung des Jesus von Nazaret, der seinen Anhängern Erlösung und ewiges Leben versprach, wurden in den letzten Jahrzehnten immer lauter ernsthafte Zweifel an seiner historischen Existenz oder der Korrektheit der ihm zugeschriebenen Aussagen laut. Diese kritische Einstellung nahm ihren Anfang zwar im Atheismus und der Aufklärung, wurde aber immer häufiger auch von modernen Theologen aufgegriffen. Regelrecht unter Beschuss kamen dabei die vier Evangelien, deren Anspruch es ist, nicht nur Frohbotschaft, sondern auch authentischer Bericht über den Nazarener zu sein, ein Anspruch, an dem immer häufiger Zweifel laut wurden. Obwohl die ersten Evangelienfragmente aus dem 2., vielleicht sogar aus dem 1. Jahrhundert nach Christi Geburt stammen und im Text größtenteils mit den uns zugänglichen Komplettversionen übereinstimmen, wird ihre Historizität immer wieder gerne infrage gestellt. Aus Spruchsammlungen Jesu sollen sie zusammengeschrieben worden sein, mit einer schönen Rahmenhandlung ausgeschmückt, die eigentlich nichts anderes als eine Mischung von frommer Legende und purer Phantasie sei, glauben wir den Vertretern dieser Hypothese. Als Beweis verweisen sie auf Unstimmigkeiten, die es tatsächlich zwischen den vier Evangelien gibt, die allerdings auch anders gedeutet werden können. Die Jesus-Tafel dagegen würde nahelegen, dass zumindest das vierte Evangelium von einem Augenzeugen verfasst wurde, ganz wie es die christliche Tradition behauptet.5 Ist der historische Jesus letztendlich doch der Nazarener der Evangelien?
Ich schrieb anfangs bereits, dass dieser Besuch in der Basilica di Santa Croce mein Leben veränderte. Das ist keineswegs übertrieben. Die folgenden beiden Jahre verbrachte ich damit, mehr zu erfahren über diesen Jesus von Nazaret, den historischen Jesus, den Fleisch – und damit Geschichte – gewordenen Menschensohn. Aus der Suche nach ihm wurde, wie aus jeder echten Suche nach der Wahrheit, eine Odyssee. Immer wieder kehrte ich nach Rom zurück, teils um weiteren Spuren nachzugehen, teils um Vertreter der Kirche – darunter Papst Johannes Paul II. – über meine Nachforschungen zu informieren oder für eine Zusammenarbeit zu gewinnen, teils um mich immer wieder von der Begegnung mit der Jesus-Tafel inspirieren zu lassen. Mehrfach reiste ich nach Jerusalem, dorthin, wo alles begann. Ich wollte in Kontakt kommen mit den Wurzeln, mit den Stätten des historischen Wirkens Jesu und der Auffindung seines Kreuzes. Ich konsultierte namhafte israelische und deutsche Experten, deren Meinung in der Fachwelt Gewicht hat, holte Gutachten ein, die schließlich eine Datierung ermöglichten. Weiter studierte ich antike Quellen, historische und archäologische Untersuchungen, um den Stammbaum der Reliquie zu rekonstruieren und Antworten auf meine Fragen zu finden: Welchen Wert haben die Evangelien als historische Quellen? Wie glaubwürdig waren die Kirchenhistoriker, die uns von der Kreuzauffindung berichteten? Wie sicher ist die Tradition von der Hinrichtungsstätte und vom Grab Jesu? Wird sie durch den archäologischen Befund gestärkt? Und schließlich: Gibt es Querverbindungen zu anderen Reliquien wie etwa dem mysteriösen Grabtuch von Turin, die bereits wissenschaftlich untersucht worden sind?
Auch nachdem dieses Buch 1999 erstmals erschien, wurde über sein Thema weitergeforscht. Daher entschied ich mich nach Absprache mit meinem Verleger Manuel Herder, es heute, 20 Jahre später, gründlich zu überarbeiten.
Als ich dieses Buch 1998 schrieb, wurde ich durch den Tod meines geliebten Vaters intensiver als je zuvor in meinem Leben mit dem Leiden, Sterben und der Hoffnung auf Auferstehung konfrontiert. Als es erstmals erschien, brach die Christenheit gerade in ein neues Jahrtausend auf, eingeleitet durch ein Heiliges Jahr, das zugleich in Rom und Jerusalem gefeiert wurde. Vom Weg der frühen Kirche von Jerusalem nach Rom handelt dieses Buch, von einem der eindrucksvollsten Zeugnisse für das Leiden Jesu, mit dem seitdem Millionen von Pilgern in der Basilica di Santa Croce konfrontiert wurden. Auch jetzt, 20 Jahre später, hat die Frage nach der Historizität unseres Glaubens und der Zuverlässigkeit der Evangelien nicht an Aktualität verloren. Deshalb hoffe ich, mit ihm auch weiterhin einen bescheidenen Beitrag zu einem besseren, intensiveren Verständnis der Wurzeln des Christentums zu leisten.
Düsseldorf, in der Fastenzeit 1999 und 2019
Michael Hesemann
1 Arnold Angenendt, Heilige und Reliquien, München 1994; Anton Legner, Reliquien in Kunst und Kult, Darmstadt 1995; Sierra/Atienza, La España Extrana, Madrid 1997; Kunsthistorisches Museum Wien, Weltliche und Geistliche Schatzkammer, Bildführer, Wien 1987/91.
2 S. Michael Hesemann, Die stummen Zeugen von Golgatha, München 2000.
3 Diese Vorschriften finden sich noch heute im Gesetzbuch der katholischen Kirche: CIC 1983, can. 1190.
4 Martyrium des Polykarp, 18,2, Hrsg.: T. Camelot, SC 10, Paris 31958.
5 Die einzige vollständige Wiedergabe der Kreuzinschrift finden wir im Johannesevangelium; die drei Synoptiker zitieren sie nur dem Inhalt nach, nämlich Matthäus: »Das ist Jesus, der König der Juden« (27,37), Markus: »Der König der Juden« (15,26), Lukas: »Das ist der König der Juden« (23,38).
1. Auf der Suche nach dem historischen Jesus
Am Fuße der am häufigsten dargestellten Hinrichtungsstätte der Geschichte, des Hügels von Golgota, beginnt unsere Suche. Es geht bei ihr um die Frage, ob sich das, was die Evangelisten geschildert haben, tatsächlich so oder ähnlich vor fast 1990 Jahren zugetragen hat. Gewiss, die Evangelien gehören zu den meistgelesenen Schriften der Weltliteratur. Aber sind es wirklich Biographien? Wie zuverlässig sind diese Texte? Wie genau haben ihre Autoren recherchiert? Wie glaubwürdig ist das, was wir über ihren Protagonisten, jenen Jesus von Nazaret, zu wissen glauben?
In der Frage, wie genau sie das Leben Jesu schildern, hängt viel davon ab, ob die Verfasser der vier Evangelien ihn tatsächlich kannten oder zumindest einen ausreichenden Kontakt zu Augenzeugen hatten. Der Anspruch eines Autors, bei einem historischen Ereignis dabei gewesen zu sein, erhöht natürlich seine Glaubwürdigkeit und die Authentizität – wenngleich zweifelsohne auch die Subjektivität – seines Berichtes. Zumindest aber sollte jeder, der über ein zeitgenössisches Ereignis schreibt, eine größere Anzahl von Augenzeugen interviewt und ihre Aussagen zur Grundlage seiner Darstellung gemacht haben. Wer sich eines historischen Geschehens annimmt, hat die Pflicht, alle davon erhaltenen Zeugnisse zu studieren. Gibt es gleichzeitig Dokumente – amtliche Berichte, Meldungen, Dossiers, Urkunden –, so sind diese in ihrer Aussage gegen die Augenzeugenberichte abzuwägen. Bestätigen sie einander oder ergänzen sie sich, hat der Historiker die Möglichkeit, glaubhaft Geschichte zu rekonstruieren. Das gilt auch, wenn seine Intention die Darstellung von Heilsgeschichte ist.
Und darum geht es uns. Die so wichtige Frage nach der heilsgeschichtlichen Relevanz der Ereignisse im Jerusalem des Jahres 30 überlassen wir den sehr viel kompetenteren Theologen. Wir wollen vielmehr überprüfen, ob der folgenschwerste Prozess der Weltgeschichte so stattgefunden hat, wie es uns überliefert wurde. Dabei testen wir die Frage nach der Glaubwürdigkeit der uns vorliegenden Berichte: der Evangelien des Markus, Matthäus und Lukas und des – angeblichen – Augenzeugen Johannes. Der Schlüssel zu unserer Suche ist ein historisches Dokument. Es ist das einzige Schriftstück, das uns von diesem Prozess vor fast 1970 Jahren erhalten blieb, und es kann ohne Übertreibung als Schlüsseldokument bezeichnet werden: Die Rede ist von der Schuldtafel, dem Titel mit der Anklage, der über dem Kopf des Gekreuzigten angebracht wurde. Sie verrät uns, wie genau, wie zutreffend unsere Quellen in diesem Punkt sind.
Dabei hinterfragen wir wie bei jeder soliden historischen Untersuchung die Echtheit unseres Dokumentes. Wir verfolgen seine Geschichte, untersuchen seine Provenienz. Schließlich unterziehen wir es einer geradezu kriminologischen Untersuchung. Nur wenn alle Indizien für seine Authentizität sprechen, kann es uns als Steinchen dienen in dem großen Mosaik, das man Geschichte nennt. Und in diesem Bild müssen wir ihn suchen, den Gekreuzigten. Er kann nur dann Christus, der Messias (wörtlich: der Gesalbte) sein, wenn er wirklich gelebt hat. Die Suche nach Jesus kann eine mystische Erfahrung sein; sie kann aber auch in der Geschichte beginnen.
Vergleicht man die Quellenlage bei Jesus von Nazaret mit der bei anderen historischen Persönlichkeiten der Antike, zum Beispiel den großen griechischen Philosophen, ergibt sich ein überraschendes Bild. So ist uns nicht ein einziges zeitgenössisches Dokument bekannt, das zum Beispiel die historische Existenz von Pythagoras, Sokrates, Platon oder Aristoteles beweist. Alles, was wir von ihnen wissen, stammt aus Jahrhunderte später verfassten Biographien, deren älteste Abschrift oft erst aus arabischer Zeit erhalten ist. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, die historische Existenz von Pythagoras, Sokrates, Apollonios oder die Authentizität der Jüdischen Altertümer zu bezweifeln.
Jesus von Nazaret ist kein Mythos, sondern eine historische Persönlichkeit. Das, so betonten seine Apostel, unterscheidet ihn von den Zentralgestalten der hellenistischen Mysterienkulte, von Attis und Adonis, von Dionysos und Apollon. Seine Existenz ist historisch besser dokumentiert als die von Pythagoras und Sokrates und wird zwar nicht von allen, aber doch von einer ganzen Reihe zeitgenössischer Chronisten und Historiker erwähnt. Nur Träger irdischer Macht wie die römischen Kaiser, ihre Statthalter und Vasallenkönige sind besser bezeugt, weil sie Inschriften und Münzen hinterlassen haben und ihr Leben im Zentrum der Aufmerksamkeit der Geschichtsschreiber stand. Ja, es ist wahr, wie der Kirchenkritiker Peter de Rosa in seinem kontroversen Buch Der Jesus-Mythos feststellt, dass wir »wahrscheinlich mehr konkrete Tatsachen über Pontius Pilatus als über Jesus«1 kennen, denn er war der judäische Repräsentant der irdischen Macht Roms. Das wusste die frühe Kirche, nicht umsonst hat sie die Formel »gelitten unter Pontius Pilatus« in ihr Glaubensbekenntnis aufgenommen. Sie war die historische Verankerung des Heilsgeschehens. Von Pontius Pilatus, der von 26 bis 36 Präfekt der römischen Provinz Judäa war, berichten uns der jüdische Historiker Flavius Josephus (37–100 n. Chr.) und der jüdische Philosoph und Theologe Philo von Alexandria ausführlich. Auch der römische Historiker Tacitus erwähnt ihn, und zwar in Verbindung mit Jesus. Zudem finden wir seinen Namen und Titel auf einer Inschrift, die von italienischen Archäologen 1961 bei Ausgrabungen im Theater von Caesarea an der israelischen Mittelmeerküste entdeckt wurde. Der sogenannte Pilatusstein schmückte ursprünglich ein öffentliches, dem Kaiser Tiberius geweihtes Gebäude, das Tiberieum. Später wurde er bei Bauarbeiten am Theater erneut verwendet. In ihn hatte ein Steinmetz gemeißelt:
S – TIBERIEUM ...
TIUSPILATUS ...
ECTUS IUDA..E
E
Auffallend ist, dass die Inschrift in lateinischer Sprache abgefasst ist, nicht in der Amtssprache des Ostens, dem Koiné-Griechisch. Zudem erfahren wir, dass der offizielle Titel des Pilatus Präfekt, nicht Prokurator war, wie es fälschlich der römische Geschichtsschreiber Tacitus behauptet hatte, Pilatus also vielmehr einen Prokurator als Vorgesetzten hatte, was Flavius Josephus bestätigt. Die Evangelien bezeichnen ihn auch nicht als Prokurator (griech. epítropos), sondern mit dem Oberbegriff hēgemṓn.2
Doch der Pilatusstein verrät uns noch mehr, denn er gibt uns Auskunft über Charakter und Mentalität des Präfekten. Das Tiberieum war ein dem Kaiser geweihtes Gebäude, das Pilatus in Caesarea, der Hauptstadt der Provinz Judäa und Amtssitz des Statthalters, errichten ließ. Einige Gelehrte vermuten in ihm einen Tempel oder Altar des Kaiserkultes. Allerdings ist diese Deutung nicht sicher. So erinnert Géza Alföldy an die beiden von Flavius Josephus erwähnten kolossalen Leuchttürme des Hafens von Caesarea, die Herodes errichten ließ und von denen einer nach Drusus, dem Bruder des Tiberius, Drusion genannt wurde. Im Tiberieum sieht er das (freilich in keiner Quelle beim Namen genannte) Gegenstück auf der anderen Seite des Hafens. Immerhin schlossen sich andere namhafte Historiker, darunter Alexander Demandt und Werner Eck, dieser Deutung an. Folgen wir ihr, so hätte Pilatus diesen Leuchtturm nach einer Beschädigung, vielleicht durch ein Erdbeben, renoviert und mit einer neuen Widmungsinschrift versehen, die dann
»(Nauti)S TIBERIEUM
(Po]NTIUS PILATUS
(praef)ECTUS IUDA(ea)e
(ref)E(cit) ((et dedicavit?))«3
gelautet hätte:
»Den Seeleuten hat dieses Tiberieum
Pontius Pilatus,
der Präfekt von Judäa,
wiederhergestellt (und gewidmet?)«
So oder so fällt auf, wie demonstrativ Pilatus sich zusammen mit dem Namen des Kaisers verewigte, als ob er Tiberius um jeden Preis gefallen wollte.
Ein zweiter Sensationsfund wurde erst im Dezember 2018 öffentlich bekannt. Es handelt sich um einen schmalen Bronzering, den der israelische Archäologe Gideon Förster von der Hebräischen Universität Jerusalem 1968 bei Ausgrabungen im Herodium entdeckte. Die Burg des biblischen Königs Herodes (40–4 v. Chr.) wurde in einen künstlich aufgeschütteten Kegelberg hineingebaut, der noch heute weithin sichtbar die Landschaft östlich von Bethlehem überragt. Sie diente im 1. nachchristlichen Jahrhundert der römischen Besatzungsmacht als Verwaltungssitz. Ein halbes Jahrhundert lang lag der Ring unbemerkt unter anderen Fundstücken, dann nahmen ihn israelische Experten erneut unter die Lupe. Mithilfe einer Spezialkamera konnten sie das eingravierte Bild eines Trinkgefäßes ausfindig machen – umgeben von der griechischen Inschrift »πιλατο« (PILATO). Sie sind sich sicher: Entweder muss der Statthalter den Siegelring selbst getragen haben, oder er gehörte einem seiner Beamten, die in seinem Namen siegelten.4»Ich kenne keinen anderen Pilatus aus dieser Zeit und der Ring zeigt, dass er eine Person von Statur und Reichtum war«, erklärte Professor Danny Schwartz von der Hebräischen Universität in Jerusalem.5
Pilatus stammte aus dem Rittergeschlecht der Pontii. Ein Mitglied dieser Familie, L. Pontius Aquilius, war an der Ermordung Julius Caesars beteiligt.6 Sein Vater war wahrscheinlich Marcus Pontius, ein tüchtiger Kommandant, der unter Augustus im Kriegszug gegen die Kantabrer (26–19 v. Chr.) die Heeresleitung innehatte. Für seine Verdienste wurde Pontius mit dem Pilum, dem Ehrenspieß ausgezeichnet, und es ist anzunehmen, dass er seinen Sohn danach benannte. Können wir daraus auch folgern, dass Pilatus kurz nach dem Feldzug, also gegen 18 v. Chr., geboren wurde? Dann wäre er 44 gewesen, als er nach Judäa kam, 48 bei der Verurteilung Jesu, 54, als er nach Rom zurückkehren musste – ein für einen Statthalter durchaus realistisches Alter. Pontius Pilatus war Anhänger des Seianus, des damals mächtigsten Mannes in Rom, der bald zu seinem Fürsprecher wurde. Seine lange Amtszeit, die zweitlängste eines römischen Statthalters in Judäa überhaupt, belegt zwar nicht unbedingt, dass man ihn in Rom als »fähigen und tüchtigen Diplomaten mit taktischem Geschick« schätzte (wie Bösen glaubt)7, sehr wohl aber, dass man sich seiner treuen Untergebenheit und Loyalität sicher war. Die Provinz galt schließlich als äußerst glattes Parkett, seine Einwohnerschaft »als ein seinem Charakter nach schwer zu regierendes und zum Ungehorsam gegen seine Herrscher geneigtes Volk«.8
Dabei machte er sich auf jüdischer Seite zahlreiche Feinde. Philo von Alexandria (ca. 15 v. Chr.–45 n. Chr.), ein Zeitgenosse des Pilatus, beschreibt ihn als »von Natur aus unbeugsam, eigenwillig und unnachgiebig« und wirft ihm »Bestechlichkeit und Gewalttätigkeit ... Räubereien, Misshandlungen, Beleidigungen, fortgesetzte Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren sowie eine unaufhörliche und unerträgliche Grausamkeit« vor. Kurzum, er sei »ein boshafter und unversöhnlicher Mensch«, behauptet Philo. Tatsächlich zeugen die unter Pilatus geprägten Münzen von einer gewissen Provakationslust und römischer Arroganz. Ein Pilatus-Lepton (kleine Kupfermünze) zeigt den Augurenstab (lituus) der römischen Orakelpriester, ein anderer ein Trankopfergefäß (simpulum), also heidnische Kultgegenstände, deren bloßer Anblick jeden frommen Juden brüskieren musste. Dazu passt eine Anekdote, die Philo zum Beweis für seine Anschuldigungen zitiert und die wieder den Übereifer des Präfekten bezeugt. Bei seiner Amtseinführung ließ Pilatus, »um die Volksmenge zu kränken«, im Herodespalast in Jerusalem, den er bezog, vergoldete Schilde mit einer Weiheinschrift anbringen. Die Menge fühlte sich provoziert und sandte eine Delegation aus vier Herodes-Söhnen und anderen Würdenträgern zu Pilatus, die von diesem nur schroff abgewiesen wurde. Erst ein Bittgesuch der Juden an Tiberius hatte Erfolg: Der Kaiser sorgte dafür, dass die Schilde aus Jerusalem entfernt und im Augustustempel von Caesarea aufgehängt wurden.9 Tatsächlich zeigen sich schon in diesem Vorfall Verhaltensmuster des Pilatus, die auch die Evangelien schildern. Erst als die jüdischen Würdenträger ihm drohten: »Wenn du (Jesus) freilässt, bist du kein Freund des Kaisers« (Joh 19,12), gab er nach, weil das seinen wunden Punkt traf. Nicht nur, dass die Gefahr bestand, dass eine zweite Beschwerde bei Tiberius ihn den begehrten Statthalterposten kosten könnte; nein, Pilatus versuchte alles, um ein Freund des Kaisers zu sein, das Wohlwollen des Imperators, den er abgöttisch verehrte, auf sich zu ziehen. Trotzdem reagierte er mit einem störrisch-arroganten »was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben« (Joh 19,22), als die Sanhedrin-Mitglieder den bewusst provokanten Kreuztitel »König der Juden« monierten.
Vielleicht ist der von Philo geschilderte Vorfall identisch mit einem Ereignis, das Flavius Josephus wie folgt beschrieb: »Als der Landpfleger von Judaea, Pontius Pilatus, sein Heer aus Caesarea nach Jerusalem in die Winterquartiere geführt hatte, ließ er, um seine Missachtung gegen die jüdischen Gesetze an den Tag zu legen, das Bild des Caesars (Tiberius) auf den Feldzeichen in die Stadt tragen, obwohl doch unser Gesetz alle Bilder verbietet. Aus diesem Grunde hatten die früheren Landpfleger stets die Feldzeichen ohne derartige Verzierungen beim Einzug der Truppen in die Stadt vorantragen lassen. Pilatus war der Erste, der ohne Vorwissen des Volkes zur Nachtzeit jene Bildnisse nach Jerusalem bringen und dort aufstellen ließ. Sobald das Volk dies erfuhr, zog es in hellen Scharen nach Caesarea und bestürmte den Pilatus viele Tage lang mit Bitten, er möge die Bilder doch irgendwo anders hinbringen lassen. Das gab aber Pilatus nicht zu, weil darin eine Beleidigung des Caesars liege. Als indes das Volk nicht aufhörte, ihn zu drängen, bewaffnete er ab dem siebten Tage in aller Stille seine Soldaten und bestieg eine in der Rennbahn befindliche Tribüne, hinter welcher die Bewaffneten versteckt lagen. Da nun die Juden ihn abermals bestürmten, gab er den Soldaten ein Zeichen, dieselben zu umzingeln, und drohte ihnen mit augenblicklicher Niedermetzelung, wenn sie sich nicht ruhig nach Hause begäben. Die Juden aber warfen sich zu Boden, entblößten ihren Hals und erklärten, sie wollten lieber sterben als etwas geschehen lassen, was der weisen Vorschrift ihrer Gesetze zuwiderlaufe. Einer solchen Standhaftigkeit bei Beobachtung des Gesetzes konnte Pilatus seine Bewunderung nicht versagen und befahl daher, die Bilder sogleich aus Jerusalem nach Caesarea zurückzubringen.«10
Ein anderer Vorfall kostete Pilatus die Statthalterschaft. Im Jahre 36 führte »ein Mensch, der sich aus Lügen nichts machte und dem zur Erlangung der Volksgunst jedes Mittel recht war«, die Bewohner von Samaria auf ihren heiligen Berg Garizim, »und versicherte, er werde dort die heiligen Gefäße vorzeigen, die von Moses daselbst vergraben worden seien«. Die Samariter glaubten diesem falschen Propheten, »ergriffen die Waffen, sammelten sich in einem Dorfe mit Namen Tirathaba und zogen immer mehr Menschen an sich heran, um in möglichst großer Anzahl auf den Berg rücken zu können«.11 Pilatus witterte einen Aufstand und besetzte den Weg zum heiligen Berg mit Reiterei und Fußsoldaten, die die Menschenmenge angriffen. Die große Masse der Versammelten wurde in die Flucht geschlagen, ihre Anführer aber gefangen genommen und hingerichtet. Gegen dieses rabiate Vorgehen protestierte der Hohe Rat der Samariter bei Vitellius, dem Prokurator von Syrien, dem Pilatus als Präfekt untergeordnet war. Vitellius schickte seinen Vertrauten Marcellus nach Judäa und befahl Pilatus, sich unverzüglich nach Rom zu begeben und vor Tiberius zu verantworten. Doch nachdem er die lange und beschwerliche Schiffsreise zurückgelegt hatte, war Tiberius bereits verstorben. Pilatus sollte nie mehr nach Judäa zurückkehren. Der neue Kaiser, Gaius Caligula, ernannte einen neuen Präfekten, Marullus, bis er seinen Jugendfreund Herodes Agrippa I. im Jahre 41 zum König von Judäa krönte. Das Schicksal des Pilatus nach seiner Rückkehr nach Rom ist ungewiss. Der Überlieferung zufolge wurde er nach Vienne in Gallien versetzt oder verbannt. In der Rhone, im Tiber oder im Vierwaldstättersee bei Luzern, wo ein mächtiger Berg noch heute seinen Namen trägt, soll er der Legende nach, von Schuldgefühlen geplagt, im Jahre 39 Selbstmord begangen haben.
Obwohl er im Fall der Samariterunruhen gewiss überreagiert hat, lässt sich aus den überlieferten Vorfällen keineswegs das extrem negative Pilatusbild ableiten, das uns Philo übermittelte. Ja, er war übereifrig und seinen Vorgesetzten in Rom gegenüber übertrieben devot. Seine Untergebenen provozierte er gern, er war störrisch, arrogant, zynisch und griff, wenn er es für notwendig erachtete, hart durch. Heute würde man ihn vielleicht als Prototyp eines Beamten in einem totalitären Regime beschreiben, als »Radfahrer«, der nach oben hin buckelt, nach unten hin trampelt. Aber er zeigte sich auch beeindruckt von der Standhaftigkeit der Juden, die in Caesarea demonstrierten, er ließ einen Aufstand von Jerusalem mit Knüppeln statt mit Schwertern niederschlagen, und Josephus räumt ein, dass die Legionäre dabei bedauerlicherweise »mit größerem Ungestüm, als es in der Absicht des Pilatus lag«, vorgingen. Man hat den Evangelien immer wieder vorgeworfen, aus Anbiederung an Rom die Gestalt des Pilatus verharmlost dargestellt zu haben, aber das kann nur gesagt werden, wenn man Philo allzu wörtlich nimmt. Aus Josephus lässt sich ein derart extremes Pilatusbild jedenfalls nicht ableiten.
Alle historischen Quellen, christliche wie nicht christliche, sind sich darin einig, dass Jesus von Nazaret unter Pilatus wirkte und hingerichtet wurde. Allerdings sind diese Quellen nicht ganz unumstritten. So heißt es bei Josephus: »Um diese Zeit (des Pilatus, Anm. d. Verf.) lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht die Sippe der Christen, die sich nach ihm nennen, fort.«12
Tatsächlich ist dieses kurze Zitat eher fragwürdig, denn wäre es authentisch, könnte das nur bedeuten, dass Josephus selbst ein Christ gewesen ist. »Er war der Christus« ist gleichbedeutend mit dem Bekenntnis »er war der Messias«, denn Christus (Gesalbter) ist nur die griechische Übersetzung des hebräischen »māšiaḥ«. Das aber glaubte der jüdische Historiker keineswegs: Für ihn war der römische Kaiser Vespasian, der Krieg gegen die Juden führte, der Messias. Andererseits ist aber auch eine Fälschung, d. h. spätere Einfügung, auszuschließen, denn zwei Kapitel später ist die Rede von der Verurteilung und Steinigung des Jakobus durch das vom Hohenpriester Ananus geleitete Synhedrium im Jahre 62 n. Chr. Dabei wird Jakobus, ganz in Übereinstimmung mit der Apostelgeschichte, als »Bruder Jesu, der Christus genannt wird«13, bezeichnet, dessen vorherige Erwähnung der Autor also voraussetzte. Zudem zitierte bereits der Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea (260–339) die seither als Testimonium Flavianum (Zeugnis des Flavius) bekannt gewordene Textstelle14, in einem Zeitraum also, als sich das Christentum gerade erst durchzusetzen begann und man sich eine so plumpe Fälschung bei einem so prominenten Autor gewiss nicht leisten konnte. Außerdem entsprechen Formulierungen wie »weiser Mann« und das ironische »die Wahrheit mit Lust aufnehmen« keineswegs christlichem, dafür aber josephianischem Sprachgebrauch. Auch das Wort von der »Sippe der Christen« klingt eher abwertend.
De Aussagen der römischen Historiker wurden, wenngleich grundlos, ebenfalls angezweifelt. Tacitus erwähnt in seinen Annalen die Christen nur, weil Kaiser Nero sie für den Brand von Rom (64 n. Chr.) verantwortlich machte und massenhaft hinrichten ließ. Obwohl er Neros Grausamkeit verurteilt, klagt auch Tacitus sie des »Hasses gegen das Menschengeschlecht« an, weshalb sie »schuldig waren und die härtesten Strafen verdient hatten«. In diesem Kontext, um die Herkunft der »christiani« zu erklären, ergänzt er: »Dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator (sic!) Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Aberglaube war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Greuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden.«15
Sueton lobt in seinen Cäsarenleben Nero sogar für die Christenverfolgung: »Mit Todesstrafen wurde gegen die Christen vorgegangen, eine Sekte, die sich einem neuen, gemeingefährlichen Aberglauben ergeben hatte.« Er weiß aber auch von einer ersten Aktion gegen die Christen unter Neros Vorgänger Claudius, der wahrscheinlich im Jahre 49 n. Chr. ein Edikt gegen die jüdische Gemeinde in Rom erließ, zu der offensichtlich schon die ersten Christen gehörten: »Die Juden, die, von Chrestus aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten, vertrieb er aus Rom.«16 Anders als Tacitus wusste Sueton offenbar nicht, woher die Christen ihren Namen hatten. Da Chrestus (Nützlicher) ein häufiger Sklavenname war, schlussfolgerte er, ein solcher müsse der Anführer der Unruhestifter gewesen sein. Ebenso unwissend war Plinius der Jüngere (61–120), der von Kaiser Trajan im Jahre 111 als kaiserlicher Legat in die Provinz Bithynien und Pontus geschickt wurde und in Rom anfragte, wie er dort mit den Christen zu verfahren habe. Nur soviel konnte er von ihnen in Erfahrung bringen: »daß sie gewöhnlich an einem festgesetzten Tag vor Sonnenaufgang sich versammelt, Christus als ihrem Gott mit Wechsel lobsungen und sich mit einem Eid verpflichtet hätten, nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen, sondern zur Unterlassung von Diebstahl, Raub, Ehebruch, Treulosigkeit und Unterschlagung von anvertrautem Gut.«17
Auch jüdische Quellen sind kaum ergiebiger. »Am Vorabend des Pessachfestes hängte man Jeshu«, stellt lakonisch der Talmud fest, nicht ohne anzumerken, dass dies alles nach einem ordentlichen Gerichtsverfahren vor dem Hohen Rat, dem Sanhedrin, geschah: »Vierzig Tage vorher hatte der Herold ausgerufen: Er wird zur Steinigung herausgeführt, weil er Zauberei getrieben und Israel verführt und abtrünnig gemacht hat; wer etwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, der komme und sage es. Da aber nichts zu seiner Verteidigung vorgebracht wurde, so hängte man ihn am Vorabend des Pessachfestes.«18 Einige Forscher halten diese Tradition für sehr alt und datieren sie in das frühe zweite Jahrhundert, als sich das Judentum nach der großen Niederlage des Jahres 70 n. Chr. und der Zerstörung des Tempels durch die Römer neu zu definieren begann. Natürlich wurde Jesus nicht gesteinigt, weil die jüdischen Autoritäten zur Zeit der römischen Besatzung nur in Ausnahmefällen Todesurteile vollstrecken durften. Trotzdem ist anzunehmen, dass er von den Mitgliedern des Sanhedrins (oder Synhedriums) der Gotteslästerung angeklagt wurde, auf die nach den mosaischen Gesetzen die Steinigung stand – eine Strafe, die die Römer nicht kannten. Um seine Hinrichtung zu bewirken, bezichtigte ihn die Tempellobby unter dem Hohenpriester Kaiapas (oder Kajaphas) stattdessen des politischen Aufruhrs und verwies darauf, dass seine Anhänger ihn für den Messias, den König der Juden hielten. Daraufhin wurde Jesus gehängt, d. h. gekreuzigt. Tatsächlich bestätigen die Evangelien indirekt, dass die Anklage durch die Sanhedrinmitglieder gründlich vorbereitet war, möglicherweise sogar, wie es das Gesetz vorschreibt, vierzig Tage lang. So erwähnen Matthäus (26,60f.) und Markus (vgl. 14,55–59), dass man »viele falsche Zeugen« zur Vernehmung im Haus des Hohenpriesters bestellt hatte, ebenso wie sie beide – und auch Lukas (22,2) – betonen, dass schon lange vor dem Paschafest »die Hohenpriester und Schriftgelehrten … nach einer Gelegenheit (suchten), ihn beseitigen zu können«.
Was hatten »die Juden von der Hinrichtung ihres weisen Königs, da ihnen von jener Zeit an das Reich weggenommen war?«19, fragte schließlich – um den Reigen zeitgenössischer Hinweise auf Jesus abzuschließen – der syrische Philosoph Mara Bar Sarapion, ein Stoiker des 1. Jahrhunderts, in einem nach Expertenmeinung kurz nach 73 n. Chr. verfassten Brief. Es ist vielleicht die eindrucksvollste Referenz. Ein gelehrter Heide hatte nicht nur von Jesus gehört und ihn ganz offensichtlich bewundert, er maß seinem Tod sogar eine solche Bedeutung zu, dass er die Katastrophe des Jahres 70 für eine Art göttliches Strafgericht hielt.
So gut dokumentiert die historische Existenz Jesu durch diese zeitgenössischen Quellen ist, so unbefriedigend sind sie in ihrer Aussagekraft. Mehr als die Tatsachen, dass
• er zu Lebzeiten »unglaubliche Taten vollbrachte« und lehrte und für einen Weisheitskönig oder den Messias gehalten wurde;• er zur Zeit des Kaisers Tiberius unter dem Statthalter Pontius Pilatus, d. h. irgendwann zwischen 26 und 36 n. Chr., auf Betreiben der Hohenpriester in Jerusalem unter dem Vorwurf der Zauberei und Volksverführung am Vorabend des Paschafestes gekreuzigt wurde;• seine Anhänger ihm treu blieben, seine Lehre in der ganzen Welt verbreiteten und dabei sogar nach Rom kamen,können wir ihnen nicht entnehmen.
Eben diese Fakten stehen nicht im Widerspruch zu den Evangelien, im Gegenteil, sie scheinen diese zu bestätigen. Wie zuverlässig jedoch sind diese Frohbotschaften – so die wörtliche Übersetzung des Griechischen »euangélion« – als historische Quellen, ja gewissermaßen als Jesusbiographien? Gar nicht, behaupten die Kritiker. »Sie sind Theologie und nicht Geschichte«20, versichert Peter de Rosa, Autor des Bestsellers Der Jesus-Mythos. Aber wurde diese Theologie nicht dadurch vermittelt, dass das authentische Lebensbild ihres Urhebers dargestellt wurde? Auch die Pythagorasbiographie des Jamblichos war in erster Linie ein Versuch, die Philosophie des großen Griechen zu vermitteln und ihn zum Ahnherrn einer neuen philosophischen Richtung, des Neuplatonismus, zu erklären. Trotzdem bemühte sich ihr Autor, den Lebensweg des Weisen von Samos, soweit dies nach 900 Jahren noch möglich war, zu rekonstruieren. Hätten es sich dann die Evangelisten, die allesamt ihre Lebensbilder unbestritten im Jahrhundert Jesu verfassten, überhaupt erlauben können, historische Realitäten zu verfälschen? Wären sie damit nicht automatisch Zielscheibe von Angriffen der schon damals so zahlreichen Kritiker und erklärten Gegner der neuen Religion geworden?
Tatsächlich stellten die Gegner der Christen zwar die Glaubwürdigkeit einzelner in den Evangelien geschilderter Ereignisse, insbesondere Jesu Wunder und die Offenbarung seiner Gottessohnschaft, nie aber deren Gesamtbild infrage. Ein Beispiel für diese Diskussion ist der schriftliche Dialog zwischen Celsus, einem Anhänger der alten griechischen Philosophen, und dem Kirchenvater Origenes, der zwischen 177 und 180 n. Chr. stattfand. Celsus verteidigte seine »uralte Lehre, die von Urbeginn an existierte« gegen das »neuerlich aufgekommene« Christentum. Obwohl das Werk des Celsus, Die wahre Lehre, nicht erhalten ist, können wir uns durch die Antwort des Origenes ein Bild von seiner Argumentation machen. So lässt Celsus einen Juden zu Jesus sagen: »Als Du bei Johannes gebadet hast (zum Zeitpunkt Deiner Taufe), sagst Du, Du hättest etwas gesehen, was ein Vogel zu sein schien, der aus der Luft auf Dich zuflog. Welcher glaubwürdige Zeuge sah diese Erscheinung, oder wer hat eine Stimme aus dem Himmel gehört, die Dich als Sohn Gottes adoptierte? Es gibt keinen Beweis außer Deinem Wort und das Zeugnis, das Du anführen könntest, von einem der Männer, die mit Dir bestraft wurden.«21
Celsus bleibt also unbeeindruckt von dem Augenzeugenbericht eines Jüngers und verlangt nach unabhängigen Zeugen. Origenes gesteht ein, »daß der Versuch, nahezu jede Geschichte als historische Tatsache zu bestätigen, selbst wenn sie wahr ist, und vollständige Sicherheit darüber zu gewinnen, eine der schwierigsten Aufgaben ist und in einigen Fällen geradezu unmöglich«. Celsus zweifelt zwar die historische Objektivität der vier Evangelisten an, doch er hätte es nie gewagt, die historische Existenz Jesu oder den Biographiecharakter der Evangelien infrage zu stellen. Unbestritten gehören die Evangelien in die biographische Tradition der Antike. So erklärt auch der Formgeschichtler Klaus Berger: »Die hellenistische Biographie ... ist so vielgestaltig, daß auch die Evangelien darin Platz haben könnten.«22 Bereits 1915 stellte Clyde Weber Votaw fest, dass die Evangelien in Stil und Aufbau der »populären griechisch-römischen biographischen Literatur«23 entsprechen. Nach Graham Stanton ist für diese charakteristisch, dass all jene Elemente, die wir heute für wichtig halten, wie die Chronologie und die Entwicklung des psychologischen Charakters des Helden, in ihnen fehlen. Dass die Evangelien »in der Art antiker Biographien geschrieben« sind, hat auch der Theologe Richard Burridge, Dekan des King’s College in London, in einer umfangreichen Studie nachgewiesen. Um zu diesem Schluss zu kommen, analysierte er zehn klassische antike Lebensbilder24 und verglich sie in Form, Aufbau und Aussage mit den Evangelien. »Die Alten hatten ein wesentlich größeres Interesse an der symbolischen oder psychologischen Bedeutung des Lebens«, stellte er fest. Auch ein Tacitus, Sueton oder Flavius Josephus beschreibt weder das Aussehen seiner Protagonisten noch die Momentaufnahmen ihres Lebens, die einen modernen Biographen interessieren würden; ihm kommt es eher darauf an, aus ganz wenigen, aber signifikanten Stationen und längeren Mono- oder Dialogen ein Fazit zu ziehen oder durch sie ein Charakterbild des Betroffenen zu entwickeln. Zudem nehmen bei fast allen antiken Viten die letzten Ereignisse im Leben des Helden den meisten Raum ein, bei Plutarch 17,3 Prozent, bei Cornelius Nepos 15 Prozent, bei Tacitus 10 Prozent, bei Philostratos 26 Prozent. Da kommt den Evangelien, bei denen der Passion Jesu zwischen 15 Prozent (Lukas, Matthäus) und 19,1 Prozent (Markus) gewidmet sind, ein guter Mittelplatz zu.25
Ebenso selektiv, wie die antiken Biographen Szenen aus dem Leben ihrer Helden auswählten, um an diesen ihr Denken und Sein aufzuzeigen, gingen die Evangelisten vor, die ihrem spezifischen Publikum die Essenz des Lebens und der Lehre Jesu vermitteln wollten. Eben das ist kein Widerspruch, sondern ein Versuch, »eine wahrhaftigere Wahrheit, als Fakten es jemals könnten, zu vermitteln«. Zweifellos ist jedes Evangelium eine Interpretation der Gestalt Jesu. Doch obwohl jeder der vier Evangelisten die Ereignisse des Lebens Jesu auf seine ganz eigene Art schildert, erzählen sie doch im Wesentlichen die gleiche Geschichte.26 Und schließlich gilt: »Die christliche Urgemeinde hätte die Evangelien nicht als ›Viten‹ erstellt, wenn sie nicht an der geschichtlichen Person Jesu interessiert gewesen wäre, die Quelle und Fundament für das Vorhandensein von Glaube, Gebet, Sendung, Dienst und Zeugnis ist.«27
Trotzdem ist immer wieder versucht worden, den Wahrheitsgehalt der Evangelien infrage zu stellen. Mit dem Zeitalter der Aufklärung begann die Geschichte der kritischen Leben-Jesu-Forschung. 1774–78 veröffentlichte G. E. Lessing die Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes des Hamburger Orientalisten Hermann Samuel Reimarus (1694–1768), der die Beschäftigung mit dem Leben Jesu unter rein historischen Gesichtspunkten forderte. Dazu gehörten, so Reimarus,
• die Unterscheidung der Verkündigung Jesu vom Christusglauben der Apostel;• die historische Erkenntnis, dass die Verkündigung Jesu nur aus dem Kontext der jüdischen Religion seiner Zeit heraus zu verstehen ist;• die Erkenntnis der Diskrepanz zwischen der politisch-messianischen Botschaft Jesu und dem Auferstehungsglauben der Jünger, der, wie Reimarus folgert, auf einen Betrug, d. h. auf das Stehlen der Leiche des Gekreuzigten, zurückgehen würde.28Wie so viele nach ihm, ließ sich auch Lessing von Reimarus überzeugen, dass sich zwischen Geschichte und Glauben »ein garstig breiter Graben« aufgetan hatte.
Während die Betrugshypothese immer wieder von Skeptikern aufgegriffen wurde – mit entsprechenden Wandlungen wie der, Jesus hätte die Kreuzigung überlebt und wäre nach Indien geflohen –, prägten die ersten beiden Reimarus-Prämissen fortan die Diskussion unter kritischen deutschen Theologen meist protestantischer Konfession.
Das vielleicht einflussreichste Manifest der Rationalisten war Das Leben Jesu des Philosophen und Theologen David Friedrich Strauß, das 1835/36 veröffentlicht wurde. Für Strauß sind die Evangelien Mythen, die rationalistisch interpretiert werden müssten. Überall, wo in den Evangelien die Naturgesetze außer Kraft gesetzt scheinen, sich die Überlieferungen widersprechen oder Ereignisse als Erfüllung alttestamentlicher Prophezeiungen gedeutet werden, ist der Mythos, »die absichtslos dichtende Sage«, am Werk, behauptete Strauß.29 Auf Hunderten von Seiten versuchte er, die Wunder Jesu zu erklären und darzulegen, weshalb ihre Schilderung nichts weiter als ein Versuch der frühen Christen sei, ihrer Umwelt mitzuteilen, wie heilbringend Jesu Wirken gewesen sei. Insbesondere das Johannesevangelium lehnte Strauß aufgrund seiner theologischen Prämissen als historische Quelle ab. Noch in unserer Zeit folgt de Rosa fast vollständig seiner Argumentation.30
Ihre Blütezeit erlebten der theologische Liberalismus und die von ihm gestellte Frage nach dem historischen Jesus während des Wilhelminischen Kaiserreiches. Sein Ziel war es, alle Christusdogmen hinter sich zu lassen und den »wahren Jesus« durch eine historisch-kritische Rekonstruktion seiner Lehren wiederzufinden. Durch eine solche »Rückbesinnung auf die eigentliche Quelle des Christentums« glaubte man, den christlichen Glauben erneuern oder zumindest besser dem Zeitgeist anpassen zu können. Eine entscheidende Frage war dabei die nach dem ältesten Evangelium, das man auch für das am ehesten authentische hielt. Schon 1776 hatte Johann Griesbach31 versucht, eine Synopse der Evangelien zu schreiben und dabei bemerkt, dass sich die Texte des Matthäus, Markus und Lukas ziemlich ähneln, während das vierte Evangelium des Johannes ein weitgehend eigenständiger, oft sogar grundverschiedener Text mit einem ganz speziellen Jesusbild ist. Daher stellte er nur die ersten drei Evangelien einander gegenüber, um einen Vergleich zu ermöglichen, und klammerte das vierte aus. Matthäus hielt er für das früheste der drei synoptischen Evangelien und Markus für dessen verkürzte Zusammenfassung. Erst 1835 bemerkte Karl Lachmann32, dass Matthäus und Lukas in der Anordnung ihres Materials nur dann übereinstimmen, wenn sie Markus folgen, während sie stark voneinander abweichen, wenn es um nicht markinische Aussagen geht. Speziell Matthäus schien sich einer Sammlung von Aussagen Jesu bedient zu haben, die Markus nicht kannte. Daraus schlussfolgerte Christian Wilke 1838 die Priorität des Markus33: Markus war das älteste Evangelium, Matthäus und Lukas schöpften aus dieser Quelle und benutzten sie als Grundlage für ihre durch eigenständige Traditionen erweiterten Texte. Christian Weise schließlich formulierte ebenfalls 1838 eine Zwei-Dokumenten-Hypothese: Neben dem Markusevangelium müssen Matthäus und Lukas noch über eine zweite schriftliche Quelle verfügt haben, eine Sammlung von Aussagen Jesu.
Diese Theorie stieß nicht sofort auf die Gegenliebe der meisten Theologen. Schon in der frühen Kirche galt das Matthäusevangelium als das älteste, zudem erschien das matthäische Jesusbild klarer und besser in den jüdischen Kontext eingearbeitet. Trotzdem sprach viel für die Zwei-Quellen-Theorie, der schließlich der einflussreiche deutsche Theologe Heinrich Julius Holtzmann (1832–1910) zum Durchbruch verhalf.34 Damit galten Markus und die Redensammlung (»Logien«), die bald als Quelle (Q) bezeichnet wurde, als die ältesten und am ehesten authentischen Zeugnisse vom historischen Jesus. Matthäus und Lukas wurden zu Kompositeuren neuer Jesus-Symphonien erklärt, Johannes ganz außer Acht gelassen. Das vierte Evangelium, so war man sich bald einig, »(nimmt) aus verschiedenen Gründen eine Sonderstellung ein und (eignet) sich am wenigsten als historische Quelle«, wie der Religionspädagoge Gerd Laudert-Ruhm noch 1996 behauptete.35
Tatsächlich spricht einiges für die Zwei-Quellen-Theorie. In den Evangelien von Matthäus und Lukas finden wir 230 Sprüche Jesu, die Markus nicht zu kennen scheint. Matthäus webt sie elegant in seinen Text ein, während Lukas sie in Blöcken präsentiert, doch 85 Prozent von ihnen – so der Theologe Johann Kloppenburg – werden in derselben Reihenfolge zitiert.36 So war es 1907 dem Kirchenhistoriker Adolf von Harnack möglich, Die Reden Jesu zu identifizieren und in einem kleinen Buch – quasi einem fünften Evangelium – zu veröffentlichen.37
Trotzdem unterlag Holtzmann einem tragischen Fehlschluss: Er reduzierte sein Bild von Jesus auf diese beiden zeitlich frühesten Quellen und vergaß dabei, dass eine Erweiterung auch eine Bereicherung und eine spätere Darstellung eines Ereignisses durchaus die vollständigere sein kann. Er versuchte, aus seiner Theorie von der Priorität des Markusevangeliums eine kritische Biographie Jesu zu entwickeln. Aus dieser quellenkritischen Analyse entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten die moderne Leben-Jesu-Forschung, die eigentlich immer auf dasselbe hinausläuft: Ein revidiertes, d. h. meist auf das vermeintlich Wesentliche reduziertes Jesusbild zu präsentieren, dessen Lücken nach Belieben ergänzt werden. Die Folge ist, dass sich in ihm letztlich immer das Persönlichkeitsideal seines Verfassers widerspiegelt, der schließlich glaubt, unterscheiden zu können, was Jesus wirklich gesagt hat und was nicht. Diese Tendenz zur Projektion prangerte Albert Schweitzer – der spätere »Urwald-Doktor« – 1906 in seiner viel beachteten Geschichte der Leben-Jesu-Forschung an. So machten fortan Autoren aus dem Mann aus Nazaret abwechselnd einen radikalen Sozialreformer, Freiheitskämpfer und politischen Rebell, einen jüdischen Ethiker, Wandercharismatiker oder Propheten, einen hellenistisch geprägten, stoischen Kyniker, ägyptischen Magier oder einen buddhistischen Wandermönch.38 Der neue, entchristianisierte Jesus war so blass und fleischlos, dass er als Schablone für jedes gewünschte theologische Abenteuer herhalten konnte, wie es Albert Schweitzer so treffend in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung feststellt: »Es ist der Leben-Jesu-Forschung merkwürdig ergangen. Sie zog aus, um den historischen Jesus zu finden, und meinte, sie könnte ihn dann, wie er ist, als Lehrer und Heiland in unsere Zeit hineinstellen. Sie löste die Bande, mit denen er seit Jahrtausenden an den Felsen der Kirchenlehre gefesselt war, und freute sich, als wieder Leben und Bewegung in die Gestalt kam und sie den historischen Menschen Jesus auf sich zukommen sah. Aber er blieb nicht stehen, sondern ging an unserer Zeit vorüber und kehrte in die seinige zurück.«39 Nichtsdestotrotz fiel auch Schweitzer dieser Versuchung zum Opfer. Für ihn hat »der Jesus von Nazareth ... der die Ethik des Königreiches Gottes predigte, der das himmlische Königreich auf Erden begründete, nie existiert«. Stattdessen sei Jesus ein apokalyptischer Prophet gewesen, der seinem eigenen Irrtum zum Opfer fiel.40
Seit Mitte der 1960er-Jahre setzte sich die Formgeschichte der Evangelien mit ihrem traditionsgeschichtlichen und redaktionsgeschichtlichen Zweig auch in der katholischen Universitätstheologie durch. Sie geht ursprünglich auf die Theologen Martin Dibelius (1883-1947) und Rudolf Bultmann (1894–1976) zurück, die annahmen, dass die Urkirche (vor dem Jahr 70) keiner Evangelien bedurfte, weil sie von der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi ausging. Einzig über eine Logiensammlung, einige Beispielerzählungen und einen sehr kurzen Kreuzigungsbericht habe man verfügt. Die Form und der inhaltliche Hauptbestand der Evangelien sei erst viele Jahre nach der Verkündigung durch die Apostel entstanden: Markus nach 70, Matthäus und Lukas nach 80, Johannes gar erst nach 90, wobei die Zuschreibungen eines Verfassers bloß dem Zweck dienten, den anonym entstandenen Werken den Anschein von Authentizität zu verleihen. Zu diesem Zeitpunkt sei eine wirkliche Erinnerung an den historischen Jesus weitgehend verloren gegangen, an seine Stelle sei der kerygmatische Jesus, der Christus der Verkündigung, getreten. Dabei sei auch die Lehre der Apostel bereits synkretistisch verfremdet worden, während es ursprünglich unüberbrückbare Differenzen zwischen der Lehre des Petrus und der des Paulus gegeben habe. Der Jesus des Petrus sei der jüdische Messias, der des Paulus ein hellenistischer Gottessohn gewesen, um den die entsprechenden Wundergeschichten gewoben wurden.41 Der Inhalt der Evangelien, so die Formgeschichtler, sei weitgehend durch den »Sitz im Leben«, also akute Probleme der jeweiligen Gemeinde, bestimmt worden.
Die Enthistorisierung des biblischen Jesus war dabei durchaus dem Zeitgeist geschuldet. Auch wenn Bultmann kein aktiver Nationalsozialist war und zeitweise sogar der Bekennenden Kirche angehörte, stand er doch dem Philosophen Martin Heidegger nahe, einem Mitglied der NSDAP, glühenden Verehrer des braunen Regimes und Mitunterzeichner des Bekenntnisses der deutschen Professoren zu Adolf Hitler (1933). Einerseits hielt Bultmann Christentum und Nationalsozialismus für unvereinbar. Doch allein die Tatsache, dass er ungehindert bis zum Kriegsende in Marburg evangelische Theologie lehrte, zeugt davon, dass er auch keinen Widerstand leistete, ja sich mit den Machthabern arrangierte. Sein Jesus, der eben nicht mehr der Sohn (des jüdischen) Gottes war, sondern ein eschatologischer Wanderprediger und politischer Revolutionär, passte zum Jesusbild der Nationalsozialisten, die ihn kurzerhand zum Abkömmling arischer Galiläer und »Kämpfer gegen den Materialismus seiner Zeit und damit gegen die Juden« (so Hitler wörtlich) erklärten.42 Denn ein enthistorisierter Jesus war auch ein entjudaisierter Jesus und Projektionsfläche für jede zeitgeistgemäße Deutung. Mit dem Jesus des christlichen Glaubens dagegen hatte Bultmanns Kunstgestalt, wie er sie 1941 in seinem Vortrag Neues Testament und Mythologie skizzierte, wenig zu tun. »Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben«, erklärte er seinen Studenten: »Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht.«43 Gottesoffenbarungen und übernatürliche Eingriffe durfte es nach dieser Denkart nicht geben, und so wurde Jesu Prophezeiung von der Zerstörung des Jerusalemer Tempels (Mt 24,1–3; Mk 13,1–4; Lk 21,5–7) im Jahre 70 zum Hauptkriterium für eine so späte Datierung der Texte.
Dabei vergessen die Formgeschichtler, dass Voraussagen von der Zerstörung des Tempels seit alttestamentlicher Zeit quasi zum Repertoire einer jeden Endzeit-Prophezeiung gehörten. Auch die Voraussage einer Belagerung von Jerusalem und der Einschließung durch Wälle finden wir schon bei Jesaja (29,1–3), Ezechiel (4,2) und ähnlich bei Jeremia (6,6). Flavius Josephus erwähnt in seiner Geschichte des Jüdischen Krieges einen »gewissen Jesus, des Ananus Sohn, ein ungebildeter Landmann«, der »vier Jahre vor dem Ausbruch des Krieges, als die Stadt sich noch tiefen Friedens und großen Wohlstandes erfreute« – also im Jahre 62 –, zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kam, um plötzlich mit lauter Stimme zu verkünden: »Wehe über Jerusalem und den Tempel!« Tag und Nacht ließ er sein Wehgeschrei ertönen, in allen Straßen und Gassen der Stadt, bis es einigen vornehmen Bürgern der Stadt zu bunt wurde. Er wurde erst ergriffen und zusammengeschlagen, dann, als er trotzdem weitermachte, vor den römischen Landpfleger Albinus (62–64) gezerrt. Dieser verfuhr zunächst einmal ganz so wie 32 Jahre zuvor Pilatus: Er ließ den Propheten geißeln. Doch auch »bis auf die Knochen durch Geißelhiebe zerfleischt« flehte Jesus Ben Ananus nicht um Gnade, antwortete auch nicht auf die Fragen des Statthalters, sondern fuhr fort zu rufen: »Wehe, Jerusalem!« Schließlich war Albinus überzeugt, dass er einen Irren vor sich hatte, und ließ den Klagerufer laufen. Sieben Jahre lang setzte dieser seine gellenden »Wehe der Stadt, dem Volke und dem Tempel«-Rufe fort, bis er schließlich, bei der Belagerung von Jerusalem, von einem Stein aus einer römischen Wurfmaschine getroffen wurde und tot zu Boden fiel.44 Wir haben keinen Grund, Josephus diese bizarre Anekdote um einen prophetischen Sonderling, die er selbst als unheimlich beschreibt, nicht zu glauben. Doch wir fragen uns, weshalb Jesus von Nazaret eine prophetische Gabe abgestritten wird, die man dem Jesus Ben Ananus zubilligt. Dabei vergessen die Formgeschichtler jedoch einen ganz entscheidenden Punkt: In der Endzeitvision Jesu gehen die Tage der großen Not (Mt 24,29–31; Mk 13,24–27) der Wiederkunft des Menschensohnes »mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels« (Mt 24,30) unmittelbar voraus. Da aber dies nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 eben nicht der Fall war, ist auch nicht anzunehmen, dass die synoptischen Evangelien so spät verfasst wurden. Sie hätten damit ja selbst die von ihnen so kunstvoll konstruierte Prophezeiung widerlegt. Daher ist vielmehr anzunehmen, dass die Evangelien zu einem Zeitpunkt entstanden, als die prophezeiten Ereignisse noch in einiger Ferne lagen; schließlich prophezeite Jesus auch: »Aber dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen« (Mt 24,14; vgl. Mk 13,10). Eben davon war man im Jahre 70 noch weit entfernt.
Mitte der 1990er-Jahre trat der Paderborner Papyrologe Carsten Peter Thiede45 an die Öffentlichkeit und behauptete, Fragmente von gleich zwei zeitgenössischen Evangelienhandschriften »aus der Zeit der Augenzeugen« identifiziert zu haben. Dabei handelt es sich zum einen um drei winzige Papyrusstücke, die im Oxforder Magdalen College aufbewahrt werden und Worte aus dem 26. Kapitel des Matthäusevangeliums enthalten. Sie wurden 1901 von Charles Huleatt, einem jungen Kaplan, in Ägypten erworben und von ihm an das College geschickt, an dem er studiert hatte. Die Fragmente waren beidseitig beschriftet und stammten daher nicht von einer Schriftrolle, sondern von einem Kodex, einem Buch also. Da man glaubte, dass sich die frühen Christen erst gegen Ende des 2. Jahrhunderts der Kodex-Form bedienten, wurden die Bruchstücke in eben diesen Zeitraum datiert. Thiede dagegen, ein renommierter Papyrologe, wies nach, dass der Schriftstil des Magdalen-Papyrus einer Zierschrift des ersten Jahrhunderts, dem sogenannten Häkchenstil, entspricht. Mit diesem Argument plädierte er für eine frühe Datierung: Die Evangelienfragmente, so ist er überzeugt, stammen aus der Zeit vor 70 n. Chr. Damit würden sie nicht nur von der frühesten uns bekannten Handschrift des Matthäusevangeliums stammen, sie würden auch belegen, dass dieses Evangelium innerhalb von 40 Jahren nach der Kreuzigung Jesu niedergeschrieben und offenbar in der ganzen antiken Welt verbreitet wurde – und dass sein Verfasser entweder selber ein Augenzeuge des Lebens Jesu war oder Kontakt mit solchen Zeugen hatte.
Noch älter, und das unbestreitbar, ist ein Papyrusfragment, das in einer der Höhlen von Qumran am Toten Meer gefunden wurde, und das vor Thiede bereits der spanische Papyrologe und Herausgeber der Palau-Ribes-Sammlung, José O’Callaghan – seine Vorfahren stammten aus Irland –, als Fragment des Markusevangeliums (Mk 6,52–53) identifizierte. Es ist im Gegensatz zu den meisten anderen Qumran-Schriften nicht in hebräischer oder aramäischer Sprache verfasst, sondern in Griechisch.46 Ein zerbrochener Tonkrug, der in unmittelbarer Nähe des Fragments gefunden wurde und einst zur Aufbewahrung von Schriftrollen diente, trägt gleich zweimal die hebräische Transkription des Wortes Rom(a). War damit der Ursprung der Papyri angezeigt? Tatsächlich behauptet die christliche Tradition, dass das Markusevangelium in Rom niedergeschrieben wurde.47