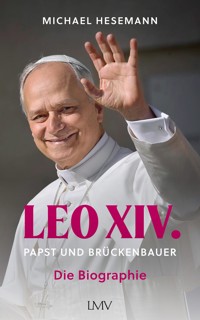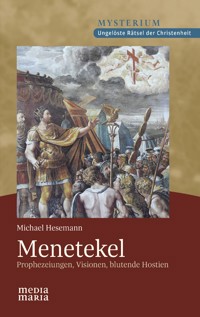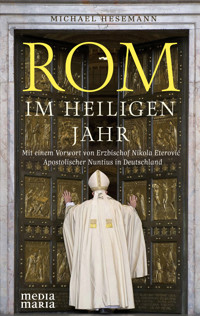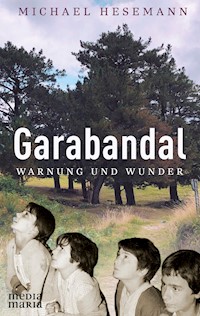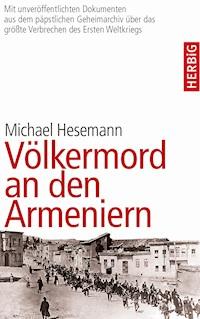4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit dem 'Kardinal der Armen', Jorge Mario Bergoglio, hatte niemand gerechnet. Wer ist dieser bescheidene Argentinier, der lieber mit dem Bus fährt als in der Limousine? Anhand von Gesprächen mit Kardinälen der Kurie und Weggefährten von Papst Franziskus beleuchtet der Journalist und Historiker Michael Hesemann Herkunft, Werdegang und Leitgedanken des nächsten geistlichen Hirten von 1,2 Milliarden Katholiken. Wird Papst Franziskus den Kurs seines Vorgängers Benedikt XVI. fortsetzen, dessen Rücktritt die Welt in Erstaunen versetzt hat? Als Vertrauter von Georg Ratzinger stellt Hesemann die wahren Hintergründe von Benedikts Amtsverzicht dar und schildert die Übergangszeit bis hin zur Wahl des Nachfolgers. Ausführlich würdigt er das Pontifikat des deutschen Papstes und umreißt nochmals dessen geistiges Erbe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Michael Hesemann
Papst Franziskus
Das Vermächtnis Benedikts XVI. und die Zukunft der Kirche
Mit 16 Abbildungen
Herbig
Abbildungsnachweis:
L’Osservatore Romano, Vatikanstadt: 1-4, 7, 10-11, 14–16
Picture alliance/dpa: 5
Mark Gatt, Malta/O.R.: 6
Michael Hesemann: 8-9
Yuliya Tkachova: 12
Rabbi Abraham Skorka: 13
Dem Papst der Demut, Benedikt XVI., in Dankbarkeit
www.herbig-verlag.net
© für die Originalausgabe und das eBook: 2013 LangenMüller in der
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: dpa picture-alliance, Frankfurt
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-7766-8179-6
Inhalt
Einleitung
I. »Habemus Papam!«
II. Ein Jesuit namens Franziskus
III. Ein römischer Frühling
IV. Der Mann, der nie Papst werden wollte
V. Der Paulus-Papst
VI. Das Pontifikat der Versöhnung
VII. Reformer Ratzinger: Der unverstandene Papst
VIII. Das Erbe Benedikts XVI.
IX. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel
Intermezzo I.: Interview mit HH Prälat Dr. Georg Ratzinger
X. Vom Ende der Welt
XI. Die Zukunft der Kirche
Intermezzo II.: Gespräch mit Maria Elena Bergoglio
XII. Das Zeichen des Franziskus
Bildteil
Dank
Literatur
Einleitung
Die Ereignisse des »römischen Frühlings« von 2013 haben die Kirche verändert. Es war bereits von einer »stillen Revolution« die Rede. Seitdem blicken 1,2 Milliarden Katholiken und mit ihnen die ganze Welt auf den Mann, der jetzt seit fast einem Vierteljahr als Nachfolger Petri waltet – und sich lieber »Bischof von Rom« als »Papst« nennt. Mit seiner spontanen Herzlichkeit und demonstrativen Bescheidenheit hat Franziskus die Herzen der Menschen erobert, und das ist gut so. Denn seine Vision einer entweltlichten Kirche, eher nach dem Vorbild der frühen Christen als in der Tradition der mächtigen Herrscher über den Kirchenstaat, fasziniert. Und viele glauben, dass es genau das ist, was im dritten Jahrtausend gebraucht wird: neue Glaubwürdigkeit nach den Skandalen der letzten Jahrzehnte, Nähe zu den Menschen, konsequente, kompromisslose Nachfolge Christi.
Doch wer ist dieser geheimnisvolle Mann vom »Ende der Welt«, der jetzt die Kirche führt und dabei sein Hirtenamt so ernst nimmt? Das gute Dutzend von Biografien, das in den letzten zwei Monaten auf den Markt geschwemmt wurde, gibt oft nur widersprüchliche Antworten. Wie können sie auch ein tieferes Bild bieten, wurden sie doch zu einem großen Teil gleich in der Woche nach seiner Wahl geschrieben, als Gerüchte kursierten, überzogene Hoffnungen vieler und unbegründete Sorgen weniger die Diskussion bestimmten? Praktisch nur drei der ersten Titel haben dauerhaften Wert: die Chronik der Papstwahl des Radio Vatikan-Redakteurs Stefan von Kempis, Sergio Rubins Interviewband El Jesuita (dt.: Papst Franziskus. Mein Leben, mein Weg) und Über Himmel und Erde, das, ein kleine Sensation für sich, der heutige Papst zusammen mit einem Rabbi aus Buenos Aires schrieb. Doch auch sie sind nicht in der Lage, die zentrale Frage zu beantworten, die uns alle bewegt: Wohin wird Franziskus die Kirche führen? Das können, das wollen diese drei Titel auch gar nicht; das erste Buch versteht sich als Bildchronik, die beiden anderen entstanden Jahre vor der Wahl Jorge Mario Bergoglios zum Papst.
Insofern erhebt das vorliegende Buch einen bislang einmaligen Anspruch. Es basiert nicht nur auf einer Analyse der ersten 60 Tage seines Pontifikats, sondern vor allem auf meinen Begegnungen mit vieren seiner engsten Freunde und Wegbegleiter, die ich in Rom und Buenos Aires interviewen konnte: seine Schwester Maria Elena Bergoglio, seinen Mitbruder Pater Peter Gumpel S.J., seinen vielleicht wichtigsten Freund, Rabbi Abraham Skorka, und seinen ehemaligen Pressesprecher Pater Guillermo Marcó. Auch auf diesem Wege möchte ich diesen vieren für ihre bewegenden Zeugnisse danken.
Als Historiker weiß ich, dass nur prognostizieren kann, wer die Vergangenheit kennt. »It is difficult to prophecy, especially the future« (»Es ist schwierig, etwas zu prophezeien, insbesondere die Zukunft«) lautet ein altes chinesisches Sprichwort. Trotzdem trägt dieses Buch dazu bei, die Zukunft zu erahnen, indem wir die Vergangenheit verstehen. Dazu aber haben wir drei Schlüssel: die gewiss turbulenten Ereignisse der letzten Monate, alles, was wir über Jorge Mario Bergoglio wissen, und das Pontifikat seines großen Vorgängers. Um eben diese drei Themen geht es auf den nächsten Seiten. Dabei gilt es auch, das Erbe Benedikts XVI. neu zu entdecken, das einen Franziskus erst möglich gemacht hat. Genau hier aber begegnen wir dem größten Missverständnis des neuen Pontifikats: dem Irrtum, es habe ein Bruch stattgefunden.
Wer Papst Franziskus für einen Revolutionär hält, der hat Benedikt XVI. nicht verstanden. Vielleicht ist es eine Revolution der Zeichen, die der Argentinier gezielt setzt, um seine Botschaft zu vermitteln, aber das ist alles. Inhaltlich setzt der Jesuit auf Kontinuität. Er ist der »Testamentsvollstrecker« des bayerischen Papstes, und das ist positiv gemeint. Populärer ausgedrückt: Benedikt war der Denker, Franziskus ist der Macher. Doch inhaltlich wollen sie das Gleiche: eine von Skandalen gereinigte, entweltlichte Kirche, die sich ganz auf Christus hin zentriert.
Zu den wichtigsten Hinterlassenschaften des Ratzinger-Papstes gehört seine Deutung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Er, der als einer seiner wichtigsten Theologen und Vordenker gilt, wehrt sich gegen eine »Hermeneutik des Bruchs«, eine Deutung also, die besagt, das Konzil sei ein Bruch mit der Vergangenheit und ein völliger Neuanfang der Kirche gewesen. Stattdessen bevorzugt er eine »Hermeneutik der Kontinuität«, die Deutung, dass das Zweite Vatikanum in der ungebrochenen Tradition der Kirche steht. Es gibt keinen ernstzunehmenden Konzilsinsider, der anderer Ansicht ist. Doch trotzdem wurde es nach außen hin als Revolution wahrgenommen. Das reale Konzil war ein anderes als das »Konzil der Medien«, seine Darstellung in der Öffentlichkeit.
Gleiches kann man vom Pontifikat Benedikts XVI. sagen. Krampfhaft hatten die Gegner seiner Reformen versucht, ihn als Papst der »Pleiten, Pech und Pannen« zu diskreditieren, ihn bewusst missverstanden, um ja das Große zu verschleiern, das sich mit ihm ankündigte. Auch davon berichtet dieses Buch, um aufzuzeigen, dass nicht erst mit Franziskus, sondern bereits mit Benedikt XVI. eine neue Ära der Kirche begonnen hat. So gilt es umso mehr, das Erbe des Ratzinger-Papstes neu zu entdecken, das die geistige Grundlage seines Nachfolgers ist. Es könnte sich als letztes großes Licht des sterbenden Europas erweisen.
Denn unbestreitbar signalisiert die Wahl des ersten Papstes aus der Neuen Welt einen Dammbruch, ja eine Zeitenwende. Die Zeit der eurozentrischen Kirche geht zu Ende. Europa steckt nicht nur wirtschaftlich in der Krise, auch geistig steht es vor dem Bankrott, weil es sich selbst von seinen Wurzeln abschneidet, der griechischen Philosophie ebenso wie dem christlich-jüdischen Menschenbild. So kann es durchaus sein, dass Ratzinger eines Tages als der letzte große Mahner des christlichen Abendlandes in die Geschichte eingeht, der freilich den Untergang nicht aufhalten konnte, schon weil der Prophet in seinem Vaterland so wenig gilt.
Die aufstrebenden, jungen und noch nicht an ihrer eigenen behäbigen Etabliertheit erstickenden Kirchen der »Dritten Welt« haben jedenfalls immer weniger Vertrauen darin, dass ihnen dieses Europa noch etwas geben kann. Daher kommen sie jetzt, um selbst im letzten Moment das Ruder zu übernehmen und das Schiff Petri wieder auf Kurs zu bringen. Insofern ist Franziskus wirklich ein »Petrus Romanus«, ein neuer Petrus, der aus der Ferne, über das große Meer, kam, um auch uns das Evangelium neu zu verkündigen und, vor allem, vorzuleben. Mit ihm kehrt das Papsttum zu seinen Anfängen zurück. Was danach kommt, das weiß nur Gott allein.
An dem Tag, an dem ich diese Zeilen schreibe, genau zwei Monate nach seiner Wahl, weihte Franziskus sein Pontifikat der Gottesmutter von Fatima, der großen Warnerin aus dem Kriegsjahr 1917, die in ihrer Botschaft die Ereignisse des 20. Jahrhunderts bis hin zur Bekehrung Russlands so präzise beschrieb. Das ist ein gutes Zeichen, das hoffnungsvoll stimmt. Aber es zeigt auch, wie ernst der 265. Nachfolger Petri[1] seine Aufgabe nimmt. In einer mehr als schwierigen Zeit setzt er sein Vertrauen darauf, dass der Herr, der diese Kirche vor fast 2000 Jahren begründet hat, sie auch in Zukunft nicht im Stich lassen wird.
»Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben«, dichtete Hermann Hesse. Das gilt ganz besonders für ein neues Pontifikat. Papst Franziskus ist die Zukunft der Kirche. Hoffen wir, dass Gott ihm die Kraft und die Weisheit schenkt, die er in diesen Tagen mehr denn je brauchen wird.
Düsseldorf, am 13. Mai 2013
Michael Hesemann
Anmerkung
[1] Franziskus ist nach offizieller Zählung im Annuario Pontificio (Ausgabe 2012) der 266. legitime Papst der katholischen Kirche (diverse Gegenpäpste werden nicht mitgerechnet), aber eben der 265. Nachfolger des hl. Petrus, der als erster Papst gilt.
I. »Habemus Papam!«
Ich stand im Regen und fror, während es langsam dunkler wurde. Doch ich war nicht allein. Um mich herum standen erst Hunderte, dann Tausende, schließlich Zehntausende unter ihren Schirmen, um nicht völlig durchnässt zu sein, wenn es denn so weit sein würde. Was sich freilich nicht ganz verhindern ließ, so heftig, wie es schüttete. Doch sie alle waren vor die beeindruckendste Fassade der Welt geströmt und standen jetzt zwischen den Kolonnaden des Bernini, die wie weit ausgebreitete Arme jeden empfangen, den es zum Grab des Apostels Petrus zieht. Auf ihnen reckten sich die Statuen der Heiligen dem wolkenverhangenen Himmel entgegen und glänzten vor Nässe. Dahinter, zumindest auf dem Braccio di Carlo Magno, der Verbindung zwischen den beiden halbkreisförmigen Säulengängen und Gottes Marmorpalast, standen und froren Hunderte Fotografen aus aller Welt. Über ihnen strahlten grelle Scheinwerfer in die graueste aller Abendstunden. Jede Dachterrasse rund um den Petersplatz war für horrende Beträge an die großen Fernsehsender der Welt vermietet worden, die dort mit Kamerateams und Korrespondenten, durch Plastik-Baldachine und transparente Planen vor dem Regen geschützt, auf die nächste Sensation dieses doch so ereignisreichen römischen Winters warteten: den neuen Papst.
Ich wusste, er würde an diesem Mittwoch, dem 13. März 2013, gewählt werden. Ich war mir sogar so sicher, dass ich für den nächsten Tag einen Flug nach Düsseldorf gebucht hatte, um abends in meiner Heimatstadt Neuss einen Vortrag zu halten. Der Termin stand schon ein halbes Jahr lang fest, und ich wollte ihn nicht absagen, warum auch. Es reichte aus, wenn ich am Freitag wieder nach Rom zurückkehren würde; an seinem ersten Tag hat ein neuer Papst genug damit zu tun, sich gratulieren zu lassen, da würde ohnehin nichts Wichtiges geschehen.
Ein bekannter Kollege sah es genauso und verwettete in einer Talkshow sein ganzes Vermögen, sprich: die Tantiemen aus mehreren Bestsellern, auf eine Papstwahl am 13. März. Er machte nur einen entscheidenden Denkfehler, als er versicherte, der neue Papst würde Angelo Scola heißen.
Scola (72) war mehr als ein »papabile«, einer der acht Kardinäle, denen die Presse zutraute, sie könnten der nächste Nachfolger Petri werden. Er galt, wenn es denn so etwas im Vatikan gäbe, praktisch als Kronprinz. Es war kein Geheimnis – mir war es aus dem engsten Umfeld des ehemaligen Papstes bestätigt worden –, dass Benedikt XVI. ihn gerne auf dem Stuhl des Apostelfürsten gesehen hätte. Denn Scola war nicht nur ein guter Theologe, der vieles genauso sah wie Ratzinger, er besaß auch eine Eigenschaft, die dem Deutschen auf dem Papstthron manchmal gefehlt hatte: Er konnte sich durchsetzen! Er besaß die feste Hand (um nicht zu sagen: die eiserne Faust), die jetzt nötig war, um aufzuräumen. Um Ordnung zu schaffen in einer Kurie, die durch den Vatileaks-Skandal ins Zwielicht geraten war. Um die Ortsbischöfe weltweit daran zu erinnern, dass noch immer Rom in der Glaubenslehre die Entscheidungen trifft. Seine Schultern wären breit und kräftig genug, um das Schiff Petri sicher durch den Sturm zu steuern, in dem es trieb. Es sickerte sogar schon durch, welchen Papstnamen er sich zulegen würde, nämlich Leo XIV. Ein echter Löwe ist dieser einstige Patriarch von Venedig, den Benedikt XVI. in die marode Diözese Mailand geschickt hatte, um dort (erfolgreich) aufzuräumen. Nur leider hat er auch den Charme einer Bulldogge.
Scola war so »sicher« als neuer Papst, dass man ihn schon in einem der ersten Wahlgänge gewählt hätte. Spätestens beim dritten, wenn klar wäre, dass kein anderer Kandidat gegen ihn eine Chance hätte. Doch dass stattdessen am Mittwochmittag um 11.41 Uhr schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle strömte, konnte nur eines bedeuten: Es war Kardinal Angelo Scola nicht gelungen, die notwendige Zweidrittelmehrheit auf sich zu vereinen. Und damit wurden die Karten neu gemischt, war er praktisch »aus dem Rennen«.
Erst später kam durch die Indiskretion einiger italienischer Kardinäle heraus, dass Scola nie eine breite Basis gehabt hatte. Die beiden mächtigsten Kurienkardinäle, Staatssekretär Tarcisio Bertone und sein Vorgänger, Kardinaldekan Angelo Sodano, eigentlich Rivalen, waren beide zu unterschiedlichen Anlässen schon mit ihm in Konflikt geraten. So standen auch die 28 italienischen Kardinäle, selbst wenn sie vielleicht von einem Papst aus ihren Reihen geträumt hätten, nicht geschlossen hinter ihm.
Für die Nichtitaliener unter den Kardinälen aber gab es von Anfang an zwei Prämissen: Bloß keinen Italiener und bloß keinen Kurienkardinal zu wählen! Zu sehr lagen die Vorwürfe von Vetternwirtschaft und Korruption, die von der Presse eifrig kolportiert wurden, in der Luft. Überhaupt traute man Europa nur noch wenig zu. Die Alte Welt, so hatte schon Benedikt XVI. treffend diagnostiziert, steckt in einer Identitätskrise. Sie leugnet ihr christliches Erbe. Ihr Reichtum hat sie blind und taub gemacht für Gott. Priestermangel, Kirchenaustritte und ein starker Rückgang der Gottesdienstbesuche sind nur die augenscheinlichsten Symptome. In Asien, Afrika und Lateinamerika dagegen nimmt die Zahl der Gläubigen und der Berufungen deutlich zu. Also war es an der Zeit, sich einen Hirten zu suchen, der aus einer jener gesunden, starken Ortskirchen stammte und ihre ganze Hoffnung verkörperte.
Der erste Blick fiel auf Afrika, wo die Kirche so rapide wächst wie nirgends sonst. Seit 1978 hat sich dort die Zahl der Katholiken von 55 Millionen auf 186 Millionen erhöht, d. h. von 12,4 Prozent der Bevölkerung auf 17,3 Prozent. Der Prozentsatz an Afrikanern unter dem weltweiten Priesternachwuchs hat sich sogar vervierfacht; er liegt heute bei 22,6 Prozent. So wurde ein Afrikaner, Kardinal Peter Turkson (64) aus Ghana, zu einem der am häufigsten genannten »papabile«. Er war sogar der Favorit der Buchmacher, die Wetten darauf annahmen, wer als »Sieger« aus dem Konklave hervorgehen würde. Seine Anhänger (oder waren es seine Gegner?) desavouierten ihn allerdings schon im Vorfeld damit, dass sie in ganz Rom »Wahlplakate« (»Al Conclave vota Turkson«) mit seinem Foto aufhängten. Auch mit seiner Aussage, die Ursache für den Missbrauchsskandal sei die Akzeptanz der Homosexualität im Westen, machte er sich wenig Freunde. »Die Zeit ist noch nicht reif für einen Afrikaner«, hieß es bald in Kurienkreisen.
Was aber war mit Lateinamerika, wo über 40 Prozent aller Katholiken leben? Da hatte man schnell Kardinal Odilo Scherer (63) ins Auge gefasst, den Erzbischof von São Paulo in Brasilien, der drittgrößten Diözese der Welt. Seine Familie stammt aus dem Saarland, er spricht fließend Deutsch, half sogar in Bad Vilbel als Pfarrer aus; mit ihm wären wir noch immer ein wenig »Papst« geblieben. Doch ihm wurde zum Verhängnis, dass ausgerechnet die Kurienkardinäle Sodano und Re seine Kandidatur unterstützten. Als ihm dann noch am Sonntag vor dem Konklave, als er in seiner römischen Titelkirche mit Gläubigen das Messopfer feierte, eine Hostie aus der Hand rutschte und auf den Boden fiel, sah man darin schnell ein Zeichen. Scherer schaffte es nicht über die ersten Wahlgänge hinaus.
Vielleicht besser ein Nordamerikaner? Der Kanadier Marc Ouellet (68) etwa, der emeritierte Erzbischof von Québec? Er gilt als exzellenter Theologe in der Tradition Benedikts XVI., spricht acht Sprachen und hatte jahrelang in Südamerika gewirkt, was ihm die Sympathie der südamerikanischen Kardinäle sicherte. Johannes Paul II. hatte ihn schließlich an die römische Kurie berufen und zum Kardinal ernannt, wo er nicht nur als Sekretär des Rates für die Einheit der Christen brillierte, sondern auch als Aufklärer im Missbrauchsskandal. Doch vielleicht war das schon zu viel »römischer Stallgeruch«, zudem wirkt Ouellet bei Predigten wenig charismatisch – beide Faktoren dürften seine Chancen gemindert haben.
Schließlich kam noch ein vierter Name »ins Rennen«: Kardinal Sean O’Malley, der Erzbischof von Boston, bekannt dadurch, dass er in seiner Diözese nach dem Missbrauchsskandal für Ordnung sorgte und das »Null-Toleranz«-Programm Benedikts XVI. rigoros umsetzte. Vor allem aber ist O’Malley Kapuziner, trägt die einfache braune Kutte seines Ordens und einen längst weißen Vollbart, dazu braune Sandalen. Ein Schüler des heiligen Franziskus also, ein Ordensbruder zudem von Padre Pio, dem Mystiker und Volksheiligen aus San Giovanni Rotondo in Apulien, dessen Bild in jeder italienischen Pizzeria, jedem römischen Krämerladen und den meisten Taxis südlich der Alpen hängt.
Ein Papst in Sandalen, mit dieser Idee konnte auch ich mich anfreunden, ein Franziskaner noch dazu, das wäre gut für die Glaubwürdigkeit der Kirche. Gegen O’Malley sprach eigentlich nur seine Nationalität; auch im katholischen Lateinamerika grassiert der Antiamerikanismus, von den muslimischen Ländern ganz abgesehen, deren Katholiken fortan bezichtigt würden, »Agenten der USA« zu sein. Dass die amerikanischen Kardinäle beim Vorkonklave geradezu als Block auftraten und, entgegen aller Absprachen, sogar gemeinsame Pressekonferenzen gaben, trug nicht gerade zu ihrer Beliebtheit bei ihren Amtsbrüdern bei. Als sich dann noch Barack Obama zu Wort meldete, wahrscheinlich eher, um einen amerikanischen Papst zu verhindern (obwohl er natürlich das Gegenteil sagte), war klar, dass auch O’Malley wenig Chancen hatte.[2]
Da half also nur noch beten! Genau dazu hatte die katholische Bewegung Jugend 2000 aus Bayern mit ihrer Initiative »Adopt a Cardinal« aufgerufen. Wer sich über das Internet anmeldete, dem wurde einer der wahlberechtigten 115 Purpurträger zugewiesen, für den er fortan beten sollte, dass der Heilige Geist ihn bei seiner Wahl lenke. Über 550.000 Gläubige aus aller Welt hatten sich schließlich dazu verpflichtet und damit auch die Initiatoren (und die Kardinäle) völlig überrascht.
Ebenfalls den Heiligen Geist und noch dazu alle Heiligen der katholischen Kirche hatten auch die Kardinäle angerufen, als sie am Montag, dem 11. Mai im Petersdom die Missa pro eligendo pontifice, die Messe vor der Papstwahl, feierten. Zu den Klängen des Dominus fortitudo plebis suae (»Der Herr ist die Stärke seines Volkes«) zogen sie in den Marmorpalast Gottes ein, jetzt nicht das Violett der Fastenzeit, sondern das helle Rot des Heiligen Geistes tragend.
Man hatte mir einen guten Platz zugewiesen, und so konnte ich aus der ersten Reihe verfolgen, wie Kardinaldekan Sodano seine Vision eines modernen Papsttums propagierte. Der mit allen Wassern gewaschene Diplomat »alter Schule« machte keinen Hehl daraus, dass ihm Benedikt XVI. stets zu »entweltlicht« gewesen war. »Er ist Papst, und was macht er? Er zieht sich zurück und schreibt seine Bücher!«, soll er sich mehr als einmal beklagt haben. Tatsächlich war Joseph Ratzinger auch als Papst nie ein Politiker oder Diplomat gewesen; dafür war er charakterlich viel zu gradlinig und bedingungslos der Wahrheit verpflichtet. Doch dass Gott sich auch etwas dabei gedacht haben könnte, ausgerechnet einen Professor auf die Kathedra Petri zu setzen, kam seinem Kritiker nie in den Sinn.
Sodanos Predigt offenbarte einmal mehr die Doppelzüngigkeit des Kardinaldekans. Auf der einen Seite dankte er Benedikt XVI., »dem geliebten und ehrwürdigen Papst (…) für das leuchtende Pontifikat, das er uns mit seinem Leben und Wirken (…) gewährt hatte«, und erhielt daraufhin minutenlangen Applaus. Doch dann kritisierte er ihn auch, durch die Blume natürlich, genauer gesagt durch die Heilige Schrift. Auf das Johannes-Evangelium eingehend, das Wort Jesu »Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt« (Joh 15,13), betonte er: »Die grundlegende Haltung jedes guten Hirten ist es also, sein Leben hinzugeben für die Schafe. Das gilt vor allem für den Nachfolger Petri, den Hirten der universellen Kirche.« Der Papst muss im Amt sterben, statt in den Ruhestand zu treten, schien Kardinal Sodano damit sagen zu wollen. Er stand mit dieser Meinung freilich nicht alleine da.
Als er dann auf »die Sendung des Papstes« einging, entwarf er das Bild eines primär politischen Pontifikats, das wenig mit Benedikts Vision einer »Entweltlichung« der Kirche zu tun hatte: »In der Nachfolge in diesem Liebesdienst an der Kirche und der ganzen Menschheit haben die letzten Päpste viel Gutes getan für die Völker und die Weltgemeinschaft und haben sich unablässig für Gerechtigkeit und Frieden eingesetzt. Beten wir dafür, dass der zukünftige Papst dieses Werk unermüdlich auf der weltlichen Ebene (›a livello mondiale‹) fortführen möge.«
»Die Vision Sodanos skizzierte die Rolle des Papstes und der Kirche als Partnerin anderer Regierungen und Institutionen in dem Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt«, fasste mein Kollege Robert Moynihan vom Inside the Vatican-Magazin den Tenor der Predigt zusammen, um anzumerken: »Dieses Bild ist nicht falsch, aber unvollständig.« Es fehlte völlig der Verweis auf die geistliche Aufgabe der Kirche und des Papstes.
Zudem war der Text der Predigt, wie ihn das vatikanische Presseamt verbreitete, unvollständig. Wie jeder nachprüfen kann – eine Videoaufnahme ist auf der Website von Radio Vatikan veröffentlicht –, sprach er nicht nur von »Gerechtigkeit und Frieden«, sondern auch von der »Weltordnung« (»ordine mondiale«), für die sich der Nachfolger Petri einsetzen sollte; eine Ergänzung, die Sodanos Wunsch nach einer weltlich-politischen Orientierung des Papsttums noch unterstrich. Ansonsten aber war es eine schwache Predigt. Offenbar wollte Kardinal Sodano nicht den Fehler seines Vorgängers Joseph Ratzinger wiederholen, der als Kardinaldekan 2005 die Predigt der Missa eligendo romano pontifice gehalten hatte. Sie war so brillant gewesen, dass er nur zwei Tage später zum Papst gewählt wurde.
Noch während Sodano sprach, brach der Himmel über Rom auf. Minutenlang donnerte es heftig und so laut, dass die Übertragung durch das Vatikan-Fernsehen CTV gestört war. Hagel prasselte auf die Ewige Stadt und ließ Zehntausende Pilger erschaudern, die sich auf dem Petersplatz versammelt hatten, um die Messe zur Eröffnung des Konklaves auf den dort aufgestellten Großbildschirmen zu verfolgen.
Nach der Eucharistiefeier stand das Mittagessen der Kardinäle auf dem Programm, gefolgt von einer längeren Siesta, in der viele erst in das vatikanische Gästehaus Domus Sanctae Marthae einzogen, wo sie während des Konklaves wohnen sollten. Andere nutzten die Zeit, um noch einmal die Ereignisse der letzten Tage Revue passieren zu lassen und ihre Gedanken zu sammeln.
Eine Woche lang, vom 4. bis 11. März, hatte das Vorkonklave gedauert, das die Aufgabe hatte, die Situation der Kirche nach dem Rücktritt Benedikts XVI. zu sondieren, und den Kardinälen die Möglichkeit gab, sich besser kennenzulernen. Nicht viel ist über diese Tage bekannt geworden. Nur dass es 133 Wortbeiträge gab und die Hauptthemen »die Kirche in der Welt«, »die Reform der Kurie« und »das Profil des neuen Papstes« waren. Am 8. März hatte man zumindest entschieden, das Konklave vier Tage später beginnen zu lassen, was eine der letzten Entscheidungen Benedikts XVI. möglich gemacht hatte. Denn wenn ein Papst verstirbt, dann müssen 15 bis 20 Tage vergehen, bis die Kardinäle seinen Nachfolger wählen; so hatte es Johannes Paul II. 1996 in der Apostolischen Konstitution Universi Dominici Gregis (»Hirte der gesamten Herde des Herrn«) festgelegt. Für den Sonderfall seines Rücktritts hatte Benedikt XVI. es den Kardinälen überlassen, den Zeitpunkt des Konklaves frei zu bestimmen. Der entscheidende Faktor für eine Vorziehung war der Palmsonntag, der in diesem Jahr auf den 24. März fiel. Bis dahin, so war man sich einig, musste der neue Papst bereits im Amt sein. Nicht nur, dass eine Amtseinführung schwer in den ohnehin gedrängten Zeitplan der Karwoche gepasst hätte, die meisten Kardinäle waren zugleich Erzbischöfe und mussten zu diesem Zeitpunkt längst wieder in ihren Heimatdiözesen sein, um dort die Osterfeierlichkeiten zu leiten. Das verlieh dem Konklave eine gewisse Dringlichkeit, wenn auch sonst die Bedingungen so viel angenehmer waren als noch im 20. Jahrhundert, geschweige denn im hohen Mittelalter.
Das Wort Konklave hat seinen Ursprung im Lateinischen »cum clave«, »mit dem Schlüssel«, was freilich nichts mit den »Schlüsseln zum Himmelreich« zu tun hat, die Jesus einst dem heiligen Petrus und seinen Nachfolgern versprach, sondern damit, dass die Kardinäle buchstäblich eingeschlossen wurden, um ihnen das Leben zur Hölle zu machen, wenn sie nicht endlich einen neuen Papst wählten.
Im frühen Mittelalter wurde der Nachfolger Petri »per acclamationem« vom römischen Klerus und Volk gewählt. Das führte freilich dazu, dass abwechselnd römische Adelsfamilien das Papsttum in Beschlag nahmen oder deutsche Kaiser mit Waffengewalt einen ihnen genehmen Kandidaten durchsetzten. So beschloss die Lateransynode 1059, dass künftig die Kardinäle den Nachfolger Petri zu wählen hatten, der nur noch durch das Volk und den Kaiser bestätigt werden musste. Doch unter den zerstrittenen Kardinälen, deren Familien oft seit Jahrhunderten miteinander verfeindet waren, den Richtigen zu finden, war gar nicht so einfach und manchmal auch extrem zeitaufwändig.
Das gläubige Volk reagierte mit drastischen Maßnahmen. Nach dem Tod Gregors IX. 1241 kamen die Kardinäle – damals gerade einmal zwölf an der Zahl – im alten Palast von Settizonio auf dem Palatin in Rom zusammen. Wochen und Monate vergingen ohne eine Einigung. Um sie unter Druck zu setzen, sperrten Senat und Volk von Rom die Purpurträger kurzerhand ein; der Begriff des Konklaves war geboren. Wochenlang harrten die Kardinäle in der römischen Hitze und unter katastrophalen hygienischen Bedingungen aus, bis einer von ihnen verstarb und andere erkrankten. Dann einigten sie sich und wählten Coelestin IV., der, gezeichnet von den Strapazen, schon nach 17 Tagen verstarb. Das gab den Kardinälen aber immerhin die Chance, nach Anagni zu gehen, wo sie, jetzt ohne äußeren Druck, weitere zwei Jahre stritten, bis Innozenz IV. gewählt war.
Das längste Konklave aber fand in Viterbo statt, wo Clemens IV. 1268 verstarb; er war vor der römischen Hitze ebenso wie vor den römischen Intrigen geflohen. Als die 16 damals amtierenden Kardinäle bereits im zweiten Jahr stritten, wer sein Nachfolger werden sollte, wurde es den Bewohnern der Bischofsstadt in Latium zu bunt. Sie vermauerten kurzerhand den Palazzi dei Papi, den »Palast der Päpste«, in dem diese tagten, und reichten ihnen nur noch Brot und Wasser hinein, hoffend, sie dadurch zur Eile zu drängen. Als nach weiteren zwölf Monaten noch immer kein neuer Papst gewählt worden war, deckten sie das Dach ab. Der einsetzende Regen verfehlte seine Wirkung nicht: Nach nur drei Tagen war Gregor X. gewählt. Doch als die Kardinäle den Papstpalast verließen, bemerkten die Einwohner von Viterbo, dass sie getäuscht worden waren; sämtliche Purpurträger wirkten wohlgenährt. Durch einen unterirdischen Gang hatten sie sich mit allerlei Köstlichkeiten versorgen lassen.
Verglichen mit den Zuständen im Mittelalter war jedes Konklave der jüngeren Zeit geradezu kurz und schmerzlos. Und doch galt es noch immer als furchtbare Strapaze. Schließlich wurden noch auf den beiden Konklaven des Jahres 1978 die Kardinäle in den Räumlichkeiten rund um die Sixtina und in den Gängen zu den Vatikanischen Museen untergebracht. Die Zahl der Wahlberechtigten war mit den Jahrhunderten rapide gestiegen. Betrug im Mittelalter ihre Mindestzahl zwölf, entsprechend den zwölf Aposteln, waren es zu Anfang des 20. Jahrhunderts bereits 60 (1903), bei der Wahl Johannes XXIII. (1963) 80, bei der Wahl Johannes Pauls I. (1978) schließlich 111 Papstwähler. Dass man das Höchstalter der wahlberechtigten Kardinäle 1970 auf 80 Jahre festsetzte, hatte auch etwas damit zu tun, dass man Hochbetagten dieseAnstrengung ersparen wollte. Denn die Unterbringung war nicht viel komfortabler als in einem Feldlazarett. Die Betten waren bloß durch Stellwände voneinander getrennt, die Notdurft wurde in Nachttöpfen verrichtet, zur morgendlichen Hygiene musste eine Waschschüssel reichen. Eine Klimaanlage gab es nicht, und so war die Luft in den Sommermonaten stickig, heiß, schwül und nicht gerade von Wohlgerüchen erfüllt. Einige Kardinäle erlitten Schwächeanfälle und akute Atemnot, weil die Fenster nicht geöffnet werden durften. »Zum Schluss waren wir so ausgelaugt, dass wir einen leeren Stuhl zum nächsten Papst gewählt hätten«, gestand ein »papabile« dieser Ära, der Genueser Giuseppe Siri.
Johannes Paul II. wollte das keinem seiner einstigen Mitbrüder mehr zumuten. Vielleicht war es auch eine Geste der Dankbarkeit, dass sie mit einer fast 500-jährigen Tradition gebrochen und anstelle eines Italieners ihn, einen Polen, gewählt hatten. Jedenfalls ließ er noch im Jahr seiner Wahl, 1978, ein ehemaliges Hospiz auf dem Vatikan-Gelände, das im Zweiten Weltkrieg zur Aufnahme von Flüchtlingen gedient hatte, zum päpstlichen Gästehaus umbauen. 1996 wurde das Domus Sanctae Marthae, wie es jetzt hieß, feierlich eingeweiht. Seinen Namen verdankt es der Gastgeberin Jesu, deren Diensteifer nur durch die Andacht ihrer Schwester Maria von Bethanien in den Schatten gestellt wurde. Außerhalb des Konklaves wird es zur Unterbringung offizieller und persönlicher Besucher des Papstes und der römischen Kurie genutzt. 2005 kam es dann zum ersten Mal bei einer Papstwahl zum Einsatz.
Wie damals, so wurden auch 2013 das eine Appartement, die 106 Suiten und 22 Einzelzimmer unter den jetzt 115 wahlberechtigten Kardinälen ausgelost. Groß gewinnen oder verlieren konnte keiner dabei, da auch die Appartements zwar gediegen, aber doch eher bescheiden eingerichtet sind. Die Wände sind in einem freundlichen Gelb gehalten, die Möbel in edlem, dunklem Nussbaumholz, passend zum Nussbaumparkett auf dem Boden. Fernseher oder gar eine Minibar sucht man vergeblich, dafür sind die Appartements zusätzlich mit einem kleinen Schreibtisch und drei Stühlen ausgestattet. So geht es bei der Auslosung eher darum, die Zimmernachbarn dem Zufall zu überlassen, um Absprachen noch ein wenig mehr zu erschweren. Ziemlich mondän wirken dagegen der große Speisesaal mit seinem lichtdurchfluteten Bogendach und die geschmackvoll gestaltete, spitzgieblige Kapelle, die an ein Zelt und damit an unsere Wanderschaft auf Erden erinnern soll.
Während des Konklaves war das »Hotel der Kardinäle« quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Es funktionierte kein Internet, kein Telefon, kein Radio oder Fernsehen, und Störsender machten auch den Handy-Empfang unmöglich. Obwohl die Rüstigeren unter den Kardinälen zweifelsohne den Weg in die Sixtina bequem zu Fuß hätten zurücklegen können – er führt an der Apsis des Petersdoms vorbei durch die herrlichen Vatikanischen Gärten –, wurden sie alle zusammen im Bus chauffiert.
Auch sonst war alles strengstens geregelt: Nach der Mittagspause, die der feierlichen Messe im Petersdom folgte, um exakt 15.45 Uhr, wurden die Kardinäle im Bus von der Domus S. Marthae zur Capella Paolina gebracht, der Privatkapelle Pauls III., die Michelangelo einst mit herrlichen Fresken von der Bekehrung des Paulus und dem Martyrium des hl. Petrus ausgestattet hatte. Sie wird nur durch die Sala Regia, die einst als Empfangsraum für königliche Delegationen diente, von der Sixtinischen Kapelle getrennt.
Um 16.30 zogen die Purpurträger in feierlicher Prozession von der Capella Paolina zur Sixtinischen Kapelle. Dabei riefen sie in einer gesungenen Litanei die großen Heiligen um ihre Fürsprache (»Ora pro nobis«) an, gefolgt vom Hymnus an den Heiligen Geist, Veni Creator Spiritus (»Komm Schöpfergeist, kehr bei uns ein«). In der Sixtina angekommen, traten die Kardinäle zunächst vor ihren ewigen Richter und verneigten sich vor dem großartigen Fresko des Jüngsten Gerichts, das Michelangelo an der Stirnseite des Altarraums angebracht hatte. Dann nahmen sie, jeder auf dem ihm zugewiesenen und mit einem Namensschild versehenen Platz, entlang der Seitenwände der Kapelle ihre Sitze ein.
Nachdem der Konklaveleiter, Kardinal Giovanni Battista Re, die Eidesformel verlesen hatte, wonach alle Teilnehmer die Wahlordnung beachten, die Geheimhaltung wahren und dem gewählten neuen Papst Gehorsam leisten sollten, trat jeder Purpurträger einzeln vor und sprach mit der Hand auf der Bibel: »Et ego N. Cardinalis N. spondeo, voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.« (»Und ich, N. Kardinal N., verspreche, verpflichte mich und schwöre es, so wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien, die ich mit meiner Hand berühre.«)
Im hinteren Teil der Kapelle verfolgten Mitglieder der Päpstlichen Familie, hohe Prälaten der römischen Kurie sowie der Präfekt des Päpstlichen Hauses, Erzbischof Georg Gänswein, den Einzug der Kardinäle. Erst als der Päpstliche Zeremoniar Guido Marini, bekleidet mit dem Gewand eines apostolischen Protonotars, die Worte »Extra omnes« (»Alle raus!«) sprach, verließen sie die herrlichste Kapelle der Christenheit. Wer sie jetzt noch betrat, dem drohte die sofortige Exkommunikation. Dann schritt Marini zu ihrem mächtigen Portal, schloss seine schwere, hölzerne Flügeltüre und verriegelte sie. Nach einer Meditation, vorgetragen von Kardinal Prosper Grech aus Malta, begann man mit dem ersten Wahlgang.
Und dieser Wahlgang endete mit einer Überraschung, wenn wir den Plaudertaschen im Kardinalspurpur glauben wollen, die ihren Eid gleich beim ersten Interview vergaßen. Natürlich, es war zunächst eine Testwahl, bei der viele Namen genannt wurden. Doch was auffiel, war, dass Angelo Scola jetzt keineswegs mehr der aussichtsreichste »papabile« war, für den man ihn noch am Vormittag gehalten hatte. Nicht nur Ouellet bekam fast so viele Stimmen wie der Erzbischof von Mailand, sondern auch einer, mit dem niemand gerechnet hatte, der jetzt aber die anderen »papabiles« Scherer und Turkson weit hinter sich ließ. Ein Unbekannter für viele, einer, den kein einziger Vatikan-Journalist auf dem Radarschirm hatte, ein absoluter Außenseiter: der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires.
Nur die Kardinäle, die bereits am Konklave 2005 teilgenommen hatten, erinnerten sich noch an ihn. Er erhielt damals rund 40 Stimmen, er hätte Ratzinger blockieren können, zumal die Gegner des Präfekten der Glaubenskongregation aus eben diesem Grund auf ihn gesetzt hatten. Glauben wir Gerüchten aus dem letzten Konklave, die der italienische Vatikan-Journalist Marco Politi zitiert, so gehörte auch der spätere Papst zu seinen Wählern: »Ratzinger schätzt Bergoglio sehr und soll im Konklave für ihn votiert haben«, behauptete Politi in seiner Benedikt-Biografie.
Schließlich, beim Mittagessen nach dem dritten Wahlgang, zog Bergoglio damals völlig überraschend seine »Kandidatur« zurück. Vielleicht ahnte er, dass er 2005 keine Chance hatte, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Ratzinger war der Mann der Stunde, das fühlte auch er. Keiner stand dem von allen geliebten Johannes Paul II. näher, keiner garantierte so sicher eine Kontinuität wie er. Eine weitere Kandidatur des Argentiniers hätte nur das Konklave endlos in die Länge gezogen, bis, wie es die Konklave-Ordnung Johannes Pauls II. festlegte, nach 30 Wahlgängen und mindestens zwei Wochen eine simple Mehrheit für einen der beiden Kardinäle gereicht hätte. Doch das hätte der Welt nur gezeigt, wie uneinig die Kirche ist, wo es doch galt, gerade nach dem Tod eines so großen Hirten Einheit zu demonstrieren. Vor allem aber hatte Bergoglio so viel Respekt und Hochachtung vor Ratzinger, dass er sich nicht von dessen Gegnern instrumentalisieren lassen wollte. So bat er die Kardinäle, die für ihn gestimmt hatten, jetzt den Deutschen zu wählen, der gleich im vierten Wahlgang die notwendige Zweidrittelmehrheit erhielt; 84 Stimmen sollen es damals gewesen sein.
Und 2013? Seit seiner Ankunft in Rom war der Argentinier überraschend unspektakulär aufgetreten. Nicht ein einziges Mal erweckte er den Eindruck, ein »Kronprinz« zu sein, gekommen, um einzufordern, was ihm vor acht Jahren versagt worden war. Er gab keine Pressekonferenzen, er sprach nicht mit Journalisten. Nur ein paar Pilger, die aus Argentinien nach Rom gekommen waren, um beim Abschied Benedikts XVI. dabei zu sein, hatten ihn erkannt.
Am 27. Februar, an jenem Morgen, an dem Zehntausende zum Petersplatz strömten, um von Benedikt XVI. Abschied zu nehmen, war er mit dem Alitalia-Flug 681 von Buenos Aires auf dem römischen Flughafen Leonardo da Vinci gelandet. Auf das First-Class-Ticket, das man ihm buchen wollte, hatte er dankend verzichtet; er flog Touristenklasse und mit leichtem Gepäck. Sein schütteres, grauweißes Haar blieb unbedeckt, sein schlichter schwarzer Regenmantel versteckte das versilberte Brustkreuz, durch das man ihn zumindest als Bischof hätte erkennen können. Seine schwarzen orthopädischen Schuhe hatte er gerade erst »eingelaufen«; seine Schwester hatte ihm dringend dazu geraten, sich ein neues Paar anzuschaffen, bevor er nach Rom reiste. Mit leichtem Humpeln und steifem Rücken verließ er die Maschine, müde von dem langen Flug. Sein Magen war leicht angeschwollen, Folge einer jahrzehntelangen Cortisonbehandlung, nachdem ihm mit 21 Jahren nach einer Lungenentzündung ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt worden war. Nach wie vor atmete er schwer. In seiner abgegriffenen Aktentasche aus schwarzem Leder trug er bereits das Rückflugticket. Es war auf den 23. März ausgestellt, gerade noch rechtzeitig, um am Palmsonntag bei den Gläubigen zu sein. Die Predigt für den Ostersonntag hatte er bereits vorbereitet.
Der Vatikan hatte einen Wagen geschickt, der Kardinal Bergoglio in sein Hotel bringen sollte, das Domus Internationalis Paulus VI. in der Via della Scrofa. Es liegt inmitten der Altstadt von Rom, nördlich der Piazza Navona, und damit ein ganzes Stück vom Vatikan entfernt. Dieses Gästehaus für Kleriker und Kurienmitarbeiter wurde 1999, rechtzeitig zum Heiligen Jahr, von Papst Johannes Paul II. eingeweiht. Es befindet sich in einem römischen Palazzo aus dem 18. Jahrhundert, der ursprünglich der Gesellschaft Jesu, dem Jesuitenorden, gehört hatte. Unter Leo XII. war es die Residenz des Kardinalvikars von Rom, später Priesterseminar und Sitz des Instituts für Kirchenmusik. Noch heute zeugen die herrlichen Fresken im Frühstücksraum von dieser großen Vergangenheit. Die Zimmer sind, ähnlich wie im Domus S. Marthae, einfach, aber zweckmäßig eingerichtet, vor allem aber sind sie preiswert; die Übernachtung mit Frühstück kostet 60 Euro, was für römische Verhältnisse fast unschlagbar ist.
Was Kardinal Bergoglio am Domus besonders gefiel, war die Lage. Bewusst wollte er nicht im »Klerikerghetto« auf der anderen Seite des Tiber wohnen, sondern dort, wo die Menschen sind. Die Piazza Navona, die ihre lang gestreckte Form dem Stadion des Domitian verdankt, über dem sie errichtet wurde, ist bei Tag wie bei Nacht das pulsierende Herz der Ewigen Stadt. Hier tummeln sich Touristen und Einheimische, bewundern die Werke der Straßenmaler oder bummeln über den römischen Weihnachtsmarkt, und in einer Seitenstraße befindet sich die vielleicht beliebteste Gelateria der Ewigen Stadt. Die prachtvolle Kirche S. Agnese in Agone erinnert daran, dass hier einst eine der populärsten Heiligen Roms das Martyrium erlitt, während Berninis Vierströmebrunnen auch der Neuen Welt seine Referenz erweist; neben Donau, Ganges und Nil ist dort der Rio de la Plata dargestellt. Vor allem aber begann hier der antike Pilgerweg zum Petersdom durch die Via dei Coronari, die Straße der Rosenkranzmacher, die heute längst teuren Antiquitätenhändlern gewichen sind, und über die von Bernini gestaltete Engelsbrücke. Kurz davor, an einer Seitenstraße, hielt der Kardinal noch inne vor seinem liebsten römischen Marienbild, der Madonna dell’ Archetto, und sprach ein kurzes Gebet.
Zu Fuß war Bergoglio in 20 Minuten im Vatikan, wenn er gemütlich schlenderte; es sind gut anderthalb Kilometer. Während sich die »papabiles« in schwarzen Limousinen mit dem unvermeidlichen Vatikan-Kennzeichen SCV zum Vorkonklave kutschieren ließen, liebte der Argentinier diese kleinen Spaziergänge, bei denen ihn niemand beachtete. Er wusste nur zu gut, dass der Volksmund in den drei Buchstaben nicht etwa das offizielle Stato della Cittá del Vaticano (Staat der Vatikan-Stadt) las, sondern eine bittere Anklage an die verwöhnten Prälaten: »Se Cristo vedesse!« (»Wenn Christus das sehen würde!«), was vom derben römischen Volksmund auch noch durch eine Umkehrung ergänzt wurde: »vi caccerebbe subito!« (»würde er euch gleich zum Teufel jagen!«).
Auch in Buenos Aires verzichtete Bergoglio auf eine Bischofslimousine und fuhr lieber mit dem Bus oder der U-Bahn, worin er Joseph Ratzinger nicht unähnlich war, der nie einen Führerschein gemacht hatte, als Theologieprofessor das Fahrrad vorzog und sogar als Präfekt der Glaubenslehrekongregation den Weg ins Büro lieber zu Fuß zurücklegte; bestenfalls ließ er sich im VW Golf seines Sekretärs herumkutschieren. Bergoglio jedenfalls war ein Mann aus dem Volke geblieben, der Sohn eines Buchhalters, den Macht und Karriere nie korrumpiert haben. So fiel allmählich auch seinen Amtsbrüdern auf, dass er anders war, erfrischend anders in seiner Bescheidenheit und Authentizität. Das eine oder andere Mal wird sein Name gefallen sein, wenn die Purpurträger in der Mittagspause im Speisesaal des Domus S. Marthae an den großen, runden Tischen ihr dreigängiges Mahl zu sich nahmen. Erst selten, dann immer häufiger. Nur er selber wollte davon nichts wissen. Er hielt sich mit 76 für zu alt, um ernsthaft für das Papstamt infrage zu kommen.
Doch dann kam alles ganz anders. Am 8. März, mitten im Vorkonklave, meldete sich auch Kardinal Bergoglio zu Wort, um seine Gedanken über die Zukunft der Kirche zu äußern. Er hatte sie auf einem einzigen Blatt Papier notiert, mit kleiner, enger Schrift; ein paar Worte waren unterstrichen. Mehr konnte, mehr durfte er nicht sagen; sämtliche Wortbeiträge waren auf fünf Minuten beschränkt. Zum Glück ist dieses Dokument erhalten geblieben. Gleich nach der kurzen Rede hatte der Erzbischof von Havanna, Kardinal Jaime Lucas Ortega y Alamino, Bergoglio um eine Kopie gebeten und das Original bekommen. Am 28.3.2013, dem Gründonnerstag, veröffentlichte der Kubaner den Text mit Erlaubnis des Papstes auf der Website seines Bistums.
Die meisten von Bergoglios Amtsbrüdern hatten bereits über die notwendige Neuevangelisierung gesprochen; ein Lieblingsbegriff Johannes Pauls II., der von Benedikt XVI. aufgegriffen worden war. Sogar ein Päpstlicher Rat zur Förderung der Neuevangelisierung wurde mit einem Motu proprio (Bekanntgabe einer administrativen Entscheidung des Papstes) von 2010 aus der Taufe gehoben. Doch die meisten Wortmeldungen dazu blieben vage, so, als hätten die Kardinäle selbst keine genaue Vorstellung davon, wie denn dieses hehre Ziel verwirklicht werden könnte. Ganz anders Bergoglio. Er erklärte:
»Ich möchte Bezug nehmen auf die Evangelisierung. Sie ist der Daseinsgrund der Kirche. Es ist die ›süße, tröstende Freude, das Evangelium zu verkünden‹ (Paul VI.). Es ist Jesus Christus selbst, der uns von innen her dazu antreibt.
1. Evangelisierung setzt apostolischen Eifer voraus. Sie setzt in der Kirche kühne Redefreiheit voraus, damit sie aus sich selbst herausgeht. Sie ist aufgerufen, aus sich selbst herauszugehen und an die Ränder zu gehen. Nicht nur an die geografischen Ränder, sondern an die Grenzen der menschlichen Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen Elends.
2. Wenn die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um das Evangelium zu verkünden, kreist sie um sich selbst. Dann wird sie krank (vgl. die gekrümmte Frau im Evangelium). Die Übel, die sich im Laufe der Zeit in den kirchlichen Institutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Es ist ein Geist des theologischen Narzissmus.
In der Offenbarung sagt Jesus, dass er an der Tür steht und anklopft. In dem Bibeltext geht es offensichtlich darum, dass er von außen klopft, um hereinzukommen. Aber ich denke an die Male, wenn Jesus von innen klopft, damit wir ihn herauskommen lassen. Die egozentrische Kirche beansprucht Jesus für sich drinnen und lässt ihn nicht nach außen treten.
3. Die um sich selbst kreisende Kirche glaubt – ohne dass es ihr bewusst wäre –, dass sie eigenes Licht hat. Sie hört auf, das ›Geheimnis des Lichts‹ zu sein, und dann gibt sie jenem schrecklichen Übel der ›geistlichen Mondänität‹ Raum (nach den Worten de Lubacs[3] das schlimmste Übel, was der Kirche passieren kann). Diese (Kirche) lebt, damit die einen die anderen beweihräuchern.
4. Was den nächsten Papst angeht: Es soll ein Mann sein, der aus der Betrachtung Jesu Christi und aus der Anbetung Jesu Christi der Kirche hilft, an die existenziellen Enden der Erde zu gehen, der ihr hilft, die fruchtbare Mutter zu sein, die aus der ›süßen und tröstenden Freude der Verkündigung‹ lebt.
Vereinfacht gesagt: Es gibt zwei Kirchenbilder: die verkündende Kirche, die aus sich selbst hinausgeht, die das ›Wort Gottes ehrfürchtig vernimmt und getreu verkündet‹; und die mondäne Kirche, die in sich, von sich und für sich lebt.
Dies muss ein Licht auf die möglichen Veränderungen und Reformen werfen, die notwendig sind für die Rettung der Seelen.«
Diese Notizen waren auf Spanisch verfasst, er hätte sie ohne Weiteres in seiner Muttersprache vortragen können; es gab Simultanübersetzungen in fünf Weltsprachen. Doch Kardinal Bergoglio wollte Klartext sprechen, vermeiden, dass ihn jemand interpretiert. So hielt er seine Ansprache auf Italienisch, in der Sprache also, die von den meisten Kardinälen verstanden wird.
Die kurze Rede, von Bergoglio mit warmer, samtweicher Stimme kraftvoll und begeistert vorgetragen, überzeugte. Kardinal Reinhard Marx aus München war von ihr ebenso angetan wie der deutsche Kurienkardinal Walter Kasper, der nicht zu den Freunden Benedikts XVI. gerechnet wird. Kardinal Cipriani Thorne aus Lima horchte auf und Kardinal Francis George aus Chicago. Endlich verband jemand den Begriff der Neuevangelisierung nicht mit vagen Phrasen, sondern mit konkreten sozialen Forderungen, einem Plädoyer für Gerechtigkeit und Menschenwürde. Das war anders, das war erfrischend.
»Wir diskutierten immer nur über kirchliche Interna«, stellte Kardinal Thorne fest, »Kardinal Bergoglios Rede aber rief uns auf, auf den Punkt zu kommen: Es geht um Jesus und seine Botschaft!«
Vor allem aber war er ein Außenseiter, dem man zutraute, im Intrigenstadel am Tiber gründlich aufzuräumen. »Wir wollten jemanden, der nicht zum Kurien-System gehört«, erklärte der französische Kardinal Vingt-Trois. 2002 wollte Johannes Paul II. Bergoglio nach Rom berufen, ihm ein bedeutendes Dikasterium anvertrauen. »Bitte nicht, ich würde in der Kurie sterben«, lautete seine Antwort. Schon damals schrieb der italienische Vatikan-Experte Sandro Magister: »Die lateinamerikanischen Kardinäle schätzen ihn zunehmend, ebenso Joseph Kardinal Ratzinger. Die einzige Schlüsselfigur an der Kurie, die zögert, wenn sein Name fällt, ist Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano.« Das konnte aber auch als Empfehlung gewertet werden.
So war es jetzt Bergoglio, der überraschenderweise schon beim ersten Wahlgang etwa gleich so viele Stimmen bekam wie Scola und Ouellet; der so hoch gehandelte Brasilianer Scherer dagegen erwies sich als völlig chancenlos. Noch nie war die alte Konzilsweisheit, dass »wer als Papst in das Konklave geht, als einfacher Kardinal wieder herauskommt«, wahrer als jetzt gewesen.
Als die 115 wahlberechtigten Kardinäle an diesem Abend um 19.15 Uhr in die Vesper gingen, während ihre Stimmzettel verbrannt wurden und exakt um 19.41 Uhr schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtina strömte, war wieder alles offen. Doch beim Abendessen, nach der Rückkehr in das Domus S. Marthae, wurde heftig diskutiert. Und der Name, der dabei am häufigsten fiel, war Bergoglio.
In aller Herrgottsfrühe, um 6.30 Uhr, trafen sich die Purpurträger am zweiten Tag des Konklaves, am Mittwoch, dem 13. März, zum Frühstück. Nach dem Transfer und der Frühmesse in der Capella Paolina (um 8.15 Uhr) schritten sie erneut zur Wahl; zwei Wahlgänge waren für den Vormittag angesetzt, zwei weitere für den Nachmittag.
Doch schon vor dem Mittagessen hatte sich herausgestellt, dass auch Scola keine Chance mehr hatte. Stimmenmäßig lag er weiter vorne, aber es war ihm nicht gelungen, seinen Vorsprung zu vergrößern. Selbst die Italiener standen nicht geschlossen hinter ihm. Im dritten Wahlgang kam er gerade einmal auf rund 50 Stimmen, weit entfernt von der erforderlichen Zweidrittelmehrheit (77 Stimmen). Der Traum von einer Erneuerung des italienischen Papsttums war ausgeträumt, als um 11.38 Uhr erneut schwarzer Rauch aus dem Schornstein aufstieg. Beim Mittagessen zog der Erzbischof von Mailand die Konsequenzen und warf das Handtuch. »Um eine Spaltung der Kirche zu vermeiden«, würde er zugunsten Bergoglios zurückstecken. Der kam dadurch beim vierten Wahlgang gegen 17.00 Uhr auf über 70 Stimmen. Beim fünften Wahlgang anderthalb Stunden später kamen knapp 20 weitere hinzu …
Zu diesem Zeitpunkt stand ich auf dem Petersplatz und starrte auf den schmalen, kupferroten Schornstein, der nur bei einem Konklave aus dem Dach der Sixtina ragt. Noch immer war es bitterkalt und regnete, und wie Zehntausende andere versuchte ich, unter einem der Fünf-Euro-Schirme Schutz zu suchen, die in Roms Straßen bei schlechtem Wetter von Straßenhändlern mit Migrationshintergrund angeboten werden und manchmal sogar einen Tag lang halten.
Für Abwechslung sorgte allein eine Möwe, die sich brennend für den berühmtesten Schornstein der Welt zu interessieren schien. Sie ließ uns rätseln: Tarnte sich hier einer der »corvi«, der »Raben«, die den Vatileaks-Skandal verursacht hatten, und hörte das Konklave ab? Oder war es gar der Heilige Geist im Tarnanzug? Zumindest wurde der geflügelte Entertainer zum beliebten Fotomotiv der Wartenden, während besonders fromme Italiener gar von »un segno«, einem Zeichen, sprachen.
Allmählich nahm der Regen ab, klappten die ersten ihre Schirme zu. Als um 18.30 Uhr die Lichter an der Fassade des Petersdoms eingeschaltet wurden, ging ein Raunen durch die Menge; dabei war es nur die Abendbeleuchtung. Interessanter war, dass sich auch im Staatssekretariat etwas tat.
Dann, exakt um 19.06 Uhr, stieg weißer Rauch aus dem Schornstein auf, erst zögernd, dann aber so üppig, dass kein Zweifel mehr bestand! In ganz Rom begannen die Glocken zu läuten, während Zehntausende auf den Platz strömten.
Besonders laut jubelten die Italiener und die Brasilianer, die glaubten, nur »ihr« Kandidat könne so schnell gewählt worden sein. Mit frenetischen »Evviva il Papa«-Rufen ließen sie einen Mann hochleben, dessen Namen sie noch nicht einmal kannten. Vielleicht vertrauten sie aber auch ganz einfach auf den Heiligen Geist und die Weisheit der Kardinäle. Am gewagtesten freilich reagierte die italienische Bischofskonferenz, die bereits ein Glückwunschtelegramm an Kardinal Angelo Scola schickte.
Auf dem Petersplatz jedenfalls herrschte Volksfeststimmung. So begeistert wurde gesungen, gegrölt und Fahnen geschwenkt, dass man denken konnte, Lazio Roma hätte einen Auswärtssieg errungen und die Mannschaft würde sich gleich, die Meisterschale im Gepäck, auf der Loggia des Petersdoms präsentieren. Nur die Priester und Nonnen, die Kreuze in die Höhe hielten und beteten, ließen noch erahnen, dass man auf einen neuen Papst wartete.
Dann, nach einer endlos langen halben Stunde, wurde es festlich, als eine Blaskapelle der vatikanischen Gendarmerie, gefolgt von der Schweizergarde, auf dem regennassen Sagrato Aufstellung nahm und die vatikanische Nationalhymne spielte. Doch erst um 20.12 Uhr, also eine Stunde und sechs Minuten nach dem fumo bianco, betrat der von seiner schweren Parkinson-Krankheit gezeichnete Kardinalprotodiakon Jean-Louis Tauran die Loggia des Petersdoms, um der Welt die berühmte Formel zu verkünden:
»Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam;
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
Qui sibi nomen imposuit Franciscum.«
(»Ich verkünde Euch eine große Freude: Wir haben einen Papst. [Es ist] Seine Eminenz, der Hochwürdigste Herr Georg Mario, der Heiligen Römischen Kirche Kardinal Bergoglio, der sich den Namen Franziskus zugelegt hat.«)
Ich gebe zu, in diesem Augenblick ging es mir nicht anders als den meisten auf dem berühmtesten Platz der Erde: Auch ich war gleichermaßen überrascht und irritiert. Ich hatte weder die Namen der 115 wahlberechtigten Kardinäle vorher auswendig gelernt, noch, des Regens wegen, das dem L’Osservatore Romano beigelegte Poster mitgenommen, das alle Purpurträger samt Namen und Heimatdiözese zeigte. Auch die 115-seitige Biografiensammlung, die der Sala Stampa della Santa Sede, das vatikanische Presseamt, uns akkreditierten Journalisten am Vortag in die Hand gedrückt hatte, lag trocken auf dem Schreibtisch meiner römischen Mietwohnung. Die acht »papabiles« mit den scheinbar größten Chancen kannte ich natürlich, ebenso gut 40 weitere profilierte Purpurträger, aber ein »Bergoglio« war nicht dabei.
Hatte ich mich verhört, war der Italiener Bagnasco gemeint? Italienisch klang der Name zumindest. Natürlich, es musste ein Italiener sein, so schnell, wie er gewählt worden war. Nur die geradezu ekstatische Begeisterung der Argentinier auf dem Platz hätte mich stutzig machen müssen. Doch sie ging im allgemeinen Jubel unter. Wir hatten einen neuen Papst, das war, was zählte! Und dass er sich Franziskus nannte, nach einem der auch mir liebsten Heiligen, das war zumindest ein gutes Zeichen.
Drei Tage später erklärte der neue Papst auf einer Audienz für die beim Presseamt des Heiligen Stuhls akkreditierten Journalisten, wie es zu dieser Namenswahl gekommen war:
»Bei der Wahl saß neben mir der emeritierte Erzbischof von São Paulo und frühere Präfekt der Kongregation für den Klerus, Kardinal Claudio Hummes – ein großer Freund, ein großer Freund! Als die Sache sich etwas zuspitzte, hat er mich bestärkt. Und als die Stimmen zwei Drittel erreichten, erscholl der übliche Applaus, da der Papst gewählt war. Und er umarmte, küsste mich und sagte mir: ›Vergiss die Armen nicht!‹
Und da setzte sich dieses Wort in mir fest: die Armen, die Armen. Sofort habe ich in Bezug auf die Armen an Franz von Assisi gedacht. Dann habe ich an die Kriege gedacht, während die Auszählung voranschritt bis zu allen Stimmen. Und Franziskus ist der Mann des Friedens. So ist mir der Name ins Herz gedrungen: Franz von Assisi. Er ist für mich der Mann der Armut, der Mann des Friedens, der Mann, der die Schöpfung liebt und bewahrt.«
Ebenfalls erst später wurde bekannt, weshalb wir draußen auf dem Platz so lange warten mussten. Auf die Frage, ob er die Wahl annehme, hatte Kardinal Bergoglio geantwortet: »Ich bin ein großer Sünder. Doch vertrauend auf die Barmherzigkeit und Geduld Gottes, nehme ich unter Schmerzen an.« Dann zog er sich zunächst in den sogenannten Saal der Tränen zurück, um sich zu sammeln – und zu rüsten für den ersten Kampf.
Als er wohl die größte der drei zur Auswahl bereitgestellten weißen Soutanen übergezogen hatte, brachte ihm der päpstliche Zeremoniar, Msgr. Guido Marini, auch eine Reihe goldener Kreuze, von denen er sich eines aussuchen sollte. Franziskus aber, wie er jetzt hieß, lehnte sie ab; er wollte auch weiterhin das schlichte, versilberte Brustkreuz tragen, mit dem er gekommen war und das den »Guten Hirten« zeigt, ein beliebtes Symbol aus der Zeit der ersten Christen.
Auch von den roten Papstschuhen, die in den Größen 42, 43 und 44 bereitstanden, wollte der frisch gewählte 265. Nachfolger Petri nichts wissen. Sie würden weder zu einem Jesuiten passen, der er nun einmal war, noch zu seinem Papstnamen Franziskus. Außerdem müsse er orthopädische Schuhe tragen, und das Paar, das er seit seiner Ankunft aus Buenos Aires getragen hatte, sei praktisch neu; er habe es sich erst kurz vor der Abreise gekauft, weil das letzte Paar ziemlich unansehnlich geworden war.
Marini, ein schmaler, filigraner Mensch mit langen Pianistenfingern und klarer, überraschend hoher Stimme, begann zu schwitzen. Dann holte er die Mozetta, den Überwurf aus rotem Samt, gesäumt von feinstem Hermelinpelz. Papst Franziskus machte wiederum eine abweisende Geste. »Heiligkeit, ich bitte Sie, das müssen Sie tragen! Das haben alle Ihre Vorgänger getragen«, redete Marini mit Engelsgeduld auf ihn ein. »Dann ziehen Sie das doch selber an!«, entfuhr es dem kräftig gebauten Mann in der weißen Soutane. Für einen Augenblick schossen dem Zeremoniar Tränen in die Augen.
Italienische Zeitungen behaupteten gar, Papst Franziskus habe noch ein rüdes »Der Karneval ist vorbei« nachgeschickt, was der bestens informierte Vatikan-Kenner Andrea Tornielli jedoch als »moderne Sage« zurückweist. Auch Stefan von Kempis von Radio Vatican belässt es bei dem oben zitierten Satz, für dessen Authentizität er sich freilich verbürgt: »Die Geschichte klang wie erfunden, aber einige Kollegen, die Zeugen des Auftritts wurden, haben bestätigt, dass es sich genau so abgespielt habe.«
Dann zeigte der neue Papst gleich auch den anderen sein wahres Gesicht. Bevor die Kardinäle ihm gratulieren konnten, schritt er selbst auf einen von ihnen zu, den gehbehinderten Inder Ivan Dias, der in der letzten Reihe sitzen geblieben war, und schüttelte ihm die Hand. Die Glückwünsche der anderen Purpurträger nahm er stehend entgegen, nicht, wie üblich, auf einem goldenen Thron.
Als Nächstes wollte er seinen Vorgänger anrufen, den er die letzten acht Jahre stets bewundert hatte, doch im Bereich der Sixtina funktionierte wegen des Konklaves kein Telefon. Also führte ihn ein Mitarbeiter von Radio Vatican in eine Kammer über der Vorhalle des Petersdoms, die den Radiojournalisten bei den Übertragungen der Papstmessen als Studio dient. Von dort aus rief der neu gewählte Papst in Castel Gandolfo an, doch niemand hob ab. Benedikt XVI. und sein Sekretär Erzbischof Dr. Georg Gänswein saßen zu diesem Zeitpunkt wie Millionen anderer Katholiken vor dem Fernseher, warteten auf das »Habemus Papam« und hörten das Klingeln nicht. Zum Glück hatte einer der Techniker Gänsweins Handynummer, über die schließlich die Verbindung zustande kam. Franziskus versprach seinem Vorgänger, ihn möglichst bald zu besuchen.
Auf dem Weg zur Loggia des Petersdoms hielt der neue Papst schließlich noch inne vor einer Sakramentskapelle, trat ein und versenkte sich minutenlang in den Anblick des Allerheiligsten, während Kardinal Tauran schon einmal das »Habemus Papam«verkündete.
Zehn Minuten später, um 20.22 Uhr, tauchte erst das mittelalterliche Vortragekreuz, dann, ihm folgend, der neue Papst hinter den schweren Samtvorhängen der Loggia auf. Er wirkte ruhig und gefasst, aber auch schockiert, ja geradezu versteinert. Anders als seine Vorgänger, die mit ausladenden Gesten der Masse entgegengetreten sind, winkelte er ein wenig steif den rechten Arm zum Winken an.
»Ich war wie erstarrt«, beschrieb er 2010 dem Journalisten Sergio Rubin seine Reaktion auf die Ernennung zum Weihbischof. »Wenn ich einen derartigen Schlag erhalte, positiv oder negativ, bin ich immer wie erstarrt. Und meine erste Reaktion ist auch immer negativ.«
Doch dann begann er zu sprechen: »Fratelli e sorelle, buonasera« waren seine ersten Worte, die im Jubel der Masse unterzugehen drohten. Schlichte Worte in seinem weichen, südamerikanischen Akzent und seiner warmen, tiefen Stimme, die stets etwas Melancholisches hat. »Carissime« hatte Johannes Paul II. seine »Brüder und Schwestern« noch genannt, »Liebste«. Bei Benedikt XVI., der nie zu Superlativen neigte, waren es meist »Cari fratelli e sorelle«. Und auch das »buonasera« knüpfte an seinen Vorgänger an; der hatte, eigentlich ein Novum, sich 13 Tage zuvor mit einem schlichten »buona notte« (»Gute Nacht«) von den Pilgern in Castel Gandolfo und damit von der Welt verabschiedet. Franziskus fuhr fort:
»Wie ihr wisst, war es die Aufgabe des Konklaves, Rom einen neuen Bischof zu geben. Es scheint so, als hätten meine Brüder, die Kardinäle, ihn gewissermaßen vom Ende der Welt geholt. Doch wir sind hier.«
Spontaner Applaus und Gelächter: Der neue Papst zeigte gerade, dass er Humor hat.
»Danke für euer Willkommen. Die Gemeinschaft der Diözese Rom hat ihren Bischof: Danke! Doch zunächst möchte ich für unseren emeritierten Bischof Benedikt XVI. beten. Lasst uns alle zusammen für ihn beten, dass der Herr ihn segne und die Gottesmutter ihn beschützt.«
Auf den Aufruf zum Gebet folgte ein Wunder. Binnen Sekunden wandelte sich die Stimmung auf dem Platz vom Jubel einer Meisterfeier zur frommen Andacht einer Pilgermesse. Ich bekam eine Gänsehaut, als aus einer Viertelmillion heiserer Kehlen das Vaterunser, das Ave Maria und das Ehre sei dem Vater ertönten. Dann ergriff Franziskus wieder das Wort:
»Und jetzt lasst uns diesen Weg beschreiten, als Bischof und Volk. Diesen Weg der Kirche von Rom, die den Vorsitz in der Liebe führt gegenüber allen Kirchen. Einen Weg der Brüderlichkeit, der Liebe, des gegenseitigen Vertrauens.«