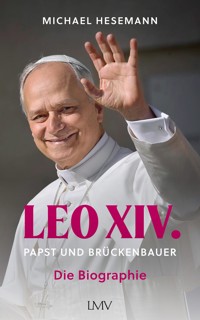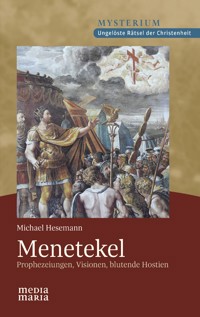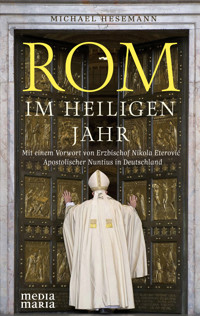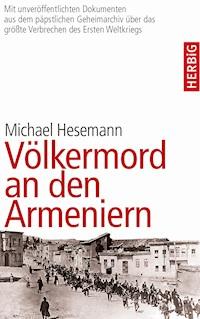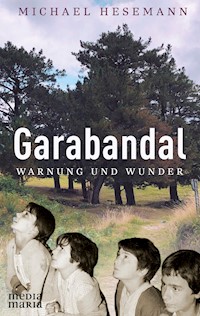
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Media Maria Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Wenn der Papst aus Moskau zurückkehrt, werden gewalttätige Verfolgungen ausbrechen«, erklärte Conchita González, eines der Seherkinder von Garabandal. Zwischen 1961 und 1965 erschien die Gottesmutter vier Mädchen in San Sebastián de Garabandal, einem Bergdorf im Norden Spaniens, und warnte vor einer noch nie dagewesenen Krise des Glaubens und der Kirche zu Beginn des 3. Jahrtausends, die selbst vor Bischöfen und Kardinälen nicht haltmachen würde. Gleichzeitig offenbarte sie den Ausweg aus dieser Krise – und versprach eine Warnung und ein Wunder, die der Welt beweisen würden, dass Gott existiert. Die heiligen Päpste Paul VI. und Johannes Paul II., der heilige Pater Pio und die heilige Mutter Teresa von Kalkutta waren von der Echtheit dieser Erscheinungen überzeugt. Doch erst in unserer Zeit scheinen sich ihre Prophezeiungen zu erfüllen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Michael Hesemann
GARABANDAL
Warnung und Wunder
Die Bibelzitate stammen aus der revidierten Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift
© Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart 2016.
GARABANDALWarnung und WunderMichael Hesemann© Media Maria Verlag, Illertissen 2022Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-9479314-6-0eISBN 978-3-9479318-3-5www.media-maria.de
Inhalt
Einleitung – Der Himmel spricht
1.Wie alles begann
2.Die Enttäuschung
3.Der Engel kehrt zurück
4.Die erste Untersuchung
5.Der Engel spricht
6.Die Gottesmutter erscheint
7.Der dreifache Ruf
8.Die erste Botschaft
9.Die »Entführung« der Seherin
10.Bei den Kiefern
11.Pater Luis und das Wunder
12.Enttäuschung über die Botschaft
13.Die Zeit der Wunder
14.Winter in Garabandal
15.Die Nächte der Schreie
16.Das Wunder der Eucharistie
17.El Milagrucu – »Das kleine Wunder«
18.Das große Wunder
19.Garabandal und das Konzil
20.Die Krise
21.Die Päpste-Prophezeiung
22.Die Warnung
23.Die letzte Botschaft
24.Ein Lebewohl im Regen
25.Reise nach Rom
26.Pater Pio, die Heiligen und Garabandal
27.Der Widerruf
28.Warten auf das Wunder
29.Eine Botschaft für unsere Zeit
30.Reise nach Garabandal
Nachwort – »Gott allein weiß es«
Anhang 1: Conchitas Foto
Anhang 2: Medizinische und psychologische Gutachten über die Seherkinder
Literaturverzeichnis
Bildquellennachweis
EinleitungDer Himmel spricht
Lange war es still geworden um die Marienerscheinungen von Garabandal und es setzten sich die Zweifler durch. Seit 2014 der blinde amerikanische Garabandal-Aktivist Joey Lomangino ausgerechnet am 53. Jahrestag der ersten Begegnung der vier Seherkinder mit dem Erzengel Michael verstarb, sahen viele darin einen Beweis, dass die Erscheinungen nicht wahr sein konnten. Immerhin hatte doch eines der vier Seherkinder, Conchita, in einer Eingebung gehört, dass Lomangino zum Zeitpunkt des endzeitlichen »Wunders« neue Augen bekommen und wieder sehen würde. Jetzt war er tot, ohne dass sich das Wunder ereignet hatte. War damit nicht auch der Glaube an die Übernatürlichkeit der Ereignisse von Garabandal unhaltbar geworden?
Doch auch das hatten die Seherkinder immer vorausgesagt: Vor der prophezeiten Endzeit würde sich etwas ereignen, das Garabandal gewissermaßen den Todesstoß versetzen würde.
Doch dann kam alles ganz anders.
Im März 2020 hatte die Corona-Pandemie auch Europa erreicht. Aus Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitssystems und der Krankenhäuser wurde in fast allen Ländern ein gut zweimonatiger Lockdown verhängt. Das Leben erstarrte: Schulen und Universitäten schlossen, die Gastronomie und der Handel kamen zum Erliegen, jede öffentliche Veranstaltung war verboten. Darunter fiel insbesondere auch das religiöse Leben: Nicht einmal zu Ostern, dem höchsten Fest der Christenheit, durfte das Messopfer öffentlich gefeiert werden. Wochenlang blieben die Kirchen geschlossen, mussten die Gläubigen sich damit begnügen, im Internet per Livestream die Messen des Papstes oder die Privatmessen einiger weniger engagierter Bischöfe und Priester zu verfolgen und geistlich zu kommunizieren.
Dass genau das in Garabandal angekündigt worden war, dass die Seherkinder von der Gottesmutter erfahren hatten, dass eine Zeit kommen würde, in der überall die Kirchen geschlossen und keine Heiligen Messen gefeiert würden, machte die Erscheinungen schlagartig wieder interessant. Etwas, was zur Zeit der Visionen, 1961–1965, noch völlig undenkbar erschien, war plötzlich wahr geworden. Damals, am 31. März 2020, erwähnte ich die Prophezeiungen von Garabandal in meinem viel zitierten Artikel »Marienerscheinungen und die Corona-Krise« auf der katholischen deutsch-österreichischen Nachrichtenseite kath.net, der zum meistdiskutierten und meistgeteilten Beitrag des Monats wurde. Die große Zahl an Anfragen von Lesern, die einfach mehr erfahren wollten, inspirierte mich zu diesem Buch. Immerhin ist es schon gut drei Jahrzehnte her, dass der große deutsche Garabandal-Experte Albrecht Weber, der am 15. November 2015 in Überlingen verstarb und in Garabandal beerdigt wurde, seinen Klassiker Garabandal – Der Zeigefinger Gottes veröffentlicht hatte. Dabei sind so viele Elemente der Prophezeiungen der Kinder erst heute zu verstehen, was wiederum darauf hindeutet, dass die vorausgesagten Ereignisse immer näher rücken.
Natürlich will, kann und darf ich als Historiker nicht das Urteil vorwegnehmen, das nur die Kirche allein über Garabandal fällen kann. Ihre derzeitige Einschätzung ist eine offene: Non constat de supernaturalitate – »Die Übernatürlichkeit steht nicht fest«. Es müssen sich zunächst die Prophezeiungen erfüllen, die von einer Warnung und einem Wunder sprechen, und das soll noch zu unseren Lebzeiten oder, genauer, zu Lebzeiten der heute 73-jährigen Conchita der Fall sein. »Sie werden glauben, wenn es zu spät ist«, sagte 1962 der größte Mystiker unserer Zeit, der stigmatisierte Kapuzinerpater Pio von Pietrelcina, voraus.
Doch sollte tatsächlich die »Mutter Gottes und unsere Mutter« (wie die Seherkinder sie nannten) in Garabandal erschienen sein, so besteht kein Zweifel, dass dies in Fortsetzung der Erscheinungen von Paris (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858) und Fátima (1917) geschah. In Fátima warnte die Gottesmutter vor der Gefahr durch den Kommunismus und bat um die Weihe Russlands an ihr Unbeflecktes Herz, in Garabandal vor der nachkonziliaren Krise der Kirche, vor Apostasie und Abtreibung und rief zum Gebet für die Priester und zur Verehrung der heiligen Eucharistie auf.
Dabei hatte sich die Natur der Erscheinungen in den 44 Jahren zwischen Fátima und Garabandal stark verändert. Maria erschien sehr viel häufiger, ihr Kontakt zu den Mädchen war intensiver und familiärer. Über die Gründe mag man spekulieren, doch gewiss ist die größere Nähe kein schlechtes Zeichen. Wir haben sie bereits bei früheren (wenn auch ebenfalls nicht anerkannten) Erscheinungen erlebt wie in Heede (1937–1940) und Heroldsbach (1949–1952); sie setzt sich fort in den noch andauernden Erscheinungen von Medjugorje (ab 1981).
Beeindruckte in Fátima das große Sonnenwunder vor über 70 000 Zeugen, so sind es in Garabandal die Ekstasen der Kinder selbst, in denen sie der Gottesmutter und dem Erzengel Michael begegneten:
»Auf den Gesichtern der Mädchen lag ein Glanz überirdischer Schönheit. Viele Fotos und Videos beweisen das Strahlen der Mädchen. Sie begannen durch das ganze Dorf zu gehen, vorwärts und rückwärts, ohne auf den steinigen Wegen zu stolpern, immer mit stark zurückgebeugtem Gesicht. Oft bewegten sie sich so schnell, dass nicht einmal die jungen Männer des Dorfes mit ihnen mithalten konnten. Auch Levitationen gab es oder Änderungen des Gewichtes: So konnten zwei Männer ein Mädchen während der Erscheinungen nicht hochheben. Die Mädchen kamen oft von getrennten Orten auf innere Einsprechungen zusammen, trugen oft Kreuze in den Händen, die sie den Umstehenden zum Kuss reichten. Auch hielten sie oft Rosenkränze von Betern Maria zum Kuss hin. Unzählige Male hatten sie Dutzende von Rosenkränzen in der Hand, die sich gegenseitig verketteten, aber sie vermochten während der Ekstasen ohne Blick auf die Umstehenden jedem seinen eigenen Rosenkranz auszuhändigen. In der Ekstase zeigten sie keine Reaktion auf von außen auf sie einwirkende Reize: Sie wurden gezwickt, mit Nadeln gestochen, mit Streichhölzern gebrannt und man streute Sand in ihre Augen, ohne jede Reaktion. Sie waren mit ihren Sinnen wie entrückt.«
Ähnlich wurde schon das Verhalten der vier Seherkinder von Heede im Emsland, Grete (11) und Maria Ganseforth (13), Anni Schulte (12) und Susi Bruns (13), beschrieben, denen die Gottesmutter und das Jesuskind zwischen 1937 und 1940 an 105 Tagen erschienen war:
»Die Anwesenden sahen immer nur, wie die Kinder plötzlich auf die Knie fielen und in auffallend gestreckter Haltung ihre Augen fest auf einen bestimmten Punkt richteten. Vielfach waren die Kinder für äußere Sinneseindrücke – wie Lichtreflexe, Ansprachen oder Berührungen – ganz unempfindlich; manchmal reagierten sie jedoch z. B. auf Fragen. Sie änderten – auch wenn sie einander nicht sehen konnten – gemeinsam ihr Verhalten, sobald sich die Gottesmutter ihrem Blick entzog; und das geschah unabhängig davon, ob sie allein, unter sich oder von einer mehr oder weniger großen Menschenmenge umgeben waren«,
berichtet Dr. Heinrich Eizereif. Ähnliches wurde aus Heroldsbach in Franken berichtet, wo zunächst vier, dann sieben Mädchen zwischen 10 und 11 Jahren die Gottesmutter, Engel und Heilige sahen: »Die Sehermädchen bekreuzigten sich zugleich. Kaum war dieser Vers [des Salve Regina, d. Verf.] gesungen, da knieten ganz plötzlich, wie vom Blitz getroffen, alle Kinder nieder und machten das Kreuzzeichen.« Auch sie machten die Bewegung absolut simultan, während ihr Blick starr zum Himmel gerichtet war, und nahmen nach eigenen Angaben die Reize der Umgebung nicht mehr wahr. Doch erst in Medjugorje wurden diese Trancen mit modernsten wissenschaftlichen Instrumenten untersucht und die Seher von einem Wissenschaftlerteam unter Leitung von Prof. Henri Joyeux von der Universität Montpellier an Elektro-Enzephalografen und Elektro-Okulografen angeschlossen, um festzustellen, was während der Ekstasen in ihren Köpfen vorging. Dabei konnten die Experten jede Pathologie kategorisch ausschließen: Die Seher litten weder unter Epilepsie noch unter Halluzinationen, es gab auch keinerlei Hinweise auf einen psychotischen Zustand:
»Die Augapfelbewegung endet und beginnt [bei allen Sehern und Seherinnen] simultan, auf die Sekunde genau. Während der Ekstase findet eine direkte Interaktion zwischen den Sehern bzw. Seherinnen und einer Person statt, die wir nicht sehen. Das ganze Verhalten der Jugendlichen ist nicht pathologisch: Während der Ekstase sind sie in einem Zustand des Gebets und der interpersonalen Kommunikation. Die Seher und Seherinnen von Medjugorje sind keine Spinner oder Träumer, noch sind sie müde oder aufgeregt; sie sind frei und glücklich, zu Hause in ihrer Heimat und der modernen Welt. Die Ekstasen sind weder pathologische Zustände noch gibt es einen Hinweis auf einen Betrug. Keine wissenschaftliche Disziplin kann diese Phänomene angemessen beschreiben. Wir würden sie als Zustand des aktiven, intensiven Gebetes beschreiben, abgetrennt von der Wahrnehmung der äußeren Welt, ein Zustand der Kontemplation mit einer anderen Person, die nur sie allein sehen, hören oder berühren können.«
Da die Ekstasen der jugendlichen Seher und Seherinnen von Medjugorje (sie waren bei Beginn der Erscheinungen zwischen 15 und 17 Jahre alt, ein Junge war erst 10 Jahre alt) denen der Mädchen von Garabandal gleichen »wie ein Ei dem anderen«, ist es legitim, diese Diagnose auch auf sie zu übertragen. Schlossen die wissenschaftlichen Messungen in Medjugorje jeden Betrug kategorisch aus – gemessene Bewusstseinsveränderungen lassen sich nicht vortäuschen –, so muss das rückwirkend auch für Garabandal gelten. Die vier einfachen, kindlich-naiven Seherkinder hatten ja keine Vorbilder, an denen sie sich orientieren, denen sie nacheifern konnten. Sie kannten sicher die Erscheinungen von Fátima, aber keiner der gängigen Berichte beschreibt ausführlich genug das Verhalten der drei Hirtenkinder während ihrer Ekstasen. Heede und Heroldsbach wurden kirchlich nie anerkannt und waren (und sind bis heute) in Spanien nahezu unbekannt. Medjugorje ereignete sich zwei Jahrzehnte später und könnte allenfalls Garabandal kopiert haben, aber auch das schließt die wissenschaftliche Untersuchung kategorisch aus. So ist es sinnvoller, all diese Erscheinungen als Ausdrucksformen ein und desselben mystischen Phänomens zu verstehen, der Kommunikation und Interaktion berufener Kinder und Jugendlicher mit dem Himmel. Sie sind also als Einheit zu betrachten, als Teile einer Botschaft, die sich allmählich entfaltet und an uns alle gerichtet ist.
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat es keine Zeit gegeben, in der sich die Krisen und Katastrophen derart häufen wie in unserer Zeit. Die Natur scheint aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Die Kirche befindet sich in der größten Krise ihrer Geschichte. Wir erleben einen massenhaften Abfall vom Glauben in der westlichen Welt. Immer deutlicher zeigt die Diktatur des Relativismus ihre hässliche Fratze, werden die Vertreter traditioneller Werte diffamiert, zensiert oder mundtot gemacht. Die Pandemie forderte nicht nur Hunderttausende Todesopfer, sie wurde auch als Vorwand zur Beschneidung bürgerlicher Rechte bis hin zu den Rechten auf körperliche Unversehrtheit und Religionsfreiheit benutzt. Inmitten Europas brach ein Krieg aus, der das Potenzial hat, auf die Nachbarländer überzugreifen. Weltweit kommt es zu Versorgungsengpässen, zu Inflation und Geldentwertung, das Finanzsystem steht vor dem Kollaps, der Wohlstand ist bedroht wie nie zuvor. Eine sinistre Clique globaler Oligarchen rund um das Weltwirtschaftsforum in Davos nutzt die Krise, um uns in einen »Great Reset« zu zwingen, den Umbau unserer Gesellschaft in eine globalsozialistische Weltdiktatur. Bestehende Religionsgemeinschaften werden diffamiert und diskreditiert, weil sie und ihre Werte in dieser »schönen neuen Welt«, in der man »nichts besitzt, aber glücklich ist«, keinen Platz mehr haben. Noch nie in ihrer Geschichte hat die Menschheit besorgter, ja ängstlicher in ihre Zukunft geblickt – und das leider zu Recht.
Die Botschaft des Himmels, wie sie offenbar auch in Garabandal verkündet wurde, ist seine Antwort auf unsere Sorgen, unsere Ängste und unsere Gebete. Darum lohnt es sich umso mehr, ihr Gehör zu schenken. Vielleicht können wirklich nur noch eine Warnung und ein Wunder die Wende bringen, die notwendig ist, um die Welt zu retten. Ganz sicher aber enthält sie den Schlüssel zur Rettung unserer Seelen und zeigt uns den Weg zu Gott, der allein Herr unserer Geschichte, unser Ziel und unsere Zukunft ist.
Düsseldorf, 18. Juni 2022
61. Jahrestag der ersten Erscheinung von GarabandalMichael Hesemann
1.
Wie alles begann
Der Norden Spaniens ist eine Region von rauer, karger Schönheit, ganz anders als der liebliche Osten, das trockene Zentrum oder der sonnendurchflutete Süden des Landes. Seit dem vierten Jahrhundert ist er christlich und blieb das sogar noch, als 712 die muslimischen Mauren das ganze Land besetzten mit Ausnahme der zerklüfteten Berge des Nordens, in denen christliche Ritter Zuflucht suchten und die Rückeroberung des Landes, seine Befreiung vom Islam, vorbereiteten. Einer von ihnen war König Alfons der Keusche, der im frühen 9. Jahrhundert Oviedo zu seiner Hauptstadt machte und dort eine mächtige Kathedrale errichten ließ, die er Christus, dem Erlöser (spanisch: San Salvador), widmete. Viele der kostbaren Reliquien, die aus dem ganzen Land vor den Mauren in Sicherheit gebracht und in einer Grube auf dem Gipfel des Berges Monsacro versteckt worden waren, ließ er in einer Seitenkapelle, der Cámara Santa, deponieren – darunter das Sudarium Domini, das Schweißtuch Christi, getränkt mit dem kostbaren Blut des Erlösers. Andere Reliquien, die Gebeine des Jüngers Jakobus und das Holz des wahren Kreuzes, legte er im äußersten Westen und Osten seines Reiches nieder: in einer Kirche nahe der Märtyrergräber von Finisterre (»Ende der Erde«), die er Santiago de Compostela (»Heiliger Jakobus vom Friedhof«) nannte, und in einem Kloster am Fuße der höchsten Berge Kantabriens, des Pico de Europa (»Spitze Europas«), das er nach einem spanischen Heiligen benannte, der einst in der Jerusalemer Grabeskirche als Hüter der Kreuzreliquie gedient hatte: Santo Toribio de Liébana. Zunächst pilgerte ganz Asturien und Kantabrien, bald das ganze christliche Spanien und schließlich halb Europa auf der alten, römischen Küstenstraße über Santo Toribio und Oviedo nach Santiago, wo damals der erste Jakobsweg (heute: Camino del Norte) entstand. Erst als man zwei Jahrhunderte später einen breiten Streifen zum Landesinneren hin zurückerobert hatte, wurde ein bequemerer Pilgerweg über Burgos und León eingerichtet, der heute als Camino Francés oder »Jakobsweg der Franken« bezeichnet wird. Galt bis dahin Quién visita Santiago y no al Salvador, sirve al criado y olvida al señor (»Wer Santiago besucht und nicht San Salvador« – die Erlöserkathedrale in Oviedo mit der Herrenreliquie – , »dient dem Knecht und vergisst den Herrn«), waren Santo Toribio und Oviedo feste Stationen auf dem Weg zum »wahren Jakob«, dessen neue Grabstätte bei Finisterre die biblische Prophezeiung erfüllte (»Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde«, Apg 1,8), gerieten sie mit dem neuen Pilgerweg bald nahezu in Vergessenheit. Dabei ist Santo Toribio de Liébana, das Kloster mit der größten Kreuzreliquie Europas, nicht weniger als das spanische Golgotha, während Oviedo sein Jerusalem ist. Im Mittelalter waren Oviedo und Santo Toribio ebenso bedeutend wie Santiago de Compostela, was sich darin zeigt, dass die Päpste jedem der drei Wallfahrtsorte ein eigenes »Heiliges Jahr« mit besonderen Ablässen gewährten. In Santo Toribio findet es immer dann statt, wenn der 16. April – der Festtag des heiligen Toribius – auf einen Sonntag fällt; das nächste Mal ist dies 2023 der Fall. Man erreicht das Kloster, wenn man auf der Küstenstraße von Oviedo nach Santander vor den »Picos de Europa« in Richtung Potes nach Süden abbiegt.
Exakt 19,61 Kilometer östlich des »spanischen Golgotha«, jenseits der 1434 Meter hohen, windumpeitschten Peña Ventosa und zu Füßen der 2024 Meter hohen Peña Sagra, liegt auf einem sanften tiefgrünen Hügelrücken des kantabrischen Gebirges, von Schluchten und Tälern umgeben, 497 Meter über dem Meeresspiegel das pittoreske Dorf San Sebastián de Garabandal. Es gehört zum Bistum Santander, das seit Jahrhunderten die Gottesmutter als »Unsere Liebe Frau, die wahrhaft auf den Bergen erschien« (Nuestra Senora Bien Aparecida en la Montaña) verehrt; ein Titel, der auf eine Erscheinung bei Laredo 1605 zurückgeht. In diesem Dorf lebten um 1960 gerade einmal 300 Menschen in 60 ärmlichen Hütten und Häusern, in der Regel aus grauem Naturstein errichtet und von blassroten Ziegeldächern bedeckt, die sich rund um ein karges, windschiefes romanisches Kirchlein kauerten.
56 km Luftlinie südwestlich von Santander liegt San Sebastián de Garabandal auf einem Hügelrücken in den kantabrischen Bergen – hier ein Foto aus der Zeit der Erscheinungen
Im Innern schlicht gehalten, wird es allein durch einen barocken Hochaltar geschmückt, in dessen Zentrum die Statue des Dorfpatrons steht: des römischen Prätorianerhauptmanns Sebastianus, der um 288 von Kaiser Diokletian wegen seines Glaubens zum Tode verurteilt wurde und von numidischen Bogenschützen hingerichtet werden sollte; er überlebte das »Erschießungskommando«, um anschließend erneut seinen Glauben zu bekennen und im Circus mit Keulen erschlagen zu werden. Rechts und links flankieren Gipsstatuen von Jesus und der Gottesmutter den Hochaltar, zudem münden die beiden Seitenflügel der Kirche jeweils in einen bescheidenen Nebenaltar. Nichts davon ist wirklich sehenswert oder gar von kunstgeschichtlicher Bedeutung, doch es passt zu dem schmucklosen, scheinbar vergessenen Bergdorf wie zu dem bescheidenen Leben seiner Bewohner. Auch ihre Häuser waren ärmlich und verfügten noch zu Anfang der 1960er-Jahre nicht einmal alle über fließendes Wasser. Taten sie es doch, dann allenfalls über einen Wasserkran anstelle einer Dusche oder gar einer Badewanne. Als Toilette benutzten viele Bewohner bei gutem Wetter die umliegenden Felder, im Winter oder nachts den eigenen Stall. Es gab weder Telefon noch Fernsehen und Licht spendeten allenfalls einzelne Glühbirnen, zumindest dann, wenn es gerade Strom gab. Man schlief auf einfachen Schlafplätzen aus Laub und Stroh; ein Bett galt als ultimativer Luxus. Als einzige Wärmequelle fungierte die Feuerstelle, die zugleich als Herd diente.
Die Pfarrkirche und der Dorfplatz von Garabandal zur Zeit der Erscheinungen
Das Innere der Dorfkirche von San Sebastián de Garabandal zur Zeit der Erscheinungen
Das Leben der Dorfbewohner war seit Jahrhunderten vom Lauf der Jahreszeiten bestimmt, von Aussaat und Ernte, von warmen, aber niemals heißen Sommern und kalten, immer regenreichen Wintern. Zumindest schützen die Berge das Dorf meist vor den kantabrischen Nebeln, sodass der Himmel nicht den ganzen Winter über grau ist. Doch grau war oft genug der Alltag seiner Bewohner, geprägt von harter Arbeit, von der selbst die Kinder nicht ausgenommen wurden. Das Läuten der Kuhglocken, das Muhen der Tiere und das Plätschern des Dorfbachs bildeten die Geräuschkulisse dieses selten beschaulichen Alltags. Schon immer drehte sich das ganze Leben um die Kühe, die im Frühling auf die Almen getrieben und im Winter in die Ställe geholt wurden, die Aussaat auf den Feldern und das Lagern der Ernte in den Scheunen. Tagsüber brachten die Kinder den Vätern, die oben auf den Almen das Vieh hüteten oder auf den Feldern schufteten, das Essen, hüteten Schafe, fütterten das Vieh oder halfen bei der Ernte mit. Die Mädchen gingen zusätzlich noch ihren Müttern im Haushalt zur Hand. Erst abends verlagerte sich das Leben in die Hütten und Häuser, in denen die Frauen liebevoll das Essen in ihren einfachen Küchen zubereitet hatten, zu dem wärmenden Feuer, um das man herumsaß, dem Lachen der Kinder und dem gemeinsamen Gebet.
Noch vor 60 Jahren hatte Garabandal zwar zwei Schulen, eine für Jungen, die andere für Mädchen, doch ihre höchstens 20 Schüler verpassten oft genug aufgrund ihrer häuslichen Verpflichtungen den Unterricht. So kam es, dass sie meist nicht einmal fehlerfrei schreiben konnten, während sie zum Lesen ohnehin keine Zeit hatten. In Glaubensfragen wurden sie von ihren Eltern unterwiesen, weshalb sie meist nur über grundlegende Kenntnisse der Volksfrömmigkeit verfügten. So verlassen war das Bergdorf, dass es nicht einmal einen eigenen Pfarrer hatte. Nur einmal in der Woche, am Sonntagabend, kam ein Priester aus dem sieben Kilometer entfernten Nachbardorf Cosío zu Pferd nach Garabandal, um in der Kirche des heiligen Sebastian die Beichte zu hören und das heilige Messopfer zu feiern. Ein Arzt kam nur im Bedarfsfall und legte die Strecke zu Fuß zurück. Für Autos war das Bergdorf nur sehr schwer erreichbar. Der einzige, steil ansteigende Weg, der von Cosío zu ihm hinaufführte, war damals noch nicht asphaltiert. So war er im Sommer steinig und holprig, bei Regen schlammig und im Winter glatt. Weil es in Garabandal keine Geschäfte gab, mussten Lebensmittel und Brot in Cosío gekauft und zu Fuß oder auf dem Eselsrücken in einem etwa anderthalbstündigen Marsch in das Dorf transportiert werden. Man lebte buchstäblich »am Ende der Welt«, weitgehend isoliert vom hektischen Treiben der Moderne, dem Licht und Lärm ihrer Städte, in natürlicher Isolation. Und so hatte sich das Leben der Dörfler über die Jahrhunderte kaum verändert, war es von den meisten Moden und Verwirrungen der Neuzeit verschont geblieben, hatte ihr abwechslungsarmes, bescheidenes Leben nur einen einzigen Fixpunkt: den Glauben.
Garabandal aus der Vogelperspektive – ganz oben die Kiefern, zu denen die Calleja, ein Hohlweg, führt
Wenn Spanien damals als eines der katholischsten Länder Europas galt, war Santander wiederum eine seiner konservativsten Diözesen. Garabandal aber wurde immer als das gläubigste Dorf der Diözese betrachtet, ein Ort, an dem in Jahrzehnten niemand ohne den Empfang der Sakramente starb und wo, wenn schon der eigene Pfarrer fehlte, die Gläubigen selbst das religiöse Leben in die Hand nahmen. Jeden Mittag, wenn die Dorfkirche pünktlich um zwölf zum Angelus läutete, unterbrachen sie ihre Arbeit und fielen auf die Knie zum Gebet. Am späten Nachmittag, nach getaner Arbeit, traf man sich in der Kirche, um gemeinsam den Rosenkranz zu beten. Brach der Abend über das Dorf herein, ging eine Frau, die Laterne in der einen Hand, eine Glocke in der anderen, durch das Dorf, um die Nachbarn einzuladen, auch der Toten in ihrem Nachtgebet zu gedenken. Am Sonntag ruhte die Arbeit und man besuchte die Heilige Messe, bevor die Kinder spielen gingen und die Jugend des Dorfes unter den Vordächern der Häuser oder im Freien zum Klang des Tamburins fröhliche Lieder sang und tanzte. Restaurants oder Bars gab es keine, nur eine kleine Taverne; das soziale Leben fand, selbst bei schlechtem Wetter, im Freien statt. So ging es tagaus, tagein, als sei in Garabandal die Zeit stehen geblieben. Nur vom Hörensagen, bei ihren Besuchen in Cosío, erfuhren die Dorfbewohner von den Schrecken des Spanischen Bürgerkrieges, der Befriedung des Landes durch Generalissimo Franco, der fortan mit harter Hand regierte, vom Zweiten Weltkrieg oder dem anschließenden Kalten Krieg. Mehr bewegte sie der Tod des Friedenspapstes Pius XII., die Wahl des gütigen Johannes XXIII. und die Ankündigung eines Konzils, auf dem die Weltkirche beraten sollte, wie sie sich den Herausforderungen der Moderne stellt. Und dennoch war all dies für sie in weiter Ferne, berührte es ihren Alltag nicht, schien sich niemals etwas zu verändern in San Sebastián de Garabandal. Bis sich – urplötzlich und unerwartet – der Himmel öffnete und nichts mehr sein sollte, wie es früher einmal war.
Garabandal heute, von der Erscheinungsstätte aus gesehen
Es begann alles mit einem Spiel. Der 18. Juni 1961 war ein Sonntag, der seinem Namen alle Ehre machte, denn er war sonnig und warm. Wie an jedem Sonntag, so war Valentín Marichalar, der Pfarrer von Cosío, auch an diesem Tag auf dem Pferderücken hinauf nach Garabandal gekommen, um in der Dorfkirche die Sonntagsmesse zu feiern. Nach dem Schlusssegen trafen sich die Dorfbewohner auf dem Dorfplatz, um wieder einmal allerlei Belanglosigkeiten auszutauschen: Es ging um das Vieh, den Zustand der Weiden oben auf den Almen oder das Wetter – die dringliche Frage, ob es in den nächsten Tagen wieder regnen würde oder nicht. Die Kinder dagegen vertrieben sich die Zeit mit unschuldigen Spielen.
Eines der Kinder war die zwölfjährige Conchita González González1, die jüngste von vier Geschwistern, die mit drei Brüdern aufwuchs und trotzdem nie die »kleine Prinzessin« ihrer Familie war. Ihr Vater war schon früh verstorben und so musste ihre Mutter Aniceta die vier Kinder allein durchbringen, was harte Arbeit auf den Feldern bedeutete. Da musste die ganze Familie mithelfen, Conchita inklusive, die, anders als ihre Brüder, zusätzlich ihrer Mutter beim Kochen und bei der Hausarbeit half. Sie war groß und schlank, größer als die anderen Mädchen ihres Alters, und hatte ihre langen schwarzen Haare zu zwei Zöpfen geflochten, während die meisten ihrer Freundinnen praktische Kurzhaarfrisuren trugen. Ihre dunkelbraunen Augen leuchteten warm und spiegelten ihr freundliches, ja herzliches Wesen wider. Ansonsten galt sie als stilles, folgsames, bescheidenes Mädchen, bei dem nur manchmal der Schalk durchkam, etwa wenn sie mit ihrer Cousine Lucía Fernández zusammen war und den einen oder anderen Schabernack ausheckte. Man sah ihr an, dass sie einmal eine echte Schönheit werden würde.
Ihre beste Freundin war die zehnjährige Mari Cruz González Barrido2, ein schmales Mädchen, dessen kurze, von ihrer Mutter geschnittenen Haare sie eher burschikos erscheinen ließen. Ihre Eltern, Escolástico und Pilar, waren ärmer als die der meisten anderen Kinder, was sie immer ein wenig verlegen machte. Ihr Vater kränkelte und haderte mit seinem Schicksal, während ihre Mutter umso besorgter um die Zukunft ihrer Kinder war. Sie gehörte gewissermaßen zur Unterschicht des Dorfes und auch ihr religiöser Eifer hielt sich in Grenzen, was ihre Marginalisierung nur noch verstärkte.
»Komm, lass uns ein paar Äpfel pflücken«, flüsterte Conchita ihr zu. »Oh ja!«, antwortete Mari Cruz. »Im Garten des Lehrers wachsen die besten!«, wusste ihre Freundin. »Aber sag niemandem etwas davon!«3
Doch kaum entfernten sich die beiden Mädchen von der Gruppe, fragten die anderen Kinder, wo sie denn hingehen würden. »Dahinten hin!«, erwiderte Conchita bewusst vage. Sie glaubte, dass niemand ihr und Mari Cruz folgen würde. Auf dem Weg zum Lehrer-Grundstück, das am Südrand des Dorfes lag, überlegten die beiden Mädchen, wie sie am besten über die Mauer klettern und die Äpfel stehlen könnten. Dort angekommen, machten sie sich ans Werk. Sie genossen das kleine Abenteuer, das ein wenig Abwechslung in ihr monotones Landleben brachte. Doch kaum hatten sie genug Äpfel eingesammelt, bemerkten sie, wie drei Mädchen nach ihnen suchten. Eines von ihnen war Jacinta González González4, die nur zwei Monate jünger als Conchita, aber einen halben Kopf kleiner war. Mit ihrem rundlichen Kindergesicht unter der Pilzkopffrisur konnte sie herzlich schalkhaft lachen, auch wenn sie sonst ein eher scheues Mädchen war. Sie wuchs mit sieben Geschwistern bei ihren tiefgläubigen Eltern Simón und María auf. Bei ihr war María Dolores Mazón González5, das kleinste der vier Mädchen, obwohl sie nur vier Tage jünger als Jacinta und ebenfalls zwölf Jahre alt war, dabei ziemlich selbstbewusst und von leicht gedrungener Gestalt. Sie wurde auch Mari Loli oder einfach Loli genannt und war das zweite von sechs Kindern des Ehepaares Ceferino und Julia. Ihr Vater war der Ortsvorsteher und besaß neben einem kleinen Stück Land auch die einzige Taverne von Garabandal. Ein drittes Mädchen namens Ginia begleitete sie.
»Conchita, du klaust ja Äpfel!«, rief Jacinta ihr mit gespielter Empörung zu.
»Sei still«, zischte Conchita, »wenn du hier rumbrüllst, hört dich noch die Frau des Lehrers und erzählt meiner Mutter davon!«
Aus Angst, jemand könnte sie sehen, ging sie in die Hocke und versteckte sich zwischen den Pflanzen eines kleinen Kartoffelfeldes, das an das Grundstück des Lehrers grenzte. Mari Cruz dagegen lief davon, so schnell sie konnte.
»Bleib stehen, Mari Cruz!«, rief Loli ihr nach. »Wir haben alles gesehen und werden es dem Besitzer sagen.«
Das Mädchen hielt inne, drehte um und kehrte zu seiner Freundin zurück. Jetzt kam auch Conchita aus ihrer Deckung hervor. Für einen Augenblick waren sie zu fünft. Dann hörte Ginia, wie ihre Eltern nach ihr riefen und rannte davon. Nun nur noch zu viert, standen die Mädchen zusammen und diskutierten das Geschehen, bis Conchita die anderen überzeugte, ihr beim Äpfelklau zu helfen.
Die vier Sehermädchen von Garabandal: Conchita (12), Mari Cruz (11), Loli (12) und Jacinta (12)
Sie waren ganz in ihren Kinderstreich versunken und hatten jede Menge Spaß dabei, als die Stimme des Lehrers die Stille durchbrach. »Concesa, geh mal in den Garten und verscheuche die Schafe«, sagte er zu seiner Frau, »sie treiben sich wieder bei dem Apfelbaum herum!« Die vier konnten sich das Lachen kaum verkneifen. Schnell stopften sie sich die Taschen voll und rannten davon, um in einiger Entfernung ihre Beute zu genießen.
Kaum hatten sie die Calleja erreicht, den steinigen alten Hohlweg, der von den Weiden zum Dorf und zur Straße nach Cosío führt, begann der Apfelschmaus. »Die sind ja noch sauer!«, nörgelte Jacinta. »Hör auf, dich zu beklagen«, erwiderte Conchita, um trotzig zu flunkern: »Mir schmecken sie!«
In diesem Augenblick durchbrach lautes Donnergrollen die ländliche Idylle. »Hört ihr das?«, fragte Mari Cruz. »Ja, es hat gedonnert!«, bestätigte Mari Loli. »Das heißt, dass es regnen wird«, prophezeite Conchita. Sofort richteten sich die Blicke der vier Mädchen auf die Peña Sagra, die oft genug von dunklen Regenwolken gekrönt war, doch dort war kein Wölkchen zu sehen. Ebenso wenig über den Bergen im Westen, wo viele Unwetter ihren Ursprung hatten. Im Dorf schlug eine Uhr – es war 20.30 Uhr.
Der Donnerschlag erinnert an das, was Bernadette Soubirous berichtete, als sie am 11. Februar 1858 am Ufer des Flusses Gave mit zwei anderen Mädchen aus Lourdes Holz sammelte. »Plötzlich hörte ich ein lärmendes Geräusch«, erinnerte sie sich später. »Ich schaute zum Wald hinüber, doch die Bäume bewegten sich nicht. Dann erhob ich meine Augen zu der Grotte [am Ufer des Flusses] und ich sah eine Frau, in Weiß gekleidet, mit einem himmelblauen Gürtel und einer gelben Rose auf jedem ihrer Füße, in derselben Farbe wie die Perlen ihres Rosenkranzes …«
Auch die Kinder von Fátima vermuteten zunächst ein Gewitter, als sie am 13. Mai 1917 beim Schafehüten mittags um zwölf in der Cova da Iria (»Mulde der heiligen Irene«) von einem Lichtblitz geblendet wurden. Sie wollten schon die Herde zurück in den Stall treiben, als ein noch grellerer zweiter Blitz ihre Aufmerksamkeit auf eine nahe gelegene Korkeiche lenkte, über der eine wunderschöne, weiß gekleidete Frau in einem hellen Licht schwebte. Sie würde fortan an jedem 13. eines Monats mittags um zwölf zurückkehren, bevor am 13. Oktober ein Sonnenwunder auch die hartnäckigsten Skeptiker von der Übernatürlichkeit des Geschehens von Fátima überzeugte.
Diese Wetterphänomene haben biblische Parallelen, nicht nur im Blitz und Donner, in dem Gott selbst auf dem Berg Sinai dem Mose erschien und sein Gesetz diktierte. Auch in der Apostelgeschichte beginnt das Pfingstereignis, die Herabkunft des Heiligen Geistes, mit einem gewitterähnlichen Phänomen: »Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen« (Apg 2,2). Damals war es, als der Apostel Petrus in Ekstase6 den Propheten Joel zitierte:
»In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott: Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen haben, und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen, und sie werden prophetisch reden. Ich werde Wunder erscheinen lassen droben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde […]« (Apg 2,17–19).
Mit der Quelle von Lourdes, die von Bernadette unter der Erscheinungsgrotte freigelegt wurde und deren Wasser seitdem Tausende heilte, aber auch mit dem Sonnenwunder von Fátima scheint sich die Prophezeiung der »Wunder am Himmel und Zeichen auf der Erde« erfüllt zu haben. Pfingsten wurde zur Geburtsstunde der Kirche. Und doch traf es selbst die Jünger Jesu völlig unerwartet und überraschend wie Jahrhunderte später die kleine Bernadette oder die Hirtenkinder von Fátima. Dabei waren sie nicht allein; ausdrücklich erwähnt die Apostelgeschichte die Anwesenheit der Gottesmutter Maria im Abendmahlssaal von Jerusalem, dem »Obergemach«, in dem sich auch das Pfingstereignis zutrug. Dort, »in einer Atmosphäre des Hörens und des Gebets, ist sie gegenwärtig, bevor die Türen weit geöffnet werden und sie beginnen, Christus, den Herrn, allen Völkern zu verkündigen und sie zu lehren, alles zu befolgen, was er geboten hat«, wie es Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache vom 14. März 2012 erklärte. Dort, wo sich Kirche ereignet und der Himmel offenbart, ist die Mutter der Kirche nahezu selbstverständlich präsent.
Die Mädchen in der Calleja, in der ihnen der Engel erschien
Von alldem aber ahnten die vier Mädchen von Garabandal zu diesem Zeitpunkt noch nichts, im Gegenteil: Sie waren noch ganz im Weltlichen verankert, als das Übernatürliche über sie hereinbrach. So wie Bernadette Holz sammelte oder die Kinder von Fátima ihre Schafe hüteten, so wie Mose die Herde seines Schwiegervaters Jitro weidete oder Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, ausgerechnet noch, um Christen zu verfolgen, als »ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte«, er zu Boden stürzte und die Stimme Jesu vernahm (Apg 9,3–4). Verglichen mit seinem Wüten »mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn« (Apg 9,1) war Conchitas Äpfelklau gewiss eine Bagatelle, ein harmloser Kinderstreich. Doch trotzdem meldete sich bei den Mädchen ihr Gewissen, nachdem sie alle Äpfel gegessen hatten.
»Was wir getan haben, war nicht richtig«, meinte Jacinta, »unsere Schutzengel müssen sehr traurig sein.« So hatte es ihnen der Pfarrer im Katechismusunterricht beigebracht. »Wir sollten uns wirklich schämen«, räumte jetzt auch Conchita ein: »Die Äpfel, die wir genommen haben, gehörten uns nicht. Jetzt freut sich der Teufel, und unsere armen Schutzengel leiden. Komm, lass uns den Teufel bestrafen!« Alle vier Mädchen bückten sich, hoben Steine vom Boden auf und warfen sie mit aller Kraft nach ihrer linken Seite, wo im Volksglauben ihrer Heimat der Teufel saß (der Schutzengel wurde rechts verortet). Als sie vom Werfen müde wurden und ihr Gewissen beruhigt hatten, begannen sie, mit den Steinen »Murmeln« zu spielen. Dazu saßen sie im Kreis und blickten einander an.
Einen Augenblick später wurde Conchita von etwas abgelenkt, das sie später als »eine sehr schöne Gestalt, die hell leuchtete, dabei aber gar nicht meine Augen blendete« beschrieb. Die anderen drei Mädchen dagegen sahen nur, wie sie in Ekstase fiel. Ohne die geringste Ahnung, was das zu bedeuten hatte, erlebten sie, wie ihre Freundin ihre Hände umklammerte und nur noch »Ay, ay! Oh, oh!« stammelte. In dem Glauben, dass sie einen Anfall hatte, wollten sie schon ihre Mutter holen, da fielen auch sie in Ekstase und stammelten ebenfalls: »Ay! Oh! Der Engel …!« Es folgte bei allen vieren ein andächtiges, staunendes Schweigen. Auch der Engel schwieg, bevor er sich buchstäblich in Luft auflöste.
Heute erinnert ein kleines Denkmal an die Stelle, an der den vier Mädchen der Engel erschien
Als die Kinder allmählich wieder zu sich kamen, überwältigte sie die Angst. So schnell sie konnten, liefen sie zur Dorfkirche. Dabei kamen sie am Dorfplatz vorbei, auf dem mittlerweile getanzt wurde. Ein kleines Mädchen aus dem Dorf, Pilar, genannt »Pili«, war die Erste, die das verschreckte Quartett bemerkte.
»Ihr seid ja richtig blass und seht verängstigt aus«, fragte sie die vier Mädchen, »was habt ihr gemacht?«
»Äpfel gepflückt«, erwiderte Conchita, die im gleichen Moment von einem tiefen Schamgefühl erfüllt wurde, doch nicht anders konnte, als die Wahrheit zu sagen.
»Und darum seht ihr so aus, wie ihr ausseht?«, hakte Pili nach.
»Nein, wir haben einen Engel gesehen!«, schoss es gleichzeitig aus allen vier Mündern.
Pili dachte einen Augenblick nach, dann kamen ihr Zweifel: »Wirklich?«
»Ja! Ja!«, riefen die Mädchen ihr zu, während sie weiter zur Kirche hetzten.
Fünf Minuten später wusste dank Pili das halbe Dorf von der Erscheinung.
Als Conchita, Mari Cruz, Loli und Jacinta den Eingang der Kirche erreicht hatten, zögerten sie, dort einzutreten. Stattdessen gingen sie um das romanische Gotteshaus herum, um an dessen Rückseite in Tränen auszubrechen. Dabei begegneten sie drei Mädchen, die dort spielten. »Warum weint ihr denn?«, fragten diese die vier. »Weil wir einen Engel gesehen haben«, lautete ihre Antwort. »Was? Das müssen wir sofort der Lehrerin erzählen!« – und weg waren sie! Während die kleinen Seherinnen zur Kirchentür zurückkehrten und das Gotteshaus betraten, tauchte ihre Lehrerin, Doña Serafina Gomez, in der Kirche auf. Sie wirkte aufgeregt und stellte die Mädchen ohne Umschweife zur Rede:
»Drei meiner Schülerinnen haben mir gerade gesagt, dass ihr einen Engel gesehen haben wollt. Ist das wahr?«
»Ja, Señora, ja!«, antworteten sie, wobei sie heftig nickten.
»Das könnt ihr euch auch eingebildet haben«, meinte die Lehrerin.
»Nein, Señora, nein. Wir haben ihn wirklich gesehen!«, insistierten sie.
»Wie hat er denn ausgesehen?«
»Er trug ein langes, nahtloses blaues Gewand. Er hatte recht große rosafarbene Flügel.7 Sein Gesicht war klein. Es war nicht lang und es war nicht rund, sondern irgendwo dazwischen. Seine Augen waren braun. Er hatte schmale Hände und kurze Fingernägel. Seine Füße konnten wir nicht sehen. Er sah aus wie ein Neunjähriger. Doch obwohl er wie ein Kind erschien, machte er doch den Eindruck, dass er sehr stark ist.«
In jedem Detail stimmten die vier Mädchen überein. Doña Serafina, die jedes der Mädchen aus dem Schulunterricht kannte, konnte gar nicht anders, als ihnen zu glauben. Sie wusste einfach, dass Conchita und ihre Freundinnen keine Lügnerinnen waren.
»Na, wenn das wirklich so ist, dann geht zu Jesus im Allerheiligsten und betet zum Dank eine Station«, ermahnte die Lehrerin sie. Eine »Station« war in Spanien eine beliebte Andachtsform. Man betete sieben Mal das »Vaterunser«, sieben »Gegrüßet seist Du, Maria«, sieben »Ehre sei dem Vater«, das Glaubensbekenntnis sowie ein weiteres Vaterunser in der Meinung des Heiligen Vaters.
So betraten die vier Mädchen das Gotteshaus, knieten in den Kirchenbänken nieder und beteten andächtig, bevor sie sich mit einem Gemisch aus Angst und Freude auf den Heimweg machten. Es war mittlerweile weit nach 21.00 Uhr.
Conchita wurde zu Hause schon ungeduldig von ihrer strengen Mutter Aniceta erwartet, die gerade das Abendessen zubereitete.
»Habe ich dir nicht gesagt, dass du zu Hause sein sollst, solange es noch hell ist«, fuhr sie das Mädchen an, »und jetzt ist es schon dunkel! Wo hast du dich nur herumgetrieben?«
Conchitas Herz raste. Sie stand noch unter dem Eindruck der Erscheinung, der sie überwältigt hatte, doch die Standpauke ihrer Mutter riss sie in die raue Wirklichkeit zurück. Statt ins Haus zu gehen, in die Küche, in der ihre Geschwister saßen, lehnte sie sich an den Türpfosten, nahm all ihren Mut zusammen und erklärte ihrer Mutter mit leiser Stimme: »Ich habe einen Engel gesehen!«
Doch diese Erklärung setzte in Anicetas Augen dem vermeintlichen Fehlverhalten ihrer Tochter nur noch die Krone auf. »Du kommst nicht nur viel zu spät, Du wagst es auch, mir einen solchen Unsinn zu erzählen? Fällt dir keine bessere Ausrede ein, als mir mit einem Engel zu kommen?«
»Aber ich habe wirklich einen Engel gesehen«, erwiderte Conchita kleinlaut. Die Mutter wiederholte ihre Standpauke, doch nicht mehr mit derselben Heftigkeit wie beim ersten Mal. Sie wusste, dass ihre Tochter keine Lügnerin war. Wenn Conchita so sehr darauf bestand, dann musste an der Sache doch etwas dran sein.
Conchitas Elternhaus
Es war jetzt 21.30 Uhr, als Conchita endlich das Haus betrat, um den Rest des Abends vor dem Schlafengehen eher schweigend zu verbringen.
»Ich beließ es dabei«, erklärte Aniceta später, »denn ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief, als meine Tochter darauf bestand, einen Engel gesehen zu haben. Irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Ich fragte mich, was sie gesehen haben könnte, aber ich stellte Conchita keine weiteren Fragen und sprach an diesem Abend auch mit niemandem mehr darüber.«
Jacintas Mutter glaubte ihrer Tochter zunächst kein Wort. Erst allmählich »begann ich, ihr ein bisschen zu glauben«, gab sie später zu Protokoll. »Wieder etwas später respektierte ich ihre Erscheinungen … und dann gab es wieder Zeiten, zu denen die Zweifel zurückkehrten.« Ihr Vater, Simón González González, reagierte ebenso skeptisch. Obwohl (oder gerade weil) er tief in seinem Innern spürte, dass seine Tochter nicht gelogen hatte, riet er ihr, mit niemandem darüber zu sprechen. Auch bei ihrem Bruder, der ausgerechnet Miguel Ángel (»Engel Michael«) hieß, fand sie keinen Glauben. »Damals hielt ich das für eine Farce«, erklärte er dem spanischen Autor Rámon Pérez. »Als Jacinta mir erzählte, sie hätte etwas gesehen, das einem Engel geglichen hätte, erklärte ich ihr: ›Unsinn! Das muss ein Vogel gewesen sein!‹«
Am härtesten traf es Mari Cruz. Ihre Mutter Pilar bekam einen Wutanfall. »Was erzählst du für einen Unsinn!«, schrie sie ihre Tochter an, bevor sie zu einer schallenden Ohrfeige ausholte. »Ich werde deine Lügen aus dir herausprügeln!« Weinend ging das verschüchterte Mädchen zu Bett, voller Angst vor dem, was der nächste Tag bringen und wie ihre jähzornige Mutter darauf reagieren würde.
1Geb. am 17. Februar 1949.
2Geb. am 21. Juni 1950.
3Die wörtliche Rede basiert auf Conchitas Wiedergabe der Ereignisse in ihrem Tagebuch, das sie im Sommer 1963, zwei Jahre nach den Ereignissen, verfasste und das von dem Assumptionistenpater Joseph A. Pelletier AA 1971 herausgegeben wurde.
4Geb. am 27. April 1949.
5Geb. am 1. Mai 1949.
6Die Juden dachten zunächst, die Jünger Jesu seien betrunken, obwohl es gerade einmal 9 Uhr früh war.
7Jahre später erklärte Conchita, dass es »nicht wirklich Flügel« gewesen seien: »Sie waren nicht mit dem Körper verbunden. Sie waren mehr wie ein Schein, als würde ein Licht hinter ihm leuchten.«
2.
Die Enttäuschung
Am nächsten Morgen – es war Montag, der 19. Juni 1961 – verbreitete sich die Nachricht von den Ereignissen des letzten Abends in Garabandal wie ein Lauffeuer. Noch bevor die Kinder aufgestanden waren und sich auf den Weg in die Schule gemacht hatten, sprach jeder im Dorf über sie. »Diese vier Mädchen müssen wirklich etwas Unglaubliches gesehen haben. Habt ihr den Ausdruck in ihren Gesichtern gesehen, als sie von der Calleja herunterkamen?«, meinten einige. »Das muss einer dieser großen Vögel gewesen sein, den die gesehen haben«, versicherten andere, »es war doch schon fast dunkel.« – »Vielleicht ist ihnen auch ein kleiner Junge begegnet, als sie so vor sich hinträumten«, lautete ein weiterer Einwurf. Jeder hatte sich schon eine Meinung gebildet, bevor man überhaupt Conchita, Jacinta, Mari Loli oder Mari Cruz nach ihrem Erlebnis fragen konnte. Sie waren an diesem Morgen das Gesprächsthema Nummer eins in ihrem Dorf, so viel war jedenfalls sicher. »An diesem Tag sprach niemand über etwas anderes«, erinnert sich Conchita in ihrem Tagebuch.
Als sie kurz vor 10.00 Uhr früh zur Schule ging, versuchten ihre Nachbarn, sich Klarheit zu verschaffen: »Wie hat er denn ausgesehen, dieser Engel?«, wurde sie immer wieder gefragt, mal mit einem Unterton von Neugierde, mal geradezu andächtig und gläubig, dann wieder mit kaum überhörbarem, beißendem Spott. Den anderen Mädchen ging es nicht besser. »Wir waren so glücklich, dass wir diese wunderschöne Gestalt gesehen haben, dass wir ihnen gerne alles erzählten«, meinte Conchita später, »die meisten Leute lachten über uns, aber das kümmerte uns nicht, denn wir wussten ja, dass es wahr war.«
Mari Cruz, Jacinta, Conchita und Loli
In der Schule stellte ihre Lehrerin sie noch einmal zur Rede: »Kinder, seid ihr euch denn sicher über das, was ihr mir gestern erzählt habt?«
»Ja, Señora, wir sahen wirklich einen Engel«, bestätigten sie. Doña Serafina Gomez beließ es dabei, ohne weitere Fragen zu stellen. Die anderen Mädchen in der Klasse staunten nur. Dann begann der Unterricht. »Alles war wie immer und wir machten uns keine Sorgen mehr«, hielt Conchita fest.
Nicht aus dem Grübeln heraus kam dagegen ihr Pfarrer Valentín Marichalar aus dem Nachbardorf Cosío, zu dem die Gerüchte um die Vision der Kinder längst vorgedrungen waren. Er war besorgt und ein wenig nervös an diesem Morgen, denn er ahnte, welche Herausforderung die Spekulationen um ein mögliches Wunder für ihn bedeuten würde. Wie auch immer er damit umging, es barg das Risiko einer Spaltung seiner Gemeinde in sich. Würde er die »Erscheinung« in Bausch und Bogen verdammen, würde er vielleicht nicht nur den Kindern unrecht tun, es könnte auch die Eltern und alle, die ihnen glaubten, gegen ihn aufbringen. Würde er sie gutheißen, könnte er bald als leichtgläubig und naiv gelten, vielleicht sogar als wundersüchtiger Opportunist. Das würde das Vertrauen seiner Schäflein in ihn erschüttern, seine Glaubwürdigkeit infrage stellen. Stellte sich schließlich heraus, dass alles doch nur ein Scherz der Kinder oder eine Sinnestäuschung war, wäre er fortan das Gespött der Leute, der Lächerlichkeit preisgegeben. Für all das würde er von seinem Vorgesetzten, dem Apostolischen Administrator von Santander [das zur Zeit der ersten Erscheinungen noch keinen neuen Bischof hatte, d. Verf.], zur Rechenschaft gezogen werden. Kaum etwas fürchtet die Kirche mehr als die Entwicklung unkontrollierbarer Kulte, basierend auf fragwürdigen Privatoffenbarungen. Darum galt es, hier von Anfang an Klugheit walten zu lassen. Er würde der erste und gründlichste Untersucher der fraglichen Erscheinung werden, beschloss er an diesem Morgen. Doch zunächst musste er warten, bis die Kinder aus der Schule kamen. So machte er sich auf den Weg, um pünktlich zum Schulschluss um 13.00 Uhr in Garabandal zu sein, wo er die Mädchen auf dem Rückweg von der Schule abfangen und befragen wollte.
Jacinta und Mari Cruz, die sich gemeinsam auf den Heimweg gemacht hatten, waren die Ersten, denen er im Dorf begegnete. Auffällig nervös, konfrontierte er sie ohne viel Federlesens:
»Nun, nun, ist es wahr, dass ihr einen Engel gesehen habt?«
»Si, Señor«, lautete die ebenso direkte Antwort der beiden Mädchen, »jawohl, mein Herr!«
»Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr da nicht einen Fehler gemacht habt«, stotterte er offensichtlich verblüfft.
»Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen«, erwiderte Jacinta lächelnd, »wir haben wirklich einen Engel gesehen.«
Die Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der die Kinder das Unglaubliche bestätigten, ließ den Pfarrer frappiert zurück, während die Mädchen nach Hause eilten, wo ihre Mütter mit dem Mittagessen auf sie warteten.
Nachdenklich, doch keineswegs weniger besorgt, eilte Pfarrer Marichalar zu Conchita. Sie war die Älteste von den vieren, von ihr erwartete er die reifste, reflektierteste Antwort auf seine Fragen. Er traf sie in der Nähe ihres Elternhauses. Nach wie vor wirkte er ziemlich nervös, als er dem Mädchen die alles entscheidende Frage stellte: »Conchita, sei ehrlich: Was hast du gestern Abend gesehen?« Aufmerksam hörte er sich ihre Antwort an, stellte immer wieder Zwischenfragen, bat hier und dort um eine Klarstellung und versuchte, freilich vergeblich, die Zwölfjährige in Widersprüche zu verwickeln. Am Ende musste er eingestehen, dass es keine solchen gab – weder in ihrem Bericht noch zu dem, was die beiden anderen Mädchen ihm erzählt hatten. »Nun denn, wenn du ihn heute Abend wieder siehst, frag ihn, wer er ist und warum er gekommen ist«, beendete er das Gespräch. »Wir werden sehen, was er darauf antwortet.« Conchita versprach, dies zu tun. Dann machte er sich auf den Weg zu Loli, um ihr dieselben Fragen wie Conchita zu stellen. Doch auch bei ihr stieß er auf keinen einzigen Widerspruch zu den Schilderungen der anderen drei Mädchen. Schließlich verabschiedete er sich von der Zwölfjährigen mit den Worten: »Gut, dann warten wir mal zwei oder drei Tage und schauen, ob ihr dieses schöne Wesen, den Engel, wie du sagst, wieder seht und was er euch dann zu sagen hat. Ich warte so lange, bis ich Seine Exzellenz [den Apostolischen Administrator, d. Verf.] über die Geschichte informiere.«
Pfarrer Valentín Marichalar und Jacinta (links)
Nach dem Mittagessen mussten die Kinder zurück zur Schule, wo um 15.00 Uhr der Nachmittagsunterricht begann. Als dieser vorüber war, gegen 17.00 Uhr, kehrte Conchita nach Hause zurück, wo ihre Mutter sie zum Milchholen schickte. Die Frau, die ihrer Familie jeden Tag frische Kuhmilch verkaufte, eine Freundin ihrer Mutter, hatte natürlich auch schon von dem Erlebnis der vier Mädchen erfahren. »Ist das wahr, was die Leute erzählen«, fragte sie Conchita, »habt ihr wirklich einen Engel gesehen?«
»Ganz sicher haben wir das!«, erwiderte die Zwölfjährige.
»Wie ist das denn passiert?«, wollte die Bäuerin wissen.
Conchita holte aus und erzählte ihr alles von Anfang an.
Die Frau lächelte. »Da ich weiß, dass du gut erzogen bist, glaube ich dir«, erwiderte sie. »Du hast wohl wirklich einen Engel gesehen. Aber die anderen ganz bestimmt nicht!«
»Aber wir haben ihn alle vier gesehen!«, entgegnete Conchita ihr geradezu trotzig, nahm die Milch und trug sie zu ihrer Mutter, von der sie sich auch gleich wieder verabschiedete: »Mama, ich geh’ jetzt zum Beten in die Calleja!«
Ihr Bruder Aniceto, der zusammen mit dem Maurer Pepe Diez etwas am Haus reparierte, hörte das und redete ihr ins Gewissen: »Geh bitte nicht! Willst du, dass die Leute über dich und uns lachen, weil du allen erzählst, du hättest einen Engel gesehen, obwohl jeder weiß, dass das nicht stimmt? Bleib bitte hier!«
Pepe, der Maurer, lachte: »Lass sie doch einfach gehen! Es schadet doch niemandem, wenn sie dort betet.«
Doch Aniceto blieb bei seiner Meinung und seine Mutter pflichtete ihm bei. Conchita versuchte, sie zu überzeugen, bat und bettelte, zunächst vergeblich. Erst als die drei anderen Mädchen sie riefen, gab Aniceta González, Conchitas Mutter, schließlich nach.
»Ay, Dios mío! – Ach, mein Gott, in welche Schwierigkeiten hast du uns gebracht!«, rief sie ihrer Tochter noch nach, als diese bereits zu ihren Freundinnen rannte. Dann drehte sich Conchita noch einmal kurz um und versuchte, ihre Mutter zu beruhigen: »Es gibt keine Schwierigkeiten!«
»Was, wenn wirklich wahr ist, was sie sagt …«, schoss es Aniceta in diesem Augenblick durch den Kopf, »… und ich es wäre, die sie daran gehindert hätte hinzugehen? …«
Doch zunächst wurde der Weg zur Calleja, die Conchita in ihrem Tagebuch als un trocito de cielo – »ein Stückchen vom Himmel« – bezeichnet hat, zu einem Spießrutenlauf. An jeder Ecke wurden die vier Mädchen angesprochen, belächelt, offen verspottet: »Wenn ihr beten wollt, warum geht ihr nicht in die Kirche?« Auf ihre Antwort »Weil uns dort, in der Calleja, gestern ein Engel erschienen ist und wir sehen wollen, ob er heute wieder erscheint, wenn wir dort beten«, ernteten sie bestenfalls ungläubiges Kopfschütteln, in den meisten Fällen aber Gelächter. Als sie an der Stelle ihrer gestrigen Erscheinung niederknieten, um zu beten, flogen sogar Steine. Ein paar Jungen aus dem Dorf waren ihnen heimlich gefolgt, hatten sich in einem benachbarten Maisfeld versteckt und versuchten jetzt alles, um ihre Andacht zu stören. Als die Mädchen sie baten, damit aufzuhören, ernteten sie nur Gelächter. Während sie den Rosenkranz beteten, gaben die Lausbuben keine Ruhe.
Dann war ihr Gebet zu Ende – und nichts geschah. Die Mädchen blickten sich um, schauten hoch. Der Himmel war von dichten grauen Wolken bedeckt, ein kalter Wind wehte ihnen ins Gesicht und ließ sie frösteln. Den Jungen wurde es langweilig, sie liefen ins Dorf zurück, während Conchita, Jacinta, Loli und Mari Cruz eine ganze Stunde an der Calleja ausharrten. Doch als es allmählich dunkel wurde, wurde ihnen klar, dass der Engel zumindest an diesem Abend nicht zurückkehren würde. Lag es an den Bengeln, deren Steinwürfe ihre Andacht gestört hatte? Hatten die Leute recht gehabt, hätten sie den Engel tatsächlich besser in der Dorfkirche erwartet? »Lasst uns noch ein Gesätz des Rosenkranzes vor dem Allerheiligsten beten!«, meinte Conchita und ihre drei Freundinnen folgten mit zustimmendem Nicken.
Auf dem Weg in die Kirche begegneten sie wieder ihrer Lehrerin. »Wart ihr wieder an der Calleja?«, wollte sie wissen. »Ja, Señora, aber wir sahen nichts«, antworteten die Mädchen mit trauriger Stimme. »Macht euch keine Sorgen«, erwiderte Doña Serafina, »vielleicht kommt er ja morgen.« Als er sich auch in der Kirche nicht blicken ließ, machten sich die vier gegen 20.45 Uhr auf den Heimweg, um pünktlich, noch vor 21.00 Uhr, bei ihren Müttern zu sein. »Habe ich es dir nicht gesagt, dass ihr euch das nur eingebildet habt?«, musste sich jedes der Mädchen beim Abendessen anhören. Gegen 21.45 Uhr gingen sie wie an jedem Abend zu Bett, nicht ohne zuvor ihre Nachtgebete zu verrichten. Nur Conchita hörte, kaum hatte sie zu beten begonnen, eine Stimme in der Nacht: »Mach dir keine Sorgen. Du wirst mich wiedersehen.« Während ihr Herz immer schneller zu pochen begann, betete sie umso inbrünstiger, bis sie schließlich der Schlaf übermannte.
3.
Der Engel kehrt zurück
Am nächsten Tag, dem 20. Juni, trafen sich die Mädchen nach der Schule an Conchitas Elternhaus, um noch einmal zur Calleja zu gehen und dort zu beten. Auch an diesem Tag arbeitete Pepe Diez, der Maurer des Dorfes, dort mit Aniceto González. Er wollte, stets den Schalk im Nacken, den vieren einen gehörigen Schrecken einjagen.
»Na, Mädels, glaubt ihr immer noch, einen Engel gesehen zu haben?«
»Ja, das haben wir!«
»Dafür wird man euch ins Gefängnis stecken! Wir haben schon die Guardia Civil [dem Innen- und Verteidigungsministerium unterstellte Polizei, d. Verf.] informiert. Auch eure Väter und Mütter müssen ins Gefängnis!«
Doch zu seiner Enttäuschung reagierten Conchita, Jacinta, Mari Cruz und Loli völlig gleichgültig auf seine Drohung. Ohne ein Zeichen von Angst oder Sorge antworteten sie mit ruhiger Stimme:
»Nun, dann werfen sie halt uns und unsere Eltern ins Gefängnis. Das ändert auch nichts daran, dass wir nun mal den Engel gesehen haben.«
Jetzt wurde Aniceto, Conchitas Bruder, wütend: »Hört auf, über dieses Zeug zu reden!«
»Reg dich nicht auf«, erklärte Pepe ihm lachend, »offenbar ist es deiner Schwester und den anderen Mädchen egal, was ich zu ihnen gesagt habe. Es scheint ihnen keine Angst gemacht zu haben. Oder sie wissen nicht, was es bedeutet, ins Gefängnis zu gehen …«
Noch während er das sagte, überkam den Maurer ein schwer definierbares Gefühl. Es war, als würde sein Gewissen sich bei ihm melden. Für einen Augenblick spürte er, dass die ganze Sache eben kein Witz war und nichts, worüber man spotten sollte …
Pepes Versuch, sie aufs Glatteis zu führen, war nur der Anfang der zahlreichen Sticheleien und offenen Angriffe, die sich noch verstärkt hatten, seit sie am Abend zuvor eher resigniert und ohne eine weitere Begegnung mit dem Engel von der Calleja zurückgekehrt waren. Immer öfter mussten sie sich anhören, dass alles nur Einbildung gewesen sei. Auch ihre Eltern waren besorgt, dass sich ihre Töchter in etwas verrannt hatten, das sie unweigerlich in eine Fantasiewelt führen würde, die nicht gut für sie wäre.
»Meine Mutter war sehr besorgt, ebenso wie alle unsere Eltern und Brüder«, schrieb Conchita in ihrem Tagebuch nieder. »Sie machten einen großen, inneren Kampf durch. Einerseits wollten sie uns glauben, dass wir die Wahrheit sagten, doch trotzdem hatten sie auch ihre Zweifel.«
Als ihre Freundinnen sie abholten, wollte Aniceta ihre Tochter erst nicht gehen lassen. »Warum willst du wieder in der Calleja beten? Wenn du beten willst, geh gefälligst in die Kirche!«
»Bitte, lassen Sie Conchita doch mit uns kommen!«, bettelten die anderen Mädchen.
»Aber warum geht ihr dorthin und macht euch vor allen Menschen zum Narren?«, wollte Aniceta wissen.
»Wir machen uns nicht zum Narren«, antwortete Jacinta, »Wir gehen dort beten und schauen, ob der Engel wiederkommt.«
»Nein, sie bleibt hier«, beharrte die Mutter auf ihrer Entscheidung, »ihr könnt ja hingehen, aber Conchita bleibt hier!«
Dem Mädchen standen Tränen in den Augen. Ganz langsam schlichen sich ihre drei Freundinnen davon, um sich hinter der nächsten Mauer zu verstecken und dort auf Conchita zu warten. Doch Aniceta hatte das mitbekommen und rief sie wieder zu sich.
Die Calleja (mit Loli)
»Gut, ich gebe mich geschlagen. Wenn ihr tut, was ich euch sage, darf Conchita gehen!«
»Ja, ja, das machen wir«, jubelten die Mädchen und auch auf Conchitas Gesicht breitete sich ein Strahlen aus.
»Tut jetzt einfach so, als würdet ihr spielen gehen und redet mit niemandem. Wenn ihr die Calleja erreicht habt, wird Conchita nachkommen, aber so, dass niemand etwas merkt.«
Gesagt, getan. Als Conchita schließlich an der vereinbarten Stelle eintraf, war es ihren Freundinnen, als hätte sie eine Ewigkeit dafür gebraucht. Gemeinsam knieten sie sich hin und beteten den Rosenkranz. Doch wieder war kein Engel zu sehen. Enttäuscht wollten die vier Mädchen schon ins Dorf zurückgehen, als ihnen das Herz fast stehen blieb.
»Als wir gerade aufstehen wollten, sahen wir alle ein sehr helles Licht, so hell, dass keine von uns die andere sehen konnte«, schrieb Conchita später in ihr Tagebuch. »Wir waren geblendet von diesem hellen Licht, das uns ganz zu umhüllen schien. Wir sahen nichts anderes mehr als dieses Licht! Wir waren zu Tode erschrocken und begannen zu schreien, als dieses grelle, blendende Licht langsam verschwand.«
Als sie wieder zu sich kamen, war es bereits 21.30 Uhr, zu spät, um noch in die Kirche zu gehen. So liefen sie auf dem schnellsten Weg nach Hause, ohne dort ihren Familien von dem geheimnisvollen Licht zu erzählen. Erst am nächsten Morgen erinnerten sie sich daran, dass ihr Pfarrer, Valentín Marichalar, sie gebeten hatte, ihn unverzüglich zu informieren, wenn sich wieder etwas Übernatürliches ereignen würde. Da ihre Eltern ihnen aber nicht erlaubten, auf dem schwierigen, sieben Kilometer langen Bergpfad in das Nachbardorf Cosío zu gehen, in dem der Pfarrer wohnte, vertrauten sie ihr Erlebnis ihren Vätern an, die für sie die Nachricht überbrachten.
Am 21. Juni verstummten die Spötter allmählich, während immer mehr Dorfbewohner sich fragten, ob die Kinder nicht doch etwas Ungewöhnliches gesehen hatten. Auch Aniceta, Conchitas Mutter, hatte keine Einwände mehr, dass ihre Tochter nach der Schule zur Calleja