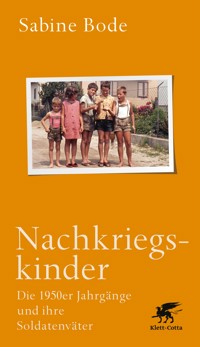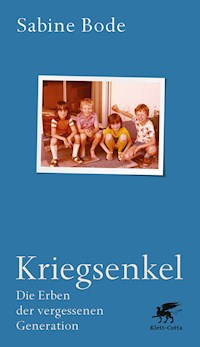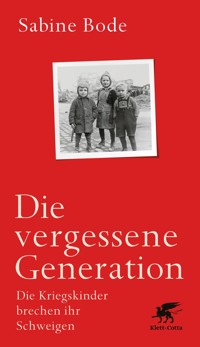8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist das hübscheste, frechste und mutigste Mädchen an den Stränden des Rheins – und sie ist Jüdin. Die Geschichte der Gudrun Samuel ist die Geschichte einer ganzen Generation junger Frauen, die die Naziherrschaft und der Krieg zur Flucht gezwungen haben. Ein beeindruckendes und mitreißendes Zeugnis einer Epoche. Als Mädchen ist sie im Rhein hinter den Kohleschleppern hergeschwommen. Sie hat den jungen Männern in Mainz die Köpfe verdreht. Doch als die Nazis an die Macht kommen und die junge Jüdin Gudrun Samuel sich entscheidet, mit gefälschten Papieren Deutschland zu verlassen, wird sie gefasst und kommt in Gestapo-Haft. Ihr gelingt die Flucht, aber sie ist nun nicht mehr das Mainzer Mädchen Gudrun, sondern die Flüchtende Judy: in der transsibirischen Eisenbahn und im Judenghetto von Shanghai. Sie überlebt den Krieg, doch die Odyssee geht weiter. Das Mädchen im Strom ist ein ergreifender Roman über das einzigartige Schicksal einer Frau im 20. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sabine Bode
DasMädchen imStrom
Roman
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2017, 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung eines Fotos von United Archives/Lämmel/Bridgeman Images
Datenkonvertierung: Fotosatz Amann, Memmingen
Printausgabe: ISBN978-3-608-96329-8
E-Book: ISBN978-3-608-10083-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
GUDRUN
MARTIN
MAINZ
NAZIS
BUCHMANN
FAUST
VOLKSSCHÄDLINGE
FLUCHT
SHANGHAI
BRODY
GHETTO
KRIEGSENDE
FREIHEIT
RÜCKKEHR
FREUNDINNEN
DILEMMA
MARGOT
In Erinnerung an Gertrude Meyer-Jörgensen, geb. Salomon, von deren Überlebensgeschichte dieser Roman in großen Teilen erzählt
GUDRUN
1 Als Gudrun noch sehr klein war, hatte sie den Hüten ihrer Mutter Namen gegeben. Sie hießen Liesel, Marga oder Ivo und konnten viel bewirken. Liesel sorgte bei Mama für gute Laune, Marga gab ihr etwas Verträumtes und Ivo machte sie unnachgiebig. Doch im Lauf der Jahre verloren die Hüte ihren Einfluss auf Mutters Stimmung. Etwas jedoch blieb. Nie ließ sie es sich entgehen, wenn Mama sich zum Ausgehen zurechtmachte, und so kam es, dass ein elfjähriges Mädchen mit dunklem Pagenkopf seine Turnübungen auf dem Hotelbett unterbrach. In ihrer Schulklasse gehörte Gudrun Samuel zu den Besten in Turnen, ihr Lieblingsfach, sie war besonders gut in Akrobatik und wollte im Zirkus auftreten. Gudrun war ein dickes Kind mit runden Armen und Doppelkinn und dabei so gelenkig wie jedes kleine Mädchen, das sich immerfort bewegt und Stillsitzen hasst.
Helene Samuel zögerte nie bei der Wahl ihrer Garderobe. Das war ein Ritual voller Ruhe und Selbstgewissheit: die prüfenden Blicke in den Spiegel, das Geradeziehen der Strumpfnähte, das Hantieren mit Kamm und Puderdose und der Duft, Mamas Duft, den sie nach ihrem Abschiedskuss zurückließ. Sie war eine schmale, hochgewachsene Frau mit dunklem Teint und geschwungenen Augenbrauen. Manchmal sagte der Vater: Meine persische Königin, darf ich bitten? Dann reichte er ihr den Arm und sie verließen die Wohnung, um in die Oper zu gehen.
Aber an diesem Vormittag in Zürich war alles anders. Unruhig ging Helene vor dem Spiegel auf und ab, probierte den schwarzen Hut aus, dann den grauen, griff wieder zum ersten, seufzte laut. So hatte Gudrun ihre Mutter noch nie erlebt. Aufgeregt wie ein Huhn, Lippenstift auf den Zähnen.
Mama? Geht es dir nicht gut, Mama?
Helene reagierte nicht. Stattdessen ging sie zum Gepäck, das neben der Zimmertür zur Abreise bereitstand, und öffnete eine dritte Hutschachtel. Sie enthielt ein dunkelgrünes Samtgebilde, flach und steif, in der Form eines übergroßen Baretts, das schräg zu tragen war und auffällig über den Kopf hinausragte. Wenn die Mutter es aufsetzte, hatte sie Ähnlichkeit mit der Reiterin auf dem Ölgemälde in Vaters Arbeitszimmer, einer edlen Dame, die einem Fuchs hinterherjagte. Diesmal nicht. Mama sah furchtbar unglücklich aus. Sie ließ die Schultern hängen. Was war nur los? Das Mädchen erhob sich vom Bett, und als es seine Mutter von der Seite ansah, machte es eine Entdeckung: Sie war plötzlich dick geworden. Das Kleid spannte über einer unförmigen Taille. Das konnte nicht sein. Gudrun sah genauer hin. Doch, so war es.
Was es bedeutete, war ihr bekannt, so ungefähr jedenfalls. Eine Elfjährige hat ihre Augen und Ohren überall. Wenn sie auf dem Schulhof mit den älteren Mädchen zusammenstand, sprachen die häufig darüber, was Mann und Frau im Bett miteinander machten. Es hatte mit Kinderkriegen zu tun, so viel stand fest. Dann bekam die Frau einen dicken Bauch.
Zwei Stunden später befanden sich Mutter und Tochter auf der Heimfahrt, nachdem ein Hotelboy Koffer und Hutschachteln in einem überheizten Zugabteil verstaut hatte. Es roch nach Dampf und Zigarrenrauch. Jedes Mal, wenn die Eisenbahn hielt, wünschte sich Gudrun, es möge noch ein anderer Erwachsener mit Kind dazukommen, vergeblich. Bevor sie zu der kurzen Reise in die Schweiz aufgebrochen waren, hatte Mama ihr einen Besuch im Züricher Zoo versprochen, aber dazu war es wegen Dauerregen nicht gekommen. Nun hatte sie ihr ein Buch hingelegt und gesagt, darin gehe es um eine Leni oder Lilli, die Geschichte sei gewiss eine schöne Abwechslung. Doch Gudrun reichte schon der Buchdeckel: Ein Mädchen steif wie eine Puppe war darauf zu sehen, es trug eine Schürze mit Rosenmuster und eine riesige Schleife im blondgelockten Haar. Bücherlesen passte nicht zu ihr, wie Gudrun fand. Das taten nur Kinder, die blass und unsportlich waren oder die niemand in der Klasse mochte.
Helene war eingenickt, selbst im Schlaf noch aufrecht, die Hände im Schoß gefaltet. Der kleine schwarze Hut, für den sie sich letztlich entschieden hatte, saß noch immer vorbildlich auf der hochgesteckten Frisur. Das Kind schüttelte den Kopf. Bei Mama und Papa konnte es sich solche Ferkeleien nicht vorstellen, wie die Heftchen sie zeigten, die während des Unterrichts heimlich weitergereicht wurden. Es musste also einen anderen Grund geben für den dicken Bauch. Vielleicht wusste Ralphie mehr.
Gudrun schaute sich um. Eine mit rotem Plüsch bezogene Sitzbank reichte vom Fenster bis zur Tür, die Vorhänge zum Gang zugezogen. Eine gute Gelegenheit. Sie zog ihre Schuhe aus, danach ihr Kleid – ein Hängerchen, von der Mutter befürwortet, weil es die Fettröllchen kaschierte. Die Bank bot genug Platz für Purzelbäume hin und zurück. Damit konnte man sich schon eine Weile beschäftigen. Hin und zurück. Sie steigerte ihr Tempo, kam richtig in Fahrt. Hin und zurück. Irgendwann knallte sie mit den Füßen gegen den Aschenbecher, das scheppernde Geräusch weckte die Mutter auf.
Lass das mal, Gudrunsche, dafür bist du wirklich schon zu groß. Zieh dich wieder an.
Als der Zug sich der deutschen Grenze näherte, erwachte Helenes Unruhe. Sie stand auf, öffnete das Fenster, schnappte nach Luft.
Ist dir schlecht, Mama?
Ein bisschen, Kind, aber mach dir keine Sorgen. Es geht bald vorüber.
Ein Pfiff, dann drosselte der Zug sein Tempo. Dampfwolken zogen am Fenster vorbei. Helene Samuel hüllte sich in ihren Mantel mit Fuchskragen. Die Eisenbahn hielt. Zwei Grenzbeamte gingen auf dem Bahnsteig vorbei, dann kamen sie zur Passkontrolle ins Abteil. Sie stellten ein paar Fragen und wünschten der gnädigen Frau und dem Fräulein Tochter eine gute Weiterreise. Vor einem Westhimmel, der sich aufgehellt hatte, flatterte eine schwarz-rot-goldene Fahne.
Nach dem Abendessen im Speisewagen wurde Gudrun müde. In den folgenden Stunden schlief sie. Spät in der Nacht erreichten sie Mainz. Wilhelm Samuel holte sie ab. Benommen stolperte das Mädchen durch den menschenleeren Bahnhof. Später saß es auf der Rückbank von Vaters Limousine, roch die Ledersitze und seine Orientzigarette, verstand nicht, was die Eltern sprachen, hörte nur ihre leisen, gereizten Stimmen.
Beim Frühstück ging der Streit zwischen Vater und Mutter weiter. Helene Samuel, wie immer beherrscht in Ton und Haltung, hielt ihrem Mann vor, er hätte sie nicht auf diese Reise schicken dürfen. Gudrun verstand noch immer nicht, worum es ging. Vielleicht würde ihr Ralphie später alles erklären. Sie schaute zu ihm hinüber. Der vier Jahre ältere Bruder saß geistesabwesend dabei, ihn schien das alles nicht zu interessieren.
Einmal mit den Vorwürfen angefangen, konnte Helene nicht mehr aufhören. An der Grenze habe sie ein furchtbarer Schrecken überkommen. Wenn jemand ihr Übles gewollt hätte. Wenn sie überfallen worden wäre …
Wenn, wenn, wenn. Wilhelm widersprach laut und bissig. Was willst du denn noch? Ist doch alles famos gelaufen. Schade nur, dass man die Geschichte niemandem erzählen kann: die Coupons, um den Bauch meiner Frau gewickelt … Er lachte auf. Seine Laune konnte von jetzt auf gleich umschlagen zum Schlechten oder zum Guten. Ich muss dich loben, Helene. Alles hat jetzt seine Ordnung. Wir können uns glücklich schätzen, in diesen schweren Zeiten einen Mann wie Brüning zu haben.
Den Reichskanzler zu unterstützen hielt Wilhelm Samuel, der im Krieg einfacher Soldat gewesen war, für seine patriotische Pflicht. Aus keinem anderen Grund hatte er Helene dazu überredet, sein Vermögen heimlich aus der Schweiz zurück nach Deutschland zu holen. Daher wiederholte er am Frühstückstisch den Satz, der seit einigen Monaten sein Lieblingsspruch war: Ein anständiger Deutscher lässt sein Geld im Land.
Helene lächelte. Je nun, Wilhelm, was lässt dich heute denken, dass dein Geld in Deutschland sicher ist? Als deine Mutter noch die Geschäfte führte, hatte sie mehr Vertrauen zu Schweizer Banken …
Schluss jetzt! Lass die alte Hexe aus dem Spiel! Er sprang hoch, warf seine Serviette auf den Teller und rannte aus dem Raum. Seine Frau folgte ihm ohne Hast. Gudrun hörte, wie sie im Flur beschwichtigend auf ihn einredete. Sie war plötzlich wieder schlank geworden.
2 Der Glücksfall in Gudruns Kindheit hieß Annemarie Holl. Die kleine Frau mit Kurzhaarfrisur und Brille kam in das Haus der Samuels, als Gudrun noch nicht zur Schule ging. Vier Jahre blieb sie. Fräulein Holl, die sich nie anders als in Grau- oder Brauntöne kleidete, besaß eine Ausbildung als Lehrerin und außerdem natürliche Autorität. Ganz gleich, was sie sagte, ihre Stimme klang stets entspannt. Ihre größte pädagogische Tat bestand darin, dass sie Helene Samuel beibrachte, Gudruns Widerborstigkeit nicht als Trotz zu sehen, sondern als Ausdruck von Charakterstärke. Nach der festen Überzeugung des Kinderfräuleins hatten die Eltern allen Grund, auf ihre Tochter stolz zu sein.
Keine Mutter lässt sich gern von einer Kinderfrau etwas sagen – doch nach der Geschichte mit dem Mohrenkopf änderte sich etwas in dieser Haltung. Sie ereignete sich, als Gudrun fünf Jahre alt war. Helene Samuel hatte zum Damenkränzchen eingeladen. Sie empfing die Gäste in einem hellblauen Wollkleid, zu dem sie eine dreifache Perlenkette trug. Die meisten Frauen, die im Salon Platz nahmen, kannten sich. Ihre Stimmen und ihr Lachen drangen durch die geschlossene Flügeltür. Irgendwann trat Helene Samuel in den Korridor.
Fräulein Holl, Sie können jetzt kommen.
In Begleitung seiner Kinderfrau näherte sich das Mädchen der Kaffeetafel, wobei es den einzigen Mohrenkopf auf der Kuchenplatte nicht aus den Augen ließ.
Gudrunsche, komm her, du darfst dir etwas aussuchen. Aber vorher lasse ich die Platte noch einmal bei den Damen herumgehen.
Das Drama wurde ausgelöst durch die Gattin des Hausarztes, die sich ahnungslos den Mohrenkopf auf den Teller lud. Gudrun packte vor Wut das Tischtuch mit beiden Händen und zog es – zack – nach unten. Kannen, Vasen, Tassen purzelten über die Tafel. Die Damen stießen kleine Schreie aus. Gudrun stand da, starr vor Schreck.
Du schlimmes Kind!, stöhnte die Mutter.
Das Mädchen rannte heulend fort. Helene Samuel ging hinterher, wieder vollkommen beherrscht, ihrem Gesicht war nichts anzumerken. Sie ignorierte den Kaffee, der auf ihrem Kleid einen hässlichen, großen Fleck hinterlassen hatte. Plötzlich stand die Kinderfrau vor ihr.
Gnädige Frau, das war nicht korrekt.
Nein?
Sie können dem Kind nicht zuerst die freie Auswahl versprechen und unmittelbar danach andere vorziehen.
Kann ich nicht?
Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Tochter bestrafen.
Was bildete dieses Kinderfräulein sich ein? Was für eine Anmaßung ihr, der Mutter gegenüber, der Hausherrin? Helene Samuel suchte nach einer passenden Zurechtweisung, da erblickte sie ihre Tochter, die todunglücklich um die Ecke schaute. Sie haben recht, Fräulein Holl, sagte sie unvermittelt. Bitte waschen Sie dem Kind das Gesicht und gehen Sie mit ihm zum Konditor.
Annemarie Holl nickte. Kurz darauf stand sie mit ihrem kleinen braunen Hut bereit. Als die Mutter nach letzten Ermahnungen und Zurechtzupfen des Kleidchens die Wohnungstür langsam hinter ihnen geschlossen hatte, begann Gudrun zu hüpfen und streckte der Kinderfrau ihre Ärmchen entgegen. Fräulein Holl hielt den Zeigefinger über ihre Lippen. Sie musste erst die Lage sondieren. Für das, was nun kam, durfte sich niemand sonst im Treppenhaus aufhalten. Alles in Ordnung, auf geht’s! Sie setzte das Mädchen auf das Geländer, drückte es fest an sich und rannte die Stufen hinunter, von der dritten Etage zum Absatz der zweiten, von der zweiten zur ersten, von der ersten bis ganz unten. Gudruns Augen strahlten, sie zappelte mit den Beinen, aber kein Jubelschrei verriet sie, weil sie fest die Hände auf den Mund presste. Als beide die Straße betraten, brannten ihre Gesichter.
Fräulein Holl hatte den Status eines bezahlten Familienmitglieds. Im Unterschied zur Köchin und zum Hausmädchen nahm sie ihre Mahlzeiten nicht in der Küche ein, sondern saß mit bei Tisch im Speisezimmer. Für die Hausherrin, die als Schülerin in einem Schweizer Pensionat französische Sprachkenntnisse erworben hatte, war sie »la bonne«. Wenn ihr Mann Interna aus seinem Geschäft oder dem Liebesleben einer entfernten Verwandten preisgab, versuchte sie ihn mit den Worten zu mäßigen: Pas devant la bonne. Eigentlich sollte »Nicht vor dem Kindermädchen« heißen »Nicht vor den Kindern!« – für Gudrun das entscheidende Stichwort: Die Situation versprach interessant zu werden. Ein vertrautes Spiel mit verteilten Rollen: Wenn seine Frau ihn zu bremsen versuchte, legte Wilhelm Samuel erst recht los, weshalb sie ihn erneut ermahnte … Manchmal hörte er dann auf, ein anderes Mal konnte ein cholerischer Anfall folgen, und wenn ihm dabei der Löffel in die Suppe fiel, dass es nur so spritzte, prustete Gudrun vor Lachen los. Die Mutter dagegen und la bonne ließen sich nicht das Geringste anmerken. Sie saßen da in untadeliger Haltung, was Helene in solchen Momenten etwas Selbstgerechtes gab. Ralphie starrte mit gesenktem Kopf auf seinen Teller. Er hatte Angst vor dem Vater.
Wenn Wilhelm Samuel sich aufregte, fuhr er sich mit den Fingern durch die semmelblonden Haare, die sich aufrichteten wie kleine Hörner. Helene hatte deshalb überall in der Wohnung Wandspiegel anbringen lassen. Wenn ihr Mann aus dem Esszimmer stürzte, rannte er im Korridor direkt in sein Spiegelbild. Die am Esstisch Zurückgebliebenen hörten ihn fluchen und wussten, dass er umgehend seine Frisur in Ordnung brachte. Er war ein Gentleman, was sein Äußeres betraf, am liebsten trug er englische Wollsakkos aus kleinkariertem Tweed, die er während gelegentlicher Geschäftsreisen in London erwarb.
Gudrun nahm die Wutausbrüche des Vaters nicht ernst, sie richteten sich auch nie gegen sie selbst. Offenbar brauchte er dramatische Auftritte. Hin und wieder brachte er seine Zyankalikapseln ins Spiel. Dann drohte er, wenn sich nichts ändere, wenn sich nicht sehr bald etwas ändere, werde er Schluss machen, einfach Schluss …
Mon cher, sagte Helene daraufhin und tätschelte seine Hand. Pas devant la bonne.
Lass mich. Davon verstehst du nichts, fauchte Wilhelm. Bei einem großen Vorhaben muss man auf Nummer Sicher gehen. Darum nicht eine, sondern zwei Kapseln. Sie liegen bereit. Sicher ist sicher.
Gudrun hatte das Gift nie gesehen und glaubte nicht daran. Wenn er von Selbstmord sprach, war es für Gudrun Theater. Einmal hatte sie arglos gefragt, was genau sich denn ändern solle, und der Vater hatte nur geschnaubt. Alles. Alles sollte sich ändern.
Gleichwohl galt Wilhelm Samuel als geselliger, liebenswürdiger Mensch. Er hatte nur seine guten und seine schlechten Tage. An schlechten Tagen fuhr er schnell aus der Haut, besonders wenn seiner Meinung nach Geld verschwendet worden war.
Sich selbst hielt er für die Bescheidenheit in Person. Obwohl steinreich, wäre er nie im allerfeinsten Hotel abgestiegen, und nie hätte er in der Eisenbahn die erste Klasse benutzt. Die zweite, fand er, sei allemal gut genug. Zwar leistete er sich einen Ford Coupé, zu Hause aber gab es Streit über den Verbrauch von heißem Wasser. In seinen Augen konnte man gar nicht sparsam genug damit umgehen. Wie in allen gutbürgerlichen Haushalten der zwanziger Jahre wurde nur einmal in der Woche gebadet. Am Sonntagmorgen stieg Wilhelm in die Wanne. Wenn er fertig war, kam seine Frau an die Reihe, danach die Kinder.
Jeden Morgen kam Friseur Schnauder in die Mainzer Kaiserstraße, um den Hausherrn zu rasieren. Er stammte aus Schwaben, damit war er, der Protestant, im katholischen Mainz ein Außenseiter. Dies sei der Grund, warum er in die SA eingetreten sei, teilte er Herrn Samuel beiläufig mit. Er, Schnauder, sei nun mal ein Rudeltier.
3 Gudrun erfand für ihre Kinderfrau einen Namen – Hollunder. Sie war noch zu klein, um seine Bedeutung zu kennen. Irgendwo hatte sie das Wort aufgeschnappt und sein weicher, schmeichelnder Klang hatte sich mit ihrer Zuneigung verbunden. Anders als die Köchin und das Hausmädchen, die eine Etage höher in winzigen, nicht zu heizenden Kammern wohnten, hatte Annemarie Holl keinen Ort, an den sie sich zurückziehen konnte. Ihr Bett stand im Kinderzimmer unter einem Regal, auf dem sechs Puppen in Rüschenkleidern herumsaßen, mit denen Gudrun nie spielte. Deren Lieblingspuppe war die Herta, ein über die Jahre zerzaustes, fleckiges und schielendes Wesen, das Fräulein Holl heimlich aus dem Abfall gerettet und dem verheulten Mädchen wieder in den Arm gedrückt hatte. Es musste versprechen, Herta künftig vor den Eltern versteckt zu halten.
Regelmäßig nahm Hollunder das Kind mit in den Mainzer Dom. Vor Beginn der Messe verschwand sie im Beichtstuhl. Was erzählte sie da? Eines Tages stellte sich Gudrun neben das Holzhäuschen, aber das Gemurmel war nicht zu verstehen.
Wie aus dem Nichts stand Hollunder plötzlich neben ihr. Na, so was, ein Kind, das lauscht! Gudrun lief puterrot an und wollte fortrennen, doch die Kinderfrau lächelte und schob sie in eine Kirchenbank. Ich mache dir einen Vorschlag, sagte sie. Wenn du etwas wissen willst, kannst du mich fragen. Ich werde es dir dann erklären, so gut ich kann.
An diesem Tag versuchte Hollunder ihr den Begriff Sünde nahezubringen, und was beichten bedeutete. Gudrun hielt es für ausgeschlossen, dass es im Leben ihres Kinderfräuleins so etwas wie Sünde gab.
Sie tun nichts Böses, Frau Hollunder. Sie tun nur Gutes. Immer.
Nein, Gudrunsche, ich bin auch nur ein Mensch. Und wie jeder Mensch tue auch ich nicht nur Gutes.
Sie sind gut! Immer, immer, immer!, rief das Kind.
Gudrun hatte von Hollunder ein Gesangbuch geschenkt bekommen, und so kannte sie bald zahlreiche Lieder. Es war die einzige religiöse Erziehung, die sie genoss. Sie verband sich mit der Erinnerung an die prunkvollen Gewänder der Geistlichen, den Geruch von Weihrauch und das Orgelspiel.
Die Eltern waren assimilierte Juden. Unser Sohn ist beschnitten, das reicht doch wohl, pflegte Wilhelm Samuel zu sagen, wenn Helene meinte, er möge sich wenigstens an den hohen Feiertagen in der Synagoge zeigen. An Ralphies Bar Mitzwa hatte er sie besucht, danach nie wieder. Dass er Jude war, empfand er als eine eher zufällige Zugehörigkeit, die sein Herz nicht berührte. Er war Deutscher. Ein einziges Mal hatte er sich näher mit seinem Stammbaum beschäftigt. Als darin im sechzehnten Jahrhundert Vorfahren aus Polen auftauchten, war er so entsetzt, dass er die Unterlagen wegpackte und nie wieder anschaute. Mit Schtetl-Juden, sagte er seiner Frau, wolle er nichts zu tun haben.
Von keiner anderen gesellschaftlichen Gruppe grenzte sich Wilhelm Samuel auch nur annähernd so radikal ab. Die langen schwarzen Mäntel, die Schläfenlöckchen, die Perücken der Frauen, die strengen religiösen Riten, die Musik, all das kollidierte mit seinem guten Geschmack und seinen Überzeugungen. Sollte ich dich jemals Jiddisch reden hören, schärfte er seiner Tochter ein, wirst du enterbt!
Seine größte Sorge ging dahin, in seiner Stadt könnten Berliner Verhältnisse entstehen, was bedeutete: ganze Viertel mit polnischen Juden. In Mainz tauchten allerdings nur vereinzelt Händlerfamilien auf, und auch in der Synagogengemeinde war man froh, wenn sie weiterzogen. Man schämte sich der Kaftan-Juden, wie man sie dort nannte, mit ihnen wollte man nicht in einen Topf geworfen werden.
Der Sabbat existierte nicht bei Samuels, der Freitag war für sie ein ganz normaler Wochentag. Gudrun freute sich auf Weihnachten mit einem Christbaum, unter dem Geschenke lagen, und auf Ostern mit Eiersuchen. Ihre Eltern hatten jüdische und katholische Freunde, doch gab es eine feine Trennungslinie. Die Juden lud man zu sich nach Hause ein, mit den Christen traf man sich im Kurhaus von Wiesbaden zum Abendessen. Die Samuels kannten keine Benachteiligung, nur Unterschiede: Bei den Juden aß man sonntags Roastbeef, bei den Christen Schweinebraten.
4 Hollunder sah die Dinge des Lebens realistisch und ließ Gudruns Neigungen freien Lauf. Den Mainzerischen Dialekt trieb man ihr nicht aus, obwohl ihre Eltern Hochdeutsch sprachen. Auch dass sie am Daumen lutschte, nahm sie hin. Genau besehen knabberte das Mädchen daran, und so hatte sich unterhalb des Nagels Hornhaut gebildet.
Das Einzige, was Gudrun an Hollunders Erziehung missfiel, war die Sache mit den Büchern. Nicht, weil sie zum Lesen gezwungen wurde, sondern weil sie beim Essen Bücher unter die Arme klemmen musste. Zwei quälend lange Wochen hindurch wurden ihr auf diese Weise Tischmanieren andressiert. Alle Erwachsenen lobten fortan die mustergültige Haltung des Kindes beim Essen, vor allem, wie schön es die Arme am Körper hielt. Zum Ausgleich fiel Gudrun heimlich über die riesige Porzellanschüssel her, die im Salon hinter einem gelben Vorhang stand. Wenn sie es geschafft hatte, den schweren Deckel beiseitezustellen, war das gefräßige Kind nicht mehr zu bremsen. Händeweise stopfte es Gebäck und Pralinen in sich hinein. Ähnlich erging es kaltem Geflügel und Würstchen, die ihm Hilde, die dicke Köchin, als Verbündete überließ, denn natürlich war es verboten, außerhalb der Mahlzeiten zu essen.
Gudrun liebte Deftiges, Brot mit Fleischwurst und Schinken, auch das Schweinefleisch beim zweiten Frühstück des Hausmeisters. Schnell hatte sie herausgefunden, wann es sich lohnte, den gutmütigen alten Mann in seiner ungelüfteten Wohnung unter dem Dach zu besuchen. Er lebte allein, seine Frau war gestorben, er freute sich über Gesellschaft. Wenn seine gelben Nikotinfinger mit einem Messer das Fleisch vom Knochen schälten, erhielt auch sein kleiner Gast eine Portion.
Mit sechs Jahren kam die Tochter der Samuels in eine Privatschule, nach wenigen Tagen verbat sie sich, von der Kinderfrau dort hingebracht und wieder abgeholt zu werden. An einem Mittag im Sommer wartete der Vater in seinem neuen Cabriolet vor der Schule. Der offene Wagen und die enganliegende Lederkappe seines Fahrers erregten Aufsehen. Gudrun aber ging einfach daran vorbei auf die andere Straßenseite.
Mach doch nicht solche Zicken, Kind, sagte Wilhelm Samuel, während er im Schritttempo neben ihr her fuhr. Und nach einer Weile: Ich warne dich, Tochter, steig ein! Als das Drohen nicht half, verlegte er sich aufs Bitten: Sag mir wenigstens, warum du nicht mitkommen willst!
Endlich blieb das Mädchen stehen, die Hände in die Seiten gestemmt. Ich steig nicht ein, weil sonst alle sagen, da fährt die reiche Gudrun Samuel aus der Kaiserstraße!
Schon nach wenigen Wochen wusste sie Bescheid: Schule lag ihr nicht. Sie verschwendete dort ihre Zeit. Gudrun langweilte sich. Fast jede Unterrichtsstunde dehnte sich endlos – eine Qual für ein Kind, das nicht gern still saß. Warum konnte sie nicht jede Stunde Turnen haben? Oder wenigstens Singen, vielleicht noch Rechnen? Mehr interessierte sie einfach nicht. Doch einen Vorteil gab es: Sie fühlte sich nicht mehr allein. Die meisten Mädchen drängten sich darum, mit ihr spielen zu können. Hollunder hatte sie gut beraten: Eine wie du wird schnell beneidet. Guck genau hin. Pass auf, dass sie dich nicht eingebildet finden.
5 Wilhelm Samuels Vermögen stammte von seiner Mutter Hannah, einer überaus tüchtigen Geschäftsfrau, die nach und nach fünfzehn Schuhgeschäfte eröffnet und schließlich ihren Ehemann zum Teufel gejagt hatte. Gudrun erfuhr nie, was die Großmutter dazu veranlasst hatte und wie ihr Großvater mit Vornamen hieß.
Wilhelms Mutter galt als reich, hässlich und klug. Ihr Sohn hasste sie und weigerte sich, sie zu besuchen. Sie lebte im benachbarten Wiesbaden, dort wohnte man vornehmer als in Mainz. In den guten Einkaufsstraßen Wiesbadens hing Eau de Cologne in der Luft, nie sah man Hundekot auf den Bürgersteigen. Die Bewohner der Stadt empfanden sich als Angehörige einer Elite, allen voran die preußischen Generalswitwen mit ihrem Erkennungszeichen: einer Gemme am Hals über der hochgeschlossenen Bluse.
Wilhelm Samuel wurde nicht müde, den protzigen Lebensstil seiner Mutter bissig zu kommentieren. Es würde ihn nicht wundern, meinte er, wenn bei der alten Hexe auch noch die Klobürste aus Gold wäre. Sie residierte in einer Achtzimmerwohnung und beschäftigte drei Personen zu ihrer Bedienung. Selbst wenn sie ganz allein speiste, ließ sie sich das Essen auf einer silbernen Platte mit Haube servieren. An ihren Enkeln zeigte sie keinerlei Interesse. Dennoch bestand Helene, die diplomatische Schwiegertochter, auf einem Mindestmaß an Kontakt. Gelegentlich brachte sie die Tochter samt Kinderfräulein mit in das Reich der alten Dame, die diese so schnell wie möglich wieder loszuwerden versuchte. Großmutter drückte Fräulein Holl Geld in die Hand und schob das Kind zur Tür.
Fahrt Kutsche, sagte sie, geht in den Kurpark oder macht, was ihr wollt. Lasst mich einfach in Ruhe.
Den Sommer verbrachte Hannah Samuel in Meran, den Winter in St. Moritz, wo sie in den teuersten Hotels abstieg, die ihren Ansprüchen gleichwohl nie genügten. Im Herbst und Frühjahr erschien die Seniorchefin in Mainz und den Filialen der Umgebung zu gelegentlichen Überraschungsauftritten. Im Stammhaus inspizierte sie die Verkaufsräume sowie Lager und Büro und sah ringsum nichts als Unzulänglichkeiten. Obwohl sie die Geschäftsführung abgetreten hatte, tat sie so, als sei der Vertrag Luft für sie. Ganz Patriarchin, forderte sie den Sohn auf, ihr die Bücher zu zeigen, aber diesen Kampf verlor sie. Wilhelm Samuel war noch sturer als seine Mutter, deren Übergriffe ihn zur Weißglut brachten.
Als er die Mutter endlich im Grab wusste, konnte jeder sehen, wie groß seine Erleichterung war. Beim Beerdigungskaffee erzählte er die lustigsten Witze. Vom Begräbnis blieb Gudrun nur die Urne in Erinnerung, ein kupferfarbenes Gefäß mit einer schwarz-weiß-roten Schleife.
Ende der zwanziger Jahre ließ Wilhelm Samuel im Hinterhof einen elektrischen Außenaufzug anbringen. Vielleicht spürte er schon sein schwaches Herz, wenn er die Stufen zur dritten Etage hochstieg. Offiziell war es der Kohlenaufzug. Es gehörte zu den Gewohnheiten der Eltern, dass Helene ihren Mann mittags vom Geschäft am Gutenbergplatz abholte und sie nach einem kleinen Spaziergang am Rhein zum Essen heimkehrten. Während sich der Fahrstuhl nach oben bewegte, stand der blonde, kurzsichtige Ralphie oft wie ein Häuflein Elend in der Balkontür und rief seinen Eltern zu: Ich hab schon wieder einen Fünfer.
Vergeblich hatte die Mutter ihn gebeten, derlei Nachrichten zurückzuhalten, bis sie in Ruhe zu Mittag gegessen hatten, doch ihr Sohn hielt den Druck einfach nicht aus. Ralphie war ein miserabler Schüler, wie seine Schwester. Doch während der Vater Gudruns schlechte Zeugnisse achselzuckend hinnahm – bei Frauen gibt es Wichtigeres als gute Noten –, kannte er bei Ralphie keine Gnade.
Sag mir, Herr Sohn, bist du zu faul oder zu blöd? Was ist dir lieber? Na, sag’s schon. Trau dich. Ach so, feige bist du auch noch.
Der Junge stammelte dann etwas Unverständliches, was seinen Vater nur noch mehr reizte.
Was hast du gesagt? Ich versteh dich nicht! Was hat der Herr Sohn nur für ein zartes Stimmchen! Eins ist mal sicher: Aus dir wird nie etwas. Nie!
Zwar war er das Lieblingskind seiner Mutter, vor den Attacken des Vaters schützte sie ihn jedoch nicht. Hinterher spendete sie Trost und Geld, so war ihr Sohn immer gut bei Kasse. Im Kreis seiner Freunde galt Ralphie als überaus großzügig. Manchmal, wenn die Eltern verreist waren, brachte er sie gleich im Dutzend mit nach Hause. Die jungen Leute lümmelten sich im Salon in den weinrot bezogenen Clubsesseln, sie rutschten auf der Couch eng zusammen oder hockten sich auf die Perserteppiche. Man rauchte Herrn Samuels flache Orientzigaretten, trank seinen Wein, krümelte mit dem Gebäck aus der großen Porzellanschüssel und kommentierte die mal selbstbewussten, mal verkniffenen Gesichtszüge irgendwelcher Vorfahren, die aus schweren Goldrahmen auf sie herabschauten. Bei angeheiterter Stimmung spielte jemand auf Helenes Bechsteinflügel, während sich das ein oder andere Pärchen zum Knutschen hinter die gerafften Portieren zurückzog. Am nächsten Morgen würde der Sohn des Hauses dem Personal eine großzügige Summe in die Hand drücken, damit es die Spuren des Festes beseitigte.
Das angrenzende Herrenzimmer war für Ralphie und seine Freunde tabu. Wilhelm Samuel hatte sein Reich mit viel Sorgfalt eingerichtet. Es war ein Eckzimmer, dessen Fenster sowohl zur Kaiserstraße wie auch zum Hindenburgplatz hinausgingen. Gudrun fühlte sich von Vaters Schreibtisch magisch angezogen, denn auf ihm stand das Merkwürdigste, was man sich vorstellen konnte: ein mittelalterlicher Bischof zum Aufklappen. Wenn man einen kleinen Riegel beiseiteschob, öffnete sich sein Bauch und im Innern der Holzstatue wurden drei Miniaturaltäre aus Elfenbein sichtbar.
Was ist das, Papa?
Das siehst du doch.
Und was macht man damit?
Man betrachtet es und freut sich. Wehe, du fasst es an!
Samuel war ein Kunstkenner und Sammler, er kaufte gern auf Reisen. Auch besuchte er gelegentlich Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, war sich aber hier seines Urteils nicht sicher. Aus Frankreich stammte die Holzbüste einer Nonne aus dem Mittelalter, angeblich eine Heilige. Sie hatte ihren Platz auf dem Bücherschrank. Gudrun nannte sie »die Madonna«, was für sie so ähnlich klang wie Nonne.
Dem Bücherschrank gegenüber hing ein großer Gobelin. Dass er eine Kostbarkeit sein sollte, kam Gudrun sonderbar vor, denn er war an mehreren Stellen ausgebessert oder morsch. Er zeigte eine mittelalterliche Szene vor der Wartburg: ein deutscher Kaiser oder König, vor dem zwei Männer ehrfürchtig knien. Sie merkte sich keine Einzelheiten, denn ihrem Vater fehlte die Geduld, ihr Kultur und Kunst nahezubringen. Ihm genügte es, wenn seine Tochter den Umgang mit Zahlen und Maßeinheiten beherrschte. Der Wandteppich, das vergaß sie nie mehr, war dreieinhalb Meter breit und zweieinhalb Meter hoch.
Vaters Lieblingsplatz war der Erker. Er hatte die Fenster mit eingebauten Bücherregalen verdeckt. Wilhelm Samuel saß in seiner Lesehöhle, den Kneifer auf der Nase, vor sich einen großen gotischen Tisch, auf dem er seine kostbaren Bücher ausbreitete, darunter handgeschriebene Folianten, die er bei Auktionen erworben hatte. Manchmal kam Gudrun ihn dort besuchen. Dann spielten sie Streitpatience, regten sich auf, gerieten sich in die Haare und waren ganz in ihrem Element.
Als sie acht Jahre alt war, kündigte Fräulein Holl ihre Stelle bei den Samuels, sie wollte in ihre elsässische Heimat zurückkehren. An einen Abschied, den es gewiss gegeben hatte, konnte sich Gudrun im späteren Leben nicht erinnern. Das Kinderfräulein schickte noch Grußkarten zum Geburtstag und zu Weihnachten. Gudrun nahm sich jedes Mal vor, umgehend zu antworten, und vergaß es. Wenn ihr die Post nach Monaten zufällig in die Hände fiel, schämte sie sich. Dann war es zu spät für eine Antwort, und irgendwann hörten die Lebenszeichen von Hollunder auf.
MARTIN
1 Ein schönes, waghalsiges Mädchen machte in Mainz von sich reden. Die Leute fragten sich, ob das wirklich die Tochter der Samuels sei, das dicke, verfressene Kind. Mit dreizehn Jahren war Gudrun schlank, ihre langen Beine erregten im Strandbad Aufsehen. Das dichte, krause Haar trug sie kurz und aus der Stirn gebürstet. Stolz zeigte sie sich in ihrem ersten Damenbadeanzug, weiß, mit tiefem Rückenausschnitt, der durch gekreuzte schmale Stoffstreifen noch betont wurde. Sie fand nichts dabei, in der Öffentlichkeit zu rauchen und sich auf ihrem Badetuch zu rekeln, genauso, wie sie es im Kino gesehen hatte.
Dann und wann erhob sich Gudrun, schlenderte mit Zigarette zum Rheinufer, rauchte an einen Baum gelehnt, warf den Stummel ins Wasser und zog die Badekappe über. Anschließend kletterte sie über eine Leiter auf das Dach des Kiosks und sprang kopfüber in den Fluss. Ihr Ziel war ein kleiner Rheinschlepper. Sie zog sich an ihm hoch, hockte sich mit anmutig gekreuzten Beinen aufs Deck und ließ sich eine Strecke mitnehmen.
Die Tochter der Samuels, so redeten die Leute, sei eigensinnig, nicht zu bändigen, schlecht erzogen. Gudruns beste Freundin, mit der sie häufig ins Schwimmbad ging, war genau das Gegenteil. Margot Weißkamp, ein braves Kind mit heller Haut, blauen Augen und roten Haaren, errötete schnell. Dass Margot klug und fleißig war, fand Gudrun günstig, weil sie ihr alle Hausaufgaben zum Abschreiben überließ, ohne beleidigt zu sein, wenn ihre Banknachbarin selbst dafür noch zu faul war.
Die schüchterne Neue in ihrer Klasse hatte Gudrun auf Anhieb gemocht. Sie beteiligte sich nicht an Witzen über Margots bayerischen Akzent, fand aber, sie müsse ein wenig aus der Reserve gelockt werden. Im Grunde ging es ganz leicht, denn die neue Freundin war eine leidenschaftliche Briefschreiberin. Post aus München beantwortete sie umgehend. Also fing Gudrun an, ihr während des Unterrichts Zettelchen zuzustecken.
Was kannst du an dir nicht leiden?
Margot las es, lief rot an und schickte sofort eine Antwort.
Meinen Vornamen.
Warum?
Er klingt so streng. Man kann ihn nicht verkleinern. Da wo ich herkomme geht das nicht.
In Mainz geht das. Hier bist du das Margotsche.
Das Mädchen war zu Beginn des neuen Schuljahres in Gudruns Klasse gekommen. In München ließen nationalsozialistische Studenten jüdische Professoren tagtäglich spüren, dass sie besser verschwinden sollten, und so war ihr Vater, Gustav Weißkamp, Professor der Germanistik, einem Ruf an die Universität Mainz gefolgt. Hier wehte noch ein anderer Wind, ein katholischer. Zwar fuhr die NSDAP auch in Mainz bei jeder Wahl beachtliche Stimmenzuwächse ein, doch beim Gottesdienst im Dom waren Mitglieder der NSDAP von den Sakramenten ausgeschlossen. Für sie gab es auch keine kirchlichen Beerdigungen, mit der Begründung, die Kulturpolitik des Nationalsozialismus stehe mit dem Christentum in Widerspruch.
Margot, ein Einzelkind, litt sehr unter dem Verlust der vertrauten Umgebung, der Verwandten und der Freundinnen, der süddeutschen Lebensart. Am meisten aber fehlten ihr die Besuche bei ihrer Großmutter auf dem Land, wo die Alpen zum Greifen nah waren und Kühe vor der Tür grasten. Sie vermisste das kleine Haus, in dem ihre Großmutter wohnte, die Wiesen, die es umgaben, die Blumen, wenn sich auf den Wiesen so weit das Auge reichte der Frühling ausbreitete.
Damit beeindruckte sie Gudrun.
Man kann Blumen vermissen?
Und wie!
Als Trost bekam Margot von ihren Eltern einen Rauhaardackel geschenkt – er war zwei Jahre alt, verspielt und unerzogen, ein kleiner Hund, der niedlich aussah, immer guter Laune war, viel bellte und kaum je gehorchte. Seine frühere Besitzerin hatte ihre Freude an ihm verloren und war froh, als Familie Weißkamp ihn übernahm.
Außerhalb der Schule sah man Margot selten ohne ihren Dackel, der entgegen seinem Temperament Schnecke hieß. Gudrun ertrug den Kläffer, weil er nun mal zu ihrer Freundin gehörte wie ihr rotes Haar und ihr leichter bayerischer Dialekt. Zum wiederholten Mal scheuchte Gudrun Schnecke vom Badelaken, griff nach ihrer Nagelfeile und sagte beiläufig: Jeder Hund kann schwimmen – man muss ihn nur ins Wasser werfen.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Margot sah aus, als habe sie ihr Gesicht in Kirschsaft gebadet, sogar auf ihrem Hals zeigten sich Flecken.
Gudrun schämte sich. Guck genau hin.
Tut mir leid, sagte sie. Es soll nicht wieder vorkommen.
An diesem Nachmittag im Strandbad zog ein älterer Schüler Gudruns Interesse auf sich, der schon wie ein junger Mann aussah und offenbar fesselnd erzählen konnte, denn eine Gruppe Gleichaltriger umringte ihn und wollte ständig mehr hören. Gudrun legte die Nagelfeile zur Seite und horchte, saß aber zu weit entfernt, um zu verstehen, worum es ging. Wo kam der denn her? Diese klassischen Gesichtszüge! Wie der Marmorgott aus dem Geschichtsbuch, dessen Bild sie offen auf dem Pult liegen lassen konnte, ohne aufzufallen. Sie beugte sich zu Margot hin. Nicht so ein Pippibub wie die anderen, flüsterte sie. Guck mal – aber vorsichtig! Er darf nichts merken.
Natürlich sollte er etwas merken, was Margot auf die Idee brachte, in ihrer Badetasche nach Schneckes Gummibällchen zu kramen. Der Dackel sprang und bellte, außer sich vor Glück, danach lief alles wie von selbst. Die ganze Gruppe schaute zu ihm hin, lachte und machte Bemerkungen. Wenig später kam es zum ersten Kontakt zwischen Gudrun und ihrem Gott.
Am Abend erklärte sie ihrem Vater, sie wolle den Tennisklub wechseln.
Warum denn das?
Ich habe einen netten jungen Mann kennengelernt.
Schon? Und was hat das bitte schön mit Tennis zu tun?
Er spielt im besseren Verein.
Wie heißt er?
Martin Schubert.
Nein, der Verein.
Gudrun nannte den Namen, und Wilhelm überlegte. Nicht, dass er die Liebesgefühle seiner Tochter ernst nahm. Gudrun begeisterte sich schnell für alles Mögliche, aber das ebbte auch genauso schnell wieder ab. Etwas anderes war es, ihren sportlichen Ehrgeiz zu unterstützen.
Also meinetwegen, sagte er schließlich, aber ich erwarte, dass du den Knaben in Grund und Boden spielst.
Eine Woche später betrat Gudrun, begleitet von Margot, das neue Klubgelände. Dort saß Martin Schubert mit anderen Jugendlichen zusammen und sorgte für ihre Unterhaltung. Wieder erzählte er eine längere Geschichte, wobei seine Zuhörer ständig in Gelächter ausbrachen. Er selbst ging mit seinem Lächeln sparsam um, aber wenn er es zeigte, erschienen auf seinen Wangen tiefe Grübchen. Gudrun kniff ihre Freundin in den Arm. Der ist es! Der und kein anderer!
Kurz darauf trat Martin an ihren Tisch und verbeugte sich vor den Mädchen. Er trug Tennisweiß, englische Shorts und ein frisch gestärktes Sporthemd. Wie erwachsen er aussieht, dachte Gudrun, als Martin sie zu einem Match aufforderte. Margot sah den beiden nach. Ein schönes Paar. Er blond, fast zwei Meter groß, sportliche Figur. Sie, dunkle Haare, ebenfalls hochgewachsen, reichte ihm bis zum Kinn.
Gudrun begriff nicht, was mit ihr los war, warum ihr nichts, aber auch gar nichts gelang. Wie eine Anfängerin schlug sie die Bälle ins Netz oder weit über sein Feld hinaus, und Martin musste von einer Ecke in die andere rennen, um sie wieder einzusammeln. Unzählige Male rief sie Entschuldigung, die Peinlichkeiten hörten nicht auf. Das Hemd war dem Jungen hinten aus der Hose gerutscht, auch dafür fühlte sie sich verantwortlich.
Nach einer Weile bemerkte sie, dass er ihr zuspielte wie einem Kind. Sie schnappte nach Luft. Nein! So nicht! Wut packte sie, wie damals, als sie den Mohrenkopf nicht bekam. Niemand durfte sie so behandeln, auch dieser Martin nicht. Doch sie war kein Kind mehr. Wenn sie sich jetzt nicht beherrschte, wäre die Blamage komplett. Andererseits: Wenn sie jetzt nicht aufwachte, wenn sie das auf sich sitzen ließ, war alles verloren. Mit gnadenloser Wucht knallte Gudrun den Ball über das Netz zurück in Martins Feld und brüllte Entschuldigung, diesmal ohne Grund, denn der Ball landete im Feld. Auch beim Rückhandspiel waren ihre Schläge nun präzise, und sie holte einen Punkt nach dem anderen. Wie genoss sie Martins verwunderte Blicke! Immer häufiger landeten seine Bälle auf ihrer Seite im Aus. Er sagte nicht Entschuldigung, sondern Sorry.
Nach dem Spiel, das sie knapp gewann, drückte er ihr anerkennend die Hand, dabei zeigte der Verlierer seine bezaubernden Grübchen. Als sie zum Tisch zurückkamen, klatschte Margot Beifall und kündigte an, sie wolle eine Runde Limonade spendieren. Martin wehrte sich. Von einem Mädchen eingeladen zu werden, kam für ihn nicht in Frage. Doch die beiden Freundinnen kicherten über seinen Protest hinweg, also fügte er sich. Während sie ihre Limonade tranken und den anderen Spielern zuschauten, spürte Gudrun, wie Martin sie immer wieder von der Seite ansah. Großmutter Regina sei Dank, dachte sie. Von ihr hatte sie eine gerade Nase geerbt.
Mit großer Geste wies sie auf die zwei Spiele, die eben im Gange waren, und meinte: Da wollen wir doch mal gucken, wer zu den Tigern gehört und wer zu den Enten.
Martin lachte laut auf, seine Freunde am anderen Tisch sahen überrascht zu ihm hin.
Das sind ja hochinteressante Kategorien, Fräulein Samuel. Wir sollten sie unbedingt in das Regelwerk des internationalen Tennisbundes aufnehmen. Aber wenn ich fragen darf: Wie, bitte, ordnen Sie selbst sich ein?
Ob ich Ente oder Tiger bin? Um Zeit zu gewinnen, sagte sie: Was meinst du, Margotsche?
Die Freundin schwieg verlegen. Gudrun wandte sich wieder Martin zu: Was mich angeht, da müssen wir unterscheiden. Beim Hin- und Herlaufen bin ich durchaus keine Ente. Aber meine Schläge, wie sie am Anfang des ersten Satzes auftraten, hätte man sehr wohl dem hektischen Flügelschlagen zuordnen können.
Normalerweise schrieb Margot aus eigenem Antrieb keine Briefchen während des Unterrichts, aber diesmal musste sie etwas loswerden.
So wie dieser Martin redet, sitzt er hoch zu Ross.
Es juckte Gudrun in den Fingern zu schreiben: Du bist ja nur neidisch. Aber das traute sie Margot nicht zu. Wofür hat man Freundinnen, wenn man ihre ehrliche Meinung nicht hören will? Nach einer längeren Pause versuchte sie es mit einer Erklärung.
Vielleicht weiß Martin nicht, wie man mit Mädchen spricht. Er hat drei Brüder und keine Schwester.
Kann sein. Ich will nur nicht, dass du genauso geschwollen daherredest wie er.
Keine Sorge!
Doch. Du hast schon damit angefangen.
Hab ich? Sag mal ein Beispiel.
Meine Schläge, wie sie am Anfang des ersten Satzes auftraten, hätte man sehr wohl dem hektischen Flügelschlagen zuordnen können.
Das soll ich gesagt haben?
Ja, hast du.
Ist ja furchtbar! Dann kneif mich das nächste Mal. So etwas darf gar nicht erst einreißen. Ich will doch nicht als dumme Pute erscheinen.
Versprochen. Dann kneife ich dich. Noch etwas: Schnecke mochte Martin.
Beim nächsten Wiedersehen im Strandbad lud Gudrun Martin Schubert zum Schlepperschwimmen ein. Er erschrak. Bitte tun Sie das nicht! Die Strömung! Sie überhörte es. Nervös ging er hinter ihr her. Ein wildes Mädchen, dachte er, man muss auf sie aufpassen. Gemeinsam enterten sie das nächste Schiff. Er fühlte sich unwohl bei der Sache. Sie dagegen griff betont entspannt unter ihre Badekappe und zog Zigaretten und Streichhölzer hervor. Möchten Sie? Martin lehnte ab, er war Nichtraucher.
Schon eine ganze Weile wünschte Gudrun sich einen Freund, mit dem sie Pferde stehlen konnte, wie sie Margot anvertraut hatte. Bei Martin sah sie nun schwarz. Sie drückte den Rücken durch, stellte die Knie auf … Verdammter Mist! Der weiße Badeanzug war voller Teer. Es lief nicht gut an diesem Nachmittag. Teer ist Teer, da war nichts mehr zu machen. Nach einer zweiten Zigarette hatte sie sich wieder beruhigt. Was soll’s, dachte sie, die Mutter kauft mir schon einen neuen Badeanzug.
Doch als sie heimkam, empfing Helene Samuel sie sehr ernst und vorwurfsvoll: Die Wasserschutzpolizei habe angerufen. Die Eltern würden zur Verantwortung gezogen, wenn ihre Tochter das Schlepperschwimmen nicht sein ließe.
Versprich mir, dass du damit aufhörst, Kind!
Gudrun tat es »hoch und heilig«. Natürlich machte sie weiter. Die nächste Beschwerde der Polizei ließ nicht lange auf sich warten, und Helene weigerte sich diesmal, den ruinierten Badeanzug zu ersetzen.
An einem Sonntag stand für die Junioren des Tennisklubs der Sommerausflug auf dem Programm. Als sich die Gruppe junger Leute auf einem Rheindampfer für ein Foto zusammenstellte, legte Martin zärtlich seinen Arm um Gudrun.
2 Sie wurden in einem Atemzug genannt. Gudrunundmartin, die sind ja schlimmer wie ein Ehepaar, hieß es im schönsten Mainzer Komparativ. Sie wohnten nur ein paar Straßen voneinander entfernt. Als sie feststellten, dass sie am selben Tag Geburtstag hatten, waren sie nicht sonderlich überrascht. Alle Kräfte, die die Welt in Schwung hielten, schienen ihnen zuzuarbeiten. Die Meinungen im Viertel gingen auseinander. Die einen sagten: Wie wunderbar, zwei junge Menschen, wie füreinander bestimmt. Andere meinten, das werde nur eine vorübergehende Schwärmerei sein. Wenn Gudrunundmartin davon hörten, lachten sie. Was wussten die Leute schon?
Eine Straßenlaterne, die auf dem halben Weg zwischen ihrem und seinem Schulgebäude lag, wurde zu ihrem Treffpunkt. Jeden Morgen wartete er auf sie oder sie auf ihn. Sie hatten sich unendlich viel zu erzählen.
Vater hat sich gestern Abend aufgeregt, dass wir so lange telefoniert haben.
Meiner auch.
Aber mein Vater meint es nicht so …
Meiner schon.
Wie findest du die Musik von Bach?
Kenn ich eigentlich nicht …
Dann müssen wir unbedingt mal in ein Konzert gehen.
Ja, das machen wir.
Welche Schuhgröße hast du? 41? Das ist aber viel für ein Mädchen. Aber du bist ja auch ziemlich groß. Das gefällt mir so an dir.
Sag mal, Martin: Magst du gekochte Zunge?
Zunge? Brrrrr, widerlich.
Da bin ich aber froh.
Häufig zur Mittagszeit, wenn Gudrun träumend den Unterricht absaß, drang Martins Pfiff bis zum zweiten Stock hoch, zweimal kurz, einmal lang mit aufsteigendem Ton. Wenn die Schülerinnen ihn hörten, wurden sie unruhig. Alle Mädchen schwärmten für Martin Schubert, der fabelhaft aussah, sportlich und obendrein unterhaltsam war. Auch galt er als sehr guter Schüler, ohne streberhaft oder eingebildet zu sein. Dass er sich ausgerechnet die faule Gudrun ausgesucht hatte, die noch am Daumen lutschte, darüber wurde in der Mädchenschule viel geklatscht. Wenig Freundliches war aus den Reihen der Gleichaltrigen zu hören. Niemand erwähnte, wie schön sie geworden war – das war unverzeihlich für alle, die sich selbst mit Pickelhaut und fettigen Haaren herumschlugen.
Nach wenigen Wochen zählten Gudrunundmartin zum Inventar der vertrauten Umgebung, wie die Christuskirche, wie Frau Gärtner mit ihrem Kiosk, wo Schulkinder Bonbons und Hefte kauften, wie das Gefängnis mit seinen vergitterten Fenstern, unter denen Frauen bei Nacht die Namen ihrer Männer riefen. In einem Punkt aber täuschten sich Gudruns Mitschülerinnen. Sie lutschte, genauer gesagt knabberte nicht mehr am Daumen. Von einem Tag auf den anderen hatte sie damit aufgehört, nachdem Martin sie auf die Hornhaut unterhalb des Nagels angesprochen hatte.
Er legte großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres, was aber nicht durchzuhalten war, wenn ihm das Hemd hinten aus der Hose hing. Schuld daran sei sein überlanger Oberkörper, erklärte er Gudrun. Zwar versuche er, dies mit überlangen Hemden auszugleichen, die er extra bei einer Schneiderin in Auftrag gab. Doch leider seien seine drei Brüder genauso gebaut, und die hätten keine Hemmungen, sich aus seiner Schublade zu bedienen.
In diesem Sommer, in dem sie jede freie Minute miteinander verbrachten und abends stundenlang telefonierten, ließen Martins Schulnoten merklich nach. Er musste seinen Platz als Klassenprimus an seinen Freund Robert Silbermann abtreten. Der Sohn des Rabbiners hatte ebenfalls ein Auge auf Gudrun geworfen, doch als Martin bei der schönen Samuel gelandet war, wünschte ihm Robert viel Glück und sie blieben beste Freunde.
Nachmittags fuhren Gudrunundmartin mit den Rädern los, strampelten am Rheinufer um die Wette, suchten einen abgelegenen Platz am Strom, wo sie niemand beim Knutschen störte. Häufig nahmen sie die Straßenbahn nach Wiesbaden, sie gingen ins Café Grün, weil sich Liebespärchen in den dunkelgrün gepolsterten Nischen nahezu unsichtbar machen konnten. Hier hatte Martin seine Freundin zum ersten Mal geküsst, so richtig, wie es Erwachsene tun. Gudrun war völlig unvorbereitet gewesen. Noch Stunden danach fühlte sie sich durch das Spiel ihrer Zungen erregt und verwirrt. Sie verpasste die Straßenbahn, kam zu spät zum Abendessen, saß geistesabwesend bei Tisch und zog sich gleich danach auf ihr Zimmer zurück. Sie schwor sich, die Fahrkarte der Straßenbahn immer und ewig aufzubewahren.
Es fiel Gudrun schwer zu glauben, dass Martin, der drei Jahre älter war als sie, gern zur Schule ging und sich für die meisten Fächer tatsächlich interessierte. Er zeichnete leidenschaftlich gern und trug immer einen Skizzenblock bei sich. Wenn in der Freizeit Gleichaltrige träge herumsaßen, schwatzten und rauchten, hielt er sich abseits und zeichnete liebevolle Skizzen von Menschen oder Szenen, die er gerade beobachtete oder noch vom Vortag im Gedächtnis hatte. Auch Schnecke hatte er sofort gezeichnet.
Vielleicht, überlegte Gudrun, unterrichteten an seinem Gymnasium einfach die besseren Lehrer. Sie jedenfalls hatte noch kein Lehrer für irgendetwas begeistert. Eines Morgens, als sie in der Klasse vor sich hin dämmerte, flog ihr ein nasser Schwamm ins Gesicht.
Samuel, wach uff!, rief Englischlehrer Tonkel, ein alter Mann, der nach Zigarre roch.
Mittags, an ihrer Laterne, berichtete sie Martin davon. Zwei Tage später, wiederum mittags nach Schulschluss, sahen sie Tonkel, wie er sein Fahrrad schob und laut über die Missgeburt schimpfte, die ihm die Ventile geklaut habe.
Martin wollte Schauspieler werden. Warum er dann so gründlich für Latein, Griechisch und Mathematik lerne, fragte Gudrun, damit könne er doch auf der Bühne überhaupt nichts anfangen. Wozu also die Mühe?
Weil ich keine Lust habe, ein dummer Schauspieler zu werden. Davon gibt es schon genügend.
Und woran merkt man das?
Dass sie aufgeblasenes Zeug reden und nicht wissen, wer Aristoteles war.
Das weiß ich auch nicht.
Na gut, du bist ja auch erst dreizehn.
Aber ich werde bald vierzehn!
Sie lagen nebeneinander im Gras. Martin erzählte von Theaterbesuchen in Berlin. Nur ein einziges Mal war er bislang dort gewesen, es hatte sein Leben verändert, es hatte seine Liebe zum Schauspiel entfacht, diese Flamme suchte nun ständig Nahrung. Nie war er ohne ein Reclambändchen unterwegs. Die Lektüre machte ihn zu einem guten Erzähler. Seine Freunde hörten die unglaublichsten Geschichten, ohne zu ahnen, dass sie lange vor ihrer Zeit von Shakespeare erzählt worden waren. Martin hatte sie einfach ins Hier und Heute übertragen. Die Unwissenheit seiner Freunde störte ihn nicht. Er wollte sie nicht bilden, er wollte sie unterhalten.
Allerdings: Wenn er sich seinen Berliner Erinnerungen überließ, flog er davon, dann wollte er nur noch erzählen, egal, wer ihm zuhörte. Seine Leidenschaft brannte mit ihm durch. Ständig fielen ihm neue Details ein. Die Namen genialer Theatermenschen und grandioser Theaterstücke, mit denen Martin nur so um sich warf, sagten Gudrun, die neben ihm an einem Grashalm kaute, überhaupt nichts. Sie gähnte, zupfte Blütenblätter, und irgendwann begann sie ihn zu kitzeln, bis er endlich still war und sie wieder in den Arm nahm.
3 Es war früher Nachmittag. Nach einem Schläfchen, das er sich stets nach dem Essen gönnte, setzte sich Wilhelm Samuel zu seiner Frau in den Salon. Sie ließen sich gerade ihren Mokka servieren, als unten auf der Straße jemand pfiff, zweimal kurz, einmal lang mit aufsteigendem Ton. Ihre Tochter erschien im Türrahmen und rief mit glänzenden Augen: Ich geh jetzt fort!
Für Gudrun besaß die Ehe ihrer Eltern nichts Nachahmenswertes. Sonntags fuhren sie nach Wiesbaden, um auf der Wilhelmstraße zu promenieren. Anschließend ging man Kaffeetrinken. Zu besonderen Anlässen wurde eine Königinnenpastete bestellt, dazu gab es ein Glas Sherry. Auch Wilhelms Nörgelei und seine Wutanfälle gehörten zu den festen Ritualen. Doch weder er noch Helene wäre je auf die Idee gekommen, sich scheiden zu lassen. Seine Frau hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Rolle als Ehefrau vorbildlich zu spielen. Dazu gehörte ihr elegantes Erscheinungsbild, ihr makelloses Auftreten, ihre durch nichts zu irritierende freundliche Haltung. Einige Male im Jahr luden die Samuels ihre jüdischen Freunde und Bekannten zum großen Abendessen ein. Wilhelm liebte es, Gäste im Haus zu haben, dann war von seiner Knauserigkeit nichts mehr zu spüren. An einer langen Tafel fanden vierundzwanzig Personen Platz. Zum Essen spielte ein Quartett Kammermusik. Die Samuels genossen ihren Lebensstil und die Sicherheit, in der besseren Gesellschaft ihrer Stadt fest verankert zu sein.
Zur Hausfrau mit praktischen Fähigkeiten war Helene nicht erzogen worden. Sie konnte nicht nähen, nicht bügeln, nicht kochen. Doch sie ließ es sich nicht nehmen, die Lebensmittel frisch einzukaufen. Im Viertel und auf dem Markt war sie beliebt – eine vornehme Dame, die sich für die täglichen Besorgungen nicht zu fein war. Außerdem verstand sie etwas von Fleisch, Fisch und Obst. Und während sie vom Bäcker zum Metzger und dann zum Gemüsehändler und zum Obststand ging, nahm sie sich stets Zeit, um die Zartheit eines Rinderfilets und den Duft bestimmter Äpfel zu loben.
Im Abschmecken der Speisen an der Seite der Köchin zeigte sie sich als wahre Meisterin. Noch etwas Majoran, Hilde, nur ganz wenig. Am liebsten war ihr das wilde Kraut von den Schweizer Berghängen. Wenn ihr Mann allein zu einer Wandertour ins Tessin aufbrach, reichte sie ihm eine kleine geflochtene Schachtel mit dem Auftrag, er möge ihr Majoran mitbringen.
Helene achtete darauf, dass nicht alle drei Hausangestellten gleichzeitig Ausgang erhielten. Als dies doch einmal geschah, ertappte Gudrun ihre Mutter dabei, wie sie hilflos mit dem Teekessel am Herd stand. Sag mal, Gudrunsche, weißt du, wie das Wasser aussieht, wenn es kocht?
In ihrem Schweizer Pensionat hatte Helene ein wenig Literatur, Kunstgeschichte und Klavierspielen gelernt. Dort war man der Auffassung gewesen, ein Mehr an Bildung könne für junge Mädchen schädlich sein. Es passte zu den Anschauungen ihres Mannes. Wilhelm zeigte ihr, wo sie bei der Wahl zum Reichstag das Kreuz machen sollte – beim Zentrum natürlich, eine andere Partei kam überhaupt nicht in Frage –, und sie tat es, ohne weiter darüber nachzudenken. Eigentlich war Helene Samuels Leben perfekt. Zwar war ihr Mann gelegentlich schwer erträglich, aber zum Ausgleich hatte sie eine Vertraute, die ihr unbegrenzt die Treue hielt, ihre eigene Mutter. In dem Ausmaß, wie Hannah Samuel von ihrem Sohn gehasst wurde, wurde Regina Trittner von ihrer Tochter geliebt. Zwei-, dreimal in der Woche fuhr Helene nach Wiesbaden, um ihre Mutter zu besuchen. Sie nahm die Straßenbahn um halb vier und kam mit der Sieben-Uhr-Bahn zurück. Um halb acht wurde zu Abend gegessen.
Helene hätte gern einen verständnisvolleren Ehemann gehabt, vor allem aber einen, der sie nicht betrog. Über seine Liebschaften wurde in der Kaiserstraße nicht gesprochen, doch Gudrun, der selten etwas verborgen blieb, wusste schon früh davon. Wenn sie ihre Mutter mit Migräne im Bett liegen sah, kam ihr als Erstes in den Sinn: Vater ist wieder einmal mit einer fremden Frau verreist.
Die Schweiz war Wilhelms liebstes Ziel. Mit ständig wechselnden Geliebten fuhr er zum Ski- und Eislaufen. Im Sommer verbrachte er gern eine Woche in Ascona. Über die Jahre hatte er miterlebt, wie das Fischerdorf am Lago Maggiore zum Treffpunkt junger Europäer geworden war, die über politische Reformbewegungen, Kunst, gesunde Ernährung und Freikörperkultur debattierten. Dem Alter nach gehörte Wilhelm, der auf die Fünfzig zuging, nicht mehr dazu, aber seine Begleiterinnen durchaus. Offenbar stand er gern am Rand und nahm die eine oder andere kulturelle Anregung dankbar an. Besonders die hingebungsvollen Tänze junger Damen auf dem Monte Verità, mit nichts als einem Schleier und dem Mondlicht bekleidet. Wenn Wilhelm mit einer seiner Geliebten in den Bergen wanderte, vergaß er nie das Schächtelchen, das seine Frau ihm mitgegeben hatte. Wenn er es ihr in Mainz mit Majoran gefüllt überreichte, machte er eine leichte Verbeugung und nannte sie seine persische Königin.
Wie es in Helene tatsächlich aussah, das erfuhr nur die Mutter in Wiesbaden, die alles verstand und verschwiegen war wie ein Grab. Das einzige Liebessehnen, das Helene zuließ, verband sich mit der Fastnacht. Zum Rosenmontagsball in der Stadthalle erschienen Wilhelm und Helene stets getrennt. Sie hatten sich verkleidet und dem anderen nichts über das eigene Kostüm verraten. Helene erkannte ihren Mann sofort, weil Wilhelm selbst mit Maske immer so aussah wie Wilhelm. Nach jedem Ball erzählte sie ihrer Mutter, er habe stundenlang an der Bar gestanden und scheinbar ahnungslos mit maskierten Damen geschäkert, die sich nach Mitternacht als seine Angestellten zu erkennen gegeben hätten.
Wilhelm selbst entdeckte seine Frau immer erst, wenn die Ballbesucher ihre Gesichter enthüllten. Bis dahin hatte Helene den Abend mit einem Musketier, einem Matrosen oder Harlekin verbracht, der sich in jedem Jahr als Dr. Kitzig entlarvte, der Direktor des Elektrizitätswerks.
Ob Wilhelm Helenes Geheimnis kannte, ob er es ihr gönnte oder ob er darüber hinwegsah, aus Angst, als eifersüchtiger Ehemann zu gelten – auch darüber rätselte seine Frau, ohne je zu einem Ergebnis zu kommen. Stundenlang konnte sie diese Fragen mit ihrer Mutter erörtern, beginnend mit dem Tag, der dem Maskenball folgte, wenn sie ihrer einzigen Vertrauten von Dr. Kitzig berichtete und sich noch einmal seine zauberhaften Komplimente auf der Zunge zergehen ließ.
4