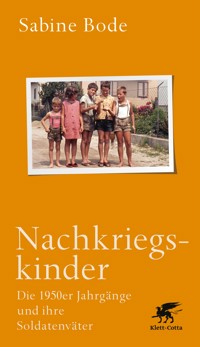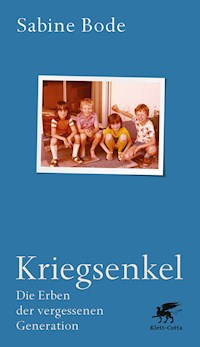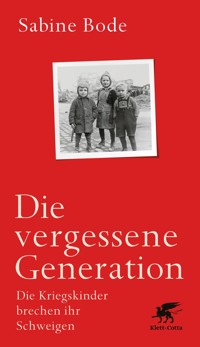Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: USM Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Familienroman von Bestsellerautorin Sabine Bode Familie, nein danke lautet Sonjas Lebensmotto – und damit ist sie stets gut gefahren. Bis ihr Bruder Rolf überraschend an der Ostsee auftaucht und in der dunklen Familiengeschichte zu graben beginnt. Lebensnah und feinfühlig erzählt Sabine Bode von einem ungleichen Geschwisterpaar, das die Narben seiner Herkunft nicht länger versteckt. Wenn der eigene Bruder plötzlich vor der Tür steht, kann es das eigene Leben ganz schön durcheinanderwirbeln. Während Sonja das Kapitel Familie schon vor Jahren geschlossen hat, ist der Erkenntnisdrang bei Rolf taufrisch. Seine Mission ist es, die Schwester zur gemeinsamen Familienaufarbeitung anzustiften, aber Sonja fällt es schwer, sich auf die neue Nähe einzulassen. Doch dann bittet ihre Nichte Nina sie um Hilfe. Halb widerwillig, halb neugierig kehrt Sonja ihrer friedlichen Ferienwohnung an der Ostsee schließlich den Rücken und macht sich mit Rolf in dessen rostigem VW-Bus auf die Reise an die Orte ihrer gemeinsamen Vergangenheit und in ihr Elternhaus, einen Ort des Schreckens. Bestsellerautorin Sabine Bode erzählt in ihrem zweiten Roman höchst authentisch von den Traumata eines Geschwisterpaares, die ihren Ursprung in der NS-Zeit haben.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Bode
Geschwister im Gegenlicht
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: © Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung zweier Abbildungen von © Thomas Barwick, gettyimages/Jörg Meier, plainpicture
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von C.H. Beck, Nördlingen
ISBN 978-3-608-98816-1
E-Book ISBN 978-3-608-12197-1
Inhalt
EINS
ZWEI
DREI
Danksagung
Literaturverzeichnis
Für Maya Lasker-Wallfisch
Es war einer von den allerschlimmsten, es war »der Teufel«. Eines Tages war er so recht guter Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, der die Eigenschaft besaß, dass alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, zu fast nichts zusammenverschwand, aber was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, das trat so recht hervor und wurde noch ärger. Die schönsten Landschaften sahen in dem Spiegel aus wie gekochter Spinat, und die besten Menschen wurden ekelhaft und standen auf dem Kopfe ohne Bauch.
Hans Christian Andersen, Die Schneekönigin
EINS
Mein großer Bruder findet mich seltsam und sich selbst normal. Seit fünfzig Jahren lacht er mich aus, wenn ich etwas tue, was er nicht nachvollziehen kann. Ruft er mich an, fragt er nicht, wie es mir geht. Er setzt mich in Kenntnis. Er macht kurze Ansagen oder lange Mitteilungen, ohne Pause. Das Ende kommt abrupt. Plötzlich höre ich: »Mach es gut.« Bevor ich selbst etwas sagen kann, legt er auf. Als hätte ich ihm genug seiner kostbaren Zeit gestohlen. Meine Fragen haben keine Chance. Weiß er etwas darüber, dass ich sterben sollte?
Auf Stammbäumen hat er alle Zweige gelb markiert und Namen eingekreist, die auf Verwandte verweisen, über die er nichts weiß. Es sind Namen, die er als kleiner Junge aufschnappte, weil die Eltern sie voller Verachtung ausstießen, aber mit Blick auf den lauschenden Sohn sofort das Thema wechselten.
»So waren sie, unsere Mutter und unser Vater, mit fast allen Verwandten verkracht«, sagt Rolf immer. »Aber wenn ich dann bei Kusinen und Vettern zweiten Grades anrufe, werde ich eingeladen und an andere Verwandte weitergereicht. Ich lerne nur nette Leute kennen.« Auch darüber würde ich gern mehr wissen. Aber mein Bruder ist ein merkwürdiger Geheimnisverwalter. Wenn man ihn unterbricht und nachfragt, zieht er sich in seinen Panzer zurück wie eine Schildkröte.
Rolfs Anruf erreicht mich in einer Ferienwohnung, in die ich mich mit zwei Bücherkartons zurückgezogen habe. Mein Handy klingelt, während ich auf der Bettkante sitze, schon im Schlafanzug, bereit, mich zu meiner Wärmflasche zu legen.
»Hallo Sonja. In Berlin meldet sich niemand«, sagt mein Bruder. Seine Stimme klingt anders als sonst, weicher, stockender.
»Wo bist du?«
»An der Ostsee.«
»Aha. West oder Ost?«
»West.« Ich versuche, ein Gähnen zu unterdrücken.
»Und wie lange bleibst du?«, fragt mein Bruder.
»Was weiß ich, Rolf … Die Ferienwohnung habe ich für zwei Monate gemietet, aber ich kann länger bleiben. Man wird sehen. Ich bin erst vor einer Stunde angekommen.«
»Im Februar an der Ostsee! Das ist nicht dein Ernst, Sonja. Warum nicht die Kanaren?«
»Habe ich schon hinter mir«, sage ich. »Hat außer Sonnenbrand nichts gebracht.«
»Na schön. Weshalb ich anrufe: Meine Jüngste, die Nina, wird bald dreizehn Jahre alt und wünscht sich, ihre Tante kennenzulernen. Wir würden dich gern besuchen. Passt dir der kommende Mittwoch? Denk doch mal drüber nach, ob du im grimmigen Norden etwas Gesellschaft brauchen kannst.«
»Wie bitte?«
»Überraschung?«
»Allerdings. Und was für eine … Kein Problem, Rolf, ihr könnt gern kommen.«
»Fein. Näheres würde ich dir als E-Mail schicken.«
»Aber ich habe hier kein Internet.«
»Weiß ich. So ist das in Ferienwohnungen. Aber ein Internet-Café gibt es doch, oder?«
»Davon gehe ich aus.«
»Ach lass mal, ich rufe dich an. Mach es gut bis dahin.«
Nach einem »Herzlichen Gruß an Nina« lege ich das Handy beiseite. Eben noch, auf der Bettkante, spürte ich nichts als totale Erschöpfung. Ich hasse Autofahrten im Stau oder wenn es schon dunkel ist. Jetzt bin ich hellwach. Meine Zusage, die wie aus der Pistole geschossen kam – was, in aller Welt, war das? Ich suche absolute Ruhe und Abgeschiedenheit, will mit niemandem reden, und knicke schon am ersten Abend ein.
Ich habe nicht die geringste Vorstellung, wie das gutgehen soll zwischen Rolf und mir. Ein Fremder bricht in mein Refugium ein, der sich einbildet, mich zu kennen, und nicht anders geht es mir mit ihm. Die Bilder, die wir voneinander haben, können sie anders sein als konturlos und unterbelichtet? Wir sind kein befreundetes Geschwisterpaar. Nicht, dass wir uns streiten. Wir können nur nichts miteinander anfangen. Wir kommen nicht in dieselbe Spur.
Zu einem Code des Smalltalks ist es zwischen uns nie gekommen. Keine Stichworte, über die nur wir beide lachen können. Unser einziger gemeinsamer Nenner ist, dass wir erfolgreich Distanz halten. Noch nie haben wir uns umarmt, uns nicht einmal an den Händen gehalten, auch nicht bei Vaters Beerdigung, als wir weinend nebeneinanderstanden. Auf Familienfesten bin ich unerwünscht. Dass Rolf vor gut einem Jahr zur Trauerfeier von Karl anreiste, rechne ich ihm hoch an. Er mochte meinen Mann nicht. Davor ergab sich vielleicht alle fünf Jahre ein Anlass sich wiederzusehen, umgeben von anderen Gästen. Wir kamen nicht auf die Idee, uns ihnen als Geschwister vorzustellen. Biologisch sind wir Bruder und Schwester, aber wir sehen uns kein bisschen ähnlich. Wir sind im selben Elternhaus aufgewachsen und einander doch so fremd wie zwei Aliens, die von völlig unterschiedlichen Planeten stammen.
Mit schlenkernden Armen und Beinen drehe ich ein paar Runden um den Esstisch. Mein Kopf ist heiß gelaufen, ich friere. Zwei Heizkörper sind bis zum Anschlag aufgedreht und arbeiten noch daran, aus diesem Iglu eine warme Unterkunft zu machen. Die beiden Außenwände sind eiskalt. Eigentlich sollte vorgeheizt sein. Eine gute Freundin werde sich um alles kümmern, hat mir die Vermieterin versichert, sie selbst verbringe die kalten Monate auf Mallorca. Bei Spätanreise befänden sich zwei Schlüssel mit einem roten Anhänger zwischen den winterfest geschnittenen Pflanzen und den Schneeglöckchen neben der Haustür links. Taschenlampe mitbringen!
Was will Rolf? Was ist los mit ihm? Vielleicht sagt er im letzten Moment wieder ab. Was weiß man schon, wenn man sich kennt, ohne sich zu kennen … Vor meinem inneren Auge taucht ein Schild mit der Aufschrift Vorsicht auf. Bei Fragen zu meinem Bruder, die mit was, wann und warum anfangen, muss ich aufpassen. Sie sind das Echo tief verankerter Reflexe, die ich in Schach halten muss, um nicht ins Grübeln zu geraten, womöglich in ein Gedanken-Labyrinth, aus dem ich nur schwer wieder herausfinde. Wenn ich mir über abwesende Leute, die sich nebulös oder kränkend verhalten haben, den Kopf zerbreche, fühle ich mich schnell wie ausgeliefert, auch dann, oder gerade dann, wenn es sich um meinen Bruder handelt.
Zum Glück hat mir das Alleinsein beigebracht, eher auf meinen Verstand zu hören als auf meine Gefühle. Kopfkino kann mich halb verrückt machen. Es gibt keinen Karl mehr, der sagt: »Stopp! Du drehst dich im Kreis! Lass uns ins echte Kino gehen.« Woran ich mich heute festhalte, ist ein Stopp, das ich mir selbst zurufe. Ich habe es trainiert. Entschlossen öffne ich ein Fenster und lasse meine Fragen zu Rolf mit einem freundlichen Adios davonfliegen.
Während ich einen herrlich duftenden Kakao trinke, blättere ich in einem Reiseführer, der auf jeder zweiten Seite eine Seebrücke zeigt. Nichts anderes habe ich mir gewünscht. Keine Abwechslung. Kein Anlass für Besichtigungstouren. Das Auto bleibt stehen. Strandspaziergänge reichen mir. Der Wetterbericht hat Sonne versprochen. Ich putze mir zum zweiten Mal die Zähne, verkrieche mich unter einem unförmigen Federbett und höre im Halbschlaf, wie die Heizkörper auf nächtliche Sparflamme umschalten.
Noch vor der Morgendämmerung treiben mich heftige Kreuzschmerzen aus dem Bett. In der Wohnung ist es kaum wärmer geworden, aber die Dusche und ein Rest vom Kakao werden schnell heiß. Eine halbe Stunde später bin ich am Strand. Auf einem ausgedehnten Marsch in frostig kalter Meeresluft, der damit beginnt, dass Möwen parallel zur Wasserfläche durch die langsam steigende Sonne fliegen, geht es mir gut, genaugenommen besser als gut. Manchmal bleibe ich unwillkürlich stehen und drehe mich mit ausgestreckten Armen langsam um die eigene Achse. Mir fällt gerade kein Gedicht ein, das mein Glücksgefühl treffend beschreibt. Großen Dichtern gelang es meisterhaft. Davon in eigenen Worten zu erzählen, kommt bei einigen Freundinnen nicht gut an. In ihren Ohren klingen sie pathetisch oder esoterisch. Warten wir ab, ob sie einmal anders darüber denken, wenn sie ihren Mann verloren haben. Ob diese Freundinnen sich meinetwegen Sorgen machen oder hinter meinem Rücken lachen, ist mir egal. Ich habe keine Hemmungen, davon zu reden, wie entspannt, dankbar und frei ich bin, weil ich mich plötzlich von allen Seiten verwöhnt fühle. Auf einmal bin ich leicht wie eine Seeschwalbe und stark wie eine Elefantin. Alles ist wieder möglich, alles ist erlaubt. Und es kommt noch besser: Aus Erfahrung weiß ich, dass sich mit jedem Tag allein am Strand die Glücksmomente zu Glücksminuten verlängern – und das hoffentlich mit der Tendenz, sich zu einem Netz zu verbinden, das mich wieder trägt und beschützt.
Nach zwei Stunden hat der Ostwind aufgefrischt. Ich lasse den Strand hinter mir und irre durch einen lang gezogenen Küstenort, auf der Suche nach einem netten Café. Mit der Ostseeküste kenne ich mich nicht aus. Ich habe den Ort im Internet gebucht, weil mein Vater den Namen erwähnte, als er von den glücklichsten Ferien seiner Kindheit erzählte. Ein altes Foto, das bis zu seinem Tod in seiner Brieftasche steckte, zeigt meine Großmutter mit einem riesigen Hut und einen kleinen Jungen mit Matrosenkragen, die vor einer Fassade der frühen Bäderarchitektur posieren. Jetzt weiß ich, dass davon nichts übriggeblieben ist.
An einem Kiosk der Uferpromenade wärmt mich in einer geschützten Ecke die Sonne wieder auf. Ansichtskarten mit Luftbildern haben mir verraten, dass ein Seebad, das als einzige Attraktion drei Kilometer Strand zu bieten hat, mit dem Label »Kleinod der Ostsee« wirbt. Ich will mich schon darüber lustig machen, doch mein Herz für Kinder lässt es nicht zu, schon gar nicht das kleine Nordseekind in mir, dessen Erinnerungen an endloses Wasser und endlosen Sand und an einen riesengroßen Bruder, den es bis zum Umfallen mit Matsch bewerfen durfte.
Historische Ansichtskarten kann ich nicht entdecken. Erinnerung unerwünscht? Seltsam. Ich will im Kiosk danach fragen, aber plötzlich läuft meine Nase, und es dauert eine Weile, bis der Mann mit der Schiffermütze einen großen Milchkaffee und ein Fischbrötchen an mich loswird. Während er mein Frühstück hochhält, fallen mir seine Fingernägel auf, seine gepflegten Hände. Kann es sein, dass er regelmäßig zur Maniküre geht, vielleicht sogar zur Kosmetikerin? Sein Gesicht ist faltenlos und rosig. Wie passt das zusammen mit dem Bild vom rauen Norden und seinen zupackenden Männern, frage ich mich ernsthaft, mit der Folge, dass ich die Kontrolle über den Milchkaffee verliere. Dünne, bis zum Rand gefüllte Plastikbecher sind nicht hilfreich. Nur die Hälfte des Kaffees überlebt den Transport zur nächsten Bank.
Das Fischbrötchen hat Hunger nach etwas Süßem geweckt. Der Mann im Kiosk erklärt mir den Weg zu einem Café, das schon morgens geöffnet hat. Alle anderen seien im Winter geschlossen. Ich freue mich auf eine Auswahl verlockender Torten und gehe, so schnell ich kann, durch Seitenstraßen, wo sich außer mir niemand aufhält. In der halb geöffneten Tür bleibe ich erschrocken stehen. Stoßweises Gelächter übertönt dröhnende Schlagermusik. Der Wärmeschub, vermischt mit einer Qualmwolke, riecht nach Schnaps und Zigaretten. Ich bin im Treffpunkt der Kettenraucher gelandet. Zwei Dutzend Menschen stehen vor der Theke eng beisammen. Von ihnen sehe ich nur die Rücken.
Erst auf den zweiten Blick erfasse ich, was los ist: In dem kleinen Café herrscht um diese Uhrzeit schon Karaoke-Stimmung. Jemand, den ich nicht ausmachen kann, feiert Geburtstag und wünscht sich ein Lied von Britta. So heißt die junge Bedienung, die erhöht, offenbar auf einem Tritthocker, an der hinteren Wand neben der Theke steht. Sie ist eine zarte blonde Frau, und ich gehe davon aus, dass sie das Glitzeroberteil eigens für den Anlass angezogen hat. Langsam führt sie das Mikro zum Mund und sagt mit einer klaren, schönen Stimme: »Lieber Heinz, es ist mir eine Ehre, an deinem Geburtstag für dich zu singen – bevor du noch eine dritte oder vierte Lokalrunde schmeißt.« Dem Lachen der Gäste gibt sie mit einer eleganten Handbewegung Raum, dann fährt sie ruhig fort: »Wie wir alle es tun, schätze ich deine Großzügigkeit. Aber ein noch größerer Fan bin ich von Nicole, und ganz besonders von ihrem Hit, der im letzten Sommer …«
»Anfangen!«, unterbricht sie jemand, der umgehend Beifall erhält. Ich finde, den ersten Applaus hätte nicht er, sondern Britta verdient. Als sie das Mikro in die Hand nahm, hat niemand geklatscht. Ich bleibe in der Tür stehen und beobachte die Szene. Die junge Frau ist kein Profi. Dem Zwischenfall ist sie nicht gewachsen. Den Blick gesenkt und verstummt, steht sie auf ihrem Podest. Räuspern und Husten im Publikum. Ich vermute, Britta hat alle Videos von Nicole studiert und ausdauernd geübt. Sie hat gelernt, dass für eine gute Show eine selbstbewusste Ansage und das Outfit genauso wichtig sind wie die Stimme. Nun ist ihr Konzept zerstört. Ob sie es trotzdem noch einmal versucht? Gern würde ich sie warnen. Aber Britta lächelt vorsichtig, schiebt die Playback-Disk ins Gerät und beginnt Sommer, Sommer zu singen – mit einer Stimme so ängstlich, so dünn, dass meine Augen feucht werden.
»Lauter!« – »Mikro an!« – »Ich hör nix.«
Missgünstig, bestenfalls gedankenlos klingen die Rufenden. Nachher werden sie sagen, sie hätten es nicht so gemeint. Britta kommen die Tränen. Sie gibt auf und erntet damit neuen Protest. Sie bleibt dem Publikum ausgeliefert. Zu spät ermahnt das Geburtstagskind seine Gäste, »unsere Britta« endlich in Ruhe zu lassen. Die wischt sich über die Augen, holt tief Luft, zupft ihr Glitzertop zurecht und gewinnt die Fassung zurück. Dann hat sie mich entdeckt und winkt mich zu sich. Unsicher erkämpfe ich mir den Weg bis zum anderen Ende der Theke. Inzwischen hat Britta ihre erhöhte Position verlassen, und wir sind auf Augenhöhe. Wie hält sie es hier nur aus, hätte ich gern gefragt. Die kranke Luft entsetzt mich am meisten. Ein Kanarienvogel würde keine drei Tage überleben.
Hastig entscheide ich mich für ein Stück Käsesahne, in Folie verpackt, das sie mir in einer kleinen Tragetasche über die Theke reicht. Ein zweiter Karaoke-Beitrag, diesmal von einer Männerstimme, Green Green Grass of Home, verfolgt mich bis auf die Straße. Den Refrain grölen die Geburtstagsgäste mit. Sie haben sich als Horde gefunden. Die Stimmung ist wieder hergestellt. Zurück in meiner Wohnung mache ich mir einen starken Kaffee und entferne vorsichtig die Folie von meiner Torte. Den ersten Bissen spucke ich gleich wieder aus. Er schmeckt nach Zigarette.
Auch meine Ferienwohnung ist ein Reinfall. Ich habe sie kurzfristig gebucht, als mich die Sehnsucht nach dem Meer gepackt hatte. Glanz gibt es nur in der integrierten Miniküche. Alles andere ist so schäbig, dass es mich graust. An den Fenstern vergilbte Stores, eine durchgelegene Matratze, der Teppichboden aus verschiedenen Resten komponiert, so scheußlich, dass man lieber nicht nach unten guckt. Abgenutzte Möbel aus mindestens fünf Jahrzehnten, jedes Stück ein Unikat. Die Wände in einem schmuddeligen Graubeige, ausgenommen vier helle Rechtecke, wo der Wandschmuck hing, den ich noch gestern entfernt habe, die einzige Tat unmittelbar nach meiner Ankunft am späten Abend.
Als ich mit dem Auspacken beginne, stelle ich fest, dass ich im Kleiderschrank nichts unterbringen kann, weil er nach Mottenkugeln riecht. Immerhin gibt es ausreichend Schubladen, von denen ich einige sofort hasse, weil sie sich verkanten und nur mühsam zu bewegen sind. Eigentlich bin ich gar nicht schlecht im Improvisieren und finde mich mit Unzulänglichkeiten schnell ab, aber die Sachen, die auf Kleiderbügel gehören, an Garderobenhaken zu hängen, geht mir zu weit. Mein Tatendrang bricht zusammen.
Nach einer Stunde Tiefschlaf auf der Couch, aus dem ich ohne Kreuzschmerzen erwache, beschließe ich erstens, meine Nächte künftig hier und nicht im Bett zu verbringen. Zweitens werde ich, weil ich Hunger habe, selbstgemachtes Chili con Carne aufwärmen, das ich aus Berlin mitgebracht habe. Drittens werde ich die Kleidungsstücke an der Garderobe auf meinem Bett ausbreiten.
Die Suche nach einer anderen Unterkunft verschiebe ich auf den nächsten Tag und rechne damit, dass ich scheitern werde – an meiner Trägheit und der geringen Auswahl an Angeboten in einem trostlosen kleinen Seebad im Februar. Immerhin erlaubt mir Rolfs Anruf, die Dinge guten Gewissens piano anzugehen. Für eine Quartiersuche plus Umzug ist die Zeit zu knapp. In zwei Tagen reisen Vater und Tochter an.
Keine Frau, die ich kenne, würde in diesem Loch ihren Verwandten Kaffee und Kuchen anbieten. Aber was bleibt mir anderes übrig? Heute Vormittag bin ich an zwei Hotels vorbeigekommen und habe erfahren, dass sie ihre Restaurants erst am Abend öffnen.
Wegen Rolf mache ich mir keine Sorgen. Ob etwas schön oder hässlich ist, scheint ihm nicht aufzufallen. Ein harmonisches Ambiente ist für ihn keine Kategorie. Genauso wenig kümmert ihn, wie sein eigenes Aussehen auf andere wirken könnte. In seiner Freizeit läuft er herum, als würde er sich beim Roten Kreuz einkleiden. Allerdings, das muss ich sagen, kann er es sich leisten. Er sieht verteufelt gut aus. Jedes noch so formlose Kleidungsstück steht ihm, weil er darin den Eindruck erweckt, für ihn sei Attraktivität ohne jede Bedeutung.
Schon in seiner Jugend war das so. Ich kann mich nicht erinnern, ihn je mit Kamm und Bürste vor dem Spiegel gesehen zu haben. Er fuhr sich mit den Händen durch sein dunkles, lockiges Haar, mehr nicht. In der Pubertät zeigte er allen ein missmutiges Gesicht, erschien nur zu den Mahlzeiten, saß schweigend am Tisch und flüchtete nach dem Essen wieder in sein Zimmer, zu seinen Schiffs- und Flugzeugmodellen. Dann erwachte er eines Tages und war Prinz Charming. Die Mädchen der oberen Schulklassen schwärmten für ihn, doch selbst das schien er nicht wahrzunehmen. Ich wette, die Frauen schauen ihm heute noch hinterher. Er ist der Typ Sean Connery, je älter desto attraktiver, aber anders als Sean Connery ist er kein Womanizer, da bin ich mir sicher. Fest steht, dass er mit seinem dunklen Teint, den schönen graugrünen Augen und dem an den Schläfen ergrauten, dichten Haar in seiner Altersklasse kaum noch Konkurrenten hat. Jemand wie er ist eine Rarität, wie ein Pfarrer, dessen Kirche jeden Sonntag voll ist.
*
Mein Handy klingelt, es reißt mich aus tiefen Gedanken, gerade als ich dabei bin, den selbstgebackenen Marmorkuchen aus dem Ofen zu holen.
»Hallo Sonja, etwas ist anders, als wir geplant haben …«
Die Kuchenform entgleitet mir und fällt mit einem Scheppern auf die Herdplatte.
»Hoppla! Heißt das, ihr kommt nicht?«
»Besser, du lässt mich ausreden. Es heißt, wir kommen eher. Nicht erst um vier, sondern schon um zwei. In Ordnung so?«
»Wo seid ihr?«
»Kurz vor Lübeck.«
»Alles klar.«
»Also dann – bis gleich.«
Ich schaue auf meine Uhr und erschrecke. Mir bleibt nur eine Stunde! Gerade noch Zeit für die letzten Vorbereitungen. Den Mittagstermin beim Friseur kann ich vergessen. Haare waschen muss ich selbst. Ich gehe in das komplett weiße Bad, in dem ich mich gern aufhalte, seit ich weiße Handtücher gekauft und die wohnungseigenen gräulichen Lappen luftdicht verpackt unter meinem Bett verstaut habe, zusammen mit dem Duschvorgang und anderem Überflüssigen, das mein Auge beleidigt hat.
Die Zeit rennt mir davon. Ich will mich für meine Nichte ein bisschen aufhübschen. Sie soll vor ihrer Tante nicht erschrecken. Wie wird sie auf meine Unterkunft reagieren? Es ist doch möglich, dass sie sich leicht ekelt, vielleicht schreit sie schon beim Anblick einer Fruchtfliege auf. Weder will ich Nina gleich zu Anfang verstören noch mit einem Schwall von Erklärungen milde stimmen. Oder doch?
Also stehe ich mit Shampoo und guten Absichten unter der Dusche, und während ich meine Kopfhaut massiere, arbeitet es drinnen im Kopf weiter. Ich könnte meiner Nichte gleich beim Begrüßen die Wahrheit sagen: »Meine Vermieterin hat die Möbel von Opa und Oma geerbt. Und die hatten sich alles, was sie brauchten, vom Sperrmüll besorgt. Darum, liebe Nina, sieht es hier so aus. Schrecklicher geht’s nicht. Nur ein Wohnungsbrand könnte helfen …«
Achtzig Prozent der Kinder ihres Alters würden daraufhin grinsen. Als Lehrerin lernt man die kleinen Tricks. Man verlernt sie auch nicht. Unbehagliche Stimmungen aufzulösen, fällt mir immer noch leicht. Wie die meisten Kinderlosen mag ich Pubertierende, vor allem die Mädchen, mit ihren seelischen Achterbahnfahrten, während die ersten Schamhaare sprießen. Da schwärmen sie für eine bestimmte Boygroup, träumen nachts davon, die große Ausnahme zu sein, was in diesem Fall bedeutet, dass sie als deren Frontsängerin groß rauskommen. Wenn sie morgens erwachen, ihren Plüschhasen knuddeln, sich die Zähne putzen, ist ihnen zum Jubeln zumute. Es sei denn, sie entdecken ein oder zwei neue Pickel. Dann steigt der Frust wie eine Rakete in die Höhe, entlädt sich in Tränen oder Wut. Für beides muss der Plüschhase herhalten, entweder als Tröster oder er wird im hohen Bogen in die Ecke geschmissen.
Aus alter Gewohnheit blättere ich manchmal noch in der neuen Bravo, auch wenn ich nicht mehr unterrichte. Ich war 25 Jahre im Schuldienst, da zahlte es sich aus, über die Vorlieben pubertierender Mädchen auf dem Laufenden zu sein. Es schaffte Vertrauen, wenn ich in Halbsätzen erkennen ließ, dass ich nicht von gestern war und ihr Gekicher in gewissen Grenzen als wohltuend empfand. Heute die Bravo in die Hand zu nehmen, weckt schöne Erinnerungen. Daher weiß ich, dass derzeit viele dieser wunderbaren und leicht verwundbaren Mischwesen entzückt sind von Snoopy-Unterhosen mit Rüschenrand.
Zum Inventar des Badezimmers gehört ein in die Jahre gekommener Föhn. Leider ist es mir nicht in den Sinn gekommen, ihn vorher zu testen. Er kennt nur einen einzigen Hitzegrad, gerade so, dass man sich nicht die Kopfhaut verbrennt. Also halte ich den heißen Luftstrom weit vom Kopf weg. Wenig später stehen meine Haare ab wie bei Struwwelpeter. Mein erster Impuls ist, den Kopf ein zweites Mal unter die Dusche zu halten, aber mir fehlt die Zeit, die Haare an der Luft trocknen zu lassen. Es gibt Frauen, die sehen mit nassen Haaren grandios aus. Ich nicht. Wenn mir die kinnlangen Strähnen am Kopf kleben, ist mein Gesicht noch schmaler als ohnehin, und wer mich nicht kennt, würde denken, ich lebte im Elend oder trüge das Elend in mir, vielleicht aufgrund von Krebs oder einem Flüchtlingsschicksal. Er würde in mir eine zutiefst bedauernswerte Frau sehen, die dazu verdammt ist, allein in einer elenden Wohnung zu leben.
Panik macht sich breit. Von mir aus soll sie. Die Panik und ich, wir haben einen Deal. Sie darf ruhig weiter Katastrophen an die Wand malen. Ich weiß, sie wird es bald leid sein, während ich eine Tasse Kaffee trinke und mit einer Feile meine Fingernägel kürze. Tatsächlich kommt mir eine gute Idee, eine sehr einfache Idee. Die Schirmmütze. Ich trage sie gern, besonders im Winter, wenn die Sonne tief steht. Sie schützt meine Augen besser als eine dunkle Brille.
Der Farbton des Glencheck-Musters entspricht dem meiner hellbraunen, von Grau durchzogenen Haare. Aufpassen mit dem Make-up. Dezent muss es sein, bloß kein auffälliger Lippenstift. Keine Wimperntusche, da bist du unbegabt, sie verschmiert so leicht. Mach keinen Clown aus dir. Ein letzter Blick in den Spiegel. Es ist mir gelungen, die lächerliche Frisur mithilfe meiner Kopfbedeckung zu zähmen. Die Kombination von farblich aufeinander abgestimmten Strohhaaren und der Schirmmütze verleiht mir das Aussehen einer unternehmungslustigen Frau, die mir unangenehm fremd ist. Keine Zeit zu grübeln. Der Kaffeetisch ist noch nicht gedeckt.
Wie angekündigt um 14 Uhr und winterlich eingewickelt, sehe ich sie die Treppe zum zweiten Stock hochkommen. Ein Mann und ein Kind, beide können sich kaum auf den Beinen halten. Ein knappes Hallo, mehr nicht. Es überrascht mich nicht. Da, wo wir herkommen, mein Bruder und ich, hat eine freundliche oder gar herzliche Begrüßung keinen Wert. »Na, dann rein mit euch zweien«, sage ich. Kalte Luft begleitet sie. Im engen Flur lassen sie Schals und Mützen zu Boden fallen, setzen sich ohne ein Wort mit geöffneten Winterjacken an den Kaffeetisch und stopfen den Marmorkuchen in sich hinein. Rolfs lockiges Haar ist weiß geworden! Wie geht das in so kurzer Zeit? Unter der Jacke meiner Nichte erkenne ich ein Sweatshirt mit einem freudig hüpfenden Snoopy auf der Brust. Ich hole Kaffee aus der Küche und setze mich hin.
Nina deutet mit der Gabel auf meinen Kopf. »Warum das?«
»Was? Ach so, die Mütze. Eine längere Geschichte. Ich bin eben erst vom Einkauf zurück.«
»Steht dir gut«, sagt Nina. Mit beiden Händen fährt sie sich durch ihre punkige Kurzhaarfrisur. Das dichte dunkle Haar hat sie vom Vater geerbt. Die Tönung, Farbe Pflaume, bringt mich auf den Gedanken, dass auch sie gelegentlich Tipps der Bravo ausprobiert.
Wieder sind wir drei im Schweigen vereint. Ninas Discman liegt neben der Kaffeekanne, aus den Kopfhörern kommt leise Musik, die ich nicht zuordnen kann. Durch ein auf Kipp gestelltes Fenster fällt die Wintersonne auf unseren Tisch. Draußen unterbricht ein LKW die Stille der Straße. Ich nehme einen Schluck Kaffee und sage, wie sehr ich gerade das Gemeinschaftsgefühl an meinem Tisch schätzte. Keine Reaktion.
»Was ist passiert?«, frage ich schließlich. »Ein Unfall?«
»Nö, ich bin von der Schule geflogen«, antwortet Nina.
Fast gleichzeitig sagt Rolf: »Gut, dass du fragst, kleine Schwester. Mein Leben ist im Arsch.«
Verwundert sehe ich zwischen Vater und Tochter hin und her, aber beide essen weiter, als sei ihr Verhalten das normalste von der Welt.
Rolf wirkt so kraftlos, als wünschte er sich, an seinen Stuhl fixiert zu werden. Meine Nichte sieht mich verständnislos an und verkündet: »Mama hat sich von Papa getrennt. Sie hat gesagt, er ist ein dummer Wessi.«
»Aua«, sage ich.
»Papa ist depressiv.«
»Ich glaube, das bin ich auch«, sage ich. »Was für ein Zufall.«
Meinem Bruder, der gerade einen Schluck trinken wollte, fällt der Kaffeepott aus der Hand, und dieser zertrümmert mit einem Knall seinen Kuchenteller. Nina verschluckt sich und prustet ihren Kakao im hohen Bogen auf die Scherben.
Sie kichert leise, sie steckt mich an. Wir werden alberner und lauter. Ernst blickt Rolf von Nina zu mir, als erwarte er, dass wir den Kinderkram sein lassen. Dann senkt er langsam den Kopf, und seine nach vorn gebeugten Schultern zucken. Zum ersten Mal in meinem Leben höre ich ihn kichern. Ich lasse mich im Stuhl zurückfallen und breche in schallendes Gelächter aus, dem sich meine Gäste, ohne zu zögern, anschließen. Der Tisch wackelt. Der Deckel der Kaffeekanne wackelt. Dreistimmig brüllen wir vor Lachen, überlassen uns dem Taumel und dem Kanon dreier zeitversetzter Tonspuren des Auf- und Abschwellens. Irgendwann laufen bei Rolf und mir die Tränen. Nina blickt in unsere knallroten Gesichter, wird von einer Lachsalve geschüttelt, überrollt. Die nächste Welle reißt uns mit, die übernächste, die überübernächste. Dann die Seitenstiche. Nein, das ist kein Spaß mehr, auch für Rolf nicht, der ächzt und stöhnt, ohne seinem Gelächter zu entkommen.
Schließlich ist es unsere Jüngste, die, immer wieder nach Fassung ringend, ein paar Worte von sich gibt. Japsend stößt sie hervor: »O mein Gott! Mein Gooott!!« Dann presst sie heraus: »Papa, sag doch was … Du und ich … wir wollten doch nicht … darüber reden.«
Rolf öffnet den Mund und schließt ihn wieder. Keine Ahnung, mit welchem Zauberwort er sich langsam beruhigt. Endlich sagt er: »Ach du dicke Scheiße, aber …«
Nina und ich starten in die nächste Runde. Sie rutscht vom Stuhl, landet in Rückenlage auf dem Teppichboden und strampelt mit den Beinen. »Super« kräht sie, »ich bin Kafkas Riesenkäfer.« Unser Lachen schwimmt auf einer nicht mehr ganz so üppigen Welle.
Irgendwann höre ich, wie mein Bruder es schafft, seinen Satz zu vollenden: »Was soll’s. Ist jetzt auch egal«.
Der Flash ebbt ab, hört auf und lässt mich verwundert zurück.
»Ich bin sooo müde«, sagt Rolf mit schwacher Stimme. »Kann ich auf die Couch?«
Ich biete ihm mein Bett an und werfe die ausgebreiteten Kleidungsstücke achtlos auf einen Stuhl. Keine fünf Minuten später hat sich mein Bruder ausgestreckt und mit seiner langen Winterjacke zugedeckt, die ich seit zwanzig Jahren kenne. Nina liegt auf dem Sofa. Ich bringe ihr eine Wolldecke. Sie nimmt die Kopfhörer aus den Ohren und bedankt sich. »Ich gehe noch mal einkaufen«, sage ich leise. »Kann ich dir etwas mitbringen?« Sie nickt, streckt sich, kramt in ihrer Hosentasche und legt mir einen Tampon in die Hand. »Diese Größe«, sagt sie. »Und bitte ein paar Ansichtskarten.«
Ich ziehe gefütterte Stiefel an, Mantel und Schal, nehme meine Umhängetasche und mache mich auf den Weg. Fisch für das Abendessen will ich kaufen und ausreichend Gutes für den Morgen, falls wir zusammen frühstücken. Mir fällt auf, wie gelassen ich es hinnehme, dass ich nicht das Geringste über Rolfs Reiseplanung weiß. Mal gucken, was die beiden sich ausgedacht haben, um mir Gesellschaft zu leisten.
Unter dem Begriff Tunnelblick konnte ich mir bisher nichts vorstellen. Doch in der Hauptgeschäftsstraße habe ich eine Erleuchtung. Jetzt weiß ich Bescheid. Der Tunnelblick entspricht der Verfassung, in der ich während der ersten Tage durch das kleine windige Seebad gelaufen bin und nichts als Defizite entdeckte. Tatsächlich gibt es nahe der Wohnung eine solide Konditorei und Bäckerei, auch einen guten Obst- und Gemüseladen mit einer Fischtheke. Im Friseursalon entschuldige ich mich wegen des versäumten Termins und vereinbare einen neuen. Das Internetcafé ist gleich nebenan.
Ich setze mich mit einem Cappuccino vor den Bildschirm und schaue mir historische Bilder von anderen Seebädern an. Ich erkenne das imposante Gebäude vom Foto mit meiner Großmutter und ihrem kleinen Sohn wieder. Und dann trifft mich der Schlag. Das Gebäude stand noch nie hier, auf der Westseite der Ostsee, es stand in Binz auf Rügen, und dort steht es heute noch. Definitiv befinde ich mich am falschen Ort. Funktioniert mein Verstand nicht mehr? Ich atme tief durch. An der Theke bestelle ich einen zweiten Cappuccino, und, da Cognac nicht angeboten wird, einen milden Weinbrand. Ich leere das Glas im Stehen, gerade so langsam, dass man mich nicht für eine Alkoholikerin hält.
Im Bauch wird es warm, in mein Herz strömt Milde, meine Schultern zucken nachsichtig. Shit happens. Mir bleibt noch Zeit, die E-Mails zu checken. Eine überschaubare Liste hat sich angesammelt. Rechnungen, eine Bitte um Spenden, Werbung, das Foto von zwei lachenden Freundinnen auf Skiern, die in der Schweiz Urlaub machen. Ich antworte: Ihr macht mich neidisch. Kommt heil wieder! Die letzte Mail ist von Rolf Senkel. Aha, denke ich, hier kommt der Reiseplan. Aber ich irre mich. Statt der Stationen der Reise erfahre ich von einem dreimonatigen Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik, dessen Ende erst eine Woche zurückliegt. Diagnose Burn-out. Rolf schreibt, er habe nach einem Zusammenbruch begreifen müssen, dass er ein Workaholic ist und dass ein zweiter Zusammenbruch einen Schlaganfall herbeiführen könnte. Dies alles sei ihm Warnung genug. Er befinde sich auf dem Weg ins vorzeitige Rentnerdasein.
Ich lehne mich im Stuhl zurück. Was für eine Nachricht! Ich muss sie erst einmal verdauen. Daher Rolfs Erschöpfung, sein weißes Haar! Wird er es schaffen, seinen Lebensstil radikal zu ändern? Wenn nicht, dann geht es jetzt bergab mit ihm. Dabei ist er nur fünf Jahre älter als ich …
Mein Bruder schreibt, ein Therapeut in der Klinik habe ihn ermuntert, etwas über Kindheit, Jugend und Elternhaus aufzuschreiben, und damit heftigen Widerstand in ihm ausgelöst. Warum solle er Vergangenes, an dem sich ja doch nichts ändern lässt, zum Problem machen? Aber schließlich habe er sich doch hingesetzt, und es seien weit mehr Seiten geworden als gedacht. Interessiert dich das, Sonja? Es wäre nämlich schön, du würdest den Text lesen. Du bist doch meine einzige Zeitzeugin.
Uff. Mir ist, als hätte jemand bei mir den Stöpsel gezogen, als hätte mein Körper plötzlich ein Loch, aus dem langsam die Energie entweicht. »Familie, nein danke. Familie, nein danke,« murmele ich vor mich hin und mache ein paar unauffällige Atemübungen. Dann gehe ich erneut zur Theke, bestelle ein großes Glas Wasser, das ich in drei Zügen leere, wähle von einem Obstteller die größte Banane und kann es kaum erwarten, bis ich sie geschält habe. Doch zurück auf meinem Platz mache ich Schluss mit der Hektik. Die Banane esse ich mit Bedacht, auch das ein Trick. Auf diese Weise bekomme ich mit, wie sich mein Akku langsam wieder auflädt.
Nein, lesen werde ich den Text auf keinen Fall, nur kurz reinschauen.
Der Titel allerdings gefällt mir auf Anhieb.
Eine langweilige Familie – Bericht von Rolf Senkel
In meinem Elternhaus war die Stimmung meistens so angespannt und bedrückt, dass ich im Unterschied dazu die Atmosphäre in der Bundeswehr als befreiend, geradezu inspirierend empfand. Den Titel Eine langweilige Familie habe ich gewählt, weil sich dort im Grunde nie etwas Neues ergab. Langweilige Familienurlaube. Langweilige Feiertage. Langweilige Anekdoten vom Krieg.
Meine Eltern waren beide Nazis und stolz darauf. Sie redeten auch laut wie Nazis und waren auch darauf stolz. Sie waren fest davon überzeugt, dass es allen anderen genauso ging und sie bloß aus Feigheit schwiegen. Meine Eltern waren Kriegsgewinnler. Ihre beste Zeit hatten sie von 1939–1945. Den Holocaust leugneten sie nicht. Aber sie fanden alles, was darüber öffentlich gesagt wurde, maßlos übertrieben.
Als Verkäufer von großen Produktionsanlagen, vermutlich auch als Vermittler von Waffengeschäften, arbeitete mein Vater in der neuen Bundesrepublik bei verschiedenen Firmen. Ich wusste von ihm, dass er dafür fürstlich bezahlt worden war. Kurz vor seinem Tod gestand er mir, bei Börsengeschäften habe er leider keine glückliche Hand gehabt. Er starb 1978 mit 65 Jahren an Krebs. Gegen Ende seines Lebens änderte sich die Haltung meines Vaters in Sachen Nazis nicht grundsätzlich. Doch er war wenigstens von seinem hohen Ross herabgestiegen und duldete auch andere Sichtweisen auf die NS-Zeit.
Als ich anfing zu studieren, besserte sich unsere Beziehung. Später sagte er mir, dass er seine Prügelei bereue, vor allem, was den Rohrstock betraf. Er bat mich um Verzeihung. Für mich war eindeutig, dass er nicht erfassen konnte, wie mich die erbarmungslose Unterdrückung meines Willens immer noch in Albträumen verfolgte, und dass jemand, der zielstrebig auftrat, mich schnell einschüchterte. Also beließ ich es dabei und nahm seine Entschuldigung an. Vater und ich sind am Ende recht gut miteinander ausgekommen.
Ich frage mich, ob sonst noch jemand weiß, dass er ein Brandstifter war. Mehrfach hat er hinter meinem Rücken gezündelt. Das erste Mal beobachtete ich ihn kurz vor Beginn des Frühjahrs. Bauern, die ihre Wiesen flämmten, müssen ihn auf die Idee gebracht haben. Sie wussten den Wind einzuschätzen. Vater nicht. So kam es, dass wir unsere Jacken auszogen und lange damit beschäftigt waren, das Feuer zu löschen. Autos hielten am Straßenrand an. Dann kam ein Polizeiwagen. Die zwei Beamten nahmen Vater beiseite. Es dauerte keine zehn Minuten, und der Fall war erledigt. Die drei haben sich nett voneinander verabschiedet. Vater machte noch eine witzige Bemerkung, es wurde gelacht. Für meine ruinierte Jacke entschädigte er mich mit einem Modell, das qualitativ dreimal besser war und zudem aus Leder. Doch Vater zündelte weiter. Beim zweiten Mal musste meine exklusive Lederjacke dran glauben, und diesmal brüllte ich ihn an: »Was soll das? So was tut nur ein Verrückter!« Vater ging darüber hinweg. Er steckte sich eine Zigarette an und wartete entspannt, bis ein Polizeiwagen eintraf. Und wieder schien es für ihn ein Leichtes, eine Anzeige wegen Brandstiftung zu verhindern.
Später wurde mir klar, dass er die Polizisten bestochen hatte. Seine Lieblingssätze lauteten: »Man darf sich nicht erwischen lassen«, und: »Artige Kinder kriegen nichts.« Er sprach sie nicht etwa schmunzelnd oder spitzbübisch aus, sondern in der vollen Überzeugung, jemand wie er habe das Recht, nach seinen eigenen Gesetzen zu leben.
Wenn er gegen Ende seines Lebens von früher erzählte, hob er immer wieder sein Bestechungstalent hervor. Natürlich nannte er es nicht »Bestechung«. Zu seinen Lieblingsgeschichten gehörte, wie er ein Köfferchen mit 100 000 DM in bar nach Zürich brachte. Damals dachte ich, er wäre immer noch der alte Angeber. Irgendwann habe ich recherchiert. In den Sechzigerjahren war es üblich, Bestechungssummen als Spesen abzurechnen. Man nannte es »Geschäftsanbahnung«. Da erst sind mir die Brandstiftungen und die Polizisten wieder eingefallen. Wie kindisch er war und wie raffiniert.
Die Beziehung zu meiner Mutter ist kompliziert und selten erfreulich …
Es reicht, denke ich, und lehne mich im Stuhl zurück. Mir ist leicht übel geworden. Einen Ausdruck der vielen Seiten werde ich mir ersparen. Aber kurz bevor ich mein Postfach schließe, zögere ich und lese noch den Schluss von Rolfs Bericht:
Nach Ende meines Wehrdienstes studierte ich Politikwissenschaften und Geschichte und wurde Journalist. Seit vielen Jahren bin ich bei einer großen regionalen Tageszeitung angestellt und leite dort das Ressort Politik. Rückblickend fällt mir auf, dass weder Sonja noch ich Karriere machten. Für mich war es die richtige Wahl. Es wird mir schwerfallen, mich von meiner Redaktion zu verabschieden. Aber es hilft nichts. Vorbei ist vorbei. Ich muss mir ein altersgerechtes Leben aufbauen und werde in der Nähe meiner drei Töchter wohnen bleiben. Ich habe zwei Enkelkinder.
Zu mir ist noch zu sagen, dass ich ein ziemlicher Eigenbrötler bin. Die meisten Leute sehen mich als Hans Dampf in allen Gassen. Offensichtliche Probleme fordern mich heraus. Sie bringen mich in Höchstform und werden gelöst. Wenn aber in mir drin Probleme auftauchen, denke ich, ich müsse sie ganz allein lösen. In der Klinik wird uns eingetrichtert: Es gibt Probleme, die sind nun mal nicht allein zu lösen. Es fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Es fällt mir noch schwerer, jemanden um Hilfe zu bitten. Meine Tochter Sophia ist Ärztin und hat mir angeboten, sich um einen Therapieplatz für mich zu kümmern. Hier habe ich unerwartet Hilfe bekommen, aber ich fühle mich, als sei ich nicht mal mehr in der Lage, einen Reifen zu wechseln.
Im Januar 2003
*
Draußen an der frischen Winterluft beruhigt sich mein Magen, und die leichte Übelkeit vergeht wieder. Auf dem Heimweg fühle ich mich alt und schwer. »Familie, nein danke. Familie, nein danke. Familie, nein danke.« Im Takt der Worte gehe ich weiter und halte nur kurz inne, um ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, zum dritten Mal, seit ich die Wohnung verlassen habe. Als ich zehn Minuten später vor der Haustür stehe, sind die Gespenster verschwunden. Auf der anderen Straßenseite entdecke ich neben meinem Toyota Rolfs blauen VW-Bus. Kaum zu glauben, dass er sich damit im Winter auf den Weg gemacht hat. Wie ist es möglich, dass der TÜV dem Uralt-Modell immer noch eine Chance gibt? Als Rolf den Bully in den Siebzigerjahren kaufte, hatte der seine besten Jahre schon lange hinter sich. Ein Wagen ohne Schnauze, Motor hinten. Ein Blech im 90-Grad-Winkel begrenzt den Fahrerraum. Der Laderaum hat fensterlose Seitenwände, rechts eine Schiebetür und über der Heckklappe ein kleines ovales Fenster.
Der Bully ist das Gegenteil eines herausgeputzten Oldtimers, der eine eigene Garage braucht. Der Lack ist strenggenommen nicht mehr vorhanden, die matte blaue Farbe wurde immer wieder erneuert. Ein kräftigeres Blau an der linken Seite bringt mich auf die Idee, dass Rolf dort ein Graffiti übermalt haben könnte. So ist mein großer Bruder, der mich seltsam findet und sich selbst normal. Mit einem Tempo putze ich die original erhaltenen Außenspiegel und streichele sie.
Beim Öffnen der Wohnungstür höre ich ein Rumoren. Ich ziehe Mantel, Mütze, Schal und Winterschuhe aus und nicke Rolf zu, der sich in der Küche ein Getränk zubereitet, das einen angenehmen, mir unbekannten Duft verbreitet.
»Was ist das?«, sage ich und zeige auf seine Tasse.
»Derzeit mein Lieblingstee. Zimt, Kardamom und Ingwer. Soll ich dir auch einen machen?«
»Ja gern. Er riecht wunderbar.«
Erst jetzt fällt mir auf, wie ordentlich es in der Ferienbehausung aussieht. Das Geschirr vom gemeinsamen Kaffeetrinken ist gespült und weggeräumt.
Als Rolf mir meine Teetasse reicht, frage ich: »Verdanke ich dir die Hausarbeit oder Nina?«
»Dreh dich um.«
Meine Nichte liegt, noch immer in der Haltung unverändert, auf der Couch. Sie nickt zur Kopfhörermusik und bedankt sich kurz, als sie Tampons und Ansichtskarten entgegennimmt. Ich setze mich mit Rolf an den Tisch. Der Lieblingstee meines Bruders schmeckt nicht so gut, wie er duftet, aber er ist okay.
Rolfs rechtes Bein wippt ohne Pause.
»Das ist der Ärger mit solchen Unterkünften«, sagt er. »Es gibt kein Internet und …«
Ich ergänze: »… es zieht durchs Fenster, wenn der Wind draufsteht.«
»Mir fehlt Musik, wollte ich sagen. Ich habe ein tolles kleines Gerät aus Asien dabei, aber ohne Netz funktioniert es nicht.«
»Ach ja? Ich selbst höre so gut wie nie Musik.«
Rolf wirft mir einen Selber-Schuld-Blick zu, erhebt sich vom Stuhl, schaut sich suchend um und fährt sich langsam durch die weißen Haare. Wie ich ihn so dastehen sehe, in aufrechter, guter Haltung, bin ich beruhigt. So sieht kein schwerkranker Mann aus. Ob er von sich aus auf seine Krise zu sprechen kommt?
»Lass mich unser Gerät aus der Steinzeit ausprobieren«, sagt er. Der längliche Kasten steht am zweiten Fenster neben der Tür zum Schlafzimmer. Ich habe ihn noch gar nicht richtig wahrgenommen, auch nicht die Massen an toten Fliegen auf der Fensterbank. Rolf geht in die Küche, kommt mit einem Kehrblech zurück, wischt mit der freien Hand die Fliegen auf die Schaufel und versenkt sie im Mülleimer. Dann stellt er das Blech wieder an seinen Platz. Die Radioschnur ist zu kurz, um die Steckdose zu erreichen. Er zeigt auf ein Verlängerungskabel an der Stehlampe. Eine Minute später hat das Radio Strom. Rolf angelt sich einen Stuhl und setzt sich davor. Der schmutzig gelbe Stoffbezug vor dem Lautsprecher erinnert mich an das Radio von früher, in Wassenhorst, im Flur neben unseren beiden Zimmern. Sonntags nach dem Mittagessen und Geschirrspülen hörte ich im Kinderfunk Kalle Blomquist. Abends, wenn ich schon schlafen sollte, stellte ich das Radio ganz leise und presste mein Ohr dagegen, um die Krimis mit Paul Temple zu verfolgen.
Mein Bruder ist voll konzentriert, er scheint die Sache zu genießen. Mehrfach geht er die Skala durch. Wenn er einen brauchbaren Sender gefunden hat, hellt sich sein Gesicht auf. Ich selbst halte das schnelle Zischen und Quietschen kaum aus. Schließlich entscheidet er sich für Jazz aus New Orleans. Die Qualität ist erstaunlich gut, was das Radio betrifft, aber auch, wenn man bedenkt, wie alt die Aufnahmen sind. A good man is hard to find. Einige Stücke kenne ich von den Schallplatten unseres Vaters.
Rolf sitzt wieder am Tisch. Er wiegt seinen Oberkörper im Takt, sein Knie jetzt völlig ruhig. Er trägt dicke, altmodische Cordhosen. Das viel zu weite, karierte Flanellhemd hat er vor einem Vierteljahrhundert in Kanada erworben, vermutlich gebraucht. Obwohl fünf Jahre älter, obwohl von einer tiefen Krise gebeutelt, hat er weniger Falten als ich. Es muss an seinem dunklen Teint liegen. Bleichgesichter altern schneller. Als ich Rolf zuletzt sah, war er bei Weitem nicht so schlank wie jetzt. Zu irgendetwas müssen drei Monate Klinik gut gewesen sein, denke ich, vielleicht hat er regelmäßig Sport gemacht und sich gesund ernährt.
Plötzlich verändert mein Bruder seine Haltung. Er sieht wie eingerostet aus. Lange starrt er vor sich hin, etwas, das ich nur zu gut an ihm kenne. Er sieht aus, als fühle er sich in meiner Gegenwart unbehaglich, als sei ich ihm lästig. Es kränkt mich noch immer.
»Sonja, was ist los? Du siehst seltsam aus.« Das hat er mich noch nie gefragt. Dann fange ich an zu begreifen. Er ist nicht von mir genervt und auch nicht in Gedanken gewesen. Er hat überlegt, ob er mir diese Frage stellen soll oder nicht.
»Was mit mir los ist? Nichts. Ach so. Nein. Doch.«
Er lacht kurz. »Meine sprachgewandte Schwester. Es muss etwas Ernstes sein.«
»Na ja, wie man’s nimmt.« Ich strecke die Beine aus, schaue auf meine blauen Wollsocken und gebe mir einen Ruck. In knappen Worten berichte ich ihm von meinem Tunnelblick und zu welch absurdem Irrtum er geführt hat.
»Ich fasse es einfach nicht. Ich könnte jetzt in Binz sein und in einer hübschen Ferienwohnung auf die Ostsee schauen.«
»Hat auch sein Gutes«, sagt mein Bruder. »Von Wassenhorst am Rhein nach Rügen wäre mir wohl doch zu weit gewesen. Und was deinen Tunnelblick betrifft: Aus eigener Erfahrung könnte ich dir viel dazu erzählen. Aber nicht jetzt, vielleicht später. Es gibt ein Problem.«
»Du brauchst doch keinen Arzt, oder?«
»Wie kommst du denn darauf?« Er sieht mich amüsiert an. »Wir brauchen eine Unterkunft. Nina und ich wollten im Bully übernachten, aber die Standheizung hat ihren Geist aufgegeben. Ich muss schauen, wo ich Ersatz bestelle. Auch die Heizung im Fußraum funktioniert nicht mehr.«
»Der Bully! Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, als ich ihn entdeckt habe. Seid ihr auf Abenteuer aus?«
»Scheint so«, sagt Rolf, in Gedanken schon woanders. Er steht auf und nimmt seine Jacke von der Stuhllehne. Nina rappelt sich vom Sofa hoch.
»Moment mal«, schaltet sie sich ein. »Wir können doch hier übernachten. Ist doch gemütlich. Und wir wären alle zusammen.«
»Wie stellst du dir das vor?«, sage ich. »Wo kriegen wir ein drittes Bett her?«
»Daran sollte es nicht scheitern«, sagt Rolf. »Zur Not kann ich auch auf dem Boden schlafen. Ich bin doch ein alter Campinghase, mit Rucksack, Schlafsack, Isomatte etc. Aber wie ist es mit dir, Sonja, würdest du uns für eine Nacht beherbergen?«
»Wie romantisch«, sage ich ohne jede Ironie.
»Dann wäre das ja geklärt.« Rolf wendet sich seiner Tochter zu. »Komm, Nina. Wir müssen noch einiges erledigen. Und, ach ja, Sonja. Wie ist es mit dem Abendessen? Hast du einen Tisch reserviert?«
Ich schüttele den Kopf. »Nur ein einziges Restaurant kam für mich infrage, aber dort sind sie ausgebucht. Ich kann eine Fischpfanne und Salat vorbereiten. Lasst euch ruhig Zeit.« Ich drücke Rolf den zweiten Wohnungsschlüssel in die Hand. »Für den Fall, dass ich zwischendurch auf die Uferpromenade gehe.«
Tatsächlich bin ich kurz darauf noch einmal auf der Straße, aber nur, um im kleinen Supermarkt Streichhölzer, weiße Haushaltskerzen und Zigaretten zu kaufen. Seit zwanzig Jahren habe ich nicht mehr geraucht. Nun ist es das Erste, was ich tue, als ich die von der Dämmerung schwach erhellte Wohnung betrete. Ohne Licht zu machen, gehe ich mit der brennenden Zigarette in die Küche. Ich stelle einen Aschenbecher, ein Glas Sprudel und einen großen Teller auf den Tisch. Erst jetzt dringt die Wetteransage aus dem Radio zu mir, sie verspricht anhaltende Sonne. Dann kündigt eine aufmunternde Männerstimme Songs mit Louis Armstrong an, When you’re smiling. Ich entzünde drei lange Kerzen, die ich mit Wachstropfen hoffentlich stabil auf dem Teller befestigt habe. Als Louis’ heisere Stimme What a Wonderful World besingt, drücke ich die zweite, halbgerauchte Zigarette aus. Es macht keinen Sinn zu rauchen, wenn man es mit schlechtem Gewissen tut. Ich trinke vom Sprudel, zünde die dritte Zigarette an, stehe auf, frage mich, warum ich aufgestanden bin, habe keine Ahnung, setze mich wieder hin und schaue mich bei Kerzenlicht um.
Wie einfach es doch ist, ein Loch in eine gemütliche Höhle zu verwandeln. Summertime. Erleichtert und etwas schläfrig blinzele ich in die drei flackernden Lichter. Plötzlich bin ich wieder wach. Kann es sein, dass die Flammen auf Louis reagieren? Jedenfalls verhalten sie sich so – als seien sie nicht nur lebendig, sondern auch noch musikalisch.
Das muss untersucht werden. Vorsichtig, damit die Kerzen nicht umkippen, platziere ich sie nah ans Radio. Test läuft. On the Sunny Side of the Street. Am stärksten reagieren die Flammen auf Armstrongs Stimme, am zweitstärksten auf seine Trompete. Aber vielleicht ist es nur Zufall, ein Luftzug durch undichte Fenster. Ich drehe den Ton stumm. Kein Flackern. Fünfmal wiederhole ich es, Ton aus, Ton an. Kein Zufall. Die Flammen tanzen zur Musik, sie surfen auf den Schallwellen des Radios oder so ähnlich. That Old Feeling. Ich schließe die Augen, breite die Arme aus und tanze langsam durch den Raum. Sonderbarerweise stört mich niemand. Sonderbarerweise stoße ich nirgendwo an. Sonderbarerweise bin ich nirgendwo. Mich trägt ein fliegender Teppich.
Es ist der Nachrichtensprecher, der von weit her meine Träumereien durchdringt. Seine Stimme ist schwach, ich verstehe gerade nur das Eine: Kanzler Schröder hat sein Nein zum Irakkrieg wiederholt. Ich schwebe zum Radio und schalte es aus. Gleichzeitig poltert es an der Wohnungstür. Die Verwandtschaft ist zurück.