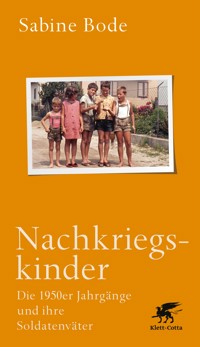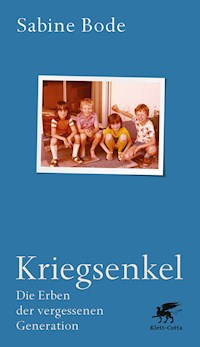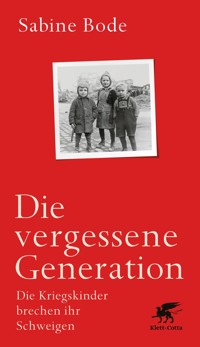8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die Kölner Journalistin hat sich umgehört unter ihren Landsleuten. Entstanden ist dabei eine Art Collage kurzer Psychogramme der deutschen Seelenlage, gespeist aus Interviews mit Politikern, Managern, Journalisten, Schriftstellern und Wissenschaftlern.« Thomas Speckmann, Die Welt Unter German Angst verstehen wir eine Mischung aus Mutlosigkeit und Zögerlichkeit, gepaart mit Zukunftsängsten und einem extremen Sicherheitsbedürfnis. Sie ist eine Altlast des Zweiten Weltkrieges und das Resultat einer nicht aufgearbeiteten Trauer über die Leiden, die der Krieg und seine Folgen verursacht haben. Dabei könnten wir eine Menge tun, um die German Angst zu überwinden. Und das wäre nicht einmal teuer. »Ein Gespenst geht um in Deutschland, die German Angst. Die Kölner Autorin Sabine Bode hat diese spezielle Mischung diffuser Gefühle des Bedrohtseins, der Angst vor dem Rückfall in die Barbarei und der Verelendung sehr eingehend untersucht.« Peer Steinbrück
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Sabine Bode
Kriegsspuren
Die deutsche Krankheit German Angst
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart 2016
Alle Rechte vorbehalten
Fotomechanische Wiedergabe nur mit Genehmigung des Verlags
Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98064-6
E-Book: ISBN 978-3-608-10953-5
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Buch ist
Pater Werner Kettner
gewidmet, der im letzten
Kriegsjahr Soldat wurde,
der als Achtzehnjähriger
vor dem Erschießungskommando
sein eigenes Grab schaufelte,
der sich von Gott gerettet sah,
und dies während der Gefangenschaft
noch zwei weitere Male.
Pater Kettner hat unzähligen Menschen
Orientierung und Lebensmut gegeben.
Er starb mit 59 Jahren.
Inhalt
Vorwort und Dank
Vorwort zur Neuausgabe
ERSTES KAPITELWie lang sind die Schatten?
Ein Nachkriegsspiel
Langweilige Stille der Nachkriegsjahre
Zerstörung macht Spaß
»Die Deutsche Krankheit«
Warum verkauft sich Angst so gut?
Es fehlt die Tiefenschärfe
Allgemeine Sprachlosigkeit
»Hitler war ja Westdeutscher«
Welche Denkmuster müssen wir auflösen?
Wer ist gut davongekommen?
Die Schlüsselrolle der Kriegskinder
Das Leid fruchtbar machen
Aus Ratlosigkeit wird Hoffnungslosigkeit
ZWEITES KAPITEL»Nie wieder …« und die Angst vor dem Nichts
Werden meine Kinder genug zu essen haben?
Endlich im Schlafanzug zu Bett gehen!
Kein Trauerverbot – aber eine Selbstzensur
Die Büchse der Pandora
»Endlich hat mal jemand davon angefangen …«
Wenn nichts mehr so ist, wie es einmal war
Millionen Menschen litten unter Kriegsfolgen
Das gute Beispiel von Dresden
Unbewußte Prägungen
Tüchtig, unauffällig und »emotional gebremst«
Die Kohl-Ära führte in den Reformstau
Lachende Franzosen: die Deutschen als Angsthasen
Hans Koschnick und die Kriege
Statt Familiengeschichten nur dunkle Andeutungen
Große Aufregung über »Heuschrecken«
Ein pessimistischer Grundzug mit Tradition
DRITTES KAPITELZwischen Rentenillusion und Panikmache
Eine schlecht gelaunte Sprache
Steinbrück und die etwas andere Sozialisation
Was war für die Bundesrepublik identitätsstiftend?
Ohne Psychologie nicht zu erklären
»Man kann ja doch nichts machen …«
Eine Sanierung, die zu spät kommt, wird teuer
Norbert Blüm: »Eine Mentalitätskrise«
»Christian von der Post« kämpfte
Neid und Intrigen in der eigenen Partei
Es fehlte ein Machtwort
VIERTES KAPITELKinder des Krieges in Zeiten des Friedens
Was die Gewalt lehrt
Moral statt Nüchternheit
Zeitgeschehen, das Biographien prägt
Das Trauma einer Familie
»Im Graben des Überlebens«
Angst, die Kindern eingeredet wurde
Blümchen auf Panzer
Die skeptische Generation
Eine ausgeschlagene Erbschaft
Dieter Wellershoff und die Freiheit
Ein einfühlsamer älterer Bruder
Der Tod der Mutter
FÜNFTES KAPITELDie verletzten Idealisten
Kriegsängste und ideologischer Kampf
Kein Blut für Öl
Bloß keine Psychologie!
Die Katastrophen und die Kriegerin
Vorbild Albert Schweitzer
1968 – in eigener Sache
Verbotene Partys
Die Kinder waren Schulversager
Unruhige Studenten
Schluß mit dem braunen Geist!
SECHSTES KAPITELDer Blick von außen
Die Angst vor Liebe und vor Frieden
Wenn endlich alles gut wird, kommt der Teufel
Der Wiedervereinigung folgte die Depression
Kornblum – ein kenntnisreicher Ausländer
»Das Vergangene ist nicht tot …«
Deutschlands Problem heute: von Freunden umgeben
Warten auf den Mißerfolg
Das Gift des Mißtrauens
SIEBTES KAPITELDer Blick nach innen
Darauf warten, daß etwas schief geht
Der verdächtige Kuchen vom Kindergeburtstag
Kleine Kinder merken nichts?
Grausame Märchen wurden umgeschrieben
Partnerersatz für die Mutter
Was Generationen erben können
Hoffnungssignal Währungsreform
Das Drama der Erziehung
Verständnis für elterliche Gewalt
ACHTES KAPITELKönnen Vaterlose führen?
Am Grab eines Fremden
Eine Schockreaktion auf Panzer
»Vati kommt nie mehr zurück«
Die Sehnsucht nach einem vergessenen Helden
Peter Härtling, der große Bruder
Blinde Flecken in der Psychotherapie
Die Heimkehrer: deprimiert und kriegsversehrt
Von der Vaterlosigkeit zur Kinderlosigkeit
Der Faktor Zukunftsangst
Schwierige Ehen
Ein Buch über mutige Eltern
Der Vater wanderte aus
NEUNTES KAPITELDer vergiftete Boden
Kinder als Zeugen von Gewalt
Mißtrauen gegenüber den eigenen Landsleuten
Reflexe des Unbehagens auf deutsche Symbole
»Sei bereit, dein Land zu verlassen«
Die jungen »Unverkrampften«
Die blinden Flecken der Mitscherlichs
Konfrontation mit einem grauen Land
Die jüdische Herkunft störte
Keine echte Empathie für die Überlebenden
»Suchte die Revolution ein gutes Ende?«
Schuldgefühle – in eigener Sache
Das Ende der Verdrängung
Familienforschung
Austausch über eine Pilgerreise
German Angst im Ost-West-Vergleich
Die Wende beendete die Nachkriegszeit
ZEHNTES KAPITELWas ein Land zusammenhält
Erziehungsziel mündige Bürger
Der deutsche Umgang mit Problemen
Land ohne eigene Interessen
»Ein Volk von Radikalen«
Dauerthema Zuwanderung
Nebelfelder in der Politik
Störmanöver aus dem Unterbewußten
Der Vorwurf Larmoyanz
Mitgefühl oder moralische Verpflichtung?
Eine Sternstunde im Bundestag
Familiengedächtnis gegen Erinnerungskultur
Hölderlin ein Nazi?
Der Umgang mit Ambivalenzen
Wer bist du, Deutschland?
Gedenkkultur hält eine Stadt lebendig
Wie versäumte Trauer nachgeholt werden kann
Zwei Hymnen mit Lücken
Eine kollektive Krankheit verstehen lernen
Anmerkungen
Personenregister
Über die Autorin
Vorwort und Dank
Die ersten Fragen tauchten vor drei Jahren auf. Warum erwarten wir Deutschen stets das Schlimmste? Sind wir auf Katastrophen geprägt? Kann es sein, daß die Hauptursachen für German Angst, für Schwarzmalerei und Mutlosigkeit, in einer Zeit zu suchen sind, die schon über sechzig Jahre zurückliegt? Sind es die unsichtbaren Nachwirkungen von Scham, Kriegsgewalt und Leid, die unsere Gesellschaft massiv verunsichern, nun, da die Wohlstandsdecke Löcher aufweist?
Diese Fragen ließen mich nicht mehr los. Ich suchte gezielt nach Menschen, die ein gemeinsames Nachdenken darüber nicht als lästig, sondern als Gewinn ansahen, genauer, nach Persönlichkeiten, deren Stimmen im öffentlichen Leben Gewicht haben oder die aufgrund ihres Berufs interessante Einblicke in die bundesrepublikanische Geschichte und in die deutsche Seele erhoffen ließen.
Die Arbeit an dem hier vorliegenden Buch kam mir vor wie das Entstehen eines Mosaiks. Das Ergebnis ist ein Gesellschaftsbild, das sich auf eine Vielzahl von Stimmen stützt. Ich kann meine Arbeit auch noch anders beschreiben: Ich habe versucht, in einem vollgestellten Keller aufzuräumen. Ich wollte in einem Durcheinander, das sich seit Kriegsende angesammelt hat, Ordnung schaffen. Wie gewinnen wir Überblick, und was gehört ans Tageslicht?
Einige wenige Passagen sind meinem Buch »Die vergessene Generation – Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen« entnommen, einfach deshalb, weil sie zur Veranschaulichung meiner These unverzichtbar waren.
Am Zustandekommen des Buchs über German Angst haben viele Menschen maßgeblich mitgewirkt, vor allem jene, die darin zu Wort kommen – meine Gesprächspartner. Sie sind mir überwiegend mit beeindruckender Offenheit begegnet. Dafür danke ich ihnen sehr. Sie haben mich teilhaben lassen an prägenden Erfahrungen aus der Kriegszeit, aus ihrem Berufsleben und teilweise auch aus ihren Herkunftsfamilien. Die Bekenntnisse und Erkenntnisse halfen mir, meinen Blick zu schärfen und meine Gedanken zu ordnen.
Ich bedanke mich bei meinem Lektor Heinz Beyer für seine Unterstützung und die ruhige, kluge Art der Beratung. Mein besonderer Dank gilt dem Verleger Michael Klett, dem Initiator des ganzen Projekts. Er war der Meinung, in German Angst stecke mehr, als ich für eine Hörfunksendung zutage gefördert hatte, weshalb er mir zu einem Buch riet. Von größter Bedeutung war von Anfang an der Austausch mit meinem Mann Georg Bode. Ihm danke ich für sein genaues Hinschauen, für Anregungen und Widerspruch und für den Nachdruck, mit dem er gemeinsame Pausen von einem anstrengenden Thema durchsetzte.
Ich möchte nun Leserinnen und Leser dazu einladen, das im Kontext mit German Angst entstandene Deutschlandbild zu betrachten, um es später zu ergänzen und zu korrigieren – vor allem aber, um darüber das Gespräch mit anderen Menschen zu suchen.
Köln, im Juli 2006Sabine Bode
Vorwort zur Neuausgabe
German Angst ist Teil der langen Schatten unserer Vergangenheit, ein Erbe kollektiver Erfahrungen durch Nationalsozialismus, Holocaust, Krieg und Vertreibung. Dem Erbe entwuchsen drei Bekenntnisse, die mit »nie wieder« anfangen: Nie wieder Krieg. Nie wieder Auschwitz. Nie wieder Rassist sein. Es sind Halbsätze, die reflexhaft eine ideologische Rhetorik entfachen können. Meiner Ansicht nach liegt der German Angst vor allem die Angst vor Verelendung und einem Rückfall in die Barbarei zu Grunde. Sie ist nicht immer leicht zu erkennen. Ihr augenfälligstes Merkmal ist Zukunftsangst. Wäre ich Anfang 2015 gefragt worden, wie es denn um die German Angst bestellt sei, ich hätte geantwortet: Die Gesellschaft zeigt sich angstfreier als von mir erwartet, und sie wird kaum noch von Schwarz-Weiß-Denken gesteuert. Die vergangenen zehn Jahre haben viel verändert.
Wahrscheinlich wirkt sich kollektiv aus, dass in vielen Familien offener über die Vergangenheit gesprochen wird – eine Gegenbewegung zu dem großen Schweigen, das seit Kriegsende Verstrickungen in das NS-Regime zudeckte, weil der gute Familienname nicht durch einen Makel Schaden nehmen sollte. Ein Schweigen, das eine Auseinandersetzung mit persönlicher Schuld nicht aufkommen ließ, aber auch die Erinnerungen an schwere Verletzungen, Entwürdigungen und Verluste auf Abstand hielt.
Der Nebel lichtet sich, und daran haben vor allem jene 40- bis 60jährigen Deutsche einen großen Anteil, die sich »Kriegsenkel« nennen. Sie stellen ihren Eltern unbequeme Fragen, forschen in Archiven nach, sie tauschen sich in Selbsthilfegruppen und in Netzwerken aus. Sie tun es, weil sich herumgesprochen hat, wie befreiend es sein kann, wenn Familiengeheimnisse und Ungereimtheiten keine Verwirrung mehr stiften. Tiefgehende Ängste, die man sich nicht erklären konnte, lösen sich auf – auch Gefühle der Heimatlosigkeit, mangelnde Empathie oder vielleicht die Scheu, eine eigene Familie zu gründen. Eine Entblockierung hat stattgefunden.
Wer sein Verhältnis zu seiner Familienvergangenheit geklärt hat, kann unbefangener in die Zukunft schauen. Die Erwartung, von dort könne nur Übles kommen, klingt nach und nach ab. Das gibt Kraft, auch Kraft für gesellschaftliches Engagement.
Wenn Angehörige der Kriegskinderjahrgänge sich dagegen zu gravierenden sozialen Missständen äußern, dann überwiegend im Sinne von: Man muss eben warten, bis alles zusammenbricht. Erst dann wird sich in diesem Land etwas ändern. Sie glauben, dass alle Menschen so denken. Der »Totalzusammenbruch«, wie sie es nennen, ist Teil ihrer prägendsten Kindheitserfahrungen, und in der Tat, erst danach ging es wieder bergauf. Solchen Menschen fehlt es an Vertrauen in gesellschaftliche Entschlossenheit, die eine Katastrophe rechtzeitig abwendet und zum Guten führt. Ihnen mangelt es an Vertrauen ins Leben schlechthin.
Im Rückblick auf die vergangene Dekade macht sich ein Generationenwechsel bemerkbar. Den Jüngeren fällt es leichter, mit Stress umzugehen, und sie argumentieren weit weniger ideologisch, als Menschen der Kriegskindergenerationen, deren aktive Zeit als Politiker in etwa mit der Abwahl von Bundeskanzler Gerhard Schröder zu Ende ging. So ungefähr war meine Einschätzung noch vor zwölf Monaten: Die Bevölkerung hat die Finanzkrise und die damit einhergehenden Verluste verblüffend gelassen aufgenommen. Sie hält die Probleme, die Griechenland aufwirft, im Grunde für unlösbar, aber ein Auseinanderbrechen der EU für kaum denkbar. Sie schaut mit Sorgen hinüber zum Krisengebiet Ukraine, aber von Kriegsangst, die früher bizarre Formen annehmen konnte, keine Spur. (Ich erinnere mich noch gut daran, dass 1991 in meiner Heimatstadt Köln wegen des ersten Irakkrieges der Rosenmontagszug abgesagt wurde).
Als dieses Buch 2006 erschien, hatten die Deutschen gerade wochenlang das Sommermärchen der Fußballweltmeisterschaft gefeiert. Zur großen Überraschung aller herrschte nach vielen Jahren der Griesgrämigkeit zum ersten Mal wieder gute Stimmung im Land. Schlechtes Timing für einen Titel über »German Angst«. Seit der Wiedervereinigung hätte ich eigentlich wissen müssen, dass sich in Deutschland von einem Tag auf den anderen alles ändern kann. Aber, mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen an den Autos, mit Dauerparty und Sonnenschein, mit einem derartigen Stimmungsumschwung hatte ich natürlich nicht gerechnet. Schon gar nicht, dass etwas Triviales wie Fußball einen Dammbruch auszulösen vermag und nicht derart Umwälzendes wie 1989 der Sieg über die Betonköpfe einer Einheitspartei.
Tatsächlich hat der unaufgeregte Regierungsstil von Angela Merkel ein Wunder vollbracht. Es ist ihr gelungen, große Teile der Bevölkerung, die sich über eine lange Periode ständig durch Katastrophen bedroht sahen, was alle – auch die seriösen Medien befeuerten, in kurzer Zeit zu beruhigen. Hierfür bediente sie sich bewusst einer nebulösen, einlullenden Sprache. Es hat funktioniert. Das, was sie erbte, war ein schwerwiegendes Problem. Sie musste lernen, mit einem Kollektiv umzugehen, in dem vagabundierende Ängste nicht als solche entlarvt, sondern für berechtigt gehalten wurden. Die Antwort der Kanzlerin auf German Angst war eine Mischung aus Nüchternheit, Beschwichtigung und Verschwiegenheit. Stets wurde gerätselt, was sie vorhatte.
Als sie 2002 zum ersten Mal mit Gerhard Schröder um die Kanzlerschaft rang und verlor, hatte sie noch Klartext geredet. Als sie beim nächsten Anlauf vier Jahre später als Siegerin hervorging, kamen pointierte Ansagen in der Innenpolitik für sie nicht mehr in Frage. Ihre Sprache wurde ungenau, unschön, einschläfernd.
Ein typischer Merkel-Satz klang so: »Viele Menschen werden heute an ihrem Einsatz, am Einbringen ihrer Möglichkeiten gehindert«. Auch ging sie gern mit Sprachwolken an die Öffentlichkeit. Da heißt es in ihrer Regierungserklärung 2010: »Die meisten Menschen haben nicht den Eindruck, dass wir heute über die Möglichkeiten verfügen, weltweit das zu vertreten, was uns an sozialem Ausgleich der freien Wirtschaft – in Form der sozialen Marktwirtschaft – wichtig ist, sondern sie haben Angst, dass davon für sie nichts mehr übrig bleibt.« Normalerweise würde man denken, da habe sich jemand im Eifer des Gefechts verstiegen, aber bei Angela Merkel war die verschleiernde Sprache Strategie. Hauptsache, das was sie sagte, war nicht zitierfähig. Sie wollte verhindern, mit Merksätzen Schlagzeilen zu machen. Sie wollte eben auf keinen Fall Aufregung auslösen.
Noch etwas anderes unterschied sie von Basta-Politiker Schröder. Anders als ihr Vorgänger wusste sie, wie leicht man bei den Deutschen allein mit der Ankündigung tiefgreifender sozialer Veränderungen Angst und Panik auslösen konnte, also verschonte sie ihre Mitbürger damit. Sie behielt recht und sie behielt die Macht. Schröder dagegen, dem die Medien jahrelang »Reformstau« vorgeworfen hatten, brachte die Hartz IV-Gesetze auf den Weg, mit der allseits bekannten Folge seiner Abwahl. Es war ein politischer Schnitt, der dazu beitrug, dass nach und nach die hohen Arbeitslosenzahlen zurückgingen. Schröder hatte nichts mehr davon. Auch hier war Angela Merkel die Gewinnerin.
Ihre Beliebtheitswerte stiegen, weil eine Mehrheit in der Bevölkerung ihr glaubte, es gebe keine Politik der gravierenden Versäumnisse, im Gegenteil, das Land sei gut in Form. Ihre Art zu regieren, ohne allzu viel von den Bürgern zu fordern, versprach Kontinuität. Die Bundeskanzlerin hatte sich zur Bundesmutter entwickelt, mit der Kernbotschaft: Macht euch keine Sorgen. Ich kümmere mich darum, dass alles so bleibt wie es ist – dass es uns in Deutschland weiterhin gut geht und wir uns sicher fühlen. Gemeinsinn und Selbstverantwortung werden auf diese Weise nicht gefördert. Doch die harten Fakten gaben Angela Merkel schließlich Recht. Deutschland hatte sich wirtschaftlich weit schneller von der Finanzkrise erholt als andere EU-Länder.
Der nächste, der im Wahlkampf gegen sie antrat, ihr Finanzminister Peer Steinbrück, sah Deutschland hingegen in einer Schieflage, er sah Krisen auf die Gesellschaft zukommen, die den sozialen Frieden und letztlich auch die Demokratie massiv gefährden könnten. Er machte sich große Sorgen um die wachsende Gruppe der »Bildungsfernen«, ein Begriff, der erst in jenen Jahren in den Sprachgebrauch kam. Steinbrück verwies darauf, dass eine immer größer werdende Minderheit mit prekären Arbeitsverhältnissen zurecht kommen müsse, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich immer weiter öffne. Doch er verhielt sich ungeschickt, Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit wurden laut. Sein Thema war soziale Gerechtigkeit, doch sein Appell an die Wähler, hierfür Verantwortung zu übernehmen, drang nicht durch. Ein Prophet des Unheils hat keine Chance, wenn die Mehrheit findet, dass die Dinge rund laufen.
Angela Merkel hat immer wieder gesagt, sie nehme die Sorgen und Ängste in der Bevölkerung ernst. Dass dies nicht nur daher gesagt war, zeigte sich, als sie den Atomausstieg durchsetzte. Noch so eine Überraschung.
Und dann 2015, im Herbst, WIR SCHAFFEN DAS. Ein Appell der Kanzlerin an Gemeinsinn, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Er hat umgehend gezündet. Ein neues Wort für etwas bisher nicht Dagewesenes tauchte auf »Willkommenskultur.« Als erstmals die Flüchtlinge zu Tausenden in München eintrafen, waren die freiwilligen Helferscharen aus der Mitte der Gesellschaft schon vor Ort. Sie zeigten Empathie, unübersehbar, es war ihnen ein Herzensanliegen. Anders, als in den 1990er Jahren, als die Flüchtlinge aus dem Balkankrieg bei uns ankamen. Zwar war auch damals die Hilfsbereitschaft groß, doch sie wurde weitgehend durch Mitarbeiter und Ehrenamtliche von Institutionen, von den Kirchen getragen. Nicht Empathie stand im Vordergrund, sondern moralische Verpflichtung.
Was ist da geschehen? Was hat die Veränderung herbeigeführt? Ich glaube, der Schlüssel heißt Empathiefähigkeit. Sie war über lange Zeit gedämpft, auch dies eine Folge von NS-Zeit und Krieg. Weil das Leid, das Hitlerdeutschland durch Holocaust und Vernichtungskrieg über Europa gebracht hatte, in seinen Ausmaßen beispiellos, einfach unfassbar war, hatten sich viele Deutsche nicht berechtigt gesehen, ihr eigenes Leid wahrzunehmen und ihre Verluste zu betrauern. Einen Teil dieser Last gaben sie unbewusst an die Nachkommen weiter.
Als ich zur Recherche für dieses Buch mit dem Schriftsteller Dieter Wellershoff über German Angst sprach, machte er deutlich: »Es gab immer eine klare Gegenüberstellung vor allem bei den Deutschen selbst: Wir tragen die Schuld an diesem furchtbaren Krieg und den darin geschehenen Verbrechen. Wir können uns nicht gleichzeitig auch als Opfer sehen. Als Täter können wir auch nicht trauern. Das ist das psychologische Schema einer tiefen emotionalen Hemmung.« Solange diese Hemmung, sich dem eigenen erfahrenen Leid zuzuwenden, bestand und Traumafolgen bei den Großeltern und Eltern nicht erkannt wurden, war das Empfinden von Empathie bei vielen Menschen grundsätzlich gestört. Denn Mitgefühl für Opfer, für Leidende, setzt voraus, dass jemand auch für sich selbst Mitgefühl empfinden kann. Ein Großteil der Deutschen, die als Kinder Krieg und Vertreibung erlebten, hat bis heute keinen emotionalen Zugang zu ihren frühen Schrecken und Gewalterfahrungen. »So was hat man eben weggesteckt«, sagen sie und fügen nicht ohne Stolz hinzu: »Für unsereins war überhaupt keine Hilfe da und wir haben es trotzdem hingekriegt.«
Zurück zu den Flüchtlingen vom Herbst 2015. Von einem Tag auf den anderen hat unsere Gesellschaft ein großes gemeinsames Thema, auf das jeder Einzelne anders reagiert. Die einen helfen, weil es ihrem Wesen entspricht zuzupacken, wenn Menschen in Not sind. Sie tun es unabhängig davon, ob Zeit und Geld knapp sind oder nicht. Die anderen zaudern, fragen sich, ob sie die Begegnung mit dem Flüchtlingselend, zumal das der Kinder, überhaupt verkraften. Und sie wissen nicht, wie sie dazu Fragen ihrer eigenen Kinder beantworten sollen.
Wieder andere kommen mit dem Flüchtlingsproblem überhaupt nicht zurecht. Sie wehren es ab, sind frustriert. Warum müssen gerade sie sich damit herumschlagen? Sie sind nicht gefragt worden, ob sie wollen, dass plötzlich eine Million Menschen unsere Fürsorge brauchen. Hätte man sie gefragt, ihre Antwort wäre Nein gewesen. Sie hätten Nein gesagt, weil sie nun mal keine gesellschaftlichen Veränderungen wollen.
Es hat sich in der Bevölkerung noch nicht ausreichend herumgesprochen, dass Menschen, die sich nicht von ihren Traumata erholt haben, sehr stressanfällig sind. Vor allem veränderte Lebensbedingungen können sie extrem unter Stress setzen. Vor langer Zeit machte mich eine ostdeutsche Seminarteilnehmerin auf einen Zusammenhang mit den in der DDR aufgewachsenen Kriegskindern aufmerksam. Sie argumentierte: Diejenigen, die 1989 zwischen 45 und 60 Jahre alt gewesen seien, hätten die Wende am wenigsten verkraftet. Dies dürfe man nicht allein der Arbeitslosigkeit und ihren Folgen zurechnen. In der DDR hätten prozentual weit mehr Flüchtlinge und Vertriebene gelebt als in der Bundesrepublik. Für sie, »Umsiedler« genannt, habe es keinen Bund der Vertriebenen geben. Sie seien als große belastete Gruppe nicht wahrgenommen, nicht gehört worden, folglich sei es auch nie zu gesellschaftlichen Kontroversen gekommen. Anders als im Westen, wo Menschen keine Scheu gehabt hätten, ihre »Angst vor den Russen« laut auszusprechen, sei dies in der DDR undenkbar gewesen, wo jedes Schulkind die Rhetorik der Dankbarkeit für die »sowjetischen Freunde« habe lernen müssen.
Menschen mit Traumatisierungen, zumal wenn es Kinder sind, brauchen, um sich zu erholen, zweierlei: ein Grundgefühl, willkommen zu sein, und das Empfinden, in einer sicheren Umgebung zu leben. Ersteres war nach dem Zweiten Weltkrieg für die Flüchtlinge und Vertriebenen im Westen genauso wenig der Fall wie im Osten. Doch die Verunsicherung und damit die Lebensbelastung der offiziell zum Schweigen Verurteilten muss in der DDR-Diktatur erheblich größer gewesen sein und somit auch die Probleme für die Nachkommen. Den Unterschied spüre ich bei meinen Lesungen in Ostdeutschland. Es geschieht ausgesprochen selten, dass ich dorthin eingeladen werde, von der Generation der Kriegskinder so gut wie nie. Zu den Lesungen zum Thema »Kriegsenkel« kommen überwiegend Menschen, deren Eltern als Kinder vertrieben wurden. Ich erinnere mich an Veranstaltungen, in denen es regelrecht zum Dammbruch kam, so sehr hatte das Thema die Besucher überrascht und aufgewühlt. Tenor: Wir hatten ja keine Ahnung! So haben wir das noch nie gesehen … Über die Elterngeneration, also die Fluchtkinder, hörte ich wiederkehrend folgende Aussagen: Sie seien unglaublich frustriert und daher oft schwer erträglich. Sie vergolden wider besseres Wissen die DDR. Unsere Eltern finden, sie kommen überall zu kurz – und wir Kinder sollen das auffangen. In ihren Augen ist es allein unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Ihre Angst vor Ausländern ist riesig, obwohl es sie hier kaum gibt.
Dies alles hat mir eine andere Perspektive als die übliche auf die PEGIDA-Unruhe vermittelt. Dresden und sein Umland haben einen sehr hohen Anteil an Heimatvertriebenen. Ich vermute, ein Großteil der, wie immer wieder betont wird, normalen Bürger gehört zu jenen, die ihre Kriegstraumata nicht aufgearbeitet haben, bzw. sie gehört zu deren Kindern. Sie fürchten jede gesellschaftliche Veränderung. Darum erscheint es mir wichtig zu sein, bei der Motivforschung der Demonstranten die auffälligsten Merkmale von Traumatisierten mit zu bedenken: Veränderte Lebensbedingungen setzen sie enorm unter Stress.
Sie fühlen sich von der Bundeskanzlerin verschaukelt. Hatte »Angie« ihnen nicht versprochen, dass alles bleibt wie es ist bzw. jedes Jahr ein bisschen besser wird? Trotz globaler Herausforderungen. Trotz schlechter Prognosen, was die Weltwirtschaft, was den Umweltschutz betrifft. Ohne zu wissen, wann die EU endlich als wirkliche Gemeinschaft handeln wird …
Was sie Angela Merkel übel nehmen, ist, dass sie ihnen eine Illusion genommen hat. Es war die Illusion einer berechenbaren und damit sicheren Zukunft. Wenn 60 Prozent der Bevölkerung einer Kanzlerin immer wieder bescheinigen, dass sie ihre Sache gut mache, heißt das: Weiter so. Bloß keine Experimente.
Doch jetzt wird sich unsere Gesellschaft, mit der die meisten Menschen im Land im Großen und Ganzen einverstanden sind, verändern. Angeblich eine massive Veränderung, vergleichbar mit der Wiedervereinigung. Das jedenfalls haben Fernsehen und Zeitungen uns gleich zu Anfang eingeschärft. Ob es wirklich so kommen wird, weiß niemand. Nur so viel ist klar: Es wird über lange Zeit viel, sehr viel zu tun sein. Teilweise werden wir Neuland betreten, wo kaum etwas auf Anhieb gelingen wird. Die Gefahr durch Terror wird bleiben.
Wie wird sich das Klima im Land entwickeln? Steht uns wieder eine Phase der Zukunftsängste bevor? Werden wir uns davon steuern lassen? Wird wieder zunehmend ideologisch debattiert? Werden wir ängstlich und konfliktscheu agieren, statt selbstbewusst und kompetent? Werden wir in unserem Umfeld klar und deutlich unsere Meinung sagen, wenn jemand, bestätigt durch die PEGIDA-Demonstrationen, rassistisch und menschenverachtend argumentiert? Werden wir uns zu eigen machen, dass wir von Menschen aus einem anderen Kulturkreis Anpassung an unsere Normen und Werte verlangen dürfen? Und wenn uns jemand deshalb Rassismus vorwirft oder gar als »Nazi« beschimpft, wird uns die passende Erwiderung einfallen?
Unsere Werte zu schützen verlangt keine Heldentaten, es fängt bei scheinbaren Kleinigkeiten an. Nur ein Beispiel: Wenn ich etwas bei unseren Männern vermisse, dann dies: dass sie die Beschwerden von Frauen ernst nehmen, die in Berlin-Kreuzberg oder anderswo wegen ihres sommerlichen Outfits von jugendlichen Migranten als »Schlampen« angepöbelt werden. Es geht nicht, wie es der Moderator in einer Satireshow des ZDF tat, dies mit Schmunzeln zu kommentieren im Sinne von »Hat die Frau keine anderen Sorgen?« Es geht auch nicht, dass ihm andere Männer im Publikum schmunzelnd zustimmen. Unser Mann wird vermutlich auch dann nicht anders reagieren, wenn er auf der Straße Zeuge einer solchen Szene wird. Hier tarnt sich die Angst vor einem Konflikt als kulturelle Toleranz. Ein schwaches Bild. Kein Vorbild. In Sachen Integration das falsche Signal. Ich erwarte von unseren Männern, dass sie auch hier intervenieren, und nicht nur, wenn Flüchtlingskinder Papier auf den Bürgersteig werfen.
Die große Frage ist: Wird die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung so lange anhalten, wie sie gebraucht wird? Werden wir Deutschen die Weltoffenheit, die während des Sommermärchens 2006 ihren Durchbruch hatte, ausbauen und kreativ nutzen, damit der Kraftakt gelingt? Vielleicht erleben wir ja keine Polarisierung, sondern das Gegenteil: Eine entsolidarisierte Gesellschaft findet wieder zusammen. Wenn uns die letzten zehn Jahre eines gelehrt haben, dann dies: Geld ist da! Unglaubliche Summen werden plötzlich bereitgestellt mit der Begründung, Schaden von Deutschland und Europa abzuwenden. Bislang war das Geld nicht vorhanden für die Chancengleichheit im Bildungswesen oder für Rentengerechtigkeit, auch nicht für eine flächendeckende stressfreie Demenzpflege, damit sich niemand mehr vor dem Altwerden fürchten muss. Mit Gemeinsinn und Zusammenhalt haben wir gute Aussichten, die Zukunftaufgaben zu stemmen. Es wird viel Geld kosten, das nur dann fließt, wenn eine starke Bürgerbewegung es einfordert, so wie beim Atomausstieg. Auch dies sind Themen der Humanität und Menschenwürde.
Köln, im Dezember 2015Sabine Bode
Erstes KapitelWie lang sind die Schatten?
Ein Nachkriegsspiel
Die Straße, auf der ich einen Großteil meiner Kindheit verbrachte, hatte viele Schlaglöcher. Zum Rollschuhlaufen taugte sie nicht. Außerdem war sie so schmal, daß zwei Wagen nur mit Mühe aneinander vorbeikamen. Hier habe ich Radfahren gelernt. In der Stille der Umgebung konnte man die Autos schon von weitem hören. Hier erreichte mich, als ich sieben Jahre alt war, aus weit geöffneten Fenstern der erste kollektive Schrei meines Lebens. Deutschland war Fußballweltmeister!
Wir Kinder der Straße bildeten eine Räuberbande. Eines unserer Lieblingsspiele hieß: »Deutschland erklärt den Krieg«. Es ging um Landeroberung. Die Grenzen, die sich ständig veränderten, wurden mit einem Stöckchen in den Erdboden gemalt und bei Bedarf wieder ausgewischt. Man mußte sich in den Dreck legen und mit Hilfe seiner ganzen Körperlänge möglichst viel Territorium für sich reklamieren. Wenn die Mutter mich abends sah, rutschte ihr regelmäßig die Hand aus. »Du siehst wieder aus wie ein Schwein. Wie schaffst du das nur?« An einer Antwort war sie schon nicht mehr interessiert. Wer vier Kinder hatte und keine Waschmaschine, dem fehlte die Zeit, sich in die Welt der Spiele hineinzuversetzen. Ich rieb mir die Wange und fand, daß so viel Spaß eine Backpfeife wert sei.
Das war Anfang der fünfziger Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, daß irgendein Erwachsener uns je an unserem »Deutschland erklärt den Krieg«-Spiel gehindert hätte. Zu Beginn wurde ausgelost, wer welches Land repräsentierte. Am begehrtesten waren die USA, dicht gefolgt von Rußland. Deutschland lag auf dem dritten Platz. England und Frankreich galten als gleich stark, sie waren am wenigsten beliebt.
Krieg war etwas Wichtiges, soviel stand fest. Das Wort verbarg ein Geheimnis. Wenn die Erwachsenen davon sprachen, veränderten sich ihre Stimmen. Sie wurden leiser oder hektischer. In einem Alter, in dem ein Kind üblicherweise nur in der Gegenwart lebt und das Vergangene noch gar keine Kategorie ist, drang etwas in mich ein, das mir eine Ahnung von Vergangenheit vermittelte und mich hellhörig machte. In der Schule erfuhren wir von den Naziverbrechen, von Auschwitz. Als ich die Eltern darauf ansprach, reagierten sie mit Ärger oder Schweigen, was meinen Wunsch, Genaues zu erfahren, anstachelte.
Und so ähnlich war es immer noch Mitte der neunziger Jahre, als ich anfing, das Thema Kriegskinder zu recherchieren. Wieder wurden meine Fragen abgewehrt. Wieder wurde mir bedeutet, ich hätte keine Ahnung. So etwas müsse man selbst miterlebt haben. – Wahrscheinlich gibt es für meine Neugier nichts Stimulierenderes als kollektive Geheimnisse.
Ich besuchte noch nicht die Schule, als ich zum ersten Mal die Großstadt sah, in der ich dann als Erwachsene heimisch wurde. Damals lernte ich: Typisch für Köln sind die Ruinen. Endlos zuckelte die Eisenbahn an hohen schwarzen Mauern mit viereckigen Löchern vorbei. Auch das hatte etwas mit dem unbegreiflichen Wort Krieg zu tun, das den Stimmen im Zugabteil die Kraft nahm. Ich war zu klein, um zu verstehen, daß es sich um ehemalige Häuser handelte, in denen einmal Menschen gelebt hatten. Das Nachkriegskind, geboren 1947, wußte nicht, wie Zerstörung vor sich geht. Was haften blieb: In Köln sieht es sonderbar aus. Interessanter als die Ruinen fand ich den Verkehr auf der Rheinuferstraße. Ich stellte mir vor, dort zu wohnen und täglich die Autos zu zählen.
Langweilige Stille der Nachkriegsjahre
Auf der Straße meiner Kindheit am Rande einer rheinischen Kleinstadt zeigte sich mal ein Traktor, mal ein englischer Jeep oder der Kleinbus des Lebensmittelhändlers, und dann war Stille, und die Welt ringsum schien wieder einzuschlafen. Manchmal wünschte ich mir, neben unserem Haus sollte ein Flugzeug abstürzen, nur damit endlich etwas Aufregendes geschah. Die Straße führte zu einem Bach, der so furchtbar stank, daß wir nicht einmal im Hochsommer mit den Füßen hineingingen. An der Brücke gab es einen Kiosk, ein »Büdchen«. Dort verkaufte ein junges Mädchen Eis am Stil, das billigste für einen Groschen.
Wir bewohnten einen Nachkriegsneubau. Die meisten Häuser sahen alt und verfallen aus, höchstens zweigeschossig, mit behelfsmäßig ausgebesserten Ziegelfassaden und Dächern. Daneben windschiefe, fensterlose Schuppen, deren Türen offenstanden, weil eigentlich immer irgendein alter Mann darin etwas reparierte.
Auf der Straße meiner Kindheit gingen die meisten Menschen zu Fuß, oder sie fuhren mit dem Rad. Einigen Männern fehlte ein Arm oder ein Bein, so manches Gesicht war rotvernarbt. Am Ende der Woche, wenn der Arbeitslohn ausbezahlt wurde, sah man auch Betrunkene. Ein Nachbar, an sich ein schweigsamer und durchaus gutmütiger Mann, verwandelte sich jedesmal in eine völlig andere Person mit struppigen Haaren und glasigen Augen. Er torkelte auf seinem Heimweg und beschimpfte laut seine Frau, die nie ein Wort erwiderte, sondern gebeugt neben ihm sein Fahrrad schob. Die Erwachsenen hatten Mitleid mit der Frau, aber sonderbarerweise genauso mit dem Arbeiter. Ein Heimkehrer, hieß es, der hat Schlimmes durchgemacht. Heimkehrer, noch so ein rätselhafter Begriff, wie auch die Bezeichnung Flüchtlinge. Mit deren Kindern spielten wir nur selten. Wegen ihrer Gewissenhaftigkeit waren sie als Mitschüler nicht sonderlich beliebt. Sie hielten sich von Streichen fern, lachten selten und galten als Streber.
In der Nähe unserer Straße lag ein Bahndamm. Dort fanden wir eines Tages Munition. Kinder, die älter waren als ich, wußten sofort Bescheid. Sie verlangten Schweigen, weil ihnen der Fund interessanter erschien als alles, was an Spielzeug den Krieg überlebt hatte. Keine Ahnung, was sie mit der Munition vorhatten, ich erinnere mich nur, daß irgend jemand die Sache verpetzte und die Erwachsenen ein Riesentheater machten. Die größeren Kinder bekamen Prügel und eine Woche Stubenarrest. Als unser Räuberhauptmann wieder auftauchte, sagte er, ihm sei eine prima Idee gekommen, und wir würden alle sehr stolz auf ihn sein. Kurz darauf klaute er seinem Opa Karbid, womit der im Garten die Maulwürfe bekämpfte: Karbid in den Maulwurfgang, Wasser dazu, Erde drauf, und dann – kawumm! In einer abgelegenen Ecke des Bahndamms machten wir Ähnliches: Karbid in eine Flasche, Wasser rein, Korken drauf, in Deckung gehen – kawumm! Nicht nur die Trümmerkinder, auch wir Nachkriegskinder vom Lande erzählen gern von den Abenteuern einer unbeaufsichtigten Kindheit.
Zerstörung macht Spaß
Jede neue Baugrube wurde mit Jubel begrüßt. Auf Baustellen konnte man großartig spielen. Man durfte nur keinen Lärm dabei machen, weil es natürlich verboten war. An manchen Sommerabenden schlichen wir uns hinein und machten alles kaputt, was für uns erreichbar war. Große Freude, wenn es gelang, eine neu errichtete Innenmauer wieder abzutragen. Vorsichtig lösten wir Stein um Stein aus dem frischen Mörtel heraus, bildeten eine Kette und schichteten das Material in einer anderen Ecke zu einem akkuraten Haufen. Wir haben gern zerstört, und wenn sich Zerstörung mit einem Streich verband, um so schöner.
Ich wurde in eine Welt hineingeboren, die im Rückblick deutliche Spuren von Verstörung und Zerstörung zeigte, auch im Verhalten vieler Erwachsener, die man heute als »gebrochene Charaktere« bezeichnen würde. Ein verläßlich selbstbewußter oder gar lebensfroher Lehrer war eine Rarität. Uns unterrichteten überwiegend Ältere, deren Gesundheit Schaden genommen hatte. Einige Männer waren regelrechte Choleriker, ihre Wutanfälle machten uns vorsichtig. Meine erste Deutschlehrerin auf dem Gymnasium erzählte, sie schlafe stets mit einer Pistole unter dem Kopfkissen.
Die Gründe für die seelische Verfassung unserer Lehrer waren mir natürlich nicht bewußt. Ich dachte, oh je, so ist das wohl, wenn man erwachsen wird. Man ist launisch, selbstgerecht und steif, und man kennt nichts Wichtigeres als die Arbeit. Keine guten Aussichten.
Die Straße meiner Kindheit gibt es immer noch. Die armseligen Häuschen sind einem Wohnpark gewichen. An der Stelle des »Büdchens« steht ein Landhotel. Das Wasser im Bach ist sauber. Aus dem Bauernhof auf der anderen Seite der Brücke wurde ein Reiterhof. Durch die angrenzenden Äcker, auf denen wir im Herbst die selbstgebastelten Drachen steigen ließen, verläuft eine Autobahn. Es gibt keine Spuren der Nachkriegszeit mehr, außer in meiner Erinnerung. Je älter ich werde, desto näher rücken sie.
Manchmal frage ich mich, woher es kommt, daß ich mich nun schon seit so vielen Jahren mit den Folgen dieses Krieges in unserer Gegenwart befasse. Seine direkte, geheimnislose Gewalt war mir erspart geblieben. Und doch – in dem schuldbeladenen, geschundenen Land, in dem ich aufwuchs, haben mich die Auswirkungen von großdeutschem Wahn, millionenfachem Mord und einem verlorenen Krieg von Anfang an begleitet. Bilder und Stimmungen sind früh in mich eingedrungen, dunkel und doch anziehend für ein Kind, weil sie untergründig mit starken Gefühlen aufgeladen waren. Sie haben sich eingeprägt, lange bevor ich das Tagebuch der Anne Frank las und lange bevor ich das Wissen über die deutschen Jahre des Unheils erwarb.
»Die Deutsche Krankheit«
Es gibt in unserem Land Auswirkungen von NS-Vergangenheit und Krieg, die würde niemand bestreiten: die deutsche Teilung und die daraus resultierenden Probleme der Wiedervereinigung, die Kriegsnarben vieler unserer Städte und daß noch immer irgendwo im Lande Bomben entschärft werden. Das Projekt Europa gehört dazu und die große Sehnsucht nach Frieden. Und daß sich angesichts einer Anhäufung von Schwarz-rot-gold und beim Hören des Deutschlandliedes Wohlgefühl nur selten einstellt, es sei denn, es handelt sich um sportliche Spitzenereignisse wie die Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land.
Aber Angst? Oder German Angst, wie die Angelsachsen ein Phänomen nennen, das für sie in den achtziger Jahren erstmals erkennbar wurde? Oder gar »German Disease«– »Die Deutsche Krankheit«, ein Begriff, auf den man sich inzwischen rund um den Globus geeinigt hat, um sich darüber zu verständigen, daß das über Jahrzehnte gültige Bild von den zupackenden, leistungsstarken Deutschen mit ihrem mustergültigen Sozialstaat revidiert werden muß. Die deutschen Urlauber, so heißt es in der internationalen Tourismusbranche, erkennt man an herunterhängenden Mundwinkeln. Ja gut, das ist für uns nichts Neues. Seit Jahren schon wird der Mangel an Optimismus in unserer Bevölkerung von Politikern und Medien kritisiert, und seit die große Koalition regiert, werden in Fernsehspots regelmäßig Appelle zur kollektiven Stimmungsaufhellung verbreitet. Die Regierung Angela Merkel schenkte den Deutschen eine Phase des Durchatmens: keine harten Einschnitte im ersten Jahr, keine neue Welle kollektiver Ängste … Es beruhigte die Bevölkerung tatsächlich ein wenig und führte in Politik und Medien zu einem verblüffenden Klimaumschwung. Plötzlich ist die Stimmung besser als die Situation des Landes. Da staunt man schon, wurden doch gerade die Massenblätter und das Fernsehen – und sie wiederum mit kräftiger Unterstützung der Politiker – nicht müde, neue Bedrohungen auszugraben und die Zukunft als eine einzige Kette von katastrophenähnlichen Zuständen darzustellen. Was soll sie daran hindern, genau dies zu wiederholen, wenn die Preise steigen und die Arbeitslosenquote nicht nennenswert sinkt?
Mag sein, wir haben es bei »Bad news are good news« mit Selbstläufern zu tun, die alle westlichen Gesellschaften irritieren, aber leider unkontrollierbar wie das Wetter sind. Gegen Regen schützt ein Schirm. Was aber hilft, um die Überdosis von schlechten Nachrichten zu ertragen, wie sie uns tagtäglich das Fernsehen verabreicht? Wie ignoriert man die einladenden Schreckensnachrichten (Bild: »Als Kassenpatient bist du der letzte Arsch!«), womit der Opferjournalismus an jedem Kiosk, an jeder Haltestelle auflauert? Wie hätte man unbeeindruckt bleiben können, als auf einem Titelblatt Kinder mit furchtsam geweiteten Augen ihr angeblich von Hartz IV bedrohtes Sparschwein in die Kamera hielten? Wie hält man die permanenten Bedrohungsszenarien (»Die Erdachse kippt!«) auf Abstand?
Warum verkauft sich Angst so gut?
Als während der Unruhen in Frankreich vor einigen Jahren jede Nacht 1000 Autos in Flammen aufgingen und bekannt wurde, daß die Brandstifter erste Nachahmer gefunden hatten, wußte der Kölner Express zu berichten, auch in Deutschland wachse die Angst. Es war eine Angst, die er gerade erst mit seinem Aufmacher produziert hatte: »Auch in Berlin brennen die Autos«. – In der Tat. Drei Wagen waren angezündet worden, 997 weniger als in Frankreich. Aber die Schlagzeile klang verheißungsvoll. Ein Anfang, so versprach sie, ist gemacht.
Wie wehrt man sich gegen Klatsch in der Boulevardpresse, der einem die gute Laune nimmt? Eigentlich geht es niemanden etwas an, wenn die bis dato unbekannte Freundin eines bekannten Popstars Brustkrebs hat. Es steht aber auf Seite 1, und es ist kaum möglich, sich der Botschaft zu entziehen, weil sie einen selbst im Vorbeigehen anspringt, und dann freut man sich nicht länger über einen sonnigen Tag, sondern man denkt an Freundinnen und Bekannte, die an Brustkrebs leiden oder daran gestorben sind.
Wem dient das? Gerade in Zeiten des Klimawandels, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen rauher werden, wenn Konzerne Riesengewinne machen und gleichzeitig die Arbeitsplätze in Deutschland weiter abbauen, wenn Menschen mehr arbeiten müssen und weniger Geld bekommen und im Falle von Arbeitslosigkeit die finanzielle Unterstützung magerer ausfällt, als man sich das einmal vorgestellt hatte – wenn also Sorgen und Belastungen wachsen und ein Ende nicht abzusehen ist, gerade dann brauchen Menschen eigentlich einen anderen geistigen Treibstoff, um bei Kräften zu bleiben, als die negative Energie wild wuchernder Bedrohungen.
Was können wir über die Grundbefindlichkeit eines Kollektivs sagen, dem wir selbst angehören, weshalb es so schwierig ist, Distanz zu entwickeln? Sind wir zu einer realistischen Einschätzung überhaupt in der Lage? Wie sollen wir unterscheiden, ob uns die Medien einen Mangel an Zuversicht und Risikofreude im wesentlichen nur einreden oder ob sie die Wirklichkeit beschreiben? Zweifelsfrei läßt sich nur sagen, daß das Schüren von Ängsten im Fernsehen und in Massenblättern auf die Kundschaft keineswegs abschreckend wirkt, sondern gute Quoten und hohe Auflagen sichert. Das Geschäft mit der Angst bedient kollektive Bedürfnisse. Aber welche?
Es fehlt die Tiefenschärfe
Was wissen wir über uns, solange es keine handfesten Untersuchungen über die Hintergründe der Stimmungslage der Nation gibt und vermutlich auch gar nicht geben kann? Was uns zur Verfügung steht, sind die Ergebnisse der Meinungs- und Marktforscher, aber ihnen fehlt die Tiefenschärfe. Allzu verläßliche Aussagen lassen sich daraus nicht ableiten, wie es spätestens das völlig unerwartete Ergebnis der Bundestagswahl im September 2005 gezeigt hat. Daß in Deutschland die Angst extrem groß sei, vor allem vor Arbeitslosigkeit, gefolgt von der Angst vor Terrorismus und vor Krieg, das wird in regelmäßigen Abständen durch Umfragen bestätigt. Doch herauszufinden, was ein Kollektiv befürchtet und wodurch es unterbewußt gesteuert wird, sind zwei verschiedene Dinge.
Gemessen daran, wie schnell hierzulande ausländische Stimmen zur »deutschen Schuld« in die Schlagzeilen gelangen, dauerte es verblüffend lange, bis sich unsere Politiker den Befund vom verängstigten Deutschen zu eigen machten. Seit einigen Jahren gehört »German Angst« zum Vokabular der öffentlichen konsensfähigen Zustandsbeschreibung. Der Bundestagspräsident aus der Zeit der sozialliberalen Koalition, Wolfgang Thierse, orakelte auf einem Katholikentag: »Von German Angst spricht man im Ausland mit Blick auf unsere kollektive Gefühlslage. Angst wovor? Ist das eine kollektive, eine nationale Lebensangst? Ist es die Angst vor der Politik als solcher? Angst vor den realen Folgen der Politik – einer Politik, die erst falsche Versprechungen von blühenden Landschaften und immerwährendem Wohlstand aufbläst und dann an der Realität scheitern muß?«
Das Rätselraten über die Ursachen von German Angst ist noch im Gange. Was lähmt die Deutschen? Warum schauen sie ihren Ängsten nicht ins Gesicht und versuchen, sie zu überwinden? Häufig wird gesagt, eine solche Zukunftsangst – die sich im Unterschied zur Furcht auf nichts Konkretes bezieht – gehöre zusagen zur Grundausstattung der deutschen Mentalität. Manche vermuten ihren Ursprung im Dreißigjährigen Krieg, andere in der Romantik; wieder andere sagen, diese Angst habe »irgendwie mit der deutschen Schuld« zu tun. Während der Arbeit an meinem Buch »Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen« fing auch ich an, mich innerlich an derartigen Spekulationen zu beteiligen. In mir wuchs ein Verdacht. Können die Schatten der Vergangenheit ein Kollektiv über viele Jahrzehnte unterschwellig so stark belasten, daß für neue Herausforderungen, für ein tiefgreifendes Umdenken einfach die Kraft fehlt? Ist es das, was uns den Umgang mit Wohlstandsverlusten so schwer macht? Sind die tatsächlichen Ursachen für die Mutlosigkeit schon über 60 Jahre alt, fragte ich mich 2006.
Ich stand mit meinen Fragen allein. Sie lösten allenfalls Kopfschütteln aus. Was soll das? Wen interessiert denn sowas? Und was bringt uns das Wissen, wenn es denn tatsächlich so wäre? Kein Thema. Die Reaktionen ähnelten der Situation 1995, als es um die Frage ging: Wie haben eigentlich die deutschen Kriegskinder ihre frühen Begegnungen mit Gewalt verkraftet?
Damals schien sich außer mir kaum jemand dafür zu interessieren, weder die Kriegskinder selbst noch Ärzte, Psychotherapeuten, Seelsorger, Redakteure. In Deutschland, so kam es mir vor, hatte man sich stillschweigend darauf geeinigt, daß die Kinder des Krieges gut davongekommen waren.
Allgemeine Sprachlosigkeit
Zehn Jahre später, im Jahr 2005, als die Generation erstmals in der Öffentlichkeit sichtbar wurde, zeigte sich dann: Viele Kriegskinder begriffen erst im Ruhestand, wie stark ihr Leben und ihr Verhalten von den frühen Schrecken geprägt waren. Die meisten sind jahrzehntelang nicht in der Lage gewesen, etwas laut zu denken, wofür ihnen keine Sprache zur Verfügung stand.
Und nun das Desinteresse am Thema German Angst. Der Gedanke, auch hier könnte der Zugang durch Sprachlosigkeit blockiert sein, lag für mich auf der Hand. Dennoch fanden sich beim inneren Abwägen zunächst mehr Gegenargumente. Hat sich ein Kollektiv je umfassender mit seiner Vergangenheit beschäftigt? Ist der Drang, sich seiner Geschichte bewußt zu werden, inzwischen nicht sogar zum Zwang geworden? Haben ausländische Stimmen recht, wenn sie die Deutschen als ständig um sich selbst kreisend, ja als geradezu erinnerungswütig kritisieren? Wo soll da Sprachlosigkeit sein? Hat nicht die erschlagende Fülle des Gedenkens im April und Mai 2005 bewiesen, daß das Interesse in der Bevölkerung 60 Jahre nach Kriegsende eher noch wächst als schwindet?
Die Aufarbeitung der dunklen Jahre Deutschlands und deren Folgen für die Opfer wurde in der Bundesrepublik weitgehend den Historikern überlassen. Die Zahlen, auf die man sich einigte, übersteigen jedes menschliche Vorstellungsvermögen. Im Zweiten Weltkrieg starben weltweit 60 Millionen Menschen. Allein in Rußland waren es 25 Millionen. Im Schatten des Krieges wurden in Europa 6 Millionen Juden ermordet. Die historische Forschung bezog sich auf die Heimsuchungen, die von Hitlerdeutschland ausgingen, auf Vernichtungskrieg und Holocaust – und im geringeren Umfang auch auf die Gewalterfahrung und die Verluste der Deutschen selbst: 5,3 Millionen gefallene Soldaten, 1,7 Millionen tote Zivilisten, 11 Millionen in Kriegsgefangenschaft, Millionen Vermißte und Kriegsversehrte, viele hunderttausend vergewaltigte Frauen und Mädchen.
Die Beschäftigung mit den von Deutschen verursachten Massenverbrechen und dem Leid der deutschen Bevölkerung – das Untersuchen »der beiden moralisch so unterschiedlich zu bewertenden Leidensspuren«, wie es der Holocaustforscher Micha Brumlik1 nannte – geschah nicht parallel, sondern zeitlich versetzt. Die Vertreibung wurde bis Anfang der siebziger Jahre in der Bundesrepublik ausgiebig erforscht und dokumentiert, was sicherlich auch dem Klima des Kalten Krieges geschuldet war.
»Hitler war ja Westdeutscher«
In der DDR wurde mehr oder weniger das Gegenteil praktiziert. Über Flucht und Vertreibung durfte nicht laut geklagt werden, dagegen wurde das Gedenken an die Zerstörung Dresdens und das Leid seiner Bewohner offiziell zum Kult erhoben. Es ging dem SED-Staat nicht um kollektive Trauer, sondern um das Verschärfen des westlichen Feindbildes, wenn er Jahr für Jahr an »die angloamerikanischen Terrorbomber« erinnerte. Auf ein grundsätzliches Aufarbeiten der NS-Vergangenheit hat man verzichtet. Um das zu erklären, greift die ehemalige DDR-Bürgerin und spätere Bundesbeauftragte für Stasiunterlagen, Marianne Birthler, zu leiser Ironie. »Das brauchten wir alle nicht. Hitler war ja, wie Peter Bender es auf den Punkt brachte, Westdeutscher. Wir waren erklärtermaßen der antifaschistische Staat, und es gab auch offizielles und öffentliches Gedenken, aber wir haben über andere geredet, nicht über uns. Denn die Verbrecher – ich sag’s jetzt etwas verkürzt –, die waren alle im Westen.«