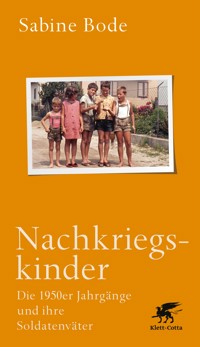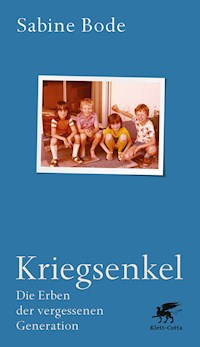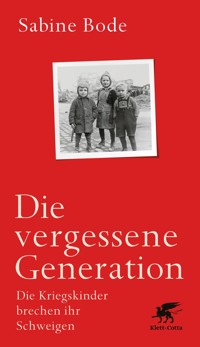9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Es ist an der Zeit, den Horrorszenarien im Zusammenhang mit Demenz eine positive Vision entgegenzusetzen. Sabine Bodes Buch beschreibt eine gute Zukunft. Denn die Probleme, die heute da sind, und jene, die auf uns zukommen werden, sind lösbar. Welche Optionen bleiben? Weiter weggucken? Darauf warten, dass das rettende Medikament gefunden wird? Oder unser Schicksal in die Hand nehmen, unsere Zukunft gestalten. Sabine Bode besuchte Alten und Pflegeheime, sprach mit Pflegepersonal, Wissenschaftlern und porträtiert Helfer, die unermüdlich Demenzerkrankten helfen, in Würde zu altern. Sie vollführt einen Perspektivwechsel: Sie bringt festgefahrene Ängste zum Einsturz und zeigt unzählige gute Ansätze und Mut machende Erfahrungen. Dieses Buch ist ein Plädoyer für ein Umdenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
SABINE BODE
FRIEDEN
SCHLIESSEN MIT
DEMENZ
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2014 /2016 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung eines Fotos von © Michael Hagedorn, Fotografie www. michaelhagedorn.de
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96108-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10678-7
Dieses E-Book entspricht der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Im Gedenken
an Alex Fricke
Inhalt
VORWORT UND DANK
EINFÜHRUNG
Wie gut funktionieren doch Scheuklappen!
Eine Gesellschaft braucht Visionen
»Die unheimliche Geißel des Alters«
Wen interessiert der psychosoziale Faktor?
Ein lösbares Problem
Von Pionieren lernen
ERSTES KAPITEL: »Das Recht der Alten auf Eigensinn«
Wurstscheibe als Brillentuch
Brücken zu einer anderen Welt
Arbeitsauftrag Verwöhnen
»Auch Helden brauchen eine Pause«
Ein riesengroßes kleines Mädchen
Sanfte Magie verscheucht den Alltag
Der Fuchs sagt: »Zähme mich!«
Grimassen schneiden
Eine erstaunliche Parallelwelt
Nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen
Bloß nicht über Pampers reden!
ZWEITES KAPITEL: Verwöhnen
Musik, die tief berührt
Hilfe von einer fremden Frau
Küsse, die beruhigen
Der Pionier Tom Kitwood
Tortur im Pflegeheim
»Hallo Schätzchen!«
Die Treppe mit den Lebensstufen
Kein Kind, aber kindhaft
Eine Frau mit Demenz tritt aus dem Schatten
Kuschelecke mit Wasserbett
Lange Flure stiften Verwirrung
Die Freude an der Freude der anderen
Werbung mit einer Badewanne
Entspannung pur
Eine Frau, die ihre Berufung fand
Im großen See der Ressourcen fischen
Hände arbeiten oft besser als der Kopf
Ehrlichkeit
Was erinnert wird
Der Umgang mit der Wahrheit
Sexualität
Eifersucht und Zärtlichkeit
Autonomie und Bedürfnisse erfüllen
Konflikte
Die Grenze einer Lebensbegleiterin
Die eigene Ernte
DRITTES KAPITEL: Liebe
»Wer ist der Mann?«
Keine Lust mehr, etwas zu entscheiden
Vorbereitung auf ein Leben mit Alzheimer
Der Trick mit dem Rollstuhl
Vollmachten und Testament
Es konnte peinlich werden
Radfahren konnte Holger noch lange
Socke an, Socke aus, Socke an, Socke aus …
Ein blaues Auge
Das rettende Angebot aus einer Wohngruppe
In der Klinik war Demenz etwas Unbekanntes
Lachen in der Selbsthilfegruppe
Wenn ein Ehemann seine Frau pflegt
Zwei Verliebte reden wie die Kinder
In der Krankheit wird die Beziehung tiefer
Manchmal fährt er aus der Haut
Alle fragen nach Peter
Sie machte sich keine Illusionen
Ein Mann, der alle Menschen liebte
Der Typ Schnauze mit Herz
Für sie sind es alles Phasen
Beziehungsdynamik
VIERTES KAPITEL: Krankheit oder Hirnalterung?
Ein Blick in die Psychiatrie der Siebziger Jahre
Die Entdeckung der Naomi Feil
»Greise sind zum zweiten Mal Kinder«
Die Nonnenstudie – eine Sensation
Dünger für das Gehirn
Eine Frage, mit der man sich verdächtig macht
»Mythos Alzheimer«
Symptomfrei und dennoch Früherkennung?
»Die Menschen sind anders, das ist alles«
FÜNFTES KAPITEL: Wenn Eltern dement werden
Eine Familie auf dem Prüfstand
Unruhe unter Geschwistern
Dilemma der häuslichen Pflege
Ein Blick auf verlorene Jahre
Mutter sitzt teilnahmslos im Sessel
»Manchmal wünschte ich, sie wäre tot«
Alle sind am Limit
Elektronik statt Pille
Heimvergnügen: Foxtrott mit einer alten Dame
Die Freiheit der Söhne
Den Elektroherd abgeklemmt
Viel Anerkennung, keine Kritik
»Bloß nicht über die DDR reden!«
Editha aus Polen
Friedliches Schweigen am Seeufer
Als Vater eine Puppe bekam
SECHSTES KAPITEL: Kriegstrauma und Alzheimer
Späte Gefangenschaft
Albtraumkino
Was von der Flucht übrig blieb
Alzheimer half, eine Tür zu öffnen
Ein Verdacht, der immer lauter wird
Der Vietnamkrieg und seine Folgen
Ein Forschungsprojekt für Europa?
Die Auffälligkeiten bei den Kriegskindern
Wenn Medikamente zu Verwirrung führen
Ein Kongress, der den Durchbruch brachte
Das Programm des Funktionierens
Ein blinder Fleck
»Die Unfähigkeit zu trauern«
Eine Mutter, die tagelang schweigen konnte
Die Beziehung wurde immer besser
»Plötzlich versteht man jeden Satz!«
SIEBTES KAPITEL: Kunst und Kultur
Der Umgang mit Demenzkranken macht kreativ
Eine Frau mit großer Intuition
Die Wiederbelebung des Bauerngartens
Wertschätzung für nicht Messbares
Wichtig für ein Heim: die Spur wechseln
Kommunikation auf der Gefühlsebene
Ein Gottesdienst
Ortswechsel für Jesus
Auf Augenhöhe
Rituale und Symbole
Gutes Theater
Als Schauspielerin war sie nie zufrieden
Entspannt Proben – geht das?
»Impuls« heißt das Zauberwort
Lernerfolge
Auf der Bühne verbessert sich die Selbstkontrolle
ACHTES KAPITEL: Vom Wert der Altenpflege
Eine entspannte Referentin
Schock im Badezimmer
Immer wieder Neues ausprobieren
Tränen im Auto
Missverständnisse
Worauf war Ihre Mutter stolz?
Streitpunkt künstliche Ernährung
»Menschenverachtende Bedingungen«
Interview mit Christian Müller-Hergl zur Situation der stationären Demenzpflege
NEUNTES KAPITEL: Wo die Zukunft schon begonnen hat
In einer Wohngemeinschaft
Gemeinschaft als Trend
Erschwingliche Mieten
Morgens kann jeder aufstehen, wann er will
Starke Stimmungsschwankungen
Der Alltag für Hochbetagte ist anstrengend
Orte des Staunens
Ein Heimplatz für 6000 Euro
In der Ferne die schneebedeckten Alpen
Ethik als Pflichtfach
Wenn Heimbewohner sich verlieben
Die kleinen Glücksmomente
Eine Begegnung wie ein Tanz
Biografiearbeit und die falschen Schlüsse
Die Freiheit eines Heimleiters
ZEHNTES KAPITEL: Wir alle können etwas tun
Eine peinliche Situation
»Wir sind Nachbarn«
Vernetzung der Altenhilfe
»No risk no fun«
Eine Kampagne findet Nachahmer
Volunteers: eine Kultur der Wertschätzung
Eine demenzfreundliche Gemeinde
Zeit schenken, gute Ideen umsetzen
Hundebesuchsdienst
In Düsseldorf setzt man auf »zentrum plus«
Es geht um Menschenrechte
ANMERKUNGEN
VORWORT UND DANK
Nachdem ich mich in vier Büchern mit den Folgen von NS-Zeit und Krieg in unserer heutigen Zeit – vor allem in den Familienbeziehungen – beschäftigt hatte, empfand ich zunehmend, dass mein Arbeitsschwerpunkt ein anderer werden sollte. Es folgte ein Abschied, der mir leicht fiel. In meiner journalistischen Arbeit wollte ich mich nicht länger auf die Auswirkungen der deutschen Vergangenheit konzentrieren. Für ein neues Buchprojekt konnte ich mir nur ein Zukunftsthema vorstellen. Gesucht habe ich danach nicht. Das Thema Demenz hat mich gefunden. Auch der Titel »Frieden schließen mit Demenz« war eines Tages einfach da, und damit die Neugier, eine mir völlig unbekannte Welt zu erforschen. Für dieses Thema habe ich eineinhalb Jahre recherchiert. An eine schönere Arbeitsphase kann ich mich nicht erinnern.
Allen Menschen, die in diesem Buch zu Wort kommen, danke ich von Herzen für ihre Offenheit, auch für ihren Realitätssinn, für ihre Risikobereitschaft und Begeisterungsfähigkeit, für Liebe und Respekt im Umgang mit Demenzerkrankten. Unsere Gespräche verhalfen mir zu wesentlichen Einblicken in den Alltag der Patienten und derer, die sie als Angehörige und Helfer begleiten und umsorgen. (Geänderte Namen wurden mit einem * gekennzeichnet.)
Wie auch bei meinen früheren Büchern fand ich in meinem Verlag Klett-Cotta große Unterstützung, für die ich mich bedanke, ganz besonders bei meinem Lektor Heinz Beyer und Frau Rosel Müller. Auch meinem Mann Georg Bode bin ich dankbar, weil er das schwere Thema nicht abwies, sondern wir uns gemeinsam auf den Weg machten, um uns vorzustellen, was die Lebensphase Demenz für unser Alter, für unsere Beziehung bedeuten könnte. Wir fühlten uns ermutigt durch die Haltung einer 15 Jahre älteren und durch Krankheit sehr eingeschränkten Freundin. Sie sagte: »Man kann sich viel ersparen, wenn man die Wahrheit kennt.«
Köln, im Januar 2014
Sabine Bode
EINFÜHRUNG
Wie gut funktionieren doch Scheuklappen!
Es ging mir nicht anders als so vielen Menschen. Ich wollte mir nicht ausmalen, was es für mich bedeuten würde, eines Tages alt und gebrechlich zu sein, die Erinnerung an meine Vergangenheit zu verlieren, meine Lieben und mich selbst nicht mehr zu kennen. Die Fernsehauftritte von prominenten Alzheimerpatienten beunruhigten mich so sehr, dass ich unmittelbar danach wieder die Scheuklappen anlegte.
Zeitungsberichte über Skandale in Altenheimen las ich nicht zu Ende. Immer dasselbe, dachte ich, eher ermüdet als empört. Das wissen wir doch alle schon so lange: dass erstens die Pflege- und Betreuungskräfte keine gesellschaftliche Wertschätzung erfahren, dass sie zweitens überfordert, immer schlechter ausgebildet und unterbezahlt sind, und sie drittens aller Voraussicht nach in der Altersarmut landen werden. Nie führte ich gezielt Gespräche über Altenpflege, ich speicherte eher zufällig Informationen, forschte nicht weiter nach. Mehr wollte ich darüber nicht wissen. In meiner Familie hatte es keine Hochbetagten gegeben. Niemand im Freundeskreis war über einen langen Zeitraum pflegebedürftig gewesen und hatte meinen Beistand gebraucht. So konnte ich mein ganz persönliches Tabu bis zu meinem 65. Lebensjahr aufrechterhalten.
Dann änderte sich mein Fokus. Ich begriff Demenz nicht länger als ein Elendsthema, mit dem man am besten klarkam, wenn man es sich so lange wie möglich vom Leib hielt. Stattdessen entdeckte ich vor allem eins: ein großes Beziehungsthema für Familien, eine Reifeprüfung für die ganze Gesellschaft. Seitdem ist mir klar, wie sinnlos die im Fernsehen üblichen kontroversen Pflegediskussionen sind. Wir brauchen eine Wertediskussion. Ein Satz, der verlässlich immer wieder auftaucht, lautet: »Die Altenpflege in Deutschland hat keine Lobby.« Wie ist es möglich, dass sie überhaupt eine Lobby braucht? Ist es nicht selbstverständlich, dass die Pflege und Begleitung alter Menschen – sprich die Zukunft jedes einzelnen von uns – allen in der Gesellschaft ein zentrales Anliegen sein muss, elementar wichtig wie sauberes Wasser und funktionierende Ampelanlagen? Und warum nehmen wir es als unveränderbar hin, dass die Deutschen im Hinblick auf das Altern vor nichts mehr Angst haben, als den Verstand zu verlieren. Man hält das hierzulande für normal, man glaubt, es sei in anderen Ländern genauso. Stimmt aber nicht. In einer Studie wurden Brasilianer, Amerikaner und Deutsche gefragt, welche Aspekte des Alters sie am meisten fürchten. Heraus kamen drei völlig unterschiedliche Ergebnisse: Bei den Brasilianern ist es in erster Linie der Verlust des sexuellen Antriebs, bei den Amerikanern das Übergewicht und bei den Deutschen die Demenz.1
Dies ist ein Buch über Beziehungen. Es geht hier nicht um die Organisation und die Kosten in der Pflege und Begleitung altersverwirrter Menschen. Es geht nicht um die Vor- und Nachteile von Heimen, Wohngruppen oder Einrichtungen der Tagespflege. Es wird kein Kriterienkatalog aufgestellt. Wer dazu Informationen braucht, findet sie in örtlichen Beratungsstellen, im Internet, bei der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und vielen anderen Netzwerken.
Die meisten Menschen, die in meinem Buch zu Wort kommen, kennen sich aus mit guten Arbeitsbedingungen: wenig Zeitdruck, viel Teamgeist, gute Fortbildungen und Supervision. Sie halfen mir, mich in der Parallelwelt einer guten Demenzpflege zurechtzufinden. Es waren überwiegend Menschen mit Visionen. Sie überzeugten mich vor allem durch ihren Mut Neues auszuprobieren, auf die Gefahr hin zu scheitern. Dass es sich bei ihnen um Ausnahmen in der Altenpflege handelt, muss nicht so bleiben. Aus Exoten können Vorbilder werden – das kennen wir aus anderen gesellschaftlichen Bewusstseinsprozessen.
Warum können gute Heime und Wohngruppen, denen man seine Lieben guten Gewissens anvertrauen könnte, nicht ausreichend angeboten werden? Wer ist schuld? Der schwarze Peter wird rumgereicht: die Politik, die Pflegekassen, die Pflegestufen, das enge Zeitkorsett eines herzlosen Minuten-Taktes, die Ökonomisierung der Pflege, Profitdenken, das Festhalten an veralteten Strukturen.
Seit Jahrzehnten hören wir, nur ein Durchbruch von Seiten der Pharmaindustrie könne Abhilfe schaffen. Aber entsprechende Medikamente sind nicht in Sicht. 60 Millionen Euro werden in Deutschland jährlich für die Pharmaforschung ausgegeben, und nur 6 Millionen Euro gehen in die Pflegeforschung. Vielleicht wäre es humaner, die Mittel umzuschichten, geleitet von der Frage: Was brauchen Menschen mit Demenz? Jeder, der Demente begleitet, weiß: Diese Gruppe der Alten erträgt keinen Zeitdruck in ihrer Umgebung. Es setzt sie unter Spannung. Und wer Stress erzeugt, muss mit Widerstand rechnen. Im Pflegedeutsch heißt das: »herausforderndes Verhalten« oder Rückzug und Apathie, die Kooperation verweigern. Jede der Betreuerinnen weiß, dass ein entspanntes, stressfreies Arbeiten in der stationären Pflege selten anzutreffen ist.
Das muss nicht so bleiben, das ließe sich ändern. Doch spätestens hier steht die Frage im Raum: »Wer soll das bezahlen?« Ich meine, wir sollten diese Frage für eine Weile beiseitestellen. Sie ist ein Totschlagargument. Menschen mit Visionen sollen mundtot gemacht werden. In Wahrheit handelt es sich nicht um eine Frage, sondern um eine Feststellung mit der banalen Aussage: Dafür ist kein Geld da, basta. Es wird ja nicht weiter gefragt, wie andere Länder es machen, die gute Lösungen in der Altenversorgung gefunden haben. Eigentlich müsste uns ziemlich peinlich sein, mit welchem Unverständnis die schweizer oder niederländischen Nachbarn auf unsere deutschen Verhältnisse schauen.
Allerdings haben Visionen nur dann Überzeugungskraft, wenn sich in der Bevölkerung herumspricht: Es gibt Alternativen. Es gibt viele, viele mutmachende Erfahrungen und Entwicklungen! Man kann etwas tun! Im Rückblick auf die Anfänge der Ökologiebewegung zeigt sich deutlich, wie in nur wenigen Jahren Resignation und Apathie überwunden wurde. Man organisierte Kampagnen. Man ging auf die Straße. Die Mutigen von Greenpeace machten als eine neue Form von Helden auf sich aufmerksam.
Der größte Schub kam, als man in den Medien begriffen hatte und mit Nachdruck darüber aufklärte: Nachhaltige Energien funktionieren. Sie sind keine Spinnereien! Die Partei der Grünen wurde 1980 gegründet. Fünf Jahre später ließ sich Joschka Fischer in weißen Turnschuhen als Landesminister vereidigen.
Was wir heute brauchen, ist eine starke Bürgerbewegung, die eine flächendeckenden stressfreie Demenzpflege einfordert.
Es wird viel Geld kosten. Doch wenn uns die zusätzlich ausgegebenen Milliardensummen seit der Finanzkrise eines gelehrt haben, dann dies: Das Geld ist da! Bislang fließt es nur dann, wenn, wie die offizelle Begründung lautet, damit »Schaden von Deutschland abgewendet werden soll«. Genau dies hier trifft zu: Eine Gesellschaft, die sich vor dem Altwerden fürchtet, hat Schaden genommen! Wenn Angehörige und alle anderen, die Demenzkranke umsorgen, überlastet und gestresst sind, dann heißt das: Einer großen Gruppe Menschen in Deutschland nimmt Schaden. Auch dies sind Themen der Humanität und Menschenwürde.
Darum brauchen wir ein starkes, unübersehbares Engagement aus der Mitte der Gesellschaft. Darum können sich die Menschen, die heute tagtäglich Demenzkranke begleiten und pflegen, nicht auch noch kümmern. Das Know-how haben nicht sie, sondern die Kulturschaffenden. Ich sehe das Engagement arbeitsteilig. Die einen sind die Helfer, die anderen rütteln die Gesellschaft wach. Eine zentrale Aufgabe für alle Menschen mit Bürgersinn.
Man kann ja doch nichts machen? Kein Argument.
Eine Gesellschaft braucht Visionen
Mit der Frage »Wer soll das bezahlen?« soll die Wertediskussion vermieden werden. Die Menschenrechte, so scheint es, spielen bei der Pflege von Altersverwirrten keine Rolle.
Wer darauf pocht – und dies verständlicher Weise immer verzweifelter – wird als Querulant eingestuft. Die guten Erfahrungen in der Demenzpflege werden als Einzelfälle abgetan und sind daher ohne Überzeugungskraft. Querdenker mit Zuversicht und Erfindungsgeist sollen als Spinner entlarvt werden. Wir kennen das aus den früheren Debatten über erneuerbare Energien. Eine Gesellschaft braucht aber Visionen. Ohne Visionen würde ein Gemeinwesen auf der Stelle treten, Innovationskraft würde nicht genutzt und schlimmer, wichtige Errungenschaften gingen wieder verloren. Unsere Erfahrungen in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland zeigen: ohne Visionen kein Mauerfall, ohne Visionen kein Atomausstieg.
»Die unheimliche Geißel des Alters«
Das Bild, das in der Öffentlichkeit von der Alzheimerkrankheit verbreitet wird, hat auch mich geprägt. Die meisten Schlagzeilen machen Angst und nicht wenige schüren Panik. Von der »unheimlichen Geißel des Alters« ist die Rede. Eine typische Bildunterschrift lautet: »Der zunehmende Verlust des Gedächtnisses und anderer kognitiver Fähigkeiten macht die Patienten hilflos und einsam.« Überrascht es irgendjemanden, wenn der Blick in eine so hoffnungslose Zukunft gemieden wird? Mein Interesse am Thema »Älterwerden« verließ mich immer knapp bevor die Frage aufkam: Wie wird mein Leben sein, wenn ich meine Autonomie verloren habe und auf fremde Hilfe angewiesen bin? Das wollte ich mir nicht vorstellen.
Natürlich kannte ich entsprechende Berichte von Angehörigen. Für das, was die Frauen – immer waren es Frauen! – leisteten, habe ich sie, wie es vermutlich jeder Mensch tut, bewundert. Ich sah auch, wie sehr sie darunter litten, wenn eine Entscheidung zur Heimunterbringung anstand. Es entlastete sie sichtlich, darüber zu reden, aber für mich überstiegen die Details manchmal die Grenze des Erträglichen. Und ich dachte: Meine Güte, wenn es mir schon beim Zuhören schlecht geht, wie erbärmlich würde ich als pflegende Tochter oder Ehefrau versagen! Sehr viel später erst begriff ich, dass die Übelkeit, die in mir hochstieg, Angst war.
Nein, ich habe noch nie, noch nicht einmal über wenige Stunden, einen verwirrten Menschen versorgt. Ich habe keinen Urin weggewischt und keine falschen Beschuldigungen ausgehalten, im Sinne von: Sie haben meine Uhr geklaut. Ich weiß nicht, wie es mir ginge, wenn mein Mann Nacht für Nacht, Stunde um Stunde, nach irgendetwas suchend in der Wohnung umherirren würde. Aber ich weiß inzwischen, wo ich mir im Ernstfall Hilfe holen könnte. Ich weiß, wer mir den Rücken stärken würde, und ich gehe davon aus, dass mein Mann es weiß, falls eines Tages ich diejenige bin, die zum Pflegefall wird. Inzwischen besitze ich Kriterien für eine gute oder eine schlechte Unterstützung in der häuslichen Pflege. Das erfuhr ich vor allem durch meine Besuche bei pflegenden Angehörigen. (Die Anonymisierung ihrer Namen wurde mit einem * hinter dem Namen gekennzeichnet.) Ich kann unterscheiden zwischen einer guten und einer schlechten Einrichtung für Menschen mit Demenz. Denn ich habe aufgehört wegzuschauen. Es hat viele Jahre gedauert, bis es so weit war.
Wen interessiert der psychosoziale Faktor?
Dass es letztlich doch geschah, verdanke ich einer immer wiederkehrenden beruflichen Situation. Seit 2004, seit ich zu Lesungen aus meinen Büchern über die Langzeitfolgen des Zweiten Weltkrieges eingeladen werde, taucht beim anschließenden Austausch regelmäßig die Frage auf: »Wissen Sie etwas über den Zusammenhang von Kriegstrauma und Demenz?« Meine Antwort war immer die gleiche: »Es gibt dazu keinerlei Studien. Der psychosoziale Faktor ist für die Demenzforschung ohne Bedeutung. Hier geht es um die Entwicklung neuer Medikamente und Untersuchungsmethoden.« Ich hätte die Frage als einen Auftrag zur Recherche sehen können, tat es aber nicht. Ich war noch nicht bereit, über meinen Schatten zu springen.
Schließlich, 2011, siegte meine journalistische Neugier. Ich beschloss, dem Thema »Kriegstrauma und Demenz« für eine Hörfunksendung nachzugehen und besuchte dazu Alteneinrichtungen. Und dann? Nicht Schrecken und Ohnmachtsgefühle überfielen mich, sondern etwas völlig anderes geschah. Ich begann zu staunen. Nirgendwo habe ich so viel Kreativität angetroffen wie in der Fürsorge für Menschen mit Demenz. Es kam mir vor wie eine stille Revolution.
Wie war das möglich? Ohne Zweifel hatte ich es bei meinen Gesprächspartnern mit Ausnahmepersönlichkeiten zu tun. Dies ergab sich aus der Thematik: Kriegstrauma, Alter, Demenz, gleich drei Tabus. Nur wenige Menschen sind dafür empfänglich. Sie müssen in der Lage sein, einen Traumatisierten, der sich sprachlich nicht mehr ausdrücken kann, in seinen Ängsten und seiner Traurigkeit wirklich wahrzunehmen. Sensibilität allein reicht nicht. Auch biografisches und historisches Wissen ist erforderlich. Vor allem aber Zeit. Es muss im Berufsalltag auch Phasen des Verweilens, des Innehaltens geben. Menschen, die in der häuslichen oder stationären Altenpflege, in Krankenhäusern, in Arztpraxen oder in der Seelsorge arbeiten, brauchen Zeit, um auszuprobieren, in welcher Weise ein verwirrter Mensch in einer bestimmten Situation beruhigt und getröstet werden kann.
Ein lösbares Problem
Meine Gespräche und meine Besuche in Alteneinrichtungen vermittelten mir vor allem eines: Es gibt unzählige gute Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Demenz. Wir haben es hier keineswegs mit einem unlösbaren Problem zu tun. Die Richtung ist bekannt. Wir müssen ihr nur folgen. Die Forschungsergebnisse machen Mut. »Es mangelt uns nicht an Wissen darüber, was Menschen mit Demenz brauchen, was ihre Bedürfnisse sind, was ihnen guttut«, sagt der Pflegeexperte Christian Müller-Hergl. »Aber die Rahmenbedingungen der Langzeitpflege machen es kaum möglich, dieses Wissen in die Praxis zu überführen. Die Schere zwischen dem, was man weiß und dem, was üblicherweise machbar ist, geht immer weiter auseinander.«
Von Pionieren lernen
Auch das Engagement für Aidskranke hat klein angefangen, mit einer Handvoll Leute. Das war in den 1980er Jahren, auf dem Höhepunkt der Aidshysterie und der Angst vor Ansteckung. Damals gab es ernst gemeinte Vorschläge, wonach HIV-Infizierte tätowiert oder in Lager gesteckt werden sollten. Es wurde der flächendeckende Aidstest für alle deutschen Erwachsenen gefordert. Bekanntlich kam es ganz anders.
Eine neue gesellschaftliche Formation, die Aidshilfe, rückte die Menschenrechte in den Vordergrund und beendete die Diskriminierung von Aidskranken. Aufklärung, neue Medikamente, ein Umdenken im Gesundheitswesen, das Entstehen von Selbsthilfegruppen führten zu einem Ergebnis, auf das wir heute stolz sein können. In Hinblick auf den Umgang mit Demenzkranken könnte Ähnliches geschehen. In absehbarer Zeit könnte sich eine weitere starke Bürgerbewegung entwickelt haben, und es würde sich herausstellen, dass meine Gesprächspartner zu den Pionieren gehören.
ERSTES KAPITEL»DAS RECHT DER ALTEN AUFEIGENSINN«
Wurstscheibe als Brillentuch
Mit seinem Gedicht »Stufen« schrieb sich Hermann Hesse in die Herzen der Deutschen. Es wird viel zitiert, besonders die letzten beiden Zeilen: »Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden … Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!« – Des Lebens Ruf hört auch dann nicht auf, wenn einem Menschen alles abhandengekommen ist, was unserem Verständnis nach zu einem erfolgreichen Leben gehört: Autonomie, Kompetenz, Rationalität, Mobilität, Sprache.
Was brauchen Menschen mit Demenz? Erich Schützendorf, seit 35 Jahren als Aufklärer, Impulsgeber und Ausbilder in der Altenpflege unterwegs, sagt: »Den Begriff Demenz mag ich eigentlich nicht. Die Menschen entwickeln sich vom Verstande weg und entdecken neue Welten.« Er schrieb Bücher mit so schönen Titeln wie »Das Recht der Alten auf Eigensinn« und »In Ruhe verrückt werden dürfen«. Eine seiner Lieblingsgeschichten, erzählt im weichen rheinischen Tonfall, geht so: Er sitzt mit einer alten Heimbewohnerin am Esstisch und beobachtet, wie sie mit einer Wurstscheibe ihre Brille putzt. Frau Schmitz ist sich ihrer Sache sicher, aber sie will für das, was sie tut, auch anerkannt werden. Das verrät ihr kurzer Blick auf den Mann neben ihr. Alles in Ordnung, der schaut sie bewundernd an. Also putzt sie das zweite Glas. Dann setzt sie die verschmierte Brille auf die Nase – und strahlt vor Freude. Was ihre Mimik deutlich macht: Frau Schmitz benutzt die von ihr neu erfundene Brille als Kaleidoskop, in dem sich das Licht bricht.
»Die meisten Pflegekräfte haben natürlich etwas ganz anderes im Blick«, sagt Schützendorf. »Sie denken: Um Gottes Willen, das ist würdelos. Das darf ich doch nicht zulassen, wenn die einer so sieht! Also wird die Scheibe Wurst sofort entsorgt, die Brille geputzt, auf die Nase gesetzt: So, Frau Schmitz, jetzt können Sie wieder gucken. – Aber Frau Schmitz will so nicht gucken!«
Es gibt viele Missverständnisse im Umgang mit Menschen mit Demenz. Schützendorf erinnert an das Entsetzen, das vor einigen Jahren durch die Medien ging, als bekannt wurde, dass der berühmte Tübinger Rhetorik-Professor Walter Jens nun, als altersverwirrter Mann, hocherfreut war, wenn ihm die Metzgereiverkäuferin ein Stück Wurst reichte. »Es wurde als entwürdigend empfunden. Im Sinne von: Kann ein bedeutender Mann tiefer sinken …« erläutert Schützendorf. »Niemand schaute auf die Frau hinter der Wursttheke«. Aber genau dieser Blick wäre aufschlussreich gewesen. Sie hatte das Herz auf dem rechten Fleck und erfasste intuitiv, womit sie ihrem betagten Kunden eine Freude machen konnte.
Es gibt das Umfeld, es gibt die Einrichtungen, es gibt die Familien, wo Alte in Ruhe verrückt werden dürfen und glückliche Phasen im Lebensabend genießen. Günstige Bedingungen herrschen dann, wenn Angehörige und Pflegekräfte den Fokus auf Defizite abgelegt und sich auf die Person, so wie sie ist, eingestellt haben. Und wenn sie ihre Arbeiten relativ entspannt erledigen können. Auf diese Weise entsteht ein Milieu, das täglich kleine Wunder ermöglicht – ein Klima, in dem sogar Familienbeziehungen heilen können. Ein Ehemann entwickelt eine wirkliche Fürsorge für seine Frau; ein Sohn entdeckt eine neue, tiefe Zuneigung zu seinem altersverwirrten Vater.
Brücken zu einer anderen Welt
Manchmal schenken uns Künstler berührende Einblicke. Der Film »Vergiss mein nicht« von David Sieveking über seine Mutter gehört dazu oder das Buch »Der alte König in seinem Exil« von Arno Geiger über seinen Vater. Menschen mit Demenz haben ihre eigene Sprache. Ob verbal oder nonverbal, sie reden »dementisch«, wie die Japaner sagen. Bei Familienmitgliedern geht es also darum, eine neue Sprache zu erlernen. »Da mein Vater nicht mehr über die Brücke in meine Welt gelangen kann, muss ich hinüber zu ihm gehen« schreibt Arno Geiger. Was ihn dort auf der anderen Seite erwartet und womit der Sohn nie gerechnet hätte, sind Geschenke der besonderen Art, es sind Reifeschritte. »Es gibt etwas zwischen uns, das mich dazu gebracht hat, mich der Welt weiter zu öffnen. Das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was der Alzheimerkrankheit normalerweise nachgesagt wird – dass sie die Verbindungen kappt. Manchmal werden Verbindungen geknüpft.«
Die Arbeiten des Schriftstellers Geiger und des Dokumentarfilmers Sieveking machen Mut, denn sie zeigen, wie Angehörige Zugang zur Welt der Altersverwirrten finden können. Der Musiker Purple Schulz ging noch einen Schritt weiter. Mit seinem Song und dem Video »Fragezeichen« versetzte er sich selbst in die Welt eines Mannes, der seine Orientierung in der Gegenwart verloren hat. Purple Schulz übernahm die Gestalt des Kranken, seine Verwirrtheit und seinen inneren Monolog, der eine grenzenlose Einsamkeit offenbart.
Was können wir Demenzpatienten geben, damit sie nicht in Leid und Apathie versinken? Was tun, damit sie sich weitgehend geborgen fühlen? Was mildert ihre Ängste, was tröstet sie?
Diese Menschen leiden vor allem dann, wenn sie in ihrem Anderssein nicht verstanden werden. Und sie blühen auf, wenn sie sich beachtet und respektiert fühlen, und wenn sie liebevoll begleitet werden. Bedarf es besonders glücklicher Umstände für entspannte, bereichernde Beziehungen, die es erlauben, gut miteinander in Kontakt zu sein? Hat die eine Familie Glück und die andere nicht? Oder ist es möglich, Einfluss zu nehmen? Wenn ja, wie können Familien auf andere Weise als bisher unterstützt werden? Ließe sich ein entsprechendes stationäres Pflegemilieu schaffen? Wenn ja, wer wäre dafür zuständig?
Gesundheitspolitiker und Pflegekassen können es offenbar nicht richten. Sie treten auf der Stelle, ihnen fehlt die Rückenstärkung aus der Bevölkerung. Zu viele Menschen weigern sich hinzuschauen. Die Solidarität mit Demenzerkrankten drückt sich vor allem in guten Worten für die Angehörigen aus. Das reicht aber nicht. Das gesellschaftliche Verantwortungsgefühl ist zu schwach. Es ist blockiert. Die Bevölkerung fühlt sich überfordert im Umgang mit einer Problematik, für die angeblich keine Lösung in Sicht ist. Doch die Blockade lässt sich auflösen, indem wir die Schreckensszenarien in unseren Köpfen nach und nach durch Bilder und Informationen ersetzen, die uns die übermächtige Angst vor Alzheimer nehmen.
Arbeitsauftrag Verwöhnen
Dabei hilft, wenn wir Menschen wie Carmen Hörter bei ihrer Arbeit zusehen. Nennt sie ihren Beruf, versteht kaum jemand, was sie macht. Sie ist Demenz-Clownin und tritt unter dem Namen Rosa auf. Rheinländer denken sofort an Karneval und stellen sich vielleicht vor, sie würde altersverwirrten Menschen Konfetti auf die Hand streuen. Gestandene Pflegekräfte aus Altenheimen reagieren skeptisch, wenn sie von ihr hören. Ihre Haltung dazu: Was hätten unsere Bewohner davon, wenn man sie bespaßt? Wir nehmen sie ernst – es handelt sich doch nicht um Kinder!
Carmen Hörter macht keine Spaßprogramme. Sie kommt nicht mit Tusch und Klamauk daher, wie wir es aus dem Zirkus kennen. »Ich bin dazu da, um die Heimbewohner zu verwöhnen«, sagt sie schlicht. In ihrer Rolle als Clownin Rosa versucht sie auf eine unglaublich ruhige, feinfühlige Art zu Menschen Kontakt aufzunehmen, deren Beziehungsfähigkeit Schaden genommen hat. Sie hat gelernt, auf die kleinsten Signale zu achten.
Als erste Deutsche hat sie sich über 14 Monate an der Theaterakademie »Stichting miMakkus« im niederländischen Eindhoven zur Demenz-Clownin ausbilden lassen. »Es gab eine sehr schwierige Aufnahmeprüfung«, erzählt sie. »Jeder der Bewerber musste sich auf die Bühne stellen, ganz allein, seinen Namen nennen, und sich fünf Minuten lang von wildfremden Menschen anstarren lassen.« Eine Gruppe von 20 blieb übrig. Nach der Abschlussprüfung bekamen nur sechs Demenz-Clowns ein Zertifikat. Alle zwölf Monate steht eine weitere Prüfung an. Es wird festgestellt, ob die erlernten Standards beibehalten wurden. Wenn nicht, geht das Zertifikat wieder verloren.
Carmen Hörter ist eine große dunkelhaarige Frau von Anfang dreißig, kinderlos. Sie hat ein offenes Gesicht mit einem schönen Lächeln. Lebhaft und völlig natürlich gibt sie Auskunft – selbst über eine Phase, in der sie sich in ihrer Arbeit als Clownin nicht wohl fühlte und keinen guten Kontakt zu Demenzerkrankten herstellen konnte. Das lag an ihrer seelischen Verfassung und hatte private Gründe. Über einige Wochen litt sie unter einer gedämpften Stimmungslage, die sich erst auflöste, als sie sich mit anderen Clowns darüber austauschte. Die kannten das Problem. Fazit: »Wir können die Heimbewohner nur erreichen, wenn wir mit uns selbst in einem guten Kontakt sind«.
»Auch Helden brauchen eine Pause«
In ihrem Arbeitsvertrag steht: Mitarbeiterin im sozialen Dienst. Ich erfahre, ihr erster Beruf als medizinisch-technische Assistentin in einer Arztpraxis habe sie nicht glücklich gemacht. Daher der Wechsel zu den katholischen Alten- und Pflegeheimen St. Josef im niederrheinischen Selfkant, der westlichsten Gemeinde Deutschlands. »Mein Chef hat mich eines Tages darauf angesprochen, ob ich nicht Clownin werden wolle«, erzählt sie. »Er meinte, das könnte etwas für mich sein«.
Auf den firmeneigenen Fahrzeugen wird mit dem Satz geworben: »Auch Helden brauchen eine Pause«. Dahinter steckt der Gedanke, dass alte Menschen ein Recht darauf haben, sich nach einem arbeitsreichen Leben auszuruhen. Eine Selbstverständlichkeit, sollte man denken, aber womöglich war es der Heimleitung wichtig, sich gegen die Folgen eines Mobilisierungskonzepts abzugrenzen, das in den 1980er Jahren die Alteneinrichtungen nachhaltig erschütterte. Deren Bewohner mussten sich anstrengenden Fitnessprogrammen unterziehen. Inzwischen ist man davon wieder abgerückt. Aber vielleicht hat es sich in der Bevölkerung noch nicht herumgesprochen, wie altersgerechte Bewegung aussehen sollte. »Auch Helden brauchen eine Pause« könnte man also als einen Appell an die Kinder von Alten verstehen, die ihre Eltern mit falschen Vorstellungen bedrängen. Pflegeexperte Schützendorf gibt zu bedenken: »Viele glauben wirklich, dass Fitness davor schützt, alt und gebrechlich zu werden. Im Sinne von: Turne, turne – bis zur Urne!«
Aber natürlich brauchen Helden Abwechslung. Carmen Hörters Arbeitstag beginnt damit, dass sie jeden einzelnen der 80 Heimbewohner begrüßt. Dann nennt sie die Angebote, die an diesem Wochentag anstehen. Tanzen oder Bingo, Kegeln oder Singen, Sitzgymnastik, Gedächtnistraining, Aromatherapie, ein Konzert oder ein Ausflug.
Ein riesengroßes kleines Mädchen
Einmal in der Woche verwandelt sich Carmen Hörter in die Clownin Rosa – gezielt für die Menschen auf Demenzstationen. Rosa kommt überraschend. Ihr Erscheinungsbild ist das eines riesengroßen kleinen Mädchens in einem riesengroßen Kinderkleid, das einen riesengroßen Puppenwagen schiebt. Woran erinnert mich das? Nach einer Weile fällt es mir ein: an das Riesenkaninchen aus »Alice im Wunderland«. Klar, dass Rosas Kleid rosa ist; auf dem Rücken kleine Flügel, einer Libelle nachempfunden. Das geschminkte Gesicht hat melancholische Clownsaugen und natürlich eine rote Nase.
Das wichtigste Gebot eines Clowns in der Demenzpflege lautet: Auf keinen Fall einen Plan haben, wenn man einen Raum mit Heimbewohnern betritt. »Sie haben uns in der Ausbildung eingeschärft, nie dort fortzufahren, wo man beim letzten Mal gute Erfolge hatte«, sagt Carmen Hörter. »Im Sinne von: Frau M. hat gut reagiert auf diese bunten Schals, das probier ich heute wieder.« Stattdessen darauf achten, welcher alte Mensch – wie versteckt auch immer – ihren Auftritt bemerkt.
Der erste Mann, der sich als Demenzclown einen Namen machte, war der Schweizer Marcel Briand. Von ihm stammt der Satz: »Menschen mit Demenz und Clowns sind Seelenverwandte. Auch der Clown verhält sich auffällig und hat Probleme mit der Rationalität.« Die erste deutsche Clownin definiert ihr Rollenverständnis so: »Ich sehe mich als die gute Freundin, die mit den alten Menschen eine gute Zeit haben möchte. Die Freundin, die überlegt, was ihnen Freude machen könnte.«
Aber nicht überall, und schon gar nicht zu jeder Zeit, ist eine gute Freundin erwünscht. Die erste Frau, mit der Rosa stumm den Kontakt sucht, ist schlecht gelaunt. Sie hat ihrer Wohngruppe den Rücken gekehrt und sich in der Sitzecke neben dem Etagenaufzug niedergelassen. Sie ruft: »Geh fort! Du sollst hier nicht bleiben«. Die Clownin mit der roten Nase und den melancholischen Augen bewegt sich langsam. Ihre Behutsamkeit erinnert daran, wie man sich einem Vogel nähern sollte, ohne ihn aufzuschrecken.
Rosa nimmt auf der anderen Seite des niedrigen Tisches Platz, mit viel Abstand. Doch ihrem Gegenüber ist auch das zu nah. Sie wiederholt, diesmal rabiater: »Geh fort!« Rosas Oberkörper weicht ein wenig zurück, dann holt sie aus ihrem Kinderwagen eine kleine Dose, öffnet den Deckel. In der Dose liegen Bonbons. Rosa stellt sie auf die Mitte des Tisches, mit einem Gesichtsausdruck, der sagt: »Gucken Sie mal, was ich hier Schönes für Sie mitgebracht habe …« Die Frau beugt sich vor, begutachtet die Bonbons in der Dose, dann weist sie das Angebot angewidert zurück. Das Gleiche geschieht mit einer Apfelsine. Fünf, vielleicht auch sieben Minuten dauert diese Szene. Rosa kommt keinen Schritt weiter. Sie verabschiedet sich.
Sanfte Magie verscheucht den Alltag
Nebenan in der Wohngruppe ist es eng, der überdimensionierte Puppenwagen eckt überall an. Zehn Frauen und zwei Männer sitzen an Tischen in einem nüchtern möblierten Raum. Doch mit dem Auftauchen der Clownin verändert sich seine Atmosphäre; eine sanfte Magie hat den Alltag verscheucht. Es wird ruhiger, die Mitarbeiterinnen senken die Stimmen, sie bewegen sich langsamer, bleiben stehen, lächeln. Zeit des Innehaltens. Einige Bewohnerinnen begrüßen Rosa, durchaus mit Zeichen des Wiedererkennens, andere schauen überhaupt nicht hin.
Die Clownin setzt sich an den größten Tisch. Die Frau rechts neben ihr erweist sich als wohlwollend und gesprächig. Sie unterhält sich mit dem Stoffhund, einer Handpuppe aus dem Fundus in Rosas Puppenwagen. Die Frau fragt: »Weißt du, wo wir hier Wurst herkriegen?« Der Hund schüttelt den Kopf. »Nein?« Der Hund schüttelt erneut den Kopf. »Tja, dann haben wir beide keine Ahnung.«
Danach wendet sich Rosa einer Bewohnerin zu, die ohne Pause im Raum hin und her geht. Eine Frau mit »Lauftendenz«, wie es in der Fachsprache der Demenzpflege heißt. Blickkontakt ist nicht möglich. Die alte Dame hat eine Tischdecke bei sich, die hält sie an einem Zipfel fest. Als sie in Rosas Nähe kommt, ergreift diese einen anderen Zipfel und steht auf. Tatsächlich, die Frau findet Gefallen an dem Kontakt. Sie zieht die Clownin an der Tischdecke hinter sich her, kreuz und quer durch den Raum, so lange, bis sie keine Lust mehr hat und die Tischdecke loslässt.
Der Fuchs sagt: »Zähme mich!«
Rosa sucht nun die Nähe zu einem Mann im Rollstuhl. Der Bewohner bewegt sich nicht, wirkt wie aus Stein gemeißelt. Sein Oberkörper ist eingefallen. Er blickt auf den Boden. Keine Reaktion auf die achtsamen Angebote, nicht auf den Hund, nicht auf einen bunten, durchsichtigen Schal. Sein Kopf bleibt gesenkt. Es zeigt sich, dass die »gute Freundin« alle Zeit der Welt zu haben scheint. Sie harrt an seiner Seite aus, unaufdringlich und geduldig.
»Der kleine Prinz« geht mir durch den Sinn – seine Begegnung mit dem Fuchs. Der hatte sagt: »Wenn du einen Freund willst, so zähme mich!« »Was muss ich da tun?« fragte der kleine Prinz. »Du musst sehr geduldig sein«, antwortete der Fuchs.
Schließlich legt Rosa die Walze einer kaputten Spieluhr auf den Tisch. Mit dem Finger erzeugt sie Töne, leise Töne, immer wieder. Damit stößt sie zum ersten Mal auf Resonanz. Der Mann horcht, seine Mundwinkel heben sich ganz leicht. Der Hauch eines Lächelns, das langsam, ganz langsam deutlicher wird. Man kann dabei zusehen, wie er Vertrauen fasst. Rosa will ihm helfen, selbst Töne zu erzeugen. Behutsam führt sie seine Hand, seinen Finger. Es ist die erste körperliche Berührung. Alles geschieht bedächtig. Man hat ja Zeit. Und schließlich ist es soweit: Der Mann im Rollstuhl wird aktiv. Nun schafft er es ganz allein, der Spieluhr Töne zu entlocken. Das macht er wieder und wieder. Er lächelt froh, sein Oberkörper beginnt sich aufzurichten. Sein Blickfeld erweitert sich, er erkennt den Hund und streichelt ihn. Nun wirkt er völlig wach. Er schaut Rosa froh in die Augen. Und als die sich irgendwann anderen Bewohnerinnen zugewandt hat, bewegt er den Rollstuhl zum Tisch und blättert dort in einer Zeitschrift. Er macht einen zufriedenen Eindruck.
Grimassen schneiden
Die Clownin hat sich zu einer Gruppe von drei Frauen gesellt. Stumm reagiert sie auf die Tischdekoration, eine einzelne, schon etwas angewelkte Blume. Sie hält die Vase den Frauen vor die Nase, keine mag an der Blume riechen. Eine Bewohnerin empfindet das Angebot als Zumutung und schneidet eine Grimasse. Rosa schneidet ebenfalls eine Grimasse. Die Frau schneidet wieder eine Grimasse. So geht es eine Weile hin und her. Plötzlich fängt Rosa an zu singen: »Wenn alle Brünnlein fließen …« Sie singt schräg, grässlich anzuhören – die Frauen am Tisch sind empört. Auch sie wollen singen, aber doch nicht so! Die Clownin zeigt sich einsichtig und holt ihre »schöne« Stimme hervor. Sie singen gemeinsam und schaffen drei Strophen. Weitere Lieder folgen.
Schließlich ist es Zeit zu gehen und Rosa stimmt »Auf Wiedersehen« an. Während sie ihren sperrigen Puppenwagen in Richtung Ausgang schiebt, schenkt ihr eine Frau noch ein Abschiedslied: »Muss i denn zum Städele hinaus«. Und der Mann im Rollstuhl winkt ihr hinterher.
Nach ihrem Auftritt, als aus der Clownin wieder Carmen Hörter geworden ist, haben wir Gelegenheit zum Austausch. Wie hat sie gespürt, dass der alte Bewohner trotz seiner Versunkenheit ansprechbar war? »Herr G. hatte Weitblick«, erklärt sie mir. »Er hielt zwar den Kopf gesenkt, aber nicht ganz, er hat seitlich zu mir hingeschaut. Manchmal blicken Menschen auf ihre Füße, und manchmal stelle ich einen Fuß in ihre Nähe. Ich spiele ein bisschen damit, und dann kann es gelingen, dass eine Reaktion kommt. – Wenn jemand nach und nach den Kopf hebt und Blickkontakt aufnimmt, dann habe ich ihn.«
Wir kommen auf ihre Einstellung zu Nähe und Distanz zu sprechen. »Körperliche Nähe geschieht nur dann, wenn eine Vertrauensbasis geschaffen ist«, sagt sie. »Bei Frau P. war das so. Erinnern Sie sich? Sie saß in einer Ecke, war sehr traurig, weinte, sie hat sich ein altes Fotoalbum angeschaut und die Trennseite zerknüllt. Aber sie hat mich wahrgenommen, als ich auf sie zukam. Ich habe sie in den Arm genommen, weil sie weinte. Es hat ihr gut getan.«
Eine erstaunliche Parallelwelt
Ich hatte durchweg inspirierende Begegnungen, mit Pflegekräften, Ehrenamtlichen, Beratern, Ausbildern, mit einzelnen Angehörigen. Auch Künstler, die mir ihre Projektarbeiten erläuterten, gehörten dazu. Sie alle öffneten mir die Augen. Sie verhalfen mir zu Einblicken in eine erstaunliche Parallelwelt, an der sie täglich weiterbauen. Hier hat die Zukunft einer guten Demenzpflege schon begonnen. Wir haben es keineswegs mit einer unlösbaren gesellschaftlichen Aufgabe zu tun.
Natürlich fragte ich mich, warum ich bis dato kaum etwas davon wusste. War ich blinder gewesen als der Rest der Bevölkerung? Oder gehörte ich mit meiner Haltung des Vermeidens zur Mehrheit? Dass es diese Parallelwelt gibt, wird ja keineswegs verschwiegen, nur wird es nicht an die große Glocke gehängt. Auf Seite eins der Tageszeitungen steht darüber nichts. Weiter hinten allerdings, im Lokalteil, wird umfangreich über die Aktivitäten der Netzwerke von Angehörigen, Ehrenamtlichen, Nachbarschaftshilfen und Beratungsstellen berichtet. Es wird geworben für Benefizveranstaltungen, man erfährt von Konzerten und anderen Kulturangeboten für Betroffene. Die Nachmittagsprogramme des Fernsehens senden kluge und vor allem einfühlsame Kurzbeiträge über neue Ansätze in der Demenzpflege, über die Beratung von Angehörigen. Alles in allem gute Nachrichten.
Erleben wir das Thema in den großen Talkshows der Abendprogramme, wird der Zuschauer am Ende mit einer völlig anderen Botschaft entlassen: Die Lage ist hoffnungslos! 1,4 Millionen Demenzkranke sind es heute – 2030 werden es schon 2,5 Millionen sein. Eine Lawine kommt auf uns zu.
Nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen
Bleibt etwas anderes als Resignation? Durchaus. Wer weiß denn heute so genau, wie die Lebensbedingungen und Einstellungen im Jahr 2030 sein werden? Innerhalb von 15 Jahren könnte sich vieles zum Guten gewendet haben. Wir hätten vielleicht gelernt, besser mit Altersverwirrten umzugehen. Die Alzheimer Gesellschaft und andere Netzwerke wären mit ihren Angeboten flächendeckend in allen Gemeinden anzutreffen, so selbstverständlich wie Kindergärten. Genauso ist es möglich, dass wir als Gesellschaft unser überdrehtes Lebenstempo gedrosselt und uns dadurch den Menschen mit Demenz etwas angenähert hätten.