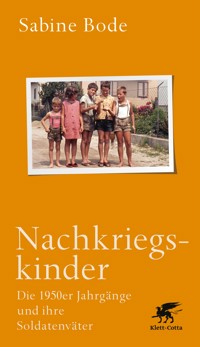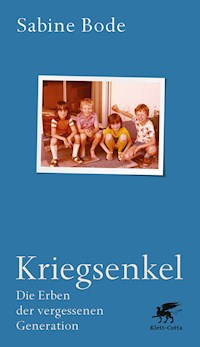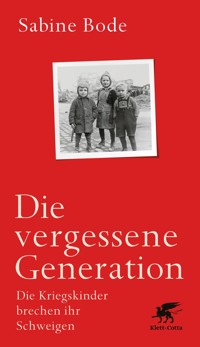13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einer Kultur, in der Trauer keinen Platz hat. Dabei kann der unterdrückte Schmerz schlimmen Folge für die körperliche und seelische Gesundheit der Hinterbliebenen haben. Dieses Buch erzählt von Menschen, die sich sehr bewusst von ihren Toten verabschiedet und dabei ganz persönliche Formen der Trauer gefunden haben: Sie zeichneten die verstorbene Mutter, legten der verunglückten Tochter letzte Gaben in den Sarg, sangen dem Vater noch mal seine Lieblingslieder. Die Bestsellerautorin Sabine Bode und der Bestatter David Roth schenken uns ein bewegendes Buch voller inspirierender Ideen, das zeigt, wie man angesichts des Todes zu neuer Lebensfreude gelangen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorenTitelImpressumVorwortSABINE BODE/DAVID ROTHWarum wir dieses Buch geschrieben habenErstes Kapitel: Die Trauer lebenSABINE BODEDie Geburt war ein FestPlötzlicher KindstodDas Kind blieb unerreichbarDie Toten lieber lebend in Erinnerung behalten?Von jedem etwas mitgebenKinderlieder auf dem FriedhofJeder trauert auf seine ArtWo finden Hinterbliebene Hilfe?DAVID ROTH»Wir lassen uns unsere Toten stehlen!«Fritz Roth und seine Revolte gegen die Sterbekultur in DeutschlandZweites Kapitel: Abschied von der EntmündigungSABINE BODEVom Schreiner zum BestatterDer Tod wird trivialisiertDie Angst, etwas falsch zu machenHorrorszenarienDie Illusion als ein Wert an sichKleine Schritte der VeränderungOffen trauern: ein großes RisikoSchockierte VerwandteDie Kraft uralter RitualeStreit mit dem PfarrerEin Anruf von der PolizeiWenn aus Toten Vermisste werdenKein Grab – und doch nicht vergessenDAVID ROTHFriedhöfe für die Toten und die LebendenWAS IST DEN MENSCHEN WIRKLICH WICHTIG? – Kunstprojekt »Ein Koffer für die letzte Reise«Drittes Kapitel: Wenn die Seele nicht hinterherkommt …SABINE BODEAnfang und EndeJeder Zyklus braucht einen AbschlussTrauerfeindliche GesetzeEin Abschied im KrankenhausDer Mythos vom LeichengiftVor Totenflecken läuft man nicht davonEin Raum für das NamenloseDAVID ROTHTrauer ist eine starke KraftViertes Kapitel: Trauergruppen und NeubeginnSABINE BODEEndlich wieder tanzen!Eine Leiche wird beschlagnahmtTrauer ist keine KrankheitTrauerkreiseDen Wüstenweg zu Ende gehenLernen, üben, hoffenZerreißprobe für eine FamilieEine hilfsbereite NachbarschaftWie Freunde helfen könnenDAVID ROTHBilanz ziehen – das Leben neu ordnenFünftes Kapitel: Eine neue Kultur, eine neue GemeinschaftSABINE BODELachen im BestattungshausZweitausend Jahre TotenkultMärchen über Leben und SterbenTrauer kann Gemeinschaft stiftenEin Sarg voller AbschiedsgeschenkeDAVID ROTHDer Tod, das Leben und die KunstSTELL DIR VOR, DU BIST TOT – Kunstprojekt »Das letzte Hemd«Sechstes Kapitel: Der Tod und das GlückSABINE BODEÜber den eigenen Schatten springenEin glücklicher TagMit dem Tod lebenGemeinsam Abschied nehmenBleibende BindungenLiteratur, Quellen und LinksÜber dieses Buch
Wir leben in einer Kultur, in der Trauer keinen Platz hat. Dabei kann der unterdrückte Schmerz schlimmen Folge für die körperliche und seelische Gesundheit der Hinterbliebenen haben. Dieses Buch erzählt von Menschen, die sich sehr bewusst von ihren Toten verabschiedet und dabei ganz persönliche Formen der Trauer gefunden haben: Sie zeichneten die verstorbene Mutter, legten der verunglückten Tochter letzte Gaben in den Sarg, sangen dem Vater noch mal seine Lieblingslieder. Die Bestsellerautorin Sabine Bode und der Bestatter David Roth schenken uns ein bewegendes Buch voller inspirierender Ideen, das zeigt, wie man angesichts des Todes zu neuer Lebensfreude gelangen kann.
Über die Autoren
Sabine Bode, Jahrgang 1947, ist Journalistin und Buchautorin. Bekannt wurde sie mit ihren Büchern DIE VERGESSENE GENERATION, NACHKRIEGSKINDER und KRIEGSENKEL. Frau Bode lebt in Köln.
David Roth, Jahrgang 1978, ist Bestatter und Trauerbegleiter. Als Mitglied der Geschäftsführung in dem Bestattungshaus Pütz-Roth bemüht er sich das Anliegen seines Vaters, Trauer individuell zu leben, weiterzuführen. Er lebt in Bergisch-Gladbach.
SABINE BODEDAVID ROTH
Das letzte Hemd hat viele Farben
Für einen lebendigenUmgang mit dem Sterben
BASTEI ENTERTAINMENT
Dieses Buch basiert auf dem 1998 im Gustav Lübbe Verlag erschienenen Bestseller von Sabine Bode und Fritz Roth »Der Trauer eine Heimat geben. Für einen lebendigen Umgang mit dem Tod«. Nun wird es in einer grundlegend überarbeiteten Version neu aufgelegt. An die Stelle des am 13.12.2012 verstorbenen Firmengründers und Visionärs Fritz Roth tritt dessen Sohn David Roth, der das Bestattungsunternehmen mit seiner Schwester Hanna Roth leitet.
Die Fotos der Bildteile stammen aus den Ausstellungen
»Ein Koffer für die letzte Reise« (© Pütz-Roth) und »Im letzten Hemd« (© Thomas Balzer). Näheres zu diesen Ausstellungen lesen Sie auf den Seiten 192 bis 194. Portraitiert für die Ausstellung »Im letzten Hemd« wurden in der Reihenfolge ihres Auftretens: Angelika Beyer, Daniel Karabatakis, Janja Milosevic und Stephan Michels.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textbearbeitung: Karin Beiküfner, Düsseldorf
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic / shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5611-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort
Sabine Bode/David Roth
WARUM WIR DIESES BUCH GESCHRIEBEN HABEN
Wir leben in einer paradoxen Kultur. Tagtäglich erfahren wir von Tod, Schmerz und Trauer aus den Nachrichten, tagtäglich wird auf den Bildschirmen, in Fernsehkrimis und Computerspielen massenhaft gelitten und gestorben. Zugleich haben wir im realen Leben Tod und Trauer aus unserem Alltag verdrängt. Friedhöfe verwahrlosen, Bestattungen werden kostengünstig, normiert und versachlicht abgewickelt. Für Trauerfeiern vergeben die Friedhofsämter Zwanzig- bis Dreißig-Minuten-Slots, dann müssen Predigt oder die warmen Worte des Trauerredners über die Bühne gegangen sein. Trauernde bleiben mit ihrem Leid und Schmerz allein. Gegen diese Kultur wendet sich dieses Buch.
Seit vor mehr als zwanzig Jahren das erste gemeinsame Buch von Sabine Bode und Fritz Roth erschien, hat sich manches verändert. Wir sind, weit stärker als frühere Generationen, eine mobile und flexible Gesellschaft. Viele Menschen leben nicht mehr an dem Ort, wo ihre Vorfahren vielleicht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte lang beigesetzt wurden. Dank Internet, Smartphone und sozialer Medien haben sich die Informations- und Wahlmöglichkeiten in vielen Lebensbereichen vervielfacht. Auch im Bestattungsgewerbe und in der Trauerbegleitung sind neue Angebote entstanden, die sich von den überlieferten Traditionen und den damit verbundenen Ritualen entfernen.
Wir haben uns die Frage gestellt, was geblieben ist von unseren Beobachtungen, der Kritik und dem Anliegen, Tod und Trauer wieder einen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu geben. Was hat sich weiterentwickelt in Deutschland, in der Bestattungskultur, in den Köpfen der Menschen? Darauf haben wir eine Antwort gesucht und uns entschieden, das Buch »Der Trauer eine Heimat geben« neu zu veröffentlichen und seine Grundgedanken mit den Erfahrungen einer jüngeren Generation zu verknüpfen.
Im »Haus der menschlichen Begleitung« ist vieles so geblieben, wie es Fritz Roth bestimmt hat. Aber ein Museum ist es nicht, im Gegenteil. Es ist ein Ort, an dem Menschen ihre Trauer leben können, und es ist ein lebendiger Ort der Begegnung, um sich mit Tod, Abschied und Trauer aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu befassen, um Veränderungen zu bewirken und »dem Tod einen Platz im Leben und in der Mitte der Gesellschaft (zurück-) zu geben«.
Dem Tod im Medium der Kunst zu begegnen ist ein Weg, ihm im Leben Raum zu geben. In Zeiten allgegenwärtiger Bilder besteht die Gefahr, sich auch an die Bilder eines fremden Todes zu gewöhnen. Unser aktuelles Kunstprojekt »Im letzten Hemd« greift den Kontrast zwischen den alltäglichen Bildern des fremden und des eigenen Todes auf. Früher wurde das letzte Hemd in den Schrank gelegt, als Memento mori, das den Gedanken an die eigene Sterblichkeit wachhielt. Das Totenhemd des 21. Jahrhunderts konkurriert mit einer Flut von Bildern und Botschaften, der es aus dem Schrank heraus nicht gewachsen ist. Wir haben fünfzig Menschen jeden Alters, aus allen Schichten und Lebenswelten eingeladen, sich in ihrem persönlichen »Letzten Hemd« fotografieren zu lassen. Und sich so auf besondere Art mit der eigenen Sterblichkeit zu konfrontieren – »Stell dir vor, du bist tot«.
Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, wie groß das Bedürfnis nach stimmigen Abschiedsritualen anstelle einer genormten, gefühlsarmen Begräbniskultur ist. Was Letzterer entgegengesetzt werden kann, davon handelt dieses Buch. Es beschreibt, wie Hinterbliebene ihren individuellen Abschied gestaltet haben, welche Gedanken und Gefühle sie dabei bestimmt haben – und dass sie gelegentlich damit auch auf Unverständnis gestoßen sind.
Dieses Buch erzählt von den persönlichen Erfahrungen, die Trauernde gemacht haben. Einige von ihnen haben uns ihre Geschichte gern unter ihrem richtigen Namen erzählt, andere, in diesem Buch mit einem * gekennzeichnete Personen, erhielten auf Wunsch eine neue Identität. Durch die Begegnung mit diesen Menschen, die offen über ihre Empfindungen sprachen, hat sich ein wertvoller Erfahrungsschatz angesammelt, der andere Wege der Trauerkultur aufzeigt.
Dieses ist jedoch kein durch und durch trauriges Buch. Genauso wenig wie das »Haus der menschlichen Begleitung« ein düsteres Trauerhaus ist, sondern eine helle, freundliche Atmosphäre schafft, die zum Leben ermutigen möchte.
Wir bitten die Leserinnen und Leser uns nachzusehen, dass auf die explizit weibliche Ausformulierung verzichtet wurde. Abschließend danken wir allen Menschen, die den Mut hatten, in der Trauer neue Wege zu gehen, und die uns ihre Erfahrungen erzählt haben, damit wir sie weitergeben können. Dank auch an alle anderen, die mitgeholfen haben, damit dieses Buch entstehen konnte.
Erstes Kapitel
Die Trauer leben
Das Leben bricht uns alle, und danach sind viele an den gebrochenen Stellen stärker.
Ernest Hemingway
Sabine Bode
DIE GEBURT WAR EIN FEST
Noch in den siebziger Jahren gehörte es zum Credo der modernen Medizin, dass einer Mutter nach der Entbindung vor allem Erholung zu gönnen sei. Ruhe sollte sie haben – auch Ruhe vor ihrem Kind. Das Neugeborene durfte Mama nur zu den Stillzeiten besuchen. Die Brust gab es nicht dann, wenn das Kind Hunger hatte und schrie, sondern nach einem strengen Plan, der dem Krankenhausrhythmus angepasst war. Der Babytransport auf Rolltischen gehörte zum vertrauten Bild einer Wöchnerinnenstation. Da lagen die Winzlinge wie Brote nebeneinander, sorgsam verpackt. Wie Rationen wurden sie auf die verschiedenen Zimmer verteilt.
Das ging viele Jahrzehnte so und wurde von fast allen Beteiligten als normal empfunden. Ruhe, Hygiene und medizinische Kontrolle hatten absolute Priorität. Natürlich gab es auch Mütter, die sich für ihre Entbindung eine intime Atmosphäre wünschten, die bei früheren Geburten unter dem plötzlichen Verschwinden ihres Babys sehr gelitten hatten. Aber nur wenige trauten sich, ihr Kind zu Hause auf die Welt zu bringen. In der Regel warnten die Ärzte vor einer Hausgeburt.
Dann setzte langsam das Nachdenken darüber ein, dass die Nähe zwischen Mutter und Neugeborenem womöglich einem natürlichen Bedürfnis entsprechen könnte. Auf Tagungen und in der Fachpresse wurde immer häufiger das Krankenhauszimmer für beide, für Mutter und Kind, gefordert. Den meisten Geburtsmedizinern war diese Vorstellung so fremd, dass sie sich ein englisches Wort dafür leihen mussten: »rooming in«. Heute sind Mutter-und-Kind-Stationen Standard in jedem Krankenhaus. Außerdem entscheiden sich seit den achtziger Jahren wieder mehr Eltern für eine Hausgeburt. Manchen Paaren fällt es schwer, sich über das Für und Wider zu einigen.
Katrin und Daniel Lambert hatten damit keine Probleme. Ihre Tochter war in einer Klinik zur Welt gekommen. Sie wussten also, was bei einer Entbindung auf sie zukam. Als das zweite Kind unterwegs war, stand für die jungen Eltern fest: Das kriegen wir zu Hause.
Paul wurde an einem Oktobermorgen geboren. Seine Mutter – »Ich war sofort wieder fit« – ging noch am selben Vormittag in den Garten, mit Paul auf dem Arm. Ihr Sohn sollte die Sonne sehen, und alle anderen Hausbewohner sollten den Sohn sehen. An diesem Morgen nahm das Staunen kein Ende: »Gestern noch in Katrins Bauch, heute mit uns am Kaffeetisch – unfassbar!«
Pauls Geburt war ein Fest.
Das Neugeborene entwickelte sich zu einem rundum zufriedenen Baby, das überall gute Laune verbreitete. Seine Fröhlichkeit war einfach ansteckend. Die dreijährige Schwester liebte Paul sehr. Er war ein in sich ruhender kleiner Kerl, der seine Umgebung genau beobachtete und in seiner Winzigkeit alle Gelassenheit dieser Welt auszustrahlen schien. Seine Eltern nannten ihn »unseren kleinen Buddha«.
PLÖTZLICHER KINDSTOD
Drei Monate später starb Paul. Die Eltern fanden ihn am Morgen leblos neben sich in ihrem Bett. Der Notarzt kam. Sanitäter rannten durch das Haus. Der Arzt, offenbar unsicher in seiner Diagnose, ließ das Kind in eine Klinik bringen. Tief in ihrem Inneren ahnte Katrin, dass jede Hilfe zu spät kommen würde, aber sie schob diese Vorstellung weit von sich. Wie jede Mutter wusste sie Bescheid über das unheimliche Sterben, dessen Ursache unbekannt ist und das deshalb die hilflose Bezeichnung »Plötzlicher Kindstod« trägt. Aber während sie dem Krankenwagen hinterherfuhr, weigerte sie sich, das Schlimmste anzunehmen: Mag ja sein, es trifft fünf von tausend Kindern, aber doch nicht mein eigenes … Stattdessen malte sie sich aus, wie sie beim Betreten des Krankenhausflurs ihr Baby schon von weitem schreien hören würde. Es hatte lange nichts getrunken. Es musste doch inzwischen Hunger haben …
Aber Paul blieb stumm.
Kaum etwas erschüttert Menschen so sehr wie die Nachricht, dass Eltern plötzlich ihr Kind verloren haben. Aber die meisten Berichte enden an dieser Stelle. Über die Beerdigung wird kaum noch ein Wort verloren. Allenfalls, wenn die Lokalpresse darüber berichtet, erfährt man von »ergreifenden Ausbrüchen von Schmerz und Trauer« angesichts des kleinen Sarges. Normalerweise findet die Bestattung im engsten Kreise statt. Nicht unbedingt, weil alle Eltern es so wünschen und einen entsprechenden Hinweis in der Todesanzeige geben, sondern weil viele Menschen glauben, mit der eigenen Zurückhaltung, sprich Abwesenheit am Grab, sei den Eltern am meisten gedient.
Katrin und Daniel Lambert waren keineswegs dieser Meinung. Die Eltern von Paul wollten bei der Beerdigung alle versammeln, die ihren kleinen Sohn gekannt hatten, Erwachsene wie Kinder. Um ihre Haltung nachvollziehen zu können, ist es wichtig, etwas über eine Zeitspanne zu erfahren, die in den Berichten über Sterben und Trauer üblicherweise unerwähnt bleibt: die Tage zwischen dem Todesereignis und der Beerdigung.
Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Hinterbliebene eines plötzlich Verstorbenen zunächst unter einer Art Schock stehen, dass sie den Verlust noch gar nicht erfassen können. Dennoch sind viele Menschen durchaus in der Lage, große Mengen organisatorischer Arbeit zu bewältigen. Das geschieht rein mechanisch. Ohne groß nachzudenken, wird ein Programmpunkt nach dem anderen abgehakt. Gott sei Dank – so die vorherrschende Meinung. Es sei doch nur günstig, wenn man als Angehöriger stark beschäftigt ist mit Dingen, über die man plötzlich entscheiden muss und die es umgehend zu erledigen gilt, so dass man gar nicht richtig zur Besinnung kommt. Auf diese Weise könne man seine Kräfte schonen, um dann am Grab gefasst genug zu sein für die endgültig letzte Begegnung mit dem Menschen, der einem so viel bedeutet hat.
Auch den Eltern von Paul ging es zunächst nicht anders. Aber dann gelang es ihnen, innezuhalten und zu erkennen, was ihr eigentliches Bedürfnis war. Das machte sie bereit für etwas Neues, Unerwartetes, das mit Worten zunächst schwer zu beschreiben ist. In aller Ruhe, einen ganzen Tag lang, haben sie von ihrem toten Kind Abschied genommen. Für die Eltern lag darin eine tiefe geistige und emotionale Erfahrung, die für sie im Rückblick genauso kostbar ist wie Pauls Geburt. Was an diesem Wintertag geschah, wird einige Menschen vielleicht schockieren, andere dagegen anrühren. Wieder anderen wird es schwerfallen zu glauben, dass so etwas tatsächlich geschehen kann: dass die jungen Eltern beim Abschied in der Lage waren, sich an das große Glück zu erinnern, das mit Paul in ihr Leben getreten war. Ein Glück, das begann, als feststand, dass Katrin wieder schwanger war. Das Glück, das sich ankündigte, als ihre kleine Tochter das Ohr auf Mamas Bauch legte und erstmals die Herztöne des kleinen Paul vernahm.
DAS KIND BLIEB UNERREICHBAR
Nicht oft geschieht es, dass Eltern, die ihr Kind verloren haben, offen darüber sprechen, und noch seltener ist es, dass sie detailliert von den ersten Tagen nach dem Tod erzählen. Daniel und Katrin Lambert tun das, was vor allem deshalb überrascht, weil ihr Baby erst zwei Monate tot ist. Das Gespräch ist lebhaft, die Atmosphäre entspannt. Manchmal wird gelacht, manchmal geweint.
Tagelang mussten die Eltern warten, bis die »Leiche freigegeben wurde«, wie es im Amtsdeutsch heißt. Bei einem plötzlichen Tod wird stets die Kriminalpolizei eingeschaltet. Erst wenn ihre Ermittlungen abgeschlossen sind, entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob zur weiteren Klärung eine Obduktion nötig ist oder nicht. Paul starb kurz vor dem Jahresende. Ein langes Wochenende stand bevor, was das Warten für die Eltern auf qualvolle Weise verlängerte. Die Staatsanwaltschaft entscheidet nur werktags. Zumindest der Beamte, der für den Fall »Plötzlicher Kindstod« zuständig war, hatte die Not von Katrin und Daniel nicht im Blick, sonst hätte er sich aus eigenem Antrieb bei den Eltern gemeldet. Einen ganzen Tag lang, erinnert sich die Mutter, habe sie telefoniert, um in einem Labyrinth ungeklärter Zuständigkeiten und ihr unbekannter Bestimmungen dorthin zu gelangen, wo über das weitere Schicksal ihres Sohnes befunden wurde. Kurz vor Büroschluss bekam sie endlich den zuständigen Staatsanwalt ans Telefon, und sie erhielt die erlösende Nachricht, dass die Leiche freigegeben sei.
Zwei Tage vorher hatte ein Gespräch im Bestattungshaus stattgefunden. Die Eltern wünschten, dass ihr Kind so bald wie möglich beerdigt werden sollte. Nachdem alle organisatorischen Standardfragen und Termine abgeklärt waren, wurde die Mutter mit dem Angebot überrascht: »Wollen Sie Ihren Sohn selbst anziehen?«
Katrin war verwirrt. Die Sehnsucht nach ihrem toten Kind bedeutete nicht, dass sie konkrete Vorstellungen davon besaß, was bei einem Wiedersehen geschehen sollte. Das Kind selbst anziehen? Wann? Wo? Hier in diesem Haus? Nicht im Traum hätten die Eltern mit dieser Möglichkeit gerechnet. Und nun, da die Frage ausgesprochen war, fühlten sich beide überfordert. Deshalb sprachen sie sich dagegen aus: »Wir wollen ihn so in Erinnerung behalten, wie er war.«
Ein paar Stunden später änderte Katrin ihre Meinung. Sie erinnert sich: »Ich stand unter der Dusche. Und da kam plötzlich dieser Gedanke: Wenn ich noch etwas für mein Kind tun kann, es noch selber anziehen kann, dann tue ich das. Und wenn ich auf allen vieren dahin kriechen muss. Es war für mich ganz wichtig, dass ich das schaffe.«
Ihr Mann wollte davon nichts hören. Offenbar, argumentierte er, könne sich Katrin nicht vorstellen, was da auf sie zukäme. In ihrer Familie sei noch nie jemand gestorben. Noch nie habe sie eine Leiche gesehen. Er selbst aber sei dabei gewesen, als seine Mutter gestorben war. Eine zweite Konfrontation mit dem Tod wolle er sich ersparen.
Außerdem war Daniel Lambert entsetzt, weil Katrin ihre Tochter dabeihaben wollte. Es kam zu einem heftigen Streit. Aber die energische junge Frau war sich ihrer Sache ganz sicher und setzte sich schließlich durch.
Rückblickend sagt sie: »Hanna hatte ihren Bruder immer so liebevoll umsorgt wie eine Mutter. Sie hat vom Anfang der Schwangerschaft an alles mitbekommen, die Arztbesuche, die Gespräche mit der Hebamme. Hanna hat Paul bereits gesehen, als er erst drei Stunden alt war. Ich wollte ihr ersparen, dass dieser dramatische Morgen – fremde Männer, die durchs Haus rennen – der letzte Eindruck von ihrem Bruder ist. Er war doch plötzlich einfach weg. Das Kind sollte einen begreifbaren Abschied haben.«
DIE TOTEN LIEBER LEBEND IN ERINNERUNG BEHALTEN?
An einem sonnigen Morgen im Januar machten sich die Eltern zum zweiten Mal auf den Weg zum Bestattungshaus. Weil Katrin und Daniel nicht wussten, wie es ihnen beim Wiedersehen mit ihrem toten Kind ergehen würde, hatten sie die Tochter zunächst in der Obhut der Großeltern zurückgelassen.
Das »Haus der menschlichen Begleitung« ähnelt am ehesten einem kleinen Landhotel mit Garten, umgeben von hohen Bäumen. Hell und einladend ist das Foyer. Alle Fenster lenken den Blick ins Grüne. Aber für das junge Ehepaar, das beklommen darauf wartete, endlich sein Kind zu sehen, war das freundliche Ambiente zu diesem Zeitpunkt ohne jede Bedeutung.
»Ja, ich hatte Angst«, bekennt Daniel später. »Die Ärzte hatten uns doch gewarnt. Wir sollten Paul lieber als gesundes Kind in Erinnerung behalten.«
Der Bestatter kam und führte die Eltern in ein anderes Geschoss des Hauses. Sie betraten einen Raum, der wie ein ansprechendes Hotelzimmer eingerichtet war. Und da lag Paul in einem offenen Sarg. Er sah erbärmlich aus.
Spätestens an dieser Stelle des Berichtes tauchen Fragen auf. Was tun die Eltern sich da an? Hätten sie nicht doch besser auf die Ärzte gehört?
»Nein«, sagt der Vater entschieden. Auch rückblickend sei es die einzig richtige Entscheidung gewesen. »Obwohl ich mir sein Aussehen so schlimm nicht vorgestellt hatte. Da lag ein zum Teil wachsweißes und zum Teil bläuliches Etwas, das unser Sohn war, Augen und Mund leicht geöffnet. Dieses Etwas hatte mit unserem lebenden Sohn nichts zu tun, und es war trotzdem unser Sohn.«
Katrins erster Gedanke war: Es ist nur die Hülle. Nicht er, sondern es. Und ihr zweiter Gedanke: Seine Haut ist eiskalt. Ein Glück, dass ich den Wollanzug ausgesucht habe … In diesem Moment wurde das Es wieder zu Paul. Und für Katrin war klar, dass Paul Wärme brauchte. Also tat sie das, was für sie als Mutter das Normalste von der Welt war: Sie zog ihren Pullover aus und drückte ihren Sohn an sich.
»Ich wollte mein Kind noch mal spüren«, erzählt sie. »Ich wollte mein Baby richtig am Körper halten, nicht durch Schichten von Kleidung hindurch.«
Viele Stunden haben sie das tote Kind gehalten, erst die Mutter, dann der Vater. Gegen Mittag ließ Katrin ihren Mann mit dem Baby allein, um ihre Tochter dazuzuholen. Für Daniel gehört diese letzte Zeit, die er mit Paul verbrachte – er und sein Sohn, ganz allein –, zu den wertvollsten Stunden seines Lebens. Während er davon redet, bricht er in Tränen aus. Vor allem schmerzt den Vater, dass er so wenig Zeit mit seinem Sohn hatte, weil er beruflich so eingespannt war. Und doch hat es Daniel erleichtert, ja geradezu beglückt, dass »ich Paul von meinen Lebensträumen, von meinen Idealen erzählen konnte. Dass ich ihm sagen konnte, wer ich bin und wie ich mir das Leben mit ihm vorgestellt hatte.«
Die Schwester verhielt sich so, als sei die Situation im Abschiedszimmer etwas völlig Normales. Paul hatte für sie nichts Erschreckendes. Der Tod ist für Dreijährige noch keine Kategorie. Hanna hielt ihren Bruder lange im Arm, kuschelte sich an ihn. Inzwischen war er wärmer und weicher geworden, und das geöffnete Auge hatte sich etwas geschlossen, so dass das Baby zu blinzeln schien. »Der spinxt«, stellte die Kleine in klarem Rheinisch fest. Dann malte sie ihm noch ein Bild und bat die Erwachsenen, eine Botschaft darauf zu schreiben: Die Oma im Himmelland – Daniels Mutter – möge Paul bitte weiter seinen Möhrenbrei kochen …
Danach wurde für sie wieder anderes wichtig. Sie wollte zurück zu den Großeltern, weiterspielen. Im Auto sagte sie, sie habe Hunger auf Kuchen.
VON JEDEM ETWAS MITGEBEN
Am Nachmittag wurde Paul für seine Reise ausgestattet. Denn so empfanden es seine Eltern. Es entsprach ihrer religiösen Überzeugung, dass der Tod nur ein Übergang ist. Alles, was sie ihm mitgaben, war sorgfältig bedacht: der von der Mutter selbstgestrickte Anzug, der das Baby von Kopf bis Fuß warm einpackte; ein Kissenbezug, den die Kinder aus Hannas Spielgruppe mit ihren Händen und Füßen bedruckt hatten; der Tragesack, in dem die Eltern ihren Sohn immer herumgeschleppt hatten. Und nicht zu vergessen die Schafwolle, die Daniel am Tag nach Pauls Tod vom Zaun gerupft hatte. So gern hätte er seinem Sohn erklärt, was Schafe sind und wie Wolle entsteht …
»Nachher haben wir festgestellt, dass wir von allem Wichtigen etwas dabeihatten«, sagt Katrin. »Von jedem eine Locke, ein paar Tropfen von meinem Lieblingsparfum. Meinen Text, in dem wir unsere ganze Liebe zu Paul ausgedrückt hatten und den ich am nächsten Tag auch bei der Beerdigung vorgelesen habe. Hannas selbstgemaltes Bild …«
Und Daniel meint lächelnd: »Was wir ihm da alles mitgegeben haben! Es erinnerte ja fast an einen Pharaonenschatz. Am Ende war der Sarg viel zu klein.«
Die Lösung wartete nebenan. Zwar befand man sich an einem intimen Ort, der Angehörigen einen individuellen Abschied ermöglicht – aber gleichzeitig ist das Beerdigungsunternehmen ein ganz normales Bestattungshaus mit Werkstatt und Sarglager. Dorthin ließ sich die Mutter führen. Sie traf eine Wahl und half mit, die Innenseite des Sarges mit weißem Tuch auszukleiden.
Die Reisevorbereitungen waren abgeschlossen. Der endgültige Abschied rückte näher. Keine Panik bei den Eltern, immer noch nicht. Sie saßen am offenen Sarg und tranken Kaffee. Ihr toter Sohn sah nun völlig verändert aus. Nichts erinnerte mehr an das kalte Etwas. Augen und Mund hatten sich geschlossen. Sein Gesicht strahlte eine durch nichts zu störende Ruhe aus und erinnerte die Eltern an den Abend vor seinem Tod, als er satt und zufrieden eingeschlafen war.
Paul war wieder der »kleine Buddha« geworden – und er wird es für die Eltern immer bleiben. Draußen schien die Sonne. Der Garten vor dem Fenster lockte die Eltern. Sie wollten ins Freie, um einen Kreis zu schließen: Paul war ja auch an seinem ersten Lebenstag draußen gewesen. Kurz entschlossen nahmen sie ihr totes Baby hoch, bahnten sich den Weg durch eine andere Trauergruppe, die vor dem Haus stand, und erreichten den Garten, kurz bevor die Wintersonne unterging. Ein Lichtstrahl fand eine Lücke zwischen den Bäumen und traf genau auf die Familie mit Kind. Wunderbar wohltuend. Wie ein Segen. Und da war ein Baum voller Meisen, direkt neben ihnen. Katrin und Daniel empfanden die Situation wie ein Abschiedsgeschenk, wie ein Zeichen, dass nun alles in Ordnung sei – als seien die kleinen Vögel Boten und als hätte Pauls Seele sie mit Grüßen zu ihnen geschickt, auch mit Dank für den liebevollen Abschied …
»Nachher haben wir uns manchmal gefragt, ob das irgendjemand nachempfinden kann«, sagt Katrin. Und ihr Mann gesteht, einmal sei ihm das Geschehen auch etwas peinlich gewesen, und zwar, als sie draußen an der anderen Trauergruppe hatten vorbeigehen müssen.
Und so beschreibt Katrin den endgültigen Abschied: »Es war auch klar, wann wir gehen sollten. Irgendwann habe ich gedacht: Wenn er jetzt reden könnte, würde er sagen: ›So, jetzt ist es auch mal gut.‹ Wir haben den Sarg selbst geschlossen und zugeschraubt. Es war uns wichtig, dass wir die Letzten waren, die ihn gesehen haben.«
Danach fühlte sich die Mutter erleichtert, fast froh. Die Beerdigung, die am nächsten Tag stattfand, hatte für sie keinen großen Schrecken. »Mein Abschied lag ja schon hinter mir«, erklärt sie. »Was auf dem Friedhof geschah, war für mich ein gesellschaftliches Ereignis. Sonderbar, nicht wahr? Eigentlich war es sogar fröhlich.«
KINDERLIEDER AUF DEM FRIEDHOF
Katrin und ihr Mann hatten beschlossen, das Ritual selbst zu gestalten. Ohne Pfarrer. Sie waren nicht kirchlich gebunden, folglich war Paul auch nicht getauft worden. Für die erwachsenen Trauergäste war das Geschehen irritierend, nicht zu begreifen. Das sollte eine Beerdigung sein? Doch wohl eher ein Kindergeburtstag … Und in der Tat: Katrin hatte auch an die Kleinsten gedacht, die ihre Eltern zum Friedhof begleiteten und für die das Ganze nur ein Ausflug war. Darum hatte sie einiges besorgt, was Kindern Freude macht. Die dreijährige Hanna wollte auf ihren Kassettenrecorder nicht verzichten. Und so war auf Pauls letztem Weg, als Vater und Mutter den kleinen Sarg trugen und auch die Schwester ein Händchen ans Holz legte, ein Lied über einen kleinen Pinguin zu hören. Wären die Eltern stattdessen in lautes Weinen ausgebrochen, hätte die Mutter einen Schwächeanfall bekommen, es wäre weniger beängstigend für die Anwesenden gewesen. Konnte es mit rechten Dingen zugehen, wenn junge Eheleute, die ihr geliebtes Kind zu Grabe trugen, sogar zu einem Lächeln fähig waren?
»Es war ein Abschied, der Pauls Charakter entsprach: auf ruhige, fröhliche, zufriedene Art«, sagt Katrin dazu. »Diese Art ist für mich ein Vorbild geworden. Ich meine, dass jeder Mensch seine Aufgabe im Leben hat. Und Paul hat seine leider nur kurze Aufgabe auf dieser Erde als eine alte, weise Seele mit Bravour erfüllt. Vielleicht war es bei uns zunächst unbewusst, aber dieses Verständnis seines Daseins hat sehr stark unser Handeln beim Abschied und auch danach – bis heute – bestimmt.«
Die Mehrheit der Trauergäste, die nicht wissen konnte, was den Eltern am Tag zuvor geschehen war, stand da wie gelähmt. In den Köpfen arbeitete die Frage, ob Vater und Mutter vor Kummer verrückt geworden seien. »Diese Heiterkeit, das ist doch nicht normal«, so werden sie sich nachher ausgetauscht haben. »Haben Sie Katrins Gesicht gesehen, als sie am Grab den Kindern auch noch Luftballons in die Hand gedrückt hat …«
Später werden die Eltern ein Vogelhäuschen auf das Grab stellen. Den ganzen Winter werden Meisen ein und aus fliegen, und die Eltern werden sich für kostbare Augenblicke noch intensiver mit der Seele ihres Sohnes verbunden fühlen. Noch Monate nach der Beerdigung wird die Mutter dem Bedürfnis nachgeben, ihrem toten Kind hin und wieder aus einem Bilderbuch vorzulesen. Pauls Name wird immer noch auf dem Klingelschild stehen. Der Anrufbeantworter wird neben den Namen Katrin, Daniel und Hanna immer noch den von Paul nennen.
Für die Eltern wird klar sein, dass sie damit ihre Umwelt weiter irritieren werden.
JEDER TRAUERT AUF SEINE ART
Noch hat sich in der Gesellschaft nicht herumgesprochen, dass jeder Mensch seine eigene Art hat, Abschied zu nehmen – wenn man ihn nur lässt. Trauer ist ein durch und durch individueller Prozess, und niemand kann wissen, was einem Hinterbliebenen am meisten hilft, mit seinem Verlust fertigzuwerden. Oft existieren völlig unrealistische Vorstellungen darüber, in welchem Zeitraum der Verlust eines Menschen zu verarbeiten ist. Mit dem Verschwinden der Trauerkleidung, die über einen langen Zeitraum getragen wurde, scheint im allgemeinen Bewusstsein auch das Trauerjahr verlorengegangen zu sein. Schon gar nicht ist es gesellschaftlich erlaubt, viele Jahre den Verlust eines Menschen zu beklagen. Seit die Trauer um einen Verstorbenen nicht mehr wie früher von einer größeren Gemeinschaft getragen wird, seit sie nur noch Familienangelegenheit ist – und sich immer mehr zur Single-Angelegenheit entwickelt –, wird sie ins Verborgene abgedrängt. Man trauert nicht mehr öffentlich, sondern versteckt sich hinter seiner Wohnungstür. Man kontrolliert seine Gefühle und seine Gesichtszüge, notfalls mit Hilfe von Pillen. Man zeigt eine glatte Fassade, um ja niemanden zu stören … Damit schwindet auch das Wissen darüber, wie ein Trauernder empfindet, wie man ihn unterstützen kann und wann man ihn am besten in Ruhe lässt. An die Stelle des Wissens ist Hilflosigkeit getreten, die sich häufig in drängelnder Besserwisserei ausdrückt. Die Fähigkeit, selbst den Weg aus der Krise zu finden, wird bei den Hinterbliebenen erst gar nicht vermutet. Zunehmend gilt Trauer als Krankheit und nicht mehr als ein natürlicher Prozess, der Menschen hilft, sich in einer überaus schwierigen Lebenssituation zurechtzufinden.
In den vergangenen Jahren hat sich das Bewusstsein für die Bedeutung von Themen rund um das Lebensende und die Situation Schwerstkranker und Sterbender – dank der wachsenden Hospizbewegung und des Engagements seitens der Palliativmedizin – deutlich erhöht. Ein Zeichen dafür ist die 2010 gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, dem Deutschen Hospiz- und PalliativVerband und der Bundesärztekammer veröffentlichte »Charta zur Betreuung Sterbender und Schwerstkranker« (www.charta-zur-betreuung-sterbender.de). Sie wurde von mehr als 15 000 Institutionen und Einzelpersonen mittlerweile unterzeichnet, darunter die Evangelische Kirche, der Verband der gesetzlichen Krankenkassen und die Ministerien für Soziales in verschiedenen Bundesländern. Im Herbst 2015 verabschiedete der Bundestag ein Hospiz- und Palliativgesetz, das im Wesentlichen den Leitsätzen der Charta folgt. Zur Weiterentwicklung und Umsetzung trifft sich seit 2016 ein Runder Tisch, dem Vertreter von fünfzig Organisationen angehören.