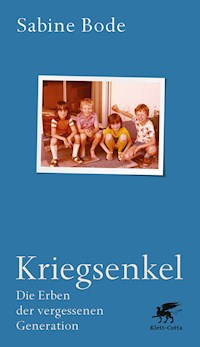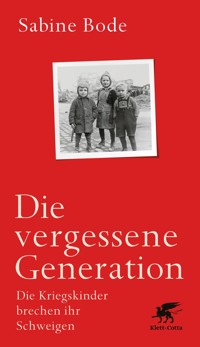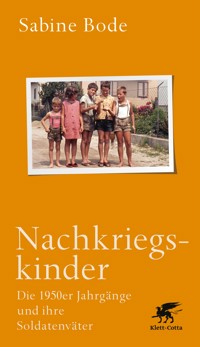
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die 50er Jahre: Zeit des Wirtschaftswunders und des Neuanfangs. Man schaute nach vorn. Die Nachkriegskinder wurden aber in Familien hineingeboren, auf denen Kriegserlebnisse und Erfahrungen von Gefangenschaft, Vertreibung und Schuld lasteten. Wie hat sich all das auf die eigenen Lebensmuster ausgewirkt? Nachkriegskinder sind in etwa die Jahrgänge bis 1960 – in West und Ost. Ihre Eltern waren keine Kriegskinder, sondern haben als Erwachsene den Krieg mitgemacht, die Väter meist als aktive Kriegsteilnehmer. Heute fangen deren Kinder an, sich mit ihrer Jugend zu beschäftigen. Sie wollen wissen, wie sie das Aufwachsen in der Nachkriegsgesellschaft geprägt hat, und stellen Fragen nach dem Vater. Das Buch hilft den Angehörigen dieser Generation, die Ungereimtheiten im eigenen Lebenslauf zu verstehen und für sich neue Ressourcen zu entdecken. Sabine Bode geht in ihrem Buch den Fragen nach, die viele Nachkriegskinder umtreiben: - Wer war mein Vater eigentlich – und solange ich das nicht weiß: Wer bin ich? - Was steckte hinter dem Schweigen meines Vaters? - War er Täter oder Opfer oder beides? - In welchem Umfang hat er von der NS-Zeit profitiert? - Wie hat Vaters Krieg unser Familienleben geprägt? - Was habe ich von ihm »geerbt«? - Wie hätte ich mich als Frau/als Mann ohne einen Kriegsvater entwickelt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Sabine Bode
Nachkriegskinder
Die 1950er Jahrgänge und ihre Soldatenväter
Impressum
Die Rechte an dem Buchtitel »Nachkriegskinder« besitzt die Zeitgut Verlag GmbH mit ihrem Buch »Nachkriegs-Kinder«. Wir bedanken uns für die großzügige Überlassung des Titels für das vorliegende Buch.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2011 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung des Fotos 1004226253, ullstein bild – Leber
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98052-3
E-Book: ISBN 978-3-608-10246-8
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Vorwort und Dank
ERSTES KAPITELDer Krieg war aus und überall
Die kleinen Hoffnungsträger
Die Freiheit einer unbeaufsichtigten Kindheit
Brüder von Heinz Erhardt
»Das wird bös enden!«
Die bleierne Zeit
Kinder trösten ihre Mütter
Stellvertretende Schuld
Täter oder Opfer oder beides?
»Wie konnte mein Vater das tun!?«
Die letzten Zeugen der Wehrmachtszeit
Kindersoldaten
Milder Blick auf die Eltern
ZWEITES KAPITELDie gut getarnte Vergangenheit
»Gerade erst den Luftschutzkellern entkommen«
Am Familientisch zwei Fraktionen
Politische Wortgefechte mit Subtext
Von Jugend an Pazifist
Kriegsnarben
Der abwesende Vater
Wachsendes Leid mit der Prothese
»Im Westen nichts Neues«
Mauerfall und Depression
Wenn Vater explodierte
In der Gedenkstätte Yad Vashem
Gespräche vom Krieg hinter verschlossenen Türen
»Mach einen Mann glücklich, dann geht es dir gut«
Alpträume und unwirksame Gebete
Das Ende falscher Schuldgefühle
Von der Schulbank in den Krieg
Die Hölle eines Tages
DRITTES KAPITELVatertöchter
Mutig und dickköpfig?
Warum verbirgt jemand seine guten Seiten?
»Dann geh doch nach drüben!«
Eine Frau mit Improvisationstalent
Der Ehekrieg von zwei psychisch Kranken?
Das Rätsel mit den Panzern
Der Neffe wurde den Töchtern vorgezogen
Bloß keinen Mann wie meinen Vater!
Alles gescheiterte Liebesbeziehungen …
Soldatenväter und Feminismus
Heinrich Böll, der »gute Vater«
Statt »Schwamm drüber« aufräumen
Eine Frau engagiert sich für Kinder im Irak
Zu Fuß von Riga nach Schleswig
Willy Brandts Kniefall in Warschau
Keine Karriere bei der Wehrmacht
Jäger, Kettenraucher und Anarchist
Großer Abstand zu anderen Menschen
Familieneinsatz auf der Baustelle
Man gab sich nur die Hand
Ein denkwürdiges Familienseminar
Untersuchung über Heimkehrer
Was Kinder nach dem Krieg beruhigte
INTERVIEW »Ich rechne auf«Herbert W., geboren 1924, über seine Gefangenschaft in Russland
VIERTES KAPITELSöhne im Schatten
Ein selbstbewusster Hartz-IV-Empfänger
Ohne haltbare Freundschaften
Das Glück eines Zündapp-Mopeds
Selbstmord mit 82 Jahren
Niemand mehr da, den man fragen könnte
Endlich frei sein!
Der Typ unvitaler Vater
Ein Lehrer, der seine Schulkinder liebt
Wiedersehen im November
Ein Mann mit starkem Willen und schwachen Nerven
Wer sich nicht wehrt, hat selbst Schuld
Die große Angst vor dem »Irrenhaus«
Bedauern über die eigene Kinderlosigkeit
Was verbirgt die stellvertretende Schuld?
Kein Talent zum Glücklichsein
INTERVIEW »Ich weiß vieles, aber darüber rede ich nicht«Friedrich S., geboren 1912, über seine Odyssee in der Wehrmacht
FÜNFTES KAPITELErmittler in eigener Sache
Ein Kämpfertyp
Im Land der Verlierer
Die Freiheit, über die eigene Geschichte zu verfügen
Kein Mangel an Geschenken
Bob Dylan und Joan Baez
Himmelfahrtskommando
Wie Besatzer ein Land ausräubern
Die Geschichte von Yvonne und Karl
Das Sterben vor dem biologischen Tod
Große Probleme mit Autoritäten
Ein Suizid vor 2000Menschen
Der Alptraum vom Keller des Vaters
Lücken in den Nachforschungen
Spezialist im Umgang mit Sprengstoff
Ein Kind verliert den Boden unter den Füßen
Wie mit neuem Sauerstoff versorgt
INTERVIEW »Die Wehrmacht war Teil des verbrecherischen Systems«Der Historiker Sönke Neitzel über die Protokolle des Unsagbaren
SECHSTES KAPITELDie DDR-Variante
Bei Gefahr rückt die Familie zusammen
Stalingrad: auf 35 Kilo abgemagert
Vier Generationen unter einem Dach
Ein Traumatisierter mit vielen Ressourcen
Das Unglück kam mit der Pubertät
Urgroßmutter war der Schutzengel
Als der Vater sein Schweigen brach
INTERVIEW »Wer waren eigentlich die Juden?«– »Das weiß ich nicht«Pfarrer Wolfram Hülsemann über seinen Kriegsvater und den Umgang der DDR mit der NS-Zeit
SIEBTES KAPITELNachkrieg und Kinderdressur
Babys unbedingt schreien lassen
Wie Kinder »freudigen Gehorsam« entwickeln
Eine behütete, enge Welt
»Das kann kein Gott vergeben«
Jeden Sonntag wurde der Krieg lebendig
Mutter und Vater: Zwei Unerlöste
Wie sich die Prügel im späteren Leben auswirkten
Dennoch ein gelungenes Leben
Das rauschende Fest zum 60. Geburtstag
Reisen mit leichtem Gepäck
Nebel und Vergesslichkeit
»Für meine Eltern waren wir Möbelstücke«
Wie ein Kind um seine Würde kämpfte
Wie hält man so viel Druck aus?
Mit 15 Jahren begannen die Depressionen
Als der Vater schwächer wurde
Ein netter Mann hatte keine Chance
Mit Dreißig kamen die gesundheitlichen Probleme
Angst und Wut eines Einzelgängers
Der Neid der Brüder
Als Kaufmann nie glücklich
Seit der NS-Zeit nichts dazugelernt
»Schade, dass man so einen Vater nicht zurückgeben kann«
INTERVIEW »Wie das Bild von des Kaisers neuen Kleidern« Jürgen Müller-Hohagen über den Nebel in deutschen Familien Nachbemerkung von Jürgen Müller-Hohagen
ACHTES KAPITELWoher kommt Orientierung?
Erinnerungen an einen liebevollen Vater
Die erste Familie starb bei einem Luftangriff
Gartenarbeit als Meditation
Alte Bücher und Briefe auf dem Dachboden
Geschichten ja, aber kein Überblick
Nachkriegskinder als Pioniere
Wenn das Vorbild fehlt
Was machte den Nebel so undurchdringlich?
Ein Kollektiv, das sein schlechtes Gewissen verdrängte
Alle hatten profitiert
Besser war’s nicht. Besser ging’s nicht
Anmerkungen
Bücher zum Thema
Vorwort und Dank
Seit meinem Buch »Die vergessene Generation« ein weiteres über »Kriegsenkel« folgte, wurde ich immer wieder auf Lesungen oder in Mails gefragt: »Ich bin weder Kriegskind noch Kriegsenkel, sondern Nachkriegskind. Haben Sie vor, sich auch mit meinen Jahrgängen zu befassen?« Meine Antwort darauf ist dieses Buch. An seinem Zustandekommen haben viele Menschen maßgeblich mitgewirkt, vor allem jene Nachkriegskinder, die darin zahlreich zu Wort kommen. Für ihre Offenheit bin ich ihnen sehr dankbar, vor allem auch für ihre Bereitschaft, die oft belastende Beziehung zum Kriegsvater vor dem Hintergrund der eigenen Lebenserfahrung und des Älterwerdens mit mir zu reflektieren. Fast alle biografischen Geschichten wurden anonymisiert und die geänderten Namen mit einem * gekennzeichnet. Mein Dank gilt auch den zwei ehemaligen Wehrmachtangehörigen sowie einigen Experten, die mir halfen, eine Reihe von wichtigen Fragen zu klären. Unsere Gespräche werden in diesem Buch in der Form des Interviews wiedergegeben.
Meinem Lektor Heinz Beyer danke ich sehr für seine Rückenstärkung, seine kluge Beratung und grundsätzlich für seinen Einsatz, einem schwierigen Thema Raum zu geben. Meinen besonderen Dank möchte ich dem Verlag Klett-Cotta sagen und dort allen jenen Mitarbeitenden, die nun schon seit vielen Jahren meine Buchprojekte unterstützen. Meinem Mann Georg Bode verdanke ich viele Anregungen. Manchmal lief ich Gefahr, mich in der Fülle des Stoffs mit seinen unzähligen Facetten zu verlieren, doch der Austausch mit ihm und vor allem sein Widerspruch halfen mir, in diesem komplexen Themenfeld meinen Standort wiederzufinden.
Dieses Buch ist dem Andenken an Uschi B. (1946–1997) gewidmet, meiner Freundin seit den Kindertagen. Bis zu ihrem Tod haben wir oft gemeinsam über unsere Kriegsväter nachgedacht. Als Jugendliche zum Beispiel fragten wir uns, was von dem so oft gehörten Satz zu halten sei: »Was Adolf gemacht hat, war nicht alles schlecht, er hätte nur eher aufhören müssen …«
Der kollektive Nebel, der über der NS-Vergangenheit lag, hat lange Zeit unsere Wahrnehmung irritiert und uns in unserem Lebensgefühl verunsichert. Während meiner Arbeit an diesem Buch kam es immer wieder vor, dass ich unsere Gespräche in Gedanken fortsetzte.
Köln, im Juli 2011
Sabine Bode
Erstes Kapitel
Der Krieg war aus und überall
Die kleinen Hoffnungsträger
Als Kind sammelt man Wörter, jeden Tag kommen neue hinzu, und man lernt die wichtigen von den weniger wichtigen zu unterscheiden. »Krieg« gehörte zu meinem frühen Wortschatz. Als Dreijährige wurde ich mehrmals am Tag ermahnt: »Pst, Nachrichten! Krieg!« Die Erwachsenen wollten Radio hören. Etwas Unheimliches ballte sich in unserer Küche zusammen: Korea im Sommer 1950. Der Zweite Weltkrieg lag gerade fünf Jahre zurück, als die Angst vor einem Dritten Weltkrieg aufstieg.
In dieser Zeit konnte ich manchmal vor Angst nicht einschlafen. Da war ein Geräusch, von dem ich nicht wusste, was es war, dumpf, rhythmisch und sehr bedrohlich– ich nannte es »Krieg«. Erst viel später begriff ich, dass es die Bässe der Musik waren, die aus der Wohnung unter uns zu mir drangen.– Der Krieg war aus und überall.
Ich wurde 1947 geboren. Damit war ich etwas Besonderes. Es gab nur wenige Kinder in meinem Alter. Wie viele Säuglinge inden ersten Jahren nach Kriegsende an Epidemien starben, ist unbekannt; entsprechende Statistiken wurden nicht geführt. Keine Frage, wir waren die Hoffnungsträger des zerstörten Deutschland, das Licht am Ende des Tunnels. Das sagt sich so leicht dahin, aber in meinem Fall kann ich es beweisen. Meine Mutter hinterließ mir eine Mappe mit Glückwünschen zu meiner Geburt. Ich habe sie mir im Laufe meines Lebens öfter angesehen, und je älter ich werde, umso mehr berühren sie mich. Als ich geboren wurde, gab es kaum vorgedruckte Karten zu kaufen, man musste improvisieren. Dünne Bleistiftränder verraten, dass das Papier ursprünglich anders genutzt wurde. Viele gute Wünsche sind auf schwarzem Fotokarton zu lesen, oder auf braunem, gebrauchtem Packpapier, das gewendet wurde– wie der abgetragene Mantel vom Vater, aus dem ich eine dicke Winterjacke geschneidert bekam. Aus jedem Brief, aus jeder Karte spricht große Freude, fast so, als wäre mit mir noch einmal das Christkind auf die Welt gekommen. Die meisten Gratulanten hatten sich die Zeit genommen, etwas zu zeichnen: dekorative Schriftzüge, von Blumen umrankte Segenswünsche und kleine, sorgfältig ausgemalte Szenen, die das Familienglück beschworen. Manche hatten gedichtet: »Sabinchen ist nun auf der Welt, was uns allen sehr gefällt …« Es war eine liebevolle Begrüßung, die sich noch einige Jahre fortsetzte, weshalb sie mir in Erinnerung blieb.
Die Freiheit einer unbeaufsichtigten Kindheit
Wir wohnten in einer ländlichen Umgebung. Autos gab es nicht. Als kleines Kind durfte ich herumlaufen, wo ich wollte, auch ohne Aufsicht. Während meine älteren Geschwister in der Schule waren, ging ich auf Entdeckungsreise. Alle Erwachsenen, die mir auf meinen Wegen begegneten, blieben kurz stehen. Mein Auftauchen munterte sie sichtlich auf, denn sie sagten, wie schön es sei, mich zu sehen. Oft ging jemand in die Knie, sprach ein paar Sätze mit mir und steckte mir etwas Süßes zu.
Bei meinen Eltern war von Zuneigung dieser Art wenig zu spüren. Verständlicherweise waren sie alles andere als begeistert von der Ankunft eines vierten Kindes zu einem Zeitpunkt, als Deutschland am Boden lag und keiner wusste, ob es jemals wieder aufstehen würde, ob und wann der Vater Arbeit finden würde. Wie alle Eltern dieser Zeit brauchten sie ihre ganze Kraft für den Überlebenskampf. Außerdem waren sie der Meinung, ein Kind zu verwöhnen sei ein kapitaler Erziehungsfehler, sie warenAnhänger der Johanna Haarer, deren Bücher in der NS-Zeit Müttern nahegelegt hatten, ihre Kleinkinder wie Äffchen zu dressieren. Umso schöner für mich, dass es außerhalb unserer Wohnung nicht nur eine unbeaufsichtigte Kindheit gab, sondern auch Begegnungen mit Erwachsenen, die sich unverhohlen freuten, wenn sie mich sahen. Aus beidem entwickelte sich, was ich später als Journalistin gut brauchen konnte: zum einen die Neugier, Unbekanntes zu erforschen, und zum anderen das Gefühl, in einer mir fremden Umgebung grundsätzlich willkommen zu sein.
In den fünfziger Jahren war die Welt noch nicht in Ordnung. Auf ganz Europa lasteten die Folgen eines verheerenden Kriegs, und die Deutschen in West und Ost bemühten sich, möglichst wenig an den Holocaust zu denken. Noch 1970 empfand fast die Hälfte der Westdeutschen Willy Brandts Kniefall am Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos als »übertrieben«, wie eine Umfrage ergab.
Ende der fünfziger Jahre begannen sich die Verhältnisse zu stabilisieren. Auch meinen Eltern war es gelungen, ihr Leben wieder in normale Bahnen zu lenken. Die Männer trugen noch Hüte, siesahen eleganter aus als die Väter heute. Aber die Hüte schienen ihnen auch etwas Unnahbares zu geben, im Unterschied zu den kumpelhaften Vätern heute mit ihren Baseballkappen. Arbeitseifer und Wirtschaftswunder machten Dinge möglich, von denen man wenige Jahre zuvor nur geträumt hatte. Als immer mehr Nachbarn ein Auto besaßen, als Urlaubskarten vom Mittelmeer eintrafen, als die ersten italienischen Eisdielen öffneten und Elvis Presley als GI nach Deutschland kam, da war klar: Man hatte das Schlimmste hinter sich.
Brüder von Heinz Erhardt
Die Erwachsenen wurden etwas gelassener, auch fröhlicher und vor allem dicker. Viele gertenschlanke Männer legten sich innerhalb eines halben Jahres einen Bauch zu. Die Auswirkungen der Fresswelle lassen sich gut an den frühen Karnevalssitzungen »Mainz wie es singt und lacht« studieren, die als Kult gelten, weshalb das Fernsehen sie gern wiederholt. Da sieht man im Publikum recht junge, gut genährte Bürgersleute mit Doppelkinn– siealle Brüder von Heinz Erhardt–, neben ihnen schunkelnde Damen, die ihre unbekleideten Speckärmchen links und rechts eingehakt haben. Als die Frauen pummelig wurden, hörte man sie immer häufiger kichern wie junge Mädchen. So lange hatten sie auf Luxus verzichten müssen, auch das war nun vorbei. Man konnte wieder ausgehen, man konnte sich etwas gönnen, eine Reise nach Paris zum Beispiel. Nur an ihren Normen und Einstellungen hatten die Erwachsenen nichts geändert. »Das tut man nicht!« war der Satz, den Kinder am häufigsten hörten. Warum man das nicht tat oder nicht tun sollte, wurde nicht erklärt.
An den Schulen der Bundesrepublik unterrichteten überwiegend ältere Lehrerinnen und Lehrer, streng und latent gereizt, mit Strafen waren sie schnell bei der Hand. In meiner Volksschule verbreitete eine Lehrerin mit dem Namen Lang nichts anderes als Furcht und Schrecken. Hinter ihrem Rücken sangen wir: »Die Lang, die Lang, die macht die Kinder bang. Mit Säbel und mit Schießgewehr ist die hinter den Kindern her.«
Wie neidisch war ich, als mir Verwandte aus der DDR erzählten, bei ihnen seien die Lehrer überwiegend jung– kaum älter als die Oberschüler der letzten Klasse. Das Lehrerkollegium auf meinem Gymnasium bestand überwiegend aus– ich will es mal vorsichtig ausdrücken– schwierigen älteren Menschen. Wenn sie das Klassenzimmer betraten, waren ihre Gesichter frei von Freundlichkeit. Bestenfalls schauten sie neutral, häufig aber einfach nur schlecht gelaunt. Jede kleine Unregelmäßigkeit schien sie zu stören. Heute weiß ich: Ihre Stressanfälligkeit war enorm hoch, ihnen steckte der Krieg noch in den Knochen. Als Kind dachte ich: Wenn man groß ist, lacht man nicht mehr, man weiß alles besser, man mag Kinder nicht.
Manche Lehrer schlugen noch mit dem Stock und wurden nurdeshalb nicht gebremst, weil in vielen Elternhäusern nichts anderes geschah und Solidarität mit den eigenen Kindern ein Fremdwort war. Wer sich bei den Eltern über Prügel in der Schule beschwerte, bekam zu hören: »Hättest du dich anständig benommen, wäre dir das nicht passiert!«
Die meisten Erwachsenen duldeten keinen Widerspruch. Wie das im Alltag aussah, lässt sich an einer Szene aus dem Heinz-Erhardt-Film »Vater, Mutter und neun Kinder« von 1958 gut nachvollziehen. Alle sitzen am Tisch, die muntere Kinderschar benimmt sich aus heutiger Sicht völlig normal. Doch die Mutter ist um absolute Kontrolle bemüht, und so hagelt es ohne Pause Ermahnungen und Maßregelungen, genau so, wie es in der Nachkriegszeit üblich war: Sitz gerade, schling nicht so, sei nicht so vorlaut, wie sehen deine Fingernägel aus, man spricht nicht mit vollem Mund, sei nicht so neugierig, reiß dich endlich zusammen…
Eigentlich wurde man als Kind ständig eingeschränkt, frustriert, überfordert. Irgendwann, in der Jugend, als man dem Zugriff der Eltern entronnen war, ergab deren »komisches Verhalten« reichlich Stoff für fröhliche Runden auf Partys und später in Wohngemeinschaftsküchen. Ein damals beliebter Witz ging so: Ein Kind schreit: »Ich will aber nicht nach Amerika. Ich will nicht nach Amerika!« Darauf die Mutter: »Sei endlich still. Schwimm weiter!« Damals lachten wir nur über eine absurde Situation. Dass in diesem Witz die eigenen Eltern karikiert wurden, konnten wir als Jugendliche nicht sehen– dafür fehlte uns die Lebenserfahrung.
»Das wird bös enden!«
Wir machten uns gern lustig über den Erziehungsstil und die Schwarzmalerei in der Elterngeneration. Zu unseren Lieblingssprüchen gehörte »Das wird bös enden!« aus der Filmkomödie »Zur Sache, Schätzchen«. Der aufmüpfige Geist von 1968 erfassteauch jene, die keine Weltrevolution wollten, sondern einfach nur ein bisschen mehr persönliche Freiheit. Fast alle meine Gesprächspartner, deren Biografien diesem Buch zugrunde liegen, haben sich im Umgang mit ihrer eigenen Erziehung eine gewisseIronie zurechtgelegt. Sie alle sind mit den aus dem Heinz-Erhardt-Film zitierten Sprüchen groß geworden. Sie ergaben die Melodie der vorherrschenden Pädagogik, die sich, etwas pauschal ausgedrückt, nur in einem Punkt unterschied: Es gab Schläge oder es gab keine Schläge. So waren auch die meisten Kinder vor dem Krieg und im Krieg behandelt worden. Aber ich bin mir sicher, dass die Eltern der Nachkriegszeit ihren Erziehungsstil noch rabiater praktizierten, einfach deshalb, weil sie ständig überlastet waren, das Nervenkostüm dünn war, ihre Selbstkontrolle versagte und sie auf diese Weise Dampf ablassen konnten– vor allem aber, weil diese Pädagogik so gut funktionierte. Viele Eltern waren stolz auf ihr konsequentes Handeln. Etwaige Nebenwirkungen wurden nicht mit Bestrafung in Verbindung gebracht. Oder doch? Wurden sie womöglich als das kleinere Übel in Kauf genommen? Der Gedanke muss erlaubt sein. Fortwährend eingeschüchterte Kinder machen vielleicht ins Bett, aber sie machen keinen Krach. Ganz ahnungslos können Eltern in den sechziger Jahren nicht mehr gewesen sein.
Auf Kaffeekränzchen wurde durchaus über die Ursachen von Bettnässen geredet, und man kann davon ausgehen, dass unter einem halben Dutzend Müttern wenigstens eine war, die unter Kindererziehung etwas anderes verstand als Drohen und Strafen.
Die bleierne Zeit
Oft sind die fünfziger und die Anfänge der sechziger Jahre nach einem Kinofilm von Margarethe von Trotta »Die bleierne Zeit« genannt worden. Für mich war es die Zeit der Abwertungspädagogik. Dass sie nun schon lange durch den Volkserzieher Fernsehen geächtet ist, dass in jeder Familienserie Eltern als vorbildlich gelten, die ihre Kinder respektieren, dafür werde ich den 68ern ein Leben lang dankbar sein. Mir ist meine Prägung durch die Nachkriegszeit sehr bewusst, und während ich mich beruflich mit Kriegskindern und später mit Kriegsenkeln beschäftigte, war mir klar, dass ich weder zur einen noch zur anderen Gruppe gehörte und dass mir diese Distanz bei meiner Arbeit half. Ein Buch zu schreiben, das auch meine eigene Altersgruppe in den Mittelpunkt stellte, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Doch als dem Buch »Die vergessene Generation« über die Kriegskinder das Buch »Kriegsenkel« folgte, das sich im Wesentlichen an die 1960er Jahrgänge richtet, stand bei jeder Lesung jemand auf und sagte: »Ich bin weder Kriegskind noch Kriegsenkel. Was ist mit uns? Was ist mit uns Nachkriegskindern?«
Ein Jahr ließ ich mir Zeit, um auszuloten, ob Recherchen über dieJahrgänge von 1946 bis 1960 tatsächlich ausreichend Neues zu Tage fördern würden. Ich wollte mich ja nicht langweilen, und ich wollte mich nicht wiederholen. So waren bei Kriegskindern, Nachkriegskindern und Kriegsenkeln die Gemeinsamkeiten in den Beziehungen zu den Eltern nicht zu übersehen. Wobei man im Blick behalten muss: Wir reden hier nicht von den Problemen ganzer Generationen, sondern von Auffälligkeiten innerhalb bestimmter Altersgruppen, von gesellschaftlichen Mustern, und natürlich lässt sich nur ungenau trennen, welche Defizite im Verhalten Erwachsener ursächlich auf Kriegstraumatisierungen zurückzuführen sind und welche einer gnadenlosen Erziehung oder anderen Faktoren geschuldet sind. Es gibt auch ohne den Hintergrund Krieg und Vertreibung ausreichend kranke Familien.
Mutter oder Vater wurden mir häufig als wenig emotional beschrieben; der Zugang in die Gefühlswelt eines Kindes, hieß es, sei nur selten gelungen. Seelischer Schmerz war keine Kategorie. Probleme wurden häufig nicht ernst genommen, sondern als »Problemchen« abgetan. Kinder wurden nicht getröstet, sondern beschwichtigt. Auffällig auch das auf den Kopf gestellte Eltern-Kind-Verhältnis: dass man sich für das Glück der Mutter oder des Vaters verantwortlich fühlte, und zwar von früher Kindheit an. War der Vater im Krieg gefallen, sah sich das Kind der Mutter gegenüber in der Rolle des Tröstenden– seinen eigenen Schmerz musste es unterdrücken. Fest stand, als Kind durfte man ihr nicht zusätzlich Sorgen bereiten, sie hatte es schon schwer genug.
Kinder trösten ihre Mütter
Parentifizierte Kinder, wie sie in der psychologischen Fachsprache heißen, sind angepasste Kinder, denen es als Erwachsene äußerst schwer fällt, sich abzunabeln. Es kann geschehen, dass sie ihr ganzes Leben der Liebe eines Elternteils hinterherlaufen, in der Hoffnung, doch noch ein bisschen Zuwendung zu ergattern– weil sie nicht verstehen, dass Mutter oder Vater als schwer Traumatisierte zu tiefen, aufmerksamen Beziehungen nicht fähig sind. Soviel zu den Gemeinsamkeiten von Kriegskindern und den später Geborenen, deren Eltern den Krieg noch miterlebt hatten.
Es ist mir am Anfang meiner Arbeit über die Spätfolgen des Krieges gelegentlich geraten worden, alle beeinträchtigten Altersgruppen zusammenzufassen, doch der Fokus Kriegskinder war mir wichtig, seit ich die Besonderheit in diesen Jahrgängen entdeckte: Hier handelt es sich um eine große Gruppe von Menschen, die in ihrer Kindheit verheerende Erfahrungen gemacht hatten, aber in ihrer Mehrzahl über Jahrzehnte eben nicht auf die Idee kamen, etwas besonders Schlimmes erlebt zu haben. Sie sagten übereinstimmend: »Das war für uns normal«, und es blieb für sie normal, das jedenfalls sagte ihnen ihr Gefühl. Ihnen fehlte der emotionale Zugang zu ihren Erlebnissen und damit der Zugang zu ihren wichtigsten Prägungen.
Nachdem die Kriegskinder 2005 zum ersten Mal in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, tauchten nach und nach, eine Generation tiefer, deren Kinder auf. Auch sie wollten gesehen werden mit ihren speziellen Problemen, mit dem, was die Eltern ihnen unbewusst weitergegeben hatten. Über diese nur schwer zu identifizierenden Spätfolgen des Krieges schrieb ich in meinem Buch »Kriegsenkel«. So entstand die Lücke zwischen den Generationengruppen, die das hier vorliegende Buch zu schließen versucht.
Schaut man sich an, was die Nachkriegskinder prägte, so sind auch sie– genau so wie die Kriegskinder und die Kriegsenkel– grob zu unterscheiden in die früh und die später Geborenen. Bei den Älteren, in etwa die Jahrgänge bis 1953, sah ich viele Parallelen zu den Kriegskindern der vierziger Jahrgänge: in Elend groß geworden, umgeben von verstörten, belasteten Erwachsenen, eine strenge Erziehung, die ansteckende Aufbruchsstimmung von 1968, Rock- und Popmusik, ausgezeichnete Berufschancen. Letzteres bezieht sich auf die wohl einmalige gesellschaftliche Situation, dass man sich in der Jugend gründlich daneben benehmen konnte, ohne dass es sich später zum Nachteil auswirkte– es sei denn, man geriet in den Verdacht, ein Verfassungsfeind zu sein und wurde auf Grund des »Radikalenerlasses« vom Staatsdienst ausgeschlossen. Genau genommen musste es jemand, der in den vierziger Jahren geboren war, schon ziemlich dumm anstellen, wenn ihm nach seinem Studium eine gut bezahlte Akademikerlaufbahn verschlossen blieb. Aber auch ohne Hochschulabschluss ergaben sich erstaunliche Karrieren, an der Spitze die von Joschka Fischer, der es vom ehemaligen Straßenkämpfer bis zum Bundesaußenminister brachte.
Stellvertretende Schuld
In den Nachkriegsjahrgängen war die Angst, der Vater könne ein schlimmer Nazi gewesen sein, weit verbreitet. Im Ausland wurde das Phänomen nicht verstanden. Es war ja auch mit Vernunft nicht nachzuvollziehen, dass sich Nachkommen, nur weil sie Deutsche waren, schuldig fühlten für die Massenverbrechen der Vergangenheit, während die Eltern sich durchweg als Opfer sahen. Schuld- und Schamgefühle hatten in der falschen Generation ihren Platz gefunden. Unter den Begriffen »stellvertretende Schuld« oder »übernommene Schuld« gingen sie in die psychotherapeutische Literatur ein. Dass die Nachkriegskinder stolz sind, Deutsche zu sein, kommt ihnen in dieser Schlichtheit nicht über die Lippen. Stattdessen hört man von ihnen Sätze wie: »Es ist nicht schlecht, Deutscher zu sein.« Oder: »Wir würden ja gern unser Land lieben, aber die Vergangenheit …«
Viele Nachkriegskinder schrieben mir, sie hätten sich teilweisein meinem Buch »Kriegsenkel« wiedergefunden. Das war dannder Fall, wenn im Elternhaus ein Klima der gedämpften Gefühle herrschte oder wenn Heimatvertriebene ihre Familie als »Burg« betrachtet und den Kindern Misstrauen gegen den Rest der Welt eingetrichtert hatten. In den Jahrgängen der Baby-Boomer schließlich– in etwa von 1958 bis 1964– überschneiden sich viele prägende Erfahrungen der Nachkriegskinder mit denen derKriegsenkel. Seit sie den Kindergarten besuchten, wissen sie: Wir sind zu viele. Auf mich kommt es nicht an. Ob in der Ausbildung, an der Universität oder im Berufsleben– eigentlich sind immer schon alle Plätze besetzt. Eine Generation in der Warteschleife.
Weder in meinem Buch »Die vergessene Generation« noch in »Kriegsenkel« spielen die Väter eine tragende Rolle. Überwiegend war zu hören, sie hätten als Ernährer gut für ihre Familie gesorgt, seien aber im Grunde abwesende Väter gewesen. Die Aufmerksamkeit lag auf der Mutter, auf sie war man ja als Kind hauptsächlich angewiesen gewesen, mit ihr hatte es offene oder verdeckte Spannungen gegeben, mit ihr hatte man sich womöglich ein Leben lang herumgezankt. Mit den Vätern weit weniger. Häufig war der Kontakt zu ihnen dünn gewesen, weshalb vor allem Töchter– anders als Söhne– über Jahrzehnte übersahen, dass auch die sogenannten abwesenden Väter auf bestimmte Aspekte der eigenen Entwicklung einen enormen Einfluss ausgeübt hatten. Vor allem von den jüngeren Nachkriegskindern wurden mir die Väter überwiegend als Männer beschrieben, die durch ihre Wehrmachtszeit und Gefangenschaft noch lange oder bis zum Tod seelisch belastet blieben und die mit viel Disziplin ihr Leben meisterten.
Täter oder Opfer oder beides?
Bei meinem Nachdenken über ein neues Buchkonzept rückten die Kriegsväter immer mehr in den Vordergrund. Sie waren auch in einem anderen Kontext nicht mehr zu übersehen. Seit Jahren bieten mein Mann und ich Seminare für »Kriegsenkel« an, die Kinder der Kriegskinder. Hier meldeten sich zunehmend auch Angehörige der fünfziger Jahrgänge an, obwohl deren Eltern Kriegserwachsene waren. Aber sie suchten nun mal ein Forum, um ihre Problematik zu reflektieren, und weil sie es woanders nicht fanden, reihten sie sich bei den Kriegsenkeln ein. Obwohl eine Minderheit, dominierten die Älteren unsere Seminare, da sie ihren Klärungsbedarf viel vehementer anmeldeten als die Kriegsenkel. Was sie herausfinden wollten, bezog sich fast immer auf Fragen zu den Kriegsvätern.
Wer war mein Vater eigentlich?
Was steckte hinter seinem Schweigen?
War er Täter oder Opfer oder beides?
Welche Bilder wurde er sein Leben lang nicht los?
In welchem Umfang hat er von der NS-Zeit profitiert?
Wie hat Vaters Krieg unser Familienleben geprägt?
Was habe ich von ihm »geerbt«?
Wie hätte ich mich als Frau/als Mann ohne einen Kriegsvater entwickelt?
Man kann sich vorstellen, dass solche Fragen für Kriegsenkel ohne großen Wiedererkennungswert waren, denn dem Alter nach handelte es sich um ihre Großväter, die ihnen in der Regelso wichtig nicht waren. Fragen nach deren Kriegserlebnissen oder mögliche Verstrickungen in die deutsche Schuld sind für die Enkel nur selten von Bedeutung. »Für uns sind das allenfalls sonderbare Opis gewesen«, erklärte mir ein Mann von Mitte Vierzig. »Über ihre Vergangenheit als junge Menschen haben wir nicht weiter nachgedacht und auch unsere Eltern haben sich diesbezüglich in Schweigen gehüllt.«
In unseren Seminaren für Kriegsenkel spiegelt sich der Befund des Buchs von Harald Welzer »Opa war kein Nazi«. Zum Beispiel: 12 Teilnehmer beschreiben ihren Familienhintergrund; fast alle sehen ihre Eltern und Großeltern als Opfer. Nur ein Mann berichtet, sein Großvater habe sich einen arisierten Betrieb billig unter den Nagel gerissen und damit sei Wohlstand in seine Herkunftsfamilie gekommen. Rein statistisch kann das nicht stimmen, 12 Teilnehmer bedeuten 24 Großelternpaare, bedeuten48 Personen. Nur ein Opa war Nazi, vielleicht nicht einmal das,vielleicht war er auch nur ein Unternehmer, der von einer günstigen Gelegenheit profitierte. Inzwischen veranstalten mein Mann und ich auch Seminare speziell für Nachkriegskinder. Hier ist die Sicht auf die Generation der Kriegserwachsenen realistischer. Darüber hinaus ist das Wissen über historische Fakten und auch über die Bedingungen und Vorgänge des Alltags in der NS-Zeit sehr viel größer als bei den Kriegsenkeln.
Die Nachkriegskinder fangen an, sich Gedanken über den Ruhestand zu machen. Da liegt eine Lebensbilanz mit einem update zur Identitätsklärung nahe. Häufig geht sie Hand in Hand mit Fragen nach der eigenen Herkunft, nach den Wurzeln. Das Schweigen in ihren Familien über die unheilvolle Vergangenheit hatte viele Nachgeborenen in ihrer Jugend verwirrt, später vielleicht sogar krank gemacht. Die Irritation bezüglich ihrer Soldatenväter muss schon deshalb größer gewesen sein als bei den Kriegskindern, da diese, sofern sie sich an die Zeit vor 1945 erinnern konnten, die männlichen Familienmitglieder noch in Uniform erlebt hatten. Für sie war es im Unterschied zu den später Geborenen kein Geheimnis, woher des Vaters Befehlston kam und warum er seine Kinder bei Bedarf »antreten« ließ.
»Wie konnte mein Vater das tun!?«
Der Fokus Vater führt notgedrungen zu einem verengten Blickwinkel. Die Beziehung zur Mutter wird in diesem Buch nur angedeutet. Oft war das Leid der Mütter begleitet von dramatischen Umständen und einschneidenden Folgen für ihre Kinder. In vielfacher Weise zeigt sich, wie hilflos die Väter als Ehemänner den seelischen Nöten ihrer Frauen gegenüberstanden und wie sie daher auch bei ihren Kindern versagten.
Manchmal schilderten mir Nachkriegskinder, wie in ihnen die Ahnung wuchs, der biedere, langweilige Vater, der jedes Risiko scheute, könnte mal ein ganz anderes, ein wildes Leben geführt haben, was sich dann durch Nachforschungen bestätigte. Manchmal wuchs damit auch das Entsetzen. Wenn die Beteiligung anKriegsverbrechen vermutet oder sichtbar wurde, zeigte sich, dassDenk- und Gefühlskategorien von Friedenskindern nicht ausreichten, und so stellten sie immer wieder die Frage: »Wie konnte mein Vater das tun!?« Der Historiker Sönke Neitzel bieteteine Erklärung an: »Konkret wurden im Krieg Verbrechen danach definiert, was von den Soldaten emotional als Verbrechen empfunden wurde.«
Oft war das Ergebnis der Nachforschungen enttäuschend. Esblieben Ungereimtheiten und Lücken, die letztlich nur neue Fragen und Spekulationen aufwarfen, weil es keine möglichen Mitwisser mehr gab, die man hatte fragen können. Die meisten Recherchen förderten nichts anderes als das ganz normale Kriegsgrauen zu Tage. »Was der Vater an der Front und in Gefangenschaft erlebt hat«, sagte ein Sohn, »war zu viel für ein Leben. Er hatte als Soldat zu viele Freunde verloren, da hat er später keine neuen Freundschaften mehr geknüpft.«
In meiner Jugend kannte ich– abgesehen von den Alten– kaum andere Männer als Kriegsteilnehmer oder Heimkehrer. Ich wusste, dass sie, wenn überhaupt, ihren Söhnen etwas anderes erzählten als ihren Töchtern. Ich ließ allerdings nicht locker, bis die Jungen auch mich einweihten. Als Erwachsene begriff ich, wieviel die Väter dabei ausblendeten. Manche Männer verteidigten ganz offen bis ins hohe Alter Hitlerdeutschland, aber die meisten taten es nicht, entweder weil sie tatsächlich keine Nazis mehr waren oder es nie gewesen waren, oder weil sie ihre Gesinnung verbargen und sie nur bei den alten Kameraden am Stammtisch zur Sprache brachten.
Die letzten Zeugen der Wehrmachtszeit
Was ich bei meinen Buchrecherchen über die Väter hörte, war mir also im Wesentlichen vertraut. Ich wusste, dass sie sich durchweg als Opfer sahen und dass sich diese Sichtweise im Alter nicht ändern würde. Erst relativ spät kam mir der Gedanke, es würden ja vermutlich auch Jüngere das Buch lesen, denen man einen Eindruck vermitteln müsse, in welcher Weise die Kriegsväter sich über ihre Wehrmachtszeit und die Gefangenschaft geäußert hatten. Ich führte zwei Interviews mit ehemaligen Soldaten– einer war zum Zeitpunkt unseres Gesprächs 97 Jahre alt, er lebt inzwischen nicht mehr. Darüber hinaus gebe ich in diesem Buch sehr ausführliche Gespräche mit drei Experten wieder. Es handelt sich bei ihnen um den bereits erwähnten Historiker Sönke Neitzel, den Psychotherapeuten Jürgen Müller-Hohagen und den ostdeutschen Pfarrer Wolfram Hülsemann, der mir die DDR-Variante der Thematik »Nachkriegskinder und ihre Soldatenväter« erläuterte.
Das Thema »Kriegsväter« ist nicht neu. Seit den achtziger Jahren beschäftigt sich die psychotherapeutische Literatur mit dem Niederschlag der Kriegs- und NS-Vergangenheit in deutschen Familien. Es waren vor allem Angehörige der Kriegskinderjahrgänge, die sich dieser Thematik annahmen, darunter Jürgen Müller-Hohagen (»Verleugnet, verdrängt, verschwiegen«), Anita Eckstaedt (»Nationalsozialismus in der zweiten Generation«), Wolfgang Schmidbauer (»Ich wusste nie, was mit Vater ist«), Tilmann Moser (»Dämonische Figuren«). Aber seit ihren Veröffentlichungen sind erneut viele Jahre ins Land gegangen. Der zeitliche Abstand, neue historische Forschungsergebnisse und Selbsterkenntnis ermöglichen heute Einsichten, die von Schwarz-Weiß-Denken und Ideologie abgerückt sind. »Als wir jung waren, wollten wir Eindeutigkeit, wir wollten klare Ansagen: entweder– oder, richtig oder falsch«, sagte mir eine Sechzigjährige. »Mit der heutigen Lebenserfahrung wissen wir, dass sie nicht zu haben sind.«
Bei meinen Gesprächen stellte sich heraus, dass man im Nachhinein den Satz des Vaters »Ich habe von nichts gewusst« als unwahr einschätzt. Damit wird reflektiert umgegangen. Vorwürfe werden heute kaum mehr erhoben. Dagegen hat sich nichts geändert an der Sichtweise, wie gravierend sich das Schweigen derVäter auswirkte– wie es die eigene Wahrnehmung und die Entscheidungsfähigkeit irritierte, wie es die Menschenkenntnis schwächte und spätere Partnerschaften belastete und nicht selten zu einer seelischen Erkrankung führte.
Kindersoldaten
In den heutigen Aussagen der Nachkriegskinder überwiegt das Mitleid mit Familienmitgliedern, die Opfer waren, auch dann, wenn sie gleichfalls Täter waren. Väter, die noch kurz vor Kriegsende eingezogen wurden, manche im Alter von 16 Jahren, werden als »Kindersoldaten« eingestuft. Wer 1933 noch nicht erwachsen war, wird darüber hinaus als Opfer der fanatischen Propaganda gesehen, der sich Jugendliche kaum entziehen konnten. Im späteren Leben blieben sie häufig einer reaktionären Weltsicht verhaftet, weshalb sich die Kinder ihrer schämten. Schon deshalb hatten sie nicht so werden wollen wie ihre Eltern.
In fast allen Gesprächen wiederholte sich das große Bedauern über seichte, schwierige oder extrem spannungsreiche Beziehungen. Auf Wut oder Empörung stieß ich nur noch selten.
Fakt bleibt, man hätte es sehr viel leichter haben können, hätten die Eltern nicht jede Schuld oder profitierende Beteiligung an den Untaten der NS-Zeit zurückgewiesen, und sich damit grundsätzlich geweigert, sich dem Unbeschreibbaren zu stellen. Zu den wenigen Ausnahmen zählte der Schriftsteller Heinrich Böll– er wurde von der jüngeren Generation dafür verehrt und geliebt.
Aber Fakt ist auch: Die Bedingungen für das eigene Leben hätten sehr viel schlechter sein können. Um das zu erkennen, ist der Blick auf die ehemalige DDR ein hilfreicher. Das Nachkriegselend dauerte im Osten weit länger als im Westen. Wer wusste das besser als wir Kinder, die diesseits des Eisernen Vorhangs aufwuchsen und der Mutter halfen, die regelmäßig Pakete und Päckchen »nach drüben« schickte. Dort gab es keine demokratischen Verhältnisse, kein Wirtschaftswunder, keinen Schüleraustausch mit den USA. Das erfuhr man als Kind des Westens schon lange bevor die Mauer fiel. Die deutsch-französische Freundschaft brachte vermutlich mehr Annehmlichkeiten mit sich als die deutsch-sowjetische Freundschaft. Aber auch in der DDR gab es rebellierende oder doch zumindest sich verweigernde Jugendliche. Aus der Reihe zu tanzen erforderte bekanntlich viel Mut, es konnte Verhöre durch die Stasi und drastische Gefängnisstrafen nach sich ziehen. Dagegen verblüffte mich, als ich nach der Wende von Gleichaltrigen erfuhr, sie hätten sich nicht geschämt, deutsch zu sein, sie hätten sich wegen der NS-Verbrechen nicht schuldig gefühlt, denn der offiziellen Propaganda zufolge habe man sich als Erben des antifaschistischen Widerstandes gesehen. Um es noch deutlicher zu machen, griff die ehemalige DDR-Bürgerin und Bundesbeauftragte für Stasiunterlagen, Marianne Birthler, zu leiser Ironie. »Hitler war ja, wie Peter Bender es auf den Punkt brachte, Westdeutscher. Wir waren erklärtermaßen der antifaschistische Staat, und es gab auch offizielles und öffentliches Gedenken, aber wir haben über andere geredet, nicht über uns. Denn die Verbrecher– ich sag’s jetzt etwas verkürzt–, die waren alle im Westen.«1
Milder Blick auf die Eltern
Wie nicht anders zu erwarten, ist der Blick der Nachkriegskinder auf die Eltern, die häufig schon tot sind, milder geworden. Man zeigt Verständnis für deren Entsetzen über lange Haare, kurze Röcke, laute Musik und Knutschen in der Öffentlichkeit. Keine Frage, man hat den kaum vom Krieg erholten Erwachsenen viel zugemutet. Aber bereut wird es nicht. Die Zeit war überreif, darum war die Veränderung so radikal, nur noch übertroffen von dem, was den ehemaligen DDR-Bürgern nach dem Mauerfall widerfuhr.
Für einige Nachkriegskinder des Westens scheint die Aufbruchsstimmung, als sie jung waren, das Einzige zu sein, was sich zu erinnern lohnt. Die bleierne Zeit der fünfziger Jahre und die Enge des Elternhauses verschwinden dahinter. Eine Freundin von mir ist sogar überzeugt: »Wir sind die goldene Generation.« Das können die Baby-Boomer von sich nicht behaupten, was wiedereinmal zeigt, dass nur wenige Jahre Altersunterschied in der Gruppe der Nachkriegskinder große Unterschiede im Lebensgefühl erzeugen konnten.
Die meisten biografischen Geschichten haben einen melancholischen Unterton. Menschen, die in der Nachkriegszeit aufwuchsen, werden in den hier veröffentlichten Erinnerungen viel Vertrautes wiederfinden, sie werden sagen: »Das war für uns normal, das ging doch allen so«– doch wenn sie sich mit zehn oder zwanzig Jahre Jüngeren darüber austauschen, werden sie feststellen: In Wahrheit sind es verstörende Geschichten.
Zweites Kapitel
Die gut getarnte Vergangenheit
»Gerade erst den Luftschutzkellern entkommen«
Der Roman »Die Erfindung des Lebens« von Hanns-Josef Ortheil erzählt davon, wie ein kleiner stummer Junge sprechen lernt, und er erzählt von einer Kindheit in den fünfziger Jahren. »Die Jahre des Krieges scheinen noch allgegenwärtig«, heißt es dort, »als wären die Menschen gerade erst den Luftschutzkellern und den Bunkern entkommen und als hätten sie den Staub noch nicht ganz von den Mänteln geschüttelt. Angst und Erschöpfung sind im alltäglichen Leben zu spüren, das viel langsamer verläuft als das Leben heutzutage.«2 Darüber hinaus erzählt das Buch von der Liebe eines Vaters zu seinem Sohn und wie die Vaterliebe ein behindertes Kind stark machte. »Jedenfalls mochte ich meinen Vater sehr, nicht nur wegen seines befreienden Lachens, sondern auch, weil er mich niemals tadelte oder schimpfte oder zu etwas aufforderte, was ich nicht gern getan hätte. Vater und ich– wir verstanden uns gut, auch ohne das ununterbrochene, korrigierende und besserwisserische Reden, das andere Eltern auf ihre Kinder niederregnen ließen.«3
Normalerweise scheuen Romanautoren ein Klima der guten familiären Beziehungen. Der handfeste Generationenkonflikt ist als Stoff weit ergiebiger als ein harmonisches Miteinander. Doch Ortheils Leser– wie man hört, überwiegend den 1950er Jahrgängen angehörend, wie der Schriftsteller selbst– empfinden dieses Buch als erholsame wenn nicht gar heilsame Lektüre, gerade weil es keine Beziehungsdramen enthält und sich der Sohn fast mühelos aus dem hochkomplizierten und viel zu engen Verhältnis zu seiner traumatisierten Mutter löst.
Nachkriegskinder erinnern sich, wie viele Väter und Großväter voller Spannung steckten. Die meisten waren starke Raucher. In der Zigarettenwerbung tauchte in dieser Zeit ein kleiner Kerl auf, der optimistisch sein Tagwerk beginnt, aber dann, sobald eine Kleinigkeit schief läuft, explodiert. Wir liebten die Episoden des HB-Männchens im Kino, bevor der Hauptfilm begann, brachten es allerdings nicht mit den uns gut bekannten Kettenrauchern inVerbindung, denn diese ließen sich, wenn sie ihre Anfälle bekamen, durch einen Zug aus der Zigarette wohl kaum beruhigen. Das leise und liebevolle Zusammenleben in dem Roman »Die Erfindung des Lebens« war fraglos eine Ausnahme. In den meisten Familien ging es erheblich geräuschvoller zu. Davon handeltdie folgende Geschichte, aber auch davon, wie ein Vater die Schrecken seiner Vergangenheit verbarg, wie biografische Erfahrungen sich in Ideologie verwandelten und wie unterschiedlich sich seine Kinder dazu stellten.
Am Familientisch zwei Fraktionen
Wenn im Elternhaus von Martin Best* das Essen auf dem Tisch stand, wurde erst gebetet und unmittelbar danach begann eine laute politische Diskussion. Es gab zwei Fraktionen. Die beiden älteren Geschwister hielten zum Vater, die beiden jüngeren zur Mutter. Hannelore Best* war Feministin und wählte die Grünen, Harald Best* wollte Franz-Josef Strauß als Bundeskanzler und warf den Sowjets Kriegstreiberei vor.
Mein Kontakt zu Martin Best war durch einen gemeinsamen Bekannten zustande gekommen. Während wir zum ersten Mal telefonierten, stellte ich ihn mir mit Designerbrille und Kaschmirpullover vor. Vermutlich lag es daran, dass er als Rahmen für unser Gespräch nicht seine Praxis, sondern ein Mittagessen in einem nicht gerade preiswerten Restaurant vorschlug, woraus ich klischeehaft schloss, er würde auch bei seiner Kleidung nicht sparen. Auf der anderen Seite wusste ich, dass die meisten Psychotherapeuten kein Faible für Anzüge haben. Tatsächlich trug er eine Designerbrille, einen Pullover im Marinestil und ausgebeulte Cordhosen, wie ich sie an Männern kenne, seit ich 20 Jahre alt bin.
Martin Best, geboren 1951, Vater von drei Kindern, ist ein kultivierter Mann. Die Speisen wählt er mit Bedacht, ein trockener Sherry vorweg, ein Glas Rotwein zum Wild. Während des Vorgerichts und der Hauptspeise reden wir über neue Filme und Theaterstücke und über das eingestürzte Archiv in meiner Heimatstadt Köln. Wir sind noch dabei, uns aufeinander einzupendeln. Natürlich will er einschätzen, wie weit er mir vertrauen kann. Er kennt meine Bücher nicht, nur grob deren Inhalte. Erst beim Dessert, einem Zimtparfait, gibt er mir einen ersten Einblick in seine meinungsfreudige Familie, und angesichts seiner ruhigen, abwägenden Art frage ich mich, wie er sich als Jugendlicher am Esstisch überhaupt Gehör verschaffen konnte.
Bei seinen Schilderungen fallen mir die Bundestagsdebatten der siebziger Jahre ein, die leidenschaftlichen, im hohen Maße ideologisierten Kontroversen, teilweise mit üblen Beschimpfungen, teilweise mit hohem Unterhaltungswert und weit entfernt von dem blutleeren Duktus, wie er heute unter der Kuppel des Berliner Reichstags Standard ist. In einer Kleinstadt am Rande des Harzes wurden die Debatten aus Bonn nachinszeniert. Bei Familie Best kreiste man damals um dieselben Themen: die Angst vor den Russen, Ost-West-Entspannung, Freiheit statt Sozialismus, RAF, Nachrüstung, Atomraketen. Langweilig wurde es nie, obwohl am Ende kein Erkenntnisgewinn stand in dem Sinn, dass sich Positionen angenähert hätten.
Politische Wortgefechte mit Subtext
Martin Best glaubt, der Subtext unter den Wortgefechten sei gelegentlich ein anderer gewesen: Die Eltern hätten ihre Paarkonflikte auf die Ebene der politischen Diskussionen verschoben. Auf andere Weise hätten sie nicht aggressiv sein können, erklärt er weiter. Vater und Mutter verstanden sich gut, vielleicht zu gut, und Ehekrach war für sie ein Tabu. Jahre später, bei einer Familienzusammenkunft, als alle Kinder erwachsen waren und die Eltern sich wie gewohnt zu einer neuen Redeschlacht rüsteten, sagte Martins älterer Bruder: »Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder die 37. Aufführung des immer gleichen Stückes, oder damit aufzuhören.« Alle im Raum lachten, und ab diesem Zeitpunkt wurde auf weitere Aufführungen verzichtet.
Martin Best schiebt seinen leeren Dessertteller zur Seite und lehnt sich entspannt zurück. »Meine Eltern haben wirklich dauernd politisch diskutiert«, sagt er, »alle Themen, die aufkamen: die Grünen, Frauenbewegung, Lohn für Hausarbeit, Gewerkschaften, Arbeitnehmerrechte. Als Jugendlicher fand ich das klasse!« So entstand sein Interesse an Politik. Seine Freunde freuten sich, wenn Martin sie mit in sein Elternhaus nahm. Dass sein Vater auch reaktionäre Sprüche klopfte, dass er manchmal abstruse Argumente in die Debatte warf, war dem Sohn nicht peinlich. Mit dieser Aussage überrascht er mich. Schämt man sich nicht, wenn der eigene Vater wie jemand vom Biertisch redet? »Nein«, wiederholt er. »Meine Freunde fanden die Atmosphäre bei uns zu Hause toll: So offen kann man bei euch miteinander reden … Mein Vater hat ja auch mit meinen Freunden diskutiert. Er hat nachher nie gesagt: Was haben die denn für Einstellungen, die will ich nicht mehr sehen. Es waren freundliche Gefechte sozusagen, die fanden wir alle belebend.«
Bei den Eltern einer Freundin lernte Martin ganz andere Gespräche kennen. Da wurde interessiert gefragt: Wie geht es dir denn, was hast du in der Zwischenzeit gemacht, wie läuft dein Studium? Bei ihm zu Hause, sagt er, seien die persönlichen Themen ausgeblendet worden. Es habe wenig Zärtlichkeit gegeben, der Mutter habe es nicht gelegen, ihre Kinder zu trösten oder mit ihnen zu kuscheln. Da seien er und seine drei Geschwister wohl etwas zu kurz gekommen. »Unsere Eltern haben sich schon dafür interessiert, ob es in der Schule klappt«, fügt er hinzu, »aber die Gespräche beim Essen waren von Politik dominiert.«
Martin erwarb am Familientisch die Basis seiner politischen Bildung und seines Engagements für soziale Gerechtigkeit und Frieden. An der Seite seiner Mutter lernte er Empathie für sozial Benachteiligte. Beim Abitur trug er die Haare lang, er verweigerte den Kriegsdienst. In den achtziger Jahren beteiligte er sich an den Blockaden in Mutlangen– symbolträchtiger Widerstand gegen die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen.
Von Jugend an Pazifist
Er bezeichnet sich als Pazifist. Aber gewaltfreier Widerstand, räumt er ein, wäre heute nicht mehr sein Weg. Überzeugender findet er politische Konzepte, wie durch wirtschaftlichen Aufbau Krieg verhindert werden kann. »Den Jugoslawen«, erläutert er, »hätte ich direkt nach Titos Tod gesagt: Ihr kommt in die EU, aber nur als ein gemeinsames Land, ihr bleibt zusammen und wir geben euch 20Milliarden Aufbauhilfe.«
1972 durfte Martin zum ersten Mal wählen, sein Kandidat hieß Willy Brandt. Die Mutter verband mit Brandt eine große Hoffnung, sein Vater befürchtete den Anfang des Sozialismus. Später erkannte der Sohn: Die lautstarken politischen Debatten hatten nicht nur die Funktion Dampf abzulassen, wenn man sich über den Ehepartner geärgert hatte. Auffällig war, dass seine Eltern nur selten Themen der deutschen Vergangenheit berührten, während davon im Fernsehen immer häufiger die Rede war, als im Zuge der Studentenunruhen von 1968 die NS-Verbrechen auf den Tisch der Nation kamen.
Viel, sehr viel hätten Martins Eltern dazu sagen können, wären sie in der Lage gewesen, die Gewalteinbrüche in ihr Leben und das Unglück in ihren Familien zu betrauern. Martin Best weiß viel über Trauer, wie wichtig sie ist, um mit seinem Schicksal Frieden schließen zu können. Zwar gelang es Harald und Hannelore Best, stabil zu bleiben, doch heftige Gefühle, scheinbar von der Vergangenheit abgekoppelt, führten ein Eigenleben und drängten zum Ausbruch. Die Wortgefechte zur aktuellen Politik dienten stellvertretend der emotionalen Entladung. Auf diese Weise gelang es, zumindest kurzfristig, innere Spannungen und Aggressionen loszuwerden.
Der Vater von Hannelore Best, ein Funktionär der Zentrumspartei, war von den Nationalsozialisten verfolgt worden. Auf Grund seiner Kontakte zu Widerständlern des Kreisauer Kreises wurde er mehrfach verhaftet, er verlor seine Arbeit, was die ganze Familie in tiefe Armut stürzte. Martins Mutter stand dem Widerstand ambivalent gegenüber, sie kritisierte die Männer, die ohne Rücksicht auf ihre Familien gehandelt hätten. Ihr Sohn berichtet,sie sei lange überhaupt nicht stolz auf ihren Vater gewesen, sondern habe die Meinung vertreten, nur Junggesellen und Priester dürften sich dem Widerstand anschließen. »Die Geschichte meines Opas wurde früher genauso verschwiegen wie die Kriegsgeschichte meines Vaters«, berichtet Martin Best. Lange Zeit konnte Hannelore ihrem Vater nicht verzeihen, sie gab ihm die Schuld an Angst, Not und Unglück in ihrer Kindheit. Grundsätzlich warf sie ihm unverantwortliches Verhalten gegenüber der Familie vor. Sie selbst wandte sich linken politischen Positionen und dem Feminismus zu, organisierte sich politisch. Sie praktizierte Gleichberechtigung unter ihren Kindern; auch die Söhne wurden zur Hausarbeit herangezogen. Inhaltlich folgte sie der Linie ihres Vaters.
Mit 12 Jahren hatte Hannelore ihre Mutter bei einem Bombenangriff verloren. Das Haus war zerstört worden. Die Familie kam auf einem Bauernhof unter, wo die Kinder dankbar sein mussten, wenn sie Abfälle essen durften. Der Vater starb nach Kriegsende an den Haftfolgen.
Später verlor Hannelore Best eine Tochter. Sohn Martin kommt zu dem Schluss: Die ersten Verluste seiner Mutter fielen in Zeiten des Überlebenskampfes, Innehalten war nicht möglich gewesen und daher hatte sie Trauern nicht gelernt.
Eine Konsequenz war ihre Partnerwahl. Mit Harald Best hatte