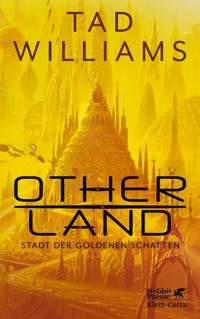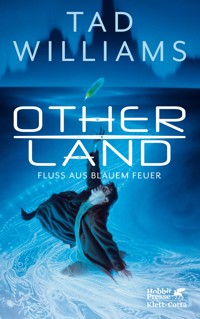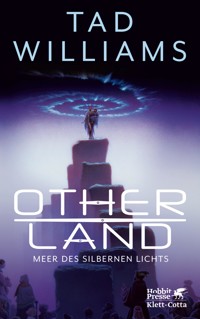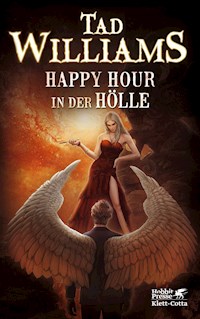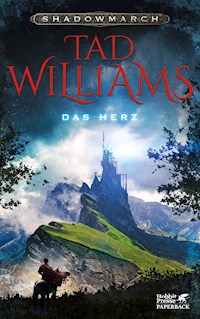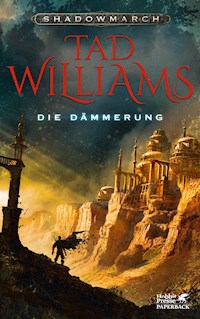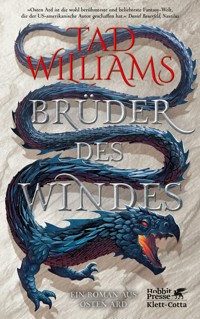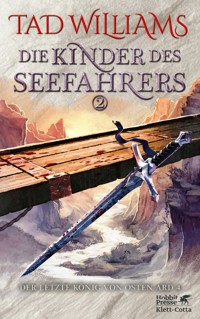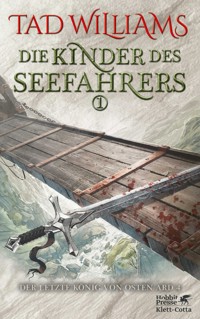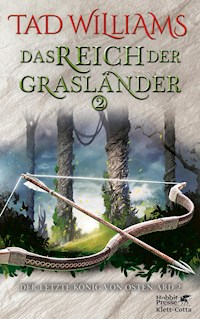
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der letzte König von Osten Ard
- Sprache: Deutsch
Dreißig Jahre herrschten König Simon und Königin Miriamel über ihre Königreiche in Frieden. Aber nun ist die totgeglaubte Nornenkönigin Utuk'ku wiedererwacht, und ein neuer Krieg wirft seine Schatten voraus. In dem riesigen Panorama der Völker von Osten Ard wird es vor allem auf zwei Einzelne ankommen: Prinz Morgan, den unzuverlässigen Thronfolger, und Unver, einen stolzen und grausamen Wilden, vom Volk der Graslandbewohner. In den weiten Ebenen des Graslandes mit ihren Nomadenclans hat eine Legende Gestalt angenommen: Dem geheimnisvollen Unver ist gelungen, was seit unzähligen Jahren niemand mehr geschafft hat. Er hat die wilden Kämpfer geeint. Von ihrem alten Hass auf alle Stadtbewohner getrieben, werden sie zur tödlichen Bedrohung für die Länder und Völker des Hochkönigtums. Aber die sind viel zu sehr mit kleinlichen Streitereien und Intrigen beschäftigt, als dass sie die Gefahr erkennen. »Tad Williams entfaltet ein riesiges bewegendes Panorama und knüpft die Erzählstränge gekonnt zu einem Ganzen.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tad Williams
Der letzte König von Osten Ard 2
Aus dem Amerikanischen von Cornelia Holfelder-von der Tann und Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Wegen des großen Textumfangs erscheint Das Reich der Grasländer. Der letzte König von Osten Ard 2 in zwei Teilbänden.
Die Übersetzung der Kap. 1–14 und 32–43 entstand mit Unterstützung des Europäischen Übersetzerkollegiums Straelen und der Kunststiftung NRW.
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Empire of Grass.
The Last King of Osten Ard« im Verlag DAW Books, New York
© 2019 by Beale Williams Enterprise
© Karten by Isaac Stewart
Für die deutsche Ausgabe
© 2020, 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg
Illustration: © Max Meinzold, München
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98502-3
E-Book: ISBN 978-3-608-11635-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
32
Das Guckloch in der Tür
33
Schatten auf den Mauern
34
Schilfbündel
35
Die Farben zu grell
36
Sturmwind
Dritter Teil
Winterfrost
37
Schlangen auf dem Weg
38
Zwei Angebote
39
Die Stätte der Stimmen
40
Das Blut ihrer Feinde
41
Ein Herz aus Asche
42
Ein Pfeil
43
Etwas für die Armen
44
Aufbruch
45
Der Staub alter Gedanken
46
Die Sorgen des Bischofs
47
Die Pflicht, gut zu sterben
48
Im Palast
49
Die Straße des Sammlers
50
Ein Pulver aus Drachenbein
51
Ein Netz über dem Himmel
52
Die Gruft
53
Rauch
54
Tote Vögel
55
Mein Feind
Nachwort
Dank
Glossar
Personen
Erkynländer
Hernystiri
Rimmersgarder
Qanuc
Thrithingbewohner
Nabbanai
Perdruineser
Wranna
Sithi (Zida’ya)
Nornen (Hikeda’ya)
Tinukeda’ya
Andere
Geschöpfe
Orte
Sonstige Namen und Begriffe
Sterne und Sternbilder
Die Feiertage
Die Wochentage
Die Monate
Wurfknöchel
Nornenorden
Die Clans der Thrithinge (und ihr Thrithing)
Wörter und Sätze
Qanuc
Sithi (Keida’yasao)
Nornen (Hikeda’yasao)
Nabbanai
Sprache der Thrithinge
Wranna
Anderes
Das letzte Kapitel von Teil 1 endete mit den Abschnitten:
Sie hatten sich über alle möglichen Eventualitäten gestritten, aber jetzt hieß es ganz konkret, in einem fremden Land von ihren Eltern Abschied zu nehmen. Sie holte tief Luft. »Wir werden gut auf uns aufpassen. Schließlich möchte ich meinen Hochzeitstag noch erleben. Habt bitte keine Angst. Ihr habt uns alles beigebracht, was wir brauchen.« Sie spürte, wie ihr Tränen in die Augen traten, und wischte sie mit dem Ärmel weg. »Ihr werdet stolz auf uns sein.«
»Das sind wir sowieso immer.« Binabik schien in der vergangenen Stunde um mehrere Jahre gealtert zu sein. »Aber jetzt hört mir gut zu, bevor ich doch noch meine Meinung ändere und euch am Sattel festbinde, wie deine Mutter vorgeschlagen hat.«
»Das habe ich nicht«, protestierte Sisqi.
»Ich weiß doch, meine Liebe. Manchmal mache ich einen Scherz, um meine Angst zu verdrängen.« Er runzelte die Stirn und überlegte. »Die Sterne, die dort, wo die Sithi leben, so unzuverlässig sind, sind auch hier merkwürdig anders – ohne dass ich wüsste, warum. Vielleicht stellt ihr also fest, dass der Weiße Bär und die Alte Frau als Orientierung nicht mehr geeignet sind. Aber wenn ihr dem Weg, den wir in den letzten Tagen gegangen sind, in Richtung der untergehenden Sonne folgt, werdet ihr zuletzt die Waldhelm-Berge erreichen. Auf der anderen Seite dieser Bergkette liegt Naglimund, eine Festung von Simon und Miriamel.« Binabik nahm ein Stöckchen und kratzte eine Karte in den Boden. »In ein oder zwei Tagen könntet ihr auf eine alte Sithi-Stadt namens Da’ai Chikiza stoßen. Sie liegt am Fluss Aelfwent, der auf dieser Seite des Waldhelm fließt. Von dort führt ein ›Zauntritt‹ genannter Weg in die Berge hinauf und zu der Burg. Dort könntet ihr Hilfe bekommen. Und wenn ihr Morgan findet, bringt ihn nach Naglimund, wo er in Sicherheit ist.«
»Warum wollt ihr beide dann zum Hochhorst zurückkehren? Warum kommt ihr nicht mit uns nach Naglimund und schickt euren Freunden von dort eine Nachricht?«
»Weil ich böse Vorahnungen habe und Boten nicht traue, Qina«, sagte ihr Vater. »Zu viele seltsame und schreckliche Dinge sind in letzter Zeit passiert. Erinnerst du dich an die Gesandte der Sithi, Tanahaya? Man hat ihr aufgelauert, als sie zu Simon und Miriamel unterwegs war, und sie wäre gestorben, wenn man sie nicht glücklicherweise gefunden hätte. Jemand wollte verhindern, dass sie mit unseren Freunden spricht, und man weiß bis heute nicht, wer dieser Jemand war. Entweder die kalte Hand der Nornenkönigin reicht bis zu den Toren des Hochhorst oder ein Feind, von dem unsere Freunde nichts wissen, lebt unter ihnen. Nein, ich habe kein Vertrauen mehr zu Boten, nicht wenn es um eine so wichtige Nachricht geht.«
»Aber dann seid ihr ja auch in Gefahr!«, rief Qina. »Die Person, die die Sitha überfallen hat, kann genauso gut euch überfallen und verhindern, dass ihr zu euren Freunden gelangt.«
Binabik nickte. »So ist das, wenn eine Familie getrennt ist. So wie wir um euch zwei Angst haben müssen, wenn ihr allein seid, müsst ihr um uns Angst haben. Wir haben nur unser Leben und die wenigen Stunden, mit denen wir es ausfüllen. Lasst uns zur Tochter des Berges beten, dass wir uns alle wiedersehen. Vergesst unsere Heimat nicht und habt Mut.«
Als der Abschied kam, hatten alle Tränen in den Augen, sogar Klein-Snenneq, obwohl er dafür den Staub verantwortlich machte, den die sommerliche Brise aufwirbelte.
32
Das Guckloch in der Tür
Porto gelang es, Feldwebel Levias lebend über die Nacht und auch über den ganzen nächsten Tag zu bringen. Er flößte ihm aus der hohlen Hand Wasser ein und säuberte und verband die Bauchwunde des Erkynländers, so gut er konnte, aber es schien ein verlorener Kampf, und das war quälend. Er hatte diesen Albtraum schon einmal durchgemacht.
Viele Jahre zuvor, während der Schlacht am Tor von Nakkiga, hatte Porto seinen sterbenden Freund Endri gepflegt. Doch Endris Wunde war von einem vergifteten Nornenpfeil verursacht worden. Diese hier stammte von einer vergleichsweise sauberen Grasländerklinge, und das war das Einzige, was ihm Hoffnung machte. Aber es war weit bis zur nächsten Wasserstelle, und so heiß die Haut seines Gefährten auch war und so mitleiderregend sein Verlangen nach etwas zu trinken, ließ er ihn doch äußerst ungern allein. Endri war damals gestorben, als Porto gerade weg war.
Das Chaos, das unter den Massen beim Thantreffen ausgebrochen war, schien sich inzwischen gelegt zu haben. Ab und zu hörte Porto von ihrem Versteck aus immer noch laute Stimmen von Thrithingmännern, aber das Rufen und Brüllen klang jetzt nicht mehr nach Kampf. Trotzdem hielten ihn nicht nur sein Stolz und sein Schmerz hier bei dem Sterbenden. Selbst wenn Levias seiner Verletzung erläge und Porto ihn zurücklassen könnte, erwartete ihn dort draußen auch nur ein langsames, qualvolles Ende. Ihre Pferde waren davongelaufen, und den ganzen Weg nach Erkynland zu Fuß zurückzulegen, war undenkbar, selbst wenn er zwanzig Jahre jünger wäre.
Aber solange ich mein Schwert und meinen Dolch habe, sagte er sich, kann ich zumindest selbst bestimmen, wie ich sterbe.
Als Levias bei Anbruch des zweiten Tages nach ihrem Kampf mit den Grasländern etwas leichter atmete, wagte es Porto, sich mit ihm auf die Suche nach Wasser zu begeben. Er hievte ihn sich auf den Rücken, stapfte mühsam ein Stück weiter vom Thantreffen weg und ließ sich dann mit Levias am Ufer eines der Flüsse nieder, die den Blutsee speisten. Der Fluss war jetzt im Spätsommer flach und schmal, nur ein Bächlein zwischen den breiten Schlammstreifen zu beiden Seiten, aber das Wasser floss und schmeckte Porto köstlich, also lehnte er Levias an einem schattigen Plätzchen gegen einen Baumstamm, wusch das blutige Unterhemd des Verwundeten aus, nahm es wieder mit zurück, wischte Levias den Schweiß von der Stirn und versuchte dann erneut, die Wunde zu säubern. Er hatte auf dem Schlachtfeld viele solcher Wunden gesehen und wusste, es bestand kaum eine Überlebenschance für den Feldwebel, aber ihn hier allein seinem Schicksal preiszugeben – das wäre, wie den armen Endri ein zweites Mal im Stich zu lassen.
Er saß den ganzen Tag bei Levias, verrückte ihn ab und zu ein wenig, damit ihm die heiße Sonne nicht ins Gesicht schien, säuberte seine Wunde von dem dunklen, trocknenden Blut und gab ihm Wasser zu trinken, wenn er durstig schien. Er konnte sich nicht vorstellen, ihn eine längere Strecke zu tragen, also blieb ihm nur zu warten, dass Gott seinen Freund zu sich nahm. Levias sagte nichts mehr, und Porto hatte nur seine eigenen düsteren Gedanken zur Gesellschaft.
Porto schreckte hoch. Er war eingedöst und von einem seltsamen Geräusch wach geworden, einem langgezogenen, rauhen Quietschen, als ob ein Nagel aus altem Holz gezogen würde. Es kam vom Bach her, also überzeugte sich Porto nur kurz, dass Levias’ flaches Atmen nicht aufgehört hatte, ergriff dann sein Schwert und kroch durch den Unterwuchs, bis er bessere Sicht auf den Fluss hatte.
Zuerst hielt er die Gestalt für eine Art Riesen, weil sie so groß und massig auf ihrem Pferd thronte, das aus dem schmalen Fluss trank. Dann aber sah er, dass der Fremde gar nicht außergewöhnlich groß war, sondern nur so wirkte, weil er auf einem kleinen Esel saß.
Der Mann drehte sich in seine Richtung, obwohl Porto kein Geräusch gemacht hatte. Porto fasste sein Schwert fester, bereit, zu kämpfen oder den Fremden von dem hilflosen Levias fortzulocken, aber der Mann auf dem Esel nickte nur und wandte sich wieder ab, als wären Männer, die mit gezücktem Schwert durchs Gras robbten, für ihn nichts Ungewöhnliches. Er hatte einen breiten Brustkorb, aber kurze Beine – als ob einer von Prinz Morgans Trollfreunden mannsgroß geworden wäre, nur dass er, anders als die Trolle, einen langen, zu einem Zopf geflochtenen Bart trug. Sein Bart- und Haupthaar bedeckte große Teile seines Gesichts, als wäre er ein Halbaffe oder ein Halb-Hune, aber ansonsten wirkten seine Züge ziemlich normal.
»Vilagum«, rief der Fremde. »Ves zhu haya.«
Es dauerte einen Moment, bis Porto verstand, was der Mann in der Grasländersprache gesagt hatte: nichts Bedrohlicheres als »Willkommen« und dass er ihm Gesundheit wünsche.
»Zhu dankun«, antwortete er – ich danke Euch.
Der Bärtige merkte, dass das nicht Portos Muttersprache war, denn er verfiel jetzt in ein recht gutes Westerling, allerdings mit einem starken Akzent, jedes Wort so stachelig wie ein Kiefernzapfen. »Ihr seid nicht vom großen Gras, wie ich höre. Woher kommt Ihr?«
»Erkynland, obwohl ich nicht dort geboren bin.«
»Trüben wir den Bach, mein Freund Gildreng und ich? Wollt Ihr trinken? Gildreng hat seinen eigenen Willen, aber er wird wohl weggehen, wenn ich darauf bestehe.«
»Ich habe Wasser in meinem Wasserschlauch«, antwortete Porto und blickte sich suchend nach dem Freund des Mannes um. Er wollte dem Fremden gern vertrauen, fürchtete jedoch einen Hinterhalt. »Aber nichts zu essen.« Ihre letzten Vorräte waren in den Satteltaschen gewesen und mit den Pferden verschwunden. Erst, als er die Worte aussprach, merkte Porto, wie hungrig er war. »Meinem Freund geht es sehr schlecht.«
Der Mann musterte ihn. »Kommt heraus, damit ich Euch sehen kann, bitte«, sagte er.
Porto kroch aus dem langen Gras hervor und stand auf. Der Fremde war ein Thrithingbewohner, das sah er jetzt, mit einer tätowierten Schlange, die sich vom rechten Handgelenk den Arm hinauf und dann auf der anderen Seite des ärmellosen Hemds zum linken Handgelenk hinabwand. Er trug auch eine Halskette aus Schlangenknochen.
»Warum geht es Eurem Freund schlecht?«, fragte der Mann.
Porto zögerte, befand dann aber, dass es besser war, ehrlich zu sein, für den Fall, dass der Fremde jemanden kannte, der Levias helfen konnte. »Er hat eine Klinge in den Leib bekommen. Hier.« Er zeigte auf eine Stelle an seinem eigenen Bauch. »Wir wurden angegriffen – wir haben keinen Streit gesucht.«
Der Bärtige nickte, glitt dann von seinem Esel. Er kam durchs seichte Wasser herangewatet und führte den Esel zu Porto hinauf.
»Ich sehe es mir an«, sagte er. »Ich habe einige … Kenntnisse.« Er fand das Wort nicht gleich, aber als er es gefunden hatte, nickte er wieder, als hätte er nicht daran gezweifelt, dass es ihm einfallen würde. »Ruzhvang bin ich, Schamane des Schlangen-Clans. Ich verstehe etwas vom Heilen. Wann wurde Euer Freund verletzt?«
»Vor zwei Tagen«, sagte Porto.
Ruzhvangs haariges Gesicht nahm einen betrübten Ausdruck an, und er schüttelte den Kopf. »Zu spät, fürchte ich. Aber vielleicht erbarmt sich die Erdnahe. Von welchem Clan ist Euer Freund?«
»Er ist aus Erkynland, wie ich.«
Ruzhvang sagte nichts mehr, folgte ihm nur zu der Mulde, in der Levias lag. Der Schamane band seinen Esel an einen Ast und hockte sich neben den Verwundeten, der immer noch schlief, aber jetzt so bleich war, dass der Tod wohl nicht mehr fern sein konnte. Der Bärtige inspizierte Levias’ Augen und Zunge, löste dann vorsichtig Portos Behelfsverband und betrachtete die Wunde, wobei er leise mit der Zunge klickte.
Schließlich drehte er sich zu Porto um. »Habt Ihr um Hilfe gebetet?«, fragte er.
Verdutzt sagte Porto: »Ja, natürlich. Zu unserem Gott.«
Ruzhvang winkte ab. »Alle Götter sind ein Gott. Man muss ein Mann der guten Taten sein, damit sie einen hören. Wir vom Schlangen-Clan sind die besten Heiler, das ist bekannt.«
»Könnt Ihr ihm helfen?«
»Ich sage nicht Ja, ich sage nicht Nein. Er ist sehr schwach.« Er vergewisserte sich, dass sein Esel gut festgebunden war. »Die bösen Geister sind in der Wunde und im Blut. Nur die Beinlose – die Erdnahe – kann ihm jetzt noch helfen, indem sie ihm Kraft schenkt. Bringt Ihr ihn?«
»Bringen? Wohin?«
»Mir nach. Dahin, wo das Wasser tiefer ist.«
Als sie stehenblieben, waren sie wieder so nah bei dem Thantreffen, dass Porto ferne Stimmen hörte. Ruzhvang nahm ein in Öltuch gehülltes Bündel aus seiner Satteltasche, ging dann hinunter zum Fluss, der hier wesentlich breiter war, zog, ohne zu zögern, seine Kleidung aus und watete nackt so weit hinaus, dass ihm das Wasser bis an die Oberschenkel reichte. Dann begann er, sich von oben bis unten zu waschen, und sang dabei in der Sprache der Thrithinge leise etwas, das Porto nicht verstand. Als er zurückkam, zog er die Hose wieder an und setzte sich neben Levias auf die Erde. »Macht ein Feuer«, sagte er. Er entnahm seinem Öltuchbündel verschiedene Dinge, kleine irdene Töpfchen und Lederbeutel, und ordnete sie vor sich auf dem Boden an. Als das Feuer richtig brannte, schickte Ruzhvang Porto mit einer Tonschüssel los, Wasser aus dem Bach holen. Dann bröselte er, noch immer singend, etwas Blättriges in die Schüssel und wartete, dass das Wasser zum Kochen kam. »Jetzt sagt mir, wie er heißt.«
»Levias.«
»Das ist ein seltsamer Name, aber ich will versuchen, ihn den Geistern so zu sagen, dass sie es verstehen.«
Als die Sonne den Mittagspunkt überschritten hatte und die Schatten sich nach Osten dehnten, hatte der Schamane, die ganze Zeit singend, Levias’ Wunde mit dem Kräutersud ausgewaschen, dann mit den ausgekochten Blättern bedeckt und mit einem Verband aus langen, getrockneten Blättern, die er einem anderen Bündel in seiner Satteltasche entnahm, versehen. Danach hatte er Porto wieder Wasser holen geschickt und dieses Wasser mit Stücken einer Wurzel oder Knolle zum Kochen gebracht. Als der Sud ein wenig abgekühlt war, flößte er Levias etwas davon ein. Die Kehle des Erkynländers bewegte sich, aber es wirkte fast zufällig. Der Feldwebel sah kein bisschen besser aus, jedenfalls nicht in Portos Augen.
»Gebt ihm den Rest nach und nach«, sagte Ruzhvang und reichte Porto die Schüssel. »Bis die Sonne untergegangen ist. Die Beinlose wird ihm helfen, wenn er es wert ist.«
»Ist er«, sagte Porto und dachte an den Humor, die Tapferkeit und den festen Glauben des Erkynländers.
»Das entscheiden nicht wir, sondern die Geister«, sagte Ruzhvang ein wenig streng. »Doch jetzt zu Gildreng, meinem Esel. Er ist temperamentvoll, aber wenn Ihr nicht mit der Hand in die Nähe seines Mauls kommt, wird Euch nichts passieren.«
»Was? Warum sagt Ihr mir das?«
»Weil ich ihn Euch hierlasse. Ich bin weit hinter meinen Leuten zurück, und wenn ich jetzt zu Fuß gehe, werde ich noch länger brauchen. Vor sechs Tagen sind sie vom Thantreffen aufgebrochen, zurück in unsere Clanlande im Osten.«
»Ihr gebt mir Euren Esel?«
»Selbst wenn die Erdnahe sein Leben verschont, kann Euer Freund nicht hier bleiben«, sagte er und zeigte auf Levias. »Aber auch mit meinem Esel bringt Ihr ihn nicht lebend bis nach Erkynland.« Plötzlich kam ihm ein Gedanke. »Doch ich habe ein Lager von Euren Leuten gesehen, als ich von Geschäften mit den Schamanen des Turmfalken- und des Bison-Clans zurückkam.«
»Ein Lager von meinen Leuten?«
»Ich glaube, es war die Fahne von Erkynland, zwei Drachen und ein Baum. Sagt Euch das etwas?«
Portos Herz schlug schneller. »Das ist die erkynländische Fahne, ja. Die habt Ihr wirklich gesehen?«
»Man hört es gerade in der ganzen Gegend nördlich von hier – die Clansleute sagen, die Steinhäusler sind hier, um mit dem neuen Shan um einen wichtigen Mann zu verhandeln, der gefangen genommen wurde.«
»Graf Eolair? Könnte er so heißen?«
»Ich weiß nichts weiter. Ein Schamane denkt über andere Dinge nach.« Er zuckte die Achseln, und sein Bartzopf bewegte sich auf seiner Brust wie der Schwanz eines sitzenden Hunds. »Sie sagen, Unver will vielleicht Lösegeld oder irgendetwas anderes von den Steinhäuslern, die Euer Erkynland regieren.«
»Wisst Ihr, wo sie den Gefangenen festhalten?«
Ruzhvang hob eine Augenbraue, so borstig wie eine Raupe, und in seinem dunkel gebräunten Gesicht stand Belustigung. »Da fragt Ihr den Falschen. Die Schlange gibt mir die Kraft zu heilen und weiter nichts. Aber wenn der neue Shan über seine Rückgabe verhandelt, dann muss ihn der neue Shan ja wohl haben, oder?«
Porto saß verwundert da. Warum war ein ganzer Trupp von Erkynwachen am Rand der Thrithinge? Doch nicht, um über Eolair zu verhandeln, so wichtig er auch sein mochte. Und dann fiel ihm Prinz Morgan ein, und Scham traf ihn so tief und schmerzhaft, wie die Klinge des Clansmanns Levias getroffen hatte. Er hatte auf der ganzen Linie versagt. Aber wenn er dieses erkynländische Lager fände, könnte er dort zumindest erzählen, was er wusste.
Aber ich kann Levias nicht zurücklassen, wurde ihm wieder klar. Ich muss bei ihm bleiben, solange … solange er lebt.
»Ich gehe jetzt«, sagte Ruzhvang. Er nahm die Satteltaschen vom Rücken des Esels und hängte sie sich über die Schultern, wodurch er noch eiförmiger aussah als vorher. »Ich lasse Euch und Eurem Freund weiße Johannisbeeren hier – das Häufchen da. Ihm müsst Ihr sie vorkauen.«
»Aber ich kann doch Euren Esel nicht behalten!«
»Ihr könnt. Ihr müsst. Die Erdnahe sagt es mir, und die Geister lügen nicht. Behandelt ihn gut, dann wird er Euren Freund behutsam tragen. Er ist nicht so schlimm, wie er tut, der alte Gildreng, obwohl er tritt, wenn er schlechter Laune ist. Ich werde ihn vermissen.«
Und während Porto verblüfft zusah, tätschelte Ruzhvang dem Esel noch einmal die Nase – wobei Gildreng wegguckte, als könnte er nicht glauben, dass er einfach so verschenkt wurde – und marschierte dann mit seiner Last davon, den gewundenen Weg am Fluss entlang.
»Denkt dran – Hände weg von seinem Maul!«, rief er noch, dann war er im Wald verschwunden.
Porto saß den Rest des Nachmittags bei Levias, tupfte ihm den Schweiß von der Stirn und verabreichte ihm kleine Schlucke von dem Sud. Er hatte Hunger, aber der Geruch des Gebräus reizte ihn gar nicht, also aß er zwei Beeren und fand sie sehr gut, nur nicht gerade sättigend.
Als es schließlich dunkel war, schlief er im Sitzen ein, Levias’ nasses Hemd noch in der Hand. Und als er mitten in der Nacht aufwachte, sicher, dass er diesen ganzen Tag nur geträumt hatte, war der Esel Gildreng immer noch an dem Baum festgebunden und Levias verlangte matt nach etwas zu essen.
◆
Eolair gefiel es nicht sonderlich, immer noch gefangen zu sein, aber Unvers Leute behandelten ihn einigermaßen gut. Man hatte ihn in einen der vielen Wagen gesperrt, die Rudur gehört hatten. Die Tür war von außen abgeschlossen, aber das Fenster in der Tür – zu klein, als dass er sich selbst in seinen schlanksten Jugendjahren hätte hindurchwinden können – ermöglichte ihm immerhin, etwas vom Lagerleben der Thrithingleute mitzubekommen, jetzt, da sich das Thantreffen dem Ende näherte.
Der Aufruhr der ersten Nächte nach Rudurs Tod hatte sich gelegt. Eolair hätte nur schwer einen Unterschied zwischen dem, was er jetzt sah, und dem normalen Tun und Treiben am Blutsee benennen können: Die Frauen kümmerten sich um die Feuer und kochten, die Männer feilschten um Tiere und beteiligten sich an Glücks- und Kraftspielen. Doch Eolair glaubte, eine Veränderung der Stimmung wahrzunehmen, von der ziellosen Erregung der ersten Tage des Thantreffens hin zu etwas Ruhigerem, Gerichteterem. Er fragte sich, ob das irgendwie Unvers Werk war oder ob diese Entwicklung jedes Jahr gegen Ende der wilden Versammlung zu beobachten war.
Als das erste Mal Essen zu seinem Wagen gebracht wurde, stellte Eolair belustigt fest, dass der Mann mit dem Tablett von zwei hünenhaften, bewaffneten Wächtern begleitet wurde.
Wenn sie einen alten Mann wie mich so sehr fürchten, dass sie gleich drei Mann schicken, müssen sie ihn für einen wahren Teufel halten, dachte er.
Doch als der Mann mit dem Tablett die Wagentreppe hinaufstieg und vor das Türfenster trat, sah Eolair, dass er auf Kopf, Kinn und Oberlippe völlig haarlos war. Das war schon ungewöhnlich genug hier im Grasland, wo der Schnurrbart viel über einen Mann aussagte, doch als der Essensträger vor dem Guckloch stand, bemerkte der Graf, dass der Mann auch keine Augenbrauen hatte, obwohl Stoppelwuchs an diesen Stellen darauf hindeutete, dass seine Kahlheit durch etwas anderes als Krankheit verursacht sein musste. Wie auch immer, Eolair brauchte Informationen, und selbst wenn der Mann ein ausländischer Sklave war, wusste er vielleicht etwas. Ja, ein Sklave, dachte Eolair, war oft eher bereit, mit einem Außenseiter zu reden. Er vergewisserte sich, dass die beiden zum Clan gehörigen Wächter zu weit vom Wagen weg standen, um viel hören zu können.
»Ich danke dir«, sagte er in der Thrithingsprache, als er das Tablett entgegennahm. »Wie heißt du, Mann?« Vom Geruch des warmen Brots und der Suppe lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Er war bei Agvalts Banditen nicht sonderlich gut verpflegt worden, allerdings war ihr eigenes Essen auch nicht viel besser gewesen.
Der Mann sah ihn milde überrascht an, sagte aber nichts. Von nahem erkannte Eolair, dass sein Gesicht und sein rasierter Schädel Misshandlungsspuren aufwiesen.
»Bei meinem Volk muss man den Namen desjenigen kennen, der einen bedient, sonst darf man nicht essen«, sagte Eolair, eine Behauptung, die die meisten hernystirischen Adligen zum Brüllen komisch gefunden hätten, denn kaum einer kannte die Namen all seiner Diener. »Bitte sag mir deinen, damit ich ihn meinen Göttern mitteilen kann.«
Der Mann schüttelte den Kopf. Er sah Eolair nicht an. »Ich habe keinen Namen«, erwiderte er nur.
»Was? Jeder hat doch einen Namen.«
Der Haarlose schüttelte wieder den Kopf, sah aber diesmal auf. Sein Gesicht war so voll Hass und Verzweiflung, dass Eolair beinahe einen Schritt zurückgewichen wäre und Mühe hatte, sein Ende des Tabletts festzuhalten. »Mein Name wurde mir genommen«, sagte der Mann, aber so leise, dass es die anderen nicht hören konnten. »Ich habe meinen Clan verraten. Ich habe mein Volk verraten. Ich habe keinen Namen mehr.«
»Aber irgendwie muss ich dich nennen«, sagte Eolair, den die Worte dieses Mannes neugierig machten, »oder die Götter werden nicht wissen, wen sie dafür belohnen sollen, dass er mir zu essen gegeben hat.«
Ein Funke glomm in den Augen des Mannes auf. Die Haut um die Augen herum war lila von alten Blutergüssen. »Ich sag doch, ich habe keinen Namen. Jetzt muss ich gehen.«
Als er das Tablett losließ und sich zum Gehen wenden wollte, versuchte es Eolair noch einmal. »Ich will dich einfach nur irgendwie nennen können.«
Die nicht vorhandenen Augenbrauen gaben dem Mann etwas Unnatürliches. »Sie nannten mich Kahlkopf.« Kurz verzog sich sein Mund zu einem humorlosen Grinsen. »Das passt immer noch, wie Ihr seht. Wenn Ihr mit Euren Göttern sprecht, sagt ihnen, sie haben eine lausige Welt erschaffen.«
Die beiden Clansmänner folgten ihm auf den Fersen, als er ging, und Eolair begriff, dass er nicht der einzige Gefangene im Lager des Shans war.
Den zweiten Besuch erhielt Eolair in den dunklen Abendstunden desselben Tages. Er hörte niemanden kommen, bemerkte erst, dass da jemand war, als eine weibliche Stimme durch das Türfenster drang.
»Graf Eolair, hört Ihr mich?« Wer auch immer die Frau war, sie sprach überraschenderweise Westerling, wenn auch mit einem starken Akzent.
Er stand von der schmalen Pritsche auf und trat an die Tür. »Ich höre Euch«, sagte er. »Ich spreche Eure Sprache, jedenfalls einigermaßen. Wäre Euch das lieber?«
Die Frau, die vor der Tür des Wagens stand, war dunkelhaarig und hübsch, wirkte aber angespannt. Im schummrigen Licht, das aus dem Wagen fiel, schien sie knapp jenseits des gebärfähigen Alters. Irgendetwas an ihr kam ihm bekannt vor, aber er hatte in den letzten Monaten so viele Thrithingleute gesehen, dass er nicht sagen konnte, woher. »Nein!« Sie blickte sich um und sagte dann leiser: »Lieber diese Sprache, obwohl ich sie nicht gut kann. Für den Fall, dass uns jemand hört.«
Sein Interesse war geweckt – nicht nur durch ihr schönes Gesicht. »Wie Ihr wünscht, edle Dame.« Diese höfliche Anrede drängte sich ihm auf – sie schien so anders als die Thrithingfrauen, denen er bisher begegnet war, schon deshalb, weil sie noch eine andere Sprache beherrschte als ihre eigene. »Wer seid Ihr, wenn ich fragen darf, und was wollt Ihr von mir?«
»Ich bin Hyara«, sagte sie. »Der Shan, wie ich ihn jetzt nennen muss, ist mein Neffe.«
Er war verblüfft und konnte es nur dank der Routine des altgedienten Diplomaten verbergen. »Sehr erfreut, edle Hyara, aber ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was Euch zu mir führt.«
»Unver hat vor, Euch freizulassen – soweit ich weiß jedenfalls.«
»Das hat er mir gegenüber auch angedeutet, aber ich bin sicher, er wird einen Preis dafür fordern, und vielleicht sind mein König und meine Königin ja nicht willens, ihn zu zahlen.«
»Unver ist kein Narr. Er will, dass Ihr heimkehrt. Er will sich Eure Herrscher gewogen halten. Er will keinen Krieg mit Eurem Erkynland.«
»Es ist nicht mein Erkynland, um ehrlich zu sein, aber die erkynländischen Interessen sind auch die meinen.« Er musterte sie. Sie wirkte unruhig, aber nicht verängstigt, ein gutes Zeichen. Dennoch konnte er nicht umhin, sich zu fragen, ob er hier in eine familiäre Auseinandersetzung oder gar etwas noch Gefährlicheres hineingezogen werden sollte. »Ich frage noch einmal, was wollt Ihr von mir?«
»Ich möchte, dass Ihr Eurem König und Eurer Königin sagt, die Thrithinge wollen keinen Krieg mit Eurem Land. Rudur ist tot, aber Unver ist kein Narr. Sein Zorn richtet sich gegen Nabban. Sagt das Euren Herrschern.«
»Aber Nabban gehört auch zu ihrem Königreich«, erklärte er. »Sie sind nicht nur die Herrscher von Erkynland und meiner Heimat Hernystir. Der Hochkönigsbann umfasst auch Nabban.«
»Dann müssen die Nabbanai innerhalb dieses Banns bleiben!«, sagte sie in einem Aufblitzen von Zorn, und er erkannte jetzt in ihr eine Willensstärke, die er nicht vermutet hätte. »Sie stehlen unser Land, sie töten unsere Leute, und dann geben sie uns die Schuld. Unver kommt aus dem Süden, wo sie immer gegen die Steinhäusler kämpfen müssen. Er hasst sie wie …« Sie suchte nach einem Wort, fand es aber nicht. »Er hasst sie«, sagte sie schließlich. »Und er wird sie hinter ihre Grenze zurücktreiben. Blut wird das Gras tränken, und nichts kann das verhindern. Aber er will nicht auch noch Krieg gegen den Norden.«
»Warum sollte er auch? Nur ein Narr kämpft an zwei Fronten.« Eolair schüttelte den Kopf. »Ich werde meinen Herrschern sagen, dass Unver nicht gegen sie kämpfen will. Aber trotzdem müssen sie über Nabban wachen, als wäre es ihr eigenes Land. Das ist es, was Hochkönigsbann bedeutet.«
»Dann werden sie die Welt in Verzweiflung stürzen«, sagte sie rundheraus. »Witwen und Waisen, das ist alles, was dann bleibt. Wisst Ihr, wie viele Männer aus dem Grasland zusammenkommen werden, um zu kämpfen? Viele haben Rudur gehasst, weil er sich zum Than der Thane erklärt und trotzdem nichts gegen die Nabbanai unternommen hat. Sie sind reif für den Krieg, so reif wie Früchte im Herbst.«
»Wo habt Ihr unsere Sprache so gut gelernt?«, schweifte er unwillkürlich ab. »Habt Ihr mal in den Steinhäuslerlanden, wie Ihr sie nennt, gelebt?«
»Nein, aber andere aus meiner Familie«, sagte sie, hörbar ungeduldig. »Mein Vater war ein Than. Zu uns kamen viele Fremde. Ich habe die Sprache gelernt, weil ich sie hörte – und weil ich mir wünschte, wegzugehen und diese Lande zu sehen.« Sie blickte sich abermals um, vergewisserte sich, dass sie immer noch allein waren. »Warum stellt Ihr so viele Fragen?«
»Weil das meine Natur ist, edle Dame. Und mein Beruf. Spricht Unver auch Westerling? Wie ist er denn so? Wie kann ich mit ihm sprechen, um zu erfahren, was er wirklich von meinen Herrschern will? Ich habe darum gebeten, ihn sprechen zu dürfen, aber niemand will mich zu ihm bringen.«
»Er wurde schlimm verletzt, von diesem tollwütigen Hund Rotbart«, sagte sie. »Unver war halb tot nach diesen Folterqualen – er hat sie nur überlebt, weil es der Wille der Geister war. Und er ist ein Mann – er wird dann mit Euch sprechen, wenn er es kann, ohne schwach und geschunden zu wirken. Aber wenn er wieder bei Kräften ist, wird er diese Clans an den Zügeln nehmen wie ein Pferdegespann. Er wird sie dazu bringen zusammenzuarbeiten, wird sie lenken, wohin er will. Eure Herrscher wissen nicht, wie stark Unvers Wille ist, wie groß seine Klugheit und wie heftig sein Zorn, aber ich habe es gesehen, und ich habe auch gesehen, wie die Geister ihm helfen. Ich habe gesehen, wie sie die Krähen schickten, um seine Feinde zu vernichten, und dieser Feind war mein Ehemann – nicht, dass ich um ihn trauere. Eure Herrscher dürfen Unver nicht provozieren!«
Das ging Eolair gegen den Strich. »Der König und die Königin sind nicht so schwach oder feige, dass sie sich diktieren lassen, was sie zu tun haben, auch nicht von diesem Shan Unver.«
»Dann kommt für uns und für euch das Ende aller Dinge. Ich weiß, Euer Volk hat viele Kämpfer, und seine Burgen sind stark. Meine Leute werden auch sterben.« Ihr Gesicht, eben noch so wild entschlossen, war jetzt so blass und entsetzt, als sähe sie tatsächlich die schrecklichen Dinge, die sie prophezeite.
»Edle Hyara, ich verstehe ja, worauf Ihr hinauswollt.« Eolair war ärgerlich auf sich selbst, weil er seine Gefühle hatte durchschimmern lassen. »Ich will keinen Krieg zwischen unseren Völkern, und ich weiß, der König und die Königin wollen ihn auch nicht. Redet mit Unver. Sagt ihm, er soll mit mir sprechen, bevor er ihnen eine Botschaft schickt, dann werden wir es schaffen, einen Frieden herzustellen, mit dem beide Völker leben können.«
Sie schüttelte vehement den Kopf. »Ich kann nicht mit ihm reden, nicht über solche Dinge. Das kommt mir nicht zu, und er würde nicht zuhören.«
»Wenn er so klug ist, wie Ihr sagt, und wenn er sein Volk so sehr liebt, wie Ihr sagt, dann wird er zuhören. Wenn er keinen Rat von einer Frau annehmen kann, dann ja vielleicht von einem alten Hernystiri, der viel gesehen und viele Kriege erlebt hat.« Eolair tätschelte ihre Hand, die die Unterkante des Fensterchens umklammerte. »Der Hochkönig und die Hochkönigin haben beängstigendere und schlimmere Feinde als die Clansleute aus dem Grasland, glaubt mir. Krieg mit den Thrithingen wollen sie so wenig wie Ihr. Sagt Unver, ich werde als Unterhändler fungieren. Er hat mich bisher anständig behandelt, also werde ich dafür sorgen, dass meine Herrscher umgekehrt dasselbe tun. Verzagt nicht, edle Hyara. Solange es gute Menschen gibt, besteht immer Hoffnung.«
»Aber wenn die Geister selbst Krieg wollen und die Herzen der Menschen auch, dann kann ihn nichts verhindern.« Damit drehte sie sich um und ging. Als Eolair durch das Fenster schaute, sah er nur eine dunkle, schlanke Gestalt über das Gras davonhuschen.
◆
Als Hyara in das große Zelt zurückkehrte, kniete dort ihre Schwester an dem Bett, das Rudur gehört hatte; jetzt war es schmuddelig von Schweiß und getrocknetem Blut. Vara löffelte ihrem Sohn Brühe in den Mund. Unvers Wunden heilten zwar schon, doch sein Gesicht war immer noch von den tiefen Schnitten und den Schwellungen entstellt. Die Liegeposition des Shans sagte Hyara, dass sein geschundener Rücken immer noch schrecklich schmerzte, aber sein Gesicht verriet wie üblich nichts davon. Sie kannte diese Demonstration von Stärke von den Männern ihres Clans und bewunderte und hasste sie gleichermaßen. Stark zu sein war ein tiefsitzendes Ideal, das jede Art von Schmerz, auch den anderer, zu etwas Unwichtigem machte, zu etwas, das man zu ignorieren hatte.
Unvers zerfetzte Haut wird in einem Monat nur noch ein Gewirr von harten, weißen Narben sein. Aber nicht alle Wunden heilen wie die des Fleisches, dachte sie.
Fremur war ebenfalls da und sagte streng zu ihr: »Es ist nicht gut, wenn du so spät noch draußen herumläufst, Hyara. Du bist eine Verwandte des Shans. Jemand könnte dir etwas antun wollen.«
Sie fragte sich, wie viel von dieser Sorge wirklich ihr galt und wie viel Unvers Ansehen. Thrithingmänner wollten nicht, dass ihre Frauen und selbst ältere weibliche Verwandte sich frei bewegten, ohne angemessene Begleitung und ohne vorher um Erlaubnis zu bitten. Aber Hyara hatte so lange mit diesen Einschränkungen gelebt, dass sie nicht willens war, sich wieder an die Leine legen zu lassen, schon gar nicht von einem Mann, der über zehn Jahre jünger war als sie.
Und er hat schließlich nicht nach meinem Brautpreis gefragt, machte sie sich klar. Was ist er denn mehr für mich als der Diener des Sohns meiner Schwester? Soll er doch für sich selbst sprechen, wenn er in meinem Leben etwas zu sagen haben will.
»Ich war spazieren«, sagte sie. »Weiter nichts. Wie geht es Unver?«
»Dem Shan geht es gut«, sagte Fremur.
»Sein Appetit kehrt zurück«, sagte ihre Schwester.
»Beim Himmelsspalter«, knurrte Unver und schob den beinernen Löffel weg, »bin ich tot? Brauche ich einen Schamanen, der für mich spricht, wie die Ahnengeister?«
Fremur schien erfreut, vielleicht weil Unver immer noch beim Totem des Kranich-Clans fluchte. »Natürlich nicht, großer Shan.«
Unver sah Hyara an. »Und was hast du beim Spazierengehen gesehen?«
Sie zögerte. »Vieles und nichts, wie immer.« Wenn er fragte, was sie gemacht hatte, sollte sie es ihm dann sagen? Niemand hatte ihr befohlen, sich von dem Steinhäusler, Graf Eolair, fernzuhalten, aber sie ahnte, dass ihr Neffe nicht erbaut wäre, wenn er wüsste, dass sie bei ihm gewesen war. Und wenn er wüsste, dass sie den Fremden beschworen hatte, einen Krieg zu verhindern, würde Unver wahrscheinlich toben. Kein Mann aus einem Graslandclan wollte, dass eine Frau für ihn sprach, geschweige denn sich für Frieden einsetzte.
Zu Hyaras Glück hatte Unver offenbar anderes im Kopf.
»Das Thantreffen ist fast vorbei.« Er wischte sich mit einer ungehaltenen Bewegung Suppe von den Lippen. Vara und Hyara hatten ihm den Schnurrbart abrasiert, damit sie die tiefen Schnitte säubern konnten, die über seine Wangen bis zur Oberlippe verliefen. Hyara war es nicht gewohnt, einen Mann seines Alters ohne Schnurrbart zu sehen. Unver sah zwar nicht so bizarr aus wie Fremurs Sklave, der Mann, der einst Gezdahn Kahlkopf geheißen hatte und der jetzt in einer Ecke des Zelts hockte und auf den Boden starrte, aber er wirkte doch anders, fremd und neu.
Schließlich ist er jetzt der Shan, rief sie sich in Erinnerung. Das ist ja auch so neu und anders, wie es nur geht. Selbst Edizel damals, in längst vergangenen Zeiten, hatte nicht so eine außergewöhnliche Geschichte gehabt wie ihr Neffe.
Zum ersten Mal dachte sie an Unvers Vater, Prinz Josua. Als Josua das erste Mal in die Thrithinge gekommen war, war Hyara noch ein Kind gewesen und hatte ihn kaum wahrgenommen, weil er lediglich als einer der Gesandten seines Vaters, König Johan, da gewesen war und sich nur mit Varas und Hyaras Vater Fikolmij, dem Than des Hengst-Clans, getroffen hatte. Als Josua und Vara Jahre später wiedergekommen waren, war Hyara alt genug gewesen, um zu erfassen, was geschah. Josua war beinahe von einem der Gefolgsleute ihres Vaters getötet worden, hatte am Ende aber überlebt und sogar triumphiert, eine Demütigung, die fortan immer im Herzen ihres Vaters gebrannt hatte. Doch mit den Jahren, als Hyara selbst zur Frau gereift war, hatte sie sich kaum noch an das Gesicht des Prinzen erinnern können, nur an das, was er getan hatte. Es war, als hätte ihre Schwester eine Art Geist geheiratet, ein übernatürliches Wesen, das nie richtig sichtbar war.
Doch jetzt, da sie in Unvers Gesicht blickte, sah sie trotz der schrecklichen Verletzungen in diesen harten Zügen Einzelheiten, die die verschüttete Erinnerung an den Prinzen wieder emporsteigen ließen – die hohe Stirn, das lange Kinn, die kühlgrauen Augen.
Was hat sein Vater ihm noch mitgegeben, diesem Mann, der jetzt über das ganze Grasland herrschen wird?
Sie konnte diese Frage nicht laut stellen – sie war sich nicht einmal sicher, ob jemand von den anderen sie verstehen würde –, also sagte sie stattdessen: »Du bist bei den Steinhäuslern aufgewachsen, Shan Unver. Wie sind sie?«
Sein Blick, der sonst oft so kalt und fern war, wirkte jetzt ein wenig argwöhnisch, mehr wie der Blick eines misstrauischen Kindes denn wie der des Herrschers über alle Clans. »Wie meinst du das, Hyara?«
»Erinnere ihn nicht an jene schlimmen Zeiten.« Vara stellte die leere Suppenschale so heftig auf den Boden, dass der Löffel darin klirrte. »Wir waren ganz allein. Sein Vater hat uns im Stich gelassen. Wir lebten unter Leuten, die uns verachteten. Wie kannst du von ihm wollen, dass er sich daran erinnert?«
Der Hauch eines Lächelns spielte um Unvers Lippen, die stellenweise immer noch blutverkrustet waren. »Deine Erinnerungen sind nicht meine, Mutter. Für mich war die Stadt am Sumpfland kein hassenswerter Ort, bis ich von dort weggeschleppt wurde. Danach musste ich sie hassen, oder ich hätte mich selbst gehasst.«
Hyara war wie gebannt. In den Wochen, die sie ihn jetzt kannte, hatte sie ihn noch nie so viel über seine Vergangenheit sagen hören. »Wie ist Kwanitupul? Ich wollte immer schon wissen, wie es dort ist. Ich habe mal einen Händler getroffen, bei dem klang es wie ein magischer Ort voller Menschen und Dinge jeder nur denkbaren Art.«
»Es war dreckig und überfüllt«, sagte Vara prompt. »Ich habe immer auf dem Dach dieses verfluchten Gasthauses gestanden und gebetet, dass der Wind dreht, damit ich die saubere Luft des Graslands riechen könnte statt des Gestanks der Sümpfe.«
Unver sah nicht seine Mutter an, sondern weiterhin Hyara, und der Hauch eines Lächelns war immer noch da, obwohl in seinem Gesicht jetzt noch etwas anderes zu lesen war, ein Zorn, den sie nicht recht verstand. »Ein Kind kann sich wohl überall zu Hause fühlen«, sagte er. »Solange da etwas Festes ist, um darauf zu stehen.«
Fremur stand unvermittelt auf und ging über den Grasboden dahin, wo der haarlose Sklave hockte. »Du da! Was lauschst du, du Hund! Das hier ist nicht für deine Ohren bestimmt. Dort liegt der Shan, den du verraten wolltest, und du hockst hier herum wie ein Spion und hörst alles mit. Und dabei verdankst du’s nur Hyara, die um dein Leben gefleht hat, dass du nicht an einem Pfahl verfaulst. Verschwinde aus diesem Zelt, du elender Kerl, oder ich werfe dich raus.«
Der Mann namens Kahlkopf stand wortlos auf und eilte hinaus, den Kopf eingezogen, als rechnete er damit, dass etwas nach ihm geworfen würde. Es stimmte, dass Hyara Fremur gebeten hatte, ihn zu verschonen, aber sie hatte es nicht aus Mitleid oder Weichherzigkeit getan. Da sie ihr Leben lang die Herrschaftsmethoden ihres Vaters vor Augen gehabt hatte, wusste sie, dass Härte nicht Gehorsam erzeugte, sondern nur trügerisches Schweigen.
»Ich hätte dieses stinkende Stück Abfall töten sollen«, sagte Fremur und sah Hyara dabei fast schon vorwurfsvoll an. »Wenn man einen Hund verschont, wird er einen niemals beißen, aber bei Menschen kann man sich darauf nicht verlassen.«
»Ho, Fremur, du musst treuere Hunde gekannt haben als ich«, sagte Unver und lachte, obwohl sein Gesicht dabei offenkundig schmerzte. »Ich kenne kein Tier – ob Hund, Mensch oder Pferd –, das einmal erlittenen Harm nicht heimzahlen will.«
»Wir brauchen solchen Harm und Verrat nicht länger zu fürchten«, sagte Vara mit der forschen Bestimmtheit einer Person, die etwas nicht wirklich glaubt, aber glauben möchte. »Von jetzt an werden wir denjenigen helfen, die es verdienen, und die niedermachen, die uns etwas anhaben wollen.«
»Darin, Mutter«, sagte Unver, jetzt ohne jede Spur von Lächeln, »sind wir uns voll und ganz einig.«
33
Schatten auf den Mauern
Kommt, Großmagister Viyeki«, sagte Prinz Pratiki. »Kommt her und seht zu, wie unsere wackeren Krieger ihr Werk verrichten.«
Der Prinz-Templer prangte in einer uralten Rüstung aus Hexenholz, die mehr wert war als alles, was Viyeki besaß, zusammengenommen. Sein Haar war zu zwei gewollt lässigen Kriegszöpfen geflochten, und an seinem Gürtel hing sein berühmtes Schwert Mondlicht. Doch Pratiki war kein bloßer Opfermutigen-Offizier: Der Prinz-Templer war ein Mitglied des königlichen Clans und hatte daher einen Rang inne, den selbst der Großmarschall aller Heere der Königin nicht erreichen konnte. Er hatte seine Bedeutung nicht erlangt, sie war Teil von ihm, und diese Gewissheit prägte alles, was er tat und sagte. »Bitte, Großmagister«, wiederholte er, wobei er sich diesmal zu Viyeki umdrehte. »Kommt her zu mir.«
Pratiki war, wie Viyeki inzwischen wusste, für einen Hamakha erstaunlich großmütig, höflich zu allen, die ihm dienten, sogar zu Sklaven. Doch wie die meisten Leute, die in eine hohe Machtposition hineingeboren wurden, begriff er nicht, welche Verpflichtungen selbst seine Großmut anderen auferlegte.
Viyeki trat zu dem Prinzen und dessen Leibwächtern an die Aussichtsstelle, obwohl er lieber etwas abseits gestanden hätte, um seine manchmal unbotmäßigen Gedanken nicht verbergen zu müssen. Der Mond war hinter den Hügeln versunken, aber auch im Sternenlicht konnte man ohne Weiteres sehen, wie Kikitis Streitmacht sich lautlos der Sterblichenfestung namens Naglimund näherte. Viyeki fragte sich unwillkürlich, wie es wohl wäre, ein Sterblicher innerhalb jener Mauern zu sein, nach Einbruch der Dunkelheit dermaßen schlecht sehen zu können und dann plötzlich feststellen zu müssen, dass ein so großes Heer aus der Nacht zum Angriff vorrückte.
Die Sterblichen halten uns für Dämonen und Monster. Wie der Kriegsdichter Zinuzo schrieb: »Die Kräfte der Nacht und des Todes stehen uns entgegen, und sie hassen, was wir sind. Sie hassen unseren Atem, sie hassen unser warmes Blut.« Aber er sprach von den Feinden, denen wir gegenüberstanden, als Schatten über den Garten zu kriechen begannen. Hätte er sich je träumen lassen, dass andere sein Volk genauso sehen könnten?
»Ah«, sagte Pratiki so freudig interessiert, als sähe er einer besonders spannenden Partie Shaynat zu. »Da! Jetzt rücken die Hammerleute vor. Stolze Krieger, das sagen alle. Wie Eure Bauleute, Viyeki, lieben sie angeblich ihr Werkzeug mehr als ihre eigene Familie. Aber sie sind heutzutage so wenige, die Hammerleute!«
Ein Dutzend Hammerleute rannten durch einen Pfeilhagel, der von den Mauern kam, den Hang hinauf, glitten trotz ihrer schweren Waffen wie Vögel dahin. Pratiki hatte recht, es waren wenige, und einer war bereits gefallen, vom Pfeil eines Verteidigers in die Brust getroffen.
»Das sind doch bestimmt nicht genug, um die Mauern einzureißen«, sagte Viyeki. »Warum sind es nicht mehr?«
»Weil unsere Armeen heutzutage aus so vielen Halbbluten bestehen«, sagte Pratiki. »Fast noch Kinder, die meisten. Sie hatten nicht die Zeit, die alten Künste zu erlernen. Aber keine Angst, Magister – Kikiti und die anderen Heerführer haben alles sorgsam geplant.«
Die Sterblichen in der Festung eilten jetzt auf die Mauern, aber im Nachtdunkel konnten ihre schwachsichtigen Bogenschützen die Hikeda’ya kaum ausmachen, und wenn auch ein weiterer Hammerschwinger fiel, erreichte der Rest des kleinen Trupps doch rasch den Fuß der Ringmauer. Viyeki wusste aus anderen Schlachten, dass sie ihre mächtigen Steinkopfhämmer mit der Präzision von Edelsteinschneidern schwingen würden, Schlag für Schlag auf einen bestimmten Punkt, bis die Mauer vibrierte wie klingender Kristall. Wenn genügend von ihnen zuschlugen, bröckelte schließlich selbst der dickste Steinwall. Aber dieser Trupp von Hammerleuten war doch zu klein!
Zu Viyekis Erstaunen schwangen die Angreifer ihre Hämmer nicht gegen die mächtige Mauer selbst, sondern ließen sie davor auf verschiedene Stellen des Erdbodens herabsausen. Er sah, wie sie ihre Reihe in die Breite zogen und wieder auf den Boden einhämmerten, lautlos und ohne sichtbare Wirkung.
»Was tun sie da?« Nur mit Mühe schaffte er es, seine Beunruhigung und Verwirrung zu unterdrücken und den kühlen, gelassenen Ton eines Hikeda’ya-Adligen beizubehalten. »Versteht Ihr, was da vor sich geht, Prinz-Templer?«
Pratiki klang fast schon belustigt. »Ich sagte doch, keine Angst, Magister. Die Mauer wird schon fallen – all die Mauern werden fallen. Aber es wird ein wenig dauern, bis der restliche Angriff erfolgt. Es ist weit von ihren Fraßgängen in der Tiefenfeste hierher.«
Viyeki hatte keine Ahnung, was Pratiki damit meinte, wurde aber jetzt von den Hammerleuten abgelenkt. Die Überlebenden, die sich in großen Abständen vor der Ringmauer verteilt hatten, eilten jetzt wieder in die Mitte, vor das Haupttor der Festung. Dort sammelten sie sich, nahezu Schulter an Schulter, und schwangen dann ihre Hämmer, so wie er es von Anfang an erwartet hatte, im Gleichtakt gegen den Fuß der Ringmauer. Alle Schläge trafen die Mauer entsprechend dicht beieinander, und wo sie sie trafen, erschienen im Mauerwerk feine Risse wie gefrorene Blitze. Viyeki sah Sterbliche in Panik von den darüberliegenden Zinnen flüchten, als die Risse länger wurden und die Mauer neben dem Tor erzitterte. Er war jetzt etwas beruhigter – das war schon eher das, was er sich vorgestellt hatte. Noch ein paar Schläge, und zumindest dieser Teil der Ringmauer würde einstürzen. Er erkannte bereits die hellen Gestalten mehrerer Riesen, die den Hang hinaufstapften.
»Seht Ihr? Die Sterblichen können uns nicht aufhalten oder auch nur nennenswert verlangsamen«, verkündete Pratiki. »General Kikiti und seine Truppen werden mit Hilfe des Nordöstlichen Heeres die Festung noch vor Sonnenaufgang eingenommen haben. Dann wird es an Euch und Euren Leuten sein, Euren Teil zu tun, und ich bin zuversichtlich, Großmagister, dass Ihr ebenso erfolgreich sein werdet wie unsere Opfermutigen.«
Wieder war Viyeki ein bisschen verwirrt – vom Nordöstlichen Heer hatte er noch nie gehört. Aber die Erwähnung seiner eigenen Aufgabe hatte ihn erneut darauf gestoßen, wie wenig er von all dem verstand, was hier passierte.
»Hoffentlich habt Ihr recht, Herr.«
Pratiki sah ihn prüfend an. »Ich höre Zweifel in Eurer Stimme, edler Viyeki. Was beunruhigt Euch?«
Wegen Pratikis ruhiger, fast schon sanfter Art zu sprechen vergaß man leicht, wie bedeutend der Prinz-Templer war und wie mächtig. »Ich wäre fester davon überzeugt, dass mein Orden seine Aufgabe erfolgreich erfüllt, wenn ich wüsste, was genau meine Bauleute und ich bewirken sollen.« Sobald die unbedachten Worte über seine Lippen waren, bereute Viyeki sie schon: Auch das gütigste Mitglied des königlichen Clans könnte sie als Verrat bewerten.
»Bewirken?« Der Prinz-Templer musterte ihn wieder. »Was meint Ihr, Magister?«
»Ich bitte um Verzeihung, Erhabene Hoheit. Natürlich bin ich voller Vertrauen und Zuversicht, was die Mission betrifft, mit der mich unsere Königin betraut hat – Ruyan Ves Grabstätte zu finden und seine Rüstung zu bergen. Aber ich gestehe, dass ich nicht begreife, was das der Königin oder ihrem Volk nützen soll.«
»Es geht um die Hexenholzkrone«, sagte Pratiki, und jetzt war sein Ton streng. »Das wisst Ihr, Großmagister. Alles, was wir tun, zielt darauf ab, die Hexenholzkrone wiederzuerlangen.«
Erleichtert, dass der Prinz-Templer ihn nicht sofort wegen seiner Zweifel des Verrats beschuldigt hatte, beeilte sich Viyeki, die Wogen weiter zu glätten. »Gewiss, Herr, natürlich. Aber bis in allerjüngste Zeit hatte ich von dieser Krone immer nur in geflüsterten Andeutungen gehört und nie aus Quellen, denen ich vertraute – bis jetzt. Obwohl ich natürlich sicher bin«, sagte er hastig, »dass meine Unwissenheit notwendig war.« Er zögerte, befand dann, dass er schon zu weit draußen im Fluss war, um umzukehren; er musste weiterwaten, so tief das Wasser auch sein mochte. »Ich muss sogar gestehen, dass ich nicht einmal weiß, ob diese Krone ein greifbares Ding ist …«
»Da, schaut!« Pratiki war wieder abgelenkt. »Selbst mit so wenigen Hammerleuten schaffen wir es! Die Mauer neben dem Tor bröckelt – seht Ihr, da! –, und die Riesen dringen in die Festung ein.« Der Prinz hielt inne, noch immer das Schlachtfeld im Blick. Die leisen Chaos-Geräusche vom Kampfgeschehen wehten durch die Nachtluft heran. »Ihr wisst nicht, was die Hexenholzkrone ist, sagt Ihr?«
»Ich bekenne mein Unwissen, Hoheit.«
Kurz herrschte Schweigen, dann sagte Pratiki: »Es geht um das Hexenholz selbst, versteht Ihr? Die letzten Bäume sterben.«
»Das habe ich gehört.« Es war so gut wie unmöglich, das nicht zu wissen. In den Ratsversammlungen der Mächtigen hatte es schon Geflüster darüber gegeben, ehe die Königin aus ihrem langen Schlaf erwacht war. »Aber was ist diese Krone, wenn ich fragen darf? Und was bewirkt sie?«
»Die Königin weiß es«, sagte Pratiki langsam, als wiederholte er etwas, das ihm in jungen Jahren beigebracht worden war und über das er seither nie nachgedacht hatte. »Unsere geheiligte Mutter Aller weiß es, und wie immer hat sie die richtige Entscheidung getroffen. Sie wird einen Weg finden, das Hexenholz zurückzugewinnen. Denn ohne das Hexenholz, Magister Viyeki – was sind wir dann? Wir haben den Garten verloren, sollen wir auch noch sein letztes und kostbarstes Relikt in diesen Landen verlieren? Sollen wir so werden wie die unseligen, kurzlebigen Sterblichen?«
»Niemals, mein Prinz.« In diesem Punkt zumindest konnte er ehrlich antworten. »Wir müssen alles daransetzen, unser Volk zu erhalten.«
»Genau«, sagte Pratiki. »Und wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Königin weiß, wie das am besten zu bewerkstelligen ist.«
»Natürlich, Hoheit. Ich höre ihre Stimme in Euren Worten.«
»Ganz recht.« Pratiki folgte wieder angeregt dem Kampfgeschehen. »Seht doch, da! Seht, was da kommt! Sie haben die Hammerschläge gehört – sie sind dem Ruf gefolgt!«
Viyeki sah, wie sich die Erde vor der Ringmauer der Festung an mehreren Stellen emporwölbte, wie Maulwurfshaufen – wenn die Maulwürfe groß wie Häuser wären. Aber er konnte sich nicht auf das konzentrieren, was er sah, weil ihn ein frappierender Gedanke ganz in Anspruch nahm.
Beim Garten, der uns hervorgebracht hat, ich glaube, nicht einmal Prinz Pratiki weiß, was die Königin will! Der Gedanke war atemberaubend. Nicht mal ein Prinz aus dem königlichen Geschlecht der Hamakha kennt das Geheimnis dieser Hexenholzkrone!
◆
Es war alles so albtraumhaft plötzlich passiert. Aelin und Hauptmann Fayn hasteten die Turmtreppe hinunter und rannten über den Hof, um auf die Mauer der Kernburg zu steigen, doch als sie die Brustwehr erreichten, war bereits ein keilförmiges Stück der äußeren Mauer eingestürzt und die ersten Angreifer kletterten schon über die Trümmer – riesige, behaarte Gestalten.
»Ädon steh uns bei«, rief Fayn. »Riesen!«
Aelin sah, wie die Monster sich ihren Weg durch die Bresche in der Ringmauer suchten, doch so furchterregend sie auch waren, am meisten beunruhigte ihn das, was sie zu tragen schienen.
»Das sind Nornenkrieger, da auf ihren Schultern«, sagte er.
»Wovon sprecht Ihr? Ich sehe nur diese zotteligen weißen Monster. Ihr habt wohl bessere Augen als ich.«
»Die Riesen tragen Nornen mit Hämmern«, insistierte Aelin. Er glaubte sich zu erinnern, dass sein Großonkel erzählt hatte, im Sturmkönigskrieg hätten die Feen in Naglimund Zauberhämmer eingesetzt, aber er hatte gedacht, das seien die Sithi gewesen, nicht ihre Nornenvettern.
Die Posten auf der Ringmauer beidseits der Bresche waren inzwischen wieder auf den Beinen und schossen Pfeile in die Mauerlücke hinab, doch obwohl einer der Hammerbewehrten getroffen wurde und von seinem Riesen fiel, gelangten die Eindringlinge rasch über die Mauertrümmer und liefen bereits auf die Mauer der Kernburg zu. Fayn schrie den Verteidigern der Burg zu, schnell die Zinnen zu besetzen, und gleich darauf standen rechts und links von ihm Bogenschützen und beschossen die Anstürmenden. Auf Fayns nächsten gebrüllten Befehl hin schwärmte ein Trupp von tapferen Pikenieren zum Haupttor hinaus, um sich den Angreifern entgegenzustellen, doch Aelin sah sofort, dass sie zu wenige waren, um die Riesen aufzuhalten. Jede schwingende Bewegung eines hellen, zotteligen Arms schleuderte einen Sterblichensoldaten durch die Luft, und keiner der Pikeniere stand danach wieder auf.
»Wir brauchen mehr Soldaten!«, schrie er Hauptmann Fayn zu.
Von unten hallten die Rufe der Verteidiger und das Gebrüll der zotteligen Hunen herauf. Die Riesen hatten die Nornen jetzt abgesetzt und bildeten einen Verteidigungsring um sie. Und als wären sie vom Wahnsinn befallen, begannen die Nornen, statt zu den inneren Mauern weiterzustürmen, mit ihren mächtigen Steinkopfhämmern auf den Erdboden einzuschlagen.
»Was tun sie da?«, rief Fayn. »Fackeln! Bringt Fackeln her!«
Dutzende weiterer Festungsverteidiger drängten sich auf dem zur Angriffsseite hin gelegenen Teil der inneren Mauer und starrten hinab auf das abgestorbene Gras und die dunkle Erde der Vorburg. Im Licht der Fackeln war nur noch deutlicher erkennbar, dass die gepanzerten, mit Halsbändern versehenen Riesen die menschlichen Verteidiger rasch dahinmordeten.
Auch Fayn sah, dass der Ausfall sinnlos war. »Zurück!«, rief er den Verteidigern unten zu. »Männer von Naglimund, zurück in die Burg!«
Noch während er es rief, ließen die Nornen ihre Hämmer ein letztes Mal auf den harten Boden krachen und hielten dann inne. Kurz senkte sich Beinahe-Stille auf die Vorburg; ein paar Brandpfeile flogen noch von der inneren Mauer hinab, aber weder die Nornen noch die Riesen schien es zu kümmern.
Aelin konnte sich auf das Geschehen keinen Reim machen. Die Hammerleute und Riesen hatten nur eine schmale Bresche in die äußere Ringmauer geschlagen, aber wenn die Hunen hindurchpassten, dann wäre doch zu erwarten, dass die flinken Nornenkrieger hinterherströmten wie ein Schwarm von weißen Ameisen. Doch das Gros ihrer Truppen wartete vor der Mauer. Aelin spürte, dass sich da etwas noch Schlimmeres anbahnte.
Warum greifen die Übrigen nicht an? Bei den Göttern, warum? Worauf warten diese verdammten Weißfüchse?
Ein tiefes Geräusch wie Donnergrollen erschütterte plötzlich den Erdboden. Es ließ Aelin bis ins Mark erzittern und seine Ohren kribbeln. Die äußere Mauer begann um die Bresche herum zu wackeln. Im nächsten Moment lösten sich riesige Brocken aus der beschädigten Mauer, die zerklüfteten Ränder des Lochs brachen herab und die Bresche wurde noch breiter – aber die Nornen stürmten immer noch nicht hindurch.
»Fayn!«, rief Aelin. »Fayn, an der äußeren Mauer passiert etwas Schreckliches!«
Vor Aelins Augen hob sich die äußere Mauer plötzlich, und ein beträchtliches Stück auf jeder Seite der Bresche zerfiel einfach. Schockiert fragte er sich, ob die Nornen mit ihrer Magie einen unsichtbaren Riesen zu ihrer Unterstützung herbeibeschworen hatten. Dann sah er, wie aus den Trümmern der Ringmauer etwas Riesiges hervorglitt.
Nein, erkannte er, nicht etwas, nur die sichtbare Spur von etwas – die aufgeworfene Erde über etwas Riesigem, das sich unter der Oberfläche durch den Boden grub, unglaublich schnell und genau auf sie zu. Von der gewaltigen Menge Erde, die es verdrängte, stürzten ganze Häuser der Vorburg ein, und Aelin war klar, dass es etwas unfassbar Riesiges sein musste.
Die Riesen und diejenigen Nornenkrieger, die die Kernburg erreicht hatten, liefen eilig auseinander, als das unsichtbare Etwas unter der Stelle hindurchpflügte, wo vorhin die Hämmer den Boden getroffen hatten. Einen Moment lang tauchte sein Rücken aus der aufgebrochenen Erde auf, dunkel, dreckig und gerundet wie ein umgedrehter Schiffsrumpf. Aelin, der entsetzt und verblüfft hinstarrte, glaubte die Form zu erkennen.
Ein Höhlenbohrer? Aber so groß! Er hatte in den Grianspog-Bergen Spuren dieser vielbeinigen Grabetiere gesehen und allerlei Geschichten darüber gehört, dass sie manchmal so groß wie Bullen wurden, aber das Monstrum dort unten, was auch immer es war, musste ein Dutzend Mal so groß sein – größer als eine Scheune.
Und dann hatte Aelin keine Zeit mehr zu staunen. Das unsichtbare Etwas schwamm erschreckend schnell durch den Erdboden, und im nächsten Moment rammte es die Fundamente des Tors zur Kernburg.
Die Mauer wackelte und schwankte unter Aelin und den anderen wie ein Baumschössling im Sturm. Er und Hauptmann Fayn taumelten gegen die Zinnen, konnten sich aber auf den Beinen halten, während ein halbes Dutzend von Fayns Männern, die näher an der gerammten Stelle gestanden hatten, schreiend von der Mauer stürzten. Und während die Übrigen entsetzt auf ihre armen Kameraden hinabstarrten, brach drunten etwas, das nur in einem Albtraum möglich schien, wild mit seinen vielen Beinen rudernd aus der Erde hervor. Es war, wie Aelin vermutet hatte, ein Höhlenbohrer, gepanzert wie eine Assel, aber gigantisch. Die mächtigen Kiefer, die Stein zermalmen konnten, klackten einmal aufeinander, dann fiel das Monstrum in sein Loch zurück und setzte erneut an, die Fundamente der Burgmauer zu rammen.
»Fort von hier!«, schrie Aelin. »Es ist ein Erdbohrer, so groß wie ein Haus. Er wird die Mauer unter unseren Füßen wegfressen!«
Man musste es Fayn hoch anrechnen, dass er keine Zeit damit verlor, diese Behauptung infrage zu stellen. Er rief vielmehr seinen Männern zu, sie sollten ihm folgen, und rannte dann zur Treppe, während die gesamte Mauerkrone unter ihm schwankte wie ein Schiff im Sturm, da der Bohrer ihr Fundament ein ums andere Mal rammte. Das Letzte, was Aelin sah, bevor er sich den Flüchtenden anschloss, war das Nornenheer, das sich jetzt durch die Bresche ergoss.
Aelin rannte die Treppe hinunter, sicher, dass sie jeden Moment unter ihm einstürzen würde. »Hernystiri!«, rief er. »Männer aus Hernystir, wo seid ihr? Ich, Aelin, bin es, der euch ruft! Hierher zu mir! Zu mir!«
Als er vom Ende der Treppe in den Hof der Kernburg hinabsprang, begann die gesamte Mauer hinter ihm zu schwanken. Dutzende erkynländischer Soldaten kamen aus verschiedenen Teilen der Burg gerannt, aber er und Hauptmann Fayn befahlen ihnen zurückzubleiben. Zum Glück, denn ein beträchtlicher Teil der Mauerkrone, auf der Aelin und Fayn eben noch gestanden hatten, sackte ab, und einer der Wehrtürme bröckelte, sodass weinfassgroße Brocken von Mauerwerk in den Burghof herabfielen.
Als sie die verbliebenen Verteidiger in sicherere Entfernung geführt hatten, stützte Fayn sich einen Augenblick auf den Oberschenkeln ab, um zu verschnaufen, und richtete sich dann wieder auf, im Gesicht so bleich wie ein Norne. »Barmherzige Elysia, Mutter Gottes. Riesen. Grabende Monster. Wie in den alten Geschichten. Was können wir gegen solche Kreaturen tun? Wie können wir sie abwehren?«
»In dieser Unterzahl können wir wenig tun«, sagte Aelin, »und ich fürchte, die Mauern sind gar nicht mehr zu halten. Ihr seht ja, sie haben noch mehr von diesen riesigen Erdbohrern – die Mauern geben schon an weiteren Stellen nach. Die Weißfüchse brechen von allen Seiten herein. Wir müssen uns in den Hauptturm zurückziehen.«
Fayn rief denen, die ihn hören konnten, zu, sie sollten sich ins Zentrum der Festung zurückfallen lassen. »Aber was ist mit Euch und Euren Männern?«, fragte er Aelin. »Das ist nicht Eure Schlacht.«
»Jetzt schon. Wir können Euch nicht allein kämpfen lassen.«
Noch während er sprach, erbebte die Mauer, die sie gerade verlassen hatten, erneut, sackte weiter in sich zusammen und spie riesige Mauerwerkbrocken, die flüchtende Soldaten erschlugen und ganze Gebäude zermalmten. Als Aelin hastig zurücksprang, um sich vor den Trümmern in Sicherheit zu bringen, sah er, dass die Riesen, die vorhin die Hammerschwinger hereingetragen hatten, jetzt durch das Loch in der inneren Mauer kletterten, und vor seinen Augen wurden zwei zurückweichende Verteidiger von einer riesigen Kriegskeule gefällt.
»Schnell!«, rief Fayn, und seine Stimme war rauh von Zorn und Schmerz. »Zurück in den Hauptturm, alle miteinander! Hier können wir sie nicht aufhalten!«
Während der Hauptmann seine verbliebenen Männer ins Zentrum der Festungsanlage zurückzuscheuchen versuchte, schickte ihnen einer der Riesen eine Art höhnisches Triumphgeheul hinterher und schwenkte dabei den schlaffen Leichnam eines Sterblichensoldaten wie eine Fahne. Brennende Scham überkam Aelin. Er wusste, er sollte wegrennen, aber den Riesen mit dem Toten wedeln zu sehen wie mit einem alten Lumpen, erfüllte ihn mit jäher Wut. Er hob einen Mauerbrocken auf, so groß wie zwei Fäuste, und schleuderte ihn nach dem Riesen. Jeder Stein, den er werfen konnte, war viel zu klein, um ernsthaft Wirkung zu zeitigen, aber das Wurfgeschoss traf das zottige Bein des Riesen, und das Monstrum brüllte auf. Es schmiss den Leichnam des Soldaten weg und trampelte auf Aelin und Fayn zu.
»Beim Haupte Ädons, jetzt sind wir dran!«, rief Hauptmann Fayn. »Lauft, Mann!«