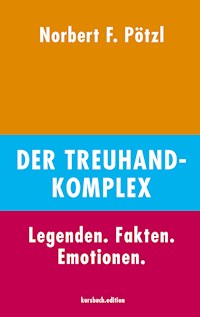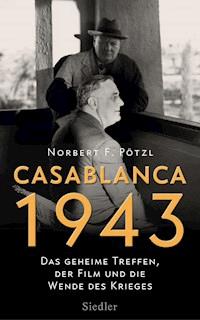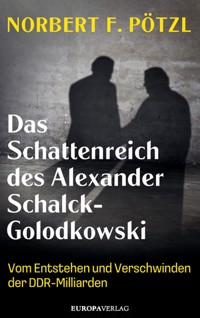
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der kommunistische Kapitalist, der die DDR finanzierte Kaum jemand in der DDR kannte ihn, obwohl er einer der mächtigsten Politiker des Landes war. Und nicht einmal in höchsten SED-Kreisen wusste man von den Geschäften, die er betrieb, obschon der von ihm geleitete »Bereich Kommerzielle Koordinierung«, kurz KoKo, die DDR wirtschaftlich viele Jahre am Leben hielt. Formal war Alexander Schalck-Golodkowski nur Staatssekretär im Ostberliner Ministerium für Außenhandel, tatsächlich führte er ein weit verzweigtes kapitalistisches Firmenimperium, das die DDR mit Devisen versorgte. Als im Herbst 1989, nach dem Sturz Erich Honeckers, ans Licht kam, dass KoKo international mit Waffen gehandelt, geraubte Kunstwerke verhökert und die Bonzensiedlung Wandlitz mit westlichen Luxusgütern versorgt hatte, wurde Schalck zur Hassfigur der Bevölkerung und zum Sündenbock der neuen SED-Führung. Vor der drohenden Verhaftung floh er in die Bundesrepublik und vertraute sich dem Bundesnachrichtendienst an. Um Alexander Schalck-Golodkowski rankt sich ein realer Politthriller, der bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist. Viele Fragen sind immer noch offen. Zum Beispiel: Welche Verbindungen bestanden zwischen Schalck und westdeutschen Politikern, namentlich dem damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble? Welche Zusagen hatte Schalck vor seiner Flucht erhalten? Wie zeigte sich der Bundesnachrichtendienst für Schalcks Offenbarungen erkenntlich? Warum kam Schalck praktisch straffrei davon? Wie hatten Schalck und seine Frau für ihre Zukunft im Westen vorgesorgt? Wer finanzierte seinen luxuriösen Lebensstil am Tegernsee? Wie verschoben seine Vertrauten in den Wirren des DDR-Umbruchs Gelder von KoKo-Konten? Welche Geldverstecke sind noch unentdeckt? Das Buch gibt Antworten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EUROPAVERLAG
Norbert F. Pötzl
DAS SCHATTENREICHDES ALEXANDERSCHALCK-GOLODKOWSKI
Vom Entstehen und Verschwinden der DDR-Milliarden
EUROPAVERLAG
INHALT
PROLOG: DOKTOR SCHALCK
1 VOM HOFFNUNGSTRÄGER ZUR HASSFIGUR
2 SCHÄFCHEN IM TROCKENEN
3 »SCHNEEWITTCHEN« BEIM GEHEIMDIENST
4 ZIEHKIND DER STAATSSICHERHEIT
5 DEVISENNOT KENNT KEIN GEBOT
6 MODERNE SKLAVEREI
7 DER WEG ALLEN FLEISCHES
8 DER EMISSÄR
9 KREDIT VOM KLASSENFEIND
10 TRAUMSCHIFFE UND TAUCHBOOTE
11 DIE TOTEN VON KOKO
12 IRRUNGEN, WIRRUNGEN
13 JÄGER DES VERLORENEN SCHATZES
14 VON AWEKO BIS ZEKOM
15 EINE HAND WÄSCHT DIE ANDERE
16 DIE AKTE MONDESSA
17 VERFOLGTE UNSCHULD
EPILOG GEKÄMPFT UND VERLOREN
DANK
LITERATUR
ARCHIVE
PERSONENREGISTER
PROLOG:DOKTOR SCHALCK
Ihre Beziehung sei »am Anfang rein privat« gewesen, erinnerte sich Alexander Schalck-Golodkowski, »wir gingen zusammen in die Sauna und auf den Fußballplatz«.1 Was Schalck, wie er sich meist ohne den zweiten Teil seines Doppelnamens nannte, und seinen Freund Heinz Volpert jedoch vor allem verband, war ihr Dienst bei der DDR-Staatssicherheit.
Kennengelernt hatten sie sich 1962 bei der Leipziger Herbstmesse. Der 30-jährige Diplom-Ökonom Schalck war damals gerade zum 1. Sekretär der SED-Kreisleitung im DDR-Außenhandelsministerium aufgestiegen. Volpert, ein halbes Jahr jünger als Schalck, hatte nach einer landwirtschaftlichen Lehre eine Offizierslaufbahn bei der Stasi eingeschlagen. Seit 1954 widmete er sich der »Bekämpfung des politischen Untergrunds«, wie es im Stasi-Jargon hieß: Er beteiligte sich an der Entführung und Verschleppung von SED-Gegnern aus Westberlin und der Bundesrepublik.2
1966 avancierte Schalck zum Leiter des neu gegründeten Bereichs Kommerzielle Koordinierung, abgekürzt KoKo. Dessen Aufgabe war es, Devisen zu beschaffen, mit denen die DDR Importe aus westlichen Ländern bezahlen konnte. Zugleich verpflichtete er sich der Stasi, angeworben von seinem Kumpel Volpert, als »Offizier im besonderen Einsatz«. Volpert wurde 1969 ins »Büro der Leitung« des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) berufen und von Minister Erich Mielke mit der »Durchführung von Sonderaufgaben« betraut.
Im Frühjahr 1970 strebte das ehrgeizige Duo nach akademischen Weihen. »Damals war es in meinen Kreisen regelrecht in Mode gekommen zu promovieren«, berichtete Schalck.3 Scharenweise schmückten sich Stasi-Funktionäre mit einem Doktortitel, den sie an der »Juristischen Hochschule Potsdam« (JHS), einer Einrichtung des MfS, erwerben konnten. Da »einige der mir gleichgestellten Kollegen … promoviert« waren, mochte Schalck »ihnen nicht nachstehen«. Viel Zeit, wusste er, stand ihm »nicht zur Verfügung, die Promotion durfte nicht aufwendig geraten«. So kam ihm »die Möglichkeit zur sogenannten Doppeldissertation … entgegen«4 – eine Besonderheit der JHS: Nur jede fünfte Promotionsarbeit an der JHS wurde von einem einzelnen Doktoranden verfasst, Kollektiv-Dissertationen von bis zu zehn Autoren waren die Regel.5
Anfang Mai 1970 legten Schalck und Volpert ihr Manuskript vor. Die 188 Seiten umfassende Abhandlung trug den sperrigen Titel »Zur Vermeidung ökonomischer Verluste und zur Erwirtschaftung zusätzlicher Devisen im Bereich Kommerzielle Koordinierung des Ministeriums für Außenwirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik«. Während des Promotionsverfahrens wurde der Titel etwas griffiger, aber auch aggressiver formuliert: »Zur Bekämpfung der imperialistischen Störtätigkeit auf dem Gebiet des Außenhandels«. Bei der in schauderhaftem Funktionärskauderwelsch abgefassten Arbeit handelte es sich, wie die Kommission des JHS-Senats ausdrücklich festhielt, um einen »Forschungsauftrag des Ministers für Staatssicherheit«.6
Tatsächlich war es eine pseudowissenschaftliche Handlungsanleitung zur Wirtschaftskriminalität. Die beiden Verfasser beschrieben, wie man ein Netz von Tarn- und Briefkastenfirmen aufbaut, sich mithilfe von Strohmännern an »lukrativen kapitalistischen Firmen« und Spekulationsgeschäften beteiligt, wie man Wirtschaftsspionage betreibt und westliche Technologien in die DDR schmuggelt. Es waren genau die Aktivitäten, die der Bereich Kommerzielle Koordinierung schon betrieb oder künftig betreiben sollte.
Die beiden Doktoranden definierten KoKo als eine Art Notwehrmaßnahme. Schuld an den ökonomischen Nöten der DDR waren nach ihrer Darstellung nicht die Konstruktionsfehler der sozialistischen Kommandowirtschaft, sondern böse Mächte im Westen: »Dem westdeutschen Imperialismus sind im ökonomischen Wettbewerb mit der DDR und zur Erhöhung seines industriellen Wachstumstempos alle Mittel und Methoden – einschließlich verbrecherischer – recht.« Die Verfasser hielten es daher für »gerechtfertigt, in Anbetracht der uns zugefügten Schäden … dem Feind mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten, durch Anwendung seiner eigenen Methoden und Moralbegriffe, Schaden zuzufügen sowie die sich bietenden Möglichkeiten des feindlichen Wirtschaftspotenzials zur allseitigen Stärkung der DDR voll zu nutzen«.7
Als »Exponenten des westdeutschen Imperialismus« identifizierten Schalck und Volpert den CSU-Politiker Franz Josef Strauß. In dessen Büchern »Entwurf für Europa« und »Herausforderung und Antwort. Ein Programm für Europa« werde ein »perfektionistisches Programm« entwickelt, »wie, mit welchen Methoden und welchen taktischen Varianten ein sogenanntes vereinigtes Europa, unter Vorherrschaft des aggressiven westdeutschen Imperialismus, durch die Liquidierung der sozialistischen Staaten errichtet werden« solle.
Die neue Deutschland- und Ostpolitik der seit Herbst 1969 in Bonn regierenden Koalition aus SPD und FDP ändere nichts an der »Aggressions- und Kriegsgefahr, die vom westdeutschen Imperialismus für die sozialistischen Staaten« ausgehe, polemisierten die beiden Doktoranden. Die neue Regierung werde vielmehr »neue verfeinerte und raffiniertere Taktiken und Methoden im Kampf gegen den Sozialismus anwenden, die schwerer durchschaubar, demagogischer und damit zugleich aber auch gefährlicher« seien. Das »Anliegen der Handelspolitik« der neuen Bundesregierung werde »auch weiterhin darin bestehen, mittels des Ausbaus der Wirtschaftsbeziehungen zur DDR zu versuchen, die DDR ökonomisch und politisch zu unterwandern«.
Als Doktorvater fungierte Stasi-Minister Mielke persönlich, der nach eigenen Angaben nur die »Volksschule 7 Klassen« und das »Köllnische Gymnasium Berlin bis zur Untersecunda« besucht, also ohne Abitur die Schule abgebrochen hatte.8 Schalcks und Volperts Promotionsverfahren war das einzige, bei dem Mielke als Betreuer auftrat.9 Gutachter waren Generalmajor Rudi Mittig, der später einer der Mielke-Stellvertreter wurde, und der JHS-Forschungsdirektor Oberstleutnant Heinz Janzen. »Die vorliegende Dissertation«, befand Mittig, sei »eine bedeutende und mutige wissenschaftliche Arbeit zur weiteren Gestaltung, Effektivierung und Sicherung unserer Außenwirtschaftsbeziehungen« mit den nichtsozialistischen Ländern. In der Diskussion, von der nur Stichworte protokolliert wurden, machte Mielke teilweise verwirrende Anmerkungen, die in der Feststellung gipfelten: »Wenn uns die Kap[italisten] nichts geben, müssen wir den Soz[ialismus] dennoch aufbauen.«
Schalck und Volpert verteidigten ihre Dissertation am 26. Mai 1970 im Dienstzimmer Mielkes vor einer fünfköpfigen Kommission des JHS-Senats. Die mit dem Prädikat »magna cum laude« ausgezeichnete Arbeit wurde, entgegen allen akademischen Regeln, weder in der Hochschule archiviert noch in wissenschaftlichen Bibliotheken hinterlegt, sondern als »Geheime Verschlusssache« MfS 210-354/70 weggesperrt. Ein Exemplar wurde im Januar 1990 in einem Tresor Mielkes gefunden.
Zuletzt hatte von den rund 200 Angehörigen der MfS-Führungsebene etwa jeder Vierte einen Doktortitel von der JHS. Den »Dr. iur.« durften die Pseudo-Akademiker nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten behalten. Auch Doktor Schalck.
1 Schalck, S. 139
2 Pötzl (2014), S. 62–63; vgl. Karl Wilhelm Fricke/Roger Engelmann: »›Konzentrierte Schläge‹«, S. 206–207
3 Schalck, S. 179
4 Schalck, S. 179
5 G. Förster, S. 41–42
6 Dissertation Schalck/Volpert in Deutscher Bundestag, Drs. 12/3462, S. 123–330 (Dokument 22)
7 Dissertation S. 3, S. 128
8 Von Erich Mielke am 15.6.1945 ausgefüllter Fragebogen der KPD, abgedruckt in Jochen von Lang: »Erich Mielke. Eine deutsche Karriere«. Berlin 1991, S. 224
9 G. Förster, S. 37
1VOM HOFFNUNGSTRÄGER ZUR HASSFIGUR
Kaum jemand in der DDR kannte ihn, obwohl er einer der mächtigsten Politiker des Landes war. Nur selten war er auf Zeitungsfotos zu sehen, immer hielt er sich im Hintergrund. Mit seiner kräftigen Statur und seiner dunkel getönten Brille sah er aus wie ein Bodyguard oder ein Geheimdienstler, was er, nebenbei, auch war. Offiziell hatte er den Titel eines Staatssekretärs im Außenhandelsministerium. Sein Name, wenn er denn überhaupt in der Öffentlichkeit fiel, wurde nur hinter vorgehaltener Hand erwähnt, und was seine Aufgabe war, blieb der Bevölkerung verborgen. Über seine Organisation, brüstete er sich später, habe »nicht einmal der kleine Kreis von Eingeweihten in den höchsten Etagen des Parteiapparats Bescheid« gewusst.10
Am 30. Oktober 1989 geriet der geheimnisumwitterte Mann unversehens ins Rampenlicht. Seit Wochen waren Hunderttausende DDR-Bürger auf die Straßen gegangen und hatten vom SED-Regime Reformen und demokratische Grundrechte wie Reise-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit gefordert. Um das Machtmonopol der Staatspartei zu retten, hatte das SED-Politbüro den seit 1971 amtierenden Generalsekretär Erich Honecker am 18. Oktober zum Rücktritt gezwungen, aber die Unzufriedenheit der Bevölkerung hielt auch unter der neuen Führung von Egon Krenz an. Die von ihm ausgerufene »Wende« beabsichtigte keinen Wandel zur Demokratie, sondern entpuppte sich als ein letztes verzweifeltes Aufbäumen der diskreditierten Staatspartei. In der aufgeheizten Stimmung sollte der Funktionär, der bislang im Verborgenen gewirkt hatte, Wege in die Zukunft weisen. Alexander Schalck-Golodkowski musste ins Fernsehen.
In der montäglichen »Aha«-Sendung, die eigentlich ein Wissenschaftsmagazin war, stellte sich der 57-Jährige live den Fragen des Publikums. Die Zuschauer erlebten einen korpulenten 1,90-Meter-Mann mit rundem Gesicht, der kräftig berlinerte. Für Schalck-Golodkowski war es »eine ungewohnte und schwierige Situation«, sollte er doch »in der Öffentlichkeit von Dingen reden, die bislang der größten Geheimhaltung unterlegen hatten«.11
Er versuchte, den Menschen am Bildschirm zu erklären, wie er sich in der Vergangenheit bemüht hatte, der überall zutage tretenden Mangelwirtschaft in der DDR entgegenzuwirken. Sein Metier war es gewesen, Devisen – also Geld in harter Währung – für den Import westlicher Güter zu beschaffen, die im Land selbst nicht hergestellt werden konnten. Mit der nicht konvertierbaren DDR-Mark konnte man auf dem Weltmarkt nichts kaufen.
Gewöhnliche DDR-Bürger, die Urlaube außerhalb des eigenen Landes ohnehin nur in sozialistischen Bruderländern verbringen durften, spürten dort, an der bulgarischen Schwarzmeerküste oder am ungarischen Balaton, wie sie mit ihren »Alu-Chips« gegenüber westdeutschen D-Mark-Besitzern von den Hoteliers und Gastwirten als »Deutsche zweiter Klasse« behandelt wurden. Ebenso fühlte sich benachteiligt, wer mangels westlicher Zahlungsmittel nicht in den Intershop-Läden einkaufen durfte.
Ob diese Geschäfte, in denen nur mit Westgeld bezahlte Wertgutscheine akzeptiert wurden, beibehalten würden, fragte ein Mann aus dem Publikum. »Dr. Schalck«, wie er vom Moderator vorgestellt wurde, holte weit aus. Die DDR mit »jährlich 38 Millionen Besuchern und acht Millionen Durchreisenden«12 nehme nun mal »als Transitland einen wichtigen Raum in Mitteleuropa« ein. Jeder Staat in dieser geografischen Lage, dozierte er, »würde schlecht beraten sein, wenn er die Möglichkeiten verschenkt, Devisen einzunehmen«. Für die Intershops gebe es als »Einnahmequelle keinen Ersatz«. Eines sei nämlich gewiss: »Diese Devisen werden für dringend wichtige Aufgaben eingesetzt.« Das sei seine »ehrliche Antwort«.
Schmallippig wich Schalck der Beantwortung der nächsten Frage aus. »Welche Größenordnung« der Einsatz von Devisen zugunsten privilegierter Staatsfunktionäre habe, wollte ein junger Mann wissen. Das Volk murre über das Luxusleben der Parteibonzen in ihrer abgeschotteten Waldsiedlung Wandlitz nördlich von Berlin. Er sei »für Außenhandel zuständig, nicht für die Versorgung der Repräsentanten«, fertigte Schalck den Fragesteller ab. Das war glatt gelogen, was aber nur Insider wussten. Pikanterweise war es Schalcks Ehefrau Sigrid, die der Polit-Prominenz in Wandlitz das schöne Leben mit westlichen Produkten organisierte. Ihr unterstand das zu Schalcks Firmen-Imperium gehörende »staatliche Handelsobjekt« Letex, das Jahr für Jahr sechs bis sieben Millionen DM ausgab, um die anspruchsvollen Wünsche ihrer Klientel zu befriedigen: Champagner und Kaviar, Kosmetik und Schmuck, Unterhaltungselektronik und Jagdgewehre.
Markus Wolf, der frühere Geheimdienstchef der DDR, ärgerte sich über Schalcks TV-Auftritt. Bis 1986, als Wolf, nicht ganz freiwillig, aus dem aktiven Dienst ausschied, hatten sich die beiden Männer »einmal im Jahr dienstlich« getroffen, wie beide übereinstimmend berichteten.13 Dabei ging es laut Wolf »um die Führung der von der HVA genutzten Firmen« in Schalcks Revier und um Devisen, die Schalck für die Arbeit des Geheimdienstes zur Verfügung stellte. Privat, erzählte Schalck, seien sie sich »hin und wieder begegnet, auf Empfängen, bei Theaterbesuchen und Modeschauen, zwei-, dreimal zufällig an beliebten Urlaubsorten« und »wenige Male« bei Wolf zu Hause. Auch der Ex-Geheimdienstchef spielte im Nachhinein seine Kontakte mit Schalck herunter.
Nun erlebte Wolf am Bildschirm, wie Schalck öffentlich mit seinem Fachwissen auftrumpfte. Das Selbstbewusstsein, das der Staatssekretär ausstrahlte, schien Gerüchten Auftrieb zu geben, dass er als Nachfolger des langjährigen Wirtschaftslenkers Günter Mittag für einen Sitz im neuen SED-Politbüro vorgesehen sei. Wolf, der stets eifersüchtig beobachtet hatte, wie hoch Schalck in der Gunst des Stasi-Ministers Mielke stand, trachtete danach, diesen Karriereschritt zu verhindern. Deshalb sprach der russophile, in Moskau aufgewachsene »Mischa« Wolf im Zusammenhang mit Schalck von einem »Raschidow-Syndrom« – der Name des ehemaligen usbekischen KP-Chefs Scharaf Raschidow war in der Sowjetunion ein Synonym für Machtmissbrauch und Korruption.14
Wolf vergaß allerdings zu erwähnen, dass er selbst am System Schalck partizipiert hatte: Einrichtung und Ausstattung der Maisonette-Wohnung am Spreeufer 2 im frisch sanierten Nikolaiviertel, die Wolf nach seiner Pensionierung bezogen hatte, hatten laut erhalten gebliebenen Rechnungen 545752,97 Mark verschlungen, davon 200000 in Devisen. Schalck machte es möglich. Während die kleine Republik hoch verschuldet war, wurde Wolfs Wohnung mit teurer westlicher Küchentechnik und Unterhaltungselektronik bestückt, auch Sauna und Solarium durften nicht fehlen.15
Bis zu Schalcks erstem Erscheinen vor Fernsehkameras war nicht einmal der Name des von ihm geleiteten geheimen Firmenverbunds an die Öffentlichkeit gedrungen. Der »Bereich Kommerzielle Koordinierung«, kurz »KoKo« genannt, bestand, wie erst sehr viel später bekannt wurde, aus einem verschachtelten Konglomerat von 223 Firmen, die meisten davon im Westen.16 Das Firmengeflecht kannte in all seinen Verästelungen nur Schalck. Manche dieser Unternehmen betrieben normalen Ost-West-Handel, andere bestanden lediglich aus Briefkästen und Nummernkonten in Steueroasen wie Liechtenstein, Luxemburg oder Curaçao. Die meisten machten kriminelle oder zumindest moralisch fragwürdige Geschäfte.
Was KoKo trieb, war noch nicht publik geworden, und so konnte sich Schalck ein paar Tage später noch einmal vorteilhaft in Szene setzen. Am Rande der großen Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November ließ er sich vom TV-Jugendmagazin »Elf99« interviewen. Schalck bedauerte die Flucht von Zehntausenden, die der DDR über die seit dem 11. September offene Grenze zwischen Ungarn und Österreich den Rücken gekehrt oder über die westdeutschen Botschaften in Prag und Warschau ihre Ausreise erzwungen hatten. Als Migrationsmotiv sah Schalck allein die Versorgungsengpässe in der DDR; dass es den Menschen an geistiger Freiheit fehlte, schien ihm fremd zu sein. »Die Wünsche werden immer größer sein als die Möglichkeiten, das ist auf der ganzen Welt so«, spielte er den Unmut herunter. Er deutete an, wie die wirtschaftliche Lage in der DDR verbessert werden könne: »Wir sollten bemüht sein …, dass wir die Produktionsbasis stärken, dass wir den Betrieben … die Möglichkeit geben, modern zu produzieren mit hoher Arbeitsproduktivität, dass die Arbeiter kontinuierlich mit Material versorgt werden, damit keine Wartezeiten, Stillstandszeiten entstehen.« Aufgrund maroder Fabriken, veralteter Maschinen und großem Personalüberhang lag die Arbeitsproduktivität in der DDR nur bei 30 Prozent des westdeutschen Niveaus.17
Schalck reihte Plattitüden aneinander. Aber seine joviale Art, Expertise vorzuspiegeln, verfing. Er erschien den Zuschauern als dynamischer Macher, und er präsentierte sich, dank seiner bisherigen Unsichtbarkeit, als neues Gesicht. »Spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsminister von morgen?«, fragte der Reporter, doch Schalck wiegelte ab: »Nee, ich habe jetzt 38 Jahre im Außenhandel gedient, nach bestem Wissen und Gewissen, habe fast vom Lehrling bis zum Staatssekretär mich dort hochgedient.«18
Tatsächlich hätte Schalck sogar zu Höherem berufen werden können. Egon Krenz, der neue SED-Generalsekretär, mit dem er befreundet war, erwog in den ersten Novembertagen, Schalck zum Vorsitzenden des Ministerrats zu berufen. Schalck, argumentierte Krenz, kenne »sich in der Ökonomie aus und im Umgang mit der BRD, beides brauchen wir«.19 Letzteres war Krenz besonders wichtig, weil die Regierung in Bonn der finanziell klammen DDR aus der Patsche helfen sollte. Schalck schien dafür der beste Mann zu sein, hatte er doch seit Jahren intensive Kontakte zu westdeutschen Politikern gepflegt, hatte 1983 mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß einen Milliardenkredit für die DDR angebahnt, Honeckers Besuch 1987 in der Bundesrepublik vorbereitet, über Transitpauschalen für die Benutzung der DDR-Autobahnen, über einen Finanzausgleich im Postverkehr und vieles mehr verhandelt. Mit dem Bonner Kanzleramtsminister Rudolf Seiters (CDU) wollte Schalck nun erörtern, inwieweit die Bundesregierung bereit wäre, sich an den Kosten der in Aussicht gestellten verbesserten Reisemöglichkeiten für DDR-Bürger in den Westen zu beteiligen.20 Denn wenn auf einmal Millionen Ostdeutsche die Bundesrepublik besuchen wollten, brauchten sie harte D-Mark, die ihnen ihr Staat nicht bieten konnte.
Wenige Tage nach seinem Amtsantritt als SED-Chef hatte Krenz am 24. Oktober ein Gutachten in Auftrag gegeben, um dem Politbüro »ein ungeschminktes Bild der ökonomischen Lage der DDR mit Schlussfolgerungen vorzulegen«. Sechs Tage später lag die Analyse vor. Verfasst hatten das geheime 24-Seiten-Papier fünf Experten, die schon jahrzehntelang verantwortliche Positionen innehatten: Gerhard Schürer, seit 1965 Leiter der Staatlichen Plankommission beim Ministerrat der DDR, Außenhandelsminister Gerhard Beil, Finanzminister Ernst Höfner, Arno Donda, seit 1963 Chef der DDR-Statistik, und Schalck.21
Die Bilanz war niederschmetternd. Die Verschuldung der DDR im kapitalistischen Ausland, dem »Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet« (NSW), habe eine Höhe erreicht, »die die Zahlungsfähigkeit der DDR in Frage stellt«. Die Auslandsverschuldung, die 1970, im Jahr vor Honeckers Machtantritt, erst zwei Milliarden »Valutamark« (so die offizielle DDR-Bezeichnung für die D-Mark) betragen hatte, sei bis 1989 auf 49 Milliarden Valutamark gestiegen. Dies liege daran, dass die Sozialpolitik seit 1971 »nicht in vollem Umfang auf eigenen Leistungen beruht« habe. Honecker und Günter Mittag, der Wirtschaftssekretär des SED-Zentralkomitees, hatten auf großzügigen Subventionen für Konsumgüter, Mieten und Verkehrsmittel beharrt, um das Volk bei Laune zu halten. Die fünf Wirtschaftsexperten malten die Zukunft in düsteren Farben: »Allein ein Stoppen der Verschuldung«, prognostizierten sie, würde 1990 »eine Senkung des Lebensstandards um 25–30 % erfordern und die DDR unregierbar machen«.
Am 6. November schickte Krenz seinen Boten wieder in geheimer Mission nach Bonn, um Kanzleramtsminister Seiters und Innenminister Wolfgang Schäuble um Milliardenbeträge für die kaputte Kommandowirtschaft anzubetteln. Schalck bat um »langfristige Kredite … bis zur Höhe von zehn Milliarden« DM, außerdem um »Bereitstellung zusätzlicher Kreditlinien in freien Devisen, die – beginnend im Jahre 1991 – zwei bis drei Milliarden DM betragen könnten«.22 Spätestens jetzt war Seiters und Schäuble klar, in welch desolatem Zustand sich die DDR-Wirtschaft befand. Mit leeren Händen musste der Ostberliner Abgesandte heimreisen. Als Gegenleistung hatte Schalck zuletzt noch angeboten, dass die DDR die innerdeutsche Grenze bis zum Jahr 2000 durchlässig machen würde. Doch mit der von Politbüro-Mitglied Günter Schabowski schusselig verkündeten Öffnung der Mauer am 9. November gab die SED-Spitze ihr einzig verbliebenes Faustpfand aus der Hand.
Während Schalck insgeheim mit westdeutschen Politikern verhandelte, wurde er in der ostdeutschen Öffentlichkeit immer heftiger angefeindet. Der Devisenbeschaffer, beklagte Krenz, werde »zu Unrecht … sehr stark mit der Politik Mittags verbunden«. Deshalb werde er auf Schalcks Kompetenz »verzichten müssen«.23 Und so wurde am 13. November nicht Schalck, sondern der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden, Hans Modrow, zum Ministerpräsidenten gewählt. Modrow, ein hagerer Asket, der immer sauertöpfisch wirkte, galt als Favorit des sowjetischen Parteichefs Michail Gorbatschow. Zu Modrows ersten Entscheidungen gehörte es, die Sonderrolle von KoKo zu beenden und Schalcks Firmenimperium in das Ministerium für Außenhandel einzugliedern. In seinem Amtszimmer eröffnete Modrow dem Devisenbeschaffer, dass er von nun an der Regierung rechenschaftspflichtig sei. Augenzeugen berichteten, Schalck sei den Tränen nahe gewesen.24
Schalck, der vorher nur zwei Vorgesetzte hatte – Mittag und Mielke –, war nun von seinem Intimfeind, dem Außenhandelsminister Gerhard Beil, weisungsabhängig.25 In diesem Moment seiner Degradierung fasste Schalck wohl erstmals den konkreten Plan, die DDR zu verlassen. Nach Erkenntnissen des Bundesnachrichtendienstes sprach er bereits »etwa Mitte November 1989 … mit Innenminister Schäuble über die Notwendigkeit, in die Bundesrepublik gehen zu müssen«.26 Gegenüber dem westdeutschen Diakonie-Präsidenten Karl Heinz Neukamm, mit dem er in geschäftlichem Kontakt stand, deutete Schalck an, »dass er eines Tages von seinen Partnern in der Bundesregierung Hilfe brauche«. Er bat Neukamm, »dieses Ansinnen Seiters und Schäuble anzutragen«.27
Das Unheil über Schalck hatte sich seit dem 6. November zusammengebraut. An diesem Tag war in der Spiegel-Titelgeschichte (»Ist die DDR noch zu retten?«) Schalck in einem Absatz gleich drei Mal als aussichtsreicher Aspirant auf den Chefposten in der Regierung erwähnt worden. »Gute Chancen«, orakelte das Nachrichtenmagazin, habe der Genosse, »der vielen SED-Leuten als zwielichtige Figur gilt, dem aber auch seine Gegner bescheinigen, der erfolgreichste Geschäftsmann der Partei zu sein«. Zum ersten Mal erfuhr die Öffentlichkeit von dem geheimnisvollen Bereich Kommerzielle Koordinierung, als deren Chef Schalck »für die SED jährlich Milliarden an Westmark« hereinhole – »wenn es sein muss, mit Steuerbetrug und kriminellen Geschäftsmethoden«. Schalck dirigiere die Intershops in der DDR und Tarnfirmen der SED in der Bundesrepublik, er habe seine Finger in Waffengeschäften der DDR ebenso wie im staatlich sanktionierten Schmuggel mit Alkohol und Zigaretten.28
Zwei Wochen später legte der Spiegel mit einer ausführlichen Story über Schalcks Schattenreich nach. Darin war die Rede von einem Wust ostdeutscher Unternehmen in der Bundesrepublik, die mithilfe verdeckten DDR-Kapitals von westdeutschen Kommunisten geführt und in Holdings außerhalb der Landesgrenzen eingebracht wurden, von illegalem Import westlicher Hightech-Produkte und von Luxusgütern, mit denen Schalck die SED-Führungsriege versorgte.29
Den Report hatten die Redakteure Georg Bönisch und Ulrich Schwarz bereits im Jahr zuvor recherchiert, offenbarte das Blatt gut zwei Jahrzehnte später in eigener Sache: »Wie Blei lag er im Stehsatz herum, der damalige Chefredakteur hielt ihn für nicht zeitgemäß. Es gab anderes zu berichten ab Frühjahr 1989: über die Demonstrationen der DDR-Opposition und die Flüchtlingsströme nach Budapest und Prag. Als aber die Mauer fiel, war plötzlich alles gefragt, was die Agonie des Honecker-Staats einigermaßen zu erklären vermochte.«
Nebenbei bestätigte der Spiegel, dass Schalck in der Bundesrepublik mächtige Fürsprecher hatte: Bonn habe »kein Interesse daran« gehabt, »Schalck zu desavouieren, das belegt ein Anruf von Innenminister Wolfgang Schäuble in der Hamburger Redaktion. Er bat kurz vor Drucklegung des Artikels um Diskretion und riet von der Veröffentlichung ab: Man brauche Schalck noch im deutsch-deutschen Verhandlungsprozess.«30 Der Spiegel druckte dennoch. Die brisanten Nachrichten verbreiteten sich rasch in der ostdeutschen Republik. »Tausendfach fotokopiert, von Hand zu Hand gereicht, in Betrieben ausgehängt, wurde er zur Volkslektüre«, freute sich die Spiegel-Redaktion über die Resonanz.31
»Dass es geheime Geschäfte gab, dass die Nomenklatura der DDR Privilegien genoss, konnte zwar niemanden überraschen«, meinte Schalck. Aber kaum jemand habe gewusst, wie es und was genau geschah. Die Folgen für Schalck waren verheerend: »Ich geriet ins Zwielicht. Man musste den Eindruck gewinnen, ich sei der Drahtzieher aller üblen Machenschaften in der DDR.«32 Da der Spiegel auch Schalcks Privatadresse preisgegeben hatte, versammelten sich vor seinem Haus in der Manetstraße 16 in Berlin-Hohenschönhausen Demonstranten, die Morddrohungen ausstießen. Innerhalb eines Monats war Schalck vom Hoffnungsträger zur Hassfigur geworden. »In der nationalen Ablehnung«, beobachtete Schalcks Hausarzt Heinz Wuschech, sei er »aktuell allenfalls noch übertroffen« worden von Margot Honecker, der verabscheuten Volksbildungsministerin und Generalsekretärsgattin.33
Die größte Wut entlud sich wegen der Privilegien der SED-Oberen in der Waldsiedlung Wandlitz. Seit 1960 wohnten die Mitglieder des Politbüros mit ihren Familien in dem streng abgeschirmten Bonzenghetto nördlich von Berlin, 40 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Das eineinhalb Quadratkilometer große Gelände, auf keiner Landkarte verzeichnet und auf Schildern als »Wildforschungsgebiet« ausgewiesen, war ringsum von Mauern und Stacheldraht umgeben. Die Wohnhäuser waren keine Luxuspaläste mit goldenen Wasserhähnen, sondern graue Fünfzigerjahre-Bauten mit spießigem Interieur. Großzügig war nur die Wohnfläche mit 200 Quadratmetern und bis zu 15 Zimmern. In dem Kaufhaus der Prominenten-Siedlung durften nur die 28 dort wohnenden Familien einkaufen und die in DM ausgezeichneten Waren 1:1 mit Ostgeld bezahlen.
Spezielle Bedürfnisse der »verdorbenen Greise«, wie der Liedermacher Wolf Biermann die Politbüro-Gerontokraten in einer Ballade betitelte, befriedigte Schalck persönlich. Bevor Honecker in Urlaub fuhr, ließ Schalck durch Kuriere jedes Mal zwei Koffer mit Videofilmen in Westberlin kaufen.34 Der SED-Chef bevorzugte Softpornos wie »Black Emanuelle« oder »Die schwarze Nymphomanin«, die Bestellung des François-Truffaut-Klassikers »Die amerikanische Nacht« beruhte wohl auf einer falschen Erwartung. Insgesamt, so kam später vor Gericht heraus, hatte Schalck für Honecker und Mittag 4864 Videokassetten im Gesamtwert von mehr als 1,3 Millionen DM beschafft, die sich die beiden SED-Führer brüderlich je zur Hälfte teilten. Honeckers Fuhrpark umfasste bis zu 60 West-Autos, darunter acht Geländewagen von Mercedes-Benz und Landrover, die in Westberlin für die Jagdausflüge der Spitzengenossen umgerüstet wurden und jeweils mehr als 300 000 DM gekostet hatten.35
Am 23. November 1989 gelang es Jan Carpentier, einem Reporter der TV-Jugendsendung »Elf99«, mit seinem Kamerateam Aufnahmen in der Waldsiedlung zu machen. In der Wandlitzer Verkaufsstelle, in der reichlich Südfrüchte auslagen, traf Carpentier die Chefin des Ladens an, die ihm, treuherzig lächelnd, weismachen wollte, das Warenangebot hier gleiche dem der »Konsum«-Kaufhallen in der übrigen DDR. Carpentier erwiderte trocken: »Mit Bananen und Ananas sieht es gerade ein bisschen schlecht aus in der Republik.«36
Nicht nur damit. Ständig herrschte Mangel an fast allem. Engpässe gab es immer wieder bei der Versorgung mit hochwertiger Kleidung, schicken Möbeln, mit Bettwäsche, Fleisch, Wurst, Obst und Gemüse. Stereoanlagen oder Farbfernseher waren schwer zu bekommen und teuer, technischer Standard, Design und Qualität der Geräte aus heimischer Produktion oft dürftig.
Schon bei seinem ersten Fernsehauftritt war Schalck die Unzufriedenheit der Bevölkerung entgegengeschwappt. Um die Stimmung zu heben, hatte er Krenz am 2. November empfohlen, »NSW-Importe zum Weihnachtsfest« zu verstärken: »Apfelsinen, Obstkonserven, Sekt, Dauerbackwaren, Schokoladenerzeugnisse, Zuckerwaren«.37 Außerdem sollten 50000 Sanya-Videorecorder eingeführt und für jeweils 7350 DDR-Mark verkauft werden.38 Das war kein Schnäppchenpreis, sondern mehr als das halbe Jahreseinkommen eines durchschnittlichen DDR-Werktätigen.
Schalcks Aussagen in der »Aha«-Sendung vom 30. Oktober löste auch interne Kritik aus. Eine ehemals leitende Außenhandelsmitarbeiterin beschwerte sich, dass der KoKo-Chef so tat, als habe er mit den »Sonderversorgungen« der Wandlitzer nichts zu tun. Nun klärte sie die Redaktion der Berliner Zeitung, die über die »Ausstattung mit Material aus dem NSW für die dort angesprochenen Häuser« berichtet hatte, darüber auf, dass dies keineswegs »über das Ministerium für Außenhandel realisiert« worden sei. »In dieser Allgemeinheit«, sagte sie dem SED-Blatt, sei das »ganz sicher falsch«. Vielmehr gebe es da »den sogenannten KoKo-Bereich«, in dem sie selbst »längere Zeit tätig« gewesen sei und den sie »aus inneren Konflikten verlassen« habe. Sie habe persönlich in Schalcks Auftrag »solche Sonderimporte durchgeführt«. Damals, fügte sie hinzu, »glaubte ich noch, es diene unserer Sache«.39
Die rasch gewendeten Abgeordneten in der DDR-Volkskammer setzten am 22. November einen »Untersuchungsausschuss zur Überprüfung von Fällen des Amtsmissbrauchs, der Korruption und der persönlichen Bereicherung« ein. Im Fokus stand neben der ehemaligen Partei- und Staatsführung auch der Bereich KoKo, der den »parasitären Lebensstil« höherer Parteifunktionäre ermöglicht habe. KoKo hatte 32 Einfamilienhäuser an Parteifunktionäre, aber auch an Verwandte und Hauspersonal Schalcks vermietet. So wohnten zwei Töchter Mittags mit ihren Familien fast umsonst in KoKo-Villen in Schildow nördlich von Berlin, auch für Mittag selbst war schon ein Altersruhesitz reserviert. »Innen- und Außeneinrichtung« seien »luxuriös und teuer« gewesen, berichtete eine Besucherin, unter anderem gab es ein Kamingitter für geschätzt 12000 DDR-Mark, ein Fliesenwandbild für 30000 Mark, eine Stützmauer im Garten, die nach vorhandenen Belegen fast eine halbe Million Mark gekostet hatte, überall edle Hölzer, ein eingebautes Rokoko-Schlafzimmer, Tapeten, Lampen, Armaturen aus dem NSW, alles »oberste Preisgruppe«.40
Zum Vorsitzenden des Ausschusses wurde ausgerechnet Heinrich Toeplitz berufen, der langjährige Präsident des Obersten Gerichts der DDR, der in vielen Schauprozessen gegen Regimegegner den Vorsitz geführt hatte. Außerdem war er bis vor wenigen Tagen stellvertretender Vorsitzender der Ost-CDU gewesen, die als »Blockpartei« mit der SED in der Nationalen Front verbunden war. Der altgediente DDR-Funktionär zählte eine lange Liste von Verfehlungen auf, die auch Schalck betrafen. Toeplitz erklärte, dass alle Schuldigen ohne Ansehen der Person zur Rechenschaft gezogen würden. Schalck wurde aufgefordert, alsbald vor dem Ausschuss zu erscheinen.
Zuerst musste Schalck sich gegenüber dem neuen Ministerpräsidenten Modrow rechtfertigen. Er schickte eine umfangreiche Stellungnahme, die auf den zentralen Vorwurf der Klüngelwirtschaft überhaupt nicht einging. Stattdessen rühmte er Ko-Ko-Wohltaten für das Volk und berief sich darauf, nur Befehle ausgeführt zu haben: Alles sei von oben, speziell von Mittag, angeordnet worden, und der Bereich Kommerzielle Koordinierung habe »immer dann … Zusatzimporte realisiert«, wenn »die Versorgung der Bevölkerung planmäßig nicht gesichert werden konnte«.41
Akribisch präparierte sich Schalck für ein Rundfunkinterview am 24. November, um Kritik an KoKo abzuwehren. »Die erfolgreiche Tätigkeit des Bereiches zum Nutzen der DDR«, notierte er in seinem sechs Seiten umfassenden »Vorbereitungsmaterial«, sei »häufig auch Gegenstand von Angriffen und Verleumdungen westlicher Medien« gewesen. »Halbwahrheiten und Verfälschungen« seien »mit dem Ziel genutzt« worden, die »Geschäftstätigkeit zu erschweren«.42
Doch Schalck geriet immer mehr unter Druck. Zuerst distanzierte sich die Stasi von ihm. Am 26. November traf sich Schalck mit Wolfgang Schwanitz, dem von Modrow berufenen Leiter des Amtes für Nationale Sicherheit, wie das Ministerium für Staatssicherheit nun hieß. Trotz neuem Namen herrschte Kontinuität: Generalleutnant Schwanitz war bisher einer der Stellvertreter des am 7. November zurückgetretenen Stasi-Ministers Mielke, fast 40 Jahre hatte er im Dienst des MfS gestanden. Schwanitz riet dem KoKo-Chef, sich bei einer Befragung durch den Volkskammerausschuss darauf zu berufen, dass er über Staatsgeheimnisse keine Auskunft geben dürfe.43
Tags darauf wurde Schalck, zusammen mit seinem Stellvertreter Manfred Seidel, zu Generalleutnant Günter Möller zitiert, auch er fast 40 Jahre im MfS, seit 1986 Leiter der Hauptabteilung Kader und Schulung. Den Posten des Personalchefs behielt Möller auch im umbenannten Amt. Schalck und Seidel waren, wie 17 andere KoKo-Mitarbeiter, Stasi-»Offiziere im besonderen Einsatz« (OibE) gewesen. Nach Aussagen Schalcks gab es im Bereich KoKo zweierlei OibE: Neun, darunter seine Ehefrau Sigrid, wurden vom MfS voll bezahlt; zehn weitere, darunter er selbst und sein Vize Seidel, erhielten Ausgleichszahlungen des MfS neben ihren offiziellen Gehältern als Außenhändler.
Auch Möller versuchte, Schalck zum Schweigen zu vergattern. Der KoKo-Chef solle sein Dienstverhältnis zur Staatssicherheit verheimlichen. Aber Schalck widersprach dem Ansinnen. Fakt sei doch, »dass westliche Behörden und Regierungsstellen als auch Geheimdienste wissen, dass alle durch den Bereich KK abgeschlossenen Geschäfte usw. nur mit Billigung des früheren MfS … geschahen und geschehen«, notierte der Protokollant des Krisengesprächs. »Von anderen Prämissen auszugehen hieße, Illusionen nachzuhängen.« Wenn er also vor dem Ausschuss aussagen müsse, könne er »die Verbindung zum MfS kaum leugnen«. Unverhohlen drohte Schalck, seine »Detailkenntnisse« über die Stasi auszubreiten, etwa zu den »Sonderbeschaffungen« für Stasi-Minister Erich Mielke und Ex-Spionagechef Markus Wolf. Sollte bei ihm eine Hausdurchsuchung stattfinden, »dann würde er auch die Gehaltsbescheide des MfS, die er sorgfältig aufbewahrt habe, vorlegen«.44
Allein schon seine Wohnadresse verriet Schalcks Zugehörigkeit zur Stasi-Elite. In dem Karree um den Ober- und den Orankesee in Alt-Hohenschönhausen lebten fast ausschließlich höhere MfS-Chargen, unter ihnen die Mielke-Stellvertreter Rudi Mittig und Gerhard Neiber sowie Stasi-Generäle wie Willi Damm, Günther Kratsch oder Horst Vogel.45 Schalcks Privathaus, ein weißer Bungalow mit Walmdach, war äußerlich unauffällig. Im Innern barg das Haus, neben allerlei Luxus und wertvollen Kunstgegenständen, eine technische Raffinesse: Um größere Gemälde gelegentlich auswechseln zu können, ließ sich ein Teil der Wände im Erdgeschoss in den tief ausgebauten Kellerbereich absenken.46
Eines Abends kam Schalcks langjähriger Freund Wolfgang Junker, seit 1963 Bauminister der DDR, völlig verzweifelt ins Haus des KoKo-Chefs. Auch Junker war in die öffentliche Kritik geraten. Ihm wurde der Verfall der Bausubstanz in den ostdeutschen Städten angelastet. »Ruinen schaffen ohne Waffen«, höhnten die Menschen. Er werde »als Idiot hingestellt«, klagte er Schalck. Junker versuchte Schalck zu überreden, mit ihm nach Moskau zu fliehen. »Alex, es ist alles aus. Krenz hat keine Macht mehr. Die werden uns alle aufhängen.« Mit einem unauffälligen Wartburg oder Trabant könnten sie sich zur Sowjet-Garnison in Jüterbog, 70 Kilometer südlich von Berlin, durchschlagen; die »Freunde«, wie man in der DDR die Sowjets nannte, würden sie mit einem Flugzeug außer Landes bringen. Schalck zögerte noch, »hielt das in diesem Moment für übertrieben«.47 Doch mehr und mehr geriet auch er in Panik. Sein Hausarzt Heinz Wuschech musste am 30. November mit einer Spritze in die KoKo-Zentrale eilen, weil Schalcks Kreislauf kollabiert war. Zu seiner Frau sagte Schalck: »Es ist alles aus. Ich kann mich nur noch erschießen.« Sicherheitshalber schloss Sigrid Schalck die Dienstpistole ihres Mannes weg.48
Am 1. Dezember erklärte Schalck im Politbüro, wo er über seine Bonner Gespräche Bericht erstatten sollte, unter Tränen, er fühle sich »bedroht« und »von allen fallen gelassen«. Generalsekretär Krenz erlebte Schalck, wie er ihn »bisher nie gesehen« habe: »Bei allen Schwierigkeiten strahlte er stets Optimismus aus. Ihm fiel auch in aussichtslosen Situationen immer eine Lösung ein. Nun sitzt er vor uns, ist verzweifelt und weint.« Krenz versuchte, ihn zu beruhigen, und gab »Weisung, dass er von den Sicherheitskräften bewacht« wird.49 Modrow, erinnerte sich Sitzungsteilnehmer Günter Schabowski, habe stumm dabeigesessen und nur missmutig gemurmelt, man »werde sehen, was sich machen lässt«.50
Während die Lage für Schalck immer bedrohlicher wurde, verhandelte er weiter mit der Bundesregierung über die künftigen Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte einige Tage zuvor ein »Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas« verkündet; über »konföderative Strukturen«, so seine Vision, solle schrittweise die Einheit erreicht werden. Aber statt nach Bonn, wie er seine Umgebung glauben machte, flog Schalck am 2. Dezember mit seiner Frau nach Stuttgart, um den Diakonie-Präsidenten Neukamm aufzusuchen. Über diese karitative Einrichtung hatte seit 1964 die KoKo-Firma Intrac unter anderem den Freikauf politischer Häftlinge abgewickelt. Von Neukamms Büro aus telefonierte Schalck mit Kanzleramtsminister Seiters, um sich mit ihm über das für den 19. Dezember geplante Treffen Modrows und Kohls in Dresden abzustimmen.
Schalck rief auch Schäuble an, der über den Inhalt des Gesprächs Stillschweigen bewahrte. Früher hatte Schalck den Bonner CDU-Politiker schon mal gefragt, ob er mit Hilfe rechnen könne, wenn es für ihn eines Tages in der DDR zu brenzlig würde. Schäuble hatte Schalck geraten, sich der westdeutschen Justiz zu stellen, weil er sich wie jeder Bürger auf rechtsstaatliche Behandlung verlassen könne. Nach dem Stuttgart-Trip kehrte Schalck nach Ostberlin zurück und schrieb, als wäre nichts geschehen, seine Berichte für Honecker, Mittag und Mielke.
Schalck residierte in einem etwa 40 Quadratmeter großen Büro in der ersten Etage eines viergeschossigen Gebäudes an der Ostberliner Wallstraße 17–22. Das Arbeitszimmer war »gediegen, aber nur spärlich möbliert«, wie der Spiegel zu berichten wusste: »großer Schreibtisch, ein Konferenztisch, an der Wand ein Regal mit Fernseher, Radioanlage und Gesetzesbüchern«. Die Angestellten, etwa hundert arbeiteten in der KoKo-Zentrale, nannten das Gebäude die »Schlüsselburg«, weil die Türen zu den einzelnen Stockwerken nur mit Spezialschlüsseln zu öffnen waren.51 Von hier aus wurden die KoKo-Firmen mit ihren rund 3000 Mitarbeitern dirigiert.
Ein Telefonanruf schreckte Schalck am Nachmittag auf. General Schwanitz warnte den KoKo-Chef erneut, dass er sich vor dem Volkskammerausschuss nicht auf seine MfS-Zugehörigkeit berufen und keinerlei Hilfe von den einstigen Kampfgefährten erwarten könne. Schwanitz legte Schalck nahe, sein MfS-Konto zu verheimlichen; die von der Stasi erhaltenen Gelder solle er als »Subventionen« von Franz Josef Strauß deklarieren.52 Schalcks Stasi-Akten und die seiner Frau sowie die Dienstausweise und alle anderen Unterlagen seien vernichtet worden, behauptete Schwanitz. »Genosse Schalck«, sagte er, »wir können nichts mehr für dich tun.« Das Telefonat war letztlich der Auslöser, dass Schalck sich entschloss, seine Fluchtpläne in die Tat umzusetzen.
Zu diesem Zeitpunkt konnte er nicht ahnen, dass sich die Skandalisierung der KoKo an diesem Tag noch steigern würde. Das DDR-Fernsehen berichtete am Abend über die Entdeckung eines geheimen Waffenlagers der KoKo-Firma IMES in Kavelstorf bei Rostock. Die örtliche Bevölkerung war schon lange misstrauisch gewesen, was auf dem mit Stacheldraht umzäunten und von Sicherheitspersonal bewachten Gelände vor sich ging. Anwohner hatten nun gefordert, den Zweck der verdächtigen Anlage offenzulegen. Die IMES-Geschäftsführung hatte einige Dorfbewohner zu einem Gespräch eingeladen. Doch es kamen, durch Mundpropaganda informiert, rund 300 Menschen. Als IMES-Generaldirektor Erhard Wiechert zugab, dass die Firma mit Waffen und Munition in Krisengebiete wie Iran, Afghanistan und Nicaragua handelte, erzwangen die Anwesenden den Zutritt zum Gelände. Beim Anblick der vielen Munitions- und Waffenkisten in den Lagerhallen brach ein Sturm der Entrüstung los. Die Menge war entsetzt, dass sich die Propaganda vom »Friedensstaat DDR« als Lüge entpuppte. Später wurden in den Kisten 24 780 Maschinenpistolen, 1298 Maschinengewehre, 1691 Revolver und Gewehre sowie 198 Karabiner gezählt, außerdem 53 Millionen Patronen Munition.53
Der Dresdner SED-Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer, Modrows Lokalrivale, war überzeugt, dass das Waffenlager an diesem Tag »nicht zufällig entdeckt« wurde: »Das wusste doch jeder von denen da oben. Das hatte Modrow in Gang gesetzt.«54 Berghofers Verdacht, dass die Enttarnung des Waffenlagers vom neuen Ministerpräsidenten arrangiert worden war, um Schalck ins Zwielicht zu rücken, bekam durch zwei weitere Enthüllungen am selben Tag zusätzliche Nahrung.
In Mühlenbeck nördlich von Berlin wurde ein Lager der Ko-Ko-Firma Kunst und Antiquitäten aufgespürt. Gemälde, Schätze aus Porzellan, antike Möbel und seltene Glasarbeiten stapelten sich dort. Mitarbeiter Schalcks hatten, wie sich schnell herumsprach, Kunstsammlern in der DDR wertvolle Gegenstände abgepresst, die sie gegen Devisen im Westen verhökerten. Außerdem wurden Journalisten in die sogenannte »Frischstrecke« der KoKo-Firma Letex in Berlin-Karlshorst geführt: Hier wurden Molkereiprodukte, Fleisch- und Wurstwaren aufbewahrt, die aus Westberlin für die Versorgung der Wandlitzer Politbürokraten eingeführt worden waren.55
Nach dem Telefonat mit Schwanitz räumte Schalck seinen Schreibtisch aus und diktierte seiner Sekretärin Gisela Brachaus einen Brief an Werner Eberlein, den Vorsitzenden der Zentralen Parteikontrollkommission der SED. Tags zuvor, teilte er Eberlein mit, habe er im Politbüro noch das Gefühl gehabt, »dass meine Partei bereit war, mich gegen diesen Rufmord, diese Unwahrheiten, Lügen, Halbwahrheiten und auch Wahrheiten zu verteidigen«. Nun müsse er jedoch feststellen, dass es »dem Genossen Modrow nicht möglich gewesen« sei, den Ausschuss-Vorsitzenden Toeplitz »davon abzuhalten, Befragungen zu meiner Person, speziell zu dem Bau und der Vermietung von Häusern, zu vermeiden«56 – gemeint waren vor allem die teuren Gefälligkeiten für Günter Mittag.
Da ihm für den Fall, dass er die Aussage verweigere oder falsch aussage, strafrechtliche Konsequenzen angedroht worden seien, übermittle er Eberlein die Abrechnung über das Vermögen der unter dem KoKo-Dach tätigen SED-Parteifirmen.57 Die Dokumente ließ er Eberlein am nächsten Tag per Kurier zustellen. Nach seinem Dafürhalten hatte Schalck damit auch in höchster Not alles ordentlich geregelt: »So wie ich gelebt habe, habe ich mich auch korrekt abgemeldet.«58
Hektisch packte Schalck Dutzende von Aktenbündeln zusammen und verstaute sie in mehreren Koffern. Die Dokumente sollten, wie Schalck später erläuterte, »Aufschluss geben über zwei Komplexe«: über seine Gespräche mit Bonner Regierungen seit 1967 und über das Parteivermögen der SED. Er habe, sagte Schalck, »sicherstellen wollen, dass Dokumente aus 25 Jahren Verhandlungsgeschichte nicht im Reißwolf landen« wie so viele andere Papiere in der Umbruchzeit.59 Dann klingelte er bei Rechtsanwalt Wolfgang Vogel an.
Er sei »in Panik«, fühle sein »Leben in der DDR bedroht«, sagte Schalck zu Vogel und bat ihn um anwaltlichen Beistand. Der langjährige DDR-Unterhändler, der gerade im Begriff war, mit seiner Frau zu einem Empfang in der Residenz des Bonner Ständigen Vertreters Franz Bertele in Pankow aufzubrechen, sagte, wo er am Abend zu erreichen sei. Gegen 22 Uhr rief Schalck dort an und bat Vogel dringend, zu ihm in die Wallstraße zu kommen. Als das Ehepaar Vogel eine Stunde später dort eintraf, saß Schalck wie ein Häuflein Elend hinter seinem Schreibtisch, vor sich eine Pistole, und beschwor den Anwalt zitternd und schluchzend: »Wenn du das Mandat nicht übernimmst, erschieße ich mich.« Schalck rechnete jederzeit mit seiner Festnahme. Vogel riet ihm, schnellstens abzuhauen.60 Nachdem das Ehepaar Vogel gegangen war, traf Sigrid Schalcks Bruder, der Chemie-Professor Manfred Gutmann, mit seiner Frau in der »Schlüsselburg« ein. Sie blieben bis gegen Mitternacht.
Zuletzt schrieb Schalck noch von Hand einen Brief an Modrow. Darin täuschte er den Ministerpräsidenten über seine Fluchtabsicht. Er wolle, log er, kurzfristig einen Urlaub antreten. Er fahre »nicht in die BRD, nach Westberlin oder NATO-Staaten« und wolle »Bürger unseres Staates sein und bleiben«. Flehentlich bat er: »Gib mir persönlich die Chance, in geordneten Verhältnissen über fast 40 Jahre im Dienst unseres Staates nachzudenken.« Pathetisch legte er einen Schwur ab, den er bald brach: »Ich verspreche Dir und meinem Staat, dass ich gegenüber niemandem über meine Kenntnisse sprechen werde.« Den Brief, mit der Grußformel »in schweren seelischen Belastungen«, unterzeichnete auch Ehefrau Sigrid.61
Ein Fahrer Schalcks steuerte den dunkelblauen BMW mit Ostberliner Kennzeichen, der sich gegen 0.40 Uhr dem Grenzübergang in der Invalidenstraße näherte. Alexander und Sigrid Schalck saßen im Fond. Sie beobachteten, dass ihnen ein Lada folgte, und vermuteten Späher der Stasi.62 Aber die Häscher hielten die Flüchtenden nicht auf. Der Geheimdienst-Pensionär Markus Wolf berichtete später, Stasi-Leute seien mit ihrem Pkw an Schalck »dran gewesen«, der habe jedoch »diese Gruppe mit seinem schnellen Wagen abgehängt«.63 Als Schalck diese Version hörte, hielt er das für eine »tolle Schote«: Dass die Verfolger ihn nachts auf der knapp fünf Kilometer langen innerstädtischen Strecke aus den Augen verloren haben sollten, habe ihn »schon vom Stuhl gehauen«. Schalck war überzeugt, dass man ihn bewusst hatte ziehen lassen.64
Die Grenze war zwar seit dem 9. November durchlässig, aber noch wurde jede Ausreise von den »Passkontrolleinheiten« der Staatssicherheit überprüft. Am Wachhäuschen musste das Ehepaar seine roten Diplomatenpässe abgeben. Das war Schalck noch nie passiert, er war immer durchgewinkt worden. Der Grenzposten ging ins Abfertigungsgebäude, wo er offenbar mit einem Vorgesetzten telefonierte. Nach bangen Minuten, die ihnen wie eine Ewigkeit vorkamen, erhielten Schalck und seine Frau die Pässe zurück und durften weiterfahren. Dreieinhalb Wochen nach dem Fall der Mauer waren die letzten Republikflüchtigen zum Klassenfeind getürmt.
Vogel war kaum in seinem Haus im brandenburgischen Dorf Schwerin, gut 30 Kilometer südlich von Berlin, angekommen, als Schalck ihm telefonisch mitteilte, er sei jetzt in Berlin-Tegel. Umgehend rief Vogel, mitten in der Nacht, den DDR-Generalstaatsanwalt Günter Wendland an und informierte ihn, dass sich Schalck nach Westberlin abgesetzt habe. Gegen zwei Uhr lieferte Schalcks Fahrer, der ebenfalls in Schwerin wohnte, die Koffer bei Vogel ab. Die Gepäckstücke brachte der Anwalt am nächsten Morgen in seine Kanzlei.65
Egon Krenz wurde gegen drei Uhr aus dem Bett geklingelt. Schwanitz meldete dem Generalsekretär, dass Schalck die DDR verlassen habe. »Auch das noch«, entfuhr es Krenz. Er sei davon ausgegangen, dass sich Schalck »in Wünsdorf bei der Sowjetarmee« befinde, berichtete Krenz später, so sei es jedenfalls »für den Notfall besprochen« worden.66 Modrow wurde danach informiert. Als Krenz morgens ins Gebäude des Zentralkomitees am Werderschen Markt kam, beriet der Regierungschef bereits mit Vertrauten über die Folgen von Schalcks Flucht.
Bevor die ZK-Sitzung am Mittag offiziell eröffnet wurde, informierte Modrow die Anwesenden über die Lage. Tags zuvor sei Schalck, den er nicht mehr als Genossen bezeichnete, »aus Verhandlungen mit der BRD zurückgekommen«. Leider habe er den langjährigen »Verhändler« nicht kurzfristig ersetzen können: »Ich hatte … keine Möglichkeit, dort einfach willkürlich auszusteigen und jemand anders dem Seiters gegenüberzusetzen, wohl wissend, dass ein gewisses Risiko besteht.« In der Nacht habe sich Schalck dann »vom Ausland, man weiß nicht, von wo, bei dem Rechtsanwalt Vogel gemeldet und mitgeteilt, dass er die Republik verlassen hat«. Das Protokoll verzeichnet an dieser Stelle »große Unruhe, Empörung, Zurufe: ›Ach du Scheiß!‹« Modrow kündigte scharfe Konsequenzen gegenüber KoKo an. Bereits in der Vorwoche habe er Außenhandelsminister Beil den Auftrag erteilt, »dass er diesen ganzen Laden auflöst«, und auch die Vizefinanzministerin Herta König sei instruiert, »damit dieser ganze Laden verschwinden kann«.67