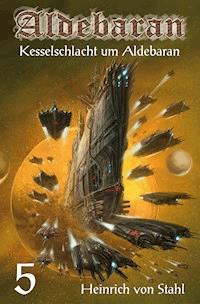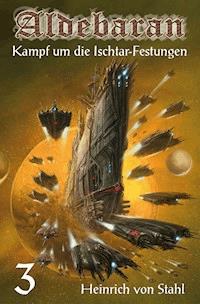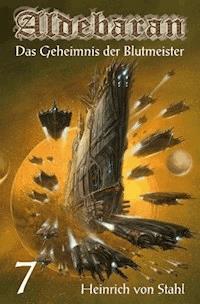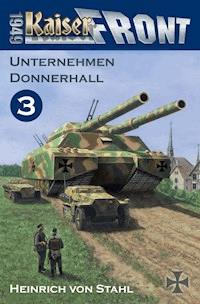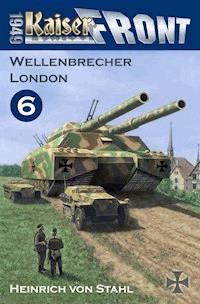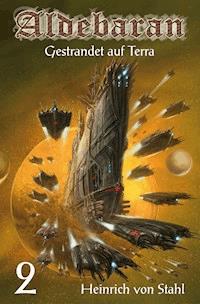9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kaiserfront 1953
- Sprache: Deutsch
Kaiser Friedrich IV. befindet sich in der Gewalt des Xer, dem Oberkommandierenden der vegalischen Streitkräfte im Sol-System. Auf die Frage, wo sich der Hauptstützpunkt der Nordischen Raumflotte befindet, nennt Friedrich die Koordinaten der letzten beiden vom CFR gehaltenen Stützpunkte auf dem Saturnmond Titan. Der Xer bricht mit einer gewaltigen Flotte auf, um das vermeintliche Zentrum der Schwarzen Macht auszuschalten. Der Vizekaiser entsendet ebenfalls einen Teil seiner Flotte zum Titan, um die Finte perfekt zu machen. Dabei riskiert er allerdings einen Angriff der bei Terra verbliebenen vegalischen Flotte auf den nun weitgehend von Raumstreitkräften entblößten Nordischen Bund. Es beginnt eine Phase der Täuschung, Gegentäuschung und der epischen Schlachten. Ein Kommandounternehmen unter General Pio Filippani-Ronconi, ausgestattet mit den neuesten Technologien, macht sich derweil auf, den Kaiser und dessen Frau aus der vegalischen Basis bei Kansas City zu befreien. Sein Vorstoß entscheidet das Schicksal des Kaisers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kaiserfront 1953
Band 3
Das Schicksal des Kaisers
Heinrich von Stahl
Inhalt
Titelseite
Prolog
Kapitel 1: Der Bluff des Kaisers
Kapitel 2: Aufbruch nach Hella
Kapitel 3: Raumschlacht um Titan
Kapitel 4: Entscheidung unter dem Eis
Kapitel 5: Intermezzo über Manhattan
Kapitel 6: In der Höhle des Löwen
Empfehlungen
Heinrich von Stahl: Kaiserfront 1949
Heinrich von Stahl: Kaiserfront 1953
Heinrich von Stahl: Aldebaran
Tom Zola: Stahlzeit
Axel Holten: Viktoria
Norman Spinrad: Der Stählerne Traum
Clayton Husker: T93
Impressum
Prolog
Schwebende, langsam rotierende Berge leuchteten sanft im Licht des fernen Sonnengestirns vor dem schwarzen Hintergrund des Alls. Vorsichtig drang der Kreuzer in den Asteroidenring ein, der die Sonne zwischen der Mars- und Jupiterbahn umgab.
Normalerweise war es völlig ungefährlich, den Asteroidengürtel zu durchqueren. Der Abstand zwischen den einzelnen Weltraumfelsen war viel zu groß, als dass es besonderes Pilotengeschick erfordert hätte, ihnen auszuweichen.
Nicht so in der Nähe des Ziels des Kreuzers: Luma. In der Umgebung des Kleinstplaneten, der immerhin einen Durchmesser von zehn Kilometern hatte, war die Asteroidendichte außergewöhnlich hoch – hoch genug, um den Navigator des Schiffes und die Bordschützen aufs Äußerste zu fordern. Genau aus diesem Grund hatte man Luma als Träger der fortschrittlichsten Forschungsstation des Reiches ausgewählt. Die Vegalier würden wohl niemals auf die Idee kommen, dass man ausgerechnet in diesem unwirtlichen Raumsektor an potenziell kriegsentscheidenden Technologien arbeitete.
Die großen Brocken waren nicht gefährlich, man konnte ihnen leicht ausweichen. Gefahr drohte vielmehr von den Kleinstplaneten, deren Masse groß genug war, um den Kreuzer ernsthaft zu beschädigen, aber doch so klein, dass es eine ungeheure Konzentration erforderte, sie rechtzeitig zu entdecken.
Entsprechend angestrengt starrte Leutnant van den Boom auf seine beiden Bildschirme, die jeweils mit einem Fadenkreuz ausgestattet waren. Der eine stellte die Ergebnisse der Mikrowellenortung, der andere die rein optische Erkennung dar. Auf dem Schaltpult vor den Schirmen befanden sich die Kontrollen zur Steuerung der Geschützkuppel 2-IV, eine Zwillingsflak des Kalibers 2 cm – also genau die passende Waffe, um zu nahe kommende Asteroiden zu pulverisieren.
In weitem Bogen wich der Kreuzer einem einhundert Meter durchmessenden Brocken aus, der trudelnd auf Kurs gelegen hatte. Unmittelbar nachdem der Weltraumfelsen passiert war, erschien ein blinkender Punkt in der unteren rechten Ecke des Schirms für die Mikrowellenortung. Rasend schnell strebte selbiger der Bildschirmmitte zu. Er war zuvor im Ortungsschatten des großen Brockens gewesen, weshalb er erst so spät wahrgenommen wurde.
Mit einem unglaublichen Reflex, in Tausenden von Übungen antrainiert, brachte der Leutnant das Zentrum des Fadenkreuzes zur Deckung mit dem Punkt und drückte den Feuerknopf.
Eintausend Zweizentimetergranaten verließen pro Sekunde jedes der beiden Geschützrohre. Diese hohe Kadenz war nur deshalb möglich, weil Magnetfelder verhinderten, dass die Granaten mit den Läufen in Berührung kamen, die ansonsten durch die Reibungshitze innerhalb eines Sekundenbruchteils geschmolzen wären.
Der Granathagel zerfetzte den drei Meter durchmessenden Asteroiden in sandkorngroße Bruchstücke, die fächerförmig auseinander stoben.
Gott sei Dank haben Asteroiden keine mikrowellenabsorbierende Schicht wie unsere Raumschiffe, sonst kämen wir nie unbeschadet durch dieses Chaos, referierte van den Boom gedanklich.
»Ausgezeichnete Leistung«, hörte der Leutnant aus seinen Helmlautsprechern. An der Stimme erkannte er Major Kleintjes, den Kommandanten des K-77.
»Ist ja noch mal gut gegangen«, gab van den Boom bescheiden zurück.
Nach ein paar weiteren Ausweichmanövern kam Luma in Sicht: ein bizarr geformter Gesteinsbrocken, sieben Kilometer durchmessend an der engsten Stelle, zehn an der breitesten. Man sah ihm nicht an, dass er zu einem Großteil mit Fusionsfräsen ausgehöhlt worden war, um für die Forschungsstation Platz zu schaffen.
»K-77 an Luma Raumkontrolle«, sprach Funkoffizier Meesters in das Mikrophon auf dem Pult vor ihm. »Erbitten Einflugerlaubnis. Authentisierungsschlüssel folgt.«
»Schlüssel akzeptiert«, kam es lakonisch aus den Lautsprechern der Zentrale des Kreuzers. Meesters hatte das Funkgerät auf Freisprechen geschaltet.
Kleintjes, ein seinem Namen Hohn sprechender Zwei-Meter-Hüne, nickte dem Navigator kurz zu.
Daraufhin ließ Jansen den K-77 zwischen zwei schroffen Felskämmen über die Front nach vorne kippen. Es sah aus, als würde das dreihundert Meter lange Rochenschiff kopfüber in die Schlucht stürzen.
Doch am Boden des tiefen Grabens tat sich ein heller Spalt auf, der sich schnell verbreiterte. Jansen verzögerte leicht, um nicht eine der beiden Schleusenhälften zu rammen, die sich für seinen Geschmack zu langsam öffneten. Dann schwebte der K-77 majestätisch in den relativ kleinen Hangar ein, der gerade mal vier Kreuzern Platz bot. Momentan war kein weiteres Schiff anwesend.
Jansen fixierte das Rochenschiff zwei Meter über dem Hangarboden, indem er die Produktion der N-Materie1 exakt auf das Gewicht des Kreuzers im künstlichen Gravitationsfeld der Forschungsstation anpasste.
Nachdem im Hangar wieder ein Luftdruck von einer Atmosphäre herrschte, befahl Kleintjes, die Schleusenrampe auszufahren. Aus einem Seitenschott des achthundert Meter im Quadrat messenden Hangars traten drei Gestalten in weißen Kitteln und näherten sich dem K-77.
Gleichzeitig marschierte eine seltsame Prozession die Schleusenrampe des Kreuzers hinab. Je zwei Männer in weißen Kitteln »trugen« drei Meter lange, fast ebenso breite und dreißig Zentimeter dicke Metallplatten. Auf insgesamt vierzehn dieser Platten lagen je ein humanoider, rot glänzender Gigant, zwei Meter und fünfzig groß, in den Schultern zwei Meter breit. An manchen Stellen wurde das Rot von einem dunklen Grün unterbrochen. Die Köpfe steckten in Metallkugeln, die wie altertümliche Raumhelme wirkten, jedoch ohne Sichtfenster.
Natürlich war jedem Beobachter klar, dass allein die Metallplatten Tonnen wiegen mussten, vom Gewicht der Giganten darauf ganz zu schweigen. Es war also völlig unmöglich, dass je zwei Menschen ein solches Gewicht tragen konnten. Bei den Metallplatten handelte es sich um technisch hochwertige Transportsysteme, die ihr Eigengewicht und das ihrer Last durch Produktion von N-Materie in ihrem Innern ausglichen. Die N-Tische, wie sie innerhalb des Instituts locker genannt wurden, schwebten also und mussten von den beiden »Trägern« nur in die passende Richtung dirigiert werden.
Der Prozession voran ging ein Mann in hellgrauem Anzug, mit blauweiß gestreifter Krawatte und streng zurückgekämmten dunkelblonden Haaren. Kurz bevor er die drei entgegenkommenden Kittelträger erreichte, machte er zwei Schritte zur Seite, um die Kollegen mit den N-Tischen passieren zu lassen.
»Wolfgang! Schön, dich wiederzusehen«, sagte der Schlipsträger und lächelte den mittleren Kittelträger freundlich an.
»Ganz meinerseits, Werner!« Mit Blick auf die monströsen Gestalten auf den N-Tischen fügte Wolfgang Pauli hinzu: »Da haben die Pechschwarzen2 aber eine fette Beute geschossen.«
»Diese Beute wird für uns eine Fundgrube neuer Erkenntnisse sein«, entgegnete Werner Heisenberg. »Wir sollten als Erstes herausbekommen, ob die sogenannten Cytanten einen Gedächtnisspeicher haben. Falls ja, dürften wir dort auf Informationen stoßen, die in den Computern auf den vegalischen Stützpunkten nicht enthalten waren.«
»Ganz besonders interessiert mich, warum dieses seltsame rötliche Metall ihrer Rüstungen nicht von Hochgeschwindigkeitsgeschossen durchdrungen werden kann.«
Heisenberg setzte eine nachdenkliche Miene auf. »Wenn wir die Antwort auf diese Frage nicht in den Gedächtnisspeichern finden, so wird uns sicherlich eine Analyse weiterbringen. Was mich aber noch viel mehr beschäftigt: Hoffentlich erfahren wir etwas über die wahren Herrscher der Vegalier, die sie ›Bran‹ nennen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die nicht mit den Cytanten identisch sind.«
»Woraus schließt du das?«, fragte Pauli, wobei ihm seine Neugierde deutlich anzusehen war.
»Weil wir ein paar von ihnen töten konnten.«
*
Die vierzehn Cytanten wurden in einer zweihundert Meter im Quadrat messenden Halle aufgebahrt. Sie lagen nach wie vor auf den N-Tischen zwischen einer sinnverwirrenden Flut von Schaltschränken, Messgeräten und Rechnersystemen. Die Transportschutz-Metallkugeln wurden nun entfernt.
Heisenberg und Pauli beugten sich über eine der »Leichen«. Wangen, Kinn, Kiefer und Stirn des Außerirdischen bestanden aus jenem rot glänzenden Metall, ebenso die beiden Zangen, die seitlich des Mundes herausragten. Ein Auge war geöffnet. Es hatte eine dunkelblaue Färbung, die Pupille war senkrecht geschlitzt, wie bei einer Katze. Aus dem anderen Auge quoll eine braune Masse – eine Folge des direkten Treffers durch das Hochgeschwindigkeitsgeschoss eines Hohenzollern. Die Teile des Kopfes, die nicht aus dem roten Metall bestanden, wirkten wie eine dunkelgrüne, lederartige Haut.
»Sind das nun biologische Wesen oder Maschinen?«, fragte Pauli.
»Ich denke beides«, entgegnete Heisenberg.
»Wenn das auch auf das Gehirn zutrifft, haben wir wirklich eine gute Chance, an Daten heranzukommen. Vielleicht gibt es ja eine Schnittstelle. Auf Anhieb sehe ich jedenfalls keine Möglichkeit, ein Kabel anzuschließen. Vielleicht auf der Rückseite. Wir sollten ihn umdrehen.«
»Wenn es eine Schnittstelle gibt, so wird diese nicht mechanisch, sondern höchstwahrscheinlich drahtlos sein. Außerdem dürfte der elektronische Teil des Hirns durch den Treffer ähnlich in Mitleidenschaft gezogen worden sein wie der biologische.«
»Sofern sich das Elektronenhirn überhaupt im Kopf befindet. Aber zurück zur Schnittstelle: Drahtlose Verbindungen haben Nachteile in der Datenübertragungsrate und sind niemals vollkommen abhörsicher. Eine drahtgebundene Schnittstelle könnte also durchaus Sinn machen.«
»Du hast Recht, vielleicht haben die Biester tatsächlich einen Stecker. Also gut, drehen wir ihn um.«
Zunächst wurde der Körper des Cytanten mit Klammern fixiert. Anschließend wurde ein zweiter N-Tisch direkt auf dem Toten platziert. Das ganze Gebilde wurde um die Längsachse um einhundertachtzig Grad gedreht, mit dem Effekt, dass der Cytant nun bäuchlings auf dem zweiten Tisch lag. Nachdem man die Klammern entfernt und den ersten N-Tisch weggeschoben hatte, begann die Untersuchung des Rückens.
Sorgfältig suchten die beiden Nobelpreisträger und fünf ihrer Assistenten den vegalischen Elitekrieger nach einer mechanischen Steckverbindung ab. Der Hinterkopf bestand komplett aus Metall, im Halsbereich folgte lederartige grüne Haut, dann zwei mächtige Rückenplatten aus Metall, geteilt durch einen Hautbereich.
Zwanzig Minuten später war klar, dass es auch hier keine Steckverbindung gab, zumindest keine, die auf Anhieb erkennbar war.
»Ultraschall!«, ordnete Pauli lakonisch an.
Kurz darauf rollten vier Assistenten einen Geräteschrank mit Monitor heran. Heisenberg selbst führte den Messkopf über den toten Körper, Pauli beobachtete die Ergebnisse auf dem Bildschirm.
Kurz bevor der metallene Hinterkopf in den Hautbereich des Halses überging, rief Pauli: »Stopp! Noch mal zurück! Da ist was! Ja, genau da!«
Heisenberg bedeutete einem Assistenten, den Messkopf festzuhalten, damit er das Bild auf dem Monitor besser in Augenschein nehmen konnte.
»Siehst du diese feine kreisförmige Struktur? Circa zwei Zentimeter durchmessend… hm, könnte eine Klappe sein, deren Ränder mit bloßem Auge nicht beziehungsweise kaum zu sehen sind.«
Heisenberg begab sich zurück zum Cytanten, ließ den Assistenten den Ultraschallmesskopf entfernen und untersuchte die entsprechende Stelle mit einer gewöhnlichen Lupe. »Tatsächlich, wenn man genau hinsieht, ist hier eine feine Naht. Geben Sie mir noch mal den Messkopf, Becker, vielleicht finden wir etwas über den Öffnungsmechanismus heraus.«
Nach intensivem Probieren erschien tatsächlich schemenhaft die Struktur hinter der Klappe.
»Eine übliche vegalische Glasfaserbuchse«, stellte Pauli fest. »Jetzt müssen wir nur noch die Verschlussklappe aufbekommen.«
Mehrere Assistenten versuchten sich mit unterschiedlichsten Methoden und Werkzeugen, doch der zwei Zentimeter durchmessende Verschluss widerstand allen Bemühungen. Als Hauptproblem stellte sich heraus, dass die Fuge zwischen Klappe und Schädel mikroskopisch klein war. Hauchdünne Metallspachtel, die in die Fuge eindringen konnten, brachen sofort ab, sobald versucht wurde, die Klappe aufzuhebeln.
»Ich habe eine Idee!«, sagte Heisenberg plötzlich.
»Herr im Himmel! Verschone uns mit deinen Ideen!«, entgegnete Pauli, der für seine bissigen Bemerkungen berühmt und berüchtigt war.
Heisenberg ging überhaupt nicht darauf ein und sagte stattdessen: »Wir haben doch eine wenige Atomlagen dicke Graphenschicht elektromagnetisch verstärkt. Warum sollten wir das Plättchen nicht benutzen, um die Klappe aufzubrechen?«
»Könnte funktionieren«, räumte Pauli nachdenklich ein.
Vier Assistenten wurden losgeschickt, das nicht einmal einen Quadratzentimeter große Stück Graphen zu holen. Wenige Minuten später kamen sie mit einem Glaskasten zurück, der auf einem Handwagen ruhte. Mehrere Leitungen führten aus dem Kasten zu einem Schaltschrank auf Rollen, der von zwei weiteren Assistenten geschoben wurde.
Im Glaskasten befand sich ein etwa fünfzig Zentimeter langes schraubenzieherförmiges Gebilde, das über die Leitungen mit dem Schaltschrank verbunden war. Die Spitze des leicht überdimensionierten »Schraubenziehers« leuchtete wie blankes Silber. Heisenberg nahm den Deckel ab und löste die Leitungen, die lediglich die Funktion hatten, Messdaten zu übertragen. Er fasste den »Schraubenzieher« am Griff, in welchem der autarke Generator für das elektromagnetische Wechselfeld untergebracht war, der die Bindungsenergie zwischen den Kohlenstoffatomen des Graphens in der Spitze um den Faktor zehntausend verstärkte. Vorsichtig hob er das Forschungsobjekt aus den Halterungen. Es wog nicht mehr als drei Kilogramm.
»Halte mal die Lupe, Wolfgang, damit ich sehen kann, wo ich den Hebel ansetzen muss.«
Auffordernd blickte Heisenberg Pauli in die Augen. Der tat wie ihm geheißen.
Heisenberg legte eine Hand auf den Hinterkopf des Cytanten und führte das EMS3-Graphenplättchen wie einen Billardqueue zwischen seine Finger hindurch. Dank der von Pauli gehaltenen Lupe sah er die Naht deutlich genug, um das Graphen zu positionieren. Mit nur leichtem Druck drang das Graphen, schärfer als jedes Messer, in das rote Metall ein. Dann kippte Heisenberg den »Schraubenzieher« und die Verschlussklappe fiel ganz unspektakulär mit einem leisen »Plopp« auf den N-Tisch.
Was sie nun freigelegt hatten, war tatsächlich ein herkömmlicher Anschluss für Glasfaserleitungen.
Ein weiterer Schaltschrank wurde herangerollt und dann mit Steckdosen im Doppelboden der Halle verkabelt. Der Schrank enthielt einen Rechner – Bestandteil des Luma-Verbundnetzes, das zusammengenommen eine Rechenleistung hatte, auf die jedes andere Forschungsinstitut im solaren System neidisch gewesen wäre. Ein mitdenkender Assistent brachte sogleich das passende Glasfaserkabel. Sekunden später war der Cytant an den Rechnerverbund angeschlossen.
»Bin mal gespannt, ob wir die sicherlich vorhandene Verschlüsselung knacken«, argwöhnte Pauli.
»Ich hoffe, die Bran gehen davon aus, dass ohnehin niemand unbefugt an die Datenschnittstelle eines Cytanten herankommt, weshalb sie auf höchste kryptologische Sicherheit verzichten«, murmelte Heisenberg.
»Immerhin funktioniert die Stromversorgung des Cytanten-Rechners noch. Wir bekommen bereits Signale rein.«
»Und?«
»Du wirst es nicht glauben: Es ist vegalischer Klartext. Vollkommen unverschlüsselt.« Pauli deutete auf den Monitor des Rechnerschranks, an den der Cytant angeschlossen war. »Wir sind bereits bei der Aufforderung, ein Kennwort einzugeben.«
Mehr als ein Dutzend Professoren und Doktoren aller mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiche hatten die beiden Topwissenschaftler, den Cytanten auf dem N-Tisch und den Rechnerschrank umringt. Mit einem Höchstmaß an Neugier betrachteten sie das Treiben der beiden Physiker.
»Weißt du, wie wir das Kennwort herausbekommen?«, fragte Heisenberg an Pauli gewandt und dann in die Runde: »Oder jemand von Ihnen?«
Ein hagerer Mann mit Seitenscheitel, schmalem Mund und breiten Kieferknochen bahnte sich einen Weg durch die Menge. Er trug einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd. »Ich habe zumindest eine Idee, wie wir das geheime Kennwort umgehen können.«
Sein Name lautete Alan Turing, und er war neben Konrad Zuse wohl der genialste Informatiker des Nordischen Bundes. Vor der Eroberung Englands hatte er in ständiger Angst leben müssen, für seine Homosexualität bestraft zu werden4. Diese dunklen Zeiten waren vorbei. Im Kaiserreich zählte nur, was jemand zum Fortschritt beitrug und nicht, was man abends im Bett trieb – sofern dies im gegenseitigen Einvernehmen der Beteiligten geschah.
»Alan!«, begrüßten Heisenberg und Pauli den Informatiker und begnadeten Kryptologen wie aus einem Munde und schüttelten ihm nacheinander die Hand.
»Ich bin höllisch gespannt, welche Tricks du diesmal auf Lager hast«, fügte Pauli hinzu.
Turing begab sich zum Rechnerschrank und setzte sich auf einen Stuhl, den ihm einer der Professoren eiligst hinschob. Dann drückte er eine Tastenkombination.
Die Kennworteingabeaufforderung verschwand augenblicklich. Stattdessen erschien eine Abfolge vegalischer Zeichen, die den Neustart des Systems dokumentierten.
Der Kryptologe gab eine weitere Tastenkombination ein. Die Zeichenfolgen verschwanden und eine neue Eingabeanforderung erschien. Mit flinken Fingern tippte Turing etwas ein, das als vegalische Schriftzeichen auf dem Monitor erschien, und drückte dann die Eingabetaste. Der Neustartvorgang wurde fortgesetzt.
»So – das neue Kennwort lautet ›Turing‹«, kommentierte Alan sichtlich zufrieden. »Ich habe das System neu gestartet und bei diesem Vorgang eine Hintertüre genutzt, die vegalische Programmierer bei solchen Betriebssystemtypen vorsorglich eingebaut haben – vor dem trivialen Hintergrund, dass einer der ihren immer an das System herankommt, selbst wenn er das Kennwort nicht weiß. Programmierer neigen eben dazu, die Kontrolle niemals aus der Hand zu geben.«
Turing setzte ein breites Grinsen auf.
»Es hat mich vor Wochen einiges Kopfzerbrechen gekostet, die Hintertür bei diesem Hergalax-Betriebssystem zu finden. Umso erfreulicher, dass mir dies erstens gelang und zweitens, dass das System für den Betrieb des elektronischen Teils der Cytanten-Hirne verwendet wurde.«
»Haben wir jetzt vollen Zugang auf die elektronischen Datenspeicher?«, hakte Heisenberg ungläubig nach.
»Uneingeschränkt«, bestätigte Turing mit einem gewissen Forscherstolz.
»Bitte versuche herauszufinden, was der Cytant über seinen eigenen Aufbau weiß«, sagte Pauli.
Turing wechselte mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von einem Verzeichnis zum nächsten. Trotzdem dauerte es fast fünf Minuten, in denen die Umstehenden in fast atemloser Stille verweilten, bis er fündig wurde.
»Hier ist es: Waffensysteme, Sinnesorgane, Verteidigungssysteme…«
»Schau bitte unter ›Verteidigungssysteme‹ nach, ob du etwas über das rote Metall findest«, sagte Pauli.
»Moment – hier ist was. Es handelt sich um eine Legierung, die ›Tselato-Metall‹ genannt wird. Jenes Metall besteht im Wesentlichen aus Aluminium, in das ein regelmäßiges Gitter eines bestimmten Minerals eingebaut wurde. Sobald es mechanisch belastet wird, zum Beispiel durch das Auftreffen eines Hochgeschwindigkeitsgeschosses, wandelt es die kinetische Energie des Geschosses in Schwingungen um, die sich über den ganzen Metallkörper verteilen und so die Energie des Geschosses wirkungslos machen.«
»Existieren nähere Informationen über das Mineral?«, wollte Heisenberg wissen.
»Ja.« Turing nannte die Strukturformel bestehend aus Mangan, Iridium, Kobalt, Phosphor und Sauerstoff. Er fügte hinzu: »Die Vegalier sind bis heute nicht in der Lage, dieses Mineral zu synthetisieren. Es kommt bei ihnen nur auf einem der Monde des achten Planeten vor, und zwar in sehr geringen Mengen. Deshalb ist die Herstellung des Tselato-Metalls extrem teuer. Für ein Kilogramm bekommt man schon ein kleines Raumschiff – so der Erinnerungsspeicher des Cytanten.«
»Und wie sieht das regelmäßige Gitter aus, das in das Aluminium eingebracht wird? Wie funktioniert der Herstellungsprozess?« Diesmal war es Heisenberg, der die Fragen stellte.
Nach zehn Minuten Suche war sich Turing völlig sicher: »Darüber weiß der Cytant – absolut nichts.«
»Tja, dann müssen wir uns eben unsere eigenen Gedanken machen; treiben wir also ein wenig Festkörperphysik«, bemerkte Pauli mit seinem typischen unerschütterlichen Selbstbewusstsein – zumindest was Physik anbelangte.
»Hier ist noch etwas anderes«, sagte Turing. »Die Biester verfügen über ein auf Ultraschall basierendes Ortungssystem. Damit können sie beispielsweise die dreidimensionale Struktur eines Gebäudes, vor dem sie stehen, wahrnehmen – inklusive der darin befindlichen Personen. Das System hat allerdings eine Schwachstelle: Es hat eine Trägheit von etwa zehn Sekunden. Nur was sich nicht relevant in diesem Zeitraum bewegt, kann wahrgenommen werden, ansonsten verschwimmt das ›Bild‹. Das ist eine wichtige Information für die kämpfende Truppe. Wenn Cytanten in der Nähe sind, sollten unsere Kämpfer immer in Bewegung bleiben.«
»Ich werde es unverzüglich weitergeben«, versprach Heisenberg.
1Materie mit negativer Energiedichte. Wirkt auf herkömmliche Materie abstoßend.
2Gemeint sind die »Hohenzollern«, die innerhalb der Kastrup eine Elite bilden.
3Elektromagnetische Stabilisierung.
4In unserer Parallelwelt wurde Alan Turing 1952 in England zu einer Haftstrafe wegen Homosexualität verurteilt und vor die Wahl gestellt, die Haftstrafe gegen eine Therapie einzutauschen. Er wählte Letzteres und erhielt Östrogengaben, die seinen Körper entstellten, was ihn 1954 in den Selbstmord trieb (vereinfachende Kurzfassung).
Kapitel 1:Der Bluff des Kaisers
Friedrich war mit seiner Strategie zufrieden – auch wenn sie an seinem baldigen Tod wohl nicht mehr viel ändern würde, außer dass er schmerzlos sein sollte, sofern der Xer sein Wort hielt.
Der in Gefangenschaft geratene Kaiser hatte dem Oberkommandierenden der vegalischen Streitkräfte im Sol-System den Bären aufgebunden, der Nordische Bund verfüge über eine Quelle kohärenter Neutrinos, mit deren Hilfe man heiße Kernwaffen zur Detonation bringen konnte. Diese Lüge sollte verhindern, dass die Vegalier auf die Idee kamen, heiße Kernwaffen gegen den Nordischen Bund einzusetzen – was fatale Konsequenzen gehabt hätte.
Außerdem hatte Friedrich behauptet, der Hauptstützpunkt der Schwarzen Flotte befände sich auf dem Saturnmond Titan. In Wirklichkeit handelte es sich um die letzen beiden Refugien, die dem alten Gegenspieler der Kastrup, dem CFR1, verblieben waren. Der Kaiser wollte, dass sich die Vegalier an den außerordentlich starken Festungsanlagen von Titan Werk II blutige Nasen holten, und er hoffte des Weiteren, dass der alte Feind des Reiches, Edward Mandell House2, ebenfalls entsprechenden Schaden davontragen, vielleicht sogar ausgelöscht werden würde.
Xer-11 hatte dem Kaiser und seiner Frau einen schnellen schmerzlosen Tod für Antworten auf die Fragen nach den neuesten technischen Entwicklungen und dem Standort des Hauptflottenstützpunkts versprochen.
Der zwei Meter und fünfzig große, zwei Meter in den Schultern breite und mindestens eine Tonne schwere Cytant stand direkt vor dem im Vergleich zerbrechlich wirkenden Kaiser. Erwartungsvoll blickte der Monarch nach oben zum Kopf des halborganischen Monstrums mit dem zangenbewehrten Maul. Die Bereiche aus rotem Tselato-Metall glänzten im Licht des Kontrollzentrums der vegalischen Festung – die durch den Angriff der Schwarzen Legion stark in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die lederartige, dunkelgrüne Haut zwischen den Metallflächen wirkte eher runzelig und matt.
Der Xer beugte seinen Kopf und starrte den Kaiser aus seinen dunkelblauen, senkrecht geschlitzten Augen finster an. Die meisten Menschen wären in Panik davongerannt – nicht so der Herrscher über den Nordischen Bund. Er wusste, dass Flucht sinnlos war und dass das Höchste, was er an Gnade erwarten durfte, der versprochene schmerzlose Tod war.
Untermalt von einem Rasseln, wie von den Ketten eines Panzers, ertönte die tiefe Bassstimme des Oberkommandierenden: »Ich werde dich nicht töten – noch nicht. Zuerst will ich prüfen, ob deine Angaben der Wahrheit entsprechen.«
Friedrich war sich nicht sicher, ob er über diese Ankündigung erleichtert sein sollte. Sie verschaffte ihm zwar eine Schonfrist, aber sobald der Xer dahinterkam, dass der Kaiser ihn belogen hatte, würde es wohl nichts mehr werden mit dem schmerzlosen Abtreten aus dieser Welt.
»Äußerst großzügig!«, entgegnete er ironisch mit einem Lächeln, um die kreatürliche Todesangst zu überspielen, die wohl jeden geistig gesunden Menschen in einer solchen Situation heimgesucht hätte. Er wusste allerdings nicht, ob der Halborganische ein Lächeln zu deuten wusste.
Der Xer gab über eine Funkschnittstelle einen Befehl, der dem Kaiser natürlich verborgen blieb. Zwei Cytanten traten heran und führten Friedrich und dessen Gemahlin Charlotte mit eisernem Griff an den Oberarmen aus dem Kontrollzentrum.
Über mehrere Gänge und Abzweigungen, vorbei an fremdartigen Skulpturen und seltsamen Ornamenten, gelangten sie in einen kleinen, schmuckvoll eingerichteten Dom mit goldenen Fresken an den Wänden und bunten Teppichen auf dem Boden, in die der Kaiser bis zu den Knöcheln versank. In der Mitte des Doms standen ein halbes Dutzend fünf Meter hohe und zehn Meter durchmessende goldene Rundkäfige. Einer davon wurde geöffnet, dann stießen die Cytanten das Kaiserpaar hinein.
Wortlos wandten sich die Riesen ab und verließen den halbkugelförmigen Raum, der nach Meinung Friedrichs wohl so etwas wie eine Trophäensammlung des Xers werden sollte.
Charlotte drückte sich zitternd an ihren Mann. »Wie soll es nur weitergehen?«
»Man wird uns befreien«, sagte Friedrich mit viel Überzeugung in der Stimme, jedoch mit wenig Zuversicht in seinen Gedanken.
*
Der Xer schätzte die Wahrscheinlichkeit, dass der Kaiser gelogen hatte, mit weniger als zwanzig Prozent ein. Grundlage seiner Berechnung waren die Daten, die von Spezialrobotern aus der Stadtbibliothek von Kansas City extrahiert worden waren. Daraus ging eindeutig hervor, dass die diesen Planeten beherrschenden Tiere einen äußerst hohen Wert auf ihre Paarbindungen legten, dass speziell die Männchen unter Einsatz ihres Lebens ihre Weibchen verteidigen würden. Daraus schloss der Xer, der Kaiser würde seine Frau nur mit geringer Wahrscheinlichkeit dem Risiko eines grausamen, schmerzvollen Todes aussetzen.
Auf Basis dieser Überlegungen stand somit sein nächster Schritt fest: ein Großangriff auf den Hauptflottenstützpunkt der schwarzuniformierten Tiere, dessen geodätische Koordinaten auf dem Saturnmond Titan ihm nun bekannt waren.
Im Vorfeld wollte sich der Xer einen Überblick über die immer noch nicht ganz geklärten Kräfteverhältnisse verschaffen. Es könnte sich nämlich als großer Fehler erweisen, eine Flotte mit zu vielen Schiffen, speziell Trägern, Richtung Titan loszuschicken – sprich: die Basis auf Planet 7-33 zu entblößen. Er musste sicherstellen, dass der zurückbleibende Teil seiner Flotte stark genug war, einen möglichen Angriff der Tiere abzuwehren.
Die erste Invasionswelle – eine zweite würde in einem knappen halben Jahr folgen, sobald das RZSF wieder mit N-Materie aufgeladen worden war – verfügte über fünf Schlachtträger und einhundertzwanzig Kreuzer, von denen allerdings bereits siebenundzwanzig den gegnerischen Angriffen zum Opfer gefallen waren.
Die wesentliche Frage, die sich nun stellte, war: Über wie viele Schlachtträger verfügten die Schwarzen? Sie besaßen zumindest einen, denn damit hatten sie den Angriff auf die Basis gestartet, während ihre Kreuzer den Großteil der vegalischen Flotte weggelockt hatten. War das ihr einziger? Oder standen dem Gegner noch weitere dieser gigantischen Kampfschiffe zur Verfügung? Mehr als fünf konnten es eigentlich nicht sein, denn dann hätten die Tiere sicherlich längst ihrerseits einen Großangriff auf die Invasoren gestartet.
Der Xer entschloss sich, sämtliche Informationen, die zur Beantwortung dieser Frage beitragen konnten, in einer Videokonferenz mit den Kommandierenden der verschiedenen Flottenteile zusammenzutragen.
All diese Kommandanten waren ausnahmslos Rho. Sie waren gezüchtet worden, um Raumschiffsverbände zu befehligen. Körperlich waren sie so schwach, dass sie nur in Schwerelosigkeit existieren konnten. Unter normalen Schwerkraftbedingungen wären sie nicht einmal in der Lage gewesen, mit ihren dünnen Extremitäten ihr eigenes Körpergewicht zu tragen. Rho wurden im Weltraum geboren und starben auch dort. In der Nähe von Gravitationsquellen wie Planeten oder beim Gefechtseinsatz, bei dem extreme Andruckkräfte auftreten konnten, begaben sie sich in Behälter mit einer speziellen Nährflüssigkeit. Letztere hatte das gleiche spezifische Gewicht wie der Körper des Rho, weshalb jegliche Gravitations- und Andruckkräfte perfekt kompensiert wurden.
Ihre geistige Reaktionsschnelligkeit und ihre Fähigkeit, eine Unmenge an Informationen gleichzeitig zu verarbeiten, waren phänomenal – genau auf diese Eigenschaften hin waren sie schließlich gezüchtet worden. Defizite wiesen sie jedoch darin auf, Entscheidungen unter Kampfbedingungen zu treffen. Feystant, der bis dahin Oberkommandierende der Invasionsflotte, war völlig überfordert gewesen, als unmittelbar nach dem Durchgang der Kampfverbände durch das RZSF die Tiere angegriffen und seinen Schiffen empfindliche Verluste zugefügt hatten. Der Rho hatte sich in seiner Verzweiflung sofort an die heiligen Bran gewandt, die nicht gezögert hatten, ihn, Xer-11, zur Klärung der Situation nach 7-3 zu entsenden.
Da war er nun – doch auch er hatte bislang keinen entscheidenden Schlag gegen die Tiere führen können.
Die vegalischen Bodentruppen hatten jene Stadt erobert, die von den Tieren »Kansas City« genannt wurde. Jetzt befanden sie sich auf dem Vormarsch auf die umliegenden Ortschaften und Städte. Die Flotte sicherte derweil den Luftraum über den Aufmarschgebieten. Wie viel davon konnte er für den Angriff auf Titan abzweigen?
Xer-11 machte es sich auf einem überdimensionierten roten Sessel aus lederartigem Material in der Mitte des Kontrollzentrums der vegalischen Basis bequem. Die vierundsechzig Bildschirme um ihn herum zeigten das weitgehend ungestörte Vordringen der Bodentruppen und die Formationen der darüber wachenden Flotte. Letztere war in fünf Verbände à achtzehn Kreuzer aufgeteilt worden, die je einem Schlachtträger zugeordnet waren.
Er gab den Gedankenbefehl, fünf der Bildschirme auf die Verbindung zu den Kommandanten der Verbände zu schalten. Sein Befehl wurde von der Funkschnittstelle des elektronischen Teils seines Gehirns an das Rechnernetz der Basis weitergegeben und prompt ausgeführt.
Die Köpfe der Rho erinnerten an graugrün eingefärbten Blumenkohl. Lediglich die vier hellgrünen, senkrecht geschlitzten Augen, die den Wesen eine Rundumsicht ermöglichten, störten den Vergleich mit jenem Gemüse. Münder oder Nasen fehlten. Die Rho nahmen ihre Nahrung über die Wurzelenden ihrer dünnen Extremitäten auf und sonderten darüber Duftstoffe ab, durch die sie kommunizierten.
»Welche Informationen haben wir über die Anzahl der feindlichen Schlachtträger?«, begann der Xer die Videokonferenz gleich mit dem wichtigsten Punkt.
Nach einigen Sekunden, in denen keiner der Rho es wagte, das Wort zu ergreifen, überwandt Feystant, der ehemalige Oberbefehlshaber der Raumflotte, seine Angst vor dem Cytanten.
»Der Angriff der Tiere auf unsere Basis, während unseres Schlages gegen Berlin, erfolgte mit fünfhundert Raumfalken, die von einem Träger nahe der Küste gestartet worden waren. Die Flotte der Tiere, die unsere eigene von der Basis weglockte, verfügte ebenfalls über einen Schlachtträger. Folglich muss die Mindestanzahl bei zwei liegen.«
»Gibt es Informationen, die auf die Existenz weiterer Träger hinweisen?«, hakte Xer-11 nach.
»Unsere Aufklärungsflüge, speziell im Raum über dem Nordischen Bund, haben keine derartigen Hinweise ergeben«, antwortete Feystant, der sich trotz seiner Degradierung, die ihm ganz und gar nicht ungelegen gekommen war, immer noch als Sprecher der Rho verstand.
»Unter diesen Umständen«, entschied der Xer, »werden mich die Trägergruppen zwei und drei zum sechsten Planeten dieses Systems begleiten. Primärziel ist die Eroberung der beiden gegnerischen Stützpunkte auf Titan. Sollte dieses Ziel nicht erreichbar sein, lautet das Sekundärziel: vollständige Vernichtung.
Du, Feystant, wirst die Trägergruppen eins, vier und fünf befehligen. Deine Aufgabe ist der Schutz des Vormarsches unserer Bodentruppen – nichts weiter. Lass dich keinesfalls provozieren, Verbände zur Verfolgung eines möglicherweise angreifenden Gegners abzustellen. Wenn du angegriffen wirst, verteidige dich, setzte aber auf keinen Fall sich zurückziehenden Feindeinheiten nach.«
»Verstanden, unfehlbarer Schützer der Bran«, entgegnete Feystant unterwürfig.
»Die Bran bedürfen keines Schutzes«, entgegnete der Xer ärgerlich. »Wir Cytanten haben lediglich den Existenzzweck, dass sich die Bran nicht um jede Kleinigkeit selbst kümmern müssen.
Gilatat und Kaytant, macht eure Verbände bereit zum Aufbruch, Kurs Saturn. Startet unverzüglich. Ich folge mit meinem Esodor und werde euch schon bald eingeholt haben.«
Anschließend ernannte der Xer einen stellvertretenden Kommandanten der Xerate. Sie sollten in der Basis verweilen, um einen möglichen Angriff feindlicher Raumlandetruppen abzuwehren. Er selbst würde nur fünf Cytanten auf seiner Reise zum Saturn mitnehmen. Zurückbleiben würden also vierundvierzig (vierzehn waren im Kampf um den Kaiserpalast in Berlin gefallen) Angehörige der Leibgarde der Bran – genug, um eine ganze Armee zurückzuschlagen.
Zwei Schlachtträger und sechsunddreißig Zerstörer scherten aus der vegalischen Flotte aus, die den Luftraum über Kansas City und der weiträumigen Umgebung der Stadt sicherte. Die Ionentriebwerke wurden gezündet. Die Dutzende Meter durchmessenden und kilometerweit in den Raum strahlenden Plasmaströme der gigantischen Triebwerke der Schlachtträger waren selbst am hellen Tage von der Erdoberfläche aus zu sehen.
Eine Flotte, deren Kampfkraft mit der der gesamten Nordischen Flotte vergleichbar war, brach auf zum Titan. Zusammen mit dem bald zu den Schiffen stoßenden Esodor war sie praktisch unbesiegbar.
Durch geschicktes Taktieren hatte der Kaiser dafür gesorgt, dass diese ungeheure Macht unweigerlich auf den CFR, den alten Erzfeind, treffen würde. Sobald der Xer von der Täuschung erfuhr, würden Friedrich und seine Frau einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Und dass der Xer die Finte als solche erkannte, war unumgänglich, denn die erwartet hohe Flottenkonzentration beim angeblichen Hauptstützpunkt der Schwarzen Legion auf Titan würde er nicht vorfinden.
*
Gelangweilt schaute Leutnant Hendriks auf die beiden Monitore für die Mikrowellenortung und die optische Erfassung. Sie waren Teil einer der größten jemals von Menschenhand gebauten Ortungsanlagen. Das dazugehörige gigantische Teleskop sowie die Mikrowellensende- und Empfangsanlage befanden sich auf dem Rücken eines Kratergebirges am lunaren Südpol. Im Fall der Annäherung feindlicher Schiffe konnten die riesigen Systeme im Boden versenkt und so für den Feind unauffindbar gemacht werden.