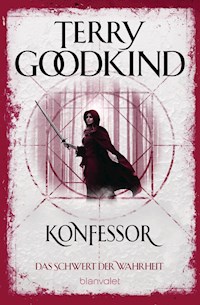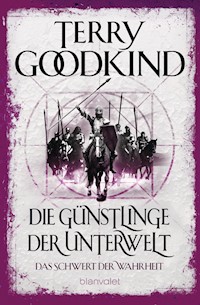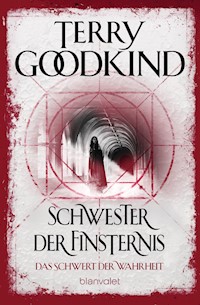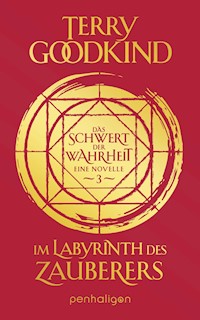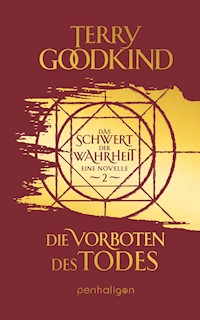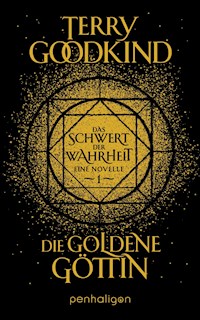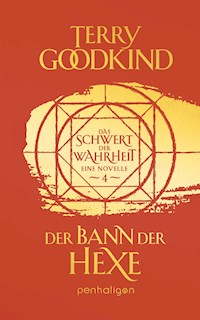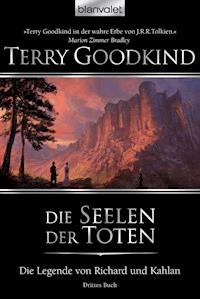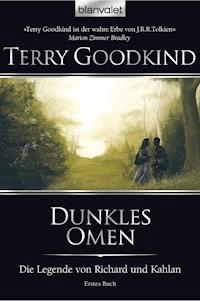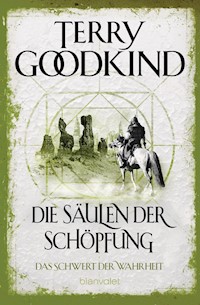
9,99 €
9,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwert der Wahrheit
- Sprache: Deutsch
Das magische Epos um das Heldenpaar Richard und Kahlan
Grausame innere Stimmen flüstern der jungen Jennsen ein, dass sie allein das Böse aufhalten kann. Doch dafür muss sie Richard Rahl – den Herrscher D‘Haras – und dessen geliebte Gemahlin Kahlan töten.
Ein Meisterwerk der modernen Fantasy!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1021
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,6 (38 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Copyright
Das Schwert der Wahrheit bei Blanvalet in der ungesplitteten, dem Original entsprechenden Taschenbuchausgabe:
Erstes Buch: Das erste Gesetz der Magie (36967) Zweites Buch: Die Schwestern des Lichts (36968) Drittes Buch: Die Günstlinge der Unterwelt (36969) Viertes Buch: Der Tempel der vier Winde (37104) Fünftes Buch: Die Seele des Feuers (37105) Sechstes Buch: Schwester der Finsternis (37106) Siebtes Buch: Die Säulen der Schöpfung (37288)
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Pillars of Creation« bei Tor Books, New York.
Gewidmet den im US-Nachrichtendienst tätigen Menschen und ihrem jahrzehntelangen heldenhaften Kampf für den Erhalt von Leben und Freiheit, bei dem sie oftmals Spott, Verachtung und Dämonisierung ausgesetzt und ihnen durch die Handlanger des Bösen die Hände gebunden sind.
»Das Böse verzaubert uns nicht etwa, indem es die schreckliche Wahrheit seiner zerstörerischen Absichten offen legt, es zeigt sich vielmehr in das zarte Gewand der Tugend gehüllt, süß klingende Lügen flüsternd, die uns in die dunkle Ruhestätte unseres ewigen Grabes locken sollen.«
- aus Koloblicins Tagebuch
1
Als sie die Taschen des Toten durchwühlte, stieß Jennsen Daggett auf einen Gegenstand, den sie dort am allerwenigsten zu finden erwartet hätte. Verdutzt ließ sie sich auf die Fersen zurücksinken. Der schneidende Wind zerzauste ihr Haar, als sie mit großen Augen auf die in pedantischen Blockbuchstaben auf das kleine Rechteck aus Papier geschriebenen Worte starrte. Der Zettel war zweimal in der Mitte gefaltet, sorgfältig, so dass die Ränder präzise aufeinander lagen. Sie kniff die Augen zusammen, halb in der Erwartung, die Worte würden verschwinden wie ein böses Trugbild. Den Gefallen taten sie ihr allerdings nicht, sondern sie blieben überaus real.
Die Albernheit des Gedankens war ihr durchaus bewusst, trotzdem kam es ihr so vor, als lauerte der Tote geradezu auf eine Reaktion von ihr. Sie ließ sich zumindest äußerlich nichts Derartiges anmerken und riskierte einen verstohlenen Blick auf seine Augen, die stumpf und glasig waren. Jennsen hatte Leute erzählen hören, dass Verstorbene oft so aussähen, als ob sie nur schliefen. Dieser nicht. Seine Augen sahen tot aus. Die bleichen Lippen waren gespannt, das Gesicht wächsern. Sein Stiernacken war violett gerötet.
Natürlich beobachtete er sie nicht; er beobachtete überhaupt nichts mehr. Aber sein leicht zur Seite hin verdrehter Kopf war ihr zugewandt, und es schien fast so, als schaute er sie an. Diese Vorstellung kam ihr keineswegs abwegig vor.
Weiter oben, auf dem steinigen Hügel in ihrem Rücken, schlugen die kahlen Äste im Wind aneinander wie klappernde Gebeine. Das flatternde Stück Papier in ihren Fingern schien in das Geräusch einzustimmen, und ihr Herz, das ohnehin schon raste, begann noch lauter zu klopfen.
Jennsen hielt sich einiges auf ihren gesunden Menschenverstand zugute; sie war sich deshalb darüber im Klaren, dass sie gerade ihre Fantasie mit sich durchgehen ließ, aber sie hatte doch noch nie einen Toten gesehen, einen Menschen, der so unnatürlich still dalag. Der Anblick hatte etwas Erschreckendes; sie schluckte und versuchte auf diese Weise wenn schon nicht ihre Nerven, so doch wenigstens ihre Atmung zu beruhigen.
Auch wenn er tot war, wollte Jennsen nicht, dass er sie anschaute. Deshalb erhob sie sich, raffte den Saum ihres langen Rocks und ging um den Körper herum. Sie faltete den kleinen Zettel sorgfältig zweimal, so wie sie ihn gefunden hatte, und ließ ihn in ihre Tasche gleiten. Darum würde sie sich später kümmern müssen. Jennsen wusste nur zu gut, wie ihre Mutter auf die beiden Worte auf dem Zettel reagieren würde. Dann hockte sie sich auf der anderen Seite des Mannes nieder.
Man hätte fast meinen können, er schaute hoch zu dem Pfad, von dem er heruntergestürzt war, und fragte sich, was wohl passiert sein mochte und wie es kam, dass er jetzt mit gebrochenem Genick auf dem Grund der steilen, felsigen Schlucht lag.
Sein Umhang hatte keine Taschen. An seinem Gürtel waren zwei Beutel befestigt. Einer davon enthielt Öl, ein paar Schleifsteine sowie einen Abzieher, der andere war mit Trockenfleisch gefüllt; ein Name stand auf keinem der beiden.
Wäre er klüger gewesen, so wie sie, hätte er den Umweg am Fuß der Klippen entlang gewählt, statt dem Pfad über die Kuppe zu folgen, den schwarz vereiste Flächen um diese Jahreszeit tückisch machten. Selbst wenn er nicht vorgehabt hatte, wieder denselben Weg zurückzugehen, den er gekommen war, wäre es klüger gewesen, sich einen Weg durch den Wald zu suchen, trotz des dichten Dornengestrüpps, das dort oben das Vorwärtskommen zwischen den abgestorbenen Ästen und Bäumen erschwerte.
Passiert war passiert. Falls sie etwas fand, das ihr seine Identität verriet, konnte sie vielleicht seine Angehörigen ausfindig machen oder sonst jemanden, der ihn kannte; sie würden doch bestimmt benachrichtigt werden wollen. Sie klammerte sich an die Sicherheit, die ihr dieser Vorwand lieferte.
Beinahe gegen ihren Willen kam Jennsen wieder auf die Frage zurück, was er hier draußen wohl gewollt haben mochte; leider schien das sorgsam gefaltete Stück Papier ihr dies nur allzu deutlich zu sagen. Trotzdem, möglicherweise gab es noch einen anderen Grund.
Wenn sie ihn nur finden könnte.
Um seine andere Tasche zu durchsuchen, musste sie seinen Arm ein Stück zur Seite schieben.
»Gütige Seelen, verzeiht mir«, murmelte sie leise, als sie den steifen Arm anfasste, der sich nur mit Mühe bewegen ließ. Jennsen rümpfte angeekelt die Nase. Er war so kalt wie der Erdboden, auf dem er lag, so kalt wie die vereinzelten Regentropfen, die vom eisengrauen Himmel fielen. In dieser Jahreszeit trieb der steife Westwind sie fast immer als Schnee vor sich her. Der ungewöhnliche, immer wieder aufkommende Nebel und der Nieselregen hatten die vereisten Stellen auf dem Pfad über die Kuppe zweifellos noch rutschiger gemacht; der Tote war der beste Beweis dafür.
Sie wusste, wenn sie hier noch länger verweilte, würde der aufziehende Winterregen sie im Freien überraschen. Ihr war durchaus bewusst, dass das lebensgefährlich sein konnte. Zum Glück war Jennsen nicht allzu weit von ihrem Zuhause entfernt. Aber wenn sie nicht bald nach Hause käme, würde sich ihre Mutter - aus lauter Sorge, was sie so lange aufhielt - vermutlich auf den Weg machen und nach ihr suchen; und Jennsen wollte nicht, dass sie ebenfalls bis auf die Knochen nass wurde.
Ihre Mutter wartete bestimmt schon auf die Fische, die Jennsen von den mit Ködern versehenen Angelschnüren im See mitgebracht hatte; ausnahmsweise hatten ihnen die in den Eislöchern ausgelegten Schnüre einen guten Fang beschert. Die toten Fische lagen drüben auf der anderen Seite der Leiche, wo sie sie hatte fallen lassen, als sie ihre schaurige Entdeckung machte. Auf dem Hinweg zum See hatte er noch nicht hier gelegen, sonst hätte sie ihn sicherlich bemerkt.
Jennsen holte tief Luft, um ihren Entschluss zu festigen, und zwang sich, ihre Durchsuchung fortzusetzen. Sie stellte sich eine besorgte Ehefrau vor, die sich fragte, ob ihr großer, gut aussehender Soldat wohl in Sicherheit, im Warmen und Trockenen wäre. Und die nicht ahnte, wie es in Wahrheit um ihn stand.
Wäre sie abgestürzt und hätte sich den Hals gebrochen, würde Jennsen wollen, dass jemand ihre Mutter benachrichtigte. Ihre Mutter hätte also sicherlich Verständnis dafür, wenn sie sich etwas verspätete, um herauszufinden, wer dieser Mann war. Jennsen verwarf den Gedanken wieder. Verständnis hätte sie vielleicht, trotzdem würde sie nicht wollen, dass Jennsen sich in der Nähe dieses Soldaten herumtrieb, auch wenn er tot war und somit niemandem mehr etwas tun konnte, schon gar nicht ihr und ihrer Mutter.
Die Besorgnis ihrer Mutter würde noch wachsen, sobald Jennsen ihr gezeigt hatte, was auf dem kleinen Stück Papier stand.
Was sie wirklich zu dieser Durchsuchung trieb - das spürte Jennsen -, war die Hoffnung, dass es noch eine andere Erklärung gab. Sie wollte unbedingt, es wäre etwas anderes. Nur dieser verzweifelte Wunsch ließ sie ausharren, obwohl sie am liebsten umgehend nach Hause gerannt wäre.
Wenn sie keine plausible Erklärung für sein Hiersein fand, mochte es das Beste sein, ihn hier zu verstecken und darauf zu hoffen, dass er nie gefunden wurde. Auch wenn sie deswegen draußen im Regen ausharren musste, sollte sie auf keinen Fall noch länger zögern und ihn so schnell wie möglich verscharren. Dann würde nie jemand erfahren, wo er lag.
Sie zwang sich, ihre Hand bis ganz nach unten in seine Hosentasche zu schieben, und hastig sammelte sie mit den Fingern das Sammelsurium kleiner Gegenstände zusammen. Es war grauenhaft für sie, dabei auch das kalte, tote Fleisch zu spüren. Schließlich zog sie den gesamten Tascheninhalt in ihrer geschlossenen Hand heraus. In der aufkommenden Dunkelheit beugte sie sich darüber und öffnete die Finger, um einen Blick darauf zu werfen.
Ganz zuoberst lagen ein Feuerstein, einige beinerne Knöpfe, ein kleines Bündel Zwirn sowie ein gefaltetes Taschentuch. Sie schob Zwirn und Taschentuch mit einem Finger zur Seite und legte eine nicht unbeträchtliche Anhäufung von Münzen frei - Silber und Gold. Der Anblick dieses Schatzes ließ sie einen leisen Pfiff ausstoßen. In ihren Augen waren Soldaten alles andere als reich, dieser Mann jedoch besaß fünf Goldtaler sowie eine größere Menge Silbermünzen: für nahezu jeden ein Riesenvermögen. Die Anzahl der Silberpfennige - Silber, und nicht etwa Kupfer - schien im Vergleich dazu beinahe unbedeutend, obwohl sie allein wahrscheinlich einen größeren Betrag darstellten, als sie in all den zwanzig Jahren ihres Lebens ausgegeben hatte.
Einen Talisman von einer Frau, der ihre Besorgnis, welche Art Mann er gewesen sein mochte, hätte mildern können, fand sie entgegen ihrer Hoffnung nicht; bedauerlicherweise verriet ihr überhaupt nichts in seinen Taschen etwas über seine Identität. Sie rümpfte unwillkürlich die Nase, als sie daranging, ihm seine Habe in die Tasche zurückzustopfen. Einige Silberpfennige fielen ihr dabei aus der geschlossenen Hand, doch sie sammelte sie ausnahmslos vom feuchten, hart gefrorenen Boden auf und zwängte ihre Hand abermals in seine Tasche, um sie wieder an ihren ordnungsgemäßen Platz zu legen.
Sein Rucksack hätte ihr vielleicht mehr verraten können, doch da er mit dem ganzen Körper darauf lag, war sie unschlüssig, ob sie tatsächlich versuchen sollte, einen Blick hineinzuwerfen; vermutlich enthielt er ohnehin nur Vorräte. Alles, was er für wertvoll gehalten hatte, hatte sich wohl in seinen Hosentaschen befunden.
Wie das Stück Papier.
Vermutlich lagen bereits alle Beweise, die sie wirklich brauchte, deutlich sichtbar vor ihr. Unter seinem dunklen Umhang und Waffenrock trug er eine steife Lederrüstung. An seiner Hüfte, in einer sehr schlichten, abgewetzten schwarzen Lederscheide, befand sich ein einfaches, jedoch robust gearbeitetes und gefährlich scharf geschliffenes Soldatenschwert; das Schwert war - zweifellos bei dem tiefen, unkontrollierten Sturz des Mannes vom Pfad - in der Mitte durchgebrochen.
Sie ließ den Blick etwas genauer über das ungewöhnliche Messer wandern, das in der Scheide an seinem Gürtel steckte. Sein Heft schimmerte matt im Dämmerlicht, und es hatte ihre Aufmerksamkeit gleich vom ersten Moment an gefesselt, der Anblick hatte sie geradezu erstarren lassen. Kein einfacher Soldat besaß ein so vorzüglich gearbeitetes Messer, da war sie völlig sicher. Es war unbestreitbar das kostbarste Messer, das sie je zu Gesicht bekommen hatte.
Auf dem silbernen Heft befand sich ein mit überladenen Verzierungen versehener Buchstabe, ein ›R‹, dennoch war es ein Gegenstand von außerordentlicher Schönheit.
Ihre Mutter hatte ihr den Umgang mit Messern von Kindesbeinen an beigebracht, deshalb wünschte sie sich, ihre Mutter besäße ebenfalls ein so edles Messer wie dieses hier.
Jennsen.
Das leise, geflüsterte Wort ließ Jennsen auffahren.
Nicht jetzt. Gütige Seelen, nur jetzt nicht. Nicht hier.
Jennsen.
Es gab nicht viel, das ihr zeit ihres Lebens verhasst war, doch diese Stimme, die sie gelegentlich heimsuchte, hasste sie von ganzem Herzen.
Wie stets, so ignorierte sie sie auch jetzt und zwang sich, ihre Finger zu bewegen und herauszufinden, ob da noch etwas anderes war, das sie über diesen Mann wissen sollte. Sie untersuchte die Lederriemen auf Geheimtaschen, konnte aber keine entdecken; der Waffenrock war von schlichtem Zuschnitt und besaß keine Taschen.
Jennsen, ließ sich die Stimme abermals vernehmen.
Sie biss die Zähne aufeinander. »Lass mich in Frieden«, sagte sie deutlich hörbar, wenn auch mit leiser Stimme.
Jennsen.
Diesmal klang es anders, fast so, als befände sich die Stimme gar nicht in ihrem Kopf, wie sonst immer.
»Lass mich in Ruhe«, brummte sie unwirsch.
Gib dich hin.
Sie sah auf und blickte in die leblosen, starren Augen des Soldaten.
Der erste Schleier kalten Regens wogte im Wind. Es fühlte sich an, als ob die Seelen der Verstorbenen ihr mit eisigen Fingern über das Gesicht strichen.
Ihr Herz begann noch schneller zu rasen, und ihr hastiger, unregelmäßiger Atem geriet ins Stocken - wie Seide, die an einem Stückchen trockener Haut hängen bleibt. Die weit aufgerissenen Augen fest auf das Gesicht des Toten geheftet, krabbelte sie, sich mit den Füßen abstoßend, rücklings über das Geröll.
Albern benahm sie sich, dessen war sie sich vollkommen bewusst. Der Mann war doch tot! Er sah sie nicht an, dazu war er überhaupt nicht fähig. Sein unnachgiebiger Blick war im Tod erstarrt, genau wie bei den toten Fischen, die sie geangelt hatte.
Jennsen.
Jenseits der Leiche, oberhalb des steilen Abhangs aus Granitgestein, wiegten sich die Föhren sacht im Wind, und die kahlen Ahornbäume und Eichen schwenkten ihr knorriges Geäst. Jennsen lauschte angespannt auf die Stimme. Die Lippen des Mannes bewegten sich nicht, sie wusste, dass sie sich nicht bewegten. Die Stimme kam aus ihrem Kopf.
Er hatte das Gesicht noch immer dem Pfad zugewandt, von dem aus er in den Tod gestürzt war. Anfangs hatte sie gedacht, sein lebloser Blick sei ebenfalls in diese Richtung gedreht gewesen, jetzt aber schienen sich seine Augen ein wenig mehr ihr zugewandt zu haben.
Jennsen schloss die Finger um das Heft ihres Messers.
Jennsen.
»Lass mich in Frieden. Ich denke nicht daran, mich hinzugeben.«
Nie wusste sie, was genau die Stimme meinte; obwohl sie sie schon fast ihr ganzes Leben lang begleitete, hatte sie sich nie näher darüber ausgelassen. Jennsen flüchtete sich in diese Zweideutigkeit.
Wie als Antwort auf ihren Gedanken, ließ sich die Stimme abermals vernehmen.
Gib dein Fleisch hin, Jennsen.
Jennsen stockte der Atem.
Gib deinen Willen hin.
Sie musste vor Entsetzen schlucken. Das hatte sie noch nie gesagt - nie zuvor hatte die Stimme etwas gesagt, das für sie irgendeinen Sinn ergab.
Oft hörte sie sie nur ganz schwach - so als wäre sie zu weit entfernt, um sie klar und deutlich zu verstehen; mitunter glaubte sie, einzelne Worte unterscheiden zu können, die jedoch einer fremden Sprache zu entstammen schienen.
Die Flüsterstimme sprach auch noch mit anderen Worten zu ihr, nie jedoch so, dass sie mehr verstand als ihren Namen und die beängstigend verlockende, aus einem kurzen Satz bestehende Aufforderung, sich hinzugeben. Dieser kurze Satz klang jedes Mal eindringlicher als alles andere, und sie hörte ihn stets heraus, selbst wenn die restlichen Worte unverständlich blieben.
Ihre Mutter behauptete, die Stimme gehöre dem Mann, der Jennsen schon fast ihr ganzes Leben lang umzubringen versuchte; sie meinte, er wolle sie damit quälen.
»Jenn«, sagte ihre Mutter dann für gewöhnlich, »es ist alles in Ordnung, ich bin ja bei dir. Seine Stimme kann dir nichts anhaben.« Um ihre Mutter nicht zu beunruhigen, erzählte sie ihr oft gar nichts von der Stimme.
Aber auch wenn diese Stimme ihr nichts anhaben konnte - der Mann konnte es, wenn er sie fand. Plötzlich sehnte sich Jennsen nach den beschützenden, tröstenden Armen ihrer Mutter.
Eines Tages würde er sie holen kommen, darüber waren sie sich beide im Klaren; bis dahin schickte er seine Stimme vor. Das zumindest glaubte ihre Mutter.
So beängstigend sie diese Erklärung auch fand, war sie Jennsen doch allemal lieber, als an ihrem Verstand zweifeln zu müssen, denn ohne diesen besäße sie gar nichts mehr.
»Was ist denn hier geschehen?«
Jennsen unterdrückte einen erschrockenen Aufschrei, fuhr herum und zog dabei ihr Messer. Dann ließ sie sich in eine geduckte Stellung nieder, die Füße ein Stück weit auseinander, das Messer in todesmutiger Entschlossenheit fest umklammert.
Das war keine körperlose Stimme - ein leibhaftiger Mann kam den tief eingeschnittenen Wasserlauf zu ihr heraufgestiegen. Das Geräusch des Windes in den Ohren und abgelenkt durch den Toten und die Stimme, hatte sie ihn nicht kommen hören.
Er war kräftig und bereits so nah, dass er sie - sollte sie fortlaufen und er die nötige Entschlossenheit an den Tag legen - ohne Mühe würde einholen können.
2
Angesichts ihrer Reaktion und des Messers in ihrer Hand verlangsamte der Mann seine Schritte.
»Ich hatte nicht die Absicht, Euch einen Schrecken einzujagen.«
Seine Stimme klang durchaus freundlich.
»Habt Ihr aber.«
Obwohl er seine Kapuze hochgeschlagen hatte und sie sein Gesicht nicht genau erkennen konnte, schien ihr, dass er ihr rotes Haar musterte, so wie die meisten Menschen, die sie zum ersten Mal sahen.
»Das sehe ich. Ich bitte um Verzeihung.«
Sie ließ den Blick suchend nach links und rechts schweifen, um festzustellen, ob der Fremde allein gekommen oder ob noch jemand bei ihm war, der sich womöglich gerade an sie heranschlich.
Wie eine Idiotin kam sie sich vor, weil sie sich so hatte übertölpeln lassen. Im Grunde ihres Herzens wusste sie doch, dass sie sich niemals wirklich sicher fühlen durfte. Es bedurfte keiner List, schon eine simple Sorglosigkeit ihrerseits konnte das Ende bedeuten. Als ihr klar wurde, wie leicht dies geschehen konnte, überkam sie ein Gefühl verzweifelter Schicksalhaftigkeit. Wenn dieser Mann am helllichten Tag kommen und sie so mühelos erschrecken konnte, was sagte dies dann hinsichtlich ihres hoffnungslos übertriebenen Traums, eines Tages über ihr Leben selbst bestimmen zu können?
Die Felswand der Klippe glänzte dunkel in der feuchten Luft; die winddurchtoste, tief eingeschnittene Schlucht war bis auf sie, den toten Soldaten und den Fremden völlig menschenleer.
Ein Dutzend Schritte entfernt blieb der Mann stehen; seiner Körperhaltung nach war es nicht die Angst vor ihrem Messer, die ihn hatte anhalten lassen, sondern vielmehr die Befürchtung, sie noch weiter zu verängstigen. Er betrachtete sie ganz unverhohlen und hing dabei scheinbar seinen eigenen Gedanken nach. Was auch immer an ihrem Gesicht ihn so gefangen genommen haben mochte - er hatte sich rasch davon erholt.
»Es scheint mir durchaus verständlich, warum eine Frau allen Grund hat, sich zu ängstigen, wenn sich ihr plötzlich ein Fremder nähert. Ich wäre auch meines Weges gegangen, ohne Euch zu erschrecken, aber dann sah ich den Mann dort auf der Erde liegen, und wie Ihr Euch über ihn beugtet. Ich dachte, vielleicht braucht Ihr Hilfe, also kam ich so rasch es ging hierher.«
Der kalte Wind hob den dunkelgrünen Umhang des Fremden an, so dass man seine gut geschnittene, aber einfache Kleidung erkennen konnte. Sein vage erkennbares Lächeln hatte etwas höflich Verbindliches, mehr nicht, doch stand es ihm gut zu Gesicht.
»Er ist tot«, war alles, was ihr als Erwiderung einfiel.
Jennsen war es nicht gewohnt, mit Fremden zu sprechen, war es nicht gewohnt, überhaupt mit jemandem außer ihrer Mutter zu sprechen. Außerdem war sie unsicher, was sie sagen und wie sie sich verhalten sollte - erst recht unter diesen Umständen.
»Oh. Das tut mir Leid.« Er reckte, ohne jedoch näher zu kommen, seinen Hals ein wenig vor, um den Mann auf dem Boden in Augenschein zu nehmen.
Jennsen empfand es als rücksichtsvoll, wenn jemand gar nicht erst den Versuch unternahm, sich einem sichtlich nervösen Menschen weiter zu nähern, allerdings ging es ihr gegen den Strich, so durchschaubar zu sein, hatte sie doch immer gehofft, auf andere ein wenig unergründlich zu wirken.
Er hob den Blick von dem Toten und betrachtete erst ihr Messer, dann ihr Gesicht. »Ich nehme an, Ihr hattet einen Grund.«
Nach einem kurzen Augenblick der Verwirrung begriff sie schließlich, was er meinte, und sprudelte hervor: »Das war nicht ich!«
Er zuckte mit den Achseln. »Verzeihung. Ich kann von hier aus nicht erkennen, was passiert ist.«
Jennsen war es unangenehm, den Mann mit dem Messer zu bedrohen, deshalb ließ sie den Arm mit der Waffe sinken.
»Es war nicht meine Absicht … wie eine Verrückte dazustehen. Ihr habt mir bloß einen fürchterlichen Schrecken eingejagt.«
Sein Lächeln wurde freundlicher. »Verstehe. Es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Was ist denn überhaupt passiert?«
Jennsen deutete mit ihrer freien Hand hinüber zu der Felswand. »Er muss wohl vom Pfad dort oben abgestürzt sein. Er hat sich das Genick gebrochen; das glaube ich zumindest, denn ich habe ihn eben erst gefunden, und andere Fußspuren sehe ich hier nirgends. Vermutlich ist er durch den Sturz umgekommen.«
Während Jennsen das Messer in die Scheide an ihrem Gürtel zurückschob, betrachtete er nachdenklich die Felswand. »Ich bin froh, dass ich unten herum gegangen bin, statt den Pfad oben entlang zu nehmen.«
Sie deutete mit einem auffordernden Nicken auf den Toten. »Gerade war ich dabei, nach etwas zu suchen, das mir möglicherweise darüber Aufschluss gibt, wer er ist. Ich dachte, vielleicht sollte ich … jemanden benachrichtigen. Aber ich habe nichts gefunden.«
Die Stiefel des Mannes knirschten auf dem Geröll, als er näher trat. Er kniete auf der anderen Seite des Toten nieder und nicht etwa neben ihr - vielleicht, um der mit dem Messer herumfuchtelnden Verrückten vorsichtshalber etwas Platz zu lassen und ihr so ein wenig von ihrer Nervosität zu nehmen.
»Ich möchte vermuten, Ihr hattet Recht«, meinte er, nachdem er die ungewöhnliche Neigung des Kopfes in Augenschein genommen hatte. »Sieht ganz so aus, als läge er schon eine Weile hier.«
»Ich bin vorhin schon einmal hier vorbeigekommen. Das dort drüben sind meine Fußspuren. Andere kann ich nirgendwo erkennen.« Sie deutete auf den unmittelbar hinter ihr liegenden Hang. »Als ich vorhin zum See hinunterging, um nach meinen Schnüren zu sehen, hat er noch nicht hier gelegen.«
Er drehte den Kopf, um das regungslose Gesicht besser betrachten zu können. »Irgendeine Vermutung, um wen es sich gehandelt haben könnte?«
»Nein. Ich habe keine Ahnung, außer, dass er Soldat ist.«
Der Mann sah auf. »Irgendeine Vermutung, was für eine Art Soldat?«
Jennsen runzelte verwirrt die Stirn. »Was für eine Art? Er ist ein d’Haranischer Soldat.« Sie ließ sich auf dem Boden nieder, um den Fremden aus der Nähe betrachten zu können. »Woher kommt Ihr, dass Ihr einen d’Haranischen Soldaten nicht erkennt?«
Er fuhr mit einer Hand unter die Kapuze seines Umhangs und rieb sich den Hals. »Ich bin nur auf der Durchreise.« Sein Tonfall wie auch sein Äußeres verrieten, wie müde er war.
Die Antwort verblüffte sie. »Ich bin mein ganzes Leben auf Reisen gewesen, trotzdem kenne ich niemanden, der einen d’Haranischen Soldaten nicht auf den ersten Blick erkennen würde. Wieso könnt Ihr das nicht?«
»Ich bin erst seit kurzem in D’Hara.«
»Das ist völlig unmöglich. D’Hara erstreckt sich doch über den größten Teil der Welt.«
Diesmal verriet sein Lächeln Amüsiertheit. »Tatsächlich?«
Sie spürte, wie ihr die Hitze ins Gesicht stieg; bestimmt lief sie rot an, weil sie ihre Unwissenheit über die Welt im Allgemeinen so deutlich unter Beweis gestellt hatte. »Etwa nicht?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Ich stamme tief unten aus dem Süden, von jenseits des Landes, das man D’Hara nennt.«
Sie starrte ihn verwundert an, während sich ihre Verärgerung über die Schlussfolgerungen, die ihr in Anbetracht einer so erstaunlichen Bemerkung durch den Kopf schossen, in nichts auflöste. Vielleicht war ihr Traum doch nicht ganz so übertrieben.
»Und was tut Ihr hier in D’Hara?«
»Das sagte ich doch bereits. Ich bin auf der Durchreise.« Er klang erschöpft. War das ein Wunder? Schließlich wusste Jennsen selbst zur Genüge, wie ermüdend es sein konnte umherzureisen. Sein Tonfall war ernster, als er sagte: »Selbstverständlich weiß ich, dass er ein d’Haranischer Soldat ist. Ihr habt mich falsch verstanden. Was ich meinte, war, was für eine Art Soldat? Gehört er einem hiesigen Regiment an? Ist er hier nur stationiert oder ein Soldat auf Heimaturlaub? Ist er unterwegs in die Stadt, um sich zu betrinken? Ein Kundschafter?«
Ihre Beunruhigung wuchs. »Ein Kundschafter? Was sollte er in seiner eigenen Heimat auskundschaften wollen?«
Der Mann richtete den Blick in die Ferne, auf die tief stehenden dunklen Wolken. »Keine Ahnung. Ich habe mich nur gefragt, ob Ihr vielleicht etwas über ihn wisst.«
»Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn doch eben erst gefunden.«
»Sind diese d’Haranischen Soldaten gefährlich? Ich meine, belästigen sie normale Bürger? Leute, die einfach auf der Durchreise sind?«
Ihr Blick wich seinem fragenden Blick aus. »Ich - das weiß ich nicht. Vermutlich, ja, das wäre möglich.«
Sie hatte Angst, zu viel zu verraten, andererseits wollte sie aber auch nicht, dass er durch ihre übertriebene Verschwiegenheit womöglich in Schwierigkeiten geriet.
»Was hat Eurer Meinung nach ein einzelner Soldat hier in dieser abgeschiedenen Gegend verloren? Es kommt nicht oft vor, dass Soldaten ganz allein unterwegs sind.«
»Auch das weiß ich nicht. Wieso glaubt Ihr eigentlich, dass eine einfache Frau mehr über das Soldatenleben weiß als ein Mann von Welt, der viel herumgekommen ist? Könnt Ihr Euch nicht selbst einen Reim darauf machen? Vielleicht dachte er gerade an sein Mädchen daheim und hat deshalb nicht die nötige Vorsicht walten lassen. Vielleicht ist er deshalb ausgerutscht und abgestürzt.«
Er rieb sich abermals den Hals, so als hätte er dort Schmerzen. »Verzeihung. Ich drücke mich wohl nicht besonders deutlich aus, denn ich bin ein wenig müde. Vielleicht denke ich nicht klar, vielleicht war ich auch nur Euretwegen besorgt.«
»Meinetwegen? Was wollt Ihr denn damit sagen?«
»Ich will damit sagen, dass Soldaten immer irgendeiner Einheit angehören. Und die anderen Soldaten wissen gewöhnlich, wo sie normalerweise zu finden sind. Soldaten ziehen nicht einfach aufs Geratewohl allein los. Bei ihnen ist das anders als bei einem einsamen Fallensteller, der verschwinden könnte, ohne dass jemand etwas davon erfährt.«
»Oder bei einem einsamen Reisenden?«
Ein nachsichtiges Lächeln nahm seinem Gesichtsausdruck etwas von seiner Angespanntheit. »Oder bei einem einsamen Reisenden.« Das Lächeln erlosch. »Worauf ich hinaus will, ist: Wahrscheinlich werden seine Kameraden nach ihm suchen. Wenn sie die Leiche hier finden, werden sie Truppen hierher beordern, um zu verhindern, dass irgendjemand das Gebiet verlässt. Sobald sie alle aufgegriffen haben, derer sie habhaft werden können, werden sie anfangen, Fragen zu stellen. Und nach allem, was ich von d’Haranischen Soldaten gehört habe, wissen sie, wie man dabei vorgeht. Sie werden über jeden, den sie verhören, alles bis ins kleinste Detail wissen wollen.«
Ein heftiges, widerwärtiges Gefühl der Bestürzung ließ Jennsens Magengegend krampfartig zusammenschrumpfen. Dass d’Haranische Soldaten ihr oder ihrer Mutter Fragen stellten, war das Letzte, was sie wollte. Dieser tote Soldat konnte am Ende ihren Tod bedeuten.
»Aber wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass …«
»Ich will damit nur sagen, ich möchte nicht, dass die Kameraden dieses Burschen hier aufkreuzen und auf die Idee kommen, jemand müsse für seinen Tod bezahlen. Womöglich betrachten sie es nicht als Unglück. Der Tod eines Kameraden wühlt Soldaten auf, auch wenn es nichts Vorsätzliches war. Wir zwei sind die beiden einzigen Personen in der Nähe. Ich möchte nicht erleben müssen, dass ein Trupp Soldaten den Toten findet und auf die Idee kommt, uns dafür verantwortlich zu machen.«
»Soll das etwa heißen, selbst wenn es ein Unglück war, könnten sie einen Unschuldigen festnehmen und ihm die Schuld daran geben?«
»Das weiß ich nicht, aber meiner Erfahrung nach verhalten Soldaten sich so. Wenn sie aufgebracht sind, suchen sie sich jemanden, dem sie die Schuld in die Schuhe schieben können.«
»Aber doch nicht uns. Ihr wart nicht einmal hier, und ich war nur auf dem Weg, um nach meinen Angelschnüren zu sehen.«
Er stützte einen Ellbogen auf seinem Knie ab und beugte sich über den Toten hinweg zu ihr. »Und dieser Soldat, unterwegs im Dienste des großen D’Haranischen Reiches, sieht eine hübsche junge Frau daherstolzieren und ist durch sie so abgelenkt, dass er ausrutscht und abstürzt.«
»Ich bin nicht ›daherstolziert‹!«
»Das wollte ich damit auch keineswegs andeuten, sondern Euch lediglich vor Augen führen, wie man einen Schuldigen findet, wenn man es darauf anlegt.«
Das hatte sie nicht bedacht! Dann dämmerte ihr allmählich, was er außerdem noch gesagt hatte. Noch nie hatte ein Mann Jennsen als hübsch bezeichnet. So unvermutet und deplatziert die Bemerkung hier, inmitten einer so Besorgnis erregenden Situation, sein mochte - sie fühlte sich geschmeichelt. Da sie nicht wusste, wie sie auf das Kompliment reagieren sollte, und da so viele wichtigere Gedanken ihre Gefühle beherrschten, tat sie ganz einfach so, als hätte sie es nicht gehört.
»Das Mindeste, was sie tun werden, wenn sie ihn finden«, fuhr der Mann fort, »ist, jeden in der Nähe aufzugreifen und ihn einem langwierigen und strengen Verhör zu unterziehen.«
Auf einmal sah sie all die unschönen Folgen nur zu deutlich vor sich; ihr Schicksalstag rückte auf einmal in bedrohliche Nähe.
»Was sollen wir Eurer Meinung nach also tun?«
Er dachte einen Augenblick nach. »Nun, sollten sie tatsächlich hier vorbeikommen, ohne ihn jedoch zu finden, hätten sie keinen Grund, hier zu bleiben und die Leute aus der Gegend zu verhören. Und wenn sie ihn hier nicht finden, werden sie woanders weiter nach ihm suchen.«
Er stand auf und sah sich um. »Der Boden ist zu hart, um ein Grab auszuheben.« Er zog seine Kapuze tiefer ins Gesicht, um seine Augen beim Suchen gegen den Nebel zu schützen. Dann zeigte er auf eine Stelle in der Nähe der Felsklippe. »Da. Dort ist eine tiefe Spalte, die mir groß genug erscheint. Wir könnten ihn hineinlegen und ihn mit Geröll und Steinen bedecken. Das beste Begräbnis, das wir ihm in dieser Jahreszeit geben können.«
Und vermutlich ein besseres, als er verdient hatte. Lieber hätte sie ihn einfach liegen lassen, aber das wäre gar nicht klug. Sie hatte ihn ja bereits verstecken wollen, bevor der Fremde zufällig des Weges gekommen war, und seine Vorgehensweise war eindeutig besser.
Er schaute sie an. »Der Mann ist tot, daran ist nichts zu ändern. Es war ein Unglück. Warum sollten wir uns durch dieses Missgeschick in Schwierigkeiten bringen lassen? Wir haben nichts Unrechtes getan, wir waren ja nicht einmal hier, als es passierte. Ich sage, wir vergraben ihn und leben einfach weiter wie zuvor.«
Jennsen erhob sich; der Mann hatte einfach Recht. »Einverstanden«, sagte sie. »Wenn wir es wirklich tun wollen, sollten wir uns sputen.«
Er lächelte, eher aus Erleichterung denn aus einem anderen Grund, wie sie fand. Dann drehte er sich herum, um ihr unmittelbar ins Gesicht zu sehen, und schlug die Kapuze zurück, wie Männer dies aus Respekt gegenüber einer Frau zu tun pflegten.
Erschrocken stellte Jennsen fest, dass sein kurz geschorenes Haar schneeweiß war, dabei schien er höchstens sechs oder sieben Jahre älter als sie zu sein. Sie musterte es ebenso staunend, wie die Leute ihr rotes Haar bestaunten. Seine Augen schimmerten ebenso blau wie ihre, so blau, wie Erzählungen zufolge auch die ihres Vaters gewesen waren.
Die Kombination aus seinem kurzen weißen Haar und den blauen Augen bot einen eindrucksvollen Anblick; beides harmonierte mit seinem glatt rasierten Gesicht und verschmolz mit seinen Gesichtszügen zu einer Einheit, die ihr absolut vollkommen zu sein schien.
Über den toten Soldaten hinweg reichte er ihr die Hand.
»Ich heiße Sebastian.«
Nach kurzem Zögern reichte sie ihm ihrerseits die Hand; sie war überrascht, wie ungewöhnlich warm sich seine Hand anfühlte.
»Wollt Ihr mir Euren Namen nicht verraten?«
»Ich bin Jennsen Daggett.«
»Jennsen.« Der Klang entlockte ihm ein wohlgefälliges Lächeln.
Sie spürte, wie sie abermals errötete. Anstatt Notiz davon zu nehmen, machte er sich umgehend an die Arbeit, indem er den Soldaten unter den Armen packte und zog, doch ließ sich der Körper mit jedem kräftigen Ruck nur ein winziges Stück bewegen. Jennsen half ihm, und gemeinsam schleiften sie den Toten, der ihr im Tod ebenso bedrohlich erschien, wie er es vermutlich lebend gewesen wäre, über das Geröll.
Sebastian wälzte ihn herum; erst jetzt gewahrte Jennsen, dass er unter seinem Rucksack ein kurzes Schwert über die Schulter geschnallt trug. In den Waffengurt an seiner Hüfte war hinten im Kreuz eine sichelförmige Streitaxt eingehakt. Jennsens Unruhe wuchs, als sie sah, wie schwer bewaffnet der Soldat gewesen war. Reguläre Truppen führten nicht so viele Waffen mit und besaßen auch nicht ein solches Messer.
Sebastian streifte ihm die Tragegurte des Rucksacks über die Arme, schnallte das Kurzschwert los und legte es zur Seite; dann löste er den Waffengurt und warf ihn auf das Schwert.
»Der Rucksack enthält keinerlei ungewöhnliche Dinge«, meinte er nach einer kurzen Untersuchung und legte ihn zu den anderen Sachen. Dann ging Sebastian daran, die Taschen des Toten zu filzen. Jennsen wollte schon fragen, was er sich da erlaube, als ihr wieder einfiel, dass sie sich genauso verhalten hatte. Um einiges aufgebrachter reagierte sie allerdings, als er die anderen Gegenstände zurücksteckte, nachdem er das Geld aussortiert hatte.
Sebastian hielt ihr das Geld hin.
»Was soll das?«, fragte sie.
»Nehmt schon.« Er bot ihr das Geld noch einmal an, mit mehr Nachdruck diesmal. »Wem nützt es, vergraben in der Erde? Geld ist dazu da, das Leid der Lebenden zu lindern, nicht das der Toten. Oder glaubt Ihr etwa, er kann sich von den Gütigen Seelen ein ehrenvolles, von Heiterkeit erfülltes, ewiges Leben erkaufen?«
»Aber es gehört mir nicht.«
Sebastian runzelte die Stirn und bedachte sie mit einem missbilligenden Blick. »Betrachtet es als teilweise Wiedergutmachung für das, was Ihr durchgemacht habt.«
Sie spürte, wie ein kalter Schauder sie überlief. Wie konnte er davon wissen? Sie waren doch immer so vorsichtig gewesen.
»Was wollt Ihr damit sagen?«
»Für die Zeit, um die sich Euer Leben durch den Schrecken verkürzt, den Euch dieser Bursche heute eingejagt hat.«
Leise seufzend atmete Jennsen erleichtert auf. Sie musste endlich damit aufhören, hinter jeder Bemerkung immer nur das Schlimmste zu vermuten.
Ein wenig widerwillig ließ sie sich die Münzen von Sebastian in die Hand drücken. Drei Münzen in den Handteller. »So nehmt schon. Das Geld gehört jetzt Euch«, sagte er.
Jennsen musste daran denken, was eine solche Summe bedeuten konnte, und nickte. »Meine Mutter hatte es im Leben immer schwer, sie kann es gebrauchen.«
»Dann will ich hoffen, dass es Euch beiden zugute kommt. Betrachten wir die Unterstützung von Euch und Eurer Mutter als die letzte gute Tat dieses Mannes.«
»Ihr habt so heiße Hände.« Dem Ausdruck seiner Augen nach glaubte sie auch den Grund dafür zu kennen, deshalb fügte sie nichts hinzu.
Er bestätigte ihre Vermutung mit einem Nicken. »Ich habe leichtes Fieber, es hat heute Morgen angefangen. Wenn wir diese Sache hinter uns haben, kann ich mich hoffentlich bis zur nächsten Ortschaft durchschlagen und eine Weile in einem trockenen Zimmer ausruhen. Ich brauche nur ein wenig Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen.«
»Die Ortschaft ist viel zu weit entfernt; heute schafft Ihr es auf keinen Fall mehr bis dorthin.«
»Seid Ihr sicher? Ich bin gut zu Fuß, denn ich bin es gewohnt, zu laufen.«
»Ich auch«, erwiderte Jennsen, »und ich brauche fast einen ganzen Tag bis dorthin. Es ist nur noch ein paar Stunden hell - und vorher müssen wir unbedingt unsere Arbeit hier zu Ende bringen.«
Sebastian seufzte. »Nun, dann werde ich mich wohl damit abfinden müssen.«
Er kniete abermals nieder und wälzte den Soldaten halb herum, um dessen Messer vom Gürtel zu lösen. Die Scheide aus fein genarbtem Leder war, passend zum Griff, mit Silber besetzt und mit demselben kunstvoll verzierten Emblem geschmückt. Sebastian reichte ihr das Messer.
»Es wäre doch schade, eine so noble Waffe zu vergraben. Hier, nehmt. Besser als das billige Spielzeug, mit dem Ihr mich vorhin bedroht habt.«
Jennsen stand wie vom Donner gerührt da, äußerst verwirrt. »Aber das solltet Ihr behalten.«
»Ich werde mir seine anderen Waffen nehmen, sie entsprechen ohnehin eher meinem Geschmack. Das Messer gehört Euch. So lautet Sebastians Gesetz.«
»Sebastians Gesetz?«
»Schönheit gehört zu Schönheit.«
Das Kompliment, das sich dahinter verbarg, ließ Jennsen erröten.
»Habt Ihr eine Idee, was das ›R‹ auf dem Heft bedeutet?«
Am liebsten hätte sie augenblicklich mit »Ja« geantwortet, schließlich wusste sie nur zu gut, wofür es stand.
»Es steht für das Haus Rahl.«
»Das Haus Rahl?«
»Für Lord Rahl - den Herrscher D’Haras«, erklärte sie, einen Alptraum in schlichte Worte fassend.
3
Als sie ihre mühselige Arbeit endlich hinter sich hatten, konnte Jennsen vor Erschöpfung kaum noch die Arme heben. Der schneidende, zudem feuchte Wind, der ihr durch die Kleider fuhr, schien bis ins Mark zu dringen, und aus Ohren, Nase und Fingern war jegliches Gefühl gewichen; Sebastians Gesicht war mit einer glänzenden Schweißschicht bedeckt.
Aber der Tote lag nun endgültig unter einer Schicht aus Geröll und Steinen begraben, die es am Fuß der Felsenklippe im Überfluss gab. Sebastian hatte den Schöpfer mit ein paar schlichten Worten gebeten, die Seele des Mannes in der Ewigkeit willkommen zu heißen; auf eine Bitte um Vergebung vor dem göttlichen Gericht hatte er, wie Jennsen auch, verzichtet.
Nachdem sie mit Hilfe eines schweren Zweigs und ihrer Füße das Geröll verteilt und so die Spuren ihrer Arbeit verwischt hatte, musterte Jennsen das Gelände noch einmal und stellte erleichtert fest, dass wohl niemand vermuten würde, hier läge ein Mensch begraben. Sollten Soldaten des Weges kommen, würden sie bestimmt nicht merken, dass hier einer der ihren den Tod gefunden hatte.
Dann legte Jennsen Sebastian die Hand an die Stirn und sah ihre Befürchtungen bestätigt. »Ihr glüht ja vor Fieber.«
»Wir sind fertig. Jetzt, da ich nicht mehr befürchten muss, von Soldaten aus meinem Schlafsack gescheucht und bei vorgehaltenem Schwert verhört zu werden, werde ich bestimmt unbeschwerter schlafen.«
Sie fragte sich nur, wo das sein sollte, denn der Nieselregen wurde zusehends dichter, und wahrscheinlich würde es bald anfangen zu regnen. Jennsen sah zu, wie ihr Gefährte sich den Waffengurt um die Hüfte schnallte. Die Axt befestigte er an seiner rechten Seite; nachdem er die Klinge geprüft und für zufrieden stellend befunden hatte, machte er das Kurzschwert an der linken Gürtelseite fest. Anschließend warf er seinen schweren grünen Umhang darüber und sah wieder aus wie ein ganz gewöhnlicher Reisender. Jennsen vermutete allerdings, dass er mehr war als das. Er hatte seine Geheimnisse, mit denen er ganz beiläufig, fast offen umging; sie dagegen hütete die ihren ziemlich ungeschickt.
Er führte das Schwert mit einer Leichtigkeit, wie sie nur durch lange Vertrautheit entsteht. Das wusste sie, weil sie selbst ihr Messer mit müheloser Eleganz handhabte, eine Fertigkeit, die man nur durch Erfahrung und fortgesetztes Üben erlangte.
Sebastian nahm den Rucksack des Toten auf und schlug dessen Klappe zurück. »Wir werden seine Vorräte unter uns aufteilen. Wollt Ihr den Rucksack haben?«
»Rucksack und Vorräte solltet Ihr behalten«, erwiderte Jennsen, während sie ihre Fische holen ging.
Er nickte, und mit einem abschätzenden Blick in den Himmel schnürte er den Rucksack zu. »Dann mache ich mich jetzt wohl am besten auf den Weg.«
»Wohin?«
»Genau genommen nirgendwohin, denn ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich schätze, ich werde noch ein Stück gehen und mir dann wohl am besten einen Unterschlupf suchen.«
»Es kommt Regen auf«, sagte sie. »Um das zu erkennen, braucht man kein Prophet zu sein.«
Er lächelte. »Wahrscheinlich nicht.« Seine Augen ertrugen geduldig den Anblick dessen, was vor ihm lag. Mit der Hand fuhr er sich durchs Haar, dann zog er seine Kapuze über. »Nun, passt gut auf Euch auf, Jennsen Daggett. Und meine Empfehlung an Eure Mutter. Sie hat eine hübsche Tochter großgezogen.«
Mit einem kurzen Nicken quittierte sie lächelnd seine Worte, sah zu, wie er kehrtmachte und sich langsam über die ebene Geröllfläche entfernte. Ringsumher erhoben sich schroffe Felswände, deren schneebedeckte Vorsprünge sich in einer grauen Wolkendecke aufzulösen schienen, die auch die endlose Kette hoher Gipfel einhüllte.
Es schien so seltsam, so unsinnig, dass ihre Wege sich in der endlosen Weite dieses Landes für so kurze Zeit gekreuzt haben sollten, für einen so tragischen Augenblick, in dem ein Menschenleben endete, um sich unmittelbar darauf wieder in der endlosen Vergessenheit des Lebensstroms zu verlieren.
Jennsen schlug das Herz bis zum Hals, als sie darauf lauschte, wie seine Schritte sich knirschend auf dem groben Geröll entfernten. Sie überlegte hin und her, was sie tun sollte. War es ihr denn tatsächlich bestimmt, sich immer nur von den Menschen abzuwenden und sich zu verkriechen?
Sollte sie sich - wie immer - jedes kleine bisschen dessen, was das Leben ausmachte, verscherzen, noch dazu wegen eines Verbrechens, das sie nicht einmal begangen hatte? Durfte sie es riskieren?
Was ihre Mutter sagen würde, wusste sie genau. Aber ihre Mutter liebte sie von ganzem Herzen, deshalb würde sie nichts sagen, um sie nicht unnötig zu quälen.
»Sebastian?« Er drehte sich um, sah sie an und wartete darauf, dass sie weitersprach. »Ohne einen Unterschlupf erlebt Ihr vielleicht nicht mal den morgigen Tag. Es würde mir gar nicht gefallen zu wissen, dass Ihr dort draußen mit Fieber herumirrt und bis auf die Haut nass werdet.«
Er stand da und sah sie weiterhin an. »Mir würde das genauso wenig gefallen. Ich werde Eure Worte beherzigen und alles daransetzen, einen Unterschlupf zu finden.«
Bevor er sich abermals abwenden konnte, hob sie eine Hand und deutete in die entgegengesetzte Richtung. Sie merkte, dass ihre Finger zitterten. »Ihr könntet doch mit zu mir nach Hause kommen.«
»Wird denn Eure Mutter nichts dagegen haben?«
Ihre Mutter würde in Panik ausbrechen. Ihre Mutter würde niemals erlauben, dass ein Fremder, ganz gleich, wie sehr er ihr geholfen hatte, in ihrem Haus schlief. Ihre Mutter würde die ganze Nacht kein Auge zutun, wenn ein Fremder auch nur in der Nähe wäre. Aber ohne ein Dach über dem Kopf konnte Sebastian sich mit seinem Fieber glatt den Tod holen. Und das würde Jennsens Mutter diesem Mann bestimmt nicht wünschen, denn ihre Mutter hatte ein großes Herz. Diese liebevolle Sorge war der Grund, weshalb sie sich Jennsen gegenüber so beschützend verhielt.
»Das Haus ist klein, aber in der Höhle, in der wir die Tiere halten, ist genug Platz. Wenn es Euch nichts ausmacht, könnt Ihr dort schlafen. Das klingt schlimmer, als es ist. Ich habe selbst schon manchmal dort übernachtet, wenn es mir im Haus zu eng wurde. Gleich am Eingang würde ich Euch ein Feuer anzünden, dann hättet Ihr es warm und bekämt die Ruhe, die Ihr so dringend braucht.«
Er wirkte unschlüssig, deshalb zeigte Jennsen ihm die Angelschnur mit den Fischen.
»Wir würden Euch auch etwas zu essen geben.« Sie versuchte, ihr Angebot verlockender klingen zu lassen. »Dann hättet Ihr wenigstens auch noch eine ordentliche Mahlzeit zu Eurem warmen Schlafplatz. Ihr habt mir geholfen; lasst Ihr Euch jetzt auch von mir helfen?«
Sein Lächeln kehrte zurück, ein Lächeln voller Dankbarkeit. »Ihr seid eine überaus freundliche Frau, Jennsen. Wenn Eure Mutter es erlaubt, werde ich Euer Angebot annehmen.«
Sie schlug ihren Umhang zurück, so dass man das scharfe Messer in seiner Scheide gewahrte, das sie hinter den Gürtel gesteckt hatte. »Wir werden ihr das Messer geben. Sie wird es zu würdigen wissen.«
»Ich denke, wegen eines fieberkranken Fremden müssen zwei mit Messern bewaffnete Frauen sich keine Sorgen machen.«
Jennsen hoffte, ihre Mutter würde es ebenso sehen.
»Dann also abgemacht. Kommt jetzt, bevor wir noch vom Regen überrascht werden.«
Als sie losging, folgte Sebastian ihr mit schnellen Schritten, bis er sie eingeholt hatte. Sie nahm ihm den Rucksack aus der Hand und warf ihn sich über die Schulter; in seinem geschwächten Zustand hatte Sebastian mit seinem eigenen Rucksack und den neuen Waffen schon genug zu tragen.
4
»Wartet hier«, flüsterte Jennsen. »Ich gehe und sage ihr, dass wir einen Gast haben.«
Sebastian ließ sich schwer auf einen niedrigen Felsvorsprung sinken, auf dem es sich bequem sitzen ließ. »Erklärt Ihr einfach, was ich Euch gesagt habe, und dass ich Verständnis dafür hätte, wenn sie keinen Fremden im Haus übernachten lassen möchte.«
Jennsen betrachtete ihn mit ruhiger, ernster Miene.
»Meine Mutter und ich brauchen keinen Besucher zu fürchten.«
Damit spielte sie nicht auf gewöhnliche Waffen an, wie er aus ihrem Ton heraushörte. Zum ersten Mal seit ihrem Zusammentreffen sah sie einen Funken von Unsicherheit in seinen ruhigen blauen Augen aufflackern.
Jennsens Lippen dagegen zeigten die Andeutung eines Lächelns, als sie ihn überlegen sah, welch rätselhafte Gefahr von ihr ausgehen mochte. »Ihr könnt ganz unbesorgt sein. Nur wer Ärger mitbringt, muss Angst haben, sich hier aufzuhalten.«
Er hob die Hände zum Zeichen, dass er sich geschlagen gab. »Dann bin ich hier sicher wie ein Neugeborenes in den Armen seiner Mutter.«
Jennsen ließ Sebastian auf dem Felsen warten, während sie, knorrige Wurzeln als Stufen benutzend, auf dem verschlungenen Pfad zwischen schützenden Nadelbäumen hindurch bis zu ihrem Haus aufstieg, das ein Stück zurückversetzt in einem Eichenhain auf einem kleinen, im Hang eines Berges eingebetteten Felsvorsprung stand; es gab ausreichend Platz, ihre Ziege weiden zu lassen, sowie für ein paar Enten und Hühner. Zur Rückseite hin machten steile Felsen jeden zufälligen Besuch aus dieser Richtung unmöglich, der Pfad an der Vorderseite war der einzige Zugang. Für den Fall, dass sie bedroht wurden, hatten Jennsen und ihre Mutter hinter dem Haus eine gut versteckte Folge von Tritten angebracht, die zu einem schmalen Felsensims hinauf- und über einen gewundenen Nebenweg und verschiedene Wildwechsel durch eine Schlucht vom Haus wegführte.
Seit Jennsens Kindertagen waren sie häufig umgezogen und niemals allzu lange an einem Ort geblieben. Hier jedoch, wo sie sich sicher fühlten, hielten sie es mittlerweile bereits seit über zwei Jahren aus. Kein einziges Mal hatten Reisende ihr Versteck in den Bergen entdeckt, was an ihren anderen Aufenthaltsorten gelegentlich vorgekommen war, und die Bewohner Briartons, der nächsten Ortschaft, wagten sich niemals so weit in den dunklen und bedrohlichen Wald vor. Es war der sicherste Unterschlupf, den sie und ihre Mutter je gefunden hatten, deshalb hatte Jennsen es nach und nach gewagt, ihn immer mehr als ihr Zuhause zu betrachten.
Jennsen wurde verfolgt, seit sie sechs war, und trotz der niemals nachlassenden Vorsicht ihrer Mutter wären sie mehrere Male um ein Haar aufgegriffen worden. Der sie verfolgte, war kein gewöhnlicher Mann und deshalb nicht auf die üblichen Mittel bei einer Verfolgung angewiesen. Soviel Jennsen wusste, konnten es seine Augen sein, mit denen die auf einem hohen Ast hockende Eule sie beobachtete, während sie den felsigen Pfad hinaufstieg.
Kaum war Jennsen am Haus angelangt, als ihre Mutter aus der Tür trat. Sie war genauso groß wie Jennsen und hatte dasselbe dichte, bis knapp über die Schultern fallende Haar, nur dass das ihre eine eher kastanienbraune denn rote Farbe hatte. Sie war noch keine fünfunddreißig und die schönste Frau, die Jennsen je gesehen hatte. Unter anderen Lebensumständen hätten gewiss zahllose Freier ihrer Mutter den Hof gemacht, und manch einer von ihnen wäre auch bestimmt bereit gewesen, einen fürstlichen Brautpreis für ihre Hand zu zahlen. Aber da die innere Schönheit ihrer Mutter ebenso ausgeprägt war wie ihre äußere, hatte sie das alles aufgegeben, um ihre Tochter zu beschützen.
Wenn Jennsen von Selbstmitleid gepackt wurde, weil sie auf ganz alltägliche Dinge verzichten musste, rief sie sich ihre Mutter ins Gedächtnis, die genau diese Dinge und noch viel mehr um ihrer Tochter willen aufgegeben hatte. Ihre Mutter war für sie wie ein Schutzengel.
»Jennsen!« Ihre Mutter kam ihr entgegengerannt und packte sie bei den Schultern. »Jenn, ich hab mir schon solche Sorgen gemacht. Dachte mir, du bist in Schwierigkeiten geraten, und wollte …«
»Das stimmt auch, Mutter«, gestand sie.
Ihre Mutter zögerte nur einen Augenblick, dann zog sie Jennsen ohne weitere Fragen in ihre schützenden Arme. Nach einem so beängstigenden Tag war Jennsen der Trost ihrer Mutter höchst willkommen; schließlich schob ihre Mutter sie Richtung Tür.
»Komm rein und sieh zu, dass du wieder trocken wirst. Wie ich sehe, hast du einen ordentlichen Fang mitgebracht. Wir werden uns ein schönes Abendessen zubereiten, dann kannst du mir erzählen …«
Jennsen ließ sich nur widerstrebend darauf ein. »Mutter, ich habe jemanden mitgebracht.«
Ihre Mutter blieb wie angewurzelt stehen und sah ihre Tochter verärgert an. »Was soll das heißen? Wen könntest du denn mitgebracht haben?«
Jennsen wies mit einer flüchtigen Handbewegung hinter sich zum Pfad. »Ich habe ihm gesagt, er soll dort unten warten, und ihm erklärt, dich fragen zu wollen, ob er in der Höhle bei den Tieren schlafen kann …«
»Er soll hier übernachten? Was hast du dir nur dabei gedacht, Jenn?«
»Mutter, bitte, hör mir doch erst einmal zu. Heute ist etwas Schreckliches passiert. Sebastian …«
»Sebastian?«
Jennsen nickte. »Der Mann, den ich mitgebracht habe. Sebastian hat mir geholfen. Ich war auf einen Soldaten gestoßen, der vom Pfad abgestürzt war - vom Pfad oben um den See.«
Ihre Mutter wurde aschfahl im Gesicht, schwieg jedoch.
Jennsen atmete tief durch, um sich zu beruhigen, dann fing sie noch einmal von vorne an. »In der Schlucht unterhalb des weiter oben gelegenen Pfades fand ich einen toten d’Haranischen Soldaten. Andere Spuren gab es nicht - ich hab mich umgesehen. Der Soldat war außerordentlich groß und schwer bewaffnet.«
Ihre Mutter legte den Kopf zur Seite, einen vorwurfsvollen Ausdruck im Gesicht. »Was verschweigst du mir, Jenn?«
Jennsen hatte damit eigentlich warten wollen, bis sie Sebastians Anwesenheit erklärt hatte, aber ihre Mutter sah es ihr an den Augen an, hörte es aus ihrer Stimme heraus. Das kleine Stück Papier in ihrer Tasche schien seine Existenz, seine entsetzliche Bedrohlichkeit geradezu herauszuschreien.
»Bitte, Mutter, lass es mich mit meinen eigenen Worten erzählen.«
Ihre Mutter legte ihr eine Hand an die Wange. »Also gut, erzähl es mir. Wenn es sein muss, mit deinen eigenen Worten.«
»Ich war gerade dabei, den Soldaten zu durchsuchen, nach irgendetwas, das vielleicht wichtig hätte sein können. Und ich fand sogar etwas. Aber dann hat mich ganz zufällig dieser Mann gesehen, ein Reisender. Tut mir Leid, Mutter, aber ich war so verängstigt wegen des Soldaten, der dort lag, und wegen dieses Zettels, den ich gefunden hatte, dass ich nicht so aufmerksam war, wie ich es hätte sein sollen.«
Ihre Mutter lächelte. »Nein, meine Kleine, kein Mensch ist gegen ein Versehen gefeit, denn keiner von uns ist vollkommen, wir alle machen Fehler.«
»Na ja, jedenfalls kam ich mir ziemlich dumm vor, als er mich ansprach, und ich mich umdrehte und er plötzlich einfach vor mir stand. Aber wenigstens hatte ich mein Messer gezogen.« Ihre Mutter nickte und lächelte dabei anerkennend. »Dann sah auch er, dass der Mann zu Tode gestürzt war. Sebastian meinte, wenn wir ihn einfach dort liegen ließen, müsste man damit rechnen, dass andere Soldaten ihn finden und auf die Idee kommen, uns alle zu verhören, um uns am Ende gar die Schuld am Tod ihres Kameraden zu geben.«
»Dieser Mann, dieser Sebastian, scheint zu wissen, wovon er spricht.«
»Das fand ich auch. Ich hatte den toten Soldaten eigentlich zudecken und irgendwo verstecken wollen, aber er war ein Hüne - allein hätte ich ihn niemals von der Stelle bewegen können. Gemeinsam ist es uns dann gelungen, ihn wegzuschleifen und in eine tiefe Felsspalte zu wälzen. Kein Mensch wird ihn finden.«
Ihre Mutter wirkte etwas erleichterter. »Das war klug.«
»Vor dem Verscharren meinte Sebastian noch, wir sollten ihm sämtliche Wertgegenstände abnehmen, statt sie in der Erde vermodern zu lassen.«
Eine Braue schoss in die Höhe. »Ach ja, hat er das?«
Jennsen nickte. Sie nahm das Geld aus ihrer Tasche und drückte ihrer Mutter die gesamte Summe in die Hand.
»Sebastian bestand darauf, dass ich alles nehme. Es sind Goldmünzen darunter. Er selber wollte nichts davon.«
Ihre Mutter betrachtete das Vermögen in ihrer Hand, dann blickte sie kurz hinüber zu dem Pfad, wo Sebastian wartete. Sie beugte sich weiter vor.
»Wenn er dich begleitet hat, Jenn, dann glaubt er womöglich, dass er sich das Geld jederzeit zurückholen kann. Er könnte sich großzügig geben, um dein Vertrauen zu gewinnen.«
»Darüber habe ich auch schon nachgedacht.«
Der Tonfall ihrer Mutter wurde milder und verständnisvoller. »Du kannst nichts dafür, Jenn - ich habe dich immer so behütet -, aber du weißt eben nicht, zu was Männer fähig sind.«
Jennsen wich den wissenden Augen ihrer Mutter aus und senkte den Blick. »Das mag vielleicht stimmen, aber eigentlich glaube ich es nicht.«
»Und warum nicht?«
Jennsen sah wieder auf, entschiedener diesmal. »Er hat Fieber, Mutter. Es geht ihm nicht gut. Er wollte schon gehen, ohne mich überhaupt zu fragen, ob er mich begleiten darf. Und er hatte sich längst von mir verabschiedet. Ich rief ihn zurück und erklärte ihm, wenn du einverstanden wärst, könne er in der Höhle bei den Tieren schlafen, wo er es wenigstens warm und trocken hätte.«
Nach einem Augenblick des Schweigens fügte Jennsen hinzu: »Er meinte noch, er hätte Verständnis dafür, wenn du keinen Fremden in der Nähe haben möchtest, und würde in dem Fall einfach seiner Wege gehen.«
»Das hat er tatsächlich gesagt? Nun, Jenn, dies bedeutet entweder, er ist sehr ehrlich oder überaus gerissen.« Sie sah Jennsen ernst in die Augen. »Was, glaubst du wohl, trifft zu, hm?«
Jennsen wirkte verlegen. »Ich weiß es nicht, Mutter, ehrlich nicht. Ich habe mir dieselben Fragen gestellt wie du, wirklich.«
Dann fiel es ihr wieder ein. »Er sagte, er wolle, dass du das hier bekommst, damit du dich vor keinem Fremden fürchten musst, der in der Nähe übernachtet.«
Jennsen nahm das Messer mitsamt Scheide und reichte es ihrer Mutter; der silberne Griff blinkte im matten, gelblichen Licht.
Einen verblüfften Ausdruck in den Augen, ergriff ihre Mutter es zögernd mit beiden Händen, während sie leise murmelte: »Gütige Seelen …«
»Ich weiß«, meinte Jennsen. »Als ich es sah, hätte ich vor Schreck fast laut aufgeschrien. Sebastian meinte, es sei eine sehr noble Waffe, viel zu nobel, um sie zu vergraben, deshalb wollte er, dass ich sie an mich nehme. Das Kurzschwert des Soldaten und die Axt hat er selbst behalten. Als ich ihm daraufhin erklärte, ich würde es dir schenken, meinte er, er hoffe, es werde dir helfen, dich sicher zu fühlen.«
Ihre Mutter schüttelte langsam den Kopf. »Dieses Ding wird mir ganz und gar nicht helfen, mich sicher zu fühlen - erst recht nicht, seit ich weiß, dass der Mann, der es bei sich trug, ganz in unserer Nähe war. Jenn, das Ganze gefällt mir nicht. Absolut nicht.«
»Sebastian ist krank, Mutter. Kann er nicht in der Höhle übernachten? Ich ließ durchblicken, dass er von uns mehr zu befürchten hat als wir von ihm.«
Ihre Mutter sah verschmitzt lächelnd auf. »Kluges Mädchen.« Sie wussten beide, dass sie als Gespann zusammenarbeiten mussten, wenn sie überleben wollten.
Daraufhin seufzte sie, als bedrücke sie das Wissen um all die Dinge, die ihre Tochter im Leben entbehren musste. Zärtlich strich sie Jennsen mit der Hand durchs Haar.
»Also gut, meine Kleine«, meinte sie schließlich, »heute Nacht werden wir ihn hier schlafen lassen.«
»Und ihm etwas zu essen geben. Ich hab ihm eine warme Mahlzeit für seine Hilfe versprochen.«
Das innige Lächeln ihrer Mutter wurde breiter. »Also gut, und eine Mahlzeit.«
Noch immer hielt sie das Messer in der Hand und betrachtete nachdenklich das fein ziselierte »R«. Jennsen vermochte sich nicht vorzustellen, welche grauenhaften Gedanken - und Erinnerungen - ihrer Mutter durch den Kopf gehen mussten, während sie schweigend das Wahrzeichen des Hauses Rahl betrachtete.
»Gütige Seelen«, meinte ihre Mutter noch einmal leise bei sich.
Jennsen schwieg, wusste sie doch nur zu gut, dass es ein hässlicher, ein schändlicher Gegenstand war.
»Mutter«, meinte Jennsen leise, nachdem diese den Griff sehr lange betrachtet hatte, »es ist fast dunkel. Darf ich jetzt Sebastian holen gehen und ihn zur Höhle bringen?«
Ihre Mutter schob die Klinge zurück in die Scheide, als wollte sie sich mit dieser Geste gleichzeitig einer endlosen Folge schmerzhafter Erinnerungen entledigen.
»Ja, vermutlich ist es besser, wenn du ihn jetzt holst. Bring ihn zur Höhle und zünde ihm ein Feuer an. Ich werde die Fische zubereiten und ihm ein paar Kräuter mitbringen, damit er trotz seines Fiebers schlafen kann. Bleib bei ihm, bis ich komme, und lass ihn nicht aus den Augen. Wir werden zusammen mit ihm dort draußen essen, denn im Haus will ich ihn nicht haben.«
Bevor ihre Mutter wieder ins Haus gehen konnte, hielt Jennsen sie mit einer sachten Berührung am Arm zurück, denn sie musste ihr ja noch etwas gestehen. Liebend gern hätte sie ihr diesen Kummer erspart, doch es führte kein Weg daran vorbei.
»Mutter«, sagte sie mit einer Stimme, kaum mehr als ein Flüstern, »wir werden dieses Haus aufgeben müssen.«
Ihre Mutter war entsetzt.
»Ich habe bei dem d’Haranischen Soldaten noch etwas gefunden.«
Jennsen zog das Stück Papier aus der Tasche, faltete es auseinander und zeigte es ihr.
Ihre Mutter erfasste die beiden Worte auf dem Papier mit einem Blick.
»Gütige Seelen …«, war alles, was sie sagte.
Sie wandte sich um und schaute, alles in sich aufnehmend, zum Haus hinüber, als ihr plötzlich die Tränen in die Augen traten. Jennsen wusste, dass auch ihre Mutter es mittlerweile als ihr Zuhause betrachtete.
»Gütige Seelen«, wiederholte ihre Mutter leise bei sich, um jedes weitere Wort verlegen.
Jennsen brach es fast das Herz, ihre Mutter solche Seelenqualen erleiden zu sehen. Was immer Jennsen im Leben hatte missen müssen - ihre Mutter hatte es doppelt entbehrt, einmal für sich selbst, und einmal für ihre Tochter. Und zu allem Überfluss hatte sie dabei auch noch stark sein müssen.
»Wir brechen gleich im Morgengrauen auf«, entschied ihre Mutter schlicht. »Ein Fußmarsch nachts und bei Regen würde uns nicht weiterhelfen. Wir werden uns ein neues Versteck suchen müssen. Diesem ist er bereits zu nahe gekommen.«
Mittlerweile standen auch Jennsen die Tränen in den Augen, und das Sprechen fiel ihr mehr als schwer. »Es tut mir unendlich Leid, Mama, dass ich dir so viel Kummer mache.« Dann kamen ihr die Tränen in einer quälenden, unaufhaltsamen Flut. Ihre Hände zu Fäusten ballend, zerknüllte sie das Stück Papier.
Daraufhin schloss ihre Mutter sie in die Arme. »Ach, Unsinn, meine Kleine. So etwas darfst du niemals sagen. Du bist mein Licht, mein Leben. An meinem Kummer sind ganz andere schuld. Du darfst dich niemals hinter Schuldgefühlen verstecken, nur weil diese Menschen böse sind. Du bist das Wunderbarste in meinem Leben, für dich würde ich alles andere tausendmal und mehr aufgeben, und das mit Freuden.«
Schließlich löste sie sich aus der Umarmung ihrer Mutter. »Mama, Sebastian kommt von sehr weit her, hat er mir erzählt. Er sagte, er stamme aus einem Land jenseits von D’Hara. Es gibt also noch andere Orte - andere Länder. Er kennt sie; ist das nicht wunderbar? Es gibt einen Ort, der nicht zu D’Hara gehört.«
»Aber diese Länder liegen jenseits unüberwindbarer Grenzen.«
»Wie kommt es dann, dass er hier ist?«
»Und Sebastian stammt tatsächlich aus einem dieser anderen Länder?«
»Unten im Süden, hat er gesagt.«
»Im Süden?«
»Ja.« Jennsen bekräftigte ihre Antwort mit einem entschiedenen Nicken. »Er erwähnte es ganz beiläufig. Vielleicht könnte er uns den Weg dorthin zeigen, Mutter. Wenn wir ihn darum bitten, führt er uns vielleicht aus diesem schlimmen Land hier hinaus.«
Jennsen konnte sehen, dass ihre sonst so vernünftige Mutter sich diese abwegige Idee durch den Kopf gehen ließ. Verrückt war der Gedanke jedenfalls nicht - ihre Mutter dachte darüber nach, also konnte er gar nicht verrückt sein. Plötzlich war Jennsen von dem Gefühl der Hoffnung erfüllt, ihr könnte vielleicht etwas eingefallen sein, das sie am Ende retten würde.
»Warum sollte er das für uns tun?«
»Ich weiß es nicht. Auch weiß ich nicht einmal, ob er es überhaupt in Erwägung ziehen oder was er dafür verlangen würde, danach habe ich ihn gar nicht gefragt. Ich habe mich nicht mal getraut, es überhaupt zu erwähnen, bevor ich nicht mit dir gesprochen hatte. Deswegen wollte ich zum Teil ja auch, dass er hier bleibt - damit du ihn aushorchen kannst.«
Ihre Mutter drehte sich abermals um und betrachtete das Haus. Es war winzig, bestand nur aus einem einzigen Raum und war - aus Stämmen und Brettern erbaut, die sie selbst zurechtgehauen hatten - wahrlich nichts Besonderes, aber es war warm, gemütlich und trocken. Die Vorstellung, mitten im tiefsten Winter von hier fortzugehen, war beängstigend. Aber die Alternative, ergriffen zu werden, war weitaus schlimmer.
Schließlich hatte sich ihre Mutter wieder gefasst und sagte: »Das war klug von dir, Jenn. Ich weiß nicht, ob die Idee zu etwas führen kann, aber wir werden mit Sebastian sprechen und dann weitersehen. Eins steht jedenfalls fest: Wir müssen von hier fort. Bis zum Frühjahr dürfen wir nicht warten - nicht, wenn sie uns schon so dicht auf den Fersen sind. Im Morgengrauen brechen wir auf.«
»Wo werden wir diesmal hingehen, Mutter, falls Sebastian uns nicht aus D’Hara hinausbringt?«
Ihre Mutter lächelte. »Die Welt ist groß, wir dagegen sind nur zwei unbedeutende Menschen. Wir werden uns einfach wieder einmal unsichtbar machen. Ich weiß, es ist schwer, aber wenigstens sind wir zusammen. Alles wird gut werden. Vielleicht werden wir ein wenig mehr von der Welt zu sehen bekommen, was meinst du? Und jetzt geh Sebastian holen und bringe ihn zur Höhle. Ich werde inzwischen mit dem Abendessen anfangen.«
Jennsen drückte ihrer Mutter noch schnell einen Kuss auf die Wange, dann lief sie den Pfad hinunter. Es hatte gerade angefangen zu regnen, und unter den Bäumen war es so finster, dass sie kaum etwas erkennen konnte. Die Bäume waren für sie allesamt d’Haranische Soldaten: mächtig, stark, bedrohlich. Sie wusste, sie würde Alpträume bekommen, sollte sie jemals einen echten d’Haranischen Soldaten aus der Nähe sehen.
Sebastian saß noch immer auf dem Felsen; als sie auf ihn zugerannt kam, erhob er sich.