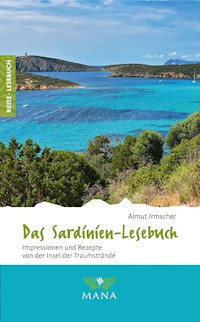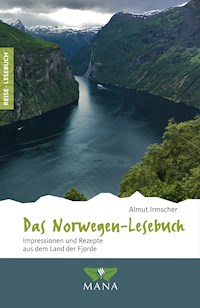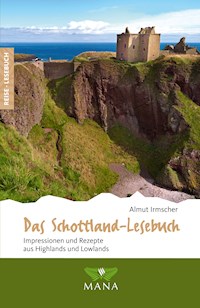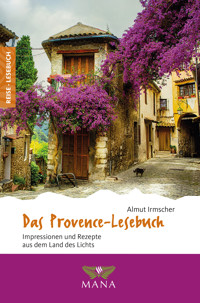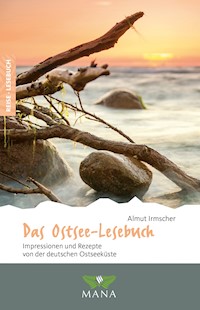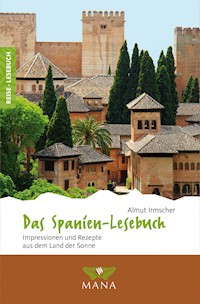Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MANA-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Reise-Lesebuch
- Sprache: Deutsch
Sanft gleitet eine Gondel durch den Kanal. Leise plätschert das grünlich leuchtende Wasser gegen die Mauern der Palazzi, deren Fassaden wie das Meisterstück eines Zuckerbäckers wirken. Mit sanftem Schwung neigt sich eine kleine Brücke über den schmalen Wasserweg, und gleich einer surrealen Erscheinung schreitet eine Gestalt in rauschendem Gewand darüber, das Gesicht hinter einer melancholischen Maske verborgen. Wir sind in Venedig, der verwunschenen Stadt, beseelt durch Träume und Märchen von Edelmännern, Prinzessinnen und tausendundeiner Nacht. Dieses Buch erzählt Geschichten aus Venedig. Von der Flucht in die Lagune bis zur Blüte der Seerepublik, von infamem Raub und immensem Reichtum, von grandioser Kunst und bezaubernder Schönheit, von schöpferischen Genies und von kleinen Gaunern. Der farbenfrohe Reigen unterhaltsamer Episoden wird durch die typischen Rezepte der Serenissima abgerundet. Kommen Sie mit auf eine Reise in die Lagune von Venedig!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Almut Irmscher
Das Venedig-Lesebuch
Impressionen und Rezepte aus der Lagunenstadt
Inhalt
Einführung
Auf Sand gebaut – vom Aufstieg einer Flüchtlingskolonie
Pincia – ein venezianischer Brotpudding
Wenn das Wasser bis zum Halse steht – Mose und die Fluten
Risotto con pollo – Reis mit Hühnchen
Eine Banane aus Holz – die Gondel
Triglie alla griglia – gegrillte Meeräschen
Vom Glücksboten zur Flugratte – die Tauben von Venedig
Peperonata con polenta – Paprikagemüse mit Polenta
Farbe, Licht und Schatten – die Meister der venezianischen Malerschule
Bellini – der Klassiker
Auf einen Drink bei Harry’s – zu Gast in einer legendären Bar
Carpaccio nach dem Rezept aus Harry’s Bar
Montgomery – Martini nach einem Rezept aus Harry’s Bar
Vier Pferde und ein orientalischer Palast – Geschichten vom Markusdom
Spaghettini gratinati al prosciuto – nach einem Nudelrezept aus Harry’s Bar
Buon mercato! – Eindrücke vom Rialtomarkt
Radicchio fritto – gebratener Radicchio
Auf der Flucht – der Getriebene von Venedig
Torta Venezia – Venezia-Torte
Verrückt nach Kunst und Künstlern – Peggy Guggenheim
Sarde in saòr – Sardinen in Sauce
Federn, Farbe, Flitterkram – die Meisterin der Masken
Castagnole fritte – Karnevalskrapfen auf venezianische Art
Der rote Priester – Antonio Vivaldi
Zuppa di carote con miele – Möhrensuppe mit Honig
Phönix, das Feuer und die Asche – das Gran Teatro La Fenice
Risi e bisi – Risotto mit Erbsen
Vom Traum zum Albtraum – Venedig und der Tourismus
Fegato alla veneziana – Kalbsleber auf venezianische Art
Gut gelaunt in der Lagune – ein Ausflug nach Burano
Bussolà Buranello – „Burano-Kringel“
Werther erschoss sich, aber Goethe blieb am Leben – vom Tod in Venedig
Bisàto al spèo – Aal am Spieß
Der verwunschene Garten – auf der Suche nach dem grünen Venedig
Crema fritta alla veneziana – ein venezianisches Dessert
Sic transit gloria mundi – Pesthauch über der Lagune
Melanzane a funghetto al forno – Auberginen aus dem Ofen, „zubereitet wie kleine Pilze“
In the Ghetto – die Juden von Venedig
Risotto nero con le seppie
Das Verwirrspiel der Maler – oder die Postkartenidylle von Venedig
Cicchetti – Venezianische Snacks
Engelchen, flieg! – Abschied nehmen, wenn es am schönsten ist
Chiacchiere di carnevale – ein Karnevals-Schmalzgebäck
Das letzte Wort
Danksagung
Karte und Fotos
Einführung
Dramatische Szenen spielen sich ab, als Indiana Jones in Begleitung einer blonden Archäologin von mordgierigen Gralshütern verfolgt wird. Wild peitschen die beiden auf ihrem Motorboot durch die Lagune, entkommen nur knapp einem grausamen Tod im Industriehafen, um dann endlich über einen Kanal in die Stadt einzufahren. Sie haben sich ihrer Feinde entledigt. Wo es eben noch so nervenaufreibend zuging, lenkt Indiana Jones nun sein Motorboot souverän vorbei an den vornehmen Fassaden der alten Palazzi. Ein märchenhafter Anblick, nicht minder atemberaubend als die Kampfszenen zuvor. Was mag ein junger Mensch dabei empfinden, der noch niemals in Venedig gewesen ist?
Mein Sohn ist elf Jahre alt, als wir zum ersten Mal gemeinsam nach Venedig reisen. Über den Ponte della Libertà – die „Brücke der Freiheit“ – sind wir hinaus zur Altstadt in der Lagune gefahren. Das ist die parallel zum Eisenbahndamm verlaufende, knapp vier Kilometer lange Straßenbrücke, die Venedig seit 1933 mit dem Festland verbindet. Sie führt uns zur Piazzale Roma, wo wir unser Auto in einem Parkhaus abstellen. Noch sind wir scheinbar Welten entfernt von jeglicher Venedig-Romantik. Weder die nüchterne Straßenbrücke noch das hektische Ambiente der Piazzale Roma, dominiert vom grottenhässlichen Kasten des Parkhauses, versprechen auch nur einen Anflug davon.
Wir eilen durch den brausenden Verkehr hinunter ans Wasser. Hier befindet sich eine Anlegestelle für Wassertaxis, und bereits im nächsten Moment sind wir an Bord. Der Fahrer wirft den Motor an, schon biegen wir in den Canal Grande ein, und weiter geht es durch einen Seitenkanal mitten hinein ins historische Herz der Lagunenstadt. Von einem Augenblick zum anderen gelangen wir in eine völlig andere Welt.
Ich sehe hinüber zu meinem Sprössling, der hinter dem Fahrer steht und mit weit geöffneten Augen umherschaut. In seinem Blick spiegelt sich jene fassungslose Faszination, die wohl nur empfinden kann, wer zum ersten Mal nach Venedig kommt. Wer zum ersten Mal mit eigenen Augen sieht, dass diese überwältigende Schönheit tatsächlich real existiert. Vor allem natürlich, wenn man ein kleiner Junge ist, der für Helden wie Indiana Jones schwärmt. Denn für die Dauer dieser Einfahrt im Wassertaxi ist er nichts Geringeres als Indiana Jones persönlich. Für ein paar Atemzüge ist der Film für ihn zur Wirklichkeit geworden, und er selbst ist mittendrin. Welche Kulisse hat die Kraft, solch eine außerordentlich starke Illusion zu bewirken? Wo auf der Welt sind Traum und Tatsächlichkeit so untrennbar miteinander verwoben wie hier in Venedig?
Das ist der Grund, weshalb Venedig die Liste der begehrtesten Reiseziele unserer Erde mit Abstand anführt. Wo Hong Kong in der Statistik der meistbesuchten Weltstädte mit knapp 28 Millionen Gästen vorne liegt, stellt das kleine Venedig die chinesische Sieben-Millionen-Metropole mit mehr als 30 Millionen jährlichen Besuchern ins Abseits. Eine sagenhafte Zahl, wenn man bedenkt, dass die Hauptstadt der Region Venetien zwar rund 260.000 Einwohner hat, davon aber inzwischen weniger als 52.000 in den historischen Vierteln des kanaldurchzogenen Zentrums in der Lagune wohnen. Rein statistisch heißt das, dass dort auf jeden Venezianer alljährlich sage und schreibe 577 Touristen kommen. Auch wenn die meisten davon nur Tagesgäste sind, schockiert diese Zahl. Und den Folgen des gewaltigen Ansturms muss man schonungslos ins Gesicht sehen, wenn man sich mit Venedig befasst.
Doch davon weiß mein Kleiner nichts, als wir an diesem kühlen, aber sonnigen Apriltag durch Venedigs Kanäle cruisen und schließlich am Markusplatz aussteigen. Der legendäre Platz quillt über vor Menschen. Allein der Versuch, in den Markusdom hineinzugelangen oder etwa auf den Markusturm hinaufzufahren und von oben den Rundblick über Venedig zu bestaunen, scheint angesichts der immensen Warteschlangen völlig aussichtslos. Wir machen auch nicht den Fehler, uns auf der Außenterrasse eines der Cafés auf dem Markusplatz niederzulassen, um eine Erfrischung zu uns zu nehmen. Die Preise sind schwindelerregend, und ob die Investition angesichts des allgemeinen Gewusels lohnend ist, scheint fraglich. Mitten in diesem exorbitanten Gedränge ist wohl kaum daran zu denken, die einzigartige Atmosphäre zu genießen.
Wir begeben uns lieber auf einen Streifzug durch die Gassen, entlang des unüberschaubaren Gewirrs der Kanäle, über zahllose Brücken, vorbei an kleinen Läden und Werkstätten. Je weiter wir uns von den üblichen Wegen der Touristen entfernen, desto mehr schenkt uns die würdevolle alte Dame von ihrem unvergleichlichen Charme. Sie ist die Serenissima, „die Durchlauchtigste“. Das ist der Beiname, den die Venezianer ihrer prachtvollen Stadt geschenkt haben, und die Palazzi, die stillen Kanäle, die schmucken Kirchen und grazilen Brücken erzählen von der Herrlichkeit vergangener Größe, als die Seerepublik Venedig noch weite Teile des Mittelmeerraums beherrschte.
Jetzt hat sich ein morbider Hauch über die Stadt gelegt, eine träumerische Melancholie, die dem grünlich schimmernden Wasser der Kanäle entsteigt und mit kühlem Odem nach den Mauern und Grundfesten der Palazzi greift. Eine stolze Schwermut scheint heimliche Herrscherin über die Stadt zu sein. Sie umschlingt mit ihrem feuchten Schimmer die Gemäuer, als wäre ganz Venedig nur kurz dem Totenreich entstiegen, dessen Nebel es im nächsten Augenblick schon wieder verschlingen mögen. Die allgegenwärtige Nähe eines unausweichlichen Endes scheint es zu sein, die Venedig seine ganz besondere Magie verleiht. Und sie dominiert selbst da, wo die Stadt am fröhlichsten ist: im Karneval. Über den fantastischen Larven und großartigen Maskeraden schwebt stets auch ein Fluidum von Traurigkeit. In allem Glanz ist doch auch schon sein baldiger Abgesang enthalten, die Vergänglichkeit ist Venedigs ständige Gegenwart.
Welch ein Gegensatz zu dieser malerischen Tristesse ist der quirlige Alltag in den lebendigen Gassen. Die Souvenirläden und -stände quellen über vor kunterbuntem Kitsch, vor billigen Andenken aus Muranoglas, Masken aus Massenproduktionen, vor T-Shirts, Taschen und Kühlschrankmagneten zu Abermillionen, um ein paar schnelle Euro von den vorbeiströmenden Touristen zu ergattern. Belebtes Treiben in den ungezählten Ristorantes und auf den Plätzen, ein nicht endendes Gewimmel auf den Kanälen, wo Gondeln mit Touristen wie Perlen an der Kette dahintreiben. Die Gäste aus aller Welt genießen dort ihren eigenen Augenblick der Seligkeit, eine Fahrt mit der Gondel, höchster Gipfel ihres venezianischen Traums. Was spielt es für eine Rolle, dass sie 100 Euro, 180 oder mehr dafür berappen müssen. Hat denn das Glück einen Preis?
Wir landen schließlich in einer abgelegenen kleinen Pizzeria, in der eine fröhliche Schar junger Männer zu lautstarkem Hip-Hop gewöhnungsbedürftige Delikatessen wie Pizza mit Pommes Frites serviert. Die ausgelassene Stimmung ist dabei so ansteckend, dass unsere Zweifel im Nu wie weggewischt sind, und wir entdecken eine ganz andere Seite von Venedig, jung, unkonventionell und gut gelaunt.
Im Laufe meines Lebens habe ich viele verschiedene Aspekte dieser Stadt kennengelernt. In den frühen Siebzigerjahren kam ich erstmals mit meinen Eltern hierher. Auch damals gab es bereits recht viele Besucher, doch natürlich war ihre Zahl nicht im Entferntesten mit der heutigen vergleichbar. Auf dem Markusplatz verkauften fliegende Händler Maiskörner, denn die Reisenden hatten als ihr Lieblingsmotiv die Tauben auserkoren, die sich zu jener Zeit dort tummelten – scheinbar waren es Millionen davon. Ein paar Maiskörner auf die Handfläche gegeben, schon war man rings umschwirrt und konnte einen quirligen Moment vor dem Markusdom fotografisch verewigen. Bei diesem Anblick würden später die Daheimgebliebenen bestimmt ganz blass vor Neid!
Doch irgendwann erkannte die Stadtverwaltung, dass es so nicht weitergehen konnte. Die Exkremente der unzähligen Vögel fügten Venedigs Baudenkmälern womöglich schwere Schäden zu! Deshalb bekämpfte man die Tiere durch Entzug der Futterquelle, und heute sind es tatsächlich nur noch wenige, die diesen Feldzug überdauert haben. Die fliegenden Futterhändler sind mit ihnen verschwunden, und nur vereinzelte illegale Einwanderer versuchen, ahnungslose Touristen mit ein bisschen Mais gegen einen Obolus in die Fotofalle zu locken. Denn natürlich ist das strengstens verboten, wehe dem, der sich erwischen lässt.
Schon in den Neunzigerjahren wichen die vielen Tauben mehr und mehr den Menschen, die in immer größer werdenden Massen in die Lagunenstadt einfielen. Um dem Trubel zu entgehen, wählte ich damals einmal die Abendstunden eines lauen Sommertages für eine Stippvisite. Unvergesslich sind mir die in goldenes Licht getauchten verwinkelten Gassen, über denen eine fast schon unheimliche Stille lag. Für die Rückfahrt wählte ich ein Wassertaxi, mit dem ich über den nächtlichen Canal Grande brauste. Erhaben blickten die stolzen Palazzi hinab auf das dunkle Wasser, in dem sich der Glanz der hell erleuchteten Fenster spiegelte. Einzelne Gondeln und Vaporetti – die öffentlichen Wasserbusse von Venedig – säumten den Weg der rasanten Fahrt, einer fast unwirklichen Reise durch ein verzaubertes Märchenland.
Um solch eindringliche Momente auch im hochfrequentierten Venedig unserer Tage noch genießen zu können, komme ich am liebsten im Winter hierher. An einem regnerischen Morgen kann es dann passieren, dass man sich sogar auf dem Markusplatz fast allein wiederfindet. Kein massiver Besucherandrang verhindert den Eintritt in den Dogenpalast, und zügig bringt mich der Fahrstuhl auf den Markusturm, von dem aus ich die weite, menschenleere Fläche des Platzes überblicke, das sich sanft wellende Wasser der Lagune bis hinüber zur Insel San Giorgio Maggiore, die Arkadengänge der Paläste und das rot-bunte Gefüge der Dächer der Stadt.
An einem anderen Morgen führt mich ein Spaziergang durch die Gassen, die noch im Dornröschenschlaf zu liegen scheinen. Erst allmählich öffnen die Läden ihre Pforten, stellen Kellner Tafeln mit Menü-Angeboten vor die Türen der Restaurants, dringen vereinzelte ostasiatische Reisegruppen auf die kleinen Plätze vor. Etwas weiter, in den Wohnstraßen abseits der Besucherwege, führen alte Frauen ihre Hunde Gassi, spielen kleine Jungs im Hinterhof Fußball, hängen bunte Bettlaken zum Trocknen quer über einem schmalen Kanal.
Jäh endet mein Weg unter einem Bogengang. Zwei glitschige Stufen führen hinab ins eisig-grüne Wasser, das träge an den Steinen leckt. Wer hier nicht achtgibt, verläuft sich schnell im Labyrinth der Gassen, und ehe man sich’s versieht, steht man vor dem unüberwindbaren Nass. In Venedig herrscht das Wasser, alle Wege enden früher oder später unwillkürlich hier, und wer zu Fuß unterwegs ist, hat das Nachsehen. Was mag die Menschen einst dazu bewogen haben, sich ausgerechnet an diesem unwirtlichen Ort niederzulassen?
Bevor wir die Antwort auf diese Frage suchen und uns auf den Weg machen, um die Lagunenstadt gemeinsam zu entdecken, möchte ich Sie noch auf die zahlreichen Fotos aus Venedig hinweisen, die auf meiner Website www.almutirmscher.de die Eindrücke aus diesem Buch visuell begleiten.
Benvenuti a Venezia – willkommen in Venedig!
Auf Sand gebaut – vom Aufstieg einer Flüchtlingskolonie
Die Stunde des mächtigen Imperium Romanum hatte geschlagen. Geschwächt durch innere Machtkämpfe, durch Pandemien und durch ausufernde Dekadenz siechte die Weltmacht vor sich hin. Und die Feinde des riesigen Reichs schliefen keineswegs. Ganz im Gegenteil, sie beobachteten mit Argusaugen die Grenzen und lagen dort ständig auf der Lauer. Überall keimten Unruhen auf.
Doch es sollte noch schlimmer kommen. Nordöstlich vom Römischen Reich, wo das germanische Volk der Goten lebte, war die Bevölkerungszahl in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Es gab immer mehr hungrige Mäuler zu stopfen, aber die bestellbare Landfläche vergrößerte sich nicht. Dazu kam eine anhaltende Schlechtwetterphase, in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren verfaulte das Getreide unter dem Dauerregen. Im Land der Goten erreichte die Nahrungsknappheit einen kritischen Punkt.
So kam es, dass sich immer öfter Rotten hungriger Gotenburschen zusammentaten und zu Raubzügen in Richtung Südwesten aufbrachen. Das wäre alles noch nicht so schlimm gewesen, denn die Männer zogen sich danach meist wieder in ihre Heimatregionen zurück. Doch mit einem Mal wurde aus dem fernen Osten weiterer Druck auf die Goten ausgeübt. Denn aus den weiten Steppen der Mongolei drangen kriegerische Hunnen wild entschlossen nach Westen vor. Sie befanden sich ihrerseits auf der Flucht vor den übermächtigen Chinesen. Das setzte eine Kettenreaktion allgemeiner Flucht in Gang, die wir heute als Völkerwanderung bezeichnen.
Einer der von diesem Schlamassel betroffenen Germanen war Alarich, der legendäre Anführer der Westgoten. Sein Stamm hatte auf der Flucht vor den Hunnen an der Donau im heutigen Rumänien Asyl gefunden. Hier arrangierten die Goten sich mit den herrschenden Römern. Für eine Weile stand der junge Alarich als Befehlshaber eines Söldnerheers in deren Diensten.
Just zu dieser Zeit, es war das Jahr 395, wurde das Römische Reich in eine östliche und eine westliche Hälfte aufgeteilt. An der Donau kam es zu einem Kompetenzgerangel, zu Machtstreitigkeiten, offenen Rivalitäten und schließlich zur Meuterei. Als im Zuge dessen der Sold nicht mehr ausgezahlt wurde, stellte sich Alarich mit seinen Männern gegen Rom. War es ihm zunächst um nichts anderes als um eine gerechte Entlohnung für seine Leute gegangen, so sollte sich der Feldzug des Alarich zu einem fatalen Schlag für das ganze Imperium entwickeln. Schließlich plünderten und verwüsteten die Goten unter Alarich im August 410 sogar Rom selbst, ein schicksalhaftes Desaster, von dem sich die Hauptstadt nie mehr ganz erholen sollte.
Doch die Offensive des Alarich zog noch weitere Auswirkungen nach sich. Kampfentschlossen waren seine Truppen auf die Hauptstadt zugezogen, und für die Landstriche, welche sie dabei durchquerten, blieb das nicht ohne Folgen. Denn der Zorn der Goten hatte sich im Lauf der Jahre, in denen sie erfolglos um Gerechtigkeit rangen, zu blanker Wut gesteigert. Entsprechend rücksichtslos agierten sie nun, wo immer sie in Erscheinung traten. Sie plünderten und brandschatzten, vergewaltigten und mordeten erbarmungslos. Wenn die Goten anrückten, hieß es: Rette sich, wer kann!
In der weiten, fruchtbaren Po-Ebene südlich der Alpen lebte das Volk der Veneter. Als die Goten auf ihrem Weg nach Süden ins Land einfielen, flohen viele Veneter in ihrer Verzweiflung hinaus aufs Meer. Hier mündete nördlich des Po-Deltas der kleine Fluss Brenta ins Adriatische Meer, und im Laufe vieler Jahrtausende war durch seine Ablagerungen in der Bucht eine ausgedehnte, flache Lagune entstanden. Vereinzelte Inseln und Sandbänke ragten aus dem Wasser empor, dort siedelten schon seit Menschengedenken ein paar arme Fischerfamilien.
Dauerfeuchte Sümpfe beherrschten diese Gegend, und Myriaden von Mücken machten den Leuten das Leben zur Hölle. Denn die Mückenstiche waren nicht nur ausgesprochen lästig, sie trugen den Gepeinigten auch noch folgenschwere Malariainfektionen ein. Nur die äußerste Not konnte einen Menschen deshalb dazu zwingen, in dieser versumpften Lagune zu leben: quälende Armut – oder die Flucht vor den Goten.
Als der gotische Kelch schließlich vorbeigezogen war, verließen die meisten der Flüchtlinge den malariaverseuchten Sumpf und kehrten in ihre Dörfer zurück. Doch der Schrecken war keineswegs vorüber. Denn nach den Goten kamen die Hunnen, und hatten die Goten schon Angst und Schrecken verbreitet, so hausten die Hunnen erst recht wie die Berserker. Unter ihrem Führer Attila zogen sie 452 durch Norditalien in Richtung Rom und hinterließen dabei eine Spur der Verwüstung. Wer jetzt noch immer auf ruhigere Zeiten hoffte, den belehrten nur zwei Jahre später die Vandalen eines Besseren. Auch dieses ostgermanische Volk zog in Richtung Rom, um zu plündern. Und im darauffolgenden Jahrhundert waren es die Langobarden, die keine Ruhe gaben. Frieden, Schutz und Rechtsstaatlichkeit lagen in der Po-Ebene vorerst in weiter Ferne. So galt es für ihre Bewohner schließlich, abzuwägen. Wollte man in ständiger Todesangst leben, oder nahm man lieber die Mückenschwärme in der Lagune vor der Mündung des Flusses Brenta in Kauf?
Es gibt keinen Stichtag für die Gründung der Stadt Venedig, auch wenn gerne der 25. April 421, der Tag des heiligen Markus, dafür herangezogen wird. Fakt ist, dass im Laufe des 5. und 6. Jahrhunderts immer mehr Flüchtlinge in der Lagune siedelten. Die meisten waren Angehörige des Volks der Veneter, was der neuen Stadt zu ihrem Namen verhalf. Sie hausten zunächst auf den kleinen Inseln. Doch schnell litten sie dort unter den ständigen Überflutungen, außerdem an der zunehmenden Knappheit des Raums. Um dauerhaft hier wohnen zu können, musste eine praktikable Lösung her!
Da verfiel man auf einen Gedanken, der schon den Urahnen in grauer Vorzeit vertraut gewesen war. Zwischen dem fünften und dem ersten vorchristlichen Jahrtausend hatten die Menschen vielerorts in Europa, besonders aber im Alpenraum, ihre Behausungen auf Pfählen errichtet, die sie ins Wasser trieben. Denn das Wasser bietet hochwillkommenen Schutz vor menschlichen Angreifern und vor wilden Tieren.
Die Venezianer besorgten sich also die Stämme von Ulmen, Eichen, Erlen, Pappeln und Lärchen. Diese rammten sie in den Untergrund der Laguneninseln, um ihre Siedlungen zu stabilisieren und zu erweitern. Der Boden unter dem Wasserniveau bestand aus einem sandigen Schlamm, nicht gerade das ideale Fundament für eine aufstrebende Stadt. Doch die findigen Venezianer stellten schon sehr bald fest, dass sie die Stämme nur tief genug hineintreiben mussten. Denn unter der Schlammschicht stießen sie auf einen weitaus festeren Lehmboden.
Nun galt es, eine Bauweise zu entwickeln, die der Unbill dieser besonderen Lage dauerhaft zu trotzen vermochte. Das ständige Auf und Ab des Meeresspiegels, das die Gezeiten den Lagunenbewohnern bescherten, ließ den Wasserstand um 60 Zentimeter hin- und herschwanken. Bis schließlich in neuerer Zeit ein System zur Wasserregulation eingeführt werden würde, sollten noch viele Jahrhunderte vergehen. Auch immer neue Anschwemmungen durch die Brenta – deren Hauptausläufer noch heute als Canal Grande (nicht „Canale“, wie es oft fälschlich heißt) durch Venedig fließt – sowie andauernde Überschwemmungen und Unterspülungen machten das Bauen nicht gerade zu einem einfachen Unterfangen.
Deshalb erhielten die Gebäude auf ihrer rückwärtigen Seite zunächst Fundamente, die aus mehreren parallel zum Kanalverlauf errichteten Ziegelmauern bestehen. Diese Mauern sind 80 Zentimeter tief in den Untergrund hineingebaut. Entlang der Stützmauern führen die als „Fondamenta“ bezeichneten Straßen, die auf der Rückseite der Häuser dem Verlauf des auf der Vorderseite entlangfließenden Kanals folgen. Auch die anderen Straßen der Stadt sind übrigens nach einem strengen System sortiert und tragen ihre Namen keinesfalls zufällig. Nur wenige dienen als Hauptverbindungsstraßen, sie heißen „Ruga“ oder „Salizada“. Die engen Gassen heißen „Calle“, die Geschäftsstraßen „Mercerie“ oder „Marzarie“. Entlang der Seitenkanäle führen die „Rive“. Daneben gibt es noch die „Lista“, einen kurzen, privaten Weg an wichtigen Palästen, den „Rio terà“, einen verlandeten Kanal, den „Ramo“, eine kurze Verbindung, und den „Sotoportego“, der unter den Häusern hindurchführt. Große Plätze heißen „Campo“, weil dort früher die Pferde weideten und Gemüse angebaut wurde, bei kleinen Plätzen reicht es nur zum „Campiello“. Mit der „Piazza“ ist der Markusplatz gemeint, und nur eine einzige Straße trägt den Namen „Strada“. Doch kehren wir zurück zum Hausbau.
Bevor das Gebäude nun in die Höhe wachsen konnte, wurden an der zum Kanal hin ausgerichteten zukünftigen Vorderseite kräftige Baumstämme bis in drei Meter Tiefe gerammt, immer im Abstand von einem halben Meter, wobei man die Zwischenräume mit Lehm befüllte. Die gesamte Grundbefestigung auf dieser Seite liegt unterhalb der Wasseroberfläche, denn so kann das Holz nicht faulen. Das Fundament ist daher äußerst solide und imstande, die Jahrhunderte zu überdauern.
Auf diesem Bollwerk wurden nun die Häuser errichtet, was ein komfortables und vor allem trockenes Leben in der Lagune ermöglichte. Um Gewicht zu sparen, entwickelten die Venezianer als Baumaterial hohle Tonziegel, denn die sind besonders leicht. So konnte man auch problemlos mehrere Stockwerke übereinandersetzen.
Die nächste Schwierigkeit musste nun im wahrsten Sinne des Wortes überbrückt werden. Denn es genügt ja nicht, im Trockenen zu wohnen, man möchte natürlich auch möglichst trockenen Fußes zu seinen Verwandten, Nachbarn, Freunden und Geschäftspartnern gelangen. Etwa 175 Kanäle mit einer Gesamtlänge von knapp 40 Kilometern durchziehen die Stadt. Zunächst begegnete man diesem Problem mit einfachen Holzbrücken, doch im Lauf der Jahrhunderte wurden sie durch stabile Steinkonstruktionen ersetzt. Davon gibt es heute stolze 398. Die meisten Brücken haben keine sonderlich große Spannweite. Damit man sie auch mit Pferd und Wagen überqueren konnte, wurden sie sehr flach angelegt. Der Hauptwasserweg Canal Grande blieb allerdings bis zum 13. Jahrhundert die meiste Zeit ein Hindernis, das ohne Boot nicht zu bewältigen war. Zwar gab es vermutlich schon früher zumindest zeitweise eine Pontonbrücke, doch erst dann entstand ein hölzerner Vorläufer der Rialtobrücke, deren Bau sich noch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts hinauszögern sollte. Sie steht am höchsten Punkt der Innenstadt, dem sie ihren Namen verdankt. Denn „Riva alta“ heißt nichts anderes als „hohes Ufer“. Das angrenzende Stadtviertel „Rialto“ ist dank seiner relativ hohen Inselchen vor Überschwemmungen besser geschützt als der Rest der Stadt. Deshalb entwickelte es sich ab dem 11. Jahrhundert zum bedeutendsten Handelsplatz der Stadt.
Nachdem nun die Frage, wie man in der nassen Lagune angenehm wohnen konnte, auf so clevere Art geklärt war, kristallisierten sich die Vorzüge der Lage immer deutlicher heraus. Sie bot Venedig nicht nur äußerst effektiven Schutz vor Angriffen vom Festland her. Über das Wasser – das Element der Venezianer – ließ sich dazu auch noch ganz vorzüglich Handel treiben.
Venedig war zunächst dem oströmischen Reich zugeschlagen worden, doch pochten die Venezianer schon bald vermehrt auf ihre Eigenständigkeit. Gleichzeitig nutzten sie aber unbeirrt die Vorteile, die ihnen die Protektion durch das mächtige Konstantinopel bot. Als die Herrschaftsverhältnisse im Mittelmeerraum in den folgenden Jahrhunderten immer wieder neu verhandelt wurden, verstanden sie es geschickt, die jeweilige Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen und ihre Unabhängigkeit zu festigen. Sie sicherten sich ein Monopol auf den Salzhandel, die Grundlage ihres wachsenden Wohlstands.
Ihren Landsleuten in der venezianischen Handelsniederlassung im ägyptischen Alexandria gelang es 828, die Markusreliquien zu entwenden. Die kostbaren Knochen wurden flugs in die Heimat geschafft, wo Markus nun zum Schutzpatron der Stadt avancierte. Die Anwesenheit der Gebeine dieses wichtigen Evangelisten verhalf Venedig zu einem rasanten Aufstieg als spirituelles Zentrum.
Und schon bald entpuppte sich die ehemalige Flüchtlingskolonie als Großmacht im Mittelmeer. Venedig erlangte die Kontrolle über die Adria und die Handelswege in Richtung Südosten genauso wie über den Brennerpass als wichtigste Handelsroute nach Norden. Die Stadt stieg in der Folge zum größten Finanzzentrum Europas auf. Ihre Handelsflotte zählte schließlich stolze 3.900 Schiffe.
Mit 150.000 Einwohnern erblühte Venedig im 14. Jahrhundert zur drittgrößten Metropole Europas. Seine Hoheitsansprüche sicherte neben zahlreichen Kolonien in der Adria, in der Ägäis und im Schwarzen Meer die mächtige venezianische Kriegsflotte. Das Holz für deren Schiffe wie auch für die Neubauten innerhalb der Stadt kam nun allerdings nicht mehr aus der direkten Umgebung auf dem Festland Venetiens. Diese war nämlich längst kahlgeschlagen, nun wich man auf die Wälder Dalmatiens aus.
Mit dem immer größeren Reichtum der Stadt und ihrer Bürger entstanden aus den vormals einfachen Häusern mehr und mehr prunkvolle Paläste. Das war jedoch nicht im Sinne des Erfinders, denn diese opulenten Bauwerke sind für das Fundament viel zu schwer. Man darf ja nicht vergessen, dass der Untergrund noch immer bloß aus Sand, Schlamm und Lehm besteht. Deshalb sinken die Bauten nun beständig Jahr für Jahr um einige Millimeter abwärts. Allein im vergangenen Jahrhundert summierte sich das zu beachtlichen 23 Zentimetern. Zahlreiche Erdgeschosse sind inzwischen schon durchfeuchtet oder gar überschwemmt.
Deshalb erhitzt spätestens seit dem letzten Jahrhundert eine dramatische Frage die Gemüter: Geht Venedig unter?
Pincia – ein venezianischer Brotpudding
Zutaten:
300 g fein gemahlene Polenta
180 g Mehl
100 g Butter
100 g Zucker
1 l Milch
100 g Rosinen
je 50 g Orangenat und Zitronat
100 g gehackte Walnüsse
100 g getrocknete Feigen (gewürfelt)
1 Tl Fenchelsamen
2 Äpfel
4 cl Grappa
Salz, Butter zum Einfetten
Puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung:
Die Milch in einen Topf geben und langsam erhitzen. Unter Rühren mit dem Schneebesen die Polenta einrieseln lassen. 250 ml Wasser hinzugießen. Die Butter in Stücke schneiden, hinzugeben und schmelzen lassen. Zucker, 1 Tl Salz und zuletzt das Mehl in den Brei einrühren. 5 Minuten unter ständigem Rühren weiter erhitzen, wobei die Masse heiß sein soll, aber nicht aufkochen darf. Anschließend vom Herd nehmen. Die Äpfel schälen, entkernen und dann grob reiben. Zusammen mit allen restlichen Zutaten unter den Brei mengen und gut verrühren.
Eine verschließbare Puddingform mit Butter einfetten und die Masse hineingeben. In einem großen Topf Wasser aufkochen und die Puddingform hineinstellen. Die Hitze soweit reduzieren, dass das Wasser nur noch leise köchelt, und den Pudding 3 Stunden lang darin ziehen lassen. Dann herausnehmen und den Pudding aus der Form auf eine Platte stürzen. Ganz abkühlen lassen, mit Puderzucker bestäuben und servieren.
Wenn das Wasser bis zum Halse steht – Mose und die Fluten
Schon seit Tagen hat es geregnet. Wintergrau und schwer hängen die Wolken über Venedig, träge treibt der Wind sie vom Meer her landeinwärts. Wieder einmal werde ich nicht umhinkommen, auf meinem Spaziergang einen Schirm mitzunehmen.
Gerade, als ich im Erdgeschoss des Palazzo ankomme, in dem ich ein Zimmer gemietet habe, ertönen Sirenen. Was hat das zu bedeuten? Feueralarm? Das Heulen der Sirenen scheint von allen Seiten zu kommen, stehen wir am Abgrund einer großen Katastrophe? Verstört blicke ich mich um.
Da entdecke ich Todaro, meinen Vermieter. Er ist damit beschäftigt, das Erdgeschoss des Hauses zu renovieren, überall steht das Material herum, Zementsäcke, Schubkarren, Eimer und Leitern. Auch jetzt macht sich der ältere Herr unbeirrt in einer Ecke zu schaffen, wo er die Spalten zwischen den Marmorplatten verfugt. „Todaro, hörst du das nicht?“, schreie ich gegen das Getöse der Sirenen an. „Alarm! Was bedeutet das?“
Irritiert schaut Todaro von seiner Arbeit auf. Dann schüttelt er sein weißes Haar, richtet sich auf und klopft den Staub von seinem Arbeitsoverall. „Ach, das kennst du ja nicht,“ sagt er scheinbar mehr zu sich selbst, doch dann sieht er mich an, setzt ein zuversichtliches Grinsen auf und hebt die Stimme. „Es ist mal wieder so weit. Acqua alta, Hochwasseralarm. Das haben wir im Winter hier regelmäßig. Kein Grund zur Sorge!“ Wie zur Bestätigung seiner Worte sind die Sirenen inzwischen verstummt.