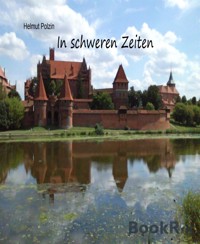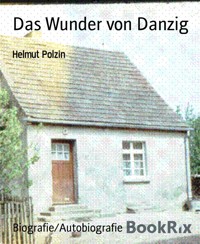
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Hauptteil:
1. Die Flucht wird von zwei damals 13 – und 14 jährigen Jungen hautnah geschildert.
2. Reise nach Pommern
3.Sein letztes Tagebuch
4.Vertonte Gedichte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Wunder von Danzig
Hiermit möchte ich dazu beitragen, dass nicht in Vergessenheit geraten darf, wie so ein Krieg gerade bei den Kindern seelische Wunden hinterlassen kann. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenNun spielen andre Kinder hier
Die ersten Jahre bis zur Konfirmation
Unsere Kindheit wurde stark geprägt durch die Kriegsereignisse. Unser Vater wurde zum Beginn des Krieges zum Militär eingezogen - ins Pionierbatalion, wie es damals hieß. Nach einigen Wochen durfte er aber wieder nach Hause kommen, weil er in einem „lebenswichtigen Betrieb“ arbeitete. So hatten wir ihn wieder bis zum Ende des Krieges, als er abermals einberufen wurde. Wir, das waren unsere Mama, unsere Oma mütterlicherseits, meine Schwester Margot, mein Bruder Karl und ich, die zurückblieben und sich auf die Flucht mit Pferd und Wagen vorbereiten mussten. Das heißt: Ich selbst war zur Zeit der Einberufung unseres Vaters noch im Internat in Köslin und wurde postwendend nach Hause geholt, vielleicht weil unsere Mama in der schweren Zeit wenigstens ihre Kinder alle um sich haben wollte.
Hungern mussten wir nicht während des Krieges, da wir Selbstversorger waren; aber die Angst vor dem Ungewissen war doch immer im Bauch.
Am 12.8.1930 kam ich auf die Welt. Meine Wiege stand – wie auch die meines Bruders Karl - in dem kleinen pommerschen Dörfchen Tangen in einer kleinen Kate mit Strohdach. Meine Großeltern väterlicherseits wohnten in diesem Hause, bis sie auch in unser Dorf nach Großtuchen zogen. Ein Bruchstück von Erinnerung aus dieser Zeit, als wir unsere Großeltern noch in Tangen besuchten, habe ich noch. Und zwar ging man von der Haustür aus gleich in die Küche auf den Herd mit offenem Feuer zu. Darüber war der Rauchabzug zum Schornstein. Die Stube war nicht sehr hell. Durch eine Klappe im Fußboden ging es über eine Leiter in den Keller.
Mein Bruder Karl und ich mit unsern Eltern; Mama war in anderen Umständen.
Unser Vater hatte zwei Brüder: Onkel Karl; der wohnte in Berlin, und Onkel Paul; der wohnte in Lünen an der Lippe. Unsere Mama hatte einen Bruder, den Onkel Gerhard. Er und Tante Else, seine Frau, kauften anno 1932 in Großtuchen 60 Morgen Land, und unsere Eltern kauften 50 Morgen Land. Dazu baute sich jeder ein kleines Haus. Die Stallgebäude und die Scheune waren noch vorhanden. In diesem Hause wurde Margot geboren, als ich gerade vier Jahre alt geworden war. Und an diese Zeit, bzw. folgende Begebenheit kann ich mich erinnern: Die Hebamme mit ihrem Behandlungskoffer kommt aus der Tür heraus und sagt, sie müsste Margot wieder mitnehmen, sie sei in diesem Koffer. v.l.n.r. Karl, Margot, Helmut (ich) Etwa um diese Zeit war ich sehr erpicht darauf, in den Kindergarten zu kommen, der in unserer Nachbarschaft eingerichtet wurde. Unsere Eltern waren dagegen. Weil ich aber nicht aufhörte, darum zu betteln, durfte ich mal hingehen, um nach einem Platz für mich zu fragen. Das war eine komplette Niederlage. Die Kindergärtnerin legte mir ein Aufnahmeformular vor, das ich unterschreiben sollte. Ich konnte zwar meinen Namen sagen und dass ich schon vier Jahre alt bin, aber unterschreiben konnte nicht. So trat ich also mit einem sauren Gesicht meinen Heimweg an. Irgendwie muss ich da dann doch noch hingekommen sein, denn ich habe noch sehr in Erinnerung, dass wir uns zum Mittagsschlaf hinlegen mussten,was mir gar nicht gefiel. Im Frühjahr 1936, noch nicht sechsjährig, wurde ich eingeschult. Aus dieser Zeit habe ich schon mehr im Gedächtnis behalten. Eines Tages kam ich weinend nach Hause, weil ich zwar schon lesen, aber kein Wort schreiben konnte; und eben das hatten wir als Hausarbeit auf. Unsere Mama hat mir das dann erklärt. Im Ranzen hatte ich eine Schiefertafel, an der mit einem Bindfaden ein nasser Gummischwamm zum Löschen des Aufgezeichneten und ein trockener Stofflappen zum Trockenwischen angebunden war.
Das erste und das zweite Schuljahr war in einem Klassenraum untergebracht. Der Lehrer hieß Kremas. Ich weiß nun nicht, ob es noch im ersten oder schon im zweiten Schuljahr war. Jedenfalls saß ich schon ziemlich weit hinten. Es kann also schon im zweiten Schuljahr gewesen sein, als ich beim Lesen einen Selbstlaut, nämlich das „e“ immer lang, anstatt kurz ausgesprochen hatte bei einer Redewendung wie z.B.: „ Sie ging weg.“ Beim zweiten oder dritten Mal bekam ich von Herrn Kremas eine schallende Ohrfeige. Das dritte und vierte Schuljahr war ebenfalls in einem Raum untergebracht. Dieser Lehrer hieß Maus. Nachdem ich ein knappes halbes Jahr schon im vierten Schuljahr war, begann der Krieg, und Herr Kremas wurde zur Wehrmacht eingezogen. Eines Tages, es war aber noch im September 1939, wir waren alle draußen auf dem Schulhof, kam der Schulleiter Herr Wotschke aufgeregt zur Tür heraus und flüsterte Herrn Maus, der auf der Treppe stand, zu, dass Herr Kremas gefallen sei. Das hatte der kleine Helmut aber mitbekommen. Gefallen – das heißt also mausetot. Und was dachte Helmut sich im Stillen dabei? Hatte er Mitleid? Herr Kremas möge ihm das verzeihen. Helmut zog daraus sein Resümee: „Dieser Mann kann mir keine Ohrfeige mehr geben.“
Von Ostern 1940 bis Ostern 1944 war ich in Herrn Wotschke´s Klasse.Hier waren die Schuljahre fünf bis acht untergebracht. Was den angehenden Schulabgängern vermittelt wurde, bekam ich als Zehnjähriger also auch schon mit. Oder wenn die Großen ihre Gedichte vortragen mussten, hörten wir in den vorderen Bänken natürlich alles mit, obwohl wir malen, rechnen oder von der großen Tafel etwas abschreiben mussten. Das Lied von der Glocke z.B. ging mir schon in Fleisch und Blut über.
Unsern Hof sollte Karl mal übernehmen, weil er kräftiger gebaut war, als ich. Dabei liebte ich die Feldarbeit über alles, jedenfalls mehr als Karl damals. Mein Vater bemühte sich, mich von diesem Wunsch abzubringen. Er versuchte immer wieder mich von den Privilegien eines Dorfschullehrers zu überzeugen. Sein Lehrer in Tangen hatte eine Kuh und Gänse und Hühner und ein kleines Stück Ackerland, das er bewirtschaftete. Im Ernteeinsatz waren immer genug Schüler zur Stelle, die ihn unterstützten.
Wir mussten Dung streuen. Unser Vater fuhr den Dung raus; wir beide standen schon draußen und stürzten uns dann auf die Haufen, die unser Papa ab lud. Wenn er mit der nächsten Fuhre kam, hatten wir alles schön gleichmäßig auf dem Acker verteilt. Karl verspürte anscheinend nicht viel Lust zu dieser stupiden Tätigkeit und bot mir einen Deal an: Wenn ich seine Reihe mit verstreuen würde, bekäme ich seine Dose mit Ostereiern, die schon ein halbes Jahr auf Oma`s Schrank stand. Jeder hatte so eine Dose mit Süßigkeiten zum Osterfest bekommen. Aber meine war nach einigen Tagen schon leer. So bin ich auf das Angebot eingegangen.
Dieser Dung wurde dann umgepflügt, und im nächsten Frühjahr wurden auf diesem Feld entweder Kartoffeln, Runkeln (Futterrüben) oder Wrucken (Steckrüben) angepflanzt. Diese sogenannten Hackfrüchte bekamen immer frischen Dung in die Erde im Jahr davor, nachdem das Getreide abgeerntet war. Also im ersten Jahr nach der Düngung kamen Kartoffeln oder Rüben rein, im zweiten und dritten Jahr dann Getreide oder Klee, auch Seradella. Seradella, glaube ich, ist auch eine Kleesorte, die auf leichtem, sogar sandigem Boden wächst. Wir haben den später gar nicht mehr angebaut, weil der als Futter auch nicht sehr nahrhaft ist. Er hat dünne rankige Stiele mit winzigen Blättern dran. Auf dem Dachboden über dem Schweinestall lag reif geerntete Seradella , die Papa immer noch ausdreschen wollte, wenn er mal Zeit hat. Und zwar wollte er das mit dem Dreschflegel machen, weil es nicht lohnte, dafür die Dreschmaschine von Onkel Gerhard rauf zu holen. Die hatten wir mit Onkel Gerhard gemeinsam. Und zu unserem Hof ging es bergauf, und wir hatten nur ein Pferd, während Onkel Gerhard zwei Pferde hatte. Das konnte ich auch nie verstehen, dass sie das nicht umgekehrt machten, nämlich dass wir mit einem Pferd die Maschine runter bringen und Onkel Gerhard mit seinen beiden Stuten die schwierigere Strecke aufwärts übernimmt. Überhaupt, meine ich, hätte doch so viel Nachbarschaft drin sein müssen, dass der, der das stärkere Gespann hat, die schwere Dreschmaschine bewegt. So war es jedes Mal ein aufregender Akt, wenn unser „Fuchs“ mit Anlauf und Galopp den Berg hochjagte. Aus dieser Maschine kam aber noch längst nicht das reine Getreide raus. Mit einer handbetriebenen Maschine wurde darnach die Spreu von den Körnern getrennt. Stundenlang habe ich diese große Kurbel gedreht, die ein Gebläse in Gang setzte, während diese zerbröckelten Ähren durch übereinanderliegende Siebe geschüttelt wurden. Und meine Gedanken wanderten durch die weite Welt. Und unser Vater schaufelte und schaufelte. Unterhalten konnte man sich nicht dabei. Die Maschine klapperte sehr laut. Und gestaubt hat es! Wenn man ins Taschentuch schnupfte, war es ziemlich schwarz. An den Augenbrauen hing auch der Staub. Aber die Armmuskeln waren gut trainiert.
So hätten wir also auch die Seradellasaat gewonnen. Nur für den Fall hatte Papa die Seradella aufgehoben. Das Dreschen mit dem Flegel habe ich einmal zu sehen gekriegt, als unsere Eltern in gleichmäßigem Takte auf die Ähren eindroschen. Auf die Tenne wurden die Garben gelegt und dann die ausgeklopften Körner samt dem Kaff (samt der Spreu) durch die eben beschriebene Reinigungsmaschine geschüttelt.
Wenn ich nicht irre, hat Papa auch, zumindest mal versuchsweise, den Klee gleich zusammen mit dem Getreide ausgesät und nach der Getreideernte wuchs der Klee heran so dass wir dann schönes fettes Grünfutter hatten für die Kühe. Die kamen übrigens auch, als Karl und ich schon als Kuhhirte eingesetzt werden konnten, nach der zweiten Heuernte auf die Wiese, nachdem das Gras dann zum dritten Male nachgewachsen war. Die ersten Tage waren immer sehr hektisch. Wenn die Kühe das ganze übrige Jahr im ziemlich düsteren Stall stehen, können sie sich nicht orientieren. Das grelle Licht blendet wahrscheinlich, und die Kühe sind sehr nervös, weil sie auch noch nicht den Weg kennen. Nach einigen Tagen trabten sie schon sicher zur Wiese hin, so dass einer von uns schon alleine mit der Herde losziehen konnte. Teddy, unser treuer Hund war immer dabei. Wenn nachmittags der „Fünf – Uhr - Zug“ durchgefahren war, durften wir unsere Kühe nachhause treiben. Ich rief dann „Halloloaloaloaloaloaloalo“ und die Kühe rannten im Laufschritt zur Straße. Wir waren nicht die Einzigen, die Kühe hüten mussten. Auf den anderen Wiesen waren auch Kinder mit ihren Herden, z.B.unsere Cousinen Irmchen und Edith (die Töchter von Onkel Gerhard), Horst und Irma Dunse, und wir hockten dann meistens zusammen, so, dass wir unsere Kühe sehen konnten. Wenn eine Kuh zur Nachbarwiese rüber steuerte, schickte ich Teddy los: „Hol sie rum!“ rief ich und wenn Teddy bellend auf sie zu lief, ging sie schon von alleine zurück.
Einen Weidezaun zu bauen lohnte wohl nicht. Vielleicht fehlte auch das nötige Geld oder die Zeit dafür. Außerdem denke ich gerne an diese Zeit zurück. Das ging so ungefähr 4 Wochen, bis das Gras nicht mehr nachwuchs.
Unser Gras auf der Wiese, die nach meiner Schätzung höchstens 4 Morgen groß war, wurde noch mit der Sense gemäht, weil ein Pferd alleine den Grasmäher nicht ziehen konnte. Es kamen sechs, sieben Tagelöhner aus dem Dorf; und in ein, zwei Tagen war das Gras abgesäbelt. Wir haben die Grasschwaden mit der Harke auseinander gestreut, am nächsten Tag gewendet usw.. Wenn es schön trocken war, wurde es mit dem Leiterwagen eingefahren. Die Leitern waren höher, als die normalen Ackerwagenbretter und standen auch schräger auseinander, so dass man eine schöne breite hohe Fuhre laden konnte. Das durfte ich auch schon machen. Das Heu war inzwischen zu kleinen Haufen zusammen geharkt, die der Vater mit der Forke aufstakte. Ich oben auf dem Wagen nahm dieses trockene sehr angenehm duftende leichte lockere Heu entgegen und packte es so, dass es an den Seiten nicht runter fiel, nämlich von der Seite angefangen übereinander zur Mitte hin. Zum Schluss legte man einen langen Baumstamm der Länge nach auf das zuletzt Gepackte rauf, und schnürte ihn nach unten fest. Papa nahm dann die Leine des Pferdes und „hüh!“, ab ging es zu unserm Heuschuppen. Das war der Dachboden unseres Pferde-, Kuh- und Hühnerstalles. Das Heu hatte ich so hoch gepackt, daß ich oben von der Fuhre aus direkt in die Heubodenluke steigen konnte, nachdem ich meine Augen geöffnet hatte. Das war damals so eine Masche von mir. Zur Heimfahrt legte ich mich, nachdem der Packbaum festgeschnürt war, neben den Baum und hielt die Augen geschlossen, bis wir zuhause auf unserm Hof waren. Papa löste diesen Baum und stakte das Heu durch die Luke, das ich oben entgegennahm.