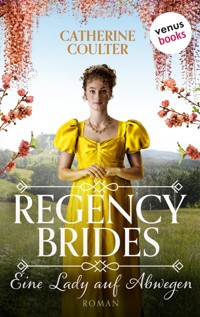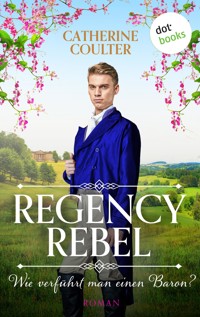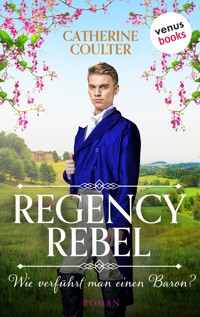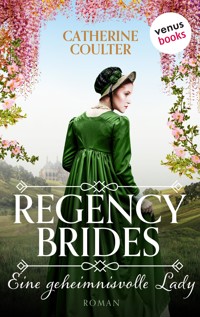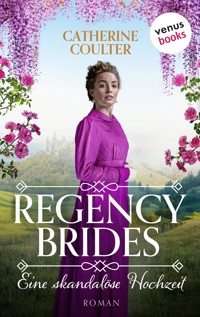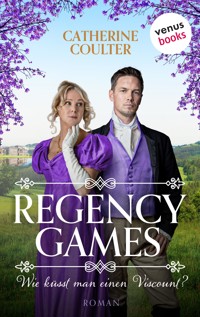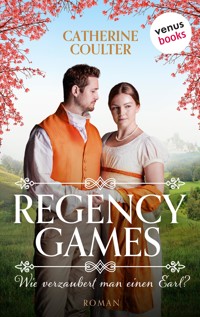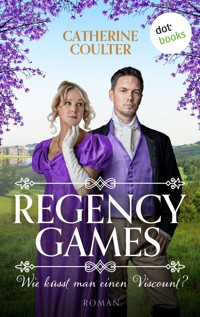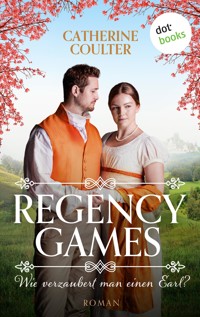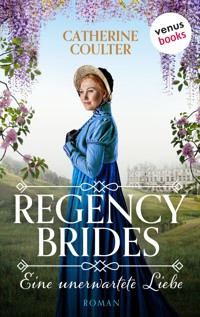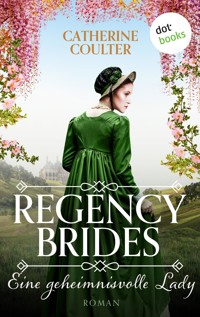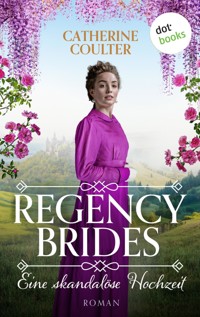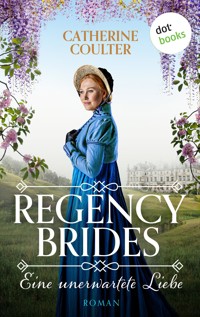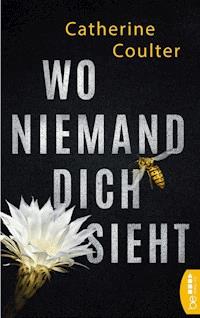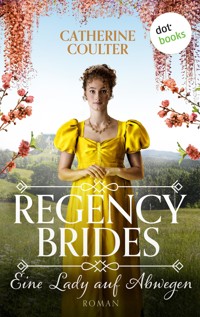
4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Brides
- Sprache: Deutsch
Eine gefährliche Scharade: Der Regency-Roman »Regency Brides – Eine Lady auf Abwegen« von Catherine Coulter jetzt als eBook bei dotbooks. Als sie herausfindet, dass ihr Stiefvater sie mit dem viel älteren Lord Rye verheiraten will, um an ihre Mitgift zu kommen, ergreift die junge Lady Winifrede kurzerhand die Flucht. Getarnt als männlicher Dienstbote findet sie Unterschlupf im Anwesen des wortkargen Lord Grayson Cliffe – doch als sie eines Nachts versucht, eines seiner Pferde für ihre weitere Flucht zu stehlen, fliegt ihre Tarnung auf … Zu Winifreds Überraschung jagt Grayson sie jedoch nicht davon – und willigt sogar ein, sie zu heiraten, um sie vor ihrem abscheulichen Verlobten zu schützen! Eine reine Zweckehe, davon ist Winifrede überzeugt – aber wieso fühlt sie sich bald immer mehr zu dem mysteriösen Lord hingezogen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Liebesroman »Eine Lady auf Abwegen« von New-York-Times-Bestsellerautorin Catherine Coulter ist Band 3 der Regency-Brides-Serie, deren Einzelbände unabhängig voneinander gelesen werden können und alle Fans des Netflix-Hits »Bridgerton« und Julianne Donaldson begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als sie herausfindet, dass ihr Stiefvater sie mit dem viel älteren Lord Rye verheiraten will, um an ihre Mitgift zu kommen, ergreift die junge Lady Winifrede kurzerhand die Flucht. Getarnt als männlicher Dienstbote findet sie Unterschlupf im Anwesen des wortkargen Lord Grayson Cliffe – doch als sie eines Nachts versucht, eines seiner Pferde für ihre weitere Flucht zu stehlen, fliegt ihre Tarnung auf … Zu Winifreds Überraschung jagt Grayson sie jedoch nicht davon – und willigt sogar ein, sie zu heiraten, um sie vor ihrem abscheulichen Verlobten zu schützen! Eine reine Zweckehe, davon ist Winifrede überzeugt – aber wieso fühlt sie sich bald immer mehr zu dem mysteriösen Lord hingezogen?
Über die Autorin:
Catherine Coulter wurde 1942 in Texas geboren. Schon früh begeisterte sie sich für die Regency-Bestseller von Georgette Heyer, die sie schließlich dazu inspirierten, selbst historische Liebesromane zu schreiben. Inzwischen ist Catherine Coulter erfolgreiche Autorin zahlreicher historischer und zeitgenössischer Liebesromane, sowie vieler Thriller, mit denen sie immer wieder auf der New-York-Times-Bestsellerliste stand.
Die Website der Autorin: catherinecoulter.com/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/CatherineCoulterBooks/
Die Autorin auf Instagram: instagram.com/catherinecoulterauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die historischen Liebesromane:
»Regency Brides – Eine skandalöse Hochzeit, Band 1«
»Regency Brides – Eine unerwartete Liebe, Band 2«
»Regency Brides – Eine Lady auf Abwegen, Band 3«
»Regency Brides – Eine geheimnisvolle Lady, Band 4«
»Regency Games – Wie verzaubert man einen Earl? Band 1«
»Regency Games -Wie küsst man einen Viscount? Band 2«
»Regency Beaus – Wie verführt man einen Baron?«
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »Mad Jack« bei Jove Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Scharade der Liebe« bei Heyne, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999 by Catherine Coulter
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Trident Media Group, LLC
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Karolina Michałowska unter Verwendung von Bildmotiven von Shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-798-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Regency Brides 3« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Coulter
Regency Brides – Eine Lady auf Abwegen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Claudia Müller
dotbooks.
Für Lesley Delone,die hervorragend kochen und Blumen arrangieren kannund vor allem eine großartige Freundin ist.Ich hoffe, wir singen noch sehr lange zusammen.
Kapitel 1
St.-Cyre-Stadthaus
London, 1811
25. März
Grayson Albemarle St. Cyre, Baron Cliffe, las die Seite noch einmal, dann zerknüllte er sie langsam. Nur ein Brief, dachte er, während er den Papierball in den Kamin warf. Es stand nicht viel darin, aber die wenigen Worte waren niederträchtig und gemein. Er beobachtete, wie sich das Papier an den Kanten braun färbte und dann in einer hellen Flamme verging.
Er trat aus dem Salon und ging den Flur entlang zum hinteren Teil seines Hauses. Dort öffnete er die Tür zu seinem Zimmer, der Bibliothek, die dämmerig, warm und voller Bücher war. Die schweren, dunkelgoldenen Samtvorhänge waren fest zugezogen, und das Feuer im Kamin brannte nur schwach, weil keiner der Dienstboten gewusst hatte, dass er um diese Zeit noch hierher kommen würde.
Sie glaubten alle, er habe vor fünf Minuten das Haus verlassen, um zu seiner Geliebten zu fahren.
Er dachte an den verdammten Brief und fluchte, allerdings nicht so heftig, wie es sein Vater stets getan hatte, wenn er so betrunken war, dass er kaum mehr laufen konnte. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch, nahm einen Briefbogen aus der obersten Schublade, tauchte die Feder in das Tintenfass und schrieb: Wenn ich noch eine Drohung von Euch erhalte, werde ich Euch so behandeln, wie Ihr es verdient. Ich werde Euch zusammenschlagen und Euch in der Gosse verenden lassen.
Er unterzeichnete mit seinen Initialen, GSC, faltete das Blatt Papier sorgfältig und steckte es in einen Umschlag. Dann ging er zu dem eleganten spanischen Tisch, der in der Eingangshalle an der Wand stand, und legte den Umschlag in die antike Silberschale, die sein Butler Quincy jeden Tag um ein Uhr mittags leerte.
Während er durch den kalten, klaren Frühlingsabend zur Wohnung seiner süßen Jenny ging, fragte er sich, was wohl als Nächstes geschehen würde.
Vielleicht gar nichts. Männer von Clyde Barristers Schlag waren Feiglinge.
Carlisle Manor
In der Nähe von Folkstone
29. März
Es gab nichts mehr zu sagen. Dieses verdammte Mädchen. Er zitterte vor Wut über die undankbare kleine Hexe und konnte sich kaum noch beherrschen. Er hob die Hand, um sie zu schlagen, besann sich dann aber. »Wenn ich dich schlage, merkt Carlton es vielleicht, und dann will er dich nicht mehr.«
Sie wimmerte leise. Den Kopf hielt sie gesenkt, und ihre Haare hingen verschwitzt und strähnig um ihr Gesicht.
»Bist du endlich still? Ich hätte nie gedacht, dich einmal stumm zu erleben! Es ist wohltuend, nicht mehr deinem Gejammer lauschen zu müssen. Schweigen und Unterwürfigkeit stehen Frauen wohl an, vor allem dir, obwohl ich es bei dir jetzt zum ersten Mal erlebe. Nun, vielleicht ist es ja überstanden, was? Ja, du hast anscheinend endlich aufgegeben. Du wirst dich mir nicht länger widersetzen.«
Sie sagte kein Wort. Als er ihr Kinn packte und ihren Kopf nach oben zwang, standen Tränen in ihren Augen. Seine Miene blieb finster. Eindringlich starrte er sie an, immer noch außer Atem von seinem wüsten Geschrei. Sein Gesicht war jedoch nicht mehr so gerötet wie noch vor einer Minute, und seine Stimme zitterte auch nicht mehr vor Wut.
»Du wirst Sir Carlton Avery heiraten. Er kommt morgen früh zurück. Du wirst ihn scheu anlächeln und ihm sagen, dass es eine Ehre für dich ist, seine Frau zu werden. Ich habe ihm meinen Segen gegeben. Die Heiratsvereinbarungen sind getroffen. Alles ist geregelt. Du wirst mir gehorchen, oder es wird dir sehr Leid tun.«
Er packte wieder ihr Kinn, sah, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen, und lächelte. »Gut«, sagte er. »Heute Abend wirst du baden und dir die Haare waschen. Du siehst aus wie eine Schlampe aus der Drury Lane.« Vor sich hin summend, verließ er ihr Schlafzimmer. Weil sie jedoch nicht vergessen sollte, dass er es ernst meinte, schlug er heftig die Tür hinter sich zu. Sie hörte, wie er den Schlüssel im Schloss umdrehte und wie sich seine schweren Schritte über den Korridor entfernten. Dann holte sie tief Luft, blickte nach oben und sagte: »Danke, Gott. Danke, Gott.«
Er hatte vergessen, ihr wieder die Hände zu fesseln.
Sie blickte auf die hässlichen, rauen Stellen an ihren Handgelenken und begann ihre Hände zu reiben, damit das Gefühl in sie zurückkehrte. Dann band sie die Fesseln um ihre Knöchel los und erhob sich langsam von dem Stuhl, an dem sie seit drei Tagen wie eine Verbrecherin festgebunden gewesen war. Sie erleichterte sich und stürzte rasch zwei Gläser Wasser aus der Karaffe hinunter, die auf ihrem Nachttisch stand. Nach und nach wurde ihr Atem ruhiger. Sie war sehr hungrig. Er hatte ihr seit gestern Abend nichts mehr zu essen gegeben.
Aber er hatte vergessen, ihr wieder die Hände zu fesseln. Vielleicht hatte er es ja gar nicht vergessen. Vielleicht hatte er geglaubt, dass er endlich ihren Willen gebrochen hatte und es deshalb keine Rolle mehr spielte, ob ihre Hände gefesselt waren. Nun, sie hatte ihr Bestes getan, um ihn in dem Glauben zu lassen. Ihre Zunge im Zaum zu halten hatte sie einiges gekostet. Die Tränen hervorzudrücken war nicht so schwer gewesen.
Würde er noch einmal zurückkommen? Dieser Gedanke setzte sie rasch in Bewegung. In den nächsten Minuten, wenn möglich noch schneller, musste sie verschwunden sein.
Sie hatte in den langen Stunden der vergangenen drei Tage oft darüber nachgedacht, hatte alles sorgfältig geplant und sich genau überlegt, was sie in dem kleinen, leichten Koffer mitnehmen konnte.
Die nächsten zwei Minuten verbrachte sie damit, die Enden ihrer beiden Laken zusammenzuknoten, dann ließ sie sie aus dem Fenster im zweiten Stock herab, wobei sie inständig hoffte, dass sie durch die schmale Öffnung passen würde. Wahrscheinlich war sie jetzt dünner als vor drei Tagen. Sie hatte während ihrer Gefangenschaft immer wieder auf das Fenster gestarrt, weil sie wusste, dass es ihr einziger Fluchtweg war. Sie würde sich hindurchquetschen müssen. Sie hatte überhaupt keine andere Wahl.
Es gelang ihr mit Mühe. Als sie sechs Fuß über dem Boden baumelte, blickte sie noch einmal auf ihr Schlafzimmerfenster und lächelte. Dann sprang sie und rollte sich auf dem weichen, abschüssigen Boden ab. Sie schüttelte sich, stellte fest, dass sie nur ein paar Schrammen abbekommen hatte, und warf einen letzten Blick auf ihr Zuhause, das im strahlenden Schein des Halbmondes da stand: Carlisle Manor, das einst ihrem Vater, Thomas Levering Bascombe, gehört hatte und nicht diesem Bastard, diesem Mann, den ihre Mutter nach dem Tod ihres Vaters geheiratet hatte. Es war ein hübscher Besitz. Und jetzt gehörte Carlisle Manor ihm, und keiner konnte etwas dagegen tun.
Mit ein bisschen Glück würde niemand vor morgen früh ihr Verschwinden bemerken. Es sei denn, er käme zurück, um ihr wieder die Hände zu fesseln. Dann würde alles schwieriger sein.
Zumindest war Georgie weit weg, in York, und würde vor der Wut ihres Stiefvaters in Sicherheit sein, wenn er entdeckte, dass seine Taube aus dem Käfig geflohen war.
Seine Taube wusste auch, wo sie hingehen musste.
Kapitel 2
St.-Cyre-Stadthaus
London
2. April
»Mylord.«
»Sei leise, Quincy«, sagte Gray, ohne die Augen zu öffnen. »Eleanor schläft.«
Quincy warf einen Blick auf die schlanke Eleanor und senkte seine Stimme zu einem Flüstern, das allerdings wohl nicht leise genug war, da Eleanor die Augen öffnete und ihn finster anblickte. »Ihr müsst unbedingt in den Salon kommen, Mylord. Ihr habt Besuch.«
Der Baron strich leicht über Eleanors Rücken, tätschelte ihren Kopf und fuhr mit seinen Fingern über ihr Kinn, wobei sie sich ihm entgegenstreckte, dann erhob er sich. Eleanor hob den Kopf, blinzelte ihn an und legte sich dann wieder hin.
»Sie schläft noch«, sagte Gray. »Das macht sie manchmal, ist dir das auch schon aufgefallen? Sie sieht dir genau in die Augen, und dann schläft sie wieder ein. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt aufwacht. Nun, es ist sehr früh für Besucher. Wer ist es denn?«
»Eure beiden Großtanten, Mylord.« Quincy betrachtete die schlafende Eleanor. Er hätte schwören können, dass sie hellwach gewesen war, als sie ihn hörte.
»Welche Großtanten?«
»Nach dem, was Miss Maude sagt, sind sie die Tanten Eurer Mutter.«
Gray war aufrichtig überrascht. Er erinnerte sich zwar an sie, aber es war lange her, viel zu lange ... Als sie zum letzten Mal zu Besuch gekommen waren, war er ein kleiner Junge gewesen, vielleicht sieben Jahre alt.
Er blickte auf den weichen, hellbraunen Ledersessel, den seine Mutter so geliebt hatte. Er sah sie immer noch vor sich, wie sie mit der Handfläche leicht über den Sitz strich. Seltsam, dass er sich daran erinnerte, denn sie waren selten hier in London gewesen.
»Diese alten Damen ... ich habe seit Jahren nichts von ihnen gehört. Was mag da wohl los sein?« Seine Mutter war ein Einzelkind gewesen – jammerschade, hatte Gray oft gedacht. Wenn sie vielleicht einen Bruder gehabt hätte, dann hätte er sie beschützen können; ihr Vater war im Kolonialkrieg an einem Ort namens Trenton gefallen, und kein Mann hatte ihr zur Seite gestanden. Nur ihr Sohn, damals noch ein sehr kleiner Junge, der sie auch nicht hatte retten können, bis er zwölf war.
Er schüttelte den Kopf. Alte Erinnerungen, Erinnerungen, die besser begraben bleiben sollten, da es jetzt sowieso zu spät war, um noch etwas zu tun.
Vor zwei Stunden hatte Gray gefrühstückt und ein wenig in seiner Bibliothek gearbeitet, nur in Gesellschaft seiner stolzen Eleanor. Er reckte sich und ging in den vorderen Teil des Hauses. Das St.-Cyre-Stadthaus stand am Portman Square. Die Fenster des Salons gingen auf den Park auf der anderen Straßenseite.
Es war ein grauer, trüber Morgen, die Luft war kühl und feucht. Heute war der 2. April, und von der Sonne war nichts zu sehen – allerdings erwartete man das in London auch gar nicht.
Als er durch die Doppeltüren den Salon betrat, verkündete Quincy mit seiner näselnden Stimme: »Lord Cliffe.« Abrupt blieb er stehen.
Mitten im Zimmer standen zwei alte Damen, eingehüllt in Schals, Hauben, Umhänge und Handschuhe, und starrten ihn an, als sei er der Teufel in Person.
»Ihr seid meine Großtanten?«, fragte Gray, während er freundlich lächelnd auf sie zutrat. Der heutige Tag, der so langweilig angefangen hatte, versprach auf einmal besonders zu werden.
Eine der beiden alten Damen trat vor. Sie war größer als die meisten Frauen, die er kannte, dünn wie eine Bohnenstange, mit einem langen, schmalen Gesicht und einer vertrockneten, leicht gelblichen Haut wie altes Pergament. Sie sah uralt aus, aber ihr Gang war federnd und ihr Gesichtsausdruck entschlossen.
»Wir brauchen deine Hilfe«, sagte sie mit einer leisen, schönen Stimme. Sie hatte einen sehr langen Hals und einen hübschen Mund, in dem sich immer noch all ihre Zähne befanden, wie er sehen konnte. Er verbeugte sich und wartete, aber die alte Dame blickte ihn nur an und trat dann zurück, wie ein Soldat, der sich wieder in Reih und Glied einordnet.
Die andere alte Dame, klein und sehr zierlich, blickte ihre Schwester kurz an und trat dann drei Schritte auf ihn zu. »Ich bin Maude Coddington, Mylord. Mathilda wollte eigentlich sagen, dass wir deine Großtanten sind. Wir waren die jüngeren Schwestern deiner Großmutter. Leider starb deine liebe Großmutter Mary bei der Geburt deiner Mama, unserer kleinen Nichte. Unsere andere Schwester, Martha, starb vor drei Jahren an einer Lungenentzündung, und jetzt sind nur noch Mathilda und ich übrig.«
Maude wirkte irgendwie flauschig mit all den Bändern und Bordüren an ihrem Kleid. Ihre Haube war mit künstlichen Trauben und Äpfeln verziert. Sie reichte ihm gerade bis zum obersten Knopf seiner Weste, Mathilda dagegen bis zur Stirn. Das sollten Schwestern sein? Er fragte sich, wie seine Großtante Martha wohl ausgesehen hatte. Er hatte einmal ein Porträt seiner Großmutter gesehen, das gemalt worden war, als sie achtzehn war.
»Es war die Schuld des Pfarrers«, sagte Tante Mathilda.
»Wie bitte?«, fragte Gray. »Was war die Schuld des Pfarrers?«
»Martha«, erwiderte Mathilda.
»Was Mathilda meint, wenn sie dir von dem Zwischenfall erzählen wollte, ist, dass unsere Schwester mit dem Pfarrer spazieren gegangen ist, und es fing an zu regnen, und er brachte sie nach Hause, aber da war es schon zu spät. Sie wurde krank und starb.«
»Oh, das tut mir Leid.« Er lächelte sie an, weil er äußerst höflich war, und außerdem wurde er langsam wirklich neugierig. Sie brachten ihn einfach zum Lächeln. Er sagte: »Danke, dass du mir die Dinge ausführlicher erklärst. Und bitte, wollt ihr euch nicht setzen? Ja, da ist es gut. Ach, du bist hier, Quincy. Bring uns doch bitte Tee und ein paar von Mrs. Posts Zitronenkeksen.« Er wartete, bis sich die beiden alten Damen auf dem Sofa ihm gegenüber niedergelassen hatten, dann setzte er sich ebenfalls. »Tante Mathilda sagte, dass ihr meine Hilfe braucht. Was kann ich für euch tun?«
»Kein Geld«, sagte Mathilda.
»Genau«, sagte Maude. »Das wäre ja geschmacklos, wenn zwei alte Damen zu dir kämen und dich um Geld bäten. Nein, finanzielle Hilfe brauchen wir nicht von dir, Mylord. Wir leben in der Nähe von Folkstone und sind gut situiert. Unser Vater hat uns bestens versorgt.«
»Reiche Gatten«, sagte Mathilda.
»Ja, nun, unsere Gatten haben uns auch wohl versorgt zurückgelassen. Es waren gute Männer.« Tante Maude holte tief Luft und fügte mit dramatischer Stimme hinzu: »Nein, Mylord, wir bitten dich um deine Hilfe als Oberhaupt der Familie St. Cyre.«
»Sehr jung«, sagte Mathilda.
Gray erwiderte langsam: »Ich bin vermutlich wirklich sehr jung für ein Oberhaupt der Familie, allerdings gibt es auch nicht mehr allzu viel Familie. Ich bin gerade sechsundzwanzig geworden. Es gibt noch ein paar Cousins, die ich noch nie gesehen habe und denen es wahrscheinlich egal ist, ob ich am Leben oder tot bin, aber sonst gibt es niemanden. Es freut mich sehr, dass ihr meine Tanten seid, und natürlich werde ich euch in jeder Beziehung helfen. Ah, da ist Quincy mit Mrs. Posts Keksen und dem Tee.«
Gray sah zu, wie Quincy, der als junger Mann sehr dünn gewesen und jetzt so rundlich wie einer von Mrs. Posts Rinderschinken geworden war, den Tee einschenkte und den beiden alten Damen half, sich aus ihren zahlreichen Hüllen herauszuschälen. Mathilda war völlig in Schwarz gekleidet, von der altmodischen Haube bis zu den Schuhen an ihren langen, schmalen Füßen. Alles war schwarz. Sogar das Medaillon, das sie um den Hals trug, war schwarz. Er hatte noch nie in seinem Leben ein schwarzes Medaillon gesehen.
Maude war in Rot gekleidet. Nein, das stimmte nicht ganz. In das Rot mischte sich auch ein wenig Braun und Rosa, was für die Augen leichter zu ertragen war. Es gab doch ein Wort für diese Farbe. O ja, es war fleischfarben, ein hässliches Wort, hatte er immer gefunden – es klang nach der Farbe tagelang aufbewahrter Reste. Ihre Haube war fleischfarben und die Schuhe an ihren sehr kleinen Füßen auch. Fleischfarben, dachte er, sah an Maude recht hübsch aus.
Als die beiden Damen sich wieder hingesetzt hatten und die Teetassen anmutig in ihren blau geäderten Händen hielten, sagte Gray: »Bitte, erzählt mir, was ich tun kann.«
Mathilda trank einen Schluck von ihrem sehr heißen Tee und sagte, als teile sie ihm damit alles umfassend mit: »Flut.«
Maude biss ein Stück von ihrem Zitronenkeks ab und seufzte, wobei sie ebenso schöne Zähne wie ihre Schwester zeigte. Dann schluckte sie den Bissen hinunter und erzählte: »Wir hatten kürzlich einen Brand in unserem hübschen Haus im Norden von Folkstone. Es heißt Feathergate Close und ist dreihundert Jahre alt. Das ist doch ein reizender, ziemlich romantischer Name, nicht wahr? Wenn Mathilda und ich sterben, wird Feathergate dir gehören.« Maude schwieg und strahlte ihn an, aber als ihre Schwester ihr einen Stoß versetzte, fuhr sie rasch fort.
»Ja, meine Liebe, ich komme ja schon auf den Punkt. Wir wollen uns doch nicht hetzen. Der Junge muss erst richtig vorbereitet werden.«
Sie schenkte ihm ein reizendes Lächeln. Wahrscheinlich hieß das, dass sie ihn jetzt für genügend vorbereitet hielt. »Nun, auf jeden Fall, nach diesem schrecklichen Brand mussten natürlich viele Reparaturarbeiten ausgeführt werden. Wir würden gern für eine Weile bei dir bleiben, bis unser Haus wieder bewohnbar ist.«
»Was ist mit der Flut?«
»Oh«, entgegnete Maude und wischte sich zierlich die Finger an der weichen weißen Serviette ab, nachdem sie das letzte Stück Zitronenkeks in den Mund gesteckt hatte. »Die Flut kam nach dem Feuer. Die schönen Chippendale-Esszimmerstühle unserer lieben Mutter sind beinahe aus dem Haus geschwemmt worden. Leider kam die Flut jedoch nicht rechtzeitig, um das Feuer zu löschen, sondern erst volle drei Tage später. Dann regnete es und regnete es. Es war sogar noch trauriger als der Heiratsantrag, den der Pfarrer Mathilda letzten Sonntag nach dem Gottesdienst in der Kirche gemacht hat.«
»Was hat Mathilda geantwortet?« Gespannt beugte er sich vor.
»Was? Oh, sie hat ihm noch einmal gesagt, dass sie bereits eine Ehe hinter sich habe und dass sie, wenn sie ihn so ansähe, nicht glaube, dass er ihr neue Erkenntnisse vermitteln oder zur Steigerung ihres Wohlbefindens beitragen könne.«
»Das hast du alles gesagt, Tante Mathilda?«
»Sie hätte es gesagt, wenn sie gewollt hätte«, erwiderte Tante Maude. »Deine Großtante Mathilda ist eine begnadete Rednerin, wenn sie will. Ich glaube, den Pfarrer jedoch brauchte Mathilda nur von oben herab anzusehen und die Nase ein wenig zu rümpfen. Sie hält ihn ihrer großartigen Redekunst nicht für würdig.«
Tante Mathilda nickte zustimmend. »Das stimmt. Schließlich hat Mortimer Martha umgebracht.«
Maude räusperte sich. »Wahrscheinlich hat er es nicht absichtlich getan, aber er ist immerhin mit Martha spazieren gegangen, wie wir dir bereits erzählt haben, und es regnete, und sie starb. Es tat ihm sehr Leid. Aber jetzt will er Mathilda.« Sie hielt inne, seufzte tief auf und fuhr fort: »Schade, dass er nicht gebetet hat, um das Feuer und die Flut zu verhindern. Aber er hat es nicht getan. Der Brand und die Flut haben einen ziemlichen Schaden angerichtet, und deshalb hatten wir keine andere Wahl, als zu dir zu kommen und uns in deine Obhut zu begeben. Wirst du uns denn ein Weilchen hier bleiben lassen, lieber Junge?«
Das war die seltsamste Geschichte, die ihm seit langem untergekommen war. Gray blickte von Mathilda, der Rednerin, wenn sie nur wollte, zu der zierlichen, gesprächigeren Maude, stellte sich vor, wie die Chippendale-Stühle ihrer Mutter auf den Rasen vor dem Haus geschwemmt wurden, und nickte grinsend. »Es ist mir ein Vergnügen, Ladys. Darf ich euch auch meine Hilfe bei den Reparaturarbeiten anbieten? Ich kann jemanden nach Feathergate Close schicken, damit er den Fortgang der Arbeiten überwacht.«
»Nein«, sagte Mathilda.
»Eigentlich, Mylord ...«, entgegnete Maude und beugte sich vor. Dann brach sie ab. Gray blinzelte, als er die schönen, blassgrünen Augen seiner Mutter in Maudes Gesicht sah. Blassgrüne Augen, genau wie seine. Maude blickte kurz zu Mathilda, dann räusperte sie sich erneut. »Wir haben Männer, denen wir völlig vertrauen. Alles wird so rasch wie möglich erledigt werden. Wir sind zufrieden.«
»Ich verstehe«, erwiderte Gray. Er trank einen Schluck von seinem Tee, der jetzt lauwarm war. »Natürlich seid ihr in meinem Heim willkommen.«
»Alice«, sagte Mathilda.
»Meine Mutter Alice?«, fragte Gray und zog die Augenbrauen hoch.
»Ach ja, deine liebe Mutter«, sagte Maude. »Sie war so ein reizendes kleines Mädchen. Wir haben sie schmerzlich vermisst, als sie deinen Vater heiratete, obwohl das schon so lange her ist, dass wir nicht mehr wissen, was genau wir eigentlich vermisst haben. Aber weißt du, dein Vater nahm sie sofort mit. Zwischen ihrer Heirat und deiner Geburt haben wir sie nur zweimal gesehen. Ich glaube, als wir dich das letzte Mal gesehen haben, warst du noch ein kleiner Junge. Ach ja, immer wenn wir an die liebe kleine Alice gedacht haben, haben wir sie vermisst.«
»Nichtsnutziger Kerl!«, sagte Mathilda und blickte Gray eindringlich an.
»Mathilda will damit sagen, dass wir damals nicht sicher waren, ob dein Vater wirklich so ein hervorragender Gentleman für unsere kleine Nichte war. Deine Mutter war so sanft, so liebevoll, so – nun, schwach, um die Wahrheit zu sagen. Selbst wenn dein Vater ein Heiliger gewesen wäre, hätte Mathilda wahrscheinlich trotzdem das Gefühl, dass er nicht gut genug für deine Mutter war.«
»Er war ein verkommener Bastard«, sagte Mathilda, dieses Mal mit noch mehr Nachdruck. Eindringlich blickte sie ihn an.
Gray sah von einer alten Dame zur anderen, dann nickte er langsam. »Ja, ihr habt völlig Recht. Mein Vater war ein verkommener Kerl. Ach, ich verstehe. Ihr fragt euch, ob ich wie mein Vater bin. Ihr habt zwar keinen Grund, mir zu glauben, aber ihr solltet es. Ich bin überhaupt nicht wie er.« Sie wussten offenbar nicht, was vor vielen Jahren geschehen war. Er überlegte, warum das wohl so war, denn sicher hätte es jeder, der es hätte wissen wollen, leicht herausfinden können.
»Nun, Ladys, gestattet Quincy, euch zu Mrs. Piller zu bringen. Sie ist meine Haushälterin, und sie war schon vor meiner Geburt bei meiner Mutter. Sie wird genau wissen, welche Zimmer für euch am bequemsten sind.«
»Da ist noch Jack«, sagte Mathilda. »Jack braucht auch ein Zimmer. In unserer Nähe.«
Mehr als ein Wort, dachte Gray. Das muss unglaublich wichtig für sie sein. Vielleicht würde sie jetzt anfangen, Reden zu halten.
»Jack?«
Maude tätschelte Mathildas Knie und nickte, wodurch das Obst auf ihrer Haube zur Seite rutschte. »Ja, wir haben unseren jungen, ähm, Kammerdiener mitgebracht. Sein Name ist ›Verrückter Jack‹. Da er sowohl Mathilda als auch mir zur Seite steht, hätten wir es gern, wenn er in unserer Nähe untergebracht wird. Vielleicht könnte er in einem der Ankleideräume schlafen.«
»Verrückter Jack ist euer Kammerdiener? Ein Junge, dessen Name wie der Beiname eines Straßenräubers klingt?«
»Nun«, erwiderte Maude nach einem flackernden Blick auf Mathilda, »eigentlich heißt er nur Jack, aber unser Junge ist recht lebhaft, nicht wild, nein, Gott bewahre, aber er macht viele Dinge, die das Haar einer alten Dame schon ziemlich weiß werden lassen.«
»Hmmm«, war die einzige Antwort, die Gray dazu einfiel. Er zwinkerte dabei, aber falls eine seiner Tanten es bemerkt hatte, so schenkten sie ihm keine Beachtung. Sie hatten also wirklich einen Kammerdiener namens Jack, den sie Verrückter Jack nannten? Das hatte er nicht erwartet, aber andererseits, wen störte es schon? Gray sagte: »Vielleicht könnt ihr mir ja ein Beispiel für irgendwelche lebhaften Dinge sagen, die Verrückter Jack hier in meinem Haus tun könnte?«
Mathilda entgegnete: »Überhaupt nichts. Vergiss das ›verrückt‹!«
»Ja, das stimmt«, erwiderte Maude, »in fremden Häusern ist unser kleiner Jack ruhig und sanft, vor allem in einem so prächtigen Haus wie diesem hier.«
Faszinierend, dachte Gray. Laut sagte er: »Beratet euch am besten mit Mrs. Piller. Wo steckt Jack?«
»Er sitzt wahrscheinlich ganz still in der Eingangshalle«, sagte Maude, »und passt auf unser Gepäck auf. Er ist ein guter Junge, sehr gut erzogen, sehr ruhig, zumindest meistens und vor allem in fremden Häusern. Du wirst gar nicht merken, dass er überhaupt da ist. Wir haben ihn schon seit jeher bei uns. Ja, Jack ist ein netter Junge und uns treu ergeben, und wenn er uns nicht aufwartet, ist er am liebsten für sich. Er wird keinen Ärger und keine Unruhe machen, er ist ein fleißiger, friedliebender Junge. Tu, was Mathilda gesagt hat, und vergiss einfach das ›verrückt‹. Es ist nur eine dumme Angewohnheit, ein alberner Beiname, der einer alten Dame einfach so eingefallen ist.«
»Jack ist ebenfalls willkommen, ob mit oder ohne seinen Beinamen. Und da wir miteinander verwandt sind und es euch ja anscheinend nicht gleichgültig ist, ob ich lebe oder tot bin, würde ich mich freuen, wenn ihr mich Gray nennen würdet.«
»Dein Name ist Grayson«, entgegnete Mathilda.
»Nun, eigentlich fand ich das immer zu lang. Meine Freunde wie meine Feinde nennen mich St. Cyre oder Cliffe, aber für gewöhnlich einfach Gray.«
»Das ist schon in Ordnung, mein Junge«, erwiderte Maude, während sie aufstand und ihre fleischfarbenen Seidenröcke ausschüttelte.
Auch Mathilda stand auf, trat an die Türen des Salons und rief: »Jack!«
Kapitel 3
Der Baron konnte Jack nicht genau erkennen, weil er sich eine Kappe über die Ohren gezogen hatte und anscheinend aufmerksam auf die beiden Koffer der Tanten blickte. Er sah jedoch einen ungefähr fünfzehnjährigen Jungen, dünn wie ein Zahnstocher, der in viel zu großen Breeches, Stiefeln mit Aufschlägen und einer erbsengrünen Jacke steckte. Jack wirkte nicht im Geringsten wie ein Junge, der eine feste Hand brauchte. Eine dünne, schlecht angezogene, kleine Laus. Gray vermutete, dass die beiden alten Damen alles jugendliche Benehmen sofort als verrückt einstuften. Was hatte er getan? Eine Teetasse zu Boden geworfen und darauf herumgetrampelt?
Der Kammerdiener ergriff die Koffer, stöhnte auf und ließ sie gleich wieder fallen. Er starrte auf sie herunter, wappnete sich und begann, sie hinter sich her zu ziehen. Was mochte er mit den Koffern vorhaben, wenn er erst einmal an der Treppe angekommen war?, fragte sich Gray. War er denn überhaupt nicht ausgebildet? Kein Kammerdiener hätte Koffer über die Haupttreppe nach oben geschleppt, noch nicht einmal ein verrückter.
Gray brach fast in Gelächter aus, als Jack der Kammerdiener begann, die Koffer mit dem Fuß vor sich her zu schieben, erst den einen, dann den anderen, wobei er jedes Mal vielleicht zwei Zentimeter vorwärts kam. Quincy beobachtete ihn kurz, dann rief er nach Remie, dem Lakaien. Remie, ein großer blonder Ire, schlug Jack, der unter der Begrüßung fast zusammenbrach, auf den Rücken, dann nahm er beide Koffer in eine große Hand und ging damit in den hinteren Teil des Hauses zur Dienstbotentreppe. Er rief Jack zu, er solle ihm folgen.
Mrs. Piller, die Haushälterin von St. Cyre – mit hochroten Wangen, deren Ursache Gray sich nicht erklären konnte –, trat vor und knickste vor den Tanten. In kürzester Zeit waren die beiden nach oben auf dem Weg zu ihren Schlafzimmern, die durch ein großes Ankleidezimmer, in dem Jack der Kammerdiener untergebracht wurde, miteinander verbunden waren.
»Ich gehe«, sagte Gray. »Sorg dafür, dass sie es bequem haben, Quincy. Die Tanten werden eine Zeit lang bei uns wohnen. Ein Feuer und eine Flut – beides – hat ihr Heim in der Nähe von Folkstone heimgesucht. Sie werden hier bleiben, bis ihr Haus wieder instand gesetzt ist. Ein Feuer und eine Flut«, wiederholte er und blickte stirnrunzelnd auf das Porträt der dritten Baroness Cliffe, die als Hexe verschrien gewesen und im Alter von zweiundachtzig Jahren in ihrem Bett eines natürlichen Todes gestorben war. »Das klingt ziemlich seltsam, nicht wahr?«
Quincy, der die beiden Großtanten und diesen unreifen, unausgebildeten Kammerdiener insgeheim als hergelaufenes Gesindel einschätzte, sah ihn streng an und erwiderte: »Ihre Kutsche war gemietet, Mylord. Ihr Gepäck stammt bestimmt aus dem letzten Jahrhundert.«
»Nun, ich denke, das ist nicht von Bedeutung, zumal sie sowieso eine Weile hier bleiben. Wir haben keinen Platz für eine weitere Kutsche in den Ställen. Und was ihr Gepäck angeht, warum soll es nicht alt sein? Schließlich sind sie selbst Altertümer. Ich bin jetzt weg.«
»Ich wünsche Eurer Lordschaft viel Vergnügen.«
Gray grinste Quincy an. Der Butler, der nicht viel größer war als Tante Maude, half ihm in den Mantel. »Sollte das ein kleiner impertinenter Scherz gewesen sein, Quincy?«
Quincy, ein Meister seines Fachs, blickte ihn mit seinem stoischen Butlerblick an und erwiderte nichts, aber Gray entging das Funkeln in seinen Augen nicht.
»Gray, bitte, koste einmal den Apfelkuchen. Ich habe ihn schon einmal gemacht, aber der Metzger, ein haariger Affe, der immer behauptet hat, ich sei viel zu hübsch zum Kochen, fand den Teig ein wenig zu trocken. Dieses Mal habe ich mehr Butter genommen, für den Fall, dass er die Wahrheit gesagt hat. Die Äpfel waren ganz frisch. Der Junge, der sie mir verkauft hat, war ein grober kleiner Kerl, der mich küssen wollte, deshalb habe ich ihm die Ohren langgezogen. Und jetzt versuch mal ein Stück. Ich habe ihn extra für dich gebacken.«
Gray lag flach auf dem Rücken, nackt, glücklich, befriedigt, und kam gerade wieder zu Atem. Vor ihm stand Jenny in einem pfirsichfarbenen Gewand, das seiner Meinung nach wesentlich essbarer aussah als der Apfelkuchen, den sie ihm vor die Nase hielt. Ihre prächtigen schwarzen Haare fielen lockig bis auf ihre hübschen Brüste, und ihre Lippen glänzten noch rot von den vielen Küssen. Er begehrte sie schon wieder – nun ja, in fünf Minuten vielleicht. Jetzt wollte er sich nur ein bisschen ausruhen, damit er wieder zu Kräften kam. Aber er sah die Erregung in ihren Augen, und da er wusste, was seine Pflicht war, nahm er ein Stück Apfelkuchen. Zumindest fütterte sie ihn immer anständig, nachdem sie ihn ausgesaugt hatte.
»Du hast doch noch nie Apfelkuchen für mich gebacken«, sagte er, während er das kleine Kuchenstück musterte, von dem heiße Apfelsoße heruntertropfte.
»Du hast gesagt, die gebratene Ente mit süßer Aprikosen- und Madeirasoße sei ein bisschen schwer nach der Liebe gewesen, deshalb wollte ich dir heute nur ein Dessert anbieten.«
Er biss ein Stück ab und sank wieder aufs Kissen zurück. Ganz langsam kaute er mit geschlossenen Augen, obwohl er wusste, dass sie bereits unruhig von einem Fuß auf den anderen trat und darauf wartete, dass er ihren Apfelkuchen zum besten im ganzen Land erklärte. Er hielt die Augen geschlossen, biss noch einmal ab, kaute noch langsamer als beim ersten Mal und schob sich schließlich den letzten Bissen in den Mund. Unter halb geschlossenen Augenlidern beobachtete er Jenny. Gleich würde sie ihn anschreien. Er öffnete die Augen und sagte: »Es ist nicht genug. Ich bin nicht sicher, ob der Geschmack wirklich hundertprozentig richtig ist. Gib mir noch ein Stück.«
Sie stopfte es ihm beinahe in den Mund.
Schweigend und nachdenklich aß er das zweite Stück und kaute wieder so lange auf jedem Bissen herum, bis er merkte, dass sie ihm gleich die ganze Platte an den Kopf werfen würde, wenn er nicht endlich seine Meinung kundtat.
Da lächelte er sie an, kratzte sich den Bauch und sagte: »Jenny, nur noch ein Klecks Sahne auf den Apfelkuchen, und er ist vollkommen. Der Teig mit der zusätzlichen Butter macht ihn fast so zart und cremig wie die Haut auf deinem Bauch.«
»Ich habe Sahne da«, rief sie und rannte aus ihrem Schlafzimmer, das ganz in zarten Pfirsichtönen, hellgelb und blassblau eingerichtet war. Der nackte Mann auf ihrem zerwühlten Bett seufzte, streckte sich und schlief ein.
Bevor er zwei Stunden später ging, noch einmal befriedigt und glücklicher als ein Vikar, der drei Goldmünzen im Kollektenbeutel gefunden hatte, aß er ein weiteres Stück Apfelkuchen, von dem dieses Mal Sahne tropfte. Es war überaus köstlich, und sie leckte ihm lachend die Sahne vom Mund. »Gib mir das Rezept für Mrs. Piller«, sagte er. »Meine Gäste werden nicht mehr vom Tisch aufstehen wollen.« Vor seinem geistigen Auge sah er sich, wie er der ältlichen, prüden Mrs. Grainger-Jones, der Gattin eines genauso ältlichen Generals aus den Kolonialkriegen, erzählte, dass das Rezept von seiner Geliebten stammte.
Jenny küsste ihn auf den Mund, dann half sie ihm, sich anzuziehen. Als er sie verließ, summte sie vor sich hin. Wahrscheinlich dachte sie sich ein neues Rezept aus und würde gleich in der Küche stehen, ohne zu merken, dass sie ein pfirsichfarbenes Seidengewand trug, das einen erregten Mann dazu bringen konnte, seinen Ellbogen aufzuessen. Er hatte auf ihren Wunsch hin mehr Geld auf die Modernisierung ihrer Küche verwendet, als er jemals für Kleider, Schmuck oder Ausflüge nach Vauxhall Gardens oder in die Oper ausgegeben hatte.
St.-Cyre-Stadthaus
7. April
Gray fragte sich, wie es den Tanten wohl gehen mochte. Er hatte sie seit ihrer Ankunft erst zweimal gesehen, beide Male beim Abendessen. Mathilda hatte ein schwarzes Kleid von 1785 getragen, sehr schlicht und streng geschnürt. Ihr schönes dichtes Haar, das sie hoch aufgetürmt auf dem Kopf trug, war so weiß, als hätte sie es gepudert.
Maudes Kleid dagegen war der letzte Schrei gewesen, mit hoch angesetzter Taille und aus fleischfarbener Seide, die sich über ihrer mageren Brust gebauscht hatte.
Sie hatten ihm noch mehr Einzelheiten über das schreckliche Feuer und die Flut erzählt, die Feathergate Close verwüstet und die beiden alten Damen ins Elend gestürzt hatten. Er hatte weitere Geschichten darüber vernommen, wie Mortimer, der Pfarrer, versucht hatte, Mathilda hinter der Sakristei einen Kuss zu stehlen und wie er sogar beim Sechsuhrläuten ihr Hinterteil getätschelt hatte. Er hatte beide Abendessen so genossen, dass er danach nicht einsam vor einem Glas Port in seinem Esszimmer hatte sitzen bleiben wollen.
Am ersten Abend war er den Tanten in den Salon gefolgt. Noch bevor sie sich hatten hinsetzen können, hatte Tante Mathilda gesagt: »Klavier.«
Und so war Gray in den Genuss eines makellosen Haydn-Stückes gekommen, das die äußerst talentierte Maude ihm vorgespielt hatte.
Das war vor zwei Abenden gewesen. Während er Eleanor streichelte, die es sich auf seinem rechten Bein bequem gemacht hatte, dachte er, dass er seine beiden Großtanten am liebsten immer schon um sich gehabt hätte. Er mochte sie wirklich gern.
Er legte sich Eleanor über beide Beine, griff zu seiner Feder und tauchte sie in das glänzende Onyxtintenfass, das die reizende Witwe Constance Duran ihm geschenkt hatte, nachdem er ihr bei der Beseitigung eines lästigen Problems, nämlich ihres Ehemanns, geholfen hatte, und schrieb einen Brief an Ryder Sherbrooke, einen Mann, der kaum älter war als Gray und den er maßlos bewunderte.
Er war gerade mit dem Brief fertig geworden, als Quincy die Bibliothek betrat.
»Was gibt es, Quincy?«
»Es ist ein Herr da, Mylord – ein Herr, den ich noch nie vorher gesehen habe. Er hat mir seine Karte gegeben.« Quincy reichte Gray eine kleine, sehr weiße Visitenkarte mit dem Namen Sir Henry Wallace-Stanford. Er kannte diesen Mann nicht und blickte Quincy fragend an. »Ich habe es schon an deiner Stimme gehört. Was stimmt nicht mit ihm?«
Quincy sagte langsam: »Es ist irgendetwas mit seinen Augen. Er sucht etwas. Ich glaube, es ist Gier, einfach nur Gier. Vielleicht übertreibe ich ja auch. Wir werden sehen. Ich glaube jedoch nicht, dass Sir Henry ein guter Mann ist.« Quincy schüttelte sich. »Nichtsdestotrotz hat er höflich gefragt, ob er Euch sehen kann. Er behauptet, es sei wichtig.«
»Das könnte interessant werden«, meinte Gray und stand auf. »Bring Sir Henry herein.«
»Lord Cliffe?« Gray nickte dem außergewöhnlich gut aussehenden Mann, der selbstbewusst die Bibliothek betrat, zu. Er war groß, hielt sich aufrecht und war in mittleren Jahren, mit dichtem dunkelbraunem Haar, das von grauen Strähnen durchzogen war. Automatisch ergriff Gray seine ausgestreckte Hand, dann verbeugte er sich leicht. »Ja. Ich bin Cliffe. Leider kenne ich Euch nicht, Sir.«
»Ich bin Wallace-Stanford, ein Freund der Schwestern von Feathergate Close, Mathilda und Maude. Ich war zufällig in London, und da dachte ich, ich sehe einmal nach, ob sie ihren Aufenthalt hier genießen. Ich mag die beiden alten Damen sehr.«
Das war eine Enthüllung. Der Mann war direkt zum Thema gekommen, ohne Umschweife oder Erklärungen. Er machte sich wohl auch Sorgen. Gray sah, dass ihm der Schweiß auf der Stirn stand. »Ich verstehe«, erwiderte Gray, obwohl er eigentlich kein Wort verstand. Er bat Sir Henry, sich zu setzen.
»Darf ich Euch einen Brandy anbieten?« Als er das Glas in Sir Henrys elegante Hand gedrückt hatte, sagte Gray: »Ihr seid also mit meinen Großtanten bekannt. Wollt Ihr sie besuchen oder Euch nur nach ihnen erkundigen?«
»Nein, eigentlich bin ich hier, um zu fragen, ob die beiden alten Damen einen jungen Gast bei sich haben.«
»Einen jungen Gast?«
»Ja.«
Er blickte in Sir Henry Wallace-Stanfords unergründlich dunkle Augen, dachte an Quincys Worte und erwiderte: »Nein, die Tanten haben keinen Gast mitgebracht.«
»Ah, ich verstehe«, sagte Sir Henry. Langsam erhob er sich. »Es tut mir Leid, wenn ich Euch gestört habe, Mylord. Seid Ihr sicher, dass sie niemanden mitgebracht haben?«
Dies war wirklich mächtig interessant. Gray schüttelte den Kopf. »Kein Gast in Sicht«, erwiderte er. »Und Ihr seid sicher, dass Ihr nicht mit ihnen reden wollt? Ich glaube, im Augenblick sind sie in Hookhams Buchladen oder vielleicht bei Gunthers, Eis essen. Vielleicht möchtet Ihr auf sie warten?«
»O nein. So wichtig ist das alles nicht.« Er blickte Gray lange an, dann nickte er langsam.
Als Sir Henry gegangen war, stand Gray in der Eingangshalle neben Quincy und starrte auf die Tür. »Das ist äußerst seltsam«, meinte Gray.
»Ein gerissener Mann«, meinte Quincy. »Äußerst gerissen. Wenn Ihr mir sagen möchtet, was er wollte, dann würde ich gern Nachforschungen über ihn anstellen.«
»Wenn ich mich nicht irre, war er hinter Jack her.«
»Hinter Jack dem Kammerdiener?«, fragte Quincy und tippte mit den Fingerspitzen auf das silberne Visitenkartentablett, das er in der Hand hielt. »Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Kein besonders einnehmender Junge. Auch kein Kammerdiener, wie Horace sagte. Er muss erst noch ausgebildet werden. Horace sagte, dass er das gern tun würde, aber der Junge meidet die Dienstboten und bleibt lieber für sich allein in den Schlafzimmern der Großtanten. Der Junge braucht auch anständige Kleider. Ich frage mich, warum Eure Großtanten nicht dafür gesorgt haben? Und warum sollte Sir Henry Jack den Kammerdiener haben wollen?«
»Gute Frage.«
Verrückter Jack, der weder Jack noch verrückt war, hatte Angst. Es war jetzt vier Tage her, seit sie aus ihrem Schlafzimmer in das Haus der Tanten geflohen war. Und jetzt waren sie hier in London, und sie musste sich als Junge ausgeben, weil die Tanten gesagt hatten, dass ihr Stiefvater sie hier sicher aufspüren und alles herauskommen würde, wenn sie ein junges Mädchen bei sich hatten. Das würde Ärger geben, und ihr Großneffe sollte nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten bekommen. Er sei so liebenswürdig, erzählten sie ihr jeden Abend, immer freundlich und überhaupt kein schlechter Kerl. Wie früher, hatte Mathilda gesagt.
Sie musste ein Kammerdiener bleiben, damit ihr Großneffe nicht einer möglichen Gewalttat von ihrem Stiefvater ausgesetzt war. Sie hatten geschwiegen, Blicke ausgetauscht und dann gesagt, der Baron sei der Sohn eines ebenfalls sehr unehrenhaften Mannes und sie wollten nicht, dass der Baron wie sein Vater würde und vielleicht versuchte, sie in seine Gewalt zu bringen und zu verführen. Jack konnte sich nicht vorstellen, dass irgendein Mann sie in seine Gewalt brachte, aber das war nicht von Bedeutung. Die Tanten machten sich eben Sorgen, und sie wussten bestimmt mehr darüber als sie, da sie mindestens dreimal so alt waren wie sie; also hielt sie den Mund.
Verrückter Jack. Sie musste unwillkürlich grinsen, als sie daran dachte, wie sie Jack erfunden hatten. Tante Mathilda hatte sie von oben bis unten angesehen und schließlich genickt. Und dann hatte sie mit ihrer tiefen, musikalischen Stimme nur ein Wort gesagt: »Reithosen.«
Tante Maude hatte mit ihren kleinen Händen gewedelt und gemeint: »Ja, das ist eine gute Idee. Wir machen einen Jungen aus ihr. Sie zieht sich die Kappe tief in die Stirn, und wir stecken sie in viel zu große Reithosen. Ah, der Kirchenbasar. Dort bekommen wir alles, was wir brauchen. Unser Großneffe, der arme liebe Junge, wird bei ihrem Aussehen nicht in Versuchung geraten, wenn sich herausstellen sollte, dass er nach seinem schlimmen Vater geraten ist.«
Sie hatte die Augen verdreht. »Ich sehe schrecklich aus, Tante Maude.«
»Jack«, hatte Tante Mathilda erwidert, ohne auf sie zu achten.
Tante Maude hatte genickt. »Ja, Jack ist ein sehr guter Name. Solide, unromantisch, ein Name, dem man vertrauen kann. Aber gab es nicht vor Jahren einmal einen Straßenräuber, der so hieß? Hieß er nicht Verrückter Jack oder so ähnlich?«
»Black Jack«, hatte Tante Mathilda erwidert. »Aber ›Verrückt‹ ist besser. Das ist unser Junge.«
»Ja, das war ein sehr romantischer, böser Mann«, hatte Tante Maude gesagt. »Nun, wenn der Baron auf irgendwelche seltsamen Gedanken kommen sollte, wenn er sie sieht, wird er denken: ›Jack‹, und er wird sich nicht mehr um sie kümmern.«
Jetzt war sie seit vier Tagen Jack. Wie lange ihr Stiefvater wohl brauchen würde, um sie zu finden?
Sie hatte den Baron nur einmal an diesem ersten Morgen gesehen, als sie angekommen waren, und da auch nur kurz, weil sie rasch den Kopf weggedreht hatte. Der Mann sah viel zu gut aus, auf eine blonde, blauäugige Wikingerweise. Jede andere Frau wäre ihm wahrscheinlich buchstäblich vor die Füße gesunken, aber sie spürte nur Abscheu und Furcht.
Sie hatte nur einen kurzen Blick auf ihn werfen können. Ob der junge Mann wohl wie sein Vater war? Verdorben bis auf die Knochen? War er wie ihr Stiefvater?
Ja, seine Großtanten hatten gesagt, der Vater des Barons habe schlechtes Blut gehabt, was bei den St. Cyres wohl häufig vorkam. Und sie glaubte den Großtanten. Wenn er ein Frauenheld war – wie ihr Stiefvater, wie sein eigener Vater –, dann würde sie eben Jack bleiben und ihn um jeden Preis meiden.
Als er sie angeblickt hatte, während sie mit den Koffern der Großtanten da gestanden hatte, hatte sie kurz diese müde Arroganz in seinen Augen gesehen, die von einem Wissen zeugte, das ein so junger Mann wie der Baron eigentlich noch nicht haben konnte. Es war schade, aber wahrscheinlich war er wirklich verdorben bis in die Stiefelspitzen.
Sie zog die Knie enger an die Brust.
In Gedanken sah sie das Gesicht ihres Stiefvaters, sein teuflisch gut aussehendes Gesicht, in das sich ihre Mutter einst verliebt hatte. Und dann war sie gestorben. Sie hörte ihn mit seiner tiefen, tönenden Stimme zornig schreien.
Und gestern hatte sie durch eine Botschaft, die die Haushälterin der Großtanten geschickt hatte, erfahren, dass Georgie wieder auf Carlisle Manor war.
Großer Gott, was sollte sie bloß tun?
Kapitel 4
Gray war müde. Außerdem war er immer noch wütend, mittlerweile auf eine ruhige und kalte Weise, aber er wusste, dass er Lilys Mann, hätte er nicht bei seinem Eintreten völlig betrunken in einer Ecke des Schlafzimmers gelegen, mit tödlicher Entschlossenheit niedergeschlagen hätte. Immerhin war Lily jetzt in Sicherheit, weil Charles Lumley zumindest so weit wieder zu Bewusstsein gekommen war, dass er begriff, dass Gray ihn ohne Zögern umbringen würde, wenn er jemals wieder seine Frau anfasste. Lumley, der zwar immer noch betrunken, aber kein Dummkopf war, hatte eingewilligt. Gray vertraute ihm nicht, aber er war gewillt abzuwarten.
Er holte noch einmal tief Luft. Es war erst eine Stunde vergangen, aber er kochte immer noch vor Wut.
Charles Lumley war ein schwacher Dreckskerl, der sich an sein Opfer nur herantraute, wenn es – wie seine Frau Lily – halb so groß war wie er. Nun, er würde sie nie mehr schlagen. Nie mehr, denn sonst würde Gray ihn umbringen.
Er ließ die Kutsche an der Ecke des Portman Square halten, bezahlte den Fahrer und ging zu seinem Stadthaus. Er wollte niemanden aufwecken, vor allem seine Großtanten nicht, und ihre Fenster lagen zur Straße. Er steckte gerade den Schlüssel ins Schloss der Haustür, als er aus den Augenwinkeln einen Lichtstrahl sah. Nein, dachte er, da ist nichts, drehte sich aber doch um. Da war es wieder – aus den Ställen drang ein Lichtstrahl. Sicher war sein Oberstallknecht Byron bei einem der Pferde. Wenn es nun etwas Ernstes war? Vielleicht hatte Brewster, sein Hengst, eine Kolik? Oder Durban hatte sich verletzt? Er ging zu den Ställen, die an der Straße lagen.
Das Licht ging aus. Die Ställe waren jetzt völlig dunkel. Das war äußerst seltsam. Sein Herz schlug schneller. Die Stalltür war aufgebrochen. Dann war es also nicht Byron.
Es war ein Einbrecher.
Du lieber Himmel, warum sollte jemand in die Ställe eines Mannes am Portman Square einbrechen? Das ergab einfach keinen Sinn. Er kannte sich in den Ställen gut aus. Er schlüpfte hinein und drückte sich sofort flach an die Wand zu seiner Rechten. Seine drei Reitpferde standen in separaten Boxen ein paar Meter entfernt. Gray verhielt sich ganz ruhig und lauschte. Dann hörte er, wie jemand mit einem der Pferde redete. Er sah, dass eine der Boxen offen stand, hörte wieder die leise, beruhigende Stimme. Der Einbrecher konnte ihn nicht sehen. Dann beobachtete er, wie sein grauer Wallach Durban den Kopf hochwarf und leise schnaubte. Der Einbrecher führte ihn heraus. Er sattelte den Grauen und schwang sich dann, mit der Leichtigkeit eines erfahrenen Reiters, auf seinen Rücken. Langsam kam Durban auf ihn zu.
Gray lächelte. Er hatte dieses betrunkene Schwein Lumley nicht zusammenschlagen können, aber jetzt war da dieser Einbrecher, und es bestand kein Zweifel an seiner Schuld. Er hatte den Dieb auf frischer Tat ertappt. Ganz leise sagte er: »Du verdammter kleiner Dreckskerl! Du entkommst mir nicht!« Und dann packte er den Dieb am Bein und zog ihn vom Pferd. Der Dieb stürzte zu Boden.
Gray trat ihn in die Rippen und hörte zufrieden, wie es knackte.
»Du verkommenes Schwein! Ich trete dir die Rippen aus dem Leib!«
»Das hast du schon getan.«
Der Dieb hörte sich nicht sehr alt an, und seine Stimme klang schmerzerfüllt. Es war ein Junge – das sah er jetzt –, ein Junge, der versucht hatte, sein Pferd zu stehlen, und auch davongekommen wäre, wenn Gray nicht im richtigen Moment aufgetaucht wäre.
»Ich sollte dich zusammenschlagen, du kleiner Gauner. Du stiehlst keins von meinen Pferden, verdammter Bettler.« Er packte den Jungen am Arm und zerrte ihn hoch, schüttelte ihn, verdrehte ihm den Arm. Am liebsten hätte er ihm den Kiefer zerschmettert. Und er lächelte dabei.
Der Dieb trat Gray gegen das Bein. Es tat weh, und Gray sah rot. Er packte den Jungen am Genick und schleuderte ihn gegen die Box von Wilhelm dem Eroberer. Der Chef, wie ihn die Stalljungen immer nannten, wieherte laut. Brewster antwortete ihm.
»Geht wieder schlafen, Chef, Brewster. Ich prügele nur die Schlechtigkeit aus einem Jungen, der Durban stehlen wollte, und weil Durban keinen Funken Verstand hat, hätte er auch noch ohne einen Laut zugelassen, dass der Dieb ihn mitnimmt.« Durban stand friedlich da und kaute Stroh. Der Dieb lag mitten im Stroh, und Gray lachte laut auf.
»Du hast dir ein bisschen den Kopf angeschlagen, nicht wahr, du kleiner Narr? Komm her und lass mich dir noch ein paar Rippen zerquetschen!« Aber der Dieb bewegte sich nicht, er lag einfach nur so da. Gray trat zu ihm und zerrte ihn hoch. »Tritt mich noch einmal, und ich prügele dich durch ganz London!«
Er schüttelte den Jungen.
»Wage es nicht, einen Laut von dir zu geben!« Er schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Dieb sank zu Boden.
»Das war doch nur ein leichtes Streicheln. Verdammt, steh auf!« Der Dieb rührte sich nicht.
Dieser feige Kerl war doch wahrhaftig in Ohnmacht gefallen. Von dem kleinen Schubs in die Rippen? Von dem leichten Schlag auf den Kiefer? Er hatte ja noch nicht einmal angefangen, und da brach der Junge schon zusammen? Er hob ihn hoch, schüttelte ihn und schlug ihm ein paarmal ins Gesicht, aber der Dieb rührte sich nicht. Leblos hing er in seinen Armen. Gray ließ ihn wieder los.
»Verdammt«, fluchte Gray und kniete sich neben den Jungen. Er zündete die Stalllaterne an und leuchtete ihm ins Gesicht.
Noch bevor er ihn betrachten konnte, kam der Junge hoch, rammte seine Faust in Grays Gesicht und krabbelte dann hektisch weg.
»Verdammter Junge«, rief Gray und rieb sich das Kinn. »Das habe ich mir gedacht. Du bist klein und dünn. Du hast keine einzige Bartstoppel am Kinn und bist noch nicht einmal alt genug, um dich zu rasieren. Ich glaube, ich prügele dich auf die Straße. Das wird dich lehren, in den Stall eines Mannes einzubrechen und seine Pferde zu stehlen.« Er rieb noch einmal über sein Kinn. »Du hattest die Frechheit, mich zu schlagen«, sagte er und holte mit der Faust aus. Der Junge wich dem Schlag aus, aber Gray traf ihn an der Seite des Gesichts und am linken Ohr. Dann legte er ihm die Hände um den Hals und drückte zu. Der Junge packte seine Hände und versuchte, sie wegzuziehen. Als die Arme des Jungen schlaff heruntersanken, kam Gray zur Besinnung. Er schüttelte sich. Um Gottes willen, fast hatte er einen Jungen umgebracht, weil dieser in seinen Stall eingedrungen war und ein Pferd stehlen wollte. Er ließ von ihm ab und kniete sich hin. Der Junge lag einfach nur da, mit geschlossenen Augen, und sagte nichts.
»Sag etwas, verdammt. Ich habe dich nicht umgebracht, ich kann dich atmen sehen. Du rappelst dich besser wieder auf, bevor ich dich persönlich in Newgate abliefere.«
Der Junge lag immer noch da und sagte nichts. Er hob die Hände und begann, sich den Hals zu reiben. Dann schlug er die Augen auf und sagte: »Ich glaube, Ihr habt mir etwas gebrochen.«
»Du hättest es verdient, aber ich habe keine von deinen verdammten Rippen gebrochen. Ich habe dir doch nur einen kleinen Schubs gegeben. Jammer nicht und steh auf. Du wolltest immerhin ein Pferd stehlen, da ist eine gebrochene Rippe das Mindeste, was du verdienst, und dabei habe ich dir noch nicht einmal eine gebrochen. Betrachte es einfach als den Beginn der Strafe für den heutigen Abend.«
Gray schwieg auf einmal. O nein, dachte er. O nein. Er hob die Laterne und leuchtete dem Jungen ins Gesicht. Der Junge versuchte, sich abzuwenden, aber Gray hielt ihn fest und sagte langsam: »Na, zum Teufel. Du bist Jack, nicht wahr? Du bist doch der Kammerdiener meiner Großtanten! Warum wolltest du mein Pferd stehlen? Los, du kleiner Dreckskerl, antworte!« Er hob die Hand und ballte sie zur Faust. Die Haut an den Knöcheln war abgeschürft. Er hatte sich an dem kleinen Bastard die Knöchel verletzt. Das war nicht gerecht.
»Ja, ich bin Jack.« Mit diesen Worten drehte der Junge sich um und übergab sich ins Stroh. »Im Übrigen bin ich überhaupt nicht verrückt. Ich wünschte, die Tanten hätten Euch nichts dergleichen erzählt.«
»Nun, sie haben es aber erzählt, und langsam beginne ich zu verstehen, warum. Sie haben gemeint, du seist lebhaft. Dass du auch ein Dieb bist, haben sie allerdings nicht erwähnt.« Gray hockte sich hin. Er zog ein Taschentuch aus der Jackentasche und reichte es dem Jungen. »Hier, mach dich sauber. Ich will nicht, dass du stinkst, wenn ich dich nach Newgate bringe. Wenn dein Verhalten ein Beispiel dafür ist, was die Tanten gemeint haben, dann bist du ziemlich verrückt. Und auch noch dumm, wenn du glaubst, du kämest damit durch, mir ein Pferd zu stehlen.«
Der Junge wischte sich den Mund mit dem Taschentuch ab. Langsam stand er auf. Dann trat er plötzlich, ohne Vorwarnung, die Lampe weg und verschwand im dunklen Stall. Gray sprang auf. Er hörte ein Geräusch, reagierte aber nicht schnell genug. Die Laterne traf ihn hart am Hinterkopf, und er wurde bewusstlos.
Er wusste nicht, wie lange er bewusstlos gewesen war, hoffentlich nur ein oder zwei Minuten. Ja, mehr konnte es nicht sein. Schwankend stand er auf und stöhnte, als er merkte, wie weh ihm sein Kopf tat. Er rannte aus dem Stall und sah gerade noch, wie der Junge auf Durban die Straße hinunterritt.