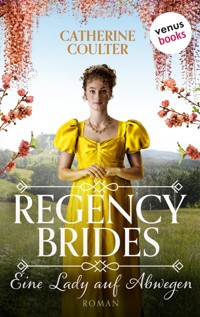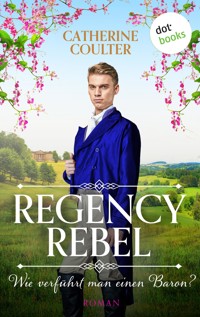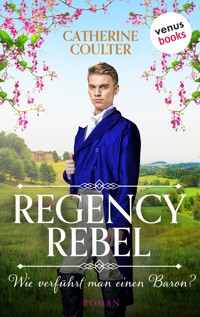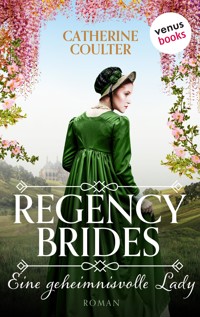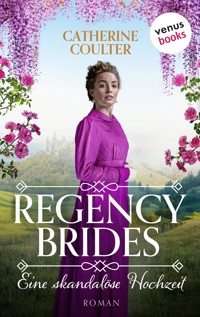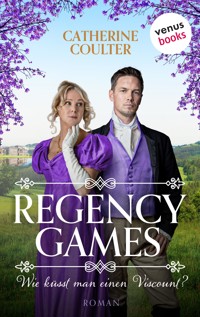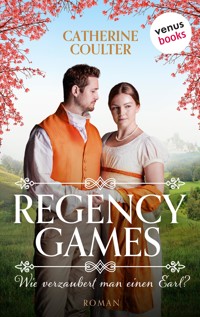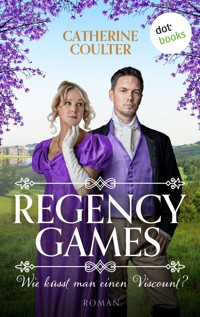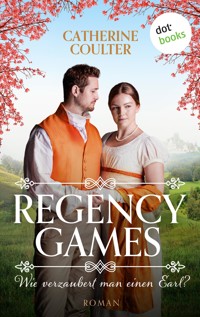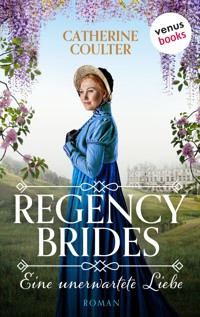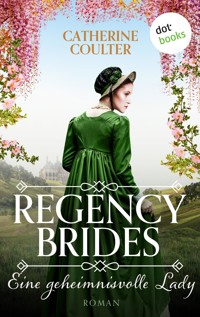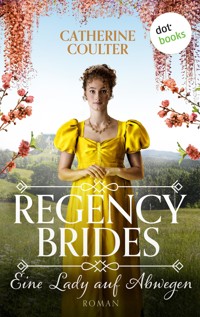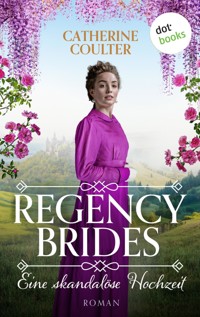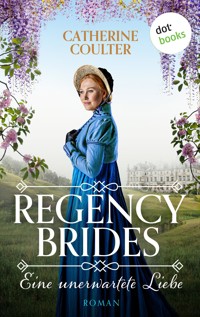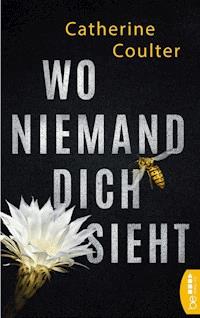4,99 €
4,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die junge Julia findet nach dem brutalen Tod ihres Mannes keine Ruhe. Als sie bei einem nächtlichen Spaziergang auf dem Pier 39 in San Francisco ins Meer gestoßen wird, entgeht sie nur knapp dem Tod. Special Agent Cheney Stone glaubt, dass Julia umgebracht werden sollte.
Gefühl und Suspense: nach „Angst“ ein neuer, mitreißender FBI-Thriller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2009
4,4 (16 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Widmung
KAPITEL 1
San Francisco Donnerstagabend
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
Copyright
Das Buch
Auguste Ransom war ein angesehener Parapsychologe. Hängt der perfekt inszenierte Angriff auf seine Ehefrau mit dem Mord an ihrem Mann zusammen? FBI-Agent Cheney Stone rollt den Mordfall an Auguste noch einmal auf. Und stößt dabei auf mysteriöse Parallelen zu einem anderen Fall. Weitere Morde treiben ihn und seine Kollegen Dillon Savich und Lacey Sherlock in eine geheimnisvolle und gefährliche Welt, in der der Schein nicht nur trügt, sondern tödlich sein kann.
Spannung und Action pur für alle Leserinnen von Nora Roberts, Heather Graham und Iris Johansen - und für alle Fans, die dem neuen Thriller der Starautorin entgegenfiebern.
Die Autorin
Catherine Coulter ist seit langem eine überaus erfolgreiche Romanautorin, doch erst mit ihren aufregenden Psychothrillern gelang ihr der große Durchbruch. Ihre Bücher stürmen regelmäßig die Bestsellerlisten der New York Times. Die Autorin lebt in Nordkalifornien.
Lieferbare Titel
Angst
Für meine wunderbare Schwester Dianeund ihren Ehemann Larry Horton.
Ich wünsche euch beiden ein Übermaß an Glück.
Catherine
KAPITEL 1
San Francisco Donnerstagabend
Julia pfiff vor sich hin. Sie war glücklich, wirklich glücklich, zum ersten Mal seit einer halben Ewigkeit. Die Polizei hatte endlich aufgegeben, und die Medien hatten sich neuen, reizvolleren Geschichten zugewandt, um ihre Quoten hoch zu halten. Und auch die seelenlosen Paparazzi, die ihr zuvor hinter Sträuchern, Autos und Bäumen aufgelauert hatten, um sie zu erwischen (Wobei eigentlich? Hatten sie gehofft, dass sie einen Liebhaber traf, damit sie die Fotos davon an den National Enquirer verscherbeln konnten? Oder vielleicht, dass sie in aller Öffentlichkeit ein Mordgeständnis ablegte?), hatten sich nach sechs endlosen Monaten zurückgezogen und richteten ihre lästigen Kameras wieder auf Filmstars und Prominente, die um einiges interessanter waren als sie. Eigentlich war ihr Mann, Dr. August Ransom, derjenige gewesen, der die Medien anzog, nicht sie. Sie hatte nur eine zeitweilige Abwechslung dargestellt: die schwarze Witwe, die wahrscheinlich mit dem Mord an einem sehr berühmten Mann und Medium davongekommen war, an einem Mann, der mit den Toten sprach.
Frei, endlich bin ich frei.
Sie wusste nicht, wie weit sie von ihrem Haus in Pacific Heights aus gelaufen war, doch nun fand sie sich am Pier 39 an der Bucht wieder, dieser urtümlichsten aller Sehenswürdigkeiten, mit all den Läden, den pfiffigen weißgesichtigen Pantomimen und den ortsansässigen Seelöwen, alles nur einen Steinwurf vom Fisherman’s Wharf entfernt. Sie war in der himmlischen Confiserie gewesen und stand nun am Geländer an der Westseite des Pier 39, kaute genüsslich ihr köstliches Walnuss-Fudge und beobachtete dabei die übergewichtigen Seelöwen, die sich auf den hölzernen Pontons vor dem Pier rekelten. Um sie herum unterhielten sich Leute, lachten, machten Witze, stritten sich. Eltern drohten ihren Kindern oder versuchten, sie zu bestechen. Alles fühlte sich so normal an - es war wunderbar. Im April in San Francisco waren nicht die Regenschauer für die Maiblumen verantwortlich, sondern der herrliche Nebel, der von der Golden Gate Bridge heranrollte. Erstaunlicherweise hatte selbst die Luft einen speziellen Aprilnebelduft - frisch, würzig und ein wenig herb.
Sie ging zum Ende des Piers und schaute über das Wasser auf Alcatraz, das eigentlich gar nicht so weit entfernt war. Doch bei dem Versuch, die Strecke schwimmend zu überwinden, konnte man schon nach wenigen Minuten in dem eiskalten Wasser oder der unvorhersehbaren Strömung sterben.
Sie drehte sich um, stützte die Ellbogen auf das Geländer und beobachtete die Menschen um sie herum voller Lebenslust. Nur wenige spazierten ganz bis zum Ende des Piers. Die Lichter gingen an. Es wurde schnell kühl, doch in ihrer flippigen Lederjacke fror sie nicht. Sie hatte ihre Lieblingsjacke schon zu Collegezeiten bei einem Garagenflohmarkt in Boston entdeckt. August war immer gleichzeitig sauer und amüsiert gewesen, wenn sie sie getragen hatte. Weil sie seine Gefühle nicht verletzen wollte, hatte sie ihm nie gesagt, dass sie sich in der Jacke wieder jung fühlte - beschwingt, sowohl körperlich als auch geistig. Aber August war nicht hier, und sie fühlte sich in diesem Moment so jung und ausgelassen, als könne sie geradewegs von den dicken Holzplanken emporschweben.
Sie hatte nicht auf die Zeit geachtet, doch plötzlich nahm die Stille um sie herum zu, und alle Lichter waren bereits an. Die wenigen Touristen, die noch nicht zu ihren Hotels zurückgekehrt waren, hatten sich zum Abendessen auf das halbe Dutzend Restaurants in der Umgebung verteilt. Sie sah auf die Uhr - fast halb acht. Sie erinnerte sich an ihre Verabredung um acht im Fountain Club mit Wallace Tammerlane, ein Name, den er ohne Zweifel erfunden hatte, als er vor dreißig Jahren ins Hellsehergeschäft eingestiegen war. Er war ein langjähriger Freund von August gewesen, hatte ihr unzählige Male seit dem Tod ihres Mannes beteuert, dass August in Die Glückseligkeit aufgenommen worden sei, dass August nicht wisse, wer ihn ermordet hat, und dass es ihn nicht besonders kümmere. Er sei jetzt glücklich und würde immer auf sie aufpassen.
Julia hatte seine Worte angenommen. Immerhin war Wallace Augusts Freund gewesen. Doch sie wusste auch, dass August über viele dieser sogenannten hellsichtigen Medien gespöttelt und über ihre Mätzchen angewidert den Kopf geschüttelt hatte, obwohl er ihre geschickte Zurschaustellung rühmte. Was glaubte sie? Wie viele andere wollte auch Julia gerne glauben, dass es besondere Menschen gab, die mit den Toten sprechen konnten. Tief in ihrem Innern war sie davon überzeugt, dass August einer von ihnen war, doch es gab nur sehr wenige wie ihn. Sie hatte in den Jahren mit ihm so viele Hochstapler gesehen und kennengelernt. Obwohl sie sich dazu nicht geäußert hatte, machte es sie doch skeptisch, dass ihnen zufolge alle Verstorbenen, egal wie sie gegangen waren, im Jenseits stets glückselig und zufrieden waren und in Frieden ruhten, ja sogar mit ihren toten Haustieren wieder vereint waren. Und sie fragte sich unweigerlich, ob August wirklich sorglos war in der Glückseligkeit, ob er nicht doch wollte, dass sein Mörder bezahlte. Wer würde das nicht wollen? Sie schon. Sie hatte seine Freunde und Kollegen in Wahrsagerkreisen gefragt, ob sie herausfinden könnten, wer ihn getötet hat, doch offenbar besaß keiner von ihnen dieses spezielle Talent. Der Mangel an Vision war bedauerlich, besonders für Julia, da die Polizei sich auf sie eingeschossen hatte und allem Anschein nach keine andere Spur verfolgte.
Sie wusste nicht, ob August mit diesem ungewöhnlichen Talent gesegnet gewesen war. In Fernsehserien konnten Hellseher Mörder ausfindig machen, sie sogar zur Strecke bringen. Sie konnten sehen, wen sie töteten und wie sie es taten, und wer bei der Aufklärung helfen konnte. War das alles nur Show, oder gab es solche Menschen wirklich? Sie wusste es nicht.
Wer hat dich umgebracht, August, wer? Und warum? Das war noch immer die allgegenwärtige Frage. Warum?
Augusts Anwalt, Zion Leftwitz, hatte sie nach dem Tod ihres Mannes angerufen. Es sei sehr wichtig, hatte er ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen, es gehe um ihre Verantwortung gegenüber Augusts Besitz. Sie wusste, dass dieser Besitz nicht allzu umfangreich war.
Verpflichtungen, dachte sie, achtzig Prozent eines Lebens bestehen aus Verpflichtungen.
Sie hatte wahrlich keine Lust, mit Wallace zu Abend zu essen, seinen tröstenden Worten zu lauschen und zu hören, dass August jetzt seinen Frieden gefunden hatte. Dann müsste sie sich unausweichlich auch Geschichten über Wallace’ neuestes Erfolgserlebnis anhören. Vielleicht hatte er den lange verstorbenen Großvater des Bürgermeisters kontaktiert. Sie war sich hundertprozentig sicher, dass Wallace ihre Hochstimmung dämpfen würde. Und es bedeutete auch, dass sie ein Taxi nach Hause nehmen musste. Sie musste diesen magischen Ort verlassen, musste sich beeilen.
»Entschuldigen Sie bitte, das ist doch Alcatraz dort drüben, oder?«
Sie drehte sich um und erblickte einen großen Schwarzen mit markantem Kinn und Brille in einem langen Mantel neben ihr, der sie anlächelte.
Sie lächelte ebenfalls. »Ja, das stimmt.«
»Da fahre ich morgen hin. Aber heute … Wissen Sie, wann die nächste Fähre nach Sausalito ablegt?«
»Nein. Aber man muss nie lange warten. Es hängt ein Plan an der Seite des Gebäudes da drüben, nicht mal fünf Minuten vom Pier 39 …« Als sie sich leicht wegdrehte, um es ihm zu zeigen, schmetterte er ihr die Faust gegen das Kinn. Die Wucht des Schlages warf sie rückwärts gegen das hölzerne Geländer. Vor ihren Augen blitzte ein Licht auf, dann erblickte sie etwas Glänzendes in seiner Hand, etwas Scharfes - o Gott, ein Messer. Warum? Die Angst schnürte ihr die Kehle zu. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt der silbernen Messerspitze.
Plötzlich rief ein Mann: »FBI! Hören Sie sofort auf, treten Sie zurück von ihr, oder ich schieße!«
Der Mann mit dem Messer hielt einen Augenblick inne und fluchte. Dann hievte er sie mit einer schnellen Bewegung hoch und warf sie über das Geländer in die Bucht. Sie fiel platschend ins eisige Wasser und rollte über die schwarzen Steine, die scharf wie Stilettklingen in ihre Haut stachen. Sie versuchte, gegen die Bewegung anzukämpfen, aber für einen kurzen Moment wurde ihr mit aller Schärfe bewusst, dass sie dem nicht entrinnen konnte, dass sie immer weiter fallen würde … Heulte da ein Seelöwe? Rief da jemand? Egal, denn alles um sie herum versank in Schwärze, als ihr Körper den steinigen Boden der Bucht berührte und das Wasser über sie hinwegwusch. Ihr letzter Gedanke, kaum mehr als ein Echo, war, dass sie nun nie mehr die Chance bekommen würde, wirklich glücklich zu werden.
KAPITEL 2
Der Druck auf ihre Brust erfolgte rhythmisch und fest, schien aber irgendwie außerhalb ihres Körpers zu sein. Dann spürte sie einen Mund auf ihrem, und ein enormer warmer Luftstoß schoss tief in ihren Hals und füllte dann ihre Lunge. Es fühlte sich seltsam an, aber es war ihr egal. Sie dämmerte hinweg.
Eine raue Männerstimme rief ihr ins Gesicht: »Nicht aufgeben! Hören Sie mich? Kommen Sie ja zurück. Na los! Ich hatte schon genug Ärger damit, Sie aus der verdammten Bucht zu ziehen, so ganz ohne Leiter. Wir hatten Glück, dass wir nicht beide ertrunken sind. Also, wagen Sie es ja nicht, jetzt aufzugeben!«
Sie fühlte einen Klaps auf der Wange, zwei, hart und brennend, dann noch mehr Druck auf ihrer Brust, der sie weiter zu sich kommen ließ. Der Druck erfüllte sie, und sie spürte jeden ruppigen Stoß bis ins Rückgrat.
»Kommen Sie schon zurück! Zum Teufel, atmen Sie!«
Sein Mund befand sich wieder auf ihrem, und sein Atem war heiß. Willkommene Wärme, die tief in sie eindrang. Sie fror so sehr, doch dieser heiße Atem glich dem Pumpen eines Blasebalgs. Plötzlich wollte sie diese Hitze unbedingt. Sie sog sie gierig ein.
Die Stimme des Mannes, dessen Atem warm über ihre Wange strich, ertönte wiederholt: »So ist’s gut, ja, kommen Sie, Sie können das. Nicht aufgeben!«
»Mehr«, flüsterte sie und war sich nicht sicher, ob sie es auch laut gesagt hatte. Er drehte sie auf den Bauch und schlug ihr mit den Fäusten auf den Rücken. Als das Wasser aus ihrem Mund sprudelte, drehte er sie schnell auf die Seite. Sie keuchte und schnappte nach Luft. Ihr war so kalt, dass sie schreien wollte, doch er schlug ihr wieder auf den Rücken, und mehr Wasser bahnte sich den Weg nach draußen. Dann tröpfelte ihr endlich der letzte Rest am Kinn hinunter.
Sie schnaufte und zitterte. Mit heiserer Stimme sagte sie: »Die Seelöwen rufen nicht mehr.«
Die harten Schläge auf ihren Rücken hörten auf. Der Mann sagte: »Ja, die haben für heute Feierabend. Halten Sie jetzt durch.« Er rieb ihr rhythmisch den Rücken, und sie hustete wieder, heiser und laut, und weiteres Wasser tropfte aus ihrem Mund. Wo kam nur all das Wasser her?
Als er ihr keinen Tropfen mehr entlocken konnte, zog er sie zum Sitzen hoch und drückte ihr den Kopf zwischen die Knie. Sie atmete schwer und konnte nicht aufhören zu zittern.
»Gut so, schön tief atmen.« Er zog ihr die Lederjacke aus und legte ihr sein schweres Sakko um.
Sie bekam Schluckauf. »Meine Jacke, meine schöne Jacke. Ich habe sie seit dem zweiten Jahr am Boston College.«
»Die ist schon so schäbig, sie wird’s überleben. Was macht schon ein wenig Wasser? Also, ich kam vorhin aus dem Crab House und sah, wie ein Typ Ihnen eins aufs Kinn verpasste - und ich habe das Messer gesehen. Als ich ihn anschrie, wurde ihm wohl klar, dass die Zeit abgelaufen war, und er warf Sie übers Geländer. Er wusste, ich konnte ihn nicht verfolgen, weil ich mich erst um Sie kümmern und Sie aus dem Wasser ziehen musste. Ich konnte nicht mal auf ihn schießen, weil ich keine Zeit dafür hatte.«
»Auf ihn schießen? Was in aller Welt meinen Sie damit?«
Die Stimme eines anderen Mannes drang aus der Dunkelheit zu ihr. »He, Cheney, kann man dich nicht mal eine Minute alleine lassen? Wo ist June? Ich dachte, sie wäre nur auf eine Zigarette rausgegangen. Und du wolltest sie holen. Was ist hier eigentlich los? Wer ist das denn?«
Der Mann kam herübergerannt, kniete sich neben sie und starrte sie mit entsetzter Miene an. »Was ist denn passiert? Hat sie versucht, sich umzubringen?«
Er hatte ihren Retter gefragt, aber sie war doch am Leben, vielen Dank auch, also antwortete sie: »Nein, mich hat einer geschlagen, aber er hatte keine Zeit mehr, mich zu erledigen, also hat er mich übers Geländer geworfen. Es ging alles so schnell, dass ich gar nicht reagieren konnte. Er - Cheney - hat ihn aufgehalten. Er hat mich gerettet.« Sie lächelte schief. »Das ist ein ungewöhnlicher Name, aber ich bin an ungewöhnliche Namen gewöhnt. Meiner ist dagegen eigentlich eher langweilig.«
»Wie heißen Sie?«
»Julia.«
Cheney lächelte und rieb ihr weiter den Rücken. »Das ist überhaupt nicht langweilig.«
Der andere Mann starrte sie an, als sei sie verrückt, doch es war ihr egal. Sie war auf eine angenehme Weise müde und sank auf Cheneys Hände zurück. »Mein Kiefer fühlt sich an, als wäre mein Gesicht explodiert.«
»Ja, das glaube ich«, sagte Cheney. »Nein, nein, lassen Sie sich jetzt nicht hängen. Setzen Sie sich gerade hin, das können Sie.« Cheney half ihr, sich wieder aufzusetzen, und schlug ihr noch ein paarmal auf den Rücken. Gott sei Dank war nichts mehr da, das noch hochkommen könnte. »Das war’s. Da ist kein Wasser mehr drin. Jetzt sammeln Sie sich, Julia. Das wird schon wieder.« Er fasste sie an der Schulter und schüttelte sie. »Zeit, sich zusammenzureißen. Kommen Sie schon!«
Sie öffnete die Augen und rief: »Hören Sie auf, verdammt noch mal! Sie brechen mir noch den Hals.«
Er hörte mit dem Schütteln auf. »Na gut, aber versuchen Sie, nicht wieder wegzutreten, oder ich muss Sie noch mal schlagen.«
Sie hörte eine Frauenstimme. »Cheney? Manny? Was ist hier los? Ich war mit meiner Zigarette fertig, aber keiner von euch war am Tisch, als ich zurückkam. Linda meinte, Manny wäre dich suchen gegangen, Cheney. Kommt wieder rein, sie haben gerade unser Essen gebracht. He, was soll das denn hier?«
Cheney stand langsam auf und zog Julia mit sich hoch, wobei er sie an der Seite stützte, damit sie nicht umfiel. Nein, so ging es nicht. Er hob sie in seine Arme. »Tut mir leid, June. Ich schätze, ich bin wieder im Dienst. Geh doch mit Manny wieder rein und genießt euren Cioppino. Er soll die Spezialität im Crab House sein, der beste in ganz San Francisco. Das hier ist Arbeit, also muss ich mich darum kümmern. Bis später.«
»Ich bin keine Arbeit. Ich bin Julia.«
»Ja, ich weiß.«
»Wie spät ist es?«
»Fast acht.«
»Oje, ich glaube nicht, dass ich es zum Abendessen mit Wallace schaffe.«
June sagte: »Was meint sie mit ›sie ist Julia‹? Du bist klatschnass, Cheney, wer ist diese Frau, was …?«
Manny sagte: »Willst du, dass ich den Notruf wähle?«
»Lasst mal, geht ihr wieder rein und amüsiert euch. Ich mache das schon. Tut mir leid, June. Ich ruf dich morgen an.« Cheney hoffte, dass die nun stille Frau in seinen Armen ihm nicht erfrieren würde, besonders nicht nach der ganzen schweren Arbeit, nicht nachdem er sie in sein wollenes Sakko eingepackt hatte.
Manny sagte: »Dafür werden also unsere Steuergelder benutzt. Komm, June. Cheney, danke für die Aufregung. Ruf mich morgen an und erzähl mir, wie sich das entwickelt.«
Cheney nickte Manny zu, während er sein Handy herausholte und den Notruf wählte. »Ich brauche einen Krankenwagen am Pier 39 …«
Plötzlich ergaben seine Worte für sie einen Sinn. Mit allerletzter Kraft griff sie nach seinem nassen Kragen. »Bitte, bitte kein Krankenhaus, keine Sanitäter, keine Ärzte, um Gottes willen, Cheney …«
»Aber, Julia, Sie …«
»Ich sterbe, wenn Sie mich ins Krankenhaus bringen.«
Die absolute Bestimmtheit in ihrer Stimme ließ ihn innehalten. Er schaltete das Handy aus. »Also gut, kein Krankenhaus. Was dann? Wo wohnen Sie?«
Er sah, dass sie Angst davor hatte, es ihm zu sagen.
Ein paar Touristen standen einige Meter entfernt, beobachteten und tuschelten über sie. »Na toll. Ich rette Ihnen den Arsch, und Sie haben Angst, mir zu sagen, wo Sie wohnen. Sagen Sie mir wenigstens Ihren vollen Namen, Julia?«
Sie wollte den Kopf schütteln, aber das war einfach zu viel. Sie flüsterte: »Julia … Jones.«
»Ah ja, hört sich echt glaubhaft an. Geben Sie mir Ihre Adresse, oder ich fahre Sie sofort rüber ins San Francisco General.«
Sie nannte ihre Adresse. Unerträgliche Angst machte sich in ihr breit. Ihr lädierter Kiefer pulsierte, und ein stechender Schmerz flammte plötzlich in jedem Teil ihres Körpers auf. Aber sie hatte noch seine Jacke … »Hoffentlich ruiniere ich nicht Ihr schönes Sakko. Das ist sehr feine Wolle.«
»Genau wie Ihre Lederjacke hat es schon viel durchgemacht.«
Cheney schleppte sie den langen Weg zum Eingang des Pier 39, mit ihrer nassen Lederjacke über seinem Sakko. Er schüttelte sie ab und zu und sagte: »Schlafen Sie ja nicht ein. Ich meine es ernst.«
Er glaubte so etwas zu hören wie, sie sei doch nicht blöd, aber war sich nicht ganz sicher.
KAPITEL 3
Die meisten Geschäfte am Pier waren jetzt geschlossen und dunkel, und nur noch wenige Touristen waren unterwegs. Eine Frau mit zwei Kindern im Schlepptau fragte, ob er Hilfe brauche.
»Nein, ich habe alles im Griff. Dankeschön.«
»Das ist aber nett von ihr«, sagte Julia und nickte der Frau zu, die ihnen hinterherstarrte. Cheney grunzte. Er war nass und fror, seine Füße quietschten in den auf Hochglanz polierten Lederstiefeln. Ihr Kopf lehnte auf seiner Schulter.
»Wachen Sie auf, zum Teufel!«
»Ist ja gut.« Aber die Worte kamen undeutlich. »Warum ist denn Ihr Sakko nicht nass?«
»Ich war schlau genug, es auszuziehen, und meine Waffe, meine Brieftasche und mein Handy auf den Pier zu werfen, bevor ich Ihnen hinterhersprang.«
Nach zehnminütigen Auseinandersetzungen mit dem Parkhauswächter, der Cheney unter anderem dazu zwang, zum Pier 39 zurückzugehen, damit er seinen Parkschein abstempeln lassen konnte und nicht die horrende Parkgebühr selbst zahlen musste, fuhr er zur Lombard Street, dann links auf die Fillmore und anschließend rechts auf den Broadway, bis sie sagte: »Das dort ist es, auf der linken Seite, wo kein Licht brennt.« Er fuhr in die Auffahrt einer Villa, denn anders konnte man dieses herrliche dreistöckige Backsteinhaus mit den großen, dichten Sträuchern auf beiden Seiten nicht bezeichnen. Efeu rankte an der hellen Steinwand empor. Er parkte in der leeren Dreifacheinfahrt, geradezu ein Wunder in San Francisco, wo selbst ein Heiliger bei dem Versuch, einen Parkplatz vor der Reinigung zu finden, durchdrehen konnte. Cheney war sich sicher, dass die Aussicht aus allen Fenstern zum Sterben schön war.
»Nette Hütte«, sagte er.
Er hatte die ganze Zeit mit ihr geredet, nein, eher zu ihr, sie hatte nur ab und zu eine Antwort gemurmelt, damit er wusste, dass sie durchhielt. Die Heizung in seinem Auto war auf Hochtouren gelaufen, und er wunderte sich, dass seine nassen Sachen noch nicht dampften. Dass er sie nach Hause brachte, war absurd, das war ihm klar. Wenn sie medizinische Hilfe brauchte, dann kannte er einen Arzt, der ihm noch einen Gefallen schuldete. Er würde nie vergessen, wie ihm Dillon Savich in Quantico gesagt hatte, dass es immer klug sei, einen Arzt in seiner Schuld stehen zu haben, weil man ja schließlich nie wissen könne, wann man mal einen brauchen würde. Jetzt war wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt. Julia zitterte wie Espenlaub, trotz seiner Jacke und trotz der Wahnsinnshitze aus der Lüftung.
»Ihre Handtasche«, sagte er. »Sie haben sie nicht mehr.«
»Ich hatte keine Handtasche dabei, die Hausschlüssel waren in meiner Jackentasche, eingewickelt in einen Zwanzigdollarschein.«
Er durchstöberte beide Taschen ihrer tropfnassen Lederjacke, zog aber nur ein zerknülltes feuchtes Papiertaschentuch hervor. »Keine Schlüssel. Wie kriege ich Sie jetzt ins Haus?«
Sie versuchte offenbar, eine Lösung zu finden. Er wartete und fragte sie dann erneut. »Ich denke nach«, sagte sie unsicher. Das beunruhigte ihn, und er fragte sich, was Dr. Ben Vrees wohl an diesem wunderschönen Donnerstagabend auf seinem Hausboot in Sausalito trieb.
Er packte sie an den Schultern und schüttelte sie kräftig.
»Wie kommen wir rein, Julia?«
»Es gibt einen Schlüssel unter den Stiefmütterchen ganz unten im zweiten Topf neben der Haustür.«
»Wow, was für ein tolles Versteck«, sagte er und rollte mit den Augen.
»Dann will ich mal sehen, wie Sie ihn finden«, antwortete sie mit schriller, beinahe garstiger Stimme.
Er lächelte. Sie war offensichtlich wieder ganz bei sich.
Er brauchte mindestens drei Minuten, bis er sich auf der Suche nach dem verdammten Schlüssel ganz zum Boden des großen Topfes, der mit violetten Stiefmütterchen bepflanzt war, vorgearbeitet hatte. Er musste den Schlüssel dann auch noch an seiner einst schönen schwarzen Hose abwischen, die er extra für sein erstes Date seit mehr als zwei Monaten ganz hinten aus dem Schrank hervorgekramt hatte. June Canning war eine sehr nette Frau, Brokerin für die Pazifische Börse. Er seufzte. Na ja, wer wollte schon die Zeit zwischen den Menügängen mit einer Frau im Freien verbringen, die immer noch rauchte? Und das in Kalifornien?
Der Alarm ging nicht an, als er die Tür aufschloss. Großer Fehler, dachte er. Er ging zurück zu seinem Audi, ein Auto, das zwar ein bisschen zu klein war für einen Mann seiner Größe, mit dem er aber fast überall in der Stadt parken konnte, selbst in der schmalen Gasse neben der Reinigung. Er hob Julia heraus und hielt sie an seiner Seite.
Als sie im Haus waren, fand er den Schalter in der Eingangshalle und machte das Licht an. Er konnte es sich nicht verkneifen, mit aufgerissenen Augen zu gaffen. In seinem ganzen Leben war er noch nie in solch einem spektakulären Haus gewesen. Zwar war er in den letzten vier Jahren in San Francisco schon in einigen wunderschön restaurierten Häusern in Pacific Heights gewesen, doch keines von ihnen konnte mit diesem mithalten. Er blieb nicht stehen, sondern führte sie einfach gleich die breite Marmortreppe, deren Treppenpfosten mit kunstvoll geschnitzten Ananas verziert waren, nach oben. Die Treppe führte zu einem geräumigen Absatz im ersten Stock, von wo aus man auf die riesige Eingangshalle herabblickte, deren Decke drei Stockwerke hoch war, wie in einer Kathedrale. Ein antiker goldener Kristallkronleuchter hing fast fünf Meter herab. Er fragte sich, wie viel das Teil wohl wiegen mochte und was man tun musste, um es zu reinigen.
»Wo geht’s lang?«
»Links herum.«
»Welches Schlafzimmer ist Ihres? Oh, was für ein netter Gedanke, oder - gibt es einen Ehemann, der sich hier irgendwo versteckt?«
»Nicht mehr«, sagte sie mit flacher Stimme. »Ganz am Ende des Flurs.«
Der Flur war breit, die herrlich polierten Ahorndielen glänzten um den antiken Teppich, der die gesamte Länge einnahm. Er hätte eigentlich vorbereitet sein sollen, als er das Licht im Schlafzimmer einschaltete. Er hielt für einen Moment in seinen Bewegungen inne. Es war riesig, größer als sein Wohnzimmer, mit einer unfassbar hohen Decke und aufwendig gestalteten Stuckverzierungen. Es gab noch eine weitere Tür, die in einen überdimensionalen begehbaren Kleiderschrank führte. Die nächste Tür gab den Blick frei auf ein gigantisches Badezimmer, das in cremig gelben Fliesen gehalten war, die in zufälliger Anordnung von Zierfliesen mit bunten italienischen Landszenerien am Boden und an den Wänden aufgelockert wurden.
Er setzte sie auf den Toilettendeckel und drehte die Dusche auf, prüfte mit der Hand die Wassertemperatur. Als es schön heiß war, wandte er sich zu ihr um, als sie gerade wieder mit dem Oberkörper nach vorne sank. Er zog sie bis auf die Unterwäsche aus - vernünftiges Zeug, nichts Gerüschtes oder Bauschiges -, öffnete die Duschkabine und blickte dann Julia an. Wenn er sie in die Dusche steckte, konnte sie umfallen und sich dabei verletzen. Und außerdem fror er jetzt auch.
Er setzte sie vorsichtig wieder ab. »Nicht umfallen, hören Sie?«
»Das werde ich nicht«, antwortete sie und rutschte dann nach links, bis ihr Gesicht auf der Toilettenrolle lag, die in einer Halterung an der Seite des langen marmornen Waschtisches befestigt war.
Er zog sich bis auf Boxershorts und Unterhemd aus, legte seine SIG, das Handy und die Brieftasche zur Seite und besah sich dabei sein einst so schönes Sakko, das auf einem Haufen mit Julias Lederjacke und dem Rest ihrer Sachen auf dem Boden lag. Als er mit ihr zusammen die große Duschkabine betrat, fragte sich Cheney, was das FBI-Handbuch wohl zum Duschen mit einer gerade geretteten Fremden vorschrieb. Er zog die Glastür zu und manövrierte sie genau unter den heißen Wasserstrahl.
Sie schrie und versuchte, sich loszureißen.
Er hätte am liebsten gleich mit geschrien, als das heiße Wasser wie Nadeln auf seine Haut prasselte.
Er hielt sie fest, bis sie sich nicht mehr wand, und rieb dann ihre Arme und den Rücken. Sie war dünn, zu dünn, aber keineswegs dürr oder zerbrechlich. War sie von Natur aus dünn, oder hatte das andere Hintergründe?
Julias Körper wärmte sich langsam auf, diesmal von außen nach innen. Auch ihre Kraft kehrte zurück. Sie sagte an seinem Hals: »Ich kann jetzt alleine stehen, danke.«
Er ließ sie los. »Wie lange reicht das heiße Wasser noch?«
»Es ist wahrscheinlich gleich alle.« Sie öffnete die Tür und trat aus der Dusche, wohl wissend, dass er da war, um sie aufzufangen.
Er drehte das Wasser ab und folgte ihr. Dabei beobachtete er sie genau und war beruhigt. Sie war wieder bei sich, mit neuer Kraft und hellwach. Ein großer Bluterguss leuchtete an ihrem Kinn, mehrere kleine blaue Flecken zierten Arme, Rippen und Beine, wo sie auf die Steine in der Bucht aufgeschlagen war.
Sie betrachtete ihn von oben bis unten und lächelte. »Danke, dass Sie mich gerettet haben. Nette Boxershorts.«
»Danke. Nettes Lächeln.« In ihren Augen war ihre Persönlichkeit zu erkennen, und er fügte schmunzelnd hinzu: »Gern geschehen.«
»Ich hole Ihnen ein paar trockene Sachen.« Sie warf ihm ein übergroßes Handtuch zu, nahm selbst eins und ließ ihn im Bad stehen.
Als er ein paar Minuten später ins Schlafzimmer kam, hatte sie einen dicken Bademantel und Strümpfe an, und ihr Haar war unter einem Handtuchturban verborgen.
»August war fast so groß wie Sie«, sagte sie, während sie ihn prüfend betrachtete. Er trug nur das große Handtuch um seine Hüfte geknotet. »Er war kräftiger, besonders um die Taille herum, aber Sie können ja den Gürtel enger machen.«
Cheney ging zurück ins Bad und musterte erneut seine durchnässten Sachen. Sie würden schon wieder trocknen. Aber es gab keinerlei Hoffnung für die teure Wollhose, die er auch schon zu seiner Hochzeit vor sechs Jahren getragen hatte und bei der Abschlussfeier der FBI-Academy, bei zwei Begräbnissen und heute Abend, bei seiner ersten Verabredung seit viel zu langer Zeit. Anstelle der Boxershorts zog er jetzt einen Baumwollslip an, ein weißes T-Shirt und einen dunkelblauen Kaschmirpullover, der sich auf seiner Haut wie eine Sünde anfühlte. Die Hose war zu weit, aber er machte einfach den Gürtel enger, wie sie es vorgeschlagen hatte, und zog den Pullover darüber. Die stinknormale dunkle Chinohose war lang genug. Er schaute auf seine nackten Füße herab. Einen Moment später rief sie: »Hier ist ein Paar Socken. Welche Schuhgröße haben Sie?«
»Vierundvierzig.«
»Etwas zu klein, tut mir leid.«
Sie reichte ein Paar italienische Slipper durch die Tür. Das Leder war so weich, dass er wettete, er könnte es essen, wenn er hungrig genug wäre.
Als er aus dem Bad kam, rief sie ihn aus dem riesigen Schrank. »Ich bin gleich bei Ihnen. Also, mir geht’s jetzt gut, keine Sorge, okay? Ich glaube, ich schwitze schon fast wieder, so warm ist mir. Ich werde hier drin nicht umfallen.«
»Na gut.« Er tippte die Nummer seines Vorgesetzten in sein Handy. Bert Cartwright war die meiste Zeit ein arroganter Arsch, weil er mit einem fotografischen Gedächtnis für Gesichter gesegnet war und auf diese Tatsache gerne immer wieder hinwies. Dann unterbrach er den Wählvorgang. Nein, dies war eine Angelegenheit für die örtliche Polizei. Er erreichte Frank zu Hause, wo er sich gerade ein Basketballspiel im Fernsehen ansah. Sein Sohn nörgelte im Hintergrund, weil er ihm sein Auto nicht lieh.
»He, Frank, ich habe einen Fall für dich.«
KAPITEL 4
Captain Frank Paulette vom San Francisco Police Department, SFPD, sagte: »Meine Güte, vielen Dank auch, Cheney. Da sitze ich hier völlig gelangweilt vorm Fernseher und sehe zu, wie die Warriors endlich mal die Lakers zur Sau machen, ein wahres Wunder.«
»Welches Viertel?«
»Das zweite.«
»Heute geschieht kein Wunder mehr, vertrau mir. Hör zu, Frank, ich habe hier ein Problem, und das ist was für euch, nicht für die Bundesbehörden. Es handelt sich um einen versuchten Mord.« Dann berichtete Cheney ihm, was passiert war.
Frank hörte wortlos zu, seufzte dann und hob seinen Blick zur Zimmerdecke. »Warum immer ich, lieber Gott? Okay, ich weiß, warum. Ich ziehe Probleme an. Nein, warte, sag nichts. Du hast diesen Typ nicht aus der Nähe gesehen?«
»Nein, und er hatte auch nichts Unverwechselbares an sich. Groß, schwarz, bewegte sich schnell und geschmeidig, wie ein Sportler. Er wusste, was er tat, keine Panik, kein Zögern. Als ich mich als FBI-Beamter zu erkennen gab und sagte, ich würde schießen, hat er nicht mal versucht, es mit mir aufzunehmen. Er warf sie einfach übers Geländer in die Bucht und verschwand.«
»Vielleicht hatte er nur das Messer und keine Schusswaffe. Möglicherweise wollte er sie nur überfallen und berauben und war nicht darauf eingestellt, sich einem Bundespolizisten zu stellen oder eine große Szene zu machen.«
»Das war kein versuchter Raubüberfall, Frank. Der war ein Profi. Alles, was er tat, war professionell, selbst die Entscheidung, wegzulaufen. Sie wird Schutz brauchen. Er muss annehmen, dass sie überlebt hat.«
»Okay, ich kaufe dir das ab, dass der Typ ein Profi ist. Der Frau geht’s gut?«
»Ja. Sie wollte nicht ins Krankenhaus, also habe ich sie nach Hause gebracht.«
»Das war ziemlich dumm, Cheney. Wieso will sie nicht ins Krankenhaus?«
»Keine Ahnung, aber sie hatte wirklich Angst. Sie hat so sehr gezittert, dass ich sie einfach nach Hause gebracht und sie unter die warme Dusche gestellt habe. Jetzt geht’s ihr besser.«
Ein erneuter Seufzer. »Wie heißt sie?«
»Äh, ja, wie wär’s mit Julia …«
Sie stand direkt neben ihm. »Mein Name ist Julia Ransom.« Sie machte eine kurze Pause und atmete tief ein. »Ich bin Dr. August Ransoms Witwe.«
Cheney starrte sie entgeistert an. So durchnässt und Wasser hervorprustend war sie ihm nicht im Geringsten bekannt vorgekommen. Natürlich erkannte er sie jetzt. Die Medien waren gnadenlos über sie hergefallen. Es hatte dabei gar keine Rolle gespielt, dass sie nie verhaftet worden war. Alle waren einfach weiter von ihrer Schuld ausgegangen. Es hatte Anspielungen gegeben, die Polizei sei inkompetent und hätte geheime Absprachen getroffen, sie hätte mit dem Polizeichef geschlafen, einem glücklich verheirateten irischstämmigen Mann mit sechs Kindern.
»Ich habe sie gehört, Cheney«, sagte Frank Paulette, aber er wiederholte ihren Namen, als ob er es gar nicht richtig glauben könnte. »Julia Ransom. Also wirklich, alter Junge, du machst keine halben Sachen, oder?« Frank verstummte. Im Hintergrund rief Franks Frau, er solle endlich den Müll raustragen, sein Sohn lachte, und das Publikum im Fernsehen jubelte, weil Kobe Bryant gerade drei Punkte gemacht hatte - kein wahres Wunder mehr, zumindest nicht in diesem Spiel.
Cheney nannte Frank die Adresse, worauf der erwiderte: »Ich kenne die verdammte Adresse. Ich bin in zwanzig Minuten da, Cheney. Pass auf die Lady auf. Ganz sicher, dass es kein Raubüberfall war?«
Cheney lächelte fast, als er die Hoffnung in Franks Stimme hörte.
»Tut mir leid, Frank. Er war darauf aus, sie umzubringen.«
»Ich lasse zu ihrer Sicherheit zwei Wagen rüberkommen.«
»Ja, gut.« Cheney beendete das Gespräch und steckte das Handy in August Ransoms Hosentasche.
»Die Polizei kommt?«
»Ja. Captain Frank Paulette.«
»Ich dachte, dass mich so ziemlich alle von denen befragt hätten. Aber den kenne ich noch nicht.«
»Sehen Sie, ich hatte keine Wahl. Jemand hat versucht, Sie zu töten. Frank ist einer von den Guten. Ich kenne ihn schon seit fast vier Jahren, fast so lange, wie ich in San Francisco lebe. Er wird Sie nicht belästigen oder behandeln wie …«
Er unterbrach sich. Sie schwieg.
Sie hatte ihre Lederjacke über die Lehne eines antiken Stuhls gehängt, der wohl aus der Zeit vor Waterloo stammte, und sein Sakko auf den dazu passenden Stuhl daneben.
Er sagte: »Ich habe meine restlichen nassen Sachen im Bad verteilt.«
»Ich kümmere mich darum. Ich habe eine sehr gute Reinigung, die Ihr Sakko und die Hose wieder hinbekommt. Hier, nehmen Sie solange diese Jacke.«
»Danke.«
Sie nickte ihm zu und verließ festen Schrittes das Schlafzimmer. Sie trug alte, weite Jeans, ein rotes 49ers-Sweatshirt und blaue Nike-Joggingschuhe. Das Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Es war so dunkel und satt wie sein Mahagoni-Schreibtisch. Sie hatte kein Make-up aufgetragen und sah sehr jung aus.
Cheney lief ihr in dem dunkelblauen Kaschmirjackett den Flur entlang hinterher. Sie hielt kurz an, nachdem er es angezogen hatte, und nickte zustimmend. Sie war groß und hatte lange Beine, mit denen sie den endlos langen Teppich in Windeseile entlanglief. Bestimmt konnte sie sich richtig gut bewegen in ihren Joggingschuhen.
Eigentlich könnte er jetzt seinen Cioppino mit knusprigem französischen Brot genießen, doch nein, Frank hatte recht. Cheney tat nie etwas nur halbherzig. Julia Ransom, Dr. August Ransoms Witwe. Aber es würde ja schon bald nicht mehr sein Problem sein.
Am Fuß der Treppe drehte sie sich nach ihm um. »Sie sehen gut aus in Augusts Sachen. Und noch mal, egal, was Sie von mir denken - jetzt, wo Sie wissen, wer ich bin -, danke, dass Sie mich gerettet haben. Ich lasse Ihre Kleidung reinigen und Ihnen zuschicken. Woher kennen Sie einen städtischen Polizisten?«
»Ich bin auch Polizist, nur nicht örtlich.«
»Also sind Sie ein Tourist?«
»Eigentlich nicht.«
Sie hob eine ihrer dunklen Brauen.
Sie erinnerte sich nicht? Verständlich, dachte er und zuckte die Achseln. »Ich bin Bundespolizist. Special Agent Cheney Stone vom FBI in der Außenstelle San Francisco.«
Sie starrte ihn einen Moment lang an, warf dann den Kopf in den Nacken und lachte lauthals, bis sie fast erstickte. Sie drückte die Fingerknöchel in die Augen, wie seine Teenager-Nichte es immer tat.
Sobald sie wieder Luft bekam, sagte sie: »Jetzt erinnere ich mich wieder, dass Sie das dem Typ, der mich umbringen wollte, zugebrüllt haben. Oje, ich muss Wallace Tammerlane anrufen und ihm sagen, dass ich es nicht zum Abendessen schaffe.«
Sie raste zu einem hübschen Tischchen an der Korridorwand, auf dem eine Vase mit frischen Azaleen und ein Telefon standen. Cheney rief unterdessen seinen alten Freund Manny Dolan an und erzählte ihm, was geschehen war, nannte aber nicht Julias Namen.
»Verdammt noch mal, Cheney, ich glaube, June wollte dir den Hals umdrehen. Sie ist gar nicht glücklich.«
»Erzähl ihr noch einmal, was für ein Held ich bin, okay?«
»Geht klar. Viel Spaß mit der Witwe.«
Als Julia wieder bei ihm war, sagte sie nur: »Wallace wollte herkommen, aber ich habe Nein gesagt. Glauben Sie mir, Sie wollen bestimmt nicht, dass ein exzentrisches Medium mit der Polizei zusammentrifft. Das ist keine tolle Mischung.«
»Nein«, sagte Cheney langsam. »Ich schätze nicht.«
KAPITEL 5
Captain Frank Paulette traf mit zwei Ermittlern ein, die den Mordfall Dr. August Ransom im vergangenen Herbst und Winter geleitet hatten - Inspector Rainy Bigger und Inspector Allen Whitten.
Die beiden Beamten nickten Julia Ransom wortlos zu, doch Cheney erkannte eine Spur Verachtung in Inspector Biggers Gesichtsausdruck, was ihn die Stirn runzeln ließ. Inspector Allen Whitten ließ nur professionelle Gleichgültigkeit erkennen. Frank trat vor und machte sich mit Julia bekannt, schüttelte ihre dünne, blasse Hand.
Cheney stellte fest, dass sie keinen Ehering am Finger hatte, sie trug überhaupt keinen Schmuck.
»Sind Sie sicher, dass Sie keinen Arzt brauchen, Mrs Ransom? Der Bluterguss am Kinn sieht ziemlich schlimm aus.«
Sie berührte leicht ihr Kinn und öffnete und schloss den Mund zwei-, dreimal. »Der Kiefer ist nicht gebrochen, er sieht nur schlimm aus. Danke für Ihre Besorgnis, Captain Paulette.« Sie sah Whitten und Bigger schicksalsergeben an. »Bitte kommen Sie herein. Das ist Agent Cheney Stone.«
Bigger und Whitten schüttelten ihm die Hand. Ein FBI-Typ, dachten sie, das wusste Cheney, und auch, dass sie sich fragten, ob er einfache Polizisten vor dem Frühstück verspeiste.
Inspector Rainy Bigger musterte Julia von oben bis unten und verbarg dabei keineswegs ihre Abneigung. »Sie sehen ziemlich gut aus, dafür dass Sie ins Gesicht geboxt und in die Bucht geworfen wurden, Mrs Ransom.«
Julia wusste, dass Bigger glaubte, sie sei mit dem Mord an August davongekommen. Sie verabscheute es, dass die Feindseligkeit der Polizistin sie in die Defensive drängte und sie sich beinahe unwürdig fühlte, überhaupt am Leben zu sein. Sie antwortete kurz angebunden: »Danke. Gute Gene.«
»Oder etwas komplett Anderes«, gab Bigger zurück.
Julia sagte: »Agent Stone, denken Sie, ich habe mich selbst geschlagen und bin danach fröhlich übers Geländer in die Bucht gesprungen, vielleicht zu einer abendlichen Schwimmübung?«
»Nein, natürlich nicht«, antwortete Cheney und gab Bigger mit Blicken zu verstehen, sie solle sich besser zurückhalten.
»Nein, das meinten Sie nicht, oder, Inspector Bigger?«, sagte Julia langsam. »Sie dachten eher an einen Streit unter Schurken, kann das sein?«
Inspector Bigger hielt den Mund, aber zuckte dramatisch mit den Schultern.
Cheney war erleichtert, dass sich die Polizistin wenigstens einen winzigen Rest Professionalität bewahrt hatte.
Inspector Whitten sagte: »Es sieht so aus, als wollte Sie jemand verletzen, Mrs Ransom.«
»Ich glaube, mit einem Messer geht die Sache schon übers Verletzen hinaus, Inspector Whitten«, antwortete Julia.
Er deutete mit einem Nicken zu einem prachtvollen impressionistischen Gemälde über dem Kamin aus Carrara-Marmor.
»Ist das neu?«
»Sie meinen, ich habe das mit meinen unrechtmäßigen Einnahmen erworben?«
Das war genau, was er meinte, wusste Cheney, doch er sagte nichts. Er wollte hören, was Julia darauf antwortete.
Julia sagte: »August mochte die Impressionisten nicht besonders. Ich schon. Ich habe es aus meinem Arbeitszimmer heruntergeholt. Es ist ein Sisley. Mein Mann hat ihn mir als Hochzeitsgeschenk gekauft. Gefällt es Ihnen, Inspector Whitten?«
»Also, ja. Ich wette, der hat Dr. Ransom einiges gekostet. Wer, denken Sie, ist hinter Ihnen her, Mrs Ransom?«
»Der Mann war kein Straßenräuber oder verrückter Drogensüchtiger. So wie er sich verhalten hat, dachte ich, könnte er derjenige sein, der meinen Mann ermordet hat. Er hätte mich getötet, wenn Agent Stone nicht da gewesen wäre.«
»Ja, Cheney ist ein Held«, sagte Inspector Bigger.
Frank runzelte die Stirn über seine beiden Polizisten. Vielleicht war es nicht so klug gewesen, sie mitzubringen, besonders Inspector Bigger. Sie war ungemein zornig. Warum nur? Er musste mit Lieutenant Vincent Delion sprechen, der in zwei Tagen aus dem Urlaub zurückkommen würde, oder verdammt, vielleicht war es auch noch eine Woche. Er sagte: »Ihr Mann wurde schon vor sechs Monaten ermordet, Mrs Ransom. Wieso sollte der Mörder Sie erst jetzt tot sehen wollen? Möglicherweise haben Sie sich an etwas erinnert? Vielleicht haben Sie etwas gefunden, das auf den Täter oder die Täterin hinweist, und die Person hat davon erfahren?«
»Ich glaube nicht, Captain Paulette.« Doch Julia runzelte die Stirn. »Ich muss noch einmal richtig darüber nachdenken.«
Cheney sagte: »Dieser Anschlag auf Ihr Leben bedeutet, dass sich etwas geändert hat, Julia. Überlegen Sie noch einmal scharf, was jetzt anders ist. Was könnte den Mörder wieder ans Licht gelockt haben?«
Inspector Bigger sagte: »Sie sind doch immer noch die Busenfreundin aller großen Wahrsager in der Gegend um San Francisco, oder, Mrs Ransom?«
»Ich treffe mich manchmal mit ihnen.« Wie mit Wallace, heute Abend zum Essen.
»Man hört, dass Sie alle gerne zusammenstecken, wie ein Club oder so etwas.«
»Wo haben Sie das gehört?«
»Hier und da«, antwortete Bigger.
Captain Paulette sagte: »Ich habe davon nichts gehört, Inspector. Vielleicht ist die richtige Frage, wer von Ihrem Tod profitieren würde?«
»Niemand, Captain Paulette. Ich habe keine lebenden Verwandten. Na gut, vielleicht ein paar entfernte Cousins, aber die kenne ich gar nicht. Ich habe ein Testament. Alles geht an verschiedene medizinische Forschungseinrichtungen.«
»Also gut. Dann erzählen Sie uns jetzt doch bitte, was vorgefallen ist, Mrs Ransom, wenn Sie dazu bereit sind.«
Julia sagte ihnen nicht, wie glücklich sie gewesen war, dass die Paparazzi endlich ihre Posten in der Umgebung aufgegeben hatten, dass sie sich so lebendig gefühlt hatte, dass sie bis zum Fisherman’s Wharf gegangen und dabei zwischendurch manchmal aus purer Freude sogar gerannt war und vor sich hin gepfiffen und alle Leute gegrüßt hatte. »Ich stand ganz am Ende des Pier 39 und schaute auf Alcatraz und sah zu, wie der Nebel von der Golden Gate Bridge heranrollte. Es wurde spät. Die meisten Touristen waren schon weg. Die Lichter gingen an. Ich merkte, dass ich nach Hause musste wegen einer Verabredung zum Abendessen.« Sie atmete tief durch. »Er war groß, schwarz, gut gekleidet, mit intelligenten Augen - Sie wissen schon, als ob er alles sehen und verstehen könnte. Er trug eine Brille mit schmalem Rand, und er war sehr höflich, fragte mich wegen Alcatraz und dann wegen einer Fähre nach Sausalito. Er hatte ein freundliches Lächeln, ich habe zurückgelächelt. Ich habe ihm wegen der Fähre geantwortet und drehte mich um, um ihm zu zeigen, wo er den Fährplan finden kann. Er schlug mich aufs Kinn, um mich zu betäuben, nehme ich an. Dann hatte er plötzlich ein Messer in der Hand, es war silbrig und hatte eine scharfe Spitze. Doch bevor er mich damit stechen konnte, schrie Cheney ihn an, aufzuhören, also hievte er mich über das hölzerne Geländer ins Wasser.« Sie runzelte die Stirn. »Es gab dort unten keine Seelöwen, aber ich schwöre, ich habe einen schreien gehört, bevor ich unterging.«
»Der Mann hat Sie nur nach Alcatraz und dann nach dem Plan für die Fähre nach Sausalito gefragt?«
»Ja, Inspector Whitten, das war alles. Er schien mir nicht bedrohlich. Er hatte eine gute Aussprache, war über eins achtzig groß, würde ich sagen. Er sah ganz gut aus und war gut gekleidet.«
Inspector Bigger wunderte sich laut: »Nur Sie haben das Messer gesehen, richtig? Vielleicht gab es gar kein Messer, Mrs Ransom, vielleicht war dieser Mann ein Straßenräuber, der Sie als jemand sehr Reiches ausgemacht hat …«
»Rainy …«, warnte Inspector Whitten. »Sie sagen, er hat Sie angelächelt, Mrs Ransom?«
Cheney sah, wie sich Julia in sich zurückzog, obwohl sie sich nicht bewegt hatte. Doch sie war jetzt völlig angespannt, konnte das alles nicht ertragen, konnte die Polizisten nicht ausstehen. Sie sagte mit fester Stimme: »Ja, Inspector Whitten, und ich habe zurückgelächelt, wie ich schon sagte. Ich konnte gar nicht anders. Er hatte einen Mantel von Burberry an, zumindest sah er so aus, teuer, meine ich. Tut mir leid, aber das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Dann hörte ich Agent Stone rufen.«
Sie beobachtete, wie Frank Paulette alles in ein kleines Notizbuch schrieb. Er war wie sie Linkshänder. Dann wandte er sich an Cheney: »Wie gut hast du den Mann gesehen?«
»Ich hab sein Gesicht nur kurz gesehen, als er sich zu mir umgedreht hat, nachdem ich gerufen hatte. Dann warf er sie übers Geländer und war weg. Wie gesagt, für mich sah er aus wie ein Sportler, schnell und gelenkig. Er bewegte sich wie ein junger Mann, sehr flink. Ich hatte keine Zeit, meine Waffe zu ziehen. Ich konnte ihm nicht hinterherlaufen, weil ich Mrs Ransom rausziehen musste.«
»Gutes Timing«, sagte Inspector Bigger.
»Ja, das habe ich auf jeden Fall gedacht«, sagte Julia und lächelte Bigger herausfordernd an. »Denken Sie vielleicht, ich habe die ganze Sache so gedeichselt, um Agent Stone auf meine Seite zu bringen? Hm, darf ich fragen, warum ich ihn auf meiner Seite brauche? Ich dachte nämlich nicht, dass ich auf irgendeiner Seite stehe. Habe ich etwas nicht mitbekommen?«
Cheney lächelte in sich hinein. Da kam ja Stärke zum Vorschein, dachte er und wartete ab.
Inspector Bigger ließ die Sache auf sich beruhen.
Cheney fragte sich, was wohl zwischen den beiden Frauen während der Mordermittlung im Fall Ransom vorgefallen sein mochte.
Um die Aufmerksamkeit von seiner Partnerin abzulenken, sagte Inspector Whitten zu Cheney: »Sie haben den Mann nicht erkannt? Kam Ihnen denn nichts an ihm irgendwie bekannt vor?«
Cheney schüttelte den Kopf. »Nur dass ich alles darauf setzen würde, dass der Typ ein Profi ist. Er war schnell und effizient. Er hat sie vorher nicht beunruhigt. Wenn ich nicht draußen gewesen wäre, um nach einer Freundin zu sehen, wäre Mrs Ransom jetzt tot. Er tat genau, was er zu tun hatte, um zu entkommen, als er merkte, dass ich eine unmittelbare Gefahr für ihn darstellte. Jetzt müssen wir …« Er unterbrach sich. »Wir wissen, dass er sie töten wollte, denn es machte ihm nichts aus, dass sie sein Gesicht sehen konnte. Und er weiß, dass er sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich war. Ihm muss klar sein, dass wir überall Steckbriefe mit seinem Gesicht aufhängen werden. Er wäre verrückt, in San Francisco zu bleiben.«
Captain Paulette sagte: »Denken Sie, was Sie von ihm gesehen haben, reicht aus, um einem Polizeizeichner bei einer Skizze zu helfen, Mrs Ransom?«
KAPITEL 6
»Ja«, sagte Julia. »Ich werde sein Gesicht nicht vergessen, solange ich lebe.«
»Gut«, sagte Cheney. »Ich habe ihn ja auch kurz gesehen. Wir machen das getrennt und vergleichen dann.«
Inspector Bigger wollte schon etwas dazu sagen, doch dann besann sie sich eines Besseren und schwieg.
Captain Paulette holte sein Handy hervor. »Ich sehe mal, ob ich Otis nicht gleich hierherbekommen kann. Er wohnt in Potrero Hill, es sollte also um diese Uhrzeit nicht so lange dauern, bis er hier ist. Wenn ich das Warriors-Lakers-Spiel verpasse, kann Otis das auch.«
»Die Warriors liegen hinten«, sagte Inspector Bigger. »Ich habe es mir auf dem Weg hierher angehört.«
Cheney stellte fest, dass es erst neun Uhr war. Er sagte: »Frank, das FBI hat ein Gesichtserkennungsprogramm, das sie so eingerichtet haben, dass man eine Polizeiskizze einlesen kann. Wir haben es vor zwei Monaten eingesetzt und den Täter gefasst. Das geht auch ein zweites Mal.«
Captain Paulette nickte. »Das hört sich gut an, wenn der Typ ein Profi ist. Ja, ich habe den Beamten kennengelernt, der das Ganze mit aus der Taufe gehoben hat - Dillon Savich. Er und seine Frau Lacey Sherlock und ein anderer Beamter, Dane Carver, waren vor einiger Zeit hier.«
»Ja, als Danes Bruder ermordet wurde«, sagte Cheney und nickte.
Die Originalausgabe DOUBLE TAKE erschien 2007 bei G. P. Putnam’s Sons
Verlagsgruppe Random House
Vollständige deutsche Erstausgabe 12/2008
Copyright © 2007 by Catherine Coulter
Copyright © 2008 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
Umschlagfoto: © mauritius-images/Brand X Pictures; © Getty Images
eISBN : 978-3-641-02446-8
www.heyne.de
Leseprobe
www.randomhouse.de