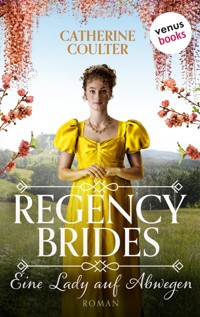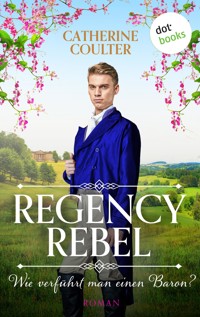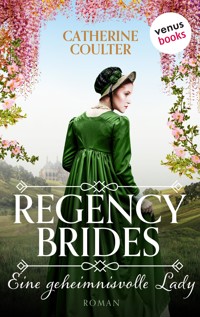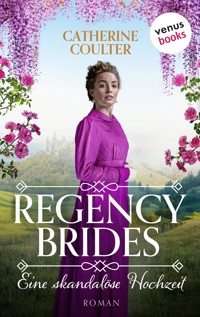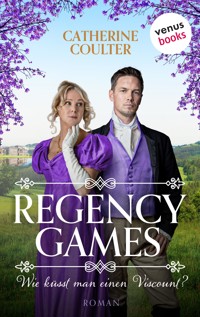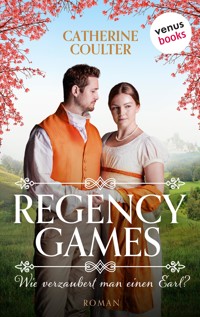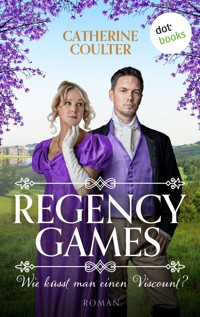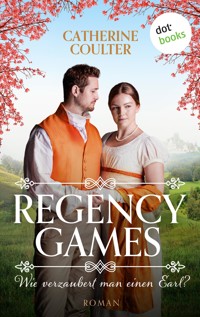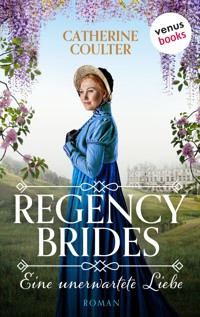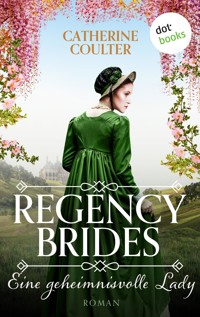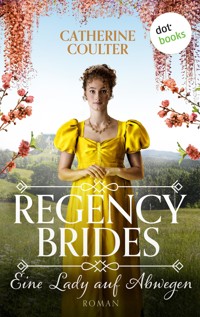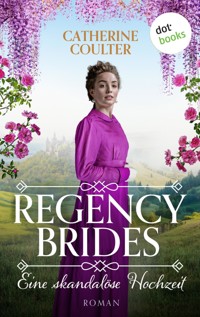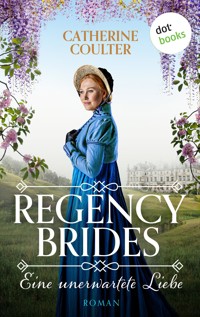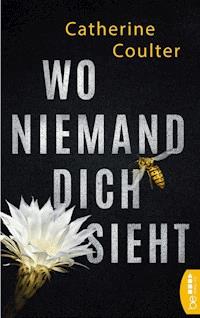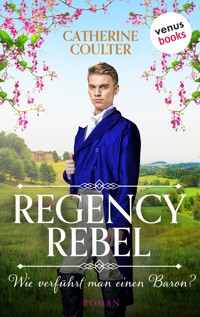
4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einer Frau wie ihr ist er noch nie begegnet: Der historische Liebesroman »Regency Rebel – Wie verführt man einen Baron?« von Catherine Coulter jetzt als eBook bei venusbooks. Während Rohan Carrington, der attraktive Baron von Mountvale, seinen zweifelhaften Ruf als Frauenheld und Schürzenjäger genießt, verkörpert sein prüder Bruder das vollkommende Gegenteil. Als dieser jedoch überraschend stirbt, macht Rohan eine schockierende Entdeckung: Der sonst immer so biedere George hatte eine heimliche Ehefrau! Da die junge Witwe Susannah ihre kleine Tochter nicht alleine versorgen kann, bittet sie Rohan um Hilfe, der sie nur widerwillig bei sich aufnimmt. Die Frauen, die für gewöhnlich sein Anwesen betreten, sind am nächsten Morgen wieder Geschichte – doch schon bald findet er überraschend Gefallen an Susannahs Gesellschaft, deren schöne Augen und scharfer Verstand ihn gleichermaßen durcheinander bringen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Regency-Roman »Regency Rebel – Wie verführt man einen Baron?« von Catherine Coulter wird alle Fans von »Bridgerton« von Bestsellerautorin Julia Quinn begeistern. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Während Rohan Carrington, der attraktive Baron von Mountvale, seinen zweifelhaften Ruf als Frauenheld und Schürzenjäger genießt, verkörpert sein prüder Bruder das vollkommende Gegenteil. Als dieser jedoch überraschend stirbt, macht Rohan eine schockierende Entdeckung: Der sonst immer so biedere George hatte eine heimliche Ehefrau! Da die junge Witwe Susannah ihre kleine Tochter nicht alleine versorgen kann, bittet sie Rohan um Hilfe, der sie nur widerwillig bei sich aufnimmt. Die Frauen, die für gewöhnlich sein Anwesen betreten, sind am nächsten Morgen wieder Geschichte – doch schon bald findet er überraschend Gefallen an Susannahs Gesellschaft, deren schöne Augen und scharfer Verstand ihn gleichermaßen durcheinander bringen …
Über die Autorin:
Catherine Coulter wurde 1942 in Texas geboren. Schon früh begeisterte sie sich für die Regency-Bestseller von Georgette Heyer, die sie schließlich dazu inspirierten, selbst historische Liebesromane zu schreiben. Inzwischen ist Catherine Coulter erfolgreiche Autorin zahlreicher historischer und zeitgenössischer Liebesromane, sowie vieler Thriller, mit denen sie immer wieder auf der New-York-Times-Bestsellerliste stand.
Die Website der Autorin: catherinecoulter.com/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/CatherineCoulterBooks/
Die Autorin auf Instagram: instagram.com/catherinecoulterauthor/
Bei venusbooks veröffentlichte die Autorin die historischen Liebesromane:
»Regency Brides – Eine skandalöse Hochzeit, Band 1«
»Regency Brides – Eine unerwartete Liebe, Band 2«
»Regency Brides – Eine Lady auf Abwegen, Band 3«
»Regency Brides – Eine geheimnisvolle Lady, Band 4«
»Regency Games – Wie verzaubert man einen Earl? Band 1«
»Regency Games -Wie küsst man einen Viscount? Band 2«
»Regency Rebel – Wie verführt man einen Baron?«
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2023
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »The Wild Baron«. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Die schöne Fremde« bei Heyne, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1997 by Catherine Coulter
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Karolina Michałowska unter Verwendung von Bildmotiven von Shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-96898-265-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Regency Rebel« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Catherine Coulter
Regency Rebel – Wie verführt man einen Baron?
Roman
Aus dem Amerikanischen von Norbert Jakober
venusbooks
Für Judy Cochran Ward, die beste Köchin in Marin County.
Sie versteht es, einem wahre Gaumenfreuden zu bescheren.
Darüber hinaus ist sie eine wunderbare Freundin.
Kapitel 1
Mountvale Townhouse, Cavendish Square
London, April 1811
Rohan Carrington, der fünfte Baron Mountvale, starrte wütend das Porträt seines Bruders an. »Wenn du das wirklich getan hast, George«, stieß er hervor, »und wenn du nicht schon tot wärst - dann würde ich dich jetzt umbringen, darauf kannst du dich verlassen, du elender Schurke. Wie hast du nur so etwas tun können?«
Rohan konnte es immer noch nicht fassen. Ein Jahr war es jetzt her, seit George gestorben war. Konnte das denn tatsächlich sein? Nein, George wäre nie zu so etwas fähig gewesen. Er war doch stets so lernbegierig gewesen, ein richtiger Gelehrter, der für die Freuden und Genüsse der Liebe keinen Sinn hatte. Rohan erinnerte sich, wie ihr Vater ihn und George einmal zu Madame Trillah’s Etablissement mitgenommen hatte. Beim Anblick einer besonders üppigen Rothaarigen war George ganz bleich im Gesicht geworden und so rasch er konnte nach Hause gelaufen.
Nach diesem Erlebnis hatte ihr Vater George in Ruhe gelassen. George gab sich ganz seinen Studien hin; vor allem Landkarten faszinierten ihn ungeheuer. Zumindest hatte Rohan das bisher immer angenommen.
»Nein«, sagte Rohan schließlich mit fester Stimme, die Augen immer noch auf das Bild des Bruders geheftet, das George im Alter von achtzehn Jahren zeigte. »Ich glaube einfach nicht, was in diesem verdammten Brief steht. Da steckt ohne Zweifel irgendein Kerl dahinter, der deinen Namen benützt, um zu Geld zu kommen. Hättest du es denn tatsächlich fertiggebracht, eine junge Lady zu entehren? Du hast doch gewiß nicht einmal gewußt, was das Wort ›entehren‹ überhaupt bedeutet, nicht wahr?
Was will dieser Mann von mir, der behauptet, ihr Vater zu sein? Dumme Frage. Geld natürlich. Ach, George, ich könnte dich ... nein, den Kerl könnte ich erwürgen, der das unter deinem Namen getan hat.«
George blickte nur stumm von der Wand herunter.
Der letzte Carrington, der eine junge Lady entehrt hatte und dafür mit dem Kerker Bekanntschaft hatte machen müssen, war Rohans Urgroßvater, der sagenumwobene Luther Morran Carrington gewesen. Wie Rohans Großvater berichtete, soll der gute Luther darüber nur den Kopf geschüttelt und gemurmelt haben, daß er doch nur ein einziges Mal mit der kleinen Cora im Bett gewesen sei - aber dieses eine Mal habe nichts zu wünschen übriggelassen. Nun, letzteres dürfte zugetroffen haben, denn Luther mußte - nach der Zahl der Sprößlinge zu schließen - noch mindestens vierzehn weitere Male das Bett mit ihr geteilt haben, wobei acht Kinder das Erwachsenenalter erreichten.
Rohan zog an dem Klingelzug hinter dem spiegelblanken Mahagonischreibtisch. Pulver, sein Sekretär, mußte wohl schon draußen gestanden haben, das Ohr an die Tür gepreßt, denn er war augenblicklich zur Stelle, kein bißchen außer Atem. Er sah blaß und ziemlich abgezehrt aus, was ihm aber ganz recht geschah, wie ihm sein Freund David Plummy des öfteren versicherte. »Es ist eine Schande, wie du dich für den wilden Baron abarbeitest«, pflegte David ihm vorzuhalten. »Dir geht es schlimmer als einem Hund bei ihm. Tag und Nacht sollst du für ihn zur Stelle sein. Und das Schlimmste ist, daß der Kerl noch mehr Frauen bekommt, als du und ich in unserem Leben auch nur grüßen können - und alle schätzen ihn um so mehr dafür, genauso wie sie seinen Vater und seine Mutter für ihren Lebenswandel verehren. Er ist ein Schürzenjäger, wie es nur wenige gibt. Und dir, Pulver, geschieht es ganz recht, daß du aussiehst, als würdest du aus dem letzten Loch pfeifen.«
Pulver schüttelte bei diesen Worten nur traurig den Kopf, doch die Wahrheit war, daß er seine Rolle überaus genoß. Daß er für den Baron Mountvale arbeitete, verlieh ihm durchaus ein gewisses Ansehen. Mehr als einmal war es vorgekommen, daß irgendeine Dame sich ihm genähert hatte, um ihn zu bestechen, weil sie in das Schlafzimmer des Barons eingelassen werden wollte.
Pulver sah sofort, daß der Baron ziemlich verärgert war. Er war nur allzu begierig, zu erfahren, was seinen Herrn derart aus der Fassung gebracht hatte. Immerhin kam es nicht jeden Tag vor, daß der Baron mit sich selbst sprach.
»Pulver, sorg dafür, daß Simington, mein Anwalt, möglichst rasch herkommt. Nein, warte.« Der Baron hielt inne und blickte zu dem Porträt seiner Mutter auf, das sich neben dem seines Bruders über dem Kaminsims befand. Es war entstanden, als sie fünfundzwanzig war - also fast genauso alt wie er, Rohan, heute. Sie war eine bezaubernde junge Frau gewesen, doch auch jetzt, mit fünfundvierzig, galt sie immer noch als eine Schönheit. In jungen Jahren war sie von einem geradezu unbezähmbaren Temperament gewesen, und seit er zurückdenken konnte, hatte man ihm immer wieder versichert, daß er genau wie seine Mutter sei - und natürlich auch wie sein stolzer Papa. Es hieß, er habe die Wildheit und Lebenslust seiner Eltern geerbt.
»Nein«, sagte er und zwang sich, seine Gedanken wieder dem Problem, das ihn bedrückte, zuzuwenden. »Ich werde mich selbst darum kümmern. Es ist einfach zu merkwürdig - ich glaube kein einziges Wort davon. Außerdem, wenn es kein uneheliches Kind gibt - wie kann man dann behaupten, daß er sie entehrt hätte? Und von einem Kind steht kein Wort in dem Brief. Wenn es eines gäbe, dann hätte er es doch gewiß erwähnt, meinst du nicht? Nein, ich muß mich selbst darum kümmern. Ich mache es ungern - aber es geht nicht anders. Ich werde drei Tage weg sein, nicht länger.«
»Aber Mylord«, stieß Pulver mit einer Stimme hervor, die nahezu verzweifelt klang, »es muß doch dabei irgend etwas für mich zu tun geben. Sie sind richtiggehend aufgewühlt. Ihre Krawatte sitzt ganz schief. Ihr Haar ist völlig zerzaust. Ihrem Kammerdiener würde das gar nicht gefallen. Kann es sein, daß Sie die Sache in der momentanen Aufregung nicht ganz klar sehen?«
Rohan fuchtelte ihm mit dem Brief vor dein Gesicht hin und her. »Ich sehe die Sache absolut klar, und ich weiß jetzt schon, daß ich dem Schurken, der das geschrieben hat, wahrscheinlich eine Kugel in den Kopf jagen werde. Der Mann ist ein verdammter Lügner - entweder er oder ein anderer, der ihm die Geschichte aufgetischt hat.«
»Aha«, gab Pulver von sich. Ohne Zweifel steckte eine Frau dahinter - wahrscheinlich eine ehemalige Geliebte, mit der er nichts mehr zu tun haben wollte. Ob sie wohl Geld von ihm wollte?
»Ich bin ein ganz guter Unterhändler«, sagte Pulver mit gekünstelter Bescheidenheit. »Ich werde mit so gut wie jedem Schuft in ganz London fertig. Wenn es sich um einen Schuft von außerhalb Londons handelt, dann werde ich ihn zertreten wie eine Laus.«
Rohan blickte seinen Sekretär geistesabwesend an. »Unterhändler?« sagte er schließlich. »Oh, du denkst wahrscheinlich an diese Melinda Corruthers. Die Kleine war wirklich keck, was? Aber du hast sie ja dann recht rasch überzeugt, daß sie auf dem falschen Dampfer ist - zumal ich sie wirklich noch nie im Leben gesehen hatte. Nun, aber diesmal geht es um etwas anderes. Ich kümmere mich selbst darum - das bin ich meinem Bruder einfach schuldig. Lehne alle Einladungen für nächste Woche ab.« Er hielt einen Moment lang inne und blickte seinen Sekretär an. »Und iß endlich etwas, Mensch. Du wirst jeden Tag magerer, kommt mir vor. Die Leute glauben schon, ich bezahle dir so wenig, daß du dir nicht einmal etwas zu essen leisten kannst. Selbst meine Mutter denkt, daß ich dich schäbig behandle.«
Pulver stand nachdenklich da, während der Baron die Bibliothek verließ. Es hatte bestimmt mit einer Frau zu tun. Mit einer Frau und seinem Bruder. Das war allerdings wirklich höchst eigenartig. Aber welcher Bruder - das war die Frage. Keiner der beiden Brüder des Barons war so wie er. Nun, viel war es nicht, was Pulver wußte - aber dennoch würde sein Freund David Plummy ziemlich beeindruckt sein, wenn er davon erfuhr.
Rohan suchte sein Schlafzimmer auf und ging unruhig auf und ab, wobei er irgend etwas vor sich hin murmelte - über einen jüngeren Bruder, der in schlechte Gesellschaft geraten sein mußte, wobei diese falschen Freunde irgendwann seinen Namen benutzten, um ihm ihre eigenen Untaten anzuhängen. Sein Kammerdiener Tinker, der kein Wort verstand, auch wenn er sich noch so bemühte, packte die Reisetasche für ihn. Tinker fragte sich, warum Seine Lordschaft nicht besserer Laune war, da es bei seiner Reise doch gewiß um eine Frau ging; schließlich ging es bei fast all seinen Reisen um eine Frau - das war kein Geheimnis. Der Baron war geradezu berühmt dafür, daß er regelmäßig eines seiner Liebesnester aufsuchte. Aber in diesem Fall schien es um mehr zu gehen als Leidenschaft und Vergnügen. Was mochte das sein? Nun, Tinker war geduldig - er würde es schon noch herausfinden. Er fragte sich, ob Pulver etwa mehr wußte als er selbst.
Rohan dachte erst an Lily, als er bereits fünfzehn Meilen von London entfernt war. Er hatte doch glatt vergessen, ihr eine Nachricht zu schicken, um ihr mitzuteilen, daß er sie diesen Abend nicht besuchen konnte. Ach, es gab im Moment so vieles, das erledigt werden mußte. Nun, er würde bestimmt nicht länger als drei Tage fort sein.
Wer zum Kuckuck war dieser Joseph Hawlworth von Mulberry House in Moreton-in-Marsh, einer Stadt, die ganz in der Nähe von Oxford lag, wo George gelebt hatte und seinen einsamen Studien nachgegangen war?
Susannah wandte ihr Gesicht der Sonne zu. Es war ein wunderbares Gefühl. Zwei Tage hatte es ununterbrochen geregnet, so daß die Menschen in der Gegend bereits ziemlich mürrisch und gereizt wurden - doch nun schien die Sonne, als hätte Gott selbst sie für sie persönlich erstrahlen lassen. Sie glättete die fruchtbare schwarze Erde rund um den Rosenstock. Danach wandte sie sich der Schleifenblume zu, auf die sie besonders stolz war; sie war ein Geschenk ihres Cousins, der von einem der Gärtner aus den Chelsea Gardens von dieser Pflanze erfahren hatte, die erst wenige Jahre zuvor von Persien nach England gebracht worden war. Im vergangenen Herbst hatte John es dann geschafft, sich einen Ableger aus den Gärten zu besorgen, den er ihr zukommen ließ. Während sie ihre Fingerspitzen zärtlich über die immergrünen Blätter und die dicht gedrängten weißen Blüten gleiten ließ, fragte sie sich, ob sie wohl jemals einem Menschen begegnen würde, der ihre Liebe zu den Blumen teilte.
Sie riß etwas Unkraut aus der Erde und vergewisserte sich, daß die Erde schön locker und feucht war. Sie hoffte inständig, daß das freundliche Wetter anhalten möge, denn die Schleifenblume brauchte viel Sonne, um zu gedeihen.
Verwundert drehte sie sich um, als sie eine Kutsche an der Vorderseite des Hauses vorfahren hörte. Ihr Vater war angeblich in Scottsdale - zumindest hatte er ihr das gesagt -, doch sie war sich ziemlich sicher, daß er in Blaystock mit seinen Kumpanen zusammensaß und wahrscheinlich sein letztes Hemd verspielte. Ob es ein Händler war? Nein, unmöglich. Sie hatte peinlich genau darauf geachtet, daß alle Händler bezahlt wurden, bevor sie ihrem Vater erlaubte, Mulberry House zu verlassen, so daß er sich bitterlich darüber beklagte, was für ein böses Weib sie doch geworden sei.
Wer mochte sonst in einer Kutsche zu ihr kommen? Als sie zur Vorderseite des Hauses gelangte, sah sie einen prächtigen Grauschimmel, der soeben schnaubend zum Stillstand kam. Der Mann, der die Kutsche lenkte, sprach dem Pferd beruhigend zu, was das mächtige Tier zu einem gelegentlichen Schnauben veranlaßte. Als das Pferd schließlich ruhig dastand, blickte der Mann sich um, vermutlich nach einem Stallburschen.
»Einen Augenblick«, rief Susannah ihm zu, »ich hole Jamie. Er kümmert sich um Ihr Pferd.«
»Vielen Dank«, rief der Mann zurück.
Als sie mit Jamie zurückkam, der hinten in der Scheune ein kleines Nickerchen im Heu gemacht hatte, strich der Mann dem Pferd über die Nüstern, wobei er immer noch mit ihm sprach.
»O Mann«, stieß Jamie bewundernd hervor, »jetzt sieh sich mal einer diesen Prachtkerl an. Ich werd’ ihn gut füttern, Sir, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Wie heißt denn der Bursche?«
»Gulliver.«
»Seltsamer Name für ein Pferd - aber was soll’s? Ich kümmere mich um ihn, Sir. Ganz grau bist du, und hast einen so wunderschönen weißen Stern auf der Stirn. Komm mit mir, du Prachtkerl.«
Rohan hörte fasziniert zu, wie der Stallbursche mit seinem Pferd zu sprechen begann, so als würde er es schon ewig kennen. Er blickte ihm nach, wie er Gulliver und die Kutsche hinter das Haus führte. Gulliver stolzierte neben ihm her, wobei er bei den Worten des Burschen hin und wieder sein mächtiges Haupt schüttelte - genauso wie er es bei Rohan machte; nur schien es, daß das Tier diesem Kerl, der ihm doch völlig fremd war, mehr Begeisterung entgegenbrachte als ihm, Rohan, der immerhin für seinen Hafer aufzukommen hatte.
Susannah beobachtete, wie er seinem Pferd nachsah. Als Jamie und Gulliver hinter dem Haus verschwunden waren, stand sie immer noch da und betrachtete den Fremden, der mit einem eleganten Mantel bekleidet war. Er zog seinen Hut und strich sich mit der Hand durch das hellbraune Haar. Er war sehr jung - ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt - und sah ziemlich gut aus. Ein wenig zu gut fast - und wahrscheinlich war er sich dessen auch sehr wohl bewußt. Sie blickte ihn ein wenig mißtrauisch an. Irgendwie wirkte das Gesicht vertraut auf sie, wenngleich sie zunächst nicht wußte, warum.
Sie brauchte jedoch nur ein paar Augenblicke. Sie holte tief Luft und wich einen Schritt zurück. »Sie sind Georges Bruder«, stieß sie hervor, »der ›wilde Baron‹. Du liebe Güte, ich wußte nicht, daß Sie ihm so ähnlich sehen.«
Sie war so blaß, daß er fürchtete, sie könnte jeden Moment in Ohnmacht fallen.
»Oh, da irren Sie sich aber. George hatte schwarzes Haar und dunkelbraune Augen. Wir sahen uns ganz und gar nicht ähnlich.«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, erwiderte sie nachdenklich. »Wie können Sie so etwas sagen? George hatte genauso grüne Augen wie Sie - er sagte, er hätte sie von seinem Vater geerbt -, und sein Haar war nur ein wenig dunkler als das Ihre.«
Tja, seine kleine List hatte nichts genützt.
»Nun gut«, sagte Rohan schließlich. »Dann war es also tatsächlich George. Sie haben ihn wirklich gekannt.« Vielleicht bedeutete es auch, daß sie nicht an diesem Plan beteiligt war, ihm eine Menge Geld abzuknöpfen. Wenigstens wußte er eines ganz sicher: es war tatsächlich George gewesen, so seltsam das Rohan auch immer noch vorkam. Er verbeugte sich nicht, wie er es vielleicht unter anderen Umständen getan hätte, sondern stand einfach da und betrachtete das ziemlich schäbige Haus, bei dem an einem der Schornsteine ein paar Ziegel fehlten, und den prachtvollen Garten, von dem es umgeben war. »Nachdem Sie mich gleich erkannt haben und außerdem George so genau beschreiben konnten, nehme ich an, daß Sie das Mädchen sind, das er angeblich entehrt haben soll?«
Sie sah ihn fassungslos an. Die dunklen Schmutzflecken auf ihren Wangen hoben sich deutlich von der Blässe ihres Gesichts ab. Sie brachte kein Wort heraus.
»Dann sind Sie wohl nicht dieses Mädchen. Na gut. Sie sind also nur ein Dienstmädchen - und nebenbei gesagt ziemlich schmutzig. Sie haben George wohl manchmal gesehen, wenn er kam? Sie arbeiten hier in diesem Haus? Für den Mistkerl, der mir diesen unverschämten Brief geschrieben hat? Wenn Sie tatsächlich hier arbeiten, dann ist an Ihrer Arbeit einiges auszusetzen - das Haus scheint nämlich in einem erbarmungswürdigen Zustand zu sein.«
Nach und nach fing sie sich wieder. »Da haben Sie schon recht, aber ich frage Sie, wie kann eine Dienstmagd dafür verantwortlich sein, wie das Haus von außen aussieht?« Das ließ ihn verstummen, und sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Natürlich war ihr sehr wohl bewußt, daß jede Dienstmagd, die etwas auf sich hielt, mit Verachtung auf sie herabsehen würde; ihre Hände waren schmutzig - genauso wie das Baumwollkleid, das sie trug; selbst unter den Fingernägeln hatte sie schwarze Erde, und das Haar hing ihr wirr ins Gesicht.
Sie half ihm aus seiner Verlegenheit, indem sie sagte: »Wissen Sie, ich arbeite nicht bloß hier - nein, ich wohne auch in diesem Haus.«
»Dann sind Sie also keine Magd?«
»Nein, das bin ich nicht.« Dann schwieg sie wieder und sah zu, wie er ein Stück Papier aus seinem Mantel hervorholte. »Wenn Sie hier leben, dann können Sie mir vielleicht sagen, warum mir dieser Joseph Hawlworth einen derart unverschämten Brief geschrieben hat, in dem er behauptet, George hätte Sie entehrt? Sie sind es doch, oder, die angeblich entehrt wurde?«
Kapitel 2
Sie schwieg länger, als Rohans Kammerdiener für gewöhnlich brauchte, um ihm die Krawatte zu binden. Rohan war kein allzu geduldiger Mensch - doch es gelang ihm, sich zu beherrschen. Tausend Fragen brannten ihm auf der Zunge, doch er würde sich in Geduld üben. Er wollte unbedingt erst einmal sehen, wie sie reagierte. Schließlich streckte sie ihre schmutzigen Hände von sich und sagte: »Ich bin nicht entehrt. Ich bin es nie gewesen.«
»Haben Sie meinen Bruder George tatsächlich gekannt? Ich meine, Sie wissen, wie er aussah - aber waren Sie ihm wirklich nahe?«
»Ja, ich stand ihm nahe - aber er hat mich nicht entehrt. Darf ich den Brief lesen, den mein Vater Ihnen geschrieben hat?«
Er reichte ihn ihr. Sie mußte das Blatt Papier erst glätten. In seinem Zorn mußte der Mann den Brief wohl ordentlich zerknüllt haben. Nun, sie verstand diesen Zorn nur zu gut. Sie las: »Geehrter Lord Mountvale, Ihr Bruder, George Carrington, hat meine Tochter entehrt. Als Oberhaupt der Familie Carrington ist es nun Ihre Pflich...«
Sie holte tief Luft. Die Absicht ihres Vaters war nur allzu offensichtlich. Langsam und sorgfältig faltete sie den Brief und gab ihn ihm zurück. »Mein Vater hat einen schweren Fehler gemacht«, sagte sie schließlich und blickte ihn an. »George hat mich nicht entehrt.« Es war eine ziemlich peinliche Situation. Jetzt wußte sie, warum ihr Vater es so eilig hatte, Mulberry House zu verlassen. Er hatte diesen verwerflichen Brief an Georges Bruder geschrieben und sich dann aus dem Staub gemacht, damit sie die Sache für ihn erledigte. Ihr Vater hatte keine Ahnung, daß Georges Bruder weithin als zügelloser Mensch und Frauenheld bekannt war, wie George ihr oft erzählt hatte. Doch er hatte stets hinzugefügt, daß sein Bruder im Grunde ein feiner Mensch sei. Sie konnte jedoch nicht verstehen, warum George ihr dann versichert hatte, daß es besser sei, wenn sein Bruder fürs erste noch nichts von ihr wußte - zumindest so lange, bis George Gelegenheit hätte, die Dinge ins Lot zu bringen und seinem Bruder alles zu erklären. Er behauptete steif und fest, daß sein Bruder sie ohne mit der Wimper zu zucken vernichten würde, wenn er sie als Bedrohung für ihn, George, erachtete. Es war alles sehr verwirrend für sie gewesen.
Und jetzt stand sie Georges älterem Bruder gegenüber. Es war kein George mehr da, der ihr hätte helfen können. Nie hatte sie vorgehabt, den Baron zu treffen und mit ihm zu sprechen. Sie hätte nicht gewollt, daß er überhaupt von ihr wußte.
Rohan steckte den Brief wieder in die Manteltasche. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie überrascht ich war, als ich diesen unverschämten Brief erhielt. Dieser Hawlworth ist also Ihr Vater?«
»Ja, er ist mein Vater. Er ist nicht hier.«
»Und er ist der Herr dieses wunderbaren Hauses?« Er blickte zu dem ramponierten Schornstein hinauf.
»Ja, ihm gehört dieses Haus. Ich bin seine Tochter, aber George hat mich nicht entehrt - das habe ich Ihnen schon gesagt. Sie können es mir glauben. Sie können wirklich mit reinem Gewissen wieder nach Hause fahren. Ich will und brauche nichts von Ihnen. Es tut mir leid, daß mein Vater Ihnen das angetan hat. Ich versichere Ihnen, er kann sich auf etwas gefaßt machen, wenn er zurückkommt.«
Das hatte Rohan nun wirklich nicht erwartet. Er mochte es ganz und gar nicht, in unerwartete Situationen zu geraten. Und in diesem Fall war nichts so, wie er gedacht hatte. Was ihn immer noch am meisten erstaunte, war die Tatsache, daß George, der eifrige Gelehrte, der sich so intensiv mit Kartographie beschäftigt hatte und der neben seinen Studien kaum andere Interessen zu haben schien - daß dieser George sehr wohl einen Sinn für das schöne Geschlecht gehabt hatte. Zumindest schien sein Interesse an dieser reizenden jungen Lady groß genug gewesen zu sein, um mit ihr das Bett zu teilen. Und eine Lady war sie ganz gewiß - mochte sie im Moment auch noch so schmutzig wirken. Er sah es an ihrer Haltung, an ihrem Auftreten, an ihren klaren und unmißverständlichen Worten. »Aber warum sind Sie bloß so schmutzig?« wollte er wissen.
Sie hob den Kopf und lächelte - es war ein reizendes Lächeln, stellte er fest - eine Beobachtung, die er aber sofort wieder als völlig unwesentlich beiseite wischte. »Sehen Sie sich doch um«, antwortete sie. »Ich bin der Gärtner hier. Und ich verstehe etwas von meiner Arbeit. Die Blumen mögen mich. Soll ich Ihnen meine Lilien zeigen? Meine Rosen sind wahrscheinlich die schönsten in der ganzen Gegend.«
Sie kümmerte sich also um den Garten? Auch das verblüffte ihn einigermaßen, doch er ließ sich nicht von seinem eigentlichen Anliegen abbringen. »Wie meinen Sie das - George hätte Sie nicht entehrt?«
»Ganz genau so wie ich es sage. Sie können jetzt wieder abfahren, Sir. Ich hole Jamie, damit er Ihr Pferd und Ihre Kutsche zurückbringt.«
»Nein, warten Sie.« Er hielt sie am Ärmel zurück. »Hören Sie, Sie sind ganz anders, als ich erwartet hatte - zumindest habe ich den Eindruck. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Mein Bruder ist vor etwa einem Jahr gestorben. Wenn Sie ihn gekannt haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir ein wenig von ihm erzählen. Wie es scheint, hatte George Interessen, die ich nicht bei ihm vermutet hätte - ich meine Sie.«
»George hatte viele Interessen damals«, gab sie mit ruhiger Stimme zurück.
»Warum sind Sie denn nicht zu seiner Beerdigung gekommen? Warum ist er nicht zu mir gekommen und hat mir von Ihnen erzählt?«
»Er wollte den richtigen Augenblick abwarten, wie er mir mehrmals versicherte. Ich hatte aber nicht das Gefühl, daß ein solcher Augenblick irgendwann in Sicht war.« Sie zuckte mit den Achseln. »Und dann war es eben zu spät. Was die Beerdigung betrifft - da konnte ich nicht kommen.«
Die ganze Sache kam ihm doch reichlich mysteriös vor. George hatte also den richtigen Moment abwarten wollen, um es ihm zu sagen? Was genau hätte er denn gesagt? Daß er diese junge Frau heiraten wollte, deren Gesicht zwar im Moment voll Erde war, die aber dennoch ziemlich hübsch aussah und die außerdem als Gärtnerin arbeitete? »Können wir nicht ins Haus gehen? Mir ist heiß, und ich bin ziemlich durstig.«
»Wenn Ihnen heiß ist - warum ziehen Sie dann nicht einfach Ihren Mantel aus?«
Er blickte sie vorwurfsvoll an. Er war es nicht gewohnt, daß Frauen so mit ihm sprachen. Nun, es kam schon vor, daß man ihn hin und wieder ein wenig neckte - vor allem seine Mutter beherrschte diese Kunst außerordentlich gut -, aber das geschah doch stets in einem liebevollen Ton. Er schlüpfte aus dem Mantel. »Mir ist immer noch heiß; soll ich die Hosen auch noch ausziehen? Und mein Durst ist auch noch nicht vergangen.«
Seine ungehörigen Worte schienen sie nicht im geringsten aus der Fassung zu bringen. Sie wollte ihn ganz einfach nicht ins Haus bitten, wenngleich sie einsah, daß sie kaum eine andere Wahl hatte. Wegschicken konnte sie ihn nicht gut, ohne ihn vorher zu bewirten. Aber sie konnte es kaum erwarten, ihn wieder loszuwerden. Sie wollte keinerlei Risiko eingehen.
Sie lauschte einen Augenblick ins Haus hinein; nichts war zu hören. Schließlich zuckte sie mit den Achseln und sagte: »Na gut. Ich gebe Ihnen gern etwas zu trinken, vielleicht auch etwas Kuchen - aber dann müssen Sie gehen.«
»Und Sie wollen kein Geld von mir?«
»Nein. Kommen Sie«, sagte sie, die Hände zu Fäusten geballt. Natürlich hätte er genau das von ihr erwartet. An seiner Stelle hätte sie nicht anders gedacht. Es schauderte sie, wenn sie an den Brief ihres Vaters dachte. Sie wußte noch nicht, was sie zu ihm sagen würde, wenn er wieder nach Mulberry House zurückkehrte - aber freundliche Worte würden es bestimmt nicht sein.
Er folgte ihr in den dunklen Hausflur. Es war sehr kühl im Inneren, vor allem deshalb, weil die Vorhänge im Flur zugezogen waren, so daß kein Sonnenlicht hereindringen konnte. Sie führte ihn in einen kleinen Raum, der hell und freundlich war und nur wenige Möbelstücke enthielt - insbesondere ein Sofa, mit Brokat bezogen, und zwei Stühle, die ziemlich unbequem aussahen. Der Teppich war zwar sauber, wirkte aber ziemlich billig. Der Eichenholzfußboden war gut gewachst, und auch in den Ecken war kein Staub zu sehen.
Ein bißchen Geld konnte gewiß nicht schaden, um dieses Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Er blickte sich nachdenklich um. Irgendwie irritierte es ihn, daß sie nicht einen einzigen Silberling von ihm wollte. Was, zum Teufel, ging hier vor?
Sie wies auf einen der Stühle und verließ das Zimmer, ohne ein Wort zu sagen.
Er blieb ungefähr zehn Minuten allein. Die meiste Zeit über saß er nur da und starrte das Sofa an. Schließlich kam sie mit einem Tablett zurück. »Ich habe hier Tee und Zitronenkuchen. Er ist erst einen Tag alt und immer noch recht frisch.«
»Sie sind also auch die Köchin des Hauses?«
»Für gewöhnlich macht es Mrs. Timmons, aber ihre Tochter hat gerade Zwillinge bekommen, und sie muß sich bis auf weiteres um die anderen Kinder kümmern.«
»Oh.« Er griff nach einem Stück Zitronenkuchen und nahm einen Bissen. Der Kuchen schmeckte sauer und ziemlich trocken.
»Mein Vater ist von meinen Kochkünsten nicht gerade begeistert. Er sagt, daß ich es schaffe, ein Stück Schweinslende in eine Schuhsohle zu verwandeln, so daß sich höchstens Lolah, unsere Ziege, dafür interessiert. Und was diesen Kuchen da betrifft, so muß ich sagen, ich weiß bis heute nicht, wieviel Zitronensaft ich dafür nehmen muß. Außerdem hatte ich nicht mehr viel Zucker im Haus - ich glaube, das schmeckt man auch.«
»Da kann ich Ihnen leider auch nicht weiterhelfen.«
»Nein, ich kann mir vorstellen, daß Sie noch nie in Ihrem Leben irgend etwas selbst gemacht haben.«
Diesen Seitenhieb konnte er nicht so einfach hinnehmen. »Wenn ich versuchen würde, Zitronenkuchen zu backen, dann würde ich es jedenfalls nicht vermasseln - ganz einfach, weil ich imstande bin, ein Kochrezept zu lesen und meinen Verstand zu gebrauchen. Dieser Kuchen ist so trocken, daß er einem in der Kehle steckenbleibt.«
»Wenn er Ihnen in der Kehle steckenbleibt, wie kommt es dann, daß Sie soviel reden?«
Er brummte etwas vor sich hin und trank einen Schluck Tee, wobei er erwartete, daß er wie lauwarmes Abwaschwasser schmecken würde. Dem war jedoch nicht so - es handelte sich um ganz vorzüglichen indischen Tee, wie er ihn besonders gerne trank. »Nun«, sagte er und lehnte sich in dem alten Stuhl zurück. »Erzählen Sie mir doch, wie Sie George kennengelernt haben und warum Sie meinen, er habe Sie gar nicht entehrt, obwohl Ihr Vater das Gegenteil behauptet.«
»Nein«, entgegnete sie. »Sie sind nur hier, weil mein Vater diese Behauptung aufgestellt hat. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht mehr von ihm hören. Folglich gibt es nichts, was Sie wissen müßten. Sie können mit reinem Gewissen von hier wegfahren.« Sie erhob sich. »Guten Tag, Mylord. Kommen Sie gut nach London zurück.«
Mit einer ungeduldigen Geste seiner feingliedrigen Hand gab er zu verstehen, daß er sich nicht so einfach ab wimmeln ließ. »Sie behaupten, Sie hätten meinen Bruder gut gekannt. Erzählen Sie mir, wie Sie ihn kennengelernt haben.«
Sie seufzte unwillig. »Ich wünschte wirklich, Sie würden mich jetzt verlassen und nach London zurückkehren.«
»Woher wissen Sie, daß ich nach London fahre?«
»Sie sind schließlich der ›wilde Baron‹, nicht wahr? Und Gentlemen Ihres Schlages sind doch für gewöhnlich in London zu Hause, oder etwa nicht?«
Man nannte ihn tatsächlich manchmal den ›wilden Baron‹, eine Bezeichnung, die ihn normalerweise eher amüsierte und die seine stolze Mama stets mit Zufriedenheit zur Kenntnis nahm - aber aus dem Mund dieser jungen Lady klang es eher wie eine Beleidigung. »Nun, so berüchtigt bin ich auch wieder nicht«, sagte er mit mürrischer Miene. »Und dem Menschen, der diesen idiotischen Beinamen erfunden hat, wünsche ich, daß ihn möglichst bald der Schlag treffen möge. Hat George Ihnen das erzählt?«
»Wenn er Sie den ›wilden Baron‹ nannte, dann tat er es immer voller Zuneigung. Er sagte, es liege Ihnen im Blut. Er erzählte mir auch, daß Ihr anderer Bruder, Tibolt, als Pfarrer ein sehr ernster und gottesfürchtiger Mensch sei, dem alles Zügellose von Natur aus fremd zu sein scheine. George meinte auch, daß man Ihre Eltern gerade für ihr ausschweifendes Leben lieben und achten würde und daß ihre Eskapaden in den höchsten Tönen gepriesen würden. Und George erzählte mir, daß Ihr Vater sich jedesmal die Hände rieb, wenn er von einer Ihrer Taten hörte, und stets sagte, daß Sie ein richtiger Teufel seien und daß er mächtig stolz auf Sie sei.«
»Vergessen Sie meine Mutter nicht in Ihrer Lobeshymne.« Verdammt, das hatte er nicht sagen wollen. Er beugte sich vor, die Hände zwischen den Knien. »Hören Sie, ich hatte keine Ahnung, daß mein Vater solche Dinge über mich gesagt haben soll. Er ist vor zwei Jahren gestorben. Meine Mutter ist trotz allem sehr lebenslustig. Sie ist einfach sie selbst. Trotzdem muß ich sagen, daß es dummes Zeug ist, was man sich so erzählt und was auch Sie vorhin wiedergegeben haben. Es ist nur Klatsch, nichts weiter.«
»Ich lese gelegentlich die London Times und die Gazette. Sie kommen mit schöner Regelmäßigkeit in beiden Zeitungen vor. Sie scheinen ein sehr abwechslungsreiches Leben zu führen. Ich kann mir vorstellen, daß Sie sehr beschäftigt sind; immerhin habe ich gelesen, daß Sie schon mit den meisten Ladies in London irgendwann eine Affäre hatten, daß Sie den Prinzregenten zu einer wahnwitzigen Wette herausgefordert und diese auch gewonnen haben sollen und daß Sie die Badewanne einer Lady mit Champagner gefüllt hätten, wobei ich lieber nicht erwähne, was höchstwahrscheinlich danach folgte.«
»Es war ohnehin kein allzu teurer Champagner. Was die Damen betrifft, so wundere ich mich, daß Sie all den Unsinn glauben. Ich lasse mich nicht mit verheirateten Frauen ein - ganz egal, ob sie dazu bereit wären oder nicht. Nein, was Sie gelesen haben, das sind nichts als absurde Übertreibungen - zumindest der Großteil davon.«
Er hielt plötzlich inne, als ihm bewußt wurde, wie lächerlich das alles klang, was er da sagte. Warum, um alles in der Welt, bemühte er sich überhaupt, sie zu überzeugen, daß er kein Frauenheld war? Schließlich konnte er mit seinem Ruf ganz gut leben. Er würde über diese Frage noch einmal nachdenken müssen. Sie brachte ihn dazu, Dinge zu sagen, die ihm normalerweise nicht in den Sinn kamen. Sie hatte die Augenbraue gehoben und blickte ihn an, wie eine nachsichtige Oberin eine junge Klosterschwester anblicken würde.
»Das Ganze geht Sie eigentlich nichts an«, sagte er schließlich, stellte die Tasse auf den Tisch und erhob sich von seinem Stuhl. »Ihr Vater hat wörtlich geschrieben, daß George Sie entehrt hätte. Was meint er damit? Hat George Sie verführt? Ihnen die Unschuld geraubt? Oder was hat er Ihnen sonst angetan? Sie sind immerhin kein knackiges siebzehnjähriges Mädchen mehr.« Er fuchtelte gereizt mit der Hand hin und her. »Wenigstens sind Sie jetzt sauberer als vorhin. Trotzdem haben Sie immer noch Schmutz unter den Fingernägeln.«
»Ich weiß. Ich konnte meine Handschuhe nirgends finden. Außerdem dachte ich, Sie wollten wissen, wie ich George kennengelernt habe. Nun, es gibt ohnehin nichts darüber zu erzählen. Wir trafen uns einfach - das ist alles. George hat nichts getan, was ich nicht gewollt hätte. Mein Vater hat unrecht. Sie können wirklich beruhigt abfahren, Sir.«
»Wie alt sind Sie, Miss Hawlworth?« fragte er ziemlich brüsk.
»Ich bin fast einundzwanzig.«
»George war dreiundzwanzig, als er starb. Ich dachte, Sie seien viel älter - eine erfahrene Frau, die sich den grünen Jungen angelt.«
»George - ein grüner Junge? Ja, mag sein, daß er das war. Er war sehr schüchtern und ruhig, und er liebte es, Landkarten zu studieren.« Sie hielt einen Moment lang inne, den Blick auf den Zitronenkuchen gerichtet.
»Wissen Sie, George war kein eingebildeter Tugendbold oder so etwas, aber er war irgendwie ein Einzelgänger, der sich ausschließlich seinen Studien widmete, vor allem den Karten, und ich wußte zwar, daß er auch seine Erfahrungen mit Frauen gehabt hatte - aber man sah es ihm einfach nicht an.«
»Nein, George war nicht prüde. Und er hatte seine Erlebnisse gehabt - zumindest hat er mir das gesagt. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es stimmte - wie sollte ich auch?«
»Natürlich. Aber, sagen Sie, wie alt waren Sie, als Sie George begegneten?«
»Das weiß ich nicht mehr so genau.«
»Sie weichen mir aus. Sagen Sie die Wahrheit, verdammt noch mal.«
»Da gibt es nicht viel zu sagen. Außerdem ist das alles doch nicht mehr wichtig«, fügte sie achselzuckend hinzu.
Er war wütend, wollte ihr aber nicht zeigen, wie wütend er tatsächlich war. Sie dachte anscheinend, daß er es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, mehr Frauen ins Bett zu bekommen als jeder andere Mann in England und daß das bei den Carringtons ohnehin in der Familie lag. Wahrscheinlich meinte sie, daß ihm die Zügellosigkeit schon in die Wiege gelegt worden war. Verdammt, das war es ja tatsächlich, was alle Welt dachte - doch in diesem Augenblick war ihm diese Tatsache unerträglich. Am liebsten hätte er dieses lächerlich aussehende Sofa gepackt und aus dem Fenster geschleudert - aber das Fenster wäre ohnehin zu klein dafür gewesen. Er holte erst einmal tief Luft. »Ich möchte mehr über George erfahren. Erzählen Sie mir doch von ihm.«
»Er war hübscher, als gut für ihn war - genau wie Sie«, erwiderte sie mit nüchterner Stimme, so daß es ganz und gar nicht wie ein Kompliment klang. »Er war klug, aber manchmal kam er mir ziemlich verloren vor, so als wollte er etwas sein, was er ganz einfach nicht war. Ich hatte des öfteren den Eindruck, daß er nicht wußte, was er tun sollte. Das mag seltsam klingen - doch so ist er mir oft vorgekommen. Aber auf seine Art war er treu.«
Das war genau der George, den er kannte. Der ruhige, wißbegierige George. »Was meinen Sie damit - er sei auf seine Art treu gewesen?«
»Die Menschen, die er ins Herz geschlossen hatte oder denen er sich verpflichtet fühlte, ließ er nicht im Stich.«
»Nein, natürlich nicht. Könnten Sie sich vielleicht etwas deutlicher ausdrücken?«
»Nein. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel noch mitteilen, daß er zuviel trank. Das hat mir große Sorgen bereitet.«
»Ich habe George nie mit auch nur einem Drink gesehen. Ich kann alles bestätigen, was Sie über ihn sagen - außer das mit dem Trinken. Sind Sie sicher, daß es wirklich George war und nicht jemand, der bloß seinen Namen benutzte - jemand, der ihm vielleicht ein wenig ähnlichsah?«
Sie erhob sich rasch. »Einen Moment. Ich glaube, ich weiß nicht genau, was Sie damit sagen wollen.«
Sie verließ den Raum. Er hörte ihre federnden Schritte auf der Treppe. Als sie wenige Augenblicke später zurückkehrte, hatte sie einen Skizzenblock in der Hand. Sie blätterte in den Seiten und reichte ihm dann den Block. Sie war eine hervorragende Zeichnerin. Und das Gesicht, das er vor sich sah, stellte ohne Zweifel seinen Bruder dar. Sein Gesicht hatte einen schüchternen, aber auch sehnsuchtsvollen Ausdruck. Diese Sehnsucht hatte er nie in den Augen seines Bruders gesehen. Er gab ihr den Block zurück, ehe ihm bewußt wurde, daß er gerne auch die anderen Zeichnungen gesehen hätte.
»Das ist George«, sagte er.
»Natürlich ist er es.«
»Wissen Sie, wie er starb?«
»Ich weiß, daß er ertrunken ist. In der Gazette stand nichts Genaueres. Ich wußte nicht, wie ich mehr hätte herausfinden können.«
»Das wäre ganz leicht gewesen. Sie hätten mir nur schreiben müssen, aber Sie haben es nicht getan. Nun, er und ein paar Freunde waren mit kleinen Segelbooten unterwegs, um eine Wettfahrt von Ventnor nach Lucy Point zu unternehmen. Sie wußten nicht, daß ein mächtiger Sturm heraufziehen würde. Georges Boot wurde bei Lucy Point gegen die Klippen geschleudert. Das Boot zerschellte. Der junge Mann, der mit George im Boot war, hat überlebt. George ertrank - er wurde nie gefunden. Wäre er betrunken gewesen, dann hätte ich ihn eigenhändig umgebracht, wenn er nicht ertrunken wäre. Aber er war bestimmt nicht betrunken. George hat nie etwas getrunken, das habe ich Ihnen schon gesagt.«
»Ja, das haben Sie«, sagte sie und schwieg. Sie war mit einem Mal sehr bleich im Gesicht, was möglicherweise auf die Erinnerung an Georges Tod zurückzuführen war. Er war ebenfalls still und schlürfte seinen Tee. Nachdem sie ein Stück Kuchen verzehrt hatte, sagte sie: »Sie haben recht, er schmeckt wirklich ziemlich sauer. Ich muß noch daran arbeiten, schätze ich.«
»Bitten Sie Mrs. Timmons, daß sie Ihnen helfen soll.«
»Ja, das werde ich vielleicht machen. Nun werden Sie wohl aufbrechen, Sir, nicht wahr?«
Er zuckte mit den Achseln. Warum auch nicht? Er hatte hier wirklich nichts mehr verloren. Nun, immerhin hatte er vielleicht ein kleines Detail über George erfahren, das ihm unbekannt gewesen war. Aber George war tot - es spielte also keine große Rolle mehr. Die junge Frau war nicht bereit, ihm mehr über ihn zu erzählen - und zwingen konnte er sie ja wohl auch nicht. Aber da war noch der Vater - er hätte zu gern gehört, was der verdammte Kerl zu sagen hatte. »Wo ist Ihr Vater jetzt?«
Ihre Haltung wurde mit einem Mal ziemlich steif »Er ist nicht hier.«
»Das sehe ich auch. Wo kann ich ihn finden? Er versteckt sich vor mir, nicht wahr? Er hat es Ihnen überlassen, mir gegenüberzutreten.«
Er war der Wahrheit so nahe, daß es ihr einen kurzen Ruck gab. Wie hatte er das nur wissen können? »Ich werde es Ihnen nicht sagen«, brachte sie schließlich hervor. »Sie könnten ihn zu einem Duell herausfordern. Sie könnten ihm ein paar Zähne ausschlagen. Und er kann es sich nicht leisten, noch mehr Zähne zu verlieren.«
»Ich werde ihm seine verdammten Zähne nicht ausschlagen, obwohl er es durchaus verdient. Wo ist er?«
Susannah schüttelte den Kopf. Ihre Lippen waren zu einem dünnen Strich zusammengepreßt. Georges Tod hatte sie bestimmt getroffen - daran zweifelte er nicht. Er sah einen Schmutzfleck an ihrem Haaransatz, den sie beim Waschen übersehen hatte; er hob sich nicht sehr von ihrem dunkelbraunen Haar ab. Es war ein warmes, volles Dunkelbraun. Doch ihre Augen waren kalt und abweisend, von einer hellen graublauen Farbe. Sie hatten etwas durchaus Geheimnisvolles an sich, glichen jenem Saphir, den er vor drei Jahren gekauft hatte. Seine Mutter hatte ihn ausgesucht, und zwar als Geschenk für eine seiner Mätressen; sie wußte nicht, daß er den Stein behalten hatte.
Rohan verzichtete auf weitere Fragen. Er nahm seinen Mantel und ging zur Haustür hinaus. Sie ging dicht hinter ihm her. Wollte sie sich etwa vergewissern, daß er tatsächlich abfuhr? Oder hatte sie Angst, daß er dieses lächerliche Sofa in dem Empfangszimmer stehlen könnte? Dachte sie vielleicht, er könnte sich im Stall verstecken?
Die Kutsche stand direkt vor dem Haus, aber Gulliver war nirgends zu sehen. Als er um das Haus herum ging, sah er Jamie, wie er das Pferd striegelte, wobei er aus voller Kehle sang:
»Es war mal ein Kerl von Lyme,
der hatte drei Frauen daheim.
›Warum drei denn gerade? ‹
Drauf er: ›Eine wär’ fade,
und Bigamie darf nun mal nicht sein‹«
Rohan hielt sich den Bauch vor Lachen. Der Stallbursche hatte den Limerick in einem schönen vollen Bariton gesungen, der durchaus geeignet gewesen wäre, ein größeres Publikum zu unterhalten.
»Jamie«, sagte Susannah, die zum Baron aufschloß, »ist ein Meister des Limericks. Das macht ihm so schnell keiner nach.«
»Ja, das kann ich mir vorstellen.« Er sah zu, wie Jamie Gulliver vor das Haus führte, der damit nicht recht einverstanden schien. Sein eigenes Pferd wollte nicht mit ihm kommen?
»Jetzt aber los, du treuloser Kerl«, rief Rohan ihm zu. »Na gut, wenn du unbedingt willst, dann lerne ich eben auch ein paar Limericks, die ich dir gelegentlich vorsinge.«
Gulliver wieherte und scharrte mit dem Vorderhuf in der Erde. Er spitzte die Ohren zunächst zu Jamie, dann in Rohans Richtung.
Susannah ging dicht hinter ihm her. Er nahm die Zügel von Jamie entgegen und führte Gulliver zur Kutsche.
Sie sah zu, wie er das Pferd mit raschen Handgriffen vor den Wagen spannte. Er blickte einmal kurz zu ihr auf und sah den besorgten Ausdruck auf ihrem Gesicht. Sie sah immer wieder zu einem der oberen Fenster hinauf.
»Haben Sie mich etwa belogen? Versteckt sich Ihr Vater da oben?« fragte er.
»Bestimmt nicht. Sind Sie immer noch nicht fertig? Sie sollten Jamie das machen lassen - er kann das schneller.«
»Ich kann Gulliver sehr gut allein vor die Kutsche spannen«, erwiderte er mit eisiger Stimme. Hielt sie ihn denn für einen völligen Taugenichts? Einen nutzlosen Idioten? Nun, so sahen ihn wahrscheinlich die meisten Menschen - und liebten ihn dafür nur noch mehr. Was für eine verrückte Welt.
»Da, jetzt haben Sie schon wieder hinaufgeblickt. Wer oder was ist denn da oben? Ein verrückter Onkel vielleicht? Sie verheimlichen mir doch irgend etwas.«
In diesem Moment hörte er ein Kind weinen.
Kapitel 3
»Das«, sagte Rohan nachdenklich, wobei er nicht zu dem Fenster blickte, sondern in ihr versteinertes Gesicht, »war ganz bestimmt nicht Ihr Vater.«
Das Kind begann von neuem loszuheulen - diesmal noch lauter als zuvor.
Sie drehte sich um und lief ins Haus.
»Jamie!« rief Rohan dem Stallburschen zu.
Er übergab ihm Gullivers Zügel. »Sing ihm bitte noch einen Limerick vor«, sagte er, während er schon auf das Haus zuging. »Und schreib ihn mir auf, damit ich ihm später selbst etwas vorsingen kann.«
Er sah gerade noch den Saum ihres Kleides am oberen Ende der Treppe verschwinden. Plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen.
Ein Kind?
Was sollte er tun? Er wandte sich rasch zur offenen Haustür um. Am besten wäre es, einfach zu verschwinden. Das war es. Umkehren und nach Hause fahren. Mit diesem Kind hatte er nicht das geringste zu tun. Es war bestimmt ihr kleiner Bruder oder ihre Schwester. Nein, dieses Kind ging ihn bestimmt nichts an.
Er hörte Jamie mit wohlklingender Stimme singen:
»Es war mal ein Greis aus St. Nyssen,
der setzte sich anstatt auf ein Kissen
auf sein falsches Gebiß
und rief aus: ›So ein Mist!
Jetzt hab’ ich mich in den Hintern gebissen!‹«
Er hörte Gulliver beifällig wiehern. Dieses treulose Pferd!
Rohan drehte sich langsam auf der untersten Stufe um und blickte nach oben. Es war kein Weinen mehr zu hören. Alles war still. Er wollte es nicht tun - immerhin ging es ihn rein gar nichts an -, und dennoch ging er nach oben, die enge steile Treppe hinauf. Er wandte sich nach rechts und schritt den engen Gang entlang, an zwei geschlossenen Türen vorbei, ehe er vor der dritten Tür stehenblieb, die einen Spaltbreit geöffnet war. Obwohl er überzeugt war, daß er sich lieber nicht in ihre Angelegenheiten einmischen sollte, drückte er die Tür schließlich ein Stück weiter auf.
Sie saß in einem Schaukelstuhl und wippte langsam vor und zurück, ein kleines Mädchen in den Armen. Sie sang dem Kind ein leises Lied und strich ihm dabei beruhigend über den Rücken, während sie ihm mit einem Finger der anderen Hand sanft die Wange streichelte. Die Kleine schluchzte noch gelegentlich auf, ehe sie sich nach und nach beruhigte. Susannah sprach ihr tröstend zu, wobei sie langsam im Stuhl vor und zurück schaukelte. »Ist ja gut, mein Liebling, alles ist gut. Du hast nur geträumt. Es ist alles gut.«
Er mußte irgendein Geräusch verursacht haben. Er war sich dessen nicht bewußt, aber aus irgendeinem Grund wurde sie plötzlich auf ihn aufmerksam. Sie starrte ihn an, das Gesicht kreidebleich. Das Kind spürte ihre Anspannung und strebte von ihr weg.
»Ist ja gut«, flüsterte sie erneut und drückte die Kleine an sich. »Ist schon gut, mein Liebling. Bleib bei deiner Mama. Es ist alles in Ordnung.«
Mama? War sie etwa die Mutter der Kleinen. Nein, unmöglich. Bestimmt war das Kind ihre kleine Schwester. Mama? Hatte sie denn nicht steif und fest behauptet, George habe sie nicht entehrt?
Er drehte sich um, ging zurück und stieg langsam wieder die Treppe hinunter. Er wollte das Haus verlassen, in seine Kutsche steigen und Gulliver lospreschen lassen, damit er so rasch wie möglich von hier wegkam.
Statt dessen trat er in das Empfangszimmer ein, in dem er zuvor Tee mit ihr getrunken hatte. Er schenkte sich noch eine Tasse ein und warf einen Blick auf den Zitronenkuchen, ohne sich jedoch ein Stück zu nehmen.
Ziemlich lange saß er da und trank seinen Tee.
Irgendwann tauchte sie in der Tür auf, ohne ein Wort zu sagen, und blickte ihn mit ausdruckslosem Gesicht an.
»Sie haben zu dem Kind gesagt, Sie seien seine Mama. Ist das wahr?«
»Nein, ich habe es gesagt, weil es sie beruhigt.«
Er stand langsam auf. »Wie alt ist die Kleine?«
Er sah ihrem Gesicht an, daß sie vorhatte, nicht die Wahrheit zu sagen, und fügte deshalb rasch hinzu: »Ich habe sie gesehen. Ich bin kein Vollidiot. Glauben Sie ja nicht, Sie könnten mich für dumm verkaufen.«
»Also gut. Sie ist drei Jahre und fünf Monate alt.«
»Dann kann sie nicht Georges Kind sein. Sie kann auch nicht Ihr Kind sein. Sie haben mir gesagt, Sie sind einundzwanzig. Wenn sie drei Jahre alt ist, dann müssen Sie achtzehn gewesen sein, als Sie sie zur Welt brachten, und siebzehn, als Sie schwanger wurden. George wäre damals gerade neunzehn gewesen. Nein, es kann nicht Georges Kind sein. Er hätte es mir gesagt, um Himmels willen. Es ist ja nicht so, daß Sie schwanger wurden und er kurz darauf starb. Nein, die Kleine ist ja kein Baby mehr, sondern ein kleines Mädchen. Sie ist nicht sein Kind, oder?«
»Nein«, antwortete sie. »Natürlich nicht. Sie ist meine kleine Schwester.«
»Schön.« Er verließ den Raum.
Sie eilte hinter ihm her. »Wo wollen Sie denn hin?« fragte sie.
Er ging wieder die Treppe hoch, den engen Gang entlang und öffnete leise jede einzelne Tür.
»Hören Sie auf damit. Bitte gehen Sie endlich.«
Er wandte sich zu ihr um. Sie war völlig außer Atem.
»Wo ist das Kind?«
»Warum gehen Sie nicht endlich? Sie wollen doch selbst schon die längste Zeit abfahren.«
»Das stimmt - aber ich kann nicht.« Er wußte, er konnte sehr wohl aufbrechen, wenn er sich wirklich dazu gezwungen hätte. Er konnte sehr wohl die Treppe hinuntersteigen - zu Gulliver und dem singenden Stallburschen. Georges Kind. Sein uneheliches Kind. Er konnte es einfach nicht glauben. Er wollte es nicht glauben.
Deshalb ging er weiter.
Sie ließ die Schultern sinken. »Also gut, diese Tür.«
Die Kleine schlief auf einem schmalen Bett. Sie lag auf dem Bauch, wobei sie mit einem Arm eine Puppe festhielt, die nur noch wenige Haare auf dem Kopf hatte. Sie war in eine dünne Decke gehüllt.
Das Gesicht des Mädchens war zur Wand gekehrt, so daß lediglich ihr blondes Haar zu sehen war.
»Wie heißt sie denn?«
»Marianne.«
Er spürte, wie sein Herz heftiger zu pochen begann. Er dachte an Marianne, die kleine Tochter von Junker Bethony, die kaum fünf Jahre alt gewesen war, als sie starb. Das arme Ding. Die Kleine war Georges bester Freund gewesen. Nach ihrem Tod sprach er acht Monate lang kaum ein Wort.
»Hat sie einen zweiten Namen?«
»Ja. Lindsay. Sie heißt Marianne Lindsay. Es ist der Name meiner Mutter.«
Es war wie ein Stich mitten ins Herz. Langsam wandte er sich ihr zu. »Sie wissen, welche Bewandtnis es mit dem Namen ›Marianne‹ hat, nicht wahr?«
»Ja, ich weiß es.«
Die Kleine rührte sich im Schlaf und begann an zwei Fingern zu saugen.
»Behaupten Sie immer noch, daß das Kind Ihre Schwester ist?«
»Ich schätze, das hätte nicht mehr viel Sinn.«
»Da haben Sie recht. Bitte wecken Sie sie. Ich möchte Georges Kind sehen - meine Nichte.«
Sie beugte sich über die Kleine und berührte sie sanft am Rücken. Das Kind begann schneller an den Fingern zu saugen. »Wach auf, Marianne. Komm schon, Liebling, wach auf. Da ist ein Gentleman, der dich sehen möchte. Komm, mein Schatz.« Sie hob die Kleine auf, mitsamt der Decke, und küßte ihr kleines Ohr. Das Kind öffnete langsam die Augen. Rohan blickte in diese Augen, die so sehr seinen eigenen glichen - und denen seines Bruders. Hellgrün waren sie - so wie bei fast allen männlichen Carringtons in den letzten drei Generationen.
Er schluckte erst einmal. Langsam streckte er die Hand aus und berührte mit den Fingerspitzen das Gesicht des Mädchens, das sogleich zurückwich.
»Ist schon gut, Liebling.«
»Ja«, sagte er mit sanfter Stimme. »Ich bin dein Onkel.«
Die Kleine nahm die Finger aus dem Mund. Sie betrachtete ihn neugierig mit ihren schönen smaragdgrünen Augen. »Was ist ein Onkel?«
»Ich bin der Bruder deines Papas.«
Mit ihrer kleinen Hand berührte sie das Grübchen in seinem Kinn. »Du hast ein Loch in deinem Kinn - genau wie Papa.«
»Ja«, sagte er und schluckte.
»Ich habe keines. Mama hat gesagt, daß Gott es nicht jedem gibt.«
»Das stimmt. Aber Gott hat es den meisten Knaben in der Familie Carrington gegeben.«
»Mama hat mir gesagt, daß Papa manchmal geschrien hat, wenn er sich rasierte, weil er sich immer bei diesem Loch geschnitten hat.«
»Ja, das ist nicht so leicht.« Rohan konnte sich nicht erinnern, George jemals beim Rasieren gesehen zu haben. Er hatte nicht viel zu rasieren gehabt. Aber er hatte ganz offensichtlich in diesem Haus gelebt, hatte hier gebadet und sich rasiert.
»Es wäre schön, wenn Gott mir auch eines gibt. Hast du gewußt, daß Papa in den Himmel gekommen ist?« Sie sagte es ganz nüchtern, so als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Dann steckte sie wieder die Finger in den Mund und begann heftig daran zu saugen.
»Ich habe kein Bild von George - außer der Kohlezeichnung, die ich vor zwei Jahren von ihm gemacht habe. Marianne wird bald vergessen haben, wie er aussah.«
»Nein, das glaube ich nicht. Die Zeichnung ist hervorragend. Sie wird ihn nicht vergessen.«
Sie zuckte mit den Achseln. »Ich fürchte, die Zeichnung ist nicht gut genug. Irgendwann wird sie sein Gesicht vergessen haben.«
»Nein, wird sie nicht.« Er wußte selbst nicht, wie er dazu kam, dies zu behaupten.
Sie wiegte das Kind sanft im Arm und sagte ganz ruhig und gelassen: »Es gibt hier nichts mehr für Sie zu tun, Mylord. Es stimmt, sie ist Georges Tochter - Sie hatten recht. Die Kleine sieht ihm auch sehr ähnlich, aber das hat keinerlei Folgen für Sie. Immerhin ist sie kein Junge. Für Sie kann sie doch in keiner Weise wichtig sein.«
»Wann genau wird sie vier Jahre alt?«
»Im November, am vierten November.«
»Sie haben mir nicht gesagt, warum Sie nicht zu Georges Beerdigung kamen - nur, daß Sie nicht konnten. Das ist doch Unsinn. Sie hätten sehr wohl kommen können. Es hätte doch niemand gewußt, wer Sie sind.«
Er wollte also die Wahrheit hören. »Ich hatte nicht genug Geld für die Fahrt. Sie brauchen nicht so hochmütig zu grinsen. Ich werde Sie nicht um Geld anbetteln, und auch auf Ihr Mitleid kann ich verzichten. Wir kommen sehr gut zurecht. Es ist nur, daß mein Vater hin und wieder Unsinn macht und sein Geld verspielt. Übrigens macht er das wahrscheinlich auch in diesem Moment. Und zu jenem Zeitpunkt war eben gerade nicht genug Geld im Haus. Zum Glück war der Pfarrer so nett und ist zu uns gekommen, damit wir für George beten konnten.« Sie senkte den Kopf und stand stumm da, das Mädchen im Arm.
Er streckte die Hand aus, um ihr Kinn sanft anzuheben. Die Tränen liefen ihr über die Wangen.
»Zumindest hat George zwei Jahre mit seiner Tochter verbringen können.«
»Ja.«
»George hat seine Tochter doch gekannt, oder?«
»Natürlich, aber er konnte nicht sehr oft hier sein. Er hat sich mit so viel Eifer seinen Studien in Oxford gewidmet.«
Aber hätte George seine Karten und Geschichtsbücher nicht genauso gut hier studieren können? Offensichtlich nicht. Warum hatte George ihm nichts von ihr und seiner Tochter gesagt? Es ergab einfach keinen Sinn.
Und dann, mit einem Mal, wurde ihm alles klar.
»Wie ist denn ihr Familienname?« fragte er, den Blick auf das Kind gerichtet.
Sie schien innerlich zu erstarren. Die Kleine in ihrem Arm fing an zu zappeln - sie fühlte die Unruhe ihrer Mutter.
Er sah zu, wie sie das Kind beruhigte, wobei sie es sich über die Schulter legte und leicht auf den Rücken tätschelte. Die Kleine schluchzte zwei-, dreimal und seufzte dann tief. Er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
Schließlich legte sie die Kleine wieder ins Bett, deckte sie zu, wartete noch ein paar Minuten, um sich zu vergewissern, daß sie auch wirklich schlief, und bedeutete ihm dann, das Zimmer zu verlassen.
Sie ging mit ihm hinaus, und als sie die Treppe erreicht hatten, fragte er sie noch einmal: »Wie ist ihr Familienname?«
»Ihr Familienname ist Carrington«, antwortete sie und ging vor ihm die Treppe hinunter.
Unten angekommen, drehte sie sich zu ihm um. »George und ich wurden im Oktober 1806 in Oxford getraut. Mein Vater gab mir seine Einwilligung, weil ich damals erst siebzehn war.«
»Aber George hätte ohne meine Einwilligung unmöglich heiraten können. Ich meine, ich mache Ihnen keinen Vorwurf, daß Sie auf dieser Lüge beharren - immerhin müssen Sie mit den Leuten hier in der Gegend irgendwie zurechtkommen. Das kleine Mädchen ist Georges uneheliches Kind - aber ich werde dafür sorgen, daß sie nicht darunter zu leiden hat. Ich werde alles tim, damit ...«
Sie standen einander in dem dunklen Hausflur gegenüber. Sie holte aus und gab ihm eine schallende Ohrfeige.
»Wie können Sie es wagen?« stieß sie hervor. »Nein, es macht mir nichts aus, daß Sie mich beleidigt haben - aber daß Sie Ihren eigenen Bruder für so ehrlos halten!« Sie erhob neuerlich ihre Hand gegen ihn. Diesmal konnte er sie jedoch rechtzeitig am Handgelenk packen. In seinem Kopf drehte sich immer noch alles von der Ohrfeige, die sie ihm gegeben hatte.
»Sie sind stark«, sagte er schließlich, ohne jedoch ihr Handgelenk loszulassen.
Sie versuchte sich von ihm loszureißen, was ihr aber nicht gelang. »George hat mir immer wieder versichert, daß es nicht sinnvoll wäre, es Ihnen zu sagen. Er meinte, Sie würden ihn nach Australien schicken und mir Marianne wegnehmen. Außerdem würden Sie mich in den Kolonien als Sklavin verkaufen.«
Rohan blickte sie entgeistert an. Das sollte George gesagt haben? Nein, das konnte nicht sein, es war einfach unmöglich.
»Dann lachte er aber und behauptete, daß Sie der beste Bruder seien, den man sich vorstellen kann - trotz Ihres Lebenswandels. Ich wußte nie so recht, was ich davon halten sollte. Ich sage Ihnen, Mylord, Sie wissen rein gar nichts. Aber nachdem Sie mir nicht glauben, werde ich Ihnen die Dokumente zeigen. Es ist mir nicht wichtig, was Sie über mich oder Marianne denken - aber ich will nicht, daß Sie eine falsche Meinung von Ihrem Bruder haben. Und dann würde ich es begrüßen, wenn Sie abfahren. Sie hatten nie irgendeinen Anteil an unserem Leben. Mir war schon bald klar, daß George niemals gewollt hätte, daß Sie an unserem Leben Anteil nehmen. Und ich will es genauso wenig.«
Er war in höchstem Maße verblüfft. Das alles ergab ganz einfach keinen Sinn.
Er hatte eine Nichte namens Marianne, und er kannte nicht einmal den Namen der Mutter.
Als sie in den Flur zurückkam, wo er auf sie wartete, übergab sie ihm einen Umschlag. Darin befand sich eine Urkunde, die durchaus echt aussah. Das war also der Trauschein. Er erkannte die Unterschrift seines Bruders. Er las auch die Unterschrift des Pfarrers. Bligh McNally. Er brauchte nicht weiterzulesen.
Langsam gab er ihr das Dokument zurück.
»Ihr Vater hat mir den Brief geschrieben, weil er Geld wollte. Offensichtlich herrscht hier in Mulberry House kein großer Reichtum. Aber Sie haben mich nicht um Geld gebeten; entweder wollen Sie wirklich keines, oder Sie verfolgen einen besonders listigen Plan, um sich zu bereichern.«
»Ich will Ihr Geld nicht. Darum ist es mir nie gegangen. George meinte, er würde eine bestimmte Summe von Ihrem Vater erben, wenn er fünfundzwanzig wäre. Leider kam es nicht mehr dazu.«
Er blickte einen Moment lang nachdenklich in die Ferne, dann lächelte er plötzlich. Endlich hatte er eine Idee, wie er vorgehen konnte. »Ach, hat er Ihnen denn gar nichts davon erzählt, daß er ... nein, wie sollte er auch - Tante Mariam starb nämlich kurze Zeit nach George. Er wußte nicht, daß sie ihm Geld hinterlassen hatte - etwa zwanzigtausend Pfund. Dieses Geld bekam dann ich, da George ja nicht mehr lebte.« Er holte tief Luft - es war ihm sehr wohl bewußt, daß sein Plan nicht ungefährlich war. »Da George eine Tochter hat, sollte sie das Geld bekommen.«
Geld, dachte sie, während sie den Baron verblüfft anstarrte. George hatte ihr doch tatsächlich Geld hinterlassen - wenn auch ohne es zu wissen. Nein, eigentlich bot der Baron ihr das Geld an, obwohl er nicht dazu verpflichtet war. Nicht einen Shilling oder zwei - nein, eine gewaltige Summe: zwanzigtausend Pfund. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals mehr als zwanzig Pfund auf einmal gesehen zu haben.