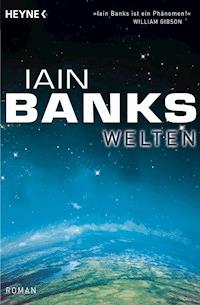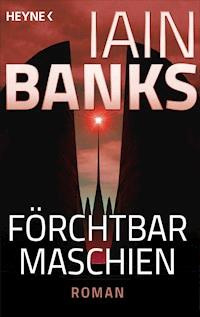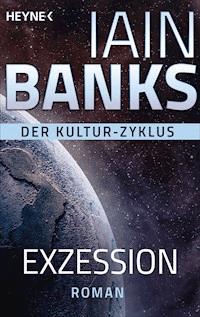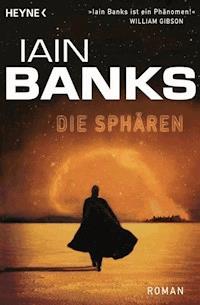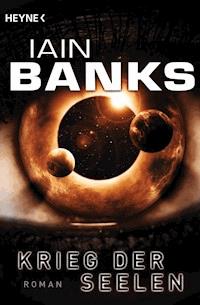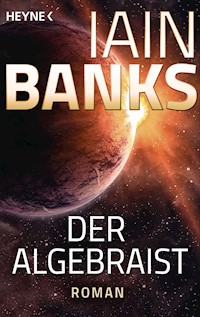
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wer die Wurmlöcher beherrscht, beherrscht die Galaxis
Um die riesigen Distanzen im All zu überwinden, wurde ein Netzwerk aus Wurmlochkanälen geschaffen, und nur wer den Algebraisten – die Formel für die Wurmlochverbindungen – besitzt, kontrolliert dieses Netzwerk. Kein Wunder also, dass etliche Völker versuchen, den Algebraisten in ihren Besitz zu bekommen …
Spannende Action vor einem mehr als epischen Hintergrund – Bestsellerautor Iain Banks stellt ein weiteres Mal unter Beweis, dass er die große Science Fiction unserer Zeit schreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1015
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
ISBN 978-3-641-08684-8V005
Das Buch
Die Dweller sind die älteste Zivilisation der Galaxis. Diese eigenwilligen Wesen haben in Millionen Jahren eine Hochkultur geschaffen und bewohnen jetzt fast alle Gasriesen im Kosmos. Die Kauzigen und eigenwilligen Individualisten scheren sich wenig um die Menschen, die nach und nach die Spiralarme der Galaxie besiedelt haben und einander permanent bekriegen und dabei immer wieder die Wurmlochverbindungen unterbrechen, die für die interstellare Raumfahrt unabdingbar sind. Doch genau diese Wurmlöcher sind der Schlüssel zur Vormacht im Universum, und als bekannt wird, dass die Dweller über eine Liste aller Verbindungen verfügen, versuchen die Kriegsherren, diese an sich zu bringen – egal, zu welchem Preis. Fassin Taak, der seit vielen Jahren unter den Dwellern lebt und ihre Geheimnisse zu ergründen versucht, erkennt schnell, dass sich hinter dieser Liste mehr verbirgt als nur simple Reiserouten: Sie führt tief in die Geheimnisse unseres Universums …
Der Autor
Iain Banks wurde 1954 in Schottland geboren. Nach einem Englischstudium schlug er sich mit etlichen Gelegenheitsjobs durch, bis ihn sein 1984 veröffentlichter Roman „Die Wespenfabrik“ als neue aufregende literarische Stimme bekannt machte. In den folgenden Jahren schrieb er zahllose weitere erfolgreiche Romane, darunter „Bedenke Phlebas“, „Exzession“ und „Der Algebraist“. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der britischen Gegenwartsliteratur. Am 9. Juni 2013 starb Iain Banks im Alter von 59 Jahren.
Für die MacLennans:Andy, Fiona, Duncan, Nicol,Catriona und Robin
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Sie hat viele Anfänge und vielleicht auch einen Schluss. Oder auch nicht. Anfänge und Schlüsse sind ohnehin immer willkürlich; Erfindungen, Hilfsmittel. Wo fängt eine Geschichte wirklich an? Alles steht in einem Kontext, einem alles übergreifenden epischen Zusammenhang. Immer gibt es etwas vor den geschilderten Ereignissen, es sei denn, wir wollten jedes Mal mit ›URKNALL! Expansion! Sssssssss …‹ beginnen und alles auflisten, was danach im Universum geschah, bevor wir endlich unser eigentliches Thema in Angriff nähmen. Und auch kein Ende ist endgültig, es wäre denn das Ende aller Dinge …
Dennoch habe ich eine Geschichte zu erzählen. Meine eigene Rolle darin war so verschwindend gering, dass ich mir nicht anmaße, mich mit einem eigenen Namen einzuführen. Immerhin war ich dabei, als alles begann, und durfte einen dieser willkürlichen Anfänge miterleben.
Man sagt, aus der Luft betrachtet schmiege sich das Herbsthaus wie eine riesige graurosa Schneeflocke an die welligen grünen Hänge. Es liegt auf der langen, flachen Geländestufe, mit der die Nördliche Tropische Hochebene nach Süden hin abschließt. An der Nordseite des Hauses breiten sich die verschiedenen klassischen Gartenanlagen und die Bauerngärten aus, deren Pflege mir Pflicht und Freude zugleich ist. Etwas weiter oben erhebt sich eine ausgedehnte Tempelruine, angeblich von einer Spezies namens Rehliden erbaut (6ar, stark dezimiert oder ausgestorben, je nachdem, welcher Quelle man Glauben schenken will). Auf jeden Fall haben sie diese Gegend längst verlassen.)
Die mächtigen weißen Säulen des Tempels ragten einst an die hundert Meter hoch in unsere dünne Luft, doch nun liegen die Kolosse mit ihren Kanneluren und Streifen auf dem Boden oder sind zur Hälfte im torfigen Erdreich der naturbelassenen Landschaft versunken. Die oberen Enden – der langsame Sturz bei halber Standardschwerkraft muss ein eindrucksvolles Schauspiel gewesen sein – schlugen tiefe Krater in die Erde und warfen lange, wulstige Wälle auf. Diese hohen Dämme wurden in den Jahrtausenden seit ihrer plötzlichen Entstehung durch Erosion und durch die vielen kleinen Erdbeben auf unserer Welt langsam abgetragen, so dass die Erde zurückrutschen und die breiten Gräben um die Säulenenden wieder auffüllen konnte. Nun weist das Gelände nur noch eine Reihe von sanften Wellen auf, eine Serie von flachen Tälern, aus denen die frei liegenden Säulenteile bleich hervorragen, als wären es die blanken Knochen unseres kleinen Planetenmondes.
Eine Säule war quer über ein flaches Flusstal gerollt und bildet nun einen schrägen, zylinderförmigen Damm. Das Wasser fängt sich in einer der metertiefen Zierrillen, die sich über die ganze Länge ziehen, fließt hinab zum kunstvoll gestalteten Kapitell und stürzt in vielen hübschen Katarakten in einen tiefen Teich gleich unterhalb der hohen, dichten Hecken an der oberen Grenze unseres Parks. Hier wird es gefasst und weitergeleitet. Ein Teil gelangt in eine große Zisterne, aus der die Springbrunnen vor dem Haus gespeist werden. Der Rest fließt in den Bach, der über Stufen und Schwellen in vielen Windungen zu den Zierteichen und dem Halbgraben führt, der das eigentliche Haus umgibt.
Ich stand inmitten von triefend nassen Exer-Rhododenronzweigen und Schlinggewächsen unterhalb einer steilen Stufe bis über die Hüften im plätschernden Wasser, spreizte mich mit drei Gliedmaßen ein, um nicht von der Strömung fortgerissen zu werden, und stutzte ein besonders störrisches Moilgestrüpp am Rand einer höher gelegenen und mit ziemlich kümmerlichem Scalpygras bewachsenen Wiese – ein an sich lobenswerter, aber gescheiterter Versuch, diese bekanntlich besonders klumpige Grassorte anzusiedeln … ach, ich schweife ab, ich darf mich nicht hinreißen lassen, das Scalpygras tut nichts zur Sache – als der junge Herr pfeifend, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, von seinem Morgenspaziergang durch die oberen Steingärten zurückkam. Er blieb über mir auf dem Kiesweg stehen und lächelte zu mir herunter. Ich drehte den Kopf, ohne mit dem Schneiden aufzuhören, schaute nach oben und nickte so gemessen, wie es mir in dieser unbequemen Haltung möglich war.
Von dem violetten Himmelsstreifen, der im Osten über dem gewölbten Horizont (Berge im Dunst) und unter Nasquerons gewaltiger Masse sichtbar war, strömte Sonnenlicht herab. Der Gasriese (ein Flickenteppich in allen Farben des Spektrums unterhalb von Hellgelb, vielfach gesprenkelt und über und über mit mehr oder weniger breiten Streifen aus zerfließenden Schnörkeln bedeckt) füllte fast den ganzen Himmel aus. Ein stationärer Spiegel, der fast genau im Zenith stand, warf eine scharfe gelbweiße Linie auf Nasquerons größten Sturmflecken, der, groß wie tausend Monde und schwerfällig wie ein bräunlich oranger Bluterguss über uns hinwegzog.
»Guten Morgen, Obergärtner.«
»Guten Morgen, Seher Taak.«
»Wie steht es um unsere Gärten?«
»Im Großen und Ganzen alles gesund, würde ich sagen. In guter Verfassung für den Frühling.« Natürlich hätte ich eine sehr viel detailliertere Beschreibung liefern können, aber noch wusste ich nicht, ob Seher Taak nicht nur Konversation machen wollte. Er deutete mit dem Kopf auf das Wasser, das meine unteren Gliedmaßen umspülte.
»Alles in Ordnung, OG? Das sieht gefährlich aus.«
»Ich bin gut verankert und habe einen festen Stand, Seher Taak, vielen Dank.« Ich zögerte (in diesem Moment hörte ich weiter unten im Park eine kleine, leichte Person die Steinstufen zum Kiesweg heraufspringen), und als mich Seher Taak auch weiterhin ermunternd anlächelte, fügte ich hinzu: »Die Strömung ist so stark, weil unten die Pumpen eingeschaltet sind und das Wasser zurückführen. Wir wollen einen der Seen von Schlingpflanzen säubern.« (Zwanzig Meter von uns entfernt erreichte die kleine Person den unbefestigten Weg, man hörte unter ihren Füßen die Steinchen aufspritzen.)
»Ich verstehe. Ich dachte mir doch, dass es in letzter Zeit nicht so viel geregnet hat.« Er nickte. »Gute Arbeit, Obergärtner, weiter so.« Er wandte sich zum Gehen und sah, wer da auf ihn zugelaufen kam. Ich schloss aus dem Geräusch, dass es sich um die kleine Zab handelte. Zab ist noch in dem Alter, in dem sie ganz selbstverständlich von einem Ort zum anderen läuft, wenn kein Erwachsener da ist, der es ihr verbietet. Dennoch glaubte ich im Rhythmus ihrer Schritte mehr Ungeduld als gewöhnlich zu hören. Seher Taak lächelte das Mädchen an und runzelte zugleich die Stirn, als sie vor ihm über den Kies schlitterte und zum Stehen kam. Die Kleine legte eine Hand auf den Latz ihrer gelben Hose, beugte sich vor, um zweimal übertrieben tief Luft zu holen – wobei die langen rosaroten Locken ihr Gesichtchen umtanzten –, richtete sich dann mit einem noch tieferen Atemzug auf und erklärte:
»Onkel Fassin! Großvater Slovius sagt, du bist wieder einmal aus den reichen Weiten, und wenn ich dich sehe, soll ich dir ausrichten, dass du sofort auf der Stelle zu ihm kommen sollst!«
»Tatsächlich?«, erwiderte Seher Taak lachend. Er bückte sich, fasste die Kleine unter den Schultern und hob sie hoch, bis ihr Gesicht auf gleicher Höhe mit dem seinen war und ihre rosaroten Stiefelchen vor dem Bund seiner Kniehosen baumelten.
»Genau das hat er gesagt«, bekräftigte sie leicht gekränkt. Dann wanderte ihr Blick nach unten, und sie entdeckte mich. »Ach, OG, hallo!«
»Guten Morgen, Zab.«
»In diesem Fall«, sagte Seher Taak, hob das Kind noch höher, drehte es um und setzte es auf seine Schultern, »sollten wir schleunigst nachsehen, was der alte Herr von uns will.« Er ging auf das Haus zu. »Sitzt du auch fest da oben?«
Sie legte ihm die Hände auf die Stirn und sagte: »Klar doch!«
»Und pass diesmal auf die Äste auf.«
»Pass du auf die Äste auf!«, sagte Zab und fuhr Seher Taak mit den Fingern durch die braunen Locken. Dann drehte sie sich um und winkte mir zu. »Wiedersehen, OG!«
»Auf Wiedersehen«, rief ich ihnen nach. Sie näherten sich bereits der Treppe.
»Nein, du musst auf die Äste aufpassen, kleines Fräulein!«
»Nein, du musst auf die Äste aufpassen!«
»Nein, du musst auf die Äste aufpassen!«
»Nein, du musst auf die Äste aufpassen.«
»Nein, du musst auf die Äste aufpassen …«
EINS
IM HERBSTHAUS
Es hatte sich hier draußen in Sicherheit gewähnt. Schließlich war es nur einer von vielen tief gefrorenen schwarzen Punkten in dem riesigen Schleier aus Eisschutt, der die Grenzbereiche des Systems wie ein dünnes Leichentuch umhüllte. Aber es hatte sich getäuscht. Von Sicherheit konnte keine Rede sein.
Es drehte sich langsam um sich selbst und beobachtete hilflos, wie die Suchstrahlen in weiter Ferne über die zernarbten, kahlen Partikel glitten. Sein Schicksal war besiegelt. Die Fühler aus kohärentem Licht waren so schnell, dass sie kaum zu spüren waren, und so trügerisch zaghaft, dass sie nicht ins Bewusstsein drangen. Die Strahlen berührten nur flüchtig und erhellten kaum, erfüllten aber ihren Zweck, indem sie nichts fanden, wo es nichts zu finden gab. Nur Kohlenstoff, Spurenelemente und steinhart gefrorenes Wasser: uralt, tot und – wenn man sich nicht daran zu schaffen machte – für niemanden bedrohlich.
Jedes Mal, wenn die Laser weiterglitten, keimte neue Hoffnung auf, und es dachte wider alle Vernunft, die Verfolger würden aufgeben, würden einfach kapitulieren, und es könnte in Ruhe für immer seine Bahnen ziehen. Oder aus dem Orbit ausbrechen und, für alle Zeiten in die Einsamkeit verbannt, mit weniger als Lichtgeschwindigkeit durch das All bummeln. Oder seine Systeme abschalten und in Schlaf sinken oder … Vermutlich könnte es auch – und das war es natürlich, was die Verfolger fürchteten und warum sie die Jagd fortsetzten – Intrigen spinnen, Reserven mobilisieren, vorbereitungen treffen, beschleunigen, bauen, kopieren, rekrutieren und schließlich – angreifen! … Die Rache üben, die ihm so eindeutig zustand, von allen seinen Feinden den Preis einfordern, den sie – wenn es unter irgendeiner Sonne noch so etwas wie Gerechtigkeit gab – für ihre Intoleranz, ihre Grausamkeit und ihren Generationenmord zu entrichten hatten.
Doch dann kamen die Nadelstrahlen wieder und erleuchteten zitternd die Pockennarben eines weiteren schwarzen Klumpens aus Eis und Ruß, aus mehr oder weniger großer Entfernung, aber immer rasch und peinlich ordentlich, mit militärischer Präzision und einer sturen, bürokratischen Systematik.
Den ersten Lichtspuren nach zu schließen, waren es mindestens drei Schiffe. Wie viele mochten es tatsächlich sein? Wie viele mochten sie für die Suche abgestellt haben? Eigentlich spielte es keine Rolle, ob sie einen Augenblick, einen Monat oder ein Jahrtausend brauchten, um die Beute aufzuspüren. Sie wussten offensichtlich, wo sie zu suchen hatten, und sie würden nicht aufgeben, bis sie es gefunden hatten, oder bis sie überzeugt waren, dass es nichts zu finden gab.
Dass es so unverkennbar in Gefahr schwebte, und dass sein Versteck bei aller Größe fast der erste Ort war, an dem die Schiffe ihre Suche begonnen hatten, erfüllte es mit Schrecken. Und das nicht nur, weil es nicht sterben oder zerlegt werden wollte, wie es anderen Opfern wie ihm widerfahren war, bevor sie vollends vernichtet wurden. Wenn es an diesem Ort, wo es sich so sicher gefühlt hatte, nicht sicher war, dann gälte das auch für so viele andere seinesgleichen, die von der gleichen Voraussetzung ausgegangen waren.
Gütige Vernunft, womöglich gibt es nirgendwo mehr Sicherheit für uns.
Alle seine Forschungen, seine Überlegungen, all die großartigen Entwicklungen, die Veränderungen, die Früchte jener einen großen Erkenntnis, zu der es nun nicht mehr gelangen, die ihm nicht mehr beschieden sein würde und die es nicht mehr weitergeben konnte, alles, alles war umsonst gewesen. Es hatte noch die Wahl, mit oder ohne eine gewisse Würde abzutreten, aber abtreten musste es.
Es konnte dem Tod nicht entrinnen.
In eisigen Fernen schalteten die Nadelschiffe ihre Nadelstrahlen an und wieder aus, und nun entdeckte es endlich das Muster, es konnte die Szintillationsfolgen der einzelnen Schiffe unterscheiden, konnte die Form der Suchraster bestimmen und durfte dennoch nur hilflos zusehen, wie sich der Fächer langsam ausbreitete und die tödlichen Verfolger unaufhaltsam näher kamen.
Der Archimandrit Lusiferus, Kampfpriester des Hungerleider-Kults von Leseum9IV, der wahre Herr über einhundertsiebzehn Sonnensysteme, etwa vierzig bewohnte Planeten, zahlreiche größere immobile Habitate und viele Hunderttausende von zivilen Großkampfschiffen, befehligte als Großadmiral das Schutzgeschwader der Vierhundertachtundsechzigsten Außenflotte (auf Sondereinsatz). Vor dem jüngsten noch andauernden Chaos und den letzten Ausläufern der Separations-Kaskade hatte er im Auftrag des Rotierenden Triumvirats des Clusters Epiphanie Fünf Menschen und Nichthumanoide im Obersten Galaktischen Rat vertreten. Vor einigen Jahren hatte man auf seinen Befehl den Kopf seines ehemals größten Widersachers, des Rebellenhäuptlings Stinausin, von dessen Schultern getrennt, unverzüglich an ein permanentes Lebenserhaltungssystem angeschlossen und mit dem Hals nach oben an die Decke von Lusiferus’ repräsentativem, in die Außenmauer der Felsenzitadelle eingelassenen Arbeitszimmer gehängt, das eine so grandiose Aussicht über Junch City und die Faraby-Bucht bis hinüber zu den schroffen, nebelverhangenen Wänden der Force-Schlucht bot. Nun konnte der Archimandrit, so oft ihm danach zumute war – und das kam ziemlich häufig vor – den Kopf seines alten Feindes wie einen Punchingball bearbeiten.
Lusiferus hatte langes, glattes, glänzend schwarzes Haar, und sein von Natur aus blasser Teint war nach allen Regeln der Kunst so verändert worden, dass die Haut nahezu rein weiß leuchtete. Die Augen hatte man künstlich vergrößert, war aber dabei so nahe am von Natur aus Möglichen geblieben, dass niemand sicher sein konnte, ob tatsächlich eine Manipulation vorlag. Das Weiße um die schwarze Iris leuchtete tief rot, und sämtliche Zähne waren sorgfältig durch lupenreine Diamanten ersetzt worden, so dass sein Mund je nach Lichteinfall bizarr und zahnlos aussah wie bei einem Primitiven aus dem Mittelalter oder ein wahres Feuerwerk versprühte.
Bei einem Straßenkünstler oder Schauspieler hätte man solche physiologischen Kapriolen als komisch, vielleicht sogar leicht verwegen empfunden. Bei einem Mann, der so viel Macht besaß wie Lusiferus, wirkten sie dagegen tief beunruhigend, ja erschreckend. Auch sein Name war zu gleichen Teilen geschmacklos und grauenerregend. Er trug ihn nicht von Geburt an, sondern hatte ihn selbst ausgewählt, weil er vom Klang her an eine von jeher verachtete irdische Gottheit erinnerte, von der die meisten Menschen – zumindest die meisten r-Menschen – irgendwann im Geschichtsunterricht gehört hatten, auch wenn sie wahrscheinlich nicht mehr genau sagen konnten, in welchem Zusammenhang.
Dank weiterer genetischer Manipulationen war der Archimandrit schon seit langem hoch gewachsen und gut gebaut und verfügte über beachtliche Kräfte in Armen und Schultern. Wenn er also im Zorn zuschlug – und wenn er zuschlug, geschah es fast immer im Zorn – war die Wirkung ungeheuer. Der Rebellenführer, dessen Kopf jetzt von Lusiferus’ Decke hing, hatte dem Archimandriten militärisch und politisch große Schwierigkeiten bereitet, bevor er endlich besiegt worden war, Schwierigkeiten, die bisweilen schon an Demütigungen grenzten, und Lusiferus empfand noch immer einen abgrundtiefen Groll gegen den Verräter. Dieser Groll schlug leicht und zuverlässig in blinden Zorn um, sobald er in das Gesicht des Mannes schaute, auch wenn es noch so blau geschlagen und blutig war (die künstlich verstärkten Selbstheilungskräfte des Kopfes arbeiteten schnell, aber nicht ohne gewisse Verzögerungen). Und so prügelte der Archimandrit wahrscheinlich immer noch mit der gleichen Begeisterung auf Stinausins Kopf ein wie vor Jahren, als er ihn erstmals in diesem Raum hatte aufhängen lassen.
Stinausin hatte diese Behandlung nur knapp einen Monat lang ertragen, dann war er rettungslos dem Wahnsinn verfallen, und man hatte ihm den Mund zugenäht, weil er nicht aufhörte, den Archimandriten anzuspucken. Er konnte nicht einmal Selbstmord begehen: dieser einfache Ausweg wurde ihm durch Sensoren, Schläuche, Mikropumpen und Bioschaltkreise versperrt. Auch ohne diese externen Einschränkungen hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, Lusiferus Beschimpfungen entgegenzuschleudern oder seine eigene Zunge zu verschlucken, denn die hatte man ihm ausgerissen, als man ihm den Kopf abschlug.
Obwohl Stinausin inzwischen ganz und gar den Verstand verloren hatte, pflegte er zu weinen, wenn ihm nach einer besonders intensiven Trainingsstunde mit dem Archimandriten das Blut von den aufgeplatzten Lippen, aus der mehrfach gebrochenen Nase und aus den verschwollenen Augen und Ohren quoll. Das bereitete Lusiferus eine besondere Genugtuung, und manchmal stand er schwer atmend da, wischte sich mit einem Handtuch den Schweiß ab und sah zu, wie sich die Tränen mit dem Blut vermischten, das von dem umgedrehten, körperlosen Kopf in das große Keramikduschbecken tropfte, das in den Boden eingelassen war.
Seit kurzem hatte der Archimandrit jedoch ein neues Spielzeug und suchte deshalb hin und wieder einen Raum mehrere Stockwerke unter seinem Arbeitszimmer auf. Dort wurde ein namenloser Attentäter gefangen gehalten, der langsam an seinen eigenen Zähnen zugrunde ging. Der Attentäter, ein großer, kräftiger Mensch mit einem Löwengesicht, war ohne Waffen losgeschickt worden, nur mit besonders geschärften Zähnen. Sein unbekannter Auftraggeber hatte wohl gehofft, er würde damit dem Archimandriten die Kehle durchbeißen, und das hatte er ein halbes Jahr zuvor auch versucht – hier im Felsenpalast bei einem Festbankett zu Ehren des Präsidenten des Systems. (Ein ausschließlich repräsentatives Amt, das auf Lusiferus’ Betreiben stets von Personen in vorgerücktem Alter und mit schwindenden Kräften ausgeübt wurde). Der Attentäter hatte seinen Auftrag nur deshalb nicht erfolgreich ausgeführt, weil der Archimandrit in fast schon paranoider Voraussicht – und unter strenger Geheimhaltung – für einen starken Personenschutz gesorgt hatte.
Nach dem Scheitern des Anschlags hatte man den Gefangenen routinemäßig, aber deshalb nicht weniger grausam gefoltert und danach unter dem Einfluss einer ganzen Palette von Wahrheitsdrogen und elektrobiologischen Substanzen verhört, aber er hatte keine verwertbaren Aussagen gemacht. Sein Auftraggeber hatte offensichtlich von Verhörtechnikern, die mindestens ebenso viel von ihrem Fach verstanden wie die Untergebenen des Archimandriten, alle belastenden Informationen aufs Sorgfältigste aus seinem Bewusstsein entfernen lassen. Die Hintermänner hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, dem Opfer, wie in solchen Fällen üblich, falsche Erinnerungen einzupflanzen, um so jemanden aus dem Umkreis des Hofs und des Archimandriten zu belasten.
Lusiferus, ein sadistischer Psychopath mit blühender Phantasie – was gibt es Schrecklicheres? –, hatte den Attentäter letztendlich zum Tod durch seine eigenen Zähne verurteilt – durch die Waffen also, mit denen er gekommen war. Dazu hatte man ihm die vier Eckzähne entfernt, sie durch biotechnische Eingriffe in unaufhörlich wachsende Stoßzähne umgewandelt und wieder eingepflanzt. Bald hatten die fingerdicken Hauer die oberen und unteren Kieferknochen durchbrochen und, nachdem sie die Lippen durchbohrt hatten, ihr Wachstum unerbittlich fortgesetzt. Die beiden unteren wölbten sich nach oben über sein Gesicht und berührten nach ein paar Monaten die Kopfhaut auf dem Schädeldach. Die beiden oberen wuchsen wie zwei Krummsäbel nach unten und erreichten etwa zur gleichen Zeit den Hals unterhalb des Kehlkopfs.
Beide Zahnpaare waren genetisch so verändert, dass sie auch dann nicht zu wachsen aufhörten, wenn sie auf Widerstand trafen. Sie drangen also in den Körper des Attentäters ein. Ein Paar bohrte sich langsam durch die knöchernen Schädelplatten, das andere durchstieß weitaus müheloser das weiche Gewebe der unteren Halspartie. Wo sich die Zähne in den Hals des Attentäters gruben, verursachten sie große Schmerzen, waren aber nicht unmittelbar lebensbedrohend; wenn man sie gewähren ließ, würden sie nach einiger Zeit im Nacken wieder austreten. Dagegen würden ihn die Zähne, die sich durch den Schädel und ins Gehirn bohrten, in Kürze, vielleicht schon in einem Monat, qualvoll töten.
Der bedauernswerte namenlose Attentäter konnte das nicht verhindern, weil er an Händen und Füßen mit dicken Bändern aus rostfreiem Stahl an die Wand gefesselt war, die jede Bewegung unmöglich machten. Die Ernährung und alle anderen Körperfunktionen wurden über verschiedene Schläuche und Implantate gesteuert. Den Mund hatte man ihm zugenäht wie dem Rebellenhäuptling Stinausin. In den ersten Monaten der Gefangenschaft hatte der Ärmste jeden Schritt des Archimandriten mit grimmigen, vorwurfsvollen Blicken verfolgt. Irgendwann hatte sich der Archimandrit davon belästigt gefühlt und befohlen, dem Mann auch die Augenlider zuzunähen.
Hören könne er freilich noch, und man hatte Lusiferus versichert, er sei auch nach wie vor bei Verstand. Deshalb kam der Archimandrit manchmal zum Zeitvertreib herunter, um selbst in Augenschein zu nehmen, wie weit die Zähne inzwischen in den Körper des Elenden vorgedrungen waren. Da er dabei stets ein im wahrsten Sinne des Wortes gebanntes – wenn auch notgedrungen diskretes – Publikum vorfand, unterhielt er sich gerne mit dem glücklosen Attentäter.
»Guten Tag«, sagte Lusiferus freundlich. Hinter ihm glitt die Tür des Aufzugs polternd zu. Der Raum unter dem Arbeitszimmer war für den Archimandriten so etwas wie sein Geheimversteck. Hier verwahrte er nicht nur den namenlosen Attentäter, sondern auch verschiedene Andenken an frühere Feldzüge, Beutestücke aus seinen vielen Siegen, Kunstwerke, die er aus einem Dutzend verschiedener Sonnensysteme zusammengeraubt hatte, eine Sammlung von zeremoniellen und Hochleistungswaffen, verschiedene Kreaturen in Käfigen oder Tanks und die aufgespießten Köpfe all jener bedeutenden und inzwischen mausetoten Feinde und Widersacher, die nicht so vollständig vernichtet worden waren, dass an sterblichen Überresten nur Strahlung, Staub, Schleim oder nicht mehr identifizierbare Fleischfetzen und Knochensplitter (oder die entsprechenden Alienrückstände) geblieben wären.
Lusiferus ging zu einem tiefen Trockentank, der zur Hälfte in den Fußboden eingelassen war, und schaute hinein. Auf dem Grund des Beckens lag zusammengerollt und reglos ein Abstruser Spleißer. Der Archimandrit schlüpfte mit einer Hand in einen dicken Handschuh, der ihm bis zum Ellbogen reichte, griff in einen großen Topf, der in Hüfthöhe auf dem breiten Beckenrand stand, und warf eine Hand voll fetter schwarzer Rüsselegel in den Tank.
»Und wie geht es dir so? Hältst du dich tapfer? Ja?«, fragte er.
Ein Zuschauer hätte nicht sagen können, ob der Archimandrit mit dem Menschen an der Wand, mit dem Abstrusen Spleißer – der jetzt nicht mehr still lag sondern den blinden glänzend braunen Kopf hob und schnupperte, während ein erwartungsvolles Zucken durch seinen langen Gliederkörper ging – oder gar mit den Rüsselegeln sprach, die Stück für Stück auf den bemoosten Grund des Beckens klatschten und sofort mit sinusartigen Wellenbewegungen über den Boden der Ecke zustrebten, die am weitesten von dem Abstrusen Spleißer entfernt war. Das massige braune Untier schleppte sich schwerfällig hinterher und trieb sie die glatten Glaswände hinauf. Jeder Egel wollte die anderen überholen und rutschte doch wieder zurück, sobald er versuchte, sich nach oben zu ziehen.
Lusiferus zog den Handschuh wieder aus und warf einen Blick durch das dämmrige Gewölbe. Die ruhige, behagliche Höhle tief im Fels hatte weder Fenster noch Lichtschächte. Hier fühlte er sich sicher und konnte sich entspannen. Er wandte sich dem Attentäter zu, der sich wie ein langer brauner Schatten vor der Wand abzeichnete, und sagte: »Zuhause ist es doch immer noch am schönsten, nicht wahr?« Der Archimandrit lächelte sogar, obwohl es niemanden gab, der ihn sehen konnte.
Im Becken scharrte etwas, dann folgte ein dumpfer Schlag und schließlich ein schrilles, kaum noch hörbares Winseln. Lusiferus drehte sich um. Der Abstruse Spleißer riss die Riesenegel entzwei und fraß sie auf. Dabei schüttelte er seinen dicken, braun gefleckten Kopf so heftig, dass schleimige schwarze Fleischbatzen bis über den Beckenrand geschleudert wurden. Einmal hatte er sogar einen lebenden Egel aus dem Becken geworfen und dabei fast den Archimandriten getroffen; Lusiferus hatte den verletzten Egel mit einem Scherenschwert durch den ganzen Raum gejagt und so heftig auf das Vieh eingehackt, dass tiefe Scharten im dunkelroten Granitboden zurückgeblieben waren.
Als es im Becken nichts mehr zu sehen gab, wandte sich der Archimandrit dem Attentäter zu. Er schlüpfte erneut in den Handschuh, holte einen weiteren Rüsselegel aus dem Topf und schlenderte damit auf den Mann an der Wand zu. »Weißt du noch, wie dein Zuhause war, Attentäter?«, fragte er und trat ganz dicht an ihn heran. »Sind in deinem Kopf noch irgendwelche Erinnerungen erhalten geblieben? An die Heimat, die Mutter, die Freunde?« Endlich blieb er stehen. »Ein winziger Rest vielleicht?« Er wedelte mit der feuchten Schnauze des Egels vor dem Gesicht des Attentäters herum. Die beiden witterten einander. Das kalte, zappelnde Wesen in der Hand des Archimandriten streckte sich, um sich an das Gesicht des Menschen zu heften, der Mensch saugte den Atem durch die Nüstern und drehte den Kopf so weit wie nur möglich zur Seite, als wollte er in der Wand verschwinden (es war nicht seine erste Begegnung mit einem Rüsselegel). Doch die Stoßzähne, die sich in seine Brust bohrten, schränkten seine Bewegungsfreiheit stark ein.
Lusiferus folgte dem Kopf des Mannes mit dem Egel und hielt das Vieh so dicht vor das leicht behaarte Löwengesicht, dass der Attentäter den zuckenden, zappelnden Fleischklumpen riechen konnte.
»Oder hat man dir alle Erinnerungen aus dem Gehirn gerissen, hat man dich gründlich gesäubert, bevor man dich losschickte, um mich zu töten? Wie? Ist nichts mehr vorhanden?« Er führte den Egel so nahe heran, dass der mit seinen Mundwerkzeugen leicht die Nase des Mannes berührte. Der Attentäter zuckte zurück und wimmerte vor Angst. »Was sagst du? Weißt du noch, wie es zu Hause war, Kumpel? Eine angenehme Umgebung, Geborgenheit und Sicherheit, Menschen, denen du vertrauen konntest, die dich vielleicht sogar liebten? Was sagst du? Wie? Was? Nun rede schon.« Der Mann versuchte, den Kopf noch weiter zu drehen, und dehnte dabei die runzlige Haut um die Einstichwunden so stark, dass sie an einer Stelle zu bluten anfing. Der Riesenegel in Lusiferus’ Hand zitterte und streckte die schleimigen Mundwerkzeuge noch weiter aus, um sich am Fleisch des Menschen festzusaugen. Doch bevor ihm das tatsächlich gelang, beugte der Archimandrit den Arm und ließ das Tier herabhängen. Es schwang und drehte sich mit bebenden Muskeln hin und her. Man konnte seine Frustration förmlich spüren.
»Hier ist mein Zuhause, Attentäter«, erklärte Lusiferus. »Dies ist mein Heim, meine Zuflucht, und du bist … einfach eingedrungen, hast es mit deinem Anschlag geschändet … entweiht. Oder hast es zumindest versucht.« Seine Stimme überschlug sich. »Ich habe dir mein Haus geöffnet, du hast an meinem Tisch gesessen, ich habe dich bewirtet … wie es die Gastgeber seit zehntausend Menschenjahren mit ihren Gästen tun, und du … du hattest nichts anderes im Sinn, als mir wehzutun, mich zu töten. In diesem meinem Heim, wo ich mich so sicher fühlen möchte wie nirgendwo sonst.« Der Archimandrit schüttelte bekümmert den Kopf, als könnte er so viel Undankbarkeit kaum fassen. Der Attentäter hatte nur einen schmutzigen Fetzen, um seine Blöße zu bedecken. Den zog ihm Lusiferus nun weg. Der Mann fuhr abermals zusammen. Lusiferus betrachtete den nackten Körper mit starrem Blick. »Man hat dich doch recht übel zugerichtet, wie?« Die Schenkel des Attentäters zuckten. Der Archimandrit ließ das Lendentuch zu Boden fallen; morgen konnte ein Diener es aufheben und wieder befestigen.
»Ich liebe mein Heim«, erklärte er leise. »Ich liebe es wirklich. Ich habe alles Nötige getan, um mehr Sicherheit zu schaffen, mehr Sicherheit für mein Heim, mehr Sicherheit für alle.« Er näherte den Rüsselegel den Genitalien des Mannes oder was davon noch übrig war, aber der Egel wirkte teilnahmslos, und der Mann war bereits erschöpft. Sogar der Archimandrit hatte den Spaß an diesem Spiel verloren. Er machte auf dem Absatz kehrt, marschierte auf die breite Brüstung des Beckens zu, warf den Egel in den Topf, der dort stand, und schälte sich den dicken Handschuh vom Arm.
»Und jetzt, Attentäter, muss ich mein Heim verlassen«, seufzte er dann und schaute in das Becken. Der Abstruse Spleißer hatte sich wieder zusammengerollt und lag ruhig auf dem Boden. Nun war er nicht mehr braun, sondern gelblich grün. Er hatte die Farben des Moosbelags angenommen. Von den Rüsselegeln waren nur ein paar dunkle Flecken und Streifen an den Wänden geblieben und ein schwacher würziger Geruch, den der Archimandrit inzwischen überall erkannt hätte. Das Blut einer weiteren fremden Spezies. Er wandte sich wieder dem Attentäter zu. »Ja, ich muss fort, für sehr lange Zeit. Offenbar bleibt mir keine andere Wahl.« Wieder ging er langsam auf den Mann zu. »Man kann nicht alles delegieren, und wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht, kann man letztlich niemandem vertrauen. Und manchmal, besonders wenn man sehr weit weg ist und die Nachrichtenübermittlung sehr lange dauert, muss man einfach selbst an Ort und Stelle sein. Was sagst du dazu? Wie? Eine schöne Bescherung, findest du nicht? Da mühe ich mich so viele Jahre lang ab, um mein Heim zu einer festen Burg auszubauen, und nun muss ich es verlassen, um es noch sicherer, noch mächtiger, noch stärker zu machen.« Er trat wieder an den Attentäter heran und berührte einen der gewölbten Stoßzähne, die sich durch dessen Schädel bohrten. »Und alles nur, weil Leute wie du mich hassen, weil sie nicht hören wollen, weil sie nicht tun, was man ihnen sagt und weil sie nicht wissen, was gut für sie ist.« Er packte den Zahn und zog daran. Der Mann winselte vor Schmerz durch die Nase.
»Das stimmt allerdings nicht ganz«, sagte Lusiferus achselzuckend und ließ den Zahn los. »Denn ob uns diese Reise wirklich mehr Sicherheit bringt, ist fraglich. Ich fliege in dieses … dieses Ulubis … System oder was immer es sein mag, weil es dort etwas geben könnte, das wertvoll ist, weil meine Ratgeber mir dazu raten und weil mein Geheimdienst diesbezügliche Informationen gesammelt hat. Natürlich ist sich niemand sicher, das ist immer so. Aber ich stelle fest, dass alle deshalb ungewöhnlich aufgeregt sind.« Der Archimandrit seufzte noch tiefer. »Und ich leichtgläubiger alter Narr werde den Empfehlungen folgen. Hältst du diese Entscheidung für richtig?« Er hielt inne, als wartete er auf eine Antwort. »Ja? Mir ist natürlich klar, dass du mir nicht unbedingt deine ehrliche Meinung sagen würdest, wenn du eine hättest, aber trotzdem … Nein? Ganz sicher?« Er fuhr mit dem Finger über eine Narbe, die sich an einer Seite über den Unterleib des Mannes zog, und überlegte kurz, ob die Verletzung wohl das Werk seiner eigenen Verhörspezialisten sein könnte. Sie kam ihm etwas zu tief vor, nicht fachmännisch genug. Der Attentäter atmete schnell und flach, ließ aber nicht erkennen, ob er überhaupt zuhörte. Hinter den zugenähten Lippen schien er mit den Zähnen zu knirschen.
»Ich bin mir nämlich selbst nicht ganz sicher und könnte einen Rat gut gebrauchen. Was wir vorhaben, muss ganz und gar nicht zu unserer Sicherheit beitragen. Aber es ist notwendig. Manche Dinge müssen einfach getan werden. Wie?« Er ohrfeigte den Mann, aber nicht zu fest. Trotzdem zuckte der Attentäter zusammen. »Keine Sorge. Ich kann dich mitnehmen. Große Invasionsflotte. Reichlich Platz.« Er sah sich um. »Ich finde, du hängst sowieso schon viel zu lange hier drin fest; höchste Zeit, dass du mal rauskommst.« Wieder lächelte der Archimandrit Lusiferus, obwohl es niemand sehen konnte. »Nachdem ich mir so viel Mühe mit dir gegeben habe, möchte ich dich doch auch sterben sehen. Ich glaube, ich nehme dich tatsächlich mit. Nach Ulubis, nach Nasqueron.«
Eines schönen Tages in der Zwischenjahreszeit Desuetude II bestellte Fassin Taaks Onkel seinen gelegentlich etwas schwierigen Neffen zu sich in den Saal des Vorläufigen Vergessens.
»Neffe.«
»Onkel? Du wolltest mich sprechen?«
»Hmm.«
Fassin Taak wartete höflich. Es war neuerdings nicht ungewöhnlich, dass Onkel Slovius selbst nach einem so einfachen und im Grunde redundanten Gespräch eine Weile schweigend und scheinbar in Gedanken versunken vor sich hinschaute, als hätten sie einander mit unerwartet tiefgründigen Worten viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Fassin war sich nie ganz schlüssig geworden, ob diese Angewohnheit ein Beweis dafür war, mit welchem Eifer sich sein Onkel seinen verwandtschaftlichen Pflichten widmete, oder lediglich bedeutete, dass der alte Knabe senil wurde. Wie auch immer, Onkel Slovius war (je nach Zeitrechnung) seit knapp drei oder mehr als vierzehn Jahrhunderten das Oberhaupt des Seher-Sept Bantrabal, und so war man sich allgemein einig, dass er in solchen Dingen Nachsicht verdiente.
Als guter Neffe, ergebenes Familienmitglied und gewissenhafter Vertreter seines Standes respektierte Fassin seinen Onkel nicht nur aus Prinzip, sondern auch aus Anhänglichkeit, wobei ihm durchaus bewusst war, dass nach den Konventionen seiner Familie und seiner Kaste die Stellung dieses Onkels samt dem damit verbundenen Ansehen eines Tages auf ihn übergehen würde, und er nicht ausschloss, dass seine Einstellung davon beeinflusst wurde. Die Pause wollte nicht enden. Fassin deutete eine Verbeugung an. »Onkel? Darf ich mich setzen?«
»Wie? Gewiss doch.« Onkel Slovius hob eine flossenförmige Hand zu einer vagen Geste. »Bitte.«
»Ich danke dir.«
Fassin Taak zog sich die Kniehosen hoch, nahm die weiten Hemdsärmel zusammen und ließ sich mit gesittet untergeschlagenen Beinen neben dem großen runden Becken nieder, wo sein Onkel in einer leuchtend blauen, leicht dampfenden Flüssigkeit schwamm. Onkel Slovius hatte vor einigen Jahren die Gestalt eines Walrosses angenommen. Ein vergleichsweise schlankes Walross mit rosig schimmernder bräunlicher Haut und Stoßzähnen, die kaum länger waren als der Mittelfinger einer Männerhand, aber dennoch ein Walross. Onkel Slovius hatte keine Hände mehr wie früher – stattdessen hingen diese Flossen an zwei Ärmchen, die seltsam dünn und nutzlos aussahen. Die Finger waren zu Stummeln verkümmert; nur noch eine Wellenlinie am Flossenrand. Gerade als Slovius zum Sprechen ansetzen wollte, trat ein Mensch in schwarzer Tracht an das Becken, kniete nieder, hielt seinen langen Pferdeschwanz mit einer vielfach beringten Hand hoch, damit er nicht nass wurde, und flüsterte dem Alten etwas ins Ohr. An der dunklen Kleidung, dem langen Haar und den Ringen war zu erkennen, dass es sich um einen der ranghöchsten Diener handelte. Fassin hätte wissen müssen, wie er hieß, aber der Name wollte ihm nicht einfallen.
Er sah sich um. Der Saal des Vorläufigen Vergessens war einer der selten benützten Räume des Hauses und trat – wenn man so sagen konnte – nur dann in Aktion, wenn sich ein ranghohes Familienmitglied dem Ende seines Lebens näherte. Das Becken nahm fast die gesamte Grundfläche des großen, nahezu halbkugelförmigen Raums ein. Die Wände waren aus Achat, so dünn, dass das Licht durchschien, und von altersgeschwärzten silbernen Adern durchzogen. Die Kuppel war Teil eines Rundtrakts des Herbsthauses. Der Familiensitz lag auf Kontinent Zwölf des felsigen Planetenmonds ’glantine, der die bunte Wolkenwirbelmasse des Gasriesen Nasqueron umkreiste wie ein Pfefferkorn einen Fußball. Durch die transparente Mittelpartie im Kuppeldach konnten Fassin und sein Onkel genau über sich ein winziges Stück der riesigen Planetenoberfläche sehen.
Dieser Teil von Nasqueron lag zurzeit im Tageslicht und präsentierte sich als chaotische Wolkenlandschaft in Purpurrot, Orange und Rostbraun. Durch die vielen Schatten gefiltert, fiel tiefrotes Licht durch ’glantines violette, dünne gerade noch atembare Atmosphäre und das verglaste Kuppeldach in den Saal und auf das Becken, wo der schwarz gekleidete Diener Onkel Slovius stützte und ihm einen Becher an die Lippen hielt, der ein Erfrischungsgetränk oder eine Medizin enthalten mochte. Ein paar Tropfen der klaren Flüssigkeit rannen dem Alten über das graustoppelige Kinn in die Halsfalten, landeten in dem blauen Wasser und erzeugten bei halber Standardschwerkraft hohe Wellen. Onkel Slovius hatte die Augen geschlossen und grunzte leise vor sich hin.
Fassin sah sich um. Ein zweiter Diener trat mit einem Tablett mit Getränken und Konfekt auf ihn zu, aber er wehrte lächelnd mit erhobener Hand ab. Der Diener verneigte sich und zog sich zurück. Fassin hob anstandshalber den Blick zum Kuppeldach mit der Aussicht auf den Gasriesen, beobachtete aber aus dem Augenwinkel, wie der erste Diener dem alten Mann mit einem ordentlich gefalteten Tuch den Mund abtupfte.
Majestätisch und trotz aller Turbulenzen von unerschütterlicher Gelassenheit drehte sich Nasqueron wie eine riesige glühende Kohle fast unmerklich um sich selbst.
Der Gasriese war der größte Planet im Ulubis-System, das, fünfundfünfzigtausend Jahre vom nominellen Zentrum der Galaxis entfernt, in einem äußeren, zu den Südlichen Riffranken gehörigen Strang des Quaternärstroms lag. Abgeschiedener konnte ein System, das noch zur großen Linse gehören wollte, kaum sein.
Es gab, besonders jetzt nach dem Krieg, verschiedene Grade von Abgeschiedenheit, doch Ulubis lag nach jeder Definition fernab von der Welt. Ein System am äußersten Rand der Galaxis – so weit unterhalb der galaktischen Ebene, dass sich die letzten Spuren von Sternen und Gasen bereits in die Weiten des Alls verflüchtigten – war aber nicht zwangsläufig unerreichbar, vorausgesetzt es lag in der Nähe eines Arteria-Portals.
Arteria – Wurmlöcher – und ihre Aus-und Eingänge, die Portale, waren für die galaktische Gemeinschaft unersetzlich; sie ermöglichten es, fast ohne Zeitverlust von einem Sonnensystem zum anderen zu gelangen, anstatt mit weniger als Lichtgeschwindigkeit durch das Weltall kriechen zu müssen. Ähnlich rasant und dramatisch war ihre Wirkung auf den Status, die Wirtschaft und sogar die Moral eines Systems. Ohne Portal hockte man wie auf einem kleinen Dorf oder in einem öden, grauen Tal fest und kam womöglich sein Lebtag lang nicht weg. Doch kaum wurde ein Wurmloch-Portal installiert, befand man sich wie in einer riesigen, aufregenden Glitzerstadt voller Leben und mit unbegrenzten Möglichkeiten.
Es gab nur eine Möglichkeit, ein Arteria-Portal von einem Ort zu anderen zu bringen: man musste es auf ein Raumschiff verladen und mit Unterlichtgeschwindigkeit an sein Ziel befördern. Das andere Ende blieb – im Allgemeinen – am Ausgangspunkt verankert. Wenn also das Wurmloch zerstört wurde – und Wurmlöcher konnten theoretisch überall, praktisch aber nur an den Enden, den Portalen, zerstört werden – dann war mit einem Schlag alles vorbei und man saß wieder in seinem kleinen Dorf am Ende der Welt.
Ulubis hatte vor mehr als drei Milliarden Jahren im damals ›Neuen Zeitalter‹ erstmalig einen solchen Anschluss an die übrige Galaxis bekommen. In jenen Tagen war es ein vergleichsweise junges System gewesen, erst wenige Milliarden Jahre alt, aber bereits mit einer großen Artenvielfalt bevölkert. Die Arteria-Verbindung war im Zuge des Zweiten Komplexes errichtet worden, eines Projekts, mit dem die galaktische Gemeinschaft zum zweiten Mal ernsthaft versucht hatte, ein integratives Wurmlochnetzwerk zu schaffen. In den eine Milliarde Jahre andauernden Wirren des Langen Zerfalls, des Kriegs der Stürme, der Streuungsanarchie und des Zusammenbruchs der Informorta hatte Ulubis diesen Anschluss wieder verloren und – mit nahezu der gesamten zivilisierten Galaxis – das erdrückende Zweite oder Große Chaos wie im Koma verschlafen. Nur die Dweller-Bevölkerung auf Nasqueron hatte diese Epoche überlebt. Die Dweller wurden zu jener Metaspezies gerechnet, die man ›die Langsamen‹ nannte. Sie lebten nach einer anderen Zeitskala und hielten es nicht weiter für tragisch, wenn sie ein paar hunderttausend Jahre brauchten, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Selbst wenn eine Milliarde Jahre lang nicht viel passierte, empfanden sie das nach eigener Aussage nur wie einen ausgedehnten Urlaub.
Im Anschluss an die Dritte Diaspora-Epoche (und manches andere – die galaktische Geschichte verlief auf keiner Zeitskala wirklich linear) kam Ulubis durch ein neues Wurmloch wieder ans Netz und wurde in den Dritten Komplex integriert. Diese Arteria überdauerte siebzig Millionen Jahre, eine produktive, friedliche Epoche, in der mehrere ›schnelle‹, aber nicht auf Ulubis entstandene Spezies kamen und wieder verschwanden. Nur die Dweller verfolgten als immerwährende Zeugen den gemächlichen Gang des Lebens und der Geschichte. Dann wurde Ulubis durch den Großen Arteria-Zusammenbruch zusammen mit fünfundneunzig Prozent der vernetzten Galaxis abermals in die Einsamkeit gestürzt. Im Krieg der ›Neuen Schnellen‹ und im Maschinenkrieg wurden weitere Portale und Wurmlöcher vernichtet, und erst die Gründung der Merkatoria brachte – zumindest nach Ansicht ihrer Führer, einen dauerhaften Frieden und leitete den Vierten Komplex ein.
Ulubis war im Verlauf dieses noch im Anfangsstadium befindlichen Prozesses schon frühzeitig wieder angeschlossen worden, und dank dieser jüngsten Arteria war das System sechstausend Jahre lang ein leicht erreichbarer Teil der allmählich wiederauflebenden galaktischen Gemeinschaft gewesen. Doch auch dieses Wurmloch war zerstört worden, und seit mehr als einem Vierteljahrtausend befand sich der nächstgelegene funktionsfähige Zugang für Ulubis auf Zenerre, volle zweihundertvierzehn Jahre weiter innen im zunehmend dicker werdenden Strom. Das sollte sich nun in etwa siebzehn Jahren ändern. Dann nämlich würde ein Wurmloch-Endpunkt eintreffen, der zurzeit mit relativistischer Geschwindigkeit auf dem Technikschiff Esttaun Zhiffir zum Ulubis-System unterwegs war. Wahrscheinlich würde man ihn an der gleichen Stelle installieren wie das alte Portal, an einem der Lagrange-Punkte in der Nähe von Sepekte, dem Hauptplaneten des Ulubis-Systems. Im Augenblick stand Ulubis jedoch trotz seiner Bedeutung als Zentrum der Dweller-Forschung zeitlich und physisch im Abseits.
Onkel Slovius entließ den Diener mit einer Flossenbewegung und zog sich an dem y-förmigen Trägergerüst, das ihn mit Kopf und Schultern über der glänzend blauen Oberfläche hielt, nach oben. Der Diener – Fassin hatte ihn inzwischen erkannt, es war Guime, der zweithöchste Bedienstete seines Onkels – kam zurück und wollte dem Alten behilflich sein. Doch Slovius zischte und schnalzte gereizt und wollte mit einer Flossenhand nach dem Mann schlagen. Doch die Bewegung war zu langsam und kraftlos. Guime wich mühelos aus, verneigte sich, zog sich an die Wand zurück und blieb dort stehen. Slovius hievte seinen Oberkörper noch etwas weiter aus dem Becken. Rumpf und Schwanz schwebten träge unter den leuchtend blauen Wellen.
Fassin wollte sich aus seinem Schneidersitz erheben. »Onkel, soll ich dir …?«
»Nein!«, rief Slovius frustriert, obwohl es ihm nicht gelingen wollte, sich weiter nach oben zu schieben. »Warum will mich alle Welt nur ständig bemuttern!« Bei diesen Worten drehte er den Kopf zur Seite, um Guime anzusehen, doch dabei rutschte er noch weiter ab und lag schließlich mehr in der Horizontalen als zuvor. Er patschte mit der Flosse auf die Oberfläche. »Da! Siehst du, was du angerichtet hast, du Idiot? Immer musst du dich wichtig machen!« Er seufzte tief auf, legte sich sichtlich erschöpft in die wogenden Wellen zurück und starrte vor sich hin. »Wenn du willst, kannst du mich umbetten, Guime«, sagte er matt. Es klang resigniert.
Guime kniete sich hinter seinen Herrn auf die Fliesen, packte ihn mit beiden Händen unter den Achseln und zog ihn so weit auf das Gerüst hinauf, dass Kopf und Schultern nahezu senkrecht waren. Slovius setzte sich zurecht, dann nickte er gebieterisch. Guime nahm seinen Platz an der Wand wieder ein.
»Nun zu dir, Neffe.« Slovius faltete die Flossen über der breiten, haarlosen Brust und richtete den Blick zur Kuppel empor.
Fassin lächelte. »Ja, Onkel?«
Slovius zögerte. Sein Blick wanderte zu seinem Neffen. »Wie steht es mit deinen … deinen Studien, Fassin? Wie kommst du voran?«
»Ich bin zufrieden. Für die Tranche Xonju ist es natürlich noch sehr früh.«
»Hmm. Früh.« Wieder blickte Onkel Slovius mit nachdenklicher Miene ins Leere. Fassin seufzte insgeheim. Die Unterredung würde wohl noch eine Weile dauern.
Fassin Taak war ›Langsamen‹-Seher am Hof der Dweller von Nasqueron. Die Dweller – genauer gesagt, die Gasriesen-Dweller … der Auftriebsneutrale Flächendeckende Gasriesen-Dweller-Stamm Erster Ordnung im Klimaxstadium, um die Präzision auf eine geradezu schmerzhafte Spitze zu treiben – waren große Lebewesen von unermesslichem Alter, Angehörige einer verwirrend komplexen und topologisch riesigen uralten Zivilisation. Ihr Lebensraum, die Wolkenschichten um den gewaltigen Gasriesenplaneten, war von seinen Ausmaßen her gigantisch und zudem in seiner Aerographie ständigen Veränderungen unterworfen.
Dweller, zumindest ausgewachsene Dweller dachten sehr langsam. Sie lebten langsam, entwickelten sich langsam, reisten langsam und übten auch fast alle anderen Tätigkeiten langsam aus. Man unterstellte ihnen, sie könnten ziemlich schnell kämpfen, das war jedoch schwer nachzuweisen, denn sie hatten es schon lange nicht mehr nötig gehabt, irgendwelche Kriege zu führen. Daraus folgte, dass sie auch schnell denken konnten, wenn es ihnen beliebte, aber meistens war das offenbar nicht der Fall, und so ging man davon aus, dass sie auch hier langsam waren. Unbestritten war, dass sie sich in späteren Jahren – oder Äonen – für ihre Gespräche sehr viel Zeit nahmen. So viel, dass manche einfache Frage vor dem Frühstück gestellt und erst nach dem Abendessen beantwortet wurde. Und Fassin hatte den Eindruck, als sei Onkel Slovius – der mit einem entrückten Ausdruck auf seinem verquollenen Gesicht mit den Stoßzähnen in den inzwischen unbewegten Fluten trieb – fest entschlossen, diese Form der Unterhaltung zu übernehmen.
»Bei der Tranche Xonju geht es um …?«, fragte Slovius plötzlich.
»Literarische Fragmente, Diaspora-Mythen und verschiedene historische Verwicklungen«, antwortete Fassin.
»Aus welchen Epochen?«
»Die meisten Texte müssen erst noch datiert werden, Onkel. Bei einigen wird das womöglich nie gelingen, man muss sie eventuell zu den Mythen rechnen. Die einzigen Stränge, die sich leicht zuordnen lassen, sind neueren Datums und beziehen sich hauptsächlich auf regional begrenzte Ereignisse während des Maschinenkriegs.«
Onkel Slovius nickte langsam und löste damit neue Wellen aus. »Der Maschinenkrieg. Das ist interessant.«
»Ich hatte die Absicht, mir diese Stränge als Erste vorzunehmen.«
»Ja«, sagte Slovius. »Das ist eine gute Idee.«
»Danke, Onkel.«
Slovius war wieder verstummt. In der Ferne grollte ein Erdbeben, und in der Flüssigkeit im Becken bildeten sich kleine konzentrische Kreise.
Die Zivilisation der Dweller von Nasqueron mit der dazugehörigen Flora und Fauna war nur ein mikroskopisch kleiner Teil der Dweller-Diaspora, einer galaxisweiten Meta-Zivilisation (manchmal war auch von Post-Zivilisation die Rede), die, soweit sich das feststellen ließ, allen anderen Reichen, Kulturen, Diasporen, Zivilisationen, Förderationen, Sozietäten, Zusammenschlüssen, Bündnissen, Ligen, Genossenschaften, Affiliationen und Organisationen von mehr oder weniger ähnlichen Wesen übergeordnet war.
Mit anderen Worten, Dweller gab es schon fast so lange wie das Leben in der Galaxis. Damit war diese Spezies zumindest ungewöhnlich, wenn nicht sogar einmalig. Und sie stellte, vorausgesetzt, man näherte sich ihr mit der gebührenden Ehrerbietung und Vorsicht, behandelte sie mit Respekt und brachte auch die nötige Geduld auf, auch eine wertvolle Ressource dar. Denn die Dweller hatten ein gutes Gedächtnis und noch bessere Bibliotheken. Zumindest vergaßen sie nichts, und ihre Bibliotheken waren sehr groß.
Tatsächlich waren die Dweller-Gedächtnisse wie die Dweller-Bibliotheken gewöhnlich voll gepackt mit blankem Unsinn. Bizarre Mythen, unverständliche Bilder, nicht zu entschlüsselnde Symbole und sinnlose Gleichungen sowie willkürlich aneinander gereihte Zahlengruppen, Briefe, Piktogramme, Holophone, Sonomeme, Chemiglyphen, Aktinome und vieles andere mehr war aus Millionen und Abermillionen von Zivilisationen ohne jede Gemeinsamkeit, von denen die meisten längst untergegangen und entweder zu Staub zerfallen oder als Strahlung ins All entwichen waren, zusammengetragen und ohne jede Ordnung – oder nach einem abstrusen und völlig unverständlichen System – in einen Topf geworfen worden.
Trotzdem fanden sich in diesem Durcheinander aus Propaganda, verzerrten Fakten, albernem Gefasel und verrückten Ideen immer wieder einzelne Wahrheitskörnchen und Tatsachenflöze, erstarrte Ströme längst vergessener Geschichte, ganze Bände von Exobiographien und so manche miteinander verwobene Erkenntnisstränge. Menschen wie der Oberste Seher Slovius und der Seher-im-Wartestand Fassin Taak hatten es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Kontakt zu den Dwellern zu suchen, mit ihnen zu reden und sich auf ihre Sprache, ihre Denkweise und ihren Metabolismus einzustellen. Die Seher schwebten – manchmal nur virtuell aus großer Entfernung, manchmal auch ganz konkret – mit den Dwellern durch Nasquerons Wolken, stießen in die Tiefen des Gasriesen hinab und stiegen wieder empor. Dabei suchten sie in Gesprächen, durch Studien und mit Hilfe von Notizen und Analysen möglichst viel von dem Material zu verstehen, das ihnen ihre uralten, ›langsamen‹ Gastgeber mündlich oder auf andere Weise zugänglich machten. So hofften sie, zur Bereicherung und zur Aufklärung der größeren Meta-Zivilisation der ›Schnellen‹ beizutragen, die derzeit die Galaxis bewohnte.
»Und, äh, Jaal?« Slovius sah seinen Neffen an. Der wirkte so verdutzt, dass der Ältere eine Erklärung für angebracht hielt. »Diese, ach, wie war doch gleich der Name … Tonderon. Ja. Die kleine Tonderon. Du bist doch noch mit ihr verlobt?«
Fassin lächelte. »Natürlich, Onkel«, sagte er. »Sie kommt heute Abend aus Pirrintipiti zurück. Ich hoffe, sie am Hafen abholen zu können.«
»Und du bist …?« – Slovius wedelte mit einer Flossenhand – »immer noch mit ihr zufrieden?«
»Zufrieden, Onkel?«, fragte Fassin.
»Bist du glücklich? Freust du dich darauf, dass sie deine Frau werden soll?«
»Natürlich, Onkel.«
»Und wie denkt sie über dich?«
»Hoffentlich ebenso. Ich glaube schon.«
Slovius sah seinen Neffen eindringlich an. »Hm. Verstehe. Natürlich. Nun ja.« Er schaufelte sich mit einer Flosse etwas von der leuchtend blauen Flüssigkeit über die Brust, als fröre er. »Wann soll die Hochzeit sein?«
»Der Termin ist auf Allerheiligen, Jocundus III festgesetzt«, sagte Fassin. »In knapp einem halbem Jahr Eigenzeit«, fügte er zur Erläuterung hinzu.
»Verstehe.« Slovius runzelte die Stirn und nickte langsam. Das leichte Heben und Senken seines Körpers erzeugte neue Wellen. »Gut zu wissen, dass du vielleicht doch noch in geordnete Verhältnisse kommst.«
Fassin war Seher mit Leib und Seele, er hielt sich für fleißig und tüchtig und verbrachte nach eigener Einschätzung überdurchschnittlich viel Zeit auf ›harten‹ Trips, also in direktem Kontakt mit den Dwellern von Nasqueron. Doch da er glaubte, sich nach jeder dieser anstrengenden Arbeitsphasen einen ›richtigen Urlaub‹ verdient zu haben, wie er es nannte, hielten ihn die ältere Generation des Sept Bantrabal und besonders Slovius offenbar für einen unverbesserlichen Taugenichts. (Onkel Slovius war nicht einmal bereit, von einem ›richtigen Urlaub‹ zu sprechen. Für ihn handelte es sich dabei um »monatelange hemmungslose Besäufnisse und Drogenexzesse, bei denen sein Neffe keiner Prügelei aus dem Weg ging und jede Körperöffnung erkundete, die sich ihm an den Fleischtöpfen von …« nun, wo auch immer boten, in Pirrintipiti vielleicht, der Hauptstadt von ’glantine, in Borquille, der Hauptstadt von Sepekte oder einer von Sepektes anderen Städten, manchmal auch in einem der vielen Vergnügungshabitate, die über das ganze System verstreut waren.)
Fassin lächelte nachsichtig. »Trotzdem werde ich die Tanzschuhe noch nicht an den Nagel hängen, Onkel.«
»Was ist mit deinen Forschungen im Lauf der letzten, drei oder vier Trips, fassin? Könnte man sagen, sie wären in eine bestimmte Richtung gegangen?«
»Du verwirrst mich, Onkel«, gestand Fassin.
»Stehen deine letzten drei oder vier Trips thematisch, vom Gegenstand her oder durch die Dweller, mit denen du gesprochen hast, in irgendeinem Zusammenhang?«
Fassin lehnte sich überrascht zurück. Warum in aller Welt mochte sich der alte Slovius plötzlich dafür interessieren? »Lass mich nachdenken«, sagte er. »Beim letzten Mal sprach ich fast ausschließlich mit Xonju, der aufs Geratewohl mit Informationen um sich warf und offenbar nicht ganz begriffen hatte, was man unter einer Antwort versteht. Es war unser erstes Treffen, und alles blieb im Vorläufigen. Falls es uns gelingt, ihn wiederzufinden, könnte es sich lohnen, mit ihm weiterzumachen. Vielleicht aber auch nicht. Möglicherweise brauche ich die Monate bis zum nächsten Trip, um zu einer Entscheidung …
»Diese Expedition war also nur ein Versuch, eine erste Kontaktaufnahme.«
»So ist es.«
»Und davor?«
»Ein ausgedehntes Treffen mit Cheuhoras, Saraisme dem Jüngeren, den Zweizwillingen Akeurle, dem Traav Kanchangesja und zwei Adoleszenten aus der Horde von Eglide.«
»Die Themen?«
»Hauptsächlich ging es um die Dichtkunst. Altertum und Moderne, die Bildlichkeit in der Epik, das Ethos der Prahlerei und der Übertreibung.«
»Und der Trip davor?«
»Allein mit Cheuhoras; eine endlose Klage um seine verstorbenen Eltern, ein paar heimische Jagdmythen aus der jüngeren Vergangenheit und eine langatmige Übersetzung und Übertragung eines epischen Texts über die Abenteuer vorzeitlicher Plasmawesen im Verlauf der Wasserstoffwanderung vor etwa einer Milliarde Jahre während des Zweiten Chaos.«
»Und davor?«
Fassin lächelte. »Mein langes Gespräch unter vier Augen mit Valseir. Es war der Trip, bei dem ich die Tollkühnen Schelme vom Stamm Dimajrian besuchte.« Wahrscheinlich konnte er es sich sparen, seinen Onkel an die Einzelheiten gerade dieser Exkursion zu erinnern. Es war eine sehr ausgedehnte Reise gewesen, auf der er sich seinen Ruf als begabter Seher erworben hatte. Nach Eigenzeit hatte sie sechs Jahre gedauert; für einen außenstehenden Beobachter fast ein Jahrhundert, und sie hatte seine Stellung innerhalb des Sept Bantrabal, aber auch in der Hierarchie der ’glantine-Seher außerhalb davon begründet. Seine Abenteuer und der Wert des literarischen und historischen Materials, das er mitbrachte, hatten nicht nur den Ausschlag für seine Beförderung zum Obersten Seher-im-Wartestand in seinem eigenen Sept gegeben, sondern auch den Sept Tonderon, den angesehensten der zwölf Septe, bewogen, ihm die Ehe mit der Tochter seines Obersten Sehers anzubieten.
»Wie viele Jahre gehen wir damit in Realzeit zurück?«
Fassin überlegte. »Etwa dreihundert … Zweihundertsiebenundachtzig, wenn ich richtig gerechnet habe.«
Slovius nickte. »Wurde im Laufe dieses Trips viel veröffentlicht?«
»So gut wie gar nichts. Die Tollkühnen Schelme hatten sich das verbeten. Sie gehören zu den … flegelhafteren Adoleszentenhorden. Ich durfte nur einmal im Jahr ein Lebenszeichen schicken.«
»Und der Trip davor?«
Fassin seufzte und klopfte mit den Fingern gegen die Glasabdeckung am Beckenrand. Bei der alten Erde, was hatte das zu bedeuten? Warum beschaffte sich Slovius solche Informationen nicht einfach aus den Archiven des Sept? An einer Wand des Saals befand sich ein großer frei tragender Arm mit einem Computerterminal, das sich, wie Fassin selbst schon gesehen hatte, auf Slovius’ Höhe bringen ließ, so dass der Alte auf den Schirm schauen und mit seinen Stummelfingern die Tasten betätigen konnte.
Natürlich wäre das weder die schnellste, noch die effektivste Methode für eine Anfrage an die Hausbibliothek, aber sie hätte alle Fragen beantwortet. Der alte Knabe könnte sich auch bei jemand anderem erkundigen. Wofür hatte man die Diener?
Fassin räusperte sich. »Auf diesem Trip war ich die meiste Zeit damit beschäftigt, Paggs Yurnvic vom Sept Reheo einzuweisen, der zum ersten Mal dabei war. Wir machten Traav Hambrier unsere Aufwartung, in Dweller-Zeit, mit Rücksicht auf Yurnvics Mangel an Erfahrung. Nach Eigenzeit dauerte der Trip nur knapp drei Monate. Eine Einführung wie aus dem Bilderbuch.«
»Und du hast keine Zeit gefunden, deinen eigenen Forschungen nachzugehen?«
»Kaum.«
»Aber ein wenig doch?«
»Ich konnte einen Teil eines Symposiums der Universitätshorde Marcal über die Tiefen der Poetik verfolgen. Wenn du Genaueres über die anderen Teilnehmer wissen willst, müsste ich im Sept-Archiv nachsehen.«
»Was gibt es sonst zu sagen? Über das Symposium, meine ich. Wie lautete das Thema?«
»Wenn ich mich recht erinnere, sollten die Jagdmethoden der Dweller mit den Verfahren der Inquisitionsbehörden im Maschinenkrieg verglichen werden.« Fassin strich sich über das Kinn. »Die Beispiele stammten aus dem Ulubis-System, einige sogar von ’glantine.«
Slovius nickte und sah seinen Neffen an. »Weißt du, was man unter einer Abgesandten-Projektion versteht, Fassin?«
Fassin blickte hinauf zu dem Teil des Gasriesen, der durch den transparenten Bereich des Dachs zu sehen war. Auf einer Seite kam soeben der Terminator in Sicht, der vordere Rand eines schwarzen Schattens, der über die ferne Wolkenlandschaft kroch. Er wandte er sich wieder seinem Onkel zu. »Kann sein, dass ich den Ausdruck schon einmal gehört habe. Aber ich würde nicht wagen, ihn zu definieren.«
»Man schickt per Laserstrahl ein Paket mit Fragen und den entsprechenden Antworten an einen räumlich entfernten Ort. Dieses Paket spielt die Rolle eines Abgesandten.«
»Wer ist ›man‹?«
»Die Techniker. Die Administrata. Vielleicht auch die Omnokratie.«
Fassin richtete sich auf. »Tatsächlich?«
»Tatsächlich. Wenn man den Begleitinformationen glauben darf, handelt es sich bei dem Objekt um so etwas wie eine Bibliothek, die mit einem Signallaser übertragen wird. Wenn diese … Entität an fortgeschrittene Apparaturen mit hinreichender Kapazität angeschlossen und aktiviert wird, vermag sie, obwohl sie im Grunde nur aus einer vielfach verzweigten Matrix von Aussagen, Fragen und Antworten und einem Regelwerk besteht, das festlegt, in welcher Reihenfolge diese Elemente zum Einsatz kommen, eine Unterhaltung zu führen, die in vieler Hinsicht als intelligent bezeichnet werden kann. Damit kommt sie einer Künstlichen Intelligenz so nahe, wie das in Nachkriegszeiten gestattet ist.«
»Unglaublich.«
Slovius schaukelte in seinem Becken hin und her. »Jedenfalls unglaublich selten«, nickte er. »Ein solcher Abgesandter ist auf dem Weg hierher.«
Fassin blinzelte. »Hierher?«
»Zum Sept Bantrabal. Zu diesem Haus. Zu uns.«
»Zu uns?«
»Er wurde von der Administrata geschickt.«
»Von der Administrata.« Fassin merkte selbst, dass er sich ziemlich einfältig anhörte.
»Mit dem Technikschiff Est-taun Zhiffir.«
»Du meine Güte«, sagte Fassin. »Welche … Ehre für uns.«
»Nicht für uns, Fassin; für dich. Die Projektion hat den Auftrag, mit dir zu sprechen.«
Fassin lächelte unsicher. »Mit mir? Aha. Und wann …?«
»Die Übertragung läuft bereits. Sie müsste bis zum späten Abend abgeschlossen sein. Vielleicht solltest du dafür alle Verabredungen absagen. Hattest du viel vor?«
»Äh … ein Abendessen mit Jaal. Aber …«
»Ich würde an deiner Stelle das Abendessen zeitlich vorziehen. Und mich nicht zu lange dabei aufhalten.«
»Hm, ja. Natürlich«, sagte Fassin. »Kannst du dir vorstellen, womit ich das verdient haben könnte?«
Slovius schwieg einen Moment lang, dann sagte er: »Ich habe nicht die leiseste Ahnung.«
Guime hängte das Interkomgerät an seinen Haken zurück, verließ seinen Posten, kniete neben Slovius nieder und flüsterte ihm etwas zu. Slovius nickte und wandte sich an Fassin. »Haushofmeister Verpych möchte dich sprechen, Neffe.«
»Verpych?« Fassin schluckte. Der Haushofmeister, der ranghöchste Diener des Sept Bantrabal, sollte eigentlich im Tiefschlaf bleiben, bis der ganze Sept in achtzig Tagen in sein Winterquartier übersiedelte. Dass man ihn vorzeitig störte, war unerhört. »Ich denke, er schläft!«
»Nun, man hat ihn geweckt.«
Das Schiff war seit Jahrtausenden tot. Wie lange tatsächlich, wusste niemand genau, aber die plausibelsten Schätzungen beliefen sich auf sechs bis siebentausend Jahre. Es war nur eines von all den untergegangenen Schiffen, die mit einer der großen Flotten am Krieg der ›Neuen Schnellen‹ (oder wenig später am Maschinenkrieg, vielleicht auch an den darauf folgenden Streuungskriegen oder an einem der kurzen, erbitterten, unkoordinierten und blutigen Scharmützel im Verlauf der Aussaat) teilgenommen hatten. Eine von vielen ausrangierten und vergessenen Figuren im großen Spiel um die Macht in der Galaxis und die Vorherrschaft unter den Zivilisationen, in dem speziesübergreifend intrigiert wurde und jedes Mittel erlaubt war.
Der Koloss hatte mindestens tausend Jahre lang unentdeckt auf ’glantine gelegen, denn ’glantine war zwar für menschliche Begriffe ein kleiner Planet – noch etwas kleiner als der Mars – aber nach den gleichen Maßstäben nur dünn besiedelt. Knapp eine Milliarde Einwohner konzentrierten sich zumeist auf die Tropen, in die leeren Weiten des Nördlichen Ödlands, wo das Wrack niedergegangen war, wagte sich nur selten ein Besucher. Auch dass es lange gedauert hatte, bis man wieder Überwachungssysteme besaß, die auch nur annähernd so komplex und hoch entwickelt waren wie vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten, hatte die Entdeckung des Wracks nicht gerade beschleunigt. Und schließlich hatten trotz der gewaltigen Größe des Schiffes ein Teil seiner automatischen Tarnsysteme den Aufschlag auf die Oberfläche des Planetenmonds, die partielle Zerstörung und den Tod aller Sterblichen an Bord überlebt. Dadurch hatte der Rumpf die ganze Zeit wie einer der vielen kahlen Felsen ausgesehen, die aus dem tiefen Einschlagskrater geschleudert worden waren, als gleich zu Beginn des Konflikts der ›Neuen Schnellen‹ ein kleineres, aber sehr viel schnelleres Schiff zehn Kilometer entfernt auf den Planeten gestürzt und verdampft war.
Die Trümmer waren nur gefunden worden, weil ein Flieger an einer der großen gewölbten (aber zu diesem Zeitpunkt perfekt als einladend leerer, klarer Himmel getarnten) Rumpfrippen zerschellt war. Erst nach diesem Unglück hatte man das Wrack untersucht und die wenigen Systeme ausgebaut, die noch funktionierten (aber unter dem neuen Regime nicht verboten waren. Dank dieser Einschränkungen war die Ausbeute gering). Schließlich – das Anheben des Rumpfes und der großen Unterkonstruktionen kam aus Kostengründen nicht in Frage, das Zerschneiden und Wegkarren der Teile war schwierig, ebenfalls nicht billig und potenziell gefährlich, und eine völlige Zerstörung wäre nur mit schweren Waffen im Gigatonnenbereich möglich gewesen, gegen deren Einsatz in der Atmosphäre eines kleinen Planetenmondes, selbst in menschenleerem Gebiet die Bevölkerung in Friedenszeiten heftig zu protestieren pflegte – hatte man die Absturzstelle weiträumig abgesperrt und ließ sie zur Sicherheit auf unbestimmte Zeit von einem Schwarm Flugdrohnen bewachen.
»Nein, das könnte gut, das könnte positiv sein«, erklärte Saluus Kehar und steuerte die kleine Maschine im Tiefflug über die Wüste auf das zerklüftete Gelände zu, wo sich die abgenagten Rippen des großen Schiffes wie Schattenfalten vor dem violetten, allmählich dunkler werdenden Himmel abzeichneten. Hinter dem Wrack erschien ein riesiger, blaugrüner Flimmerteppich, wogte lautlos über den Himmel und erlosch wieder.
»Scheiße, das kannst auch nur du sagen«, bemerkte Taince, die an den Knöpfen des Funkgeräts drehte. Aus den Lautsprechern rauschte es wie Brandungswellen.
»Müssen wir so dicht über dem Boden fliegen?«, fragte Ilen, die ihre Stirn gegen das Kanzeldach drückte und nach unten starrte. Sie streifte den jungen Mann, der mit ihr den Rücksitz des kleinen Flugzeugs teilte, mit einem Blick. »Ehrlich, Fass, ist das ratsam?«
Fass ließ sich nicht stören. »Sal kann immer noch nicht fassen, dass sein gnadenloser Optimismus auch Unwillen hervorrufen kann. Wie bitte, Len? Was sagtest du?«
»Ich dachte nur …«
»Richtig«, murmelte Taince. »Schalt den gottverdammten Pinger ein.«