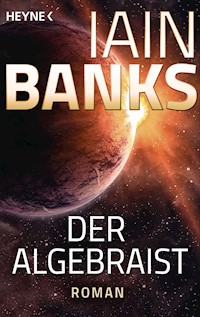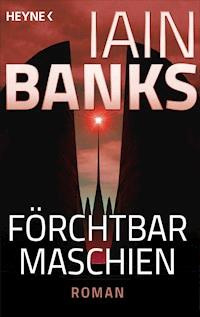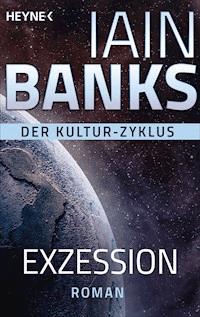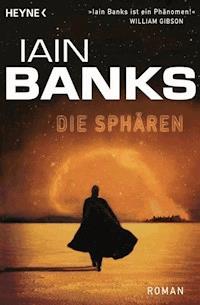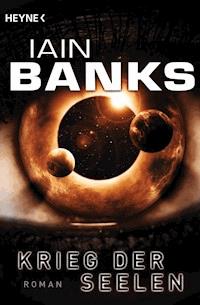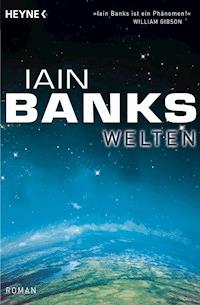
8,99 €
8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gibt es eine Welt jenseits der Welt?
Adrian Cubbish hat offenbar gerade eine Glückssträhne: Er steigt vom gerissenen Drogendealer zu einem der mächtigsten Finanzmanager der Welt auf. Doch als sich ihm seine Mittelsmänner offenbaren, kann er es kaum glauben. Denn es gibt neben unserer Realität noch eine Vielzahl weiterer Welten, die von einem mächtigen Konsortium überwacht werden. Ehe sich Adrian versieht, ist er in ein weitreichendes Komplott zwischen diesen Welten verstrickt – und nicht nur sein Leben, sondern unsere gesamte Realität steht auf dem Spiel ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2010
3,8 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Danksagung
PROLOG
EINS
PATIENT 8262
DER WELTENWECHSLER
ADRIAN
MADAME D’ORTOLAN
Copyright
Das Buch
Adrian Cubbish, der vom kleinkriminellen Drogendealer zu einem der mächtigsten Finanzmanager der Welt aufgestiegen ist, wird eines Tages mit einer unglaublichen und schockierenden Tatsache konfrontiert: unsere Welt ist nur eine von vielen parallel existierenden Realitäten, die von einem mächtigen Konsortium, genannt der »Konzern«, überwacht werden. Die Aufgabe des Konzerns ist es, präventiv in die verschiedenen Welten einzugreifen, um der Zukunft einer jeden Realität den bestmöglichen Verlauf zu garantieren. Doch die Mächtigen des Konsortiums selbst verfolgen finstere Pläne, und als ihr Machtmissbrauch bekannt wird, kommt es innerhalb der Organisation zu einer offenen Rebellion. Ehe Adrian es sich versieht, ist er in ein weitreichendes, alle Welten umspannendes Komplott verstrickt, das nicht nur sein Leben, sondern die Existenz des gesamten Universums bedroht …
Monatelang auf den britischen Bestsellerlisten - der neue atemberaubende Roman von Kultautor Iain Banks.
Der Autor
Iain Banks wurde 1954 in Schottland geboren. Nach einem Englischstudium schlug er sich mit etlichen Gelegenheitsjobs herum, bis ihn sein 1984 veröffentlichter Roman »Die Wespenfabrik« als neue aufregende literarische Stimme bekannt machte. In den folgenden Jahren schrieb er zahllose weitere Romane, darunter »Bedenke Phlebas«, »Der Algebraist« und »Die Sphären«. Banks gilt heute als einer der bedeutendsten Vertreter der britischen Gegenwartsliteratur.
Für Alastair und Emily und zum Andenken an Bec
Dank an Adèle, Mic, Richard, Les, Gary und Zoe
… nach einer falschen Geschichte
PROLOG
Anscheinend bin ich das, was man einen unzuverlässigen Erzähler nennt, aber wer alles für bare Münze nimmt, was ihm vorgeschwatzt wird, hat es sowieso nicht anders verdient. Es ist wirklich erstaunlich, das kannst du mir glauben, und vollkommen beispiellos, dass du diese Worte überhaupt liest. Hast du schon mal einen Seismografen gesehen? Du weißt schon, so ein furchtbar zartes und empfindliches Gerät mit einem spinnenhaft langen Stift, der eine Linie auf eine bewegliche Papierrolle kritzelt, um Erderschütterungen aufzuzeichnen.
Stell dir so einen Apparat vor, der gerade eine ruhige Kugel schiebt und nichts Besonderes dokumentiert, der einfach mit einer gleichmäßigen schwarzen Linie nur Stille und Reglosigkeit zu deinen Füßen und überall sonst auf der Welt registriert, doch plötzlich rattert er los, in gestochen scharfer Schrift, und das Papier darunter zuckt hin und her, um den fließenden kalligrafischen Wirbel zu erfassen. (Vielleicht schreibt er: »Anscheinend bin ich das, was man einen unzuverlässigen Erzähler nennt …«)
Ungefähr so unwahrscheinlich ist es, dass ich das hier schreibe und irgendjemand es liest.
Zeit, Ort. Notwendig wohl, wenn auch unzureichend unter den Umständen. Aber irgendwo und irgendwann müssen wir eben einsteigen, also fange ich mit Mrs. Mulverhill an und halte fest, dass ich ihr, nach deiner Zählung, zum ersten Mal kurz vor Anbruch jenes goldenen Zeitalters begegnet bin, das damals niemand als solches empfand; ich spreche von dem langen Jahrzehnt zwischen dem Fall der Mauer und dem Fall der Türme.
Wenn du es pedantisch genau nehmen willst, dauerte dieses im Rückblick so glückselige Dutzend Jahre von der kalten, fieberhaften Nacht des 9. November 1989 in Mitteleuropa bis zu dem klaren Morgen des 11. September 2001 an der Ostküste Amerikas. Das erste Ereignis stand symbolhaft für die Aufhebung der Bedrohung durch einen atomaren Holocaust, die fast vierzig Jahre lang als Damoklesschwert über der Menschheit geschwebt hatte, und beendete damit eine Zeit der Idiotie. Das zweite Ereignis läutete eine neue ein.
Der Fall der Mauer war nicht besonders spektakulär. Es war Nacht, und im Fernsehen sah man nur einen Pulk Berliner in Lederjacken, die sich auf Stahlbeton stürzten - zumeist mit Hämmern und ziemlich ineffektiv. Es gab keine Todesopfer. Viele Leute waren blau und high - und vermutlich landeten nicht wenige miteinander im Bett. Die Mauer selbst war kein imposantes Bauwerk, weder recht hoch noch übermäßig abschreckend; das eigentliche Hindernis war immer schon die nackte, sandige Todeszone dahinter mit Minen, Hundezwingern und Natodraht gewesen.
Die vertikale Barriere hatte als Abgrenzung von jeher eher Symbolcharakter besessen. Daher war es unerheblich, dass ihr die dort oben hockenden fröhlichen Vandalen in Ermangelung schweren Geräts nicht viel anhaben konnten; was zählte, war, dass sie überall auf diesem berüchtigten Symbol der Entzweiung herumturnten, ohne von Maschinengewehren niedergemäht zu werden. Aber als Ausdruck einer Aufbruchsstimmung und der Hoffnung auf einen Wandel zum Besseren konnte man wahrscheinlich nicht mehr verlangen. Der Al-Kaida-Angriff auf die USA - da unter Berufung auf diesen Anschlag ein Land besetzt wurde, und noch dazu im Namen der Demokratie, sollten wir die Sache auch bei ihrem nationalistischen Namen nennen: der saudi-arabische Angriff auf die USA hätte keinen größeren Kontrast dazu abgeben können.
Zwischen diesen weitreichenden Einebnungen spannten sich die Jahre wie eine Hängematte, die die Zivilisation in einen glückseligen Schlummer der Unwissenheit wiegte.
Irgendwann in der Mitte dieser friedlichen Mulde kamen Mrs. M und ich einander abhanden. Ein letztes Mal trafen und trennten wir uns wieder kurz vor dem dritten Fall, dem Fall der Wall Street und der City, dem Fall der Banken und der Märkte, der am 15. September 2008 einsetzte.
Wohl die meisten Menschen begreifen solche Ereignisse als Lesezeichen im Buch ihres Lebens.
Dennoch scheint mir, dass solche Überschneidungen zwar durchaus nützlich sind, wenn es darum geht, eine persönliche Ära in unserer gemeinsamen Geschichte zu verankern, aber ansonsten keine Bedeutung haben. Während ich nach meinem eigenen kleinen Fall die ganze Zeit hier gelegen habe, bin ich zu der Auffassung gelangt, dass die Dinge ziemlich genau die Bedeutung haben, die wir ihnen zuschreiben. Wenn es uns in den Kram passt, entnehmen wir dem banalsten Zufall Sinn, zugleich jedoch ignorieren wir zufrieden selbst die auffälligste Symmetrie zwischen getrennten Aspekten unseres Lebens, falls sie ein vertrautes Vorurteil oder eine tröstlich bestärkende Überzeugung bedrohen. Gerade dort, wo die erhellendsten Einsichten warten, sind wir am blindesten. Das hat Mrs. Mulverhill gesagt, glaube ich. Möglicherweise war es auch Madame d’Ortolan - ich verwechsle die beiden manchmal.
Da ich nun ohnehin schon etwas vorgegriffen habe, wollen wir diese Wirkung gleich vollends auskosten, statt ihr einen Riegel vorzuschieben.
Denn bestimmt möchtest du schon jetzt am Anfang wissen, wie es mit meiner Rolle in dieser Geschichte ausgeht.
Dann will ich es dir erzählen.
Es endet folgendermaßen: Er kommt in mein Zimmer. Schwarz gekleidet und mit Handschuhen. Hier drinnen ist es dunkel, nur ein Nachtlicht brennt, aber er kann mich auf dem Krankenhausbett erkennen, leicht aufgestützt und durch ein oder zwei Schläuche und Kabel mit medizinischen Apparaten verbunden. Diesen schenkt er keine Beachtung. Der Pfleger, der jeden Alarm registrieren müsste, liegt gefesselt und geknebelt auf seiner Station, der Monitor vor ihm ist abgeschaltet. Der Mann schließt die Tür, und im Zimmer wird es noch dunkler. Leise tritt er heran, obwohl es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass ich aufwache, da man mir ein leichtes Beruhigungsmittel verabreicht hat, damit ich gut schlafe. Er betrachtet mein Bett. Selbst bei dem schwachen Licht kann er ausmachen, dass mich die Decke eng umschlungen hält. Beruhigt greift er nach dem Reservekissen neben meinem Ohr und schiebt es mir - sachte zuerst - übers Gesicht, dann drückt er es rasch auf mich nieder, die Hände zu beiden Seiten meines Kopfs, und hält meine unter dem Bettzeug gefangenen Arme mit den Ellbogen fest. Fast sein ganzes Gewicht ruht auf seinem Oberkörper, und seine Füße heben sich vom Boden, bis er ihn nur noch mit den Schuhspitzen berührt.
Anfangs reagiere ich gar nicht. Als ich mich endlich bewege, lächelt er. Meine schwachen Anstrengungen, die Hände nach oben zu zerren und mich mit den Beinen freizustrampeln, bleiben vergeblich. Eingehüllt in die Decke wäre es selbst einem kräftigen Mann kaum gelungen, sich von dieser erstickenden Last zu befreien. Mit einem letzten hoffnungslosen Aufbäumen versuche ich, einen Buckel zu machen. Mühelos übersteht er diese Aufwallung, und ich sinke zurück. Jede Gegenwehr erlischt.
Aber er ist nicht dumm; er rechnet damit, dass ich mich tot stellen könnte.
Also legt er sich eine Weile quer über mich, reglos wie ich, und wirft hin und wieder einen Blick auf die Uhr, die die vorübertickenden Sekunden anzeigt, um ganz sicher zu sein, dass ich erledigt bin.
Hoffentlich bist du jetzt zufrieden. Ein Ende, und schon so kurz nach dem Auftakt! Doch erst mal zurück zum Anfang, zu etwas, das gewissermaßen erst geschehen muss.
Es beginnt in einem Zug zwischen China und Tibet, der höchstgelegenen Eisenbahnlinie der Welt. Es beginnt mit einem Mann in einem billigen braunen Straßenanzug, der mit etwas unsicherem Gang von einem schwankenden Waggon in den nächsten wechselt. In einer Hand hält er eine kleine Sauerstoffflasche, in der anderen eine halbautomatische Handfeuerwaffe. Er tritt auf die beweglichen Metallplatten zwischen den Wagen, und neben ihm ächzt und biegt sich der Faltenbalg wie eine gigantische Version des gerippten Schlauchs, der den Sauerstoffzylinder mit der durchsichtigen Maske vor seiner Nase und seinem Mund verbindet. Er spürt sein nervöses Lächeln in der Maske.
Um ihn herum rattert und rüttelt der Zug schwerfällig auf und ab, hin und her und wirft ihn kurz gegen die gewellten Wände der Manschette. Vielleicht eine Stelle, wo sich der Permafrost als nicht mehr ganz so permanent erweist - er hat von entsprechenden Problemen gehört. Er richtet sich auf, als der Zug wieder sein Gleichgewicht findet und seine Fahrt ruhig fortsetzt. Dann schiebt er sich die Sauerstoffflasche unter die Achsel, um mit der freien Hand die Krawatte zurechtzurücken.
Die Waffe ist eine mehrere Jahrzehnte alte K-54 der Volksarmee und liegt angenehm glatt in der Hand. Er hat noch nie damit geschossen, aber sie soll zuverlässig sein. Der Schalldämpfer wirkt plump, fast wie ein Eigenbau. Aber er muss reichen. Nachdem er sich die Hände an der Hose abgewischt hat, entsichert er die Pistole und streckt die Finger nach der Zahlentafel an der Tür zu dem Privatwaggon aus. Auf dem Anzeigefeld des Schlosses pulsiert langsam ein winziges rotes Licht.
Jetzt nähern sie sich dem höchsten Punkt der Strecke, dem Tanggula-Pass, der immer noch fast einen Tag von Lhasa entfernt ist. Hier oben, fünf Kilometer über dem Meeresspiegel, fühlt sich die Luft kühl und dünn an. Die meisten Leute werden auf ihren Plätzen bleiben, angeschlossen an die Sauerstoffversorgung des Zugs. Draußen furcht und wölbt sich seit einer Stunde die tibetische Hochebene - eine Sinfonie aus Grau, Beige und Braun mit Einsprengseln von frühsommerlichem Grün - zu Ausläufern, die die runzligen Wälle näher rückender Berge in der Ferne ankündigen.
Der Hauptschaffner hat viel Geld verlangt für den Freischaltcode. Sollte also funktionieren. Schnell tippt er ihn ein.
Das rote Pulsieren wird zu einem gleichmäßigen Grün. Unwillkürlich muss er schlucken.
Der Zug schaukelt; der Griff liegt kalt zwischen seinen Fingern.
Und es beginnt mit unserem jung klingenden, jung aussehenden und sich jung gebenden, aber letztlich doch schon etwas in die Jahre gekommenen Freund Mr. Adrian Cubbish, der an einem Londoner Morgen in seinem Zuhause in Mayfair erwacht - ach, sagen wir im Spätsommer 2007, der Ablauf ist an den meisten Tagen sowieso der gleiche. Er liegt in seiner Schlafzimmersuite, die den größten Teil des ehemaligen Speichers in dem Stadthaus einnimmt. Leichter Regen fällt auf die Doppelglasscheiben, die im Fünfundvierziggradwinkel zum hellgrauen Himmel zeigen.
Wenn Adrian ein Symbol hätte, müsste es ein Spiegel sein. Jeden Morgen, bevor er zur Arbeit geht, und manchmal auch an den Wochenenden, wenn er nicht arbeiten muss, nur so aus Spaß, wendet er sich an den Spiegel: »Der Markt ist Gott, es gibt keinen anderen Gott als den Markt.«
Dann holt er Luft und lächelt sein noch nicht ganz waches Gesicht an. Er wirkt frisch und fit, schlank und muskulös. Er hat gebräunte Haut, schwarzes Haar, graugrüne Augen und einen breiten Mund, um den normalerweise ein wissendes Grinsen spielt. Adrian hat nur ein einziges Mal mit einer deutlich älteren Frau geschlafen; sie hat seinen Mund als »sinnlich« bezeichnet, was er nach kurzer Überlegung cool fand. Frauen in seinem Alter oder jünger nannten seinen Mund höchstens süß, wenn sie überhaupt auf die Idee kamen, ihn zu beschreiben. Er hat einen Bartschatten, der eine Nacht alt ist. Manchmal lässt er den Bart bis zu einer Woche wachsen, bevor er ihn abrasiert. Ob mit oder ohne, er wirkt immer attraktiv. Wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist, sieht er aus wie ein männliches Model. Er sieht aus, wie er aussehen will. Nur ein wenig größer könnte er vielleicht sein.
Er räuspert sich und spuckt in eins der zwei Glaswaschbecken im Bad. Er fährt sich mit der Hand durch die dunklen Locken seines Schamhaars. »Im Namen des Kapitals, barmherzig und weise.« Mit amüsiertem Grinsen zwinkert er seinem Spiegelbild zu.
Und dann haben wir noch die Suite in einem niedrigen Bürogebäude in Glendale, Los Angeles, deren Jalousien das schräg einfallende Spätnachmittagslicht zerteilen und als dunkel glänzende Streifen über Teppichfliesen, Stühle, Anzüge und einen Konferenztisch werfen, während Mike Esteros vor dem gleichförmigen Rauschen der Autobahn sein Angebot unterbreitet.
»Meine Herrschaften … das ist mehr als nur eine Geschäftsidee. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch - es ist eine Geschäftsidee, aber es ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Films, von dessen Erfolgsaussichten ich Sie zu überzeugen hoffe.
Kurz gesagt geht es darum, wie man Aliens aufspüren kann. Wirklich. Wenn ich fertig bin, werden Sie mir glauben, dass es möglich ist. Sie werden wie ich der Meinung sein, dass wir ein Alien fangen können. Aber auf jeden Fall werden wir in der Lage sein, einen Film zu drehen, der eine ganze Generation in seinen Bann zieht - einen Film wie Unheimliche Begegnung der dritten Art oder Titanic. Vielen Dank, dass Sie mir einige Minuten Ihrer kostbaren Zeit gewähren; ich verspreche Ihnen, dass sie nicht verschwendet sein werden.
Also, hat schon mal jemand von Ihnen eine totale Sonnenfinsternis beobachtet? Wenn von der Sonne nur noch zarte Lichtranken hinter dem Mond hervorlugen? Sie, Sir? Ziemlich eindrucksvoller Anblick, nicht? Ja, wirklich umwerfend. Und für manche Menschen ein echter Wendepunkt im Leben. Sie werden zu Schattenjägern - zu Leuten, die Sonnenfinsternisse sammeln und in alle Winkel der Welt reisen, um dieses unheimliche und einzigartige Schauspiel möglichst oft zu erleben.
Denken wir einen Moment über Sonnenfinsternisse nach. Selbst wer persönlich noch bei keiner dabei war, kennt Fotos aus Zeitschriften und Filmmaterial aus dem Fernsehen oder YouTube. Sie sind fast zu einer Selbstverständlichkeit für uns geworden; sie gehören eben zu den Dingen, die auf unserem Planeten passieren, wie das Wetter oder Erdbeben, nur dass sie nicht zerstörerisch und lebensbedrohlich sind.
Aber überlegen Sie mal, was für ein unglaublicher Zufall es ist, dass unser Mond genau über unsere Sonne passt. Jeder Astronom wird Ihnen erklären, dass der Mond der Erde relativ betrachtet viel größer ist als die Monde aller anderen Planeten. Die meisten Planeten - Jupiter, Saturn und so weiter - haben Monde, die im Vergleich zu ihnen winzig sind. Der Erdmond dagegen ist riesig und außerdem sehr nah. Wäre er kleiner oder weiter weg, hätten wir nur partielle Sonnenfinsternisse; wäre er größer oder näher, würde er die Sonne komplett verdecken, und es gäbe keine Lichtkorona um den Mond. Das ist ein verblüffendes Zusammentreffen, ein unfassbarer Glücksfall. Und möglicherweise sind solche Sonnenfinsternisse sogar absolut einzigartig. Es könnte sich um ein Phänomen handeln, das nur auf der Erde und nirgends sonst zu beobachten ist. Behalten Sie das bitte im Kopf.
Stellen wir uns nun vor, dass es außerirdische Lebewesen gibt. Nicht wie E.T. - nicht so lieb und nicht so einsam. Auch nicht so verrückt und aggressiv wie die Aliens aus Independence Day, sondern einfach ganz normale Außerirdische, okay? Durchschnittsaliens. Lassen Sie sich das durch den Kopf gehen, und Sie werden merken, dass es absolut möglich ist. Schließlich sind auch wir hier, und die Erde ist bloß ein kleiner Planet, der eine normal große Sonne in einer Galaxie umkreist. In dieser einen Galaxie gibt es eine Viertelmilliarde Sonnen, und im Universum gibt es eine Viertelmilliarde Galaxien, vielleicht sogar mehr. Schon jetzt kennen wir Hunderte von Planeten, die andere Sonnen umkreisen, obwohl wir erst seit kurzem nach ihnen Ausschau halten. Von Wissenschaftlern erfahren wir, dass praktisch jeder Stern Planeten haben könnte. Auf wie vielen davon ist Leben möglich? Die Erde ist sehr alt, aber das Weltall ist noch älter. Wer weiß, wie viele Zivilisationen vor der Entstehung der Erde oder in ihrer Anfangszeit existiert haben? Wer weiß, wie viele in diesem Augenblick existieren?
Wenn es also zivilisierte Aliens gibt, können wir davon ausgehen, dass sie in der Lage sind, von Stern zu Stern zu reisen.Wir können davon ausgehen, dass ihre Energiequellen und Technologien den unseren so überlegen sind, wie es Überschallflugzeuge, Atom-U-Boote und Spaceshuttles denen eines Amazonasstammes sind, der seine Kanus aus Baumstämmen schnitzt. Und wenn diese Außerirdischen aus Neugier zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und technischen Erfindungen gelangt sind, dann werden sie aus Neugier auch die Welt erkunden wollen.
Nun, bei den meisten Flugreisen auf der Erde geht es um Tourismus - nicht um Geschäfte, sondern um Tourismus. Sollten sich diese intelligenten, neugierigen Aliens wirklich so sehr von uns unterscheiden? Ich glaube nicht. Die meisten von ihnen wären ebenfalls Touristen. Wie wir würden sie mit Schiffen herumkreuzen. Und würden sie hierherkommen und den Fuß, den Tentakel oder was auch immer auf unsere Erde setzen, statt dafür irgendeinen Virtual-Reality-Apparat zu benutzen? Na ja, einige würden sich bestimmt mit der zweitbesten Lösung zufriedengeben. Vielleicht sogar die Mehrheit. Aber für die Glücksritter, die Superreichen, die Eliten zählt nur das Echte. Sie wollen damit angeben können, die exotischen Ziele einer Rundreise durch die Galaxis wirklich besucht zu haben. Und wer weiß, welche Herrlichkeiten sie auf den Tourplan setzen würden? Den Grand Canyon,Venedig, die chinesische Mauer, den Yellowstone-Nationalpark, die Pyramiden?
Was ich damit sagen will, ist: Neben all diesen Wundern würden sie sicher auch diese eine kostbare Sache erleben wollen, die wir haben und sonst wahrscheinlich niemand: unsere Sonnenfinsternis. Sie wären ganz scharf darauf, mit ihren eigenen Augen durch die Erdatmosphäre zu beobachten, wie sich der Mond vor die Sonne schiebt und das Licht fast vollkommen verblasst, zu hören, wie die Tiere in der Nähe verstummen, und auf ihrer eigenen Haut die plötzliche Kälte in der Luft zu spüren. Selbst wenn unsere Atmosphäre für sie tödlich ist, wenn sie einen Raumanzug brauchen, um zu überleben, würde es ihnen darauf ankommen, das Ganze aus möglichst großer Nähe zu verfolgen, unter Bedingungen, die so unverfälscht und natürlich sind, wie es sich nur einrichten lässt. Sie würden hier unter uns sein wollen, wenn der Schatten vorüberzieht.
Das ist also die Gelegenheit, um nach Aliens Ausschau zu halten. Im Verlauf einer totalen Sonnenfinsternis. Wenn alle anderen ehrfürchtig hinauf zum Himmel blicken, muss man sich nach Leuten umsehen, die irgendwie seltsam wirken oder merkwürdig gekleidet sind, Leute, die nicht aus dem Wohnmobil oder der ankernden Jacht mit den dunkel getönten Scheiben aussteigen.
Wenn sie irgendwo sind, dann dort, und zwar so abgelenkt - und damit anfällig - wie alle anderen, die voller Staunen in dieses atemberaubende Spektakel versunken sind.
Auf dieser Idee beruht der Film, den ich produzieren will. Er ist aufregend, er ist komisch, er ist traurig und tiefgründig und am Schluss auch erhebend, er hat zwei fantastische Hauptrollen, eine für einen Dad, eine für einen Jungen, und eine großartige weibliche Nebenrolle, dazu die Möglichkeit zu starken Charakterrollen und kleineren Parts.
Das ist das Grundgerüst. Und jetzt möchte ich Ihnen die Handlung erzählen.«
Und auch an einem völlig anderen Ort beginnt es …
»Zwischen den Platanen und Aussichtstürmen von Aspherje erhebt sich an diesem klaren Mittsommermorgen die im Dämmerlicht glitzernde Nebelkuppel in all ihrer Pracht wie eine riesige goldene Denkkappe über der Universität für Praktische Talente. Unten, zwischen den Statuen und Bächlein des Parks auf den Dächern der Philosophischen Fakultät wandelt Lady Bisquitine mit Gefolge.«
… ja, auch so beginnt es.
Und mit einem schmächtigen, gebeugten, unscheinbaren Mann, der ein kleines Zimmer in einem großen Gebäude betritt. Er hat nur ein Blatt Papier und eine Südfrucht dabei, wird jedoch von Schreien begrüßt. Ungerührt mustert er sein Gegenüber und schließt die Tür hinter sich. Die Schreie hören nicht auf.
Und es beginnt hier und jetzt, an diesem Tisch vor einem Café im Pariser Stadtteil Marais, mit einem Mann, der eine winzige weiße Tablette aus einer kleinen, verzierten Süßstoffdose in seinen Espresso wirft. Sein Blick schweift über den vorbeiziehenden Verkehr und die Fußgänger - einige haben es eilig, die anderen flanieren -, streift den attraktiven jungen algerischen Kellner, der in seiner lebhaften Art mit zwei vorsichtig lächelnden Amerikanerinnen flirtet, und verweilt kurz bei einer elegant geschminkten und frisierten Pariserin mittleren Alters, die ihr zwergenhaftes Hündchen zum Tisch hochhebt, damit es ein paar Croissantkrümel auflecken kann. Dann gibt er ein schrumpeliges Stück braunen Zucker in seine Tasse und rührt in gespielter Nachdenklichkeit den Kaffee um, während er die Ormolu-Tabletten zurück in seine Jackeninnentasche gleiten lässt.
Nachdem er einen Fünfeuroschein unter die Zuckerdose geschoben und die Brieftasche weggesteckt hat, leert er die Espressotasse mit zwei tiefen, genießerischen Schlucken. Als er sich zurücklehnt, hält er mit einer Hand noch den winzigen Griff, die andere hängt untätig herab. Ein erwartungsvoller Ausdruck liegt jetzt auf seinem Gesicht.
Es ist ein Nachmittag im Frühherbst des Jahres 2008 unserer Zeitrechnung, die Luft steht klar und warm unter einem milchigen, passtellfarbenen Himmel, kurz bevor sich alles verändert.
EINS
PATIENT 8262
Ich glaube, was ich gemacht habe, war sehr schlau. Dass ich hier gelandet bin, meine ich. Aber natürlich neigen viele Leute so wie ich im Moment dazu, sich zu ihrer Cleverness zu gratulieren. Und viel zu oft in meiner Vergangenheit folgte diesem Gefühl, es besonders schlau angestellt zu haben, die Erkenntnis, dass ich es nicht schlau genug angestellt habe. Aber diesmal …
Mein Bett ist bequem, die Ärzte und Pflegekräfte behandeln mich gut und mit einer professionellen Gleichgültigkeit, die in meiner speziellen Situation viel beruhigender ist als übertriebene Hingabe. Das Essen ist annehmbar.
Wenn ich so im Bett liege, habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Und vom Nachdenken verstehe ich was. Wir alle verstehen etwas davon. Als Gattung, meine ich. Es ist unsere Stärke, unsere Fähigkeit, unsere überragende Begabung. Das, was uns über den Durchschnitt erhebt. Zumindest bilden wir uns das ein.
Wie entspannend, hier zu liegen und sich versorgen zu lassen, ohne dafür einen Finger rühren zu müssen. Was für ein herrlicher Luxus, ungestört nachdenken zu können.
Ich bin allein in einem kleinen, quadratischen Raum mit weißen Wänden, hoher Decke und großen Fenstern. Das Bett ist ein alter Stahlkasten mit einer manuell einstellbaren Rückenlehne und Gitterseiten, die klirrend hochgezogen werden können, damit der Patient nicht heraus fällt. Die frische weiße Bettwäsche strahlt nur so vor Sauberkeit, und die Kissen sind zwar etwas klumpig, aber prall. Der Linoleumboden glänzt hellgrün. Das restliche Mobiliar des Zimmers besteht aus einem ramponierten Holznachttisch und einem billigen Stuhl aus schwarz bemaltem Metall und verblichenem roten Plastik. An der Wand über der Tür zum Gang ist ein Oberlicht angebracht. Hinter den Fenstern, die vom Boden bis zur Decke reichen, befindet sich ein kleiner Balkon mit einem dekorativen Eisengeländer.
Zwischen den Stäben geht der Blick auf einen Grasstreifen und eine Reihe von Laubbäumen, dahinter auf einen seichten Fluss, der bei entsprechendem Einstrahlwinkel im Sonnenlicht glitzert. Die Bäume verlieren inzwischen die Blätter, und der Fluss ist deutlicher zu erkennen. Mein Zimmer liegt im zweiten und damit höchsten Stockwerk der Klinik. Einmal sah ich auf dem Fluss ein Ruderboot mit zwei oder drei Leuten darin, und manchmal bemerke ich Vögel. Ein anderes Mal hinterließ ein Flugzeug hoch droben am Himmel einen langen weißen Kondensstreifen, wie das Kielwasser eines Schiffs. Eine Zeit lang beobachtete ich, wie er sich langsam ausbreitete, ausfranste und im Sonnenuntergang rot wurde.
Hier müsste ich eigentlich in Sicherheit sein. Sie werden nicht auf die Idee kommen, hier nach mir zu suchen. Glaube ich. Natürlich sind mir auch andere Möglichkeiten eingefallen: eine Jurte in einer endlosen Steppe mit einer Großfamilie und dem Wind als einziger Gesellschaft; eine brechend volle Favela an einem steilen Hang, geprägt vom gemeinsamen Schweißgeruch und dem Lärm plärrender Kinder, brüllender Kerle und scheppernder Musikrhythmen; die stolze Ruine eines Klosters auf den Kykladen, wo ich den Ruf eines Einsiedlers und Exzentrikers erwerbe; zusammen mit anderen zerlumpten Tunnelbewohnern im düsteren Manhattaner Untergrund.
Ob offen sichtbar oder in größter Abgeschiedenheit, es gibt immer viele, viele Verstecke, auf die sie nie verfallen würden. Andererseits kennen sie mich und wissen, wie ich denke, daher erraten sie vielleicht schneller als ich selbst, wohin ich mich wenden werde. Dann die Schwierigkeit, sich natürlich einzufügen oder sich zu tarnen, eine Rolle zu spielen: ethnische Zugehörigkeit, Physiognomie, Hautfarbe, Sprache, Fähigkeiten - alles muss berücksichtigt werden.
Wir sind ja immer am Sortieren. Hier die eine Gruppe, dort die andere. Sogar in Großstädten, sogenannten Schmelztiegeln, teilen wir uns meist nach kleinen Enklaven und Bezirken ein, um in den Gemeinsamkeiten des Hintergrunds und der Kultur Trost zu finden. Unser Wesen, unsere Sexualität, unser genetisch bedingtes Verlangen nach Herumstreifen und Experimentieren, unsere Lust aufs Exotische oder einfach nur das andere können zu interessanten Paarbildungen und einem gemischten Erbe führen, doch unser kontinuierliches Bedürfnis nach Gruppierung, Bewertung und Einordnung zieht uns immer wieder zurück in feste Arrangements. Dadurch wird es schwer, sich zu verstecken. Ich bin - oder sehe zumindest danach aus - ein blasser, hellhäutiger Mann, und entsprechend eingeschränkt ist auch die Auswahl der möglichen Schlupfwinkel, in denen ich nicht auffallen würde.
Ein Lastwagenfahrer. Das wäre eine gute Tarnung. Ein Fernfahrer, der durch den mittleren Westen der USA oder durch die Ebenen Kanadas braust, quer durch Argentinien oder Brasilien. Oder gleich am Steuer eines Lastzugs mit mehreren Anhängern, der durch die australische Wüste brettert. Man bleibt verborgen, weil man ständig in Bewegung ist und nur selten Leuten begegnet. Oder ein Deckhelfer oder Koch auf einem Schiff: ein Containerfrachter, der mit einer kleinen Mannschaft über die Hochsee pflügt und ausschließlich riesige, automatisierte und praktisch menschenleere Containerterminals anläuft, weit entfernt von den Großstädten, zu denen sie gehören. Wer könnte mich aufspüren, wenn ich ein derart unstetes Leben führe?
Doch nun bin ich hier. Ich habe meine Entscheidung getroffen und keine andere Wahl mehr; ich muss damit klarkommen. Ich habe meine Route berechnet, die Mittel, das Geld und das Personal mit den Fähigkeiten beschafft, die erforderlich waren, um mir auf meinem Weg in die Vergessenheit zu helfen, habe die Möglichkeiten derer geprüft, die vielleicht ein Interesse haben könnten, mir nachzuspüren, habe mir Methoden zurechtgelegt, um ihre Pläne zu durchkreuzen, und als alles vorbereitet war, die Sache schließlich durchgezogen.
Und so liege ich jetzt hier und denke nach.
DER WELTENWECHSLER
Andere haben mir erzählt, dass es bei ihnen während eines Blinzelns passiert oder einfach so zwischen zwei Herzschlägen oder sogar während eines Herzschlags. Es gibt immer ein äußeres Anzeichen: ein Zittern oder Beben, häufig ein sichtbares, gelegentlich sogar ein starkes Zucken, als hätte der Körper des Betreffenden einen Stromschlag erhalten. Eine Person gab an, dass sie in diesem Moment immer meint, aus dem Augenwinkel etwas Überraschendes oder Bedrohliches bemerkt zu haben, und ein unangenehmes Brennen im Hals spürt wie von einem Elektroschock. Bei mir ist es in der Regel eine Spur peinlicher: Ich niese.
Ich nieste einfach.
Ich habe nur eine ganz vage Vorstellung davon, wie lange ich vor dem kleinen Café im dritten Arrondissement saß, während ich darauf wartete, dass die Wirkung der Droge eintrat, und in den Wachtraum sank, der die notwendige Voraussetzung dafür ist, um genau das gewünschte Ziel zu erreichen. Mehrere Sekunden? Fünf Minuten? Die Rechnung habe ich hoffentlich bezahlt. Eigentlich könnte es mir gleichgültig sein - ich bin nicht er, und er wird sowieso noch dort sein -, aber es ist mir nicht gleichgültig. Ich beuge mich vor und richte den Blick auf den Tisch. Auf dem kleinen Plastiktablett mit der festgehefteten Rechnung liegt ein wenig Kleingeld. Francs, Centimes - keine Euros. So weit, so gut.
Ich empfinde das starke Bedürfnis, die Gegenstände auf dem Tisch zurechtzurücken. Die Zuckerdose hat genau in der Mitte zu stehen, während die geleerte Espressotasse schnurgerade und exakt auf halber Strecke zwischen der Dose und mir platziert sein muss. Das Rechnungstablett lasse ich gern rechts von der Dose, als Ausgleich für den Gewürzständer. Erst als ich die Dinge in diese angenehme Konstellation bringe, bemerke ich, dass die Hand, die aus meinem Ärmel ragt, tiefbraun ist. Außerdem fällt mir auf, dass ich gerade eine Art Kreuz auf dem Tisch arrangiert habe. Ich blicke auf, um die Bauart der Autos und Straßenbahnen und die Kleidung der Fußgänger zu erfassen. Wie erwartet befinde ich mich in einer jüdisch-islamischen Wirklichkeit. Sofort bilde ich mit den Objekten auf dem Tisch eine Figur, die dort, wo ich herkomme, ein Friedenssymbol darstellt. Erleichtert lehne ich mich zurück. Zwar sehe ich garantiert nicht wie ein christlicher Terrorist aus, aber man kann gar nicht vorsichtig genug sein.
Oder sehe ich womöglich doch so aus? Ich greife in meinen Brustbeutel - wie die meisten Männer und Frauen hier trage ich einen praktisch taschenlosen Salwar Kamiz - und ziehe heraus, was vor mehreren Sekunden oder fünf Minuten noch mein iPod gewesen wäre. Hier ist es ein Zigarettenetui aus rostfreiem Stahl. Ich tue so, als würde ich mit dem Gedanken spielen, eine Zigarette zu rauchen; in Wirklichkeit jedoch studiere ich mein Spiegelbild auf der blanken Rückseite des Etuis. Erneut Erleichterung: keine Ähnlichkeit mit einem christlichen Terroristen. Ich sehe aus wie üblich, wenn ich diese Hautfarbe habe, und im Großen und Ganzen wie immer, unabhängig von Teint, Rasse und Typ, das heißt untadelig, unauffällig, nicht unattraktiv (auch nicht attraktiv, aber das macht mir nichts aus). Ich wirke einfach farblos. Doch farblos ist gut, farblos ist sicher, farblos passt sich gut an: die perfekte Tarnung.
Die Uhr. Immer auf die Uhr schauen. Ich schaue auf die Uhr. Die Uhr ist in Ordnung, kein Problem mit der Uhr. Ich nehme keine Zigarette, weil ich kein Verlangen danach spüre. Anscheinend habe bei dieser neuen Verkörperung auf dieses Gelüst verzichtet. Ich stecke das Etui zurück in den Beutel, der von der Schulter bis zur Hüfte reicht, und überprüfe, dass die kleine Dose mit den Ormolu-Tabletten sicher in der verschlossenen inneren Tasche verstaut ist. Abermals Erleichterung! (Die Tablettendose ist bisher noch jedes Mal mitgereist, aber man macht sich immer Sorgen. Na ja, ich mache mir immer Sorgen. Zumindest glaube ich das.)
Meinem Ausweis entnehme ich, dass ich Aiman Q’ands bin, was einigermaßen richtig klingt. Aiman, hey, Mann; schön, mich kennenzulernen. Sprachcheck. Ich beherrsche Französisch, Arabisch, Englisch, Hindisch, Portugiesisch und Lateinisch. Ein paar Brocken Deutsch und Neumongolisch. Kein Mandarin, was ungewöhnlich ist.
Ich mache es mir auf dem Stuhl bequem und arrangiere meine Beine in dem voluminösen Salwar genau parallel zu den überkreuzten Beinen des Tischchens. Offenbar habe ich zwar keine Tabaksucht mitgebracht, aber dafür - wieder einmal - eine Art Zwangsstörung, die sicher nicht weniger lästig und ablenkend ist, wenn auch nicht so lebensbedrohlich.
Hoffentlich ist es nur eine leichte Zwangsstörung. Kann ich das wirklich glauben? Womöglich doch nicht so leicht. (Meine Hände fühlen sich ein wenig klebrig an, als müsste ich sie waschen.) Vielleicht sogar schlimm. (In diesem Café gibt es vieles, was aufgeräumt, ausgerichtet, zurechtgerückt werden könnte.) Darum muss ich mir Sorgen machen. Anscheinend bin ich also jemand, der sich immer Sorgen macht. Unangenehm und selbst wiederum Anlass zur Sorge.
Wie auch immer, ich kann hier nicht den ganzen Tag rumsitzen. Schließlich bin ich nicht ohne Grund hier, man hat mich gerufen. Sie höchstpersönlich sogar. Inzwischen ist auch der letzte flüchtige Schwindel im Zusammenhang mit dem Wechsel verflogen. Keine Müdigkeit vorschützen! Ich muss los, also stehe ich auf.
ADRIAN
Den Leuten habe ich gesagt, dass ich ein ehemaliger Straßenhändler aus dem East End bin, stimmt. Dad hatte einen Aalstand, und Mum war Bardame. Aber das ist totaler Quatsch, alles gelogen. Das erzähle ich ihnen nur, weil sie es gern hören, weil sie es hören wollen. Das ist nämlich eine von den Lektionen, die ich gelernt habe. Wenn man den Leuten erzählt, was sie hören wollen, kann man damit viel erreichen. Klar, man muss vorsichtig sein und sich die Richtigen dafür aussuchen, aber trotzdem, du verstehst schon.
Natürlich kann jeder Idiot anderen was vorschwafeln, wenn er schon weiß, dass sie es hören wollen. Das Kreative, also der echte Mehrwert an der Sache ist, dass man früher als sie selbst weiß, was sie hören wollen. Darauf fahren sie total ab. Das bringt Dividenden. Ist praktisch eine Dienstleistung. Wie auch immer, den Akzent hab ich voll drauf. Wirklich überzeugend. Solltest mich mal hören. Den East-End-Slang, meine ich. Das Straßenhändlergelaber. Was ich damit sagen will, ist, bei Cockney kann mir keiner was vormachen. Alles klar?
Eigentlich komm ich aus dem hohen Norden. Eine von diesen trostlosen Städten da oben mit dem ganzen Dreck und so. Welche trostlose Stadt da oben, willst du gar nicht wissen, weil sie sowieso alle gleich sind, da gibst du mir bestimmt Recht, also bringt es überhaupt nichts, wenn ich dir den genauen Namen verrate, okay? Wenn du also unbedingt wissen willst, welche, Pech gehabt. Mach’s wie ich. Benutz deine Fantasie.
Nö, mein Dad war Bergarbeiter, bevor die Kumpels von Saint Margaret (mit ein wenig oder reichlich Unterstützung von King Arthur, hängt von der politischen Anschauung ab) zur bedrohten Gattung gemacht wurden. Mum hat in einem Friseursalon gearbeitet. Außerdem meine ich es ernst, dass La Thatch eine Heilige ist, auch wenn man das da, wo ich aufgewachsen bin, besser nicht jedem auf die Nase binden sollte, was natürlich auch einer von vielen Gründen ist, warum ich dort kaum mehr hinfahre. Ich meine, wer will schon sein ganzes Leben in irgend so einem Scheißloch im Boden rumbuddeln? Bestimmt niemand, der sie noch alle beisammen hat. La Thatch hat ihnen doch nur einen Gefallen getan. Eigentlich müssten sie vor den geschlossenen Gruben Denkmäler für sie aufstellen.
Also, zu meiner Zeit war das alles schon längst graue Vorgeschichte. Na ja, zumindest für mich. Aber wenn ich den Leuten um mich herum so zuhörte, hätte man glauben können, dass das alles erst gestern passiert ist. Wir wohnten in einer Doppelhaushälfte, das heißt, wir hatten eine Familie gleich nebenan, ist ja klar. Aber wir mussten unsere Nachbarn wie Luft behandeln, weil der Typ, früher anscheinend einer von Dads besten Kumpels, zur Democratic Union of Miners of Britain oder so gegangen war und deswegen für meinen Alten ein Streikbrecher war, und das war offenbar noch schlimmer, wie wenn er ein Pädo oder ein Mörder gewesen wäre. Das einzige Mal, dass mir mein Vater fast eine gescheuert hätte, war, als er mich beim Klönen mit den Zwillingen von nebenan erwischt hat.
Jedenfalls war die Gegend nichts für mich. Sobald ich mich aus der Schule abseilen konnte, war ich auf der Autobahn, unterwegs in die große böse Stadt, und je größer und böser, umso besser. Zuerst blieb ich kurz in Manchester hängen, aber obwohl es nach einem Monat allmählich interessant wurde, blieb ich nicht dort. Es zog mich weiter nach Süden. M6 nach London. Die hellen Lichter haben mir schon immer gefallen. Für mich war London das einzig Wahre.Wenigstens auf dieser Seite des Teichs. New York wäre bestimmt auch okay gewesen, aber später wurde London dank Leuten wie meiner Wenigkeit sogar noch besser und cooler als NYC.
Irgendwie kann ich schon nachvollziehen, warum die Leute bleiben wollen, wo sie aufgewachsen sind, zumindest wenn sie aus einer großen Stadt kommen. Ich meine, wer hat schon Lust, auf dem Land zu versauern? Vielleicht möchte man aus sentimentalen Gründen bleiben, weil man seine Kumpels dort hat und so weiter, aber wenn es nicht wirklich total klasse dort ist und einem der Ort echt was fürs Leben gibt, dann ist man ein Trottel, du verstehst schon. Wenn man an so einem Ort kleben bleibt, obwohl man weiß, dass man woanders, wo es größer und heller ist, mehr Chancen hätte, dann steckt man einfach mehr rein, als man zurückkriegt. Ein Verlustgeschäft, nichts anderes. Ich meine, wenn sich einer für ein unentbehrliches Mitglied seiner Gemeinde hält, schön für ihn, aber er soll bitte nicht so tun, als würde er sich nicht ausbeuten lassen. Es wird viel geredet von Loyalität und Heimatverbundenheit und so, aber das ist alles reiner Quatsch. Damit wollen sie einen doch nur dazu bringen, dass man Dinge macht, die eigentlich nicht im eigenen Interesse sind. Loyalität ist was für Träumer.
Also zog ich ins sonnige London. Und es war wirklich sonnig im Vergleich zu Manchester und meinem Geburtsort, das kannst du mir glauben. Schon am ersten Tag habe ich mir meine erste Oakley-Sonnenbrille gekauft. Ja, gekauft. Jedenfalls, London war sonnig und sogar lau, und voller Weiber und Chancen. Ich wohnte bei einem Kumpel von zu Hause, besorgte mir einen Job als Barkeeper in Soho, legte mir ein, zwei Freundinnen zu, traf ein paar Typen, machte mich nützlich bei Leuten, die jemanden mit ein bisschen Grips und der Gabe zum Quasseln zu schätzen wissen. Man muss bloß ausgeschlafen sein, dann landet man immer auf beiden Füßen. Aber vor allem kommt es darauf an, dass man bei den Richtigen landet.
Kurz und gut, ich fing an, die Überflieger mit dem Mittel zum Fliegen zu versorgen.Voll von kreativen Typen, dieses Soho, und viele Leute im kreativen Gewerbe pudern sich gern die Nase, damit der Akku immer schön voll bleibt. Ziemlich große Sache bei den Kreativen, damals zumindest. Und zu besagten Kreativen würde ich auf jeden Fall auch die Finanzjongleure mit ihren ausgesprochen exotischen Instrumenten und Produkten zählen. Außerdem sind sie auch ausreichend bei Kasse, um so ein Hobby zu vertiefen.
So hab ich mich gewissermaßen hochgearbeitet. Und irgendwie auch vor. Im Sinne von vor nach Osten, wo die Kohle ist. Um genau zu sein, von Soho aus Richtung City und Canary Wharf, wo viele von den größten Überfliegern Rast machten. Immer schön dem Geld folgen, das war meine Devise.
Ich hatte nämlich einen Plan, von Anfang an. Um das auszugleichen, was mir an akademischer Ausbildung und entsprechenden Titeln fehlte. Nämlich, was machen die Leute, wenn sie sich ein oder zwei Nasen reingezogen haben? Sie quasseln. Wie ein Wasserfall, ohne Punkt und Komma. Und natürlich geben sie an, wenn sie besonders von sich eingenommen sind. Was so ungefähr auf alle meine Kunden zutraf.
Und wenn man die ganze Zeit arbeitet, sich konzentriert, Geld verdient, Risiken eingeht, finanzielle Drahtseilakte vollführt und so weiter, redet man auch darüber. Ist ja klar. Diese Typen sprudeln doch nur so über vor Testosteron und Genialität, da wollen sie natürlich auch zum Besten geben, was sie so treiben, welche Deals sie gedeichselt haben, wie viel Kohle hängengeblieben ist, welche Manöver sie als Nächstes planen und was sie alles wissen.
Und jemand, der zufällig dabei ist, wenn sie über dieses Zeug labern, noch dazu jemand, der kein Kollege, also auch keine Bedrohung ist, kein Konkurrent, sondern einfach nur ein Kumpel und ein jederzeit verfügbarer Lieferant ihrer bevorzugten entspannungsfördernden Substanz, tja, so jemand kriegt viele interessante Sachen zu hören, du verstehst schon. Und wenn sich dieser Jemand etwas dämlicher und weniger informiert gibt, als er in Wirklichkeit ist, und gleichzeitig Augen und Ohren offenhält und immer hellwach bleibt, dann kann er einige potenziell höchst brauchbare Hinweise aufschnappen. Potenziell sehr lukrative Hinweise, wenn man die richtigen Leute kennt und ihnen zur richtigen Zeit die richtige Information zuspielt.
Hauptsache, man kann sich nützlich machen. Wie gesagt, ich verstehe mich als Dienstleister. Und sobald man einige Geheimnisse kennt, erfährt man immer mehr davon, wirklich erstaunlich. Die Leute handeln mit Geheimnissen und merken nicht, dass sie was verraten, vor allem, wenn sie einem vertrauen oder einen unterschätzen oder beides. Nach und nach war ich in der Lage, Gegenleistungen für erwiesene Gefälligkeiten zu fordern und ein wenig Leverage einzusetzen, wie unsere Finanzfreunde das nennen, um mir Ausbildung, Empfehlungen, Protektion und, nicht zu vergessen, auch Betriebskapital zu sichern.
Nochmal kurz und gut, ich wurde vom Dealer zum Trader. Tauschte das Pulver gegen das Papiergeld, ersetzte den Stoff, der durch einen zusammengerollten Schein gleitet, durch den Schein selbst. Das war ein ziemlich schlauer Schachzug, wenn ich das so sagen darf.
Versteh mich nicht falsch. Drogen sind klasse, ganz klar. In vieler Hinsicht ein lohnendes Geschäft und auf jeden Fall dauerhaft beliebt in guten wie in schlechten Zeiten. Warum würden die Leute sonst so viel Kies dafür lockermachen und sogar das Risiko eingehen, im Knast zu landen? Aber genau genommen ist man als Dealer doch der Blöde, zumindest wenn man es längere Zeit betreibt. Ständig muss man auf der Hut sein, und sogar einen Teil des Profits muss man opfern, um die Jungs in Blau bei Laune zu halten. Ich meine, es bleibt schon was übrig, ein ziemlicher Haufen sogar, aber genau das lockt dann auch diese finsteren Gestalten ohne Manieren an, und wenn man tot ist, nützt einem der ganze Zaster gar nichts mehr. Rein ins Geschäft, so viel wie möglich abräumen und dann wieder raus, solange man noch seine Eier und eine heile Kehle hat, so und nicht anders muss man es anstellen, wenn man noch richtig tickt. Man benutzt es als Räuberleiter in ein Geschäft, das genauso lukrativ ist, aber viel ungefährlicher. So ist es schlau, und so ist es bei mir gelaufen.
Schon erstaunlich, was man erreichen kann, wenn man sich ein bisschen reinhängt und sich nützlich macht.
MADAME D’ORTOLAN
Frustriert saß Madame d’Ortolan in ihrer Orangerie. Sie war als Rassistin beschimpft worden! Und noch dazu von einer Person, gegen die sie keine sofortigen Vergeltungsmaßnahmen ergreifen konnte. Selbstverständlich war sie keine Rassistin. Nicht selten hatte sie hier in ihrem Stadthaus sogar Besuch von Schwarzen und Juden, wobei sie natürlich immer streng darauf achtete, wo sie saßen und was sie angefasst oder benutzt hatten, damit sie anschließend alle derart berührten Gegenstände gründlich reinigen und desinfizieren lassen konnte. Man konnte schließlich nicht genug aufpassen.
Aber eine Rassistin? Nie im Leben. Ganz im Gegenteil, in passender Gesellschaft (das heißt, in äußerst begrenzter und erklärtermaßen diskreter Gesellschaft) hätte sie sogar darauf verweisen können, dass sie sich schon des Öfteren den dunklen Freuden mit Schwarzen hingegeben hatte. Der Inbegriff des Genusses war es für sie, von so einem barbarischen Nubier anal genommen zu werden. Im Stillen nannte sie diesen Akt eine »Fahrt nach Sèvres-Babylone«, da dies nach ihrer Kenntnis die tiefste, finsterste und verlockend gefährlichste von allen Métro-Stationen war.
Rassistin! Was für eine Unverschämtheit. Der Anruf hatte sie hier in der Orangerie erreicht:
»Oui?«
»Madame, ich bin froh, Sie zu erwischen.«
»Ah, Mrs. M. Ich bin sicher, wir werden uns bald revanchieren können.«
Mrs. Mulverhill hatte das Gespräch auf Englisch eröffnet, immer ein sicheres Zeichen, dass sie nicht nur plaudern, sondern über geschäftliche Dinge reden wollte. Abgesehen davon war es schon eine Weile her, dass sie einander aus rein privaten Gründen angerufen hatten. »Darf ich fragen, wo Sie sind?«
»Ich denke schon, allerdings ohne aufschlussreiche Konsequenzen.«
Madame d’Ortolan spürte eine innere Aufwallung. »Ein einfaches Nein hätte genügt.«
»Gewiss, aber es wäre ungenau gewesen. Geht es Ihnen gut?«
Titel der englischen Originalausgabe: TRANSITION
Deutsche Erstausgabe 06/2010 Redaktion: Tamara Rapp
Copyright © 2009 by Iain Banks
Copyright © 2010 der deutschen Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-04706-1
www.heyne-magische-bestseller.de
Leseprobe
www.randomhouse.de