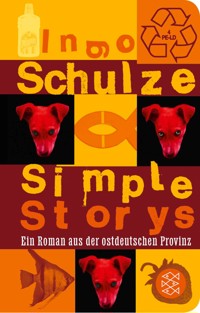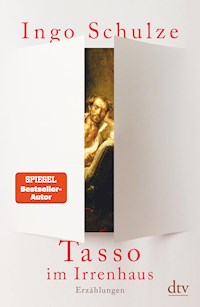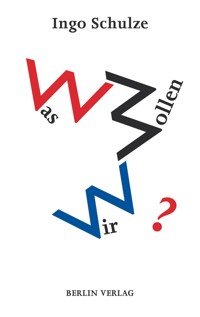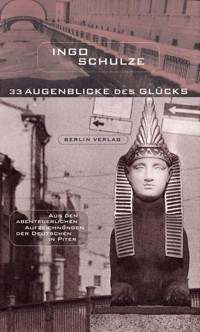19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ingo Schulze ist ein raffinierter Erzähler und ein engagierter politischer Autor. In seinen Geschichten und Romanen von »33 Augenblicke des Glücks« bis »Die rechtschaffenen Mörder« erzählt er virtuos von unseren gesellschaftlichen Entwicklungen. Literatur und Kunst können Perspektiven verändern, der Vereinzelung entgegenwirken und dem lähmenden "Weiter so" widersprechen. Zu unterschiedlichsten Anlässen reflektiert Ingo Schulze die glückhaften wie auch die problematischen Erfahrungen von 1989/90, die unsere Welt bis heute prägen. Er beleuchtet die Konsequenzen der zunehmenden Polarisierung und Radikalisierung in allen Bereichen. Er besteht auf dem Vorrang des Gemeinwohls und einer gerechten Weltinnenpolitik. Der vorliegende Band versammelt zentrale Texte dieses kritischen und selbstkritischen Denkens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ingo Schulze
Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte …
Essays
Essays
Über dieses Buch
Ingo Schulze ist ein raffinierter Erzähler und ein engagierter politischer Autor. In seinen Geschichten und Romanen von »33 Augenblicke des Glücks« bis »Die rechtschaffenen Mörder« erzählt er virtuos von unseren gesellschaftlichen Entwicklungen. Literatur und Kunst können Perspektiven verändern, der Vereinzelung entgegenwirken und dem lähmenden »Weiter so« widersprechen. Zu unterschiedlichsten Anlässen reflektiert Ingo Schulze die glückhaften wie auch die problematischen Erfahrungen von 1989/90, die unsere Welt bis heute prägen. Er beleuchtet die Konsequenzen der zunehmenden Polarisierung und Radikalisierung in allen Bereichen. Er besteht auf dem Vorrang des Gemeinwohls und einer gerechten Weltinnenpolitik. Der vorliegende Band versammelt zentrale Texte dieses kritischen und selbstkritischen Denkens.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ingo Schulze wurde 1962 in Dresden geboren und lebt in Berlin. Seine Bücher, darunter »33 Augenblicke des Glücks«, »Simple Storys«, »Neue Leben«, »Adam und Evelyn«, »Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst« sowie »Die rechtschaffenen Mörder« wurden zu großen Erfolgen. Die Bände »Was wollen wir?« und »Unsere schönen neuen Kleider« versammeln Essays und Reden. Für sein Werk wurde Ingo Schulze mit zahlreichen, auch internationalen Preisen ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation
Coverabbildung: Frank Gross / Millennium Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491284-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog
Sterntalers Geschichte
Vier Versuche über die Gegenwart
Erster Versuch. Nicht nur in eigener Sache
Zweiter Versuch. Schaffen wir das? Ein Dialog
Dritter Versuch. Eine ungeschriebene Geschichte
Vierter Versuch. Über die Unsichtbarkeit des Wirklichen. Noch ein Dialog
I Über Literatur
»… Der gefrorene Schnee knirschte unter den Sommerschuhen.«
Sich nicht zum Feind machen lassen.
Eine Welt, erschaffen aus bodenloser Sprache.
Wenn wir nicht singen, singen andere.
»Ein Interesse an der erhaltung auch nur eines Teils dieser grossstädtischen Bevölkerung besteht unsererseits nicht.«
Pietisten und Piraten oder: jeder trägt sein eigenes Licht, sein eigenes, einsames Licht.
Vom Einverständnis mit dem Teufelspakt.
II Vier Reden
Können wir uns eine öffentliche Meinung leisten?
Wie lang hält Sie durch?
Fünfzig durch zwei. 25 Jahre davor und 25 Jahre danach.
»Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte …« oder wer ist wir?
III Sprachglossen und Betrachtungen
Sprachglossen
Abwrackprämie
Ankommen
Arbeitgeber/Arbeitnehmer
Finanzwirtschaft/Realwirtschaft
Endlager
Intensität – intensiv – intensivieren
Kaugummi kauen mit geschlossenem Mund. Sächsisch und Hochdeutsch
Systemrelevant
Behelmt in der Universität
Unruhige Balance
Endlich wieder Verbote!
Anmerkungen zu Martin Luthers These 90
Ein Schwede in Stockholm
IV Nicht nur Politisches
Gegen die Ausplünderung der Gesellschaft
Du Portugiese! Ich Deutscher! Fertig!
Der blinde Fleck.
Charkiw in Europa
Rede vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 5. Oktober 2020
Wo bleibt der Gegenentwurf?
Dreissig Jahre danach
1989. Kapitel
1990. Kapitel
Epochenende
Epilog
Fast ein Märchen
Nachtrag 2021
Nachweise
Prolog
Sterntalers Geschichte
Sterntaler kann all die Taler gar nicht mehr in ihrem Herrgottskleidchen auffangen, die da vom Himmel regnen. Der Talersegen will und will einfach kein Ende nehmen. Am nächsten Morgen bringt Sterntaler so viele Taler, wie sie in ihrem Kleid zu tragen vermag, aus dem Wald. Da begegnet ihr ein Kind. Du hast mir dein schäbiges Kleidchen gegeben und besitzt selbst ein feines aus Linnen und hast so viele blanke Taler darinnen, gib sie mir! Sterntaler gibt sie ihm, geht zurück in den Wald und nimmt sich wieder von den Talern. Da begegnet ihr das zweite Kind. Du hast mir dein Röcklein geschenkt, aber ich bin krank, jetzt gib mir auch Taler! Und Sterntaler gibt sie ihm, kehrt um und kommt wieder, das linnene Kleid voller Taler. Da steht das dritte Kind da. Und so weiter und so fort. Der alte Mann, der immer Hunger hat, sagt: Ach, gib mir etwas zu essen. Da aber Sterntaler kein Brot hat, gibt sie ihm all ihre Taler und sagt: Gott segne dir’s! Sie rennt zurück in den Wald, schaufelt mit ihren Händchen Taler ins Kleid und gelangt endlich bis in die Stadt. Aber wie staunt Sterntaler, als der Vermieter den Preis für ihre alte Kammer nennt. Für alle Taler im linnenen Kleid kann sie sich kaum ihre alte Kammer leisten. Denn alle Welt, so etwas spricht sich schnell herum, holt sich Taler aus dem Wald, so dass die Taler wie Pfennige sind und das linnene Herrgottskleidchen das Wertvollste ist, was Sterntaler besitzt. Aber auch das zerreißt man ihr, denn Sterntaler gilt als die Schuldige, die all das viele Geld unter die Menschen gebracht hat. Vor Schmerz und Empörung kann Sterntaler nicht einschlafen, obwohl sie am Ende ihrer Kräfte und hundemüde ist. Sie setzt sich hinunter in die Küche zu der alten Magd. Sterntaler erzählt ihr von einem Waisenkind, das der liebe Gott mit vielen Talern und einem linnenen Kleidchen belohnt, weil es alles verschenkt hat, was es auf dem Leib getragen hatte. Darüber muss die Magd weinen, so schön ist diese Geschichte. Doch auf einmal, noch während sie darauf wartet, dass die alte Magd sich beruhigt, ist Sterntaler auf der Ofenbank eingeschlafen. Als sie wieder erwacht, kennt die ganze Welt ihre halbe Geschichte, die sie für die ganze hält, was Sterntaler verwundert, ja empört – die Leute müssten es doch besser wissen! Bald aber gibt Sterntaler Ruh. Denn auch in ihrem ganz persönlichen Interesse, das hat sie endlich begriffen, ist es so, wie es ist, einfach am besten.
(2017)
Vier Versuche über die Gegenwart
Erster Versuch. Nicht nur in eigener Sache
Am 20. Februar 2013, einem Mittwoch, erhielt ich über meinen Verlag das Angebot, bis Freitag 9.30 Uhr einen Text für die Wirtschaftsseiten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu schreiben, und zwar für die Rubrik »Pro & Contra«. Die Redakteurin erläuterte: »Hasso Plattner, Mitbegründer von SAP, will die Hälfte seines Vermögens von 5,4 Milliarden Euro stiften (wofür genau, ist noch nicht ganz klar, auf jeden Fall für wohltätige Zwecke, was ja sehr viel sein kann). Jetzt würden wir gerne ein Pro & Contra zur Frage machen, ob das eine gute Sache ist. Wir würden vermuten, dass Herr Schulze eher auf der Contra-Seite ist und so argumentiert, dass der Staat sich um Wohltätiges kümmern sollte und Herr Plattner dann im Zweifelsfall höher besteuert werden sollte. Wir würden ihn gerne dafür gewinnen, das Contra für uns zu schreiben.«
Für schnell zu schreibende Texte bin ich nicht besonders geeignet. Was mich aber grämte, war die Zuordnung – wenn auch nur als Vermutung. »Bin ich so einfach auszurechnen?«, fragte ich mich in gekränkter Eitelkeit. Vor allem aber wollte ich nicht den Gegenkasper spielen, der, wenn man ihm den Einsatz gibt, sein »Contra« singt. Ich lehnte ab. Die Redaktion blieb hartnäckig und bat den Verlag, mich zu überreden, man sei eben gerade an mir interessiert, die Argumente habe ich doch im Kopf, der Text sei nicht lang, und ich wäre mit Foto in der Zeitung.
Ich blieb standhaft, und der Verlag sagte erneut ab. Kaum war das getan, ärgerte ich mich über meine Standhaftigkeit. Hätte ich nicht wenigstens darum bitten können, das »Pro« übernehmen zu dürfen? Und hatte mich nicht Mitte Januar dieses Jahres der Leiter der Wirtschafts- und Finanzredaktion Rainer Hank auf eben diesen Seiten in dem Artikel »Geld stinkt nicht« zitiert und kritisch bedacht? Beim Lesen seines Artikels hatte ich anfangs geglaubt, hier schreibe einer eine Parodie, weil er all jene, die Kritik am heutigen »Ökonomismus« übten, zu Romantikern machte, die die Vergangenheit antikapitalistisch verklärten. Sinngemäß ersetzte der Artikel die Aufforderung »Dann geh doch in die Zone!« durch »Er will zurück in die DDR / bessere Vergangenheit«. Aber wie ich beim Weiterlesen merkte, war es Rainer Hank ernst damit. Gern hätte ich erwidert: Statt irgendwohin zurückzuwollen, wolle ich heute Geld verdienen. Doch müsse man ja nur den jüngsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung lesen, um zu sehen, was in diesem Land schieflaufe. Und das hindere immer mehr Menschen, genug Geld für ein würdiges Leben zu verdienen, und anderswo in der Welt … Und nun hatte ich mir die Möglichkeit, darauf zu antworten, durch die Lappen gehen lassen!
Kleinlaut rief ich den Verlag an, ob ich nicht doch … Kurz darauf kam die Antwort. »Ja, schreib!«
Freitagfrüh 9.30 Uhr schickte ich 4.505 Zeichen folgenden Inhalts an die Redaktion:
Es tut mir leid, selbst wenn es mich mein Honorar kostet – heute fällt das Contra aus. Vor dieser Geste verstummt jede Kritik. Was soll man denn anderes sagen als: Danke! Selbst wenn man es zweimal sagt oder dreimal – was ist schon ein: Danke! angesichts dieser Atombombe des Guten!
So, mit diesen Sätzen wollte ich beginnen. Meine Begeisterung war ehrlich! Ich versuchte weiterzuschreiben, ich dachte weiter und – erschrak! Plötzlich war mir klar: Was für ein Wahnsinn! Was tut dieser Mann da? Sieht er nicht die Konsequenzen? »Eigentum verpflichtet.« So steht es im Grundgesetz. Aber dort steht auch: »Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.« Und deshalb sage ich es ganz deutlich: Etwas Schlimmeres hätte uns nicht widerfahren können – uns als Allgemeinheit und uns als Einzelnen, den Spender eingeschlossen.
Zunächst einmal: Sein Geld liegt ja nicht in Bündeln von 500-Euro-Scheinen im Tresor, es ist angelegt, das Geld arbeitet! Er hat das Beste gemacht, was man mit Geld machen kann, er hat investiert. Gibt es einen größeren Dienst an der Allgemeinheit? Und selbst wenn ein Teil des Geldes in Fonds oder Finanzprodukten steckt – auch spekulieren bedeutet investieren! Die Welt ist gar nicht so schlecht eingerichtet, wie uns viele glauben machen wollen. Man muss sich nur an die Spielregeln halten. Aber genau das tut er nicht! Ganz gleich, woher das Geld kommt, er entzieht es sinnvollen Anlagen! Wer denkt an die, die dadurch ihre Existenz verlieren? An die, deren Aktien einen Kurssturz erleben? Seine Verteidiger sagen jetzt: Solange es keine gerechteren Gesetze gibt, bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als zu spenden. Oder: Besser er spendet, bevor jemand auf die Idee kommt, die Gesetze zu ändern. Worüber reden die da?!
Grundsätzlich gesprochen: So eine Spende demotiviert mich als Leistungsträger. Ich fühle mich da ganz persönlich betroffen. Erfolg drückt sich doch nicht erst seit heute in Geld aus. Selbst den Persönlichkeiten der Zeitgeschichte ist ihre Villa im Grunewald der eigentliche Maßstab ihres Erfolges. Wenn ich mich mit einer Milliarde genauso gut fühle wie mit drei Milliarden oder mit sechs Milliarden, was soll dann die ganze Schufterei? Ist nun auch der letzte verbliebene Maßstab passé? Wohlgemerkt: Es geht ums Prinzip! Es geht ums System!
Die persönliche Kränkung ließe sich verschmerzen. Nicht aber die Schlussfolgerung, dass ich ja dann gleich jeden Durchschnittsheini meiner Firma am Gewinn beteiligen kann. Und den Stundenlohn der Reinigungskräfte hebe ich auch noch um drei Euro an und stelle sie ein und packe ihnen eine Betriebsrente oben drauf – ich dachte, das hätten wir hinter uns! Wie soll ich denn höchste Effizienz und maximalen Einsatz in allen Bereichen bei Senkung der Personalkosten verlangen, um dann – »Ja, wofür denn?« Damit ich Milliarden verschenke? Wer den persönlichen Gewinn nicht in Ehren hält, öffnet sozialistischen Methoden Tür und Tor! Für die Philosophie unserer Unternehmen wie für die Arbeitsmoral ist der Schaden noch gar nicht absehbar.
Die zielführende Anregung von Peter Sloterdijk, an die Stelle der Steuern Spenden zu setzen, hat Hasso Plattner gründlich missverstanden. Es ging doch gerade darum, der irrsinnigen Steuerlast in Deutschland ein maßvolles selbstbestimmtes System entgegenzusetzen.
Wissen Sie, was passieren wird? Man wird Hasso Plattner Selbstzweifel unterstellen, schlimmer: ein schlechtes Gewissen. Denn die Spende erweckt den Verdacht, wir seien für das Elend der Welt verantwortlich. Und dieses Elend, darauf können Sie sich verlassen, wird jetzt aus allen Löchern kriechen, und dort, wo es nicht von sich aus gekrochen kommt, werden es die Zeitungsschreiber hervorzerren. Sie werden die Rechnung aufmachen: Wie viele Menschen (die dreisteren sprechen gleich von »Kindern«) können mit diesem Geld vor dem Hungertod, vor dem Verdursten, vor Malaria, vor Aids, vor was weiß ich was gerettet werden. Und dann werden sie weiterfragen: Warum erst jetzt, und warum nur die Hälfte des Vermögens? Ist es nicht unmenschlich, ja kriminell, keine Hilfe zu leisten? Und sie werden erst Ruhe geben, bis er sagt: Ich habe nichts mehr! So wird es kommen, lieber Hasso Plattner. Doch wenn Sie partout spenden wollen: Dann zu niemandem ein Wort! Übernehmen Sie klammheimlich die Mehrkosten von Stuttgart 21 oder einen Teil davon. So käme das Geld lautlos aus der Welt und zurück in die Wirtschaft und störte nicht weiter. Bitte, überlegen Sie es sich noch einmal!
Den ganzen Tag über wartete ich wie immer, wenn ich einen Text abgegeben habe (und ohne es mir einzugestehen), auf eine enthusiastische Reaktion, eine E-Mail oder besser noch auf einen Anruf. Gegen 16.00 Uhr rief dann tatsächlich die Redakteurin an. Ob ich meinen Artikel nicht umschreiben könne, so sei er sicherlich für viele Leser missverständlich. Ihr fiel es schwer, ihr Unbehagen zu artikulieren (das ist doch nicht Ihre wirkliche Meinung!), mir fiel es schwer, auszudrücken, warum ich es nur so und nicht anders hatte schreiben können (da steckt natürlich meine Meinung drin!). Wir vertagten uns.
Ich schrieb eine E-Mail, denn die Veröffentlichung eines Artikels durchzusetzen ist ja Teil der Arbeit. »Es gibt wirklich keinen besseren Ort für diesen Text als Ihre Seiten. Es ist Kritik (oder Contra) durch Affirmation. Das habe ich ja (leider) nicht erfunden. Meine Position kommt schon sehr deutlich heraus, aber eher dadurch, dass ich die Argumente der Gegenseite zuspitze. Das ist ja keine ironische Frage, ob ich mich mit einer Milliarde genauso gut fühle wie mit drei oder sechs Milliarden. Es ist doch absurd, dass Einzelne so viel Geld anhäufen können. Die Geste/Tat von Plattner reißt etwas auf, über das hier nur sehr selten und wenn, dann in marginalisierten Formaten gesprochen wird. Ihre Einladung war für mich (auf den zweiten Blick) so eine Chance.«
Die Redakteurin schrieb zurück, sie glaube, dass für mich meine eigene Position schon zu selbstverständlich geworden sei, für ihre Leser aber sei diese relativ neu und fremd. Die müssten erst mal verstehen, wie ich denke, bevor sie darüber nachdenken könnten. Und das würden wir doch wollen, dass sie nachdenken, oder? Da brauche man es klar, fände sie. Und weiter: Es sei schade, dass das für mich so wenig reizvoll gewesen sei, auch wenn sie verstehe, dass das intellektuell vielleicht nicht so reizvoll sei wie die Übertreibung der Gegenthese.
Hatte ich schlecht argumentiert? Der ganze Effektivitätswahn wie der technologische Fortschritt dient eben nicht der ganzen Menschheit, nicht mal der ganzen Bevölkerung dieses Landes. Auch hierzulande werden Einzelne unvorstellbar reich, während sieben Millionen Menschen von ihrem »fulltime job« nicht mehr leben können, von den Arbeitslosen ganz zu schweigen. Die Selbstverständlichkeiten dieses Systems sind absurd. Hätte ich das kritisieren sollen? Mir schien es besser, das vorzuführen.
Ich fragte die Redakteurin: »Ist das jetzt eine Absage? Oder eine Überlegung?« Die Antwort: »Wir überlegen noch …«
Am Sonnabend kam dann die Absage. Mein Text sei schlicht und einfach für ihre Leser zu kompliziert, ich hole sie nicht da ab, wo sie stehen. Diese Ansicht der Redakteurin teile ich nicht. Und dieses »Abholen« ist mir als Gedanke mehr als suspekt, selbst wenn ich alle weiteren Konnotationen dieses bedrohlichen Wortes vergesse. Aber vielleicht hat die Redakteurin ja recht. Vielleicht hat sie wirklich recht, und ich hätte ganz anders schreiben sollen, ein Contra mit allen Zahlen und Fakten und mir das Herz aufreißen. Eben eindeutig, in den Grenzen des Spielfeldes. Ich hätte alles schreiben können, was mir durch den Kopf geht. Ein nicht zu unterschätzendes Privileg! Dafür gibt es ja dieses Format. Innerhalb des Formats ist (fast) alles möglich. So sind die Spielregeln. Was aber ist es nur, das sich in mir dagegen derart sträubt?
(2013)
Zweiter Versuch. Schaffen wir das? Ein Dialog
»Komm«, sagte er, »lass uns das Thema wechseln. Ich will mich nicht streiten. Nicht auch noch mit dir – jedenfalls nicht jetzt!«
»Und stattdessen?«, erwiderte sie. »Soll ich dir was Gruseliges aus meiner Kindheit erzählen?«
»Du weißt doch, was ich meine … Ich finde es eine Zumutung. Jetzt soll ich diejenigen verteidigen, die seit Jahr und Tag das Falsche tun, nur weil sie seit September vergleichsweise menschlich handeln?«
»Du meinst Merkel?«
»Sie ist doch mitschuldig an diesem ganzen Dilemma. Wenn sie …«
»Jetzt fängst du auch schon so an! Ohne sie …«
»Lass mich ausreden! Hätte sie nicht mal sagen können, tut mir leid, damals, einen Tag vor Beginn des Irakkrieges, da habe ich es dummerweise noch bedauert, dass sich Deutschland nicht an der ›Drohkulisse‹ beteiligt. Der Westen bekämpft mal wieder das, was er selbst angefacht hat. Oder: Es tut mir leid, dass ich keine Zeitung gelesen habe und mir niemand gesagt hat, dass es in den Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon, in der Türkei seit Jahren unhaltbare Zustände gibt. Wer dort vegetieren muss, kann ja gar nichts anderes mehr denken, als sich möglichst schnell auf den Weg nach Europa zu machen.«
»›Nach Deutschland‹ müsstest du fairerweise sagen.«
»Jedenfalls irgendwohin, wo sie leben können.«
»Dann musst du aber auch sagen, dass Deutschland eben nicht Teil der ›Koalition der Willigen‹ gewesen ist, sich in Libyen zurückgehalten hat und dass wir jetzt eine Verantwortung übernehmen, vor der sich all diejenigen drücken, die da kräftig mitgemischt haben und gegenwärtig kräftig mitmischen, die USA, die Golfstaaten, Großbritannien, die Franzosen, der Iran und letztlich auch die Russen. Kein Grund, allein auf die kleineren osteuropäischen Staaten zu zeigen oder gar auf Deutschland.«
»Ich wusste, dass wir uns streiten würden! Es reicht nicht, allein vom Standpunkt menschlicher Hilfe und dem Recht auf Asyl zu argumentieren. Du musst, tut mir leid, über Kolonialpolitik sprechen, du musst darüber reden, dass die CIA und der MI6 Mossadegh, den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten des Iran, 1953 gestürzt und den Schah installiert haben. Ohne Schah kein Chomeini! Mit Chomeini kam der islamistische Extremismus. Dann Afghanistan, die militärischen Aktivitäten der USA vor – ich betone: vor – der Invasion der Sowjetunion, was jene nicht rechtfertigt …«
»Und jetzt kommt gleich wieder das Interview von Zbigniew Brzeziński aus dem Nouvel Observateur von 1999, habe ich recht?«
»Man muss es immer wieder sagen: Ein Interview, in dem Brzeziński, der ehemalige Sicherheitsberater von Präsident Carter, davon erzählt, dass er seinem Präsidenten Anfang 1979 dazu gratuliert, militärische Aktionen in Afghanistan angeordnet zu haben, die den Einmarsch der Russen zur Folge haben würden. Was gibt’s da zu lächeln?«
»Ich habe das schon so oft von dir gehört, dass ich es singen kann.«
»Ich wäre ja froh, wenn’s auch mal ein anderer sagte! Die Russen, resümiert Zbigniew Brzeziński 1999, sind in unsere Falle gegangen. Da gibt es nichts zu bereuen. Und das sagt er, als die Taliban schon an der Macht sind.«
»Und Bin Laden als Kreatur der CIA. Und wie sie auch Saddam Hussein unterstützt haben, weil es gegen den Iran ging, aber auch dem Iran Waffen verkauften …«
»Die verheerende Sanktionspolitik gegenüber dem Irak in den neunziger Jahren, die Hunderttausende, vor allem Kinder und Alte, mit dem Leben bezahlt haben. Die Erinnerung daran, wenn’s denn überhaupt je im Bewusstsein gewesen ist, wird gelöscht oder ausgeblendet! Es ist so viel, was der Westen eingestehen müsste, um dann zu sagen: Wir hängen da ursächlich mit drinnen, wir tragen Verantwortung dafür, was in Afghanistan, im Iran, in Syrien, im Irak, in Libyen etc. geschieht.«
»Ich würde eher von Mitverantwortung sprechen.«
»Verantwortung ist auch immer Mitverantwortung.«
»Wer dich hört, könnte denken, ohne die Kriege wäre alles in Butter. Die eigentliche Frage ist doch, wieso kommen sie alle erst jetzt? Denn so, wie die Welt eingerichtet ist, muss sich doch niemand darüber wundern, dass Menschen gen Norden und Westen flüchten.«
»Jetzt kommen die falschen EU-Agrarsubventionen …«
»Es sind täglich eine Milliarde Dollar, die die USA und die EU für Agrarsubventionen ausgeben, von der Abschottung unserer Märkte mal ganz zu schweigen …«
»Über die Fischfangflotten vor den afrikanischen Küsten, die Erdölfirmen, die Rohstoffe aus den Händen der Marodeure etc. etc., also über die verschiedenen Erscheinungsformen des Neokolonialismus …«
»… in dem ich und du, in dem wir alle tagtäglich mit drinhängen. Das ist doch das eigentliche Problem. Wir sind das Problem!«
»Na ja, ich habe diese Schiffe nicht losgeschickt …«
»Aber du kaufst ihren Fisch … Versuche nur mal, eine Woche einkaufen zu gehen, ohne eine Schweinerei zu begehen. Und was besonders pervers daran ist: Wer mehr Geld hat als der Durchschnitt, schafft das eher.«
»Das ist eine Ausrede.«
»Wenn du gerade so über die Runden kommst, kaufst du nicht im Bioladen ein.«
»Das hieße, ich müsste mich zwischen einem guten Leben entscheiden und dem Luxus, über die Welt nachzudenken. Denn wenn ich nachdenke, statt zu verdrängen, und dementsprechend handle, habe ich kein gutes Leben mehr?«
»Das klingt mir jetzt zu kokett. Ich mag keine Radikalismen. Es geht darum, beides zu vereinen. Zu einem guten Leben gehört das Nachdenken und Handeln dazu. Andernfalls bliebe dir nur Verdrängung und Zynismus.«
»Und den anderen Elend, Durst, Hunger, Krankheit, Gewalt, Obdachlosigkeit, Sinnlosigkeit …«
»Und weil wir das jetzt alles so benannt haben, was noch niemand wusste, wirst du als Experte zur Klausurtagung der Regierungskoalition nach Dresden eingeladen. Und die fragen dich dann: Gut und schön, alles richtig, was Sie da sagen, aber was machen wir jetzt mit den Flüchtlingen?«
»Du meinst, die würden tatsächlich sagen, ›gut und schön, alles richtig‹?«
»Nur mal angenommen, es wäre so, was dann?«
»Dann würde ich es ihnen sagen.«
»Ja, aber was?«
»Dass sie Glück haben, gerade in dieser Zeit Politiker zu sein, weil sie jetzt notwendige grundlegende Veränderungen bewirken können.«
»Und die wären?«
»Ich würde zuerst von dem Unbehagen sprechen, das ich bei dem Satz des Jahres verspürte, aber mein Unbehagen nicht formulieren konnte.«
»Du meinst: ›Wir schaffen das!‹«
»Ja! Einerseits klang der nicht unsympathisch. Andererseits …«
»Fehlte dir das ›Wie‹?«
»Nein, nein, das meine ich nicht! ›Wir schaffen das‹ – diese drei Worte klingen so nach einer rechtschaffenen Erzählung: Wir krempeln die Ärmel hoch, wir hauen uns so richtig in die Arbeit, wir erledigen die uns gestellte Aufgabe.«
»Was soll daran falsch sein?«
»›Wir schaffen das‹ suggeriert aber auch: Wenn wir das geschafft haben, ist Feierabend, Wochenende, nächstes Jahr dann wieder Urlaub wie eh und je. Und das ist das irreführende Versprechen daran. Das ist der Unterschied zwischen einer gut gemeinten Erzählung und einer guten Erzählung. ›Wir schaffen das‹ ist eine gut gemeinte Erzählung, aber eben keine wirklich gute, weil sie die Widersprüche nicht enthält.«
»Es geht hier aber nicht um den Unterschied von Kitsch und Literatur. Es geht darum, die Bevölkerung aufzurufen und anzuspornen – anders ginge es ja gar nicht.«
»Die Bevölkerung war den Parteien und der Regierung weit voraus.«
»Du meinst, weil kein Feierabend oder gar Urlaub in Sicht ist wie indirekt versprochen, bekommen selbst diejenigen, die im September auf einmal sagten ›Die Merkel wird mir noch sympathisch‹, jetzt weiche Knie und gehen von der Fahne?«
»Ja. Gerade wegen dieser Abtrünnigen möchte ich sie eigentlich unterstützen, auch wenn sie viel zu spät reagiert hat, auch wenn sie mit Griechenland …«
»Gut, das mal beiseite.«
»Ich will nicht unter dem Wimpel kämpfen: ›Das schaffen wir!‹, das ist zu wenig, das reicht nicht.«
»Sondern?«
»Wir tun immer noch so, als hätten wir eine Wahl, als stünde es uns frei, diese Aufgabe zu übernehmen oder nicht, als sei das eine Bewerbung um die Olympiade oder das Management einer Großbaustelle.«
»Ja, aber was würdest du sagen?«
»Das passt nicht in einen Satz.«
»Dann eben zwei.«
»Wir können kein gutes Leben führen, wenn vor oder auf unserer Schwelle die blanke Not herrscht und gestorben wird. Wir haben nicht nur die menschliche Schuldigkeit und die gesetzliche Pflicht zu helfen, wir tragen als Europäer auch Mitverantwortung für die Zustände in dieser Welt. Spätestens jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir handeln müssen.«
»Ja, richtig, aber der Merkel-Satz zündet mehr.«
»Wie eine Jahrmarktsrakete.«
»Nein, der Vergleich ist nicht fair.«
»Dann sag du mir einen Satz, in dem enthalten ist, dass wir Mitverantwortung tragen, dass wir gar keine Wahl haben und gar nicht anders können, wenn wir nicht alles aufgeben wollen, was uns lieb und …«
»Unsere Werte also …«
»… lieb und teuer ist und eben nichts, was im Sommer oder im nächsten Jahr oder in ein paar Jahren vorüber sein wird. Wir können nicht so weitermachen wie bisher.«
»Du meinst, wir müssen uns neu erfinden.«
»Modischer Slang. Ich hätte gesagt: Wir haben jetzt die Chance, uns zu ändern. Jeder für sich und wir als Gesellschaft. – Warum lachst du?«
»Das hat doch keine Chance! Denk an Griechenland, wie sie sich da verhalten haben. Die Risiken der Banken und Spekulanten auf das Gemeinwesen umschulden und dann den Hauslehrer mit Prügelstrafe geben. Schlimmer geht’s doch nicht!«
»Aber jetzt bin ich zur Klausurtagung der Regierung eingeladen. Und da sage ich, dass wir am Ende nur die Wahl haben, es als Chance zur Veränderung zu begreifen …«
»Was heißt: Chance zur Veränderung?«
»Wenn wir die eigene Gesellschaft sozial gerechter machten, wären wir auch in der Lage, sie international gerechter zu machen.«
»Steile These. Das würde heißen, wir müssten uns ändern, damit wir verändern können?«
»Für all diejenigen, die gerade so über die Runden kommen, muss es doch höhnisch klingen, wenn sie gesagt bekommen, Deutschland ist reich, wir schaffen das. Die soziale und ökonomische Polarisierung im eigenen Land entspricht jener in der Welt, das lässt sich nicht getrennt verhandeln.«
»Und wenn wir uns, wie du sagst, nicht ändern, was dann?«
»Dann geben wir Almosen, bis endlich mal Feierabend ist.«
»Aber Feierabend gibt’s nur in unserer Vorstellung.«
»Ja. Selbst wenn morgen das Leben in Syrien friedlich und lebenswert wäre, der IS verschwunden und in Saudi-Arabien und im Iran die Trennung von Politik und Religion vollzogen wäre – das wäre ein Glück, das wäre wunderbar, aber am eigentlichen Problem hätte sich noch nichts geändert!«
»Aber darf ich dich fragen: Hat denn irgendein deutscher Politiker bisher gesagt: Wenn wir mit der Ungleichheit in der Welt fertigwerden wollen, müssen wir unser Leben, unsere Politik, unsere Gesellschaft ändern? Bestenfalls freut man sich auf junge Arbeitskräfte für unsere überalterte Gesellschaft und hofft auf etwas mehr Buntheit und einen friedfertigen Islam. Als Kollege Grönemeyer eine Reichensteuer forderte, die den Flüchtlingen zugutekommen sollte, sind sie über ihn hergefallen. Nicht mal eine kleine Steuer ist möglich! Oder dass eine deutsche Regierung erklärt: Ja, das war Völkermord an den Herero und Nama, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutsch-Südwestafrika geschehen ist, wir tragen die Konsequenzen.«[1]
»Lass es mich noch mal anders sagen: Ganz gleich, welche Entscheidungen in den nächsten Wochen getroffen werden, es ist nicht gleichgültig, aus welcher Haltung heraus man das tut.«
»Jetzt wirst du aber plötzlich sehr defensiv.«
»Wie du dich selbst siehst und einschätzt und wie du dein Gegenüber siehst und einschätzt, so verhältst du dich auch. Wir müssen also über uns reden, wer wir sein wollen, und darüber, in welcher Beziehung wir zu den anderen stehen.«
»Du meinst: Sehen wir uns als jemand, der Almosen verteilt, oder sind wir jemand, der mit anderen teilt, nicht nur aufgrund der eigenen Werte, sondern weil es unerlässlich ist und wir als Europäer viel, sehr viel gutzumachen haben?«
»So könnte man es sagen.«
»Ist das nicht, zugespitzt formuliert, eine Haltung zwischen Zynismus und Selbstaufgabe?«
»Nein, der Zynismus wäre die Selbstaufgabe.«
»Das sehen aber die Verteidiger unserer abendländischen Werte anders.«
»Aber nur, weil sie so tun, als wären diese Werte etwas, das zu Hause im Safe liegt, und sie sind die Hilfssheriffs, die den Safe bewachen. Werte drücken sich aber nur in Handlungen aus, anders gibt es sie nicht. Das ist wie mit den Gedanken. Ein Gedanke wird erst zum Gedanken, wenn er formuliert wird, wenn er ausgesprochen oder niedergeschrieben wird. Ein Wert ist kein Wert, wenn er im Alltag keine Rolle spielt.«
»Mit anderen Worten: Werte zu praktizieren ist die einzige Möglichkeit, sie zu verteidigen.«
»Das wäre immerhin ein Satz für die Klausurtagung.«
»Falls wir eingeladen werden …«
(2015)
Dritter Versuch. Eine ungeschriebene Geschichte
Im Frühjahr 2010 war ich zu Lesungen in Izmir und Muğla in der Türkei eingeladen. Schon als Schüler hatte mich das antike Ionien fasziniert, der westliche Küstenstreifen Kleinasiens, wo »unsere« Philosophie und »unsere« Literatur entstanden waren, wo Ost und West aufeinandertrafen, wo Ost und West miteinander handelten und einander bekämpften und sich ineinander verliebten. Ich sah weder Troja noch Pergamon, aber ich sah Ephesos und den Tempel des Apollon in Didyma, auch ein antikes Theater abseits der Straße, von dem nur ein paar Steinstufen zutage lagen, alles andere blieb unter der Erde verborgen, bewacht von Kühen. Die Endstation der kleinen Reise war Bodrum, das antike Halikarnassos, das sich heute als das Saint Tropez der Türkei anpreist. Ich war mit C., die für das Goethe-Institut unsere Reise mit organisiert hatte, von Muğla aus vorausgefahren, da sie am nächsten Morgen mit der Fähre nach Kos wollte. Zu sehen war Kos, die Insel des Asklepios, nicht, jedenfalls nicht an jenem Tag. Würde man aber der Landzunge, die sich nördlich von Bodrum ins Meer erstreckt, folgen, sollte Kos zu sehen sein. Am Kartenschalter der Fähre standen vor uns zwei Männer und eine junge attraktive Frau. Die beiden Männer radebrechten mit der Frau auf Englisch. Ich weiß nicht mehr, ob es ihr Akzent war, der mich darauf brachte, dass sie russischsprachig sein müsse, oder ob sie tatsächlich ein paar russische Worte wechselten. Die Männer redeten untereinander türkisch. Plötzlich stieß mich C. an und lenkte mit einer Kopfbewegung meinen Blick auf die Fahrkarten, die einer der Männer gerade bezahlte und an sich nahm. Was sollte ich denn sehen? »Dreimal Hinfahrt, zweimal Rückfahrt. Die liefern die Frau nach Kos«, sagte C. »Furchtbar!«
Ich fand C.s Deutung ziemlich gewagt. Sie erklärte mir, dass dies ein beliebter Weg gen Westen sei, denn in die Türkei kämen russische Staatsbürger ohne Visa, und von hier hinüber in die EU, also auf eine der Inseln, sei keine Schwierigkeit. Sie erzählte von einem befreundeten Ehepaar, das eine junge Russin aufgenommen hätte. Die sollte von Bodrum über Kos in die EU geschleust werden. Man hatte ihr eine gute Arbeit versprochen, am Ende ging es um Prostitution. Sie war ihren Schleusern entkommen, saß aber jetzt voller Angst auf Kos fest. Nicht mal das Haus traue sie sich zu verlassen. Wenn ich mitkäme, könnte ich vielleicht sogar mit ihr sprechen.
Am nächsten Morgen brachte ich C. zur Fähre. Die beiden Männer und die Russin sah ich nicht.
Abends, die anderen waren nachgekommen, gingen wir essen. Wir waren eine kleine Gruppe. Obwohl Restaurant an Restaurant grenzte und Tische und Stühle die Straße bis auf einen schmalen freien Streifen okkupiert hatten, brauchte es eine Weile, bis sich ein freier Tisch für uns fand.
Mitten im Essen fragte mich plötzlich meine Kollegin Katja, was das denn da oben für Rauch sei, und deutete auf die Dachgaube des Hauses, vor dem wir saßen. »Das ist doch noch nicht die Küche!« Sie hielt einen der vorbeieilenden Kellner an und machte ihn auf den Rauch aufmerksam. Der nickte, erkundigte sich bei uns, ob alles in Ordnung sei und ob es uns munde, und verschwand im Eilschritt mit Stapeln benutzter Teller. Wir aßen weiter und sahen auf den Rauch, der stärker zu werden schien. Wir standen auf und gingen ins Restaurant und konnten uns dank unseres Übersetzers verständlich machen. Als wir wieder herauskamen, glaubten wir, Flammen hinter der Scheibe zu sehen. Mittlerweile hatten auch die anderen Tische um uns herum bemerkt, dass es im Dachgeschoss des einstöckigen Hauses brannte. An dem Tisch unmittelbar unter dem Fenster erhoben sich die Gäste. Zu viert trugen die Männer den schweren Tisch etwa zehn Meter weiter. Sie setzten ihn dort ab, wo bisher für die Fußgänger Platz geblieben war. Zuerst hatte ich die Gesellschaft der Tafelnden für ihre Ruhe bewundert, mit der sie eine Panik vermieden. Doch als die anderen mit ihren Stühlen nachkamen, sich an dem neuen Standort niederließen und weiteraßen, verging mir die Bewunderung. An den entfernten Tischen hatte sich nichts verändert. Sie tafelten genüsslich, und die Kellner rannten hin und her, und ich muss gestehen, ich kaute auch noch. Und über uns drang schwarzer Qualm aus dem Fenster, das keine fünfzehn Meter Luftlinie entfernt war. Ich selbst blieb untätig, nur dass ich nicht mehr saß, sondern stand. Die Feuerwehr mit ihrem rot-blauen Warnlicht kam gemächlich und eher wie zufällig herangerollt, kein Sirenengeheul, kein Tatütata. Ihretwegen mussten jetzt doch ein paar mehr Tische weggetragen werden. Und ich war froh, wenigstens dabei helfen zu können. Die Kellner eilten mit vollen Tellern heraus und mit leeren Tellern hinein. Die Feuerwehr aber schien beim Anblick des Brandes im Dach von derselben Gleichgültigkeit übermannt worden zu sein wie die Gäste des Restaurants. Einer der Feuerwehrmänner kletterte auf den Feuerwehrwagen und rüttelte an der Leiter, die obenauf lag. Als er sie endlich frei hatte, ließ er sie im nächsten Moment aus den Händen fallen, so dass sie schräg auf dem Dach des Wagens liegen blieb. Mehr Aktivitäten gab es vorerst nicht, bis ein junger Mann mit einer Haushaltsleiter aus der Restauranttür schritt. Er stellte seine Leiter unter dem Fenster, in dem es brannte, auf und kletterte selbst hinauf, bekam das Gitter eines Gaubenfensters zu fassen, hielt sich daran fest und schwang sich hinauf auf die Dachschräge. Während die Gäste bereits zu applaudieren begannen, schlug er die Scheibe ein. Katja fragte mich, ob das eine gute Idee sei, ob das nicht das Feuer nun gerade anfache. Aber in diesem Moment rutschte der Kletterheld schon wieder hinunter und ließ sich von zwei oder drei Kellnern auffangen. Erst jetzt fuhr langsam im Rückwärtsgang ein Lkw mit einem Wassertank heran, der Schlauch wurde ausgerollt, weitere Tische mussten weggetragen werden, wobei die Tafelnden sie so wieder aufstellten, dass sie das Geschehen im Blick behalten konnten. Wir zahlten und machten uns aus dem Staub. Als ich am nächsten Morgen die Straße mit den Restaurants aufsuchte, die alle noch geschlossen hatten, war an Stelle der Dachgaube ein großes schwarzes Loch. Aber darunter standen die Tische und Stühle, die, wie ich auf den zweiten Blick sah, aneinandergekettet waren.
Glauben Sie mir bitte. Wenn ich diese Szene erfunden hätte, hätte ich sie plausibler erfunden.
Ich hatte immer die Absicht, diese unterschiedlichen Erlebnisse in einer Erzählung zusammenzubringen. Die (womöglich) geschmuggelte oder verkaufte Russin, diese Apathie und diese Hilflosigkeit, die auch mich angesteckt hatten, angesichts eines Brandes. Und dies vor dem Hintergrund dieser uralten und zugleich ganz gegenwärtigen Grenze zwischen dem Osten und dem Westen, an der das alte Ionien buchstäblich aus dem Boden hervorschimmert und die europäische Literatur unter dem Namen Homer mit dem Trojanischen Krieg und der Odyssee begann.
Spätestens seit dem Sommer dieses Jahres weiß ich, dass ich diese Geschichte wohl nicht mehr schreiben werde. Die Flüchtlinge, die in Bodrum oder Kos auf Touristen treffen, die in dem Meer baden, das für die anderen Tag für Tag zum Grab wird, offenbaren den Zwiespalt unserer Welt auf eine so dramatische Art und Weise, dass mein damaliges Erlebnis dahinter verblasst. Ich käme mir vor, als würde ich nachträglich ein Menetekel installieren. Aber vielleicht war das auch nur der Anfang einer ganz anderen Geschichte.
(2015)
Vierter Versuch. Über die Unsichtbarkeit des Wirklichen. Noch ein Dialog
A: Mir fällt es immer schwerer, über etwas zu schreiben.
B: Aber schreibt man denn nicht immer über etwas?
A: So meinte ich das nicht.
B: Es ist doch ganz gleich, worum es geht, man sagt immer: Ich schreibe über Liebe und Tod, über Fußball und Flüchtlinge, über das Jetzt und Hier. Man sagt ja nicht: Ich schreibe Liebe und Tod. Nur: Ich schreibe einen Artikel, einen Roman, ein Gedicht. Wer schreibt und das Geschriebene veröffentlicht (selbst wenn ich es nur einem Menschen vorlese, ja selbst wenn ich etwas schreibe, das nur mir allein zu mehr Klarheit oder Unklarheit verhilft), schafft ein Faktum in dieser Welt.
A: Ich weiß ja, das weiß ich doch!
B: Es gibt dann eben diesen Artikel oder dieses Gedicht. Ich stolpere über einen Artikel oder ein Gedicht zwar anders, als ich über einen Baumstumpf stolpere, aber beide Arten des Stolperns wirken auf mich. Das eine wie das andere kann ich nach zehn Minuten bereits vergessen haben – oder es lenkt mein Leben in eine andere Bahn. Die Entscheidung, ob etwas wichtig ist und wie bedeutsam es ist, hängt auch vom Zusammenhang ab …
A: Das ist mir schon klar! Du musst mich nicht trösten oder aufbauen. Ich habe mich ungeschickt ausgedrückt. Ich versuche ja selbst herauszufinden, was ich mit diesem Überdruss am darüber Reden und Schreiben meine. Mal erscheint mir alles offensichtlich und überdeutlich, weil klar ist, dass es so nicht weitergeht. Sehe ich etwas anders hin, gibt es weniger Eindeutigkeit denn je. Nie ist das drin, was draufsteht. Und selbst das stimmt nicht immer.
B: Das kenne ich. Noch als Schüler las ich bei Stephan Hermlin den Satz: »Wer schreibt, muss handeln.« Das heißt, die Einsicht, die beim Schreiben entsteht, kann nicht folgenlos für meinen Alltag bleiben. Ich habe das immer abgewandelt in die Formel: Die Einsicht, die mich beim Lesen trifft, kann nicht folgenlos bleiben. Das stimmt doch heute noch genauso.
A: Ja, schon, und zugleich klingt dieser Satz wie aus einer fernen, übersichtlicheren Zeit. Ohne Verdrängung lässt sich unser heutiger Alltag weniger denn je bestehen.
B: Du meinst, dass es kaum möglich ist, eine Woche lang einkaufen zu gehen, ohne eine Schweinerei zu begehen? Und je weniger Geld jemand hat, umso schwieriger wird das?
A: Ja. Das auch. Du kannst nehmen was du willst. Du musst nachbohren, weil das meiste indirekt wirkt und unsichtbar bleibt in unserem Alltagsleben. Wir sehen nur das Smartphone oder das Hühnerei, das schöne Baumwollhemd oder den guten Kaffee.
B: Du meinst die Herstellung dieser Dinge? Du meinst, wenn wir wüssten, wie jedes unserer Produkte entsteht, wäre alles fragwürdig?
A: Es ist alles fragwürdig.
B: Aber weder du noch ich möchten unser gutes Leben aufgeben. Jedenfalls nicht grundsätzlich. Und wir möchten trotzdem nicht aufhören, über diese Welt nachzudenken.
A: Das ist erst mal ein Widerspruch, oder? Und es bleibt einer, wenn sich dadurch nichts verändert.
A: Und die Literatur? Hat die was dazu zu sagen?
A: Du meinst, sie ist viel zu harmlos?
B: Das wäre zumindest ein begründbarer Anfangsverdacht.
A: Literatur wehrt sich per se gegen alle Instrumentalisierung. Du kannst nicht sagen: Weil die Situation so unerträglich ist, schreibe ich jetzt ein Buch über Flüchtlinge, über Hunger, über Ungerechtigkeit. Das wäre lächerlich.
B: Wieso?
A: Weil es dann letztlich Werbung wird in der einen oder anderen Form. Wenn am Anfang feststeht, was am Ende rauskommen soll, brauchst du gar nicht erst anzufangen mit dem Schreiben.
B: Oder mit dem Reden.
A: Wenn das eine wie das andere keine Unternehmung mit offenem Ausgang ist, sollten wir es lassen. – Was ist?
B: »Unternehmung mit offenem Ausgang …«
A: Ja, was stört dich daran?
B: Das klingt, entschuldige, als würden wir uns auf einen gefährlichen Weg begeben, eine Flucht, als müssten wir uns Schleusern überantworten.
A: Keine schlechte Metapher!
B: Ich meine das ganz und gar nicht metaphorisch!
A: Ich habe eine Schwäche für Schleuser.
B: Weil du sie metaphorisch nimmst. Schleuser sind Kriminelle, die aus der Not flüchtender Menschen ein Geschäft machen, um es mal milde auszudrücken.
A: Ich habe einen Freund, der ist Schleuser.
B: Du kennst einen Schleuser?
A: Ja, Rick, eher ein Hobbyschleuser. Ich kenne ihn schon lange, dreißig Jahre ungefähr. Damals war er der Chef einer Bar, in der sich Abend für Abend alle trafen, die etwas auf sich hielten und sich vergnügen wollten. Sogar Militärs waren dabei, Offiziere einer im Lande nicht geliebten Armee.
B: Und wieso wurde dein Rick zum Schleuser?
A: Durch Zufall. Jemand, dem die Polizei im Nacken saß und der Rick vertraute, gab ihm zwei Visa zur Verwahrung. Rick gab diese Visa schließlich an zwei Flüchtlinge weiter, deren Leben bedroht war. Damit sie auch wirklich fliehen konnten, musste Rick sogar zum Mörder werden. Er erschoss einen hohen Offizier.
B: Er hat einen Offizier erschossen?
A: Liebe spielte dabei eine Rolle.
B: Kein Grund für mildernde Umstände.
A: Aber sein Mord an dem Offizier tat unserer Freundschaft keinen Abbruch. Im Gegenteil.
B: Spinnst du? Hast du ihn nicht angezeigt?
A: Nein. Ich – und nicht nur ich – war der Überzeugung, dass Rick alles richtig gemacht hatte. Das war sogar der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
B: