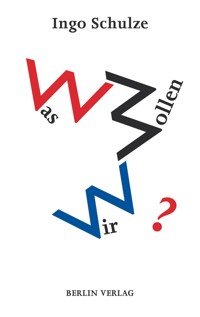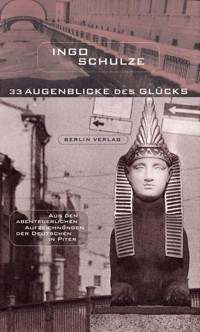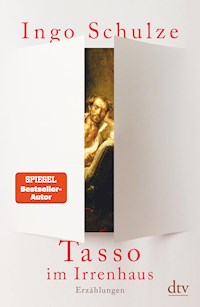
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Geschichten über die Kunst, das Leben und die verrückte bürgerliche Gesellschaft Ein Schriftsteller-Dissident flieht aus der Öffentlichkeit, um sein Leben zu retten. In der Installation ›Das Deutschlandgerät‹ findet er ein Muster, um die Gegenwart zu deuten. »Immer wenn man etwas weiß, gibt es gleich wieder etwas, das man nicht weiß.« Mit dieser Behauptung verwickelt ein Schweizer Verleger unseren Erzähler vor Delacroix' ›Tasso im Irrenhaus‹ in ein ambivalentes Gespräch, das für einen Moment seltener Klarheit sorgt. Und in einem Berliner Hospiz hält der Maler Grützke fröhlich Hof, womit er die ängstlichen Besucher überrascht und ihnen Stunden von glücklicher Intensität beschert. Die Kunst und das Leben: tragisch und komisch, abgründig und heiter. Wirft uns das eine virtuos aus der Bahn, setzt uns die andere wieder aufs Gleis. Oder ist es umgekehrt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ingo Schulze
Tasso im Irrenhaus
Drei Erzählungen
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Das Deutschlandgerät
Brief an eine Museumsdirektorin
Für Thomas Fritz
Liebe Frau ***,
es tut mir leid, dass ich Sie in die unangenehme Situation gebracht habe, mich mahnen zu müssen. Unsere Abmachung habe ich keineswegs vergessen, im Gegenteil, sie beschäftigt mich mehr, als mir lieb ist. Ich muss Ihnen sogar gestehen, vorsätzlich gehandelt, also das Niederschreiben dieser Zeilen hinausgezögert zu haben. Es waren nicht nur andere Aufgaben (oder meine Faulheit oder meine Angst, der Sache nicht gewachsen zu sein), die die Einlösung meines Versprechens hinauszögerten.
Als ich Ihren Brief das erste Mal las, also Ihre Einladung, etwas über Das Deutschlandgerät zu schreiben, war ich mir sicher, dass dies auf Anregung von B.C. geschehe. Mir fiel erst gar nicht auf, dass Sie ihn mit keinem Wort erwähnten. Als Sie mir dann am Telefon gestanden, ihn nicht persönlich, ja eigentlich nur dem Namen nach zu kennen, hegte ich sogar einen gewissen Groll gegen Sie, weil Sie nichts von Ihrem passioniertesten Museumsbesucher wussten (ein lächerlicher Vorwurf, ich weiß) und seine Bücher nicht gelesen hatten (auch das lässt sich ja niemandem vorwerfen). Anders gesagt, ich war enttäuscht, dass alles nur ein Zufall sein sollte.
Natürlich kann man es auch ganz anders sehen: Zwei kunstsinnige Menschen wie Sie und B.C., die beide in Düsseldorf leben, lieben eben auch dasselbe dort ausgestellte Kunstwerk. Ich war Ihnen zutiefst dankbar, dass Sie meiner Bitte entsprachen, den Artikel über Das Deutschlandgerät B.C. anzutragen. Erst jetzt, nach seinem Tod, habe ich manches erfahren, von dem ich mir gewünscht hätte, es bereits vorher gewusst zu haben.
Nun, da der Auftrag sozusagen an mich zurückgefallen ist, muss ich Ihnen sagen, dass ich über Das Deutschlandgerät nicht schreiben kann, ohne auch von B.C. zu berichten – und von Elzbieta Kühn (andersherum müsste ich, wollte ich von den beiden erzählen, auch von diesem Kunstwerk sprechen). Warum das so ist, will ich im Folgenden zu erklären versuchen. Sie müssen dann entscheiden, ob es für Ihre Zwecke tauglich ist oder nicht.
Ich weiß nicht, ob Sie ermessen können, welchen Rang oder, besser gesagt, welchen Status B.C. besaß, als ich zum ersten Mal von ihm hörte. Ich war sechzehn, als ich Gezeiten in die Hand bekam, geborgt für ein paar Tage von einer Mitschülerin, eingeschlagen in Zeitungspapier der Dresdner Tageszeitung Die Union. Den 1975 bei Aufbau erschienenen Band lesen zu dürfen, der ja sein einziges Buch im Osten bleiben sollte, kam einer Initiation gleich. Ja allein die Existenz dieses Buches, das offenkundig die Hürden der Zensur passiert haben musste, erschien mir ungeheuerlich, so ungeheuerlich wie Brechts Buckower Elegien, die in der Vitrine zwischen den beiden Klassenräumen für den Literaturunterricht lagen. Aufgeschlagen war ausgerechnet jene Seite mit dem Gedicht zum 17. Juni »Die Lösung«.
Damals musste man kein Leser sein, um zu wissen, wer B.C. war und dass er einige Monate im Gefängnis gesessen hatte und dass diese Haftstrafe dem, was man im Osten das »Ansehen der DDR« nannte, furchtbar geschadet hatte. Und nun durfte ich tatsächlich etwas von jenem B.C. lesen (und hätte, wäre ich in der Schule mit seinem Buch erwischt worden, nicht mal etwas Verbotenes getan, denn es war ja bei uns erschienen). Ich begriff gerade so viel davon – oder gerade so wenig –, dass die bewundernde Distanz zu seinem Namen und seinem Buch gewahrt blieb. Mache ich mich verständlich? Ich war überzeugt gewesen, die geheime Botschaft des Buches nicht entdeckt zu haben, für das Eigentliche noch nicht reif zu sein. Mir blieb vor allem sein Tonfall in Erinnerung. Ich war im Grunde sogar enttäuscht, weil von dem Staatssicherheitsmann so selbstverständlich gesprochen wurde wie von allen anderen Figuren, er war überhaupt nicht kritischer dargestellt. Das schob ich natürlich auf die Zensur. Trotzdem hatte in meinen Augen jemand, der ein Buch wie Gezeiten schreibt, sich nicht den Mund verbieten lässt, der ins Gefängnis geworfen wird, der sich weigert, die DDR zu verlassen, und gegen seinen Willen in den Westen abgeschoben wird, wo er nun endlich und verdientermaßen als Schriftstellerdissident gefeiert wird, alles richtig gemacht. Auch ich würde mich dereinst so aufrecht und untadelig verhalten, wenn ich nur erst mal ein Buch wie Gezeiten zu Wege gebracht haben würde.
Im Juli 1996 begegnete ich B.C. zum ersten Mal persönlich. Wir sollten in der Akademie der Künste in Berlin die sogenannten »Sommerlesungen« eröffnen. Ich, der Debütant vom letzten Herbst, war als Lückenbüßer erst ein paar Tage zuvor eingeladen worden und saß nun plötzlich neben B.C. und einem dritten, dessen Name nichts zur Sache tut, an einem Tisch und vor demselben Publikum. B.C. hatte mich mit einem kurzen Nicken begrüßt, so wie man eben den Gruß eines Unbekannten erwidert. Ich weiß noch, dass er als Erster las, was mich befremdete, denn eigentlich beschließt ja der Prominenteste die Lesung. B.C. sagte »Guten Abend« und entschuldigte sich beim Publikum für die Begrüßung der Moderatorin – sie habe den »verehrten Damen und Herren« für deren »zahlreiches Erscheinen« gedankt. Man könne nur für das Erscheinen danken, das wolle er gern tun, darüber freue er sich, aber »zahlreich« könne nun mal niemand erscheinen, selbst bei größter Anstrengung nicht. Einige klatschten.
Im nächsten Atemzug bedankte sich B.C. bei der Zerknirschung demonstrierenden Moderatorin für die schöne Einführung und kündigte an, nun aus einem Manuskript zu lesen, aus dem vielleicht einmal eine Art Autobiografie entstehen könnte. Er begann nach einer kurzen Pause, in der er dem Klang einer imaginären Stimmgabel zu lauschen schien, seinen Text vorzutragen. B.C. las langsam, übertrieben langsam, als fürchtete er, mit weniger Achtsamkeit die Wörter nicht auf den ihnen bestimmten Platz setzen zu können. Insbesondere fiel das bei den Dialogen auf, Wortwechsel, die oft nur aus zwei oder drei Einsilbern bestanden. Er beschrieb – seine Familie hatte in der Nachkriegszeit am Stadtrand von Chemnitz gewohnt –, wie er als Junge den Besuch eines fremden Mannes, der sein Vater sein sollte, erlebt hatte. Erst nach mehreren Wochen war er bereit gewesen, mit diesem Mann zu reden, obgleich er ihm nicht unsympathisch war, sich nicht aufdrängte, ihm und seinen Geschwistern Zeit ließ und vorsichtig um sie warb. Es wäre mit diesem Fremden alles in Ordnung gewesen, hätte er nicht den Anspruch gehabt, der Vater zu sein. Der Junge wollte keinen Vater mehr. Über Väter hatte er nicht viel Gutes gehört. Trotzdem gewinnt der Vater das Vertrauen seines Sohnes. Doch gerade als sich der Sohn entschieden hat, als letztes der Geschwister den Vater zu akzeptieren, verschwindet dieser spurlos. Und es bleibt offen, ob er sich einfach nur aus dem Staub gemacht hat, ob er dazu genötigt wurde oder ob man ihn »abgeholt« hat.
Wenn ich meiner Erinnerung glauben darf, dann war das, was mich eigentlich an diesem Ausschnitt faszinierte, die Perspektive des Erzählers. Es gab keinen Ich-Erzähler, wie man ihn bei einer Autobiografie erwartet. Er sprach von sich, doch war er dabei distanziert, als beobachte er sich selbst mit den Augen dieses Fremden.
Ich saß neben B.C. und applaudierte ihm, wie man so sagt, aus ganzem Herzen. Ich war ihm dankbar für diese Seiten, für diese klare und einfache Prosa, die so bildhaft und eingängig war. Man glaubte nicht, dass dieser Autor auch die Gezeiten geschrieben hatte, so anders klang er hier.
Ich sollte nach ihm lesen. Die Moderatorin verwischte allein dadurch, dass sie mich vorstellte und lange darüber sinnierte, warum deutsche Literatur und Unterhaltsamkeit so lange nicht zusammengefunden hätten und erst eine Generation jüngerer Autoren auf den Plan habe treten müssen, um breite Leserkreise für die deutsche Literatur zurückzugewinnen, die Wirkung von B.C.s Vortrag. Im Grunde setzte ihr Gerede B.C. herab. Während sie sprach, ließ sie ihn allerdings kaum aus den Augen, als ginge es ihr allein um die Wirkung auf ihn.
Ich las wohl noch schneller als sonst, vielleicht weil ich das Gefühl nicht loswurde, die falsche Geschichte ausgewählt und mehr an das Publikum als an meinen Nachbarn gedacht zu haben. Ich prüfte mich selbst mit den Augen von B.C. und bemerkte nun, wie geradezu simpel meine Geschichte gestrickt war, die sich als einfache Steigerung abspulte. Die Lacher aus dem Publikum, die mir normalerweise Sicherheit verliehen, bewirkten nun das Gegenteil. B.C., so fürchtete ich, könnte darin nur Anbiederung sehen. Und je mehr sich das Publikum amüsierte, desto härter würde sein Urteil ausfallen. Als ich dann neben mir ein Lachen, ein glucksendes, fast kindliches Lachen vernahm, wäre ich beinah der Versuchung erlegen, meine Lesung zu unterbrechen, um mir den Urheber dieses Lachens anzusehen. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich schließlich, wie sich der Oberkörper meines Nachbarn bewegte, ja wie er vom Lachen regelrecht geschüttelt wurde. B.C. lachte! Und es war kein höhnisches Lachen. Ich war wie befreit. Und zugleich enttäuscht. Sollte es so leicht sein, B.C. zum Lachen zu bringen? Die letzten Seiten trug ich halbwegs entspannt und wohl auch langsamer vor, was meinem Text guttat.
Nachdem auch der Dritte im Bunde gelesen und die Moderatorin das Publikum gebeten hatte, noch einmal für uns drei zu applaudieren, reichte ich B.C. mein Exemplar von Gezeiten, dessen Schutzumschlag mehrfach mit Tesafilm geklebt war.
»Sie haben schon begriffen, wie man es macht«, sagte er und nickte in Richtung derer, die mit meinem Buch in der Hand vor unserem Tisch warteten. »Man muss vorlesen, was vorrätig ist.« Er sagte das nicht bitter, sondern als habe er erst soeben diese Erkenntnis gewonnen.
»Es gibt ja nur dieses Buch von mir«, rechtfertigte ich mich. Während ich signierte, blätterte er in meinem Gezeiten-Exemplar – es gab darin etliche mit Bleistift markierte Passagen. Er sah erst auf, als ihn ein Mann in meinem Alter um ein Autogramm bat – für die Taschenbuchausgabe seiner Essays und Reden mit dem Gerhard-Altenbourg-Holzschnitt auf dem Cover. B.C. war Linkshänder und schrieb mit Kuli.
Elzbieta Kühn, B.C.s Frau, hatte ich schon unmittelbar nach der Lesung bemerkt, freilich ohne zu wissen, wer sie ist. Sie war ein paar Schritte vor unserem Tisch stehen geblieben. Ich dachte, sie wolle etwas fragen, sobald wir die Signierwünsche erfüllt hätten. Deshalb sah ich sie erwartungsvoll an, als nur noch sie vor uns verharrte. Elzbieta jedoch rührte sich nicht von der Stelle. Erst als B.C. mir mein Exemplar von Gezeiten zurückgab, trat sie heran. Sie wirkte älter als er, zumindest auf den ersten Blick. Dachte man sich ihre Augenringe weg, verschwand dieser Eindruck sofort.
Ich dankte B.C. für das signierte Buch, wagte aber nicht, in seiner Gegenwart hineinzusehen. Ich sagte, wie sehr es mich freue, ihn persönlich kennenzulernen, es sei eine Ehre für mich, in seiner Gegenwart vorlesen zu dürfen.
»Hat es dir gefallen?«, fragte er Elzbieta. Sie nickte. »Kommen Sie uns doch mal besuchen«, sagte B.C. Er reichte mir die Hand und bat seine Frau um eine Visitenkarte. »Elzbieta«, sagte er entschuldigend, »hat eine Praxis, und die öffnet jeden Morgen früh um acht.«
»Um sieben Uhr dreißig«, verbesserte sie.
»Um sieben Uhr dreißig«, wiederholte er.
Obwohl ich meinen Vater noch nie besucht hatte, erwähnte ich ihn. Er lebte mit seiner neuen Familie schon seit ihrer »Republikflucht« 1977 in Düsseldorf.
»Melden Sie sich«, sagte B.C., »wenn Sie in der Nähe sind.«
Ich war beinah erleichtert, dass die beiden sich so schnell anschickten zu gehen. Denn was hätte mir im Gespräch mit B.C. noch Schöneres widerfahren können, als von ihm nach Hause eingeladen zu werden? Die Moderatorin beteuerte, sie werde nie wieder für »zahlreiches Erscheinen« danken, was wiederum bei B.C. eine Art von Selbstbezichtigung auslöste. Manchmal wisse er schon kurz darauf nicht mehr, warum ihn der Hafer steche. Sie solle es ihm nicht nachtragen. Mit dem dritten Vorleser wechselte er noch ein paar Worte, die beiden duzten sich. Dann folgte er seiner Frau zum Ausgang.
Mit der Moderatorin und zwei Kollegenfreunden des anderen Schriftstellers saß ich danach in einem Gartenlokal unweit der Akademie zusammen. Aus naheliegenden Gründen muss ich mich bei der Schilderung dieser Runde zurückhalten. Heute wünschte ich, ich wäre gleich nach Hause gegangen, hätte ein Buch für B.C. signiert und es ihm geschickt.
Obwohl die drei Kollegen beteuerten, vor B.C. Respekt zu haben, zogen sie über ihn her. Das Gespräch wäre wohl anders verlaufen, wäre die Moderatorin nicht dabei gewesen. Meine älteren Kollegen begannen, auf geradezu pubertäre Art und Weise um sie zu buhlen. Und dabei – ich weiß, das klingt paradox – schien ihnen niemand so sehr im Weg zu stehen wie B.C.
Sie machten sich über seine Berichtigung der Begrüßung lustig, seine geradezu manisch zu nennende Kritik des Sprachgebrauchs, die seine neueste Macke sei. Sie ahmten sein langsames Vorlesen samt der Pausen nach. Weil die Moderatorin ihn verteidigte, kam sogar Häme ins Spiel. Früher sei bei B.C.s Lesungen die Bude rammelvoll gewesen. »Wenn man nur alle paar Jahre so ein schmales Buch herausbringt …«, begann unser Mitleser, ohne den Satz zu beenden. Stattdessen wandte er sich abrupt mir zu: »Du hast mit deinem ersten Buch viel mehr verdient als er mit seinen letzten drei zusammen.« Die Bemerkungen meiner älteren Kollegen griffen wie Zahnräder ineinander. Die Moderatorin schwieg und ich wand mich. Mir war diese offensichtliche Schmeichelei peinlich, aber sie verfehlte nicht ihre Wirkung. Es berauschte mich, neben B.C. gestellt zu werden, ja über ihn. Und das merkten sie.
»Damals war B.C. ein Dissident«, fuhr unser Mitleser fort, »jeder kannte ihn! Aber wenn du so weiterleben willst wie damals, so auf großem Fuß, brauchst du eine, die dich durchfüttert.«
Und wie hältst du es damit?, wollte ich fragen. Wer füttert dich durch? Aber ich schwieg, während er und die anderen jetzt erst richtig in Fahrt kamen.
»Neureiches Düsseldorfer Bürgertum, unsere Elzbieta. Sie hat ihn sich geangelt, ihren Hauspoeten.« Ihr Gesicht, meinten sie, nehme immer mehr den Ausdruck eines Vogels an, unklar sei nur, ob es in Richtung Käuzchen oder Habicht mutiere. Doch ganz gleich ob Habicht oder Käuzchen, bei Elzbieta habe B.C. zu parieren. Unter ihrer Obhut habe er seinen Antrieb und seine Eigenständigkeit verloren, denn er bekomme ja sowieso alles, was er wolle. Sage er aber mal eine Lesung zu, dann zerre sie ihn gleich wieder nach Hause wie einen unerzogenen Hund. Trotz ihres vielen Geldes würden sie knausern und mit dem Auto fahren, weil sie dann noch an der Kilometerpauschale verdienten und Elzbietas Zugticket sparten.
Meine Kollegen sagten es schärfer, gemeiner, und sie hatten weitere Beispiele zur Hand. Elzbieta gebe auch den politischen Ton vor, den B.C. nachzusingen habe. Mit Geld im Hintergrund könne man sich offenbar jede politische Meinung leisten, selbst solche postrevolutionären Attitüden, die schon vor zehn Jahren zum Gähnen gewesen seien.
Ich wusste nicht, worauf sie dabei anspielten. Elzbietas Visitenkarte in der Brusttasche, fühlte ich mich wie ein Verräter, weil ich schwieg. Nein, ich war ein Verräter! Sie hatten meine Eitelkeit geweckt. War denn die Anzahl der verkauften Bücher wirklich gleichbedeutend mit dem Ansehen und der Popularität eines Autors? Ich widersprach ihnen, nahm es dann aber schweigend hin, als sie mich zu widerlegen suchten. Stimmte es etwa nicht, dass B.C. von seiner Frau umgehend nach Hause verfrachtet worden war? Offenbar bestand tatsächlich eine gewisse Abhängigkeit von ihr.
Die Moderatorin kehrte, nachdem sie auf die Toilette gegangen war, gar nicht mehr an unseren Tisch zurück. Sie zahlte an der Theke, winkte nur kurz zu uns herüber und verschwand. Mehr als über ihre Flucht schien man an unserem Tisch darüber verärgert zu sein, die Rechnung nun selbst zahlen zu müssen.
Als ich zu Hause mein Exemplar der Gezeiten aufschlug, war ich zunächst enttäuscht, weil B.C. zwischen meinen Namen und seine Unterschrift nur ein »herzlichst« gesetzt hatte, darunter Ort und Datum. Seine Schrift war so klein und krakelig, dass ich schon Mühe hatte, »herzlichst« zu entziffern. Dafür fand sich auf der nächsten Seite eine lustige Zeichnung, drei Strichmännchen an einem Tisch und in so bewegter Haltung, als würden sie singen. Darunter stand gut lesbar: »Nicht mehr ganz mein Buch.«
Was nun folgt, kann ich noch weniger erklären als mein Schweigen in der Tischrunde. Ich hatte mir vorgenommen, mein Buch an B.C. zu schicken, seine Bücher noch einmal zu lesen und ihn möglichst bald zu besuchen. Aus dieser Begegnung würde dann wie von selbst ein Briefwechsel entstehen. Ich würde ihm begründen, warum Gezeiten ein großes Buch sei und er nicht den leisesten Zweifel daran haben müsse. In meiner Vorstellung hatten wir plötzlich die Rollen getauscht. Ich, der mehr als er verkauft hatte, war es nun, der ihn, den in Selbstzweifel verstrickten Kollegen, ermutigte. Ich würde ihm vorschlagen, gemeinsam zu lesen, ja gemeinsam ein paar Tage auf Tour zu gehen. Gemeinsam mit mir könnte er dann die Abende verbringen, befreit von Elzbietas Aufsicht. Doch ich rührte mich nicht. Sooft ich daran dachte, fiel mir keine geeignete Widmung ein. Und je länger ich zögerte, desto schwieriger wurde es, zwei angemessene Zeilen zu finden. Schließlich zweifelte ich, ob ich es überhaupt tun sollte. Wäre B.C. tatsächlich an mir interessiert gewesen, hätte er mein Buch ja kaufen können.
Als ich meine erste Lesung in Düsseldorf hatte, waren zwei Jahre seit unserem Treffen vergangen. Noch in den Tagen davor war ich überzeugt gewesen, ihn anrufen und zu meiner Lesung einladen zu müssen. Er brauchte ja nicht zu kommen, aber ich hätte ihm eine Gelegenheit geboten, seine Einladung zu erneuern. Am Tag der Lesung fasste ich den Entschluss, dass es genug sei, mich mit meinem Vater zu treffen, den hatte ich schließlich über zwanzig Jahre nicht gesehen.
Von B.C. war in der Zwischenzeit nichts erschienen, ich hingegen hatte mein zweites Buch veröffentlicht und war wieder auf Lesereise. Und ich weiß noch, dass ich überschlug, nun bald halb so viele Bücher wie er zu haben, gemessen in Seiten vielleicht sogar schon mehr als die Hälfte.
Ein paar Monate später, im März 1999, kurz nach Beginn des Kosovokrieges, erschien in der Frankfurter Allgemeinen ein Artikel von B.C., in dem er sehr sachlich, ja geradezu im Protokollstil schilderte, wie es zu diesem Krieg gekommen war. Ich weiß noch, dass ich beim Lesen bis zum letzten Satz nicht wusste, worauf er eigentlich hinauswollte. Dabei hätte man bei bestimmten Worten hellhörig werden müssen. Er sprach von »Scheinverhandlungen«, von den Scheinverhandlungen von Rambouillet, und forderte, den gesamten Vertrag endlich offenzulegen. Nur der letzte Satz verriet seine kalte Wut, in der dieser Artikel abgefasst war: »Jeder deutsche Politiker, der diesen Krieg befürwortet, muss sein Mandat verlieren.«
Ich ärgerte mich darüber. Besser handeln als nicht handeln, besser eingreifen und sich damit auch die Hände schmutzig machen, als zu sagen, das geht uns nichts an. Natürlich müsse man Milošević seine Grenzen zeigen und die Albaner schützen. Ich war damals selbst noch ein Befürworter des Einsatzes. Deshalb weckte dieser Artikel einen gewissen Unwillen gegen B.C. in mir. Zwei oder drei Wochen später hörte ich den Schluss eines Interviews von B.C. im Deutschlandfunk, während ich mit einem Freund zusammen im Auto fuhr. B.C. sagte, dass die Nato die Städte der Opposition bombardiere, in Novi Sad und Belgrad regierten ja schon die Milošević-Gegner. Jede Bombe stärke Milošević. Er sprach von der Dummheit und Arroganz des Westens. Der letzte Satz seines Artikels war auch der letzte Satz seines Interviews.
Jener Freund – ich weiß heute nicht mehr, ob wir noch Freunde sind – sagte, dass B.C. nichts Neues mehr einfalle und er wohl wieder von den Kommunisten regiert werden wolle, denn diese seien ja jetzt die Einzigen, die seiner Meinung nach ihr Mandat nicht niederzulegen brauchten. B.C., so fuhr er fort, habe seinen Bedeutungsverlust als Dissident nicht verkraftet und sehne sich nach seiner alten Rolle zurück. Oder wie solle man sein notorisches Querulantentum sonst deuten? Ich will mich nicht in Details verlieren, doch letztlich sind es ebendiese verächtlichen Urteile, die das Bild eines Menschen in der Öffentlichkeit bestimmen. Noch heute machen mich solche Kommentare sprachlos, gerade dann, wenn sie von Menschen kommen, die einem einstmals nahe gewesen sind.
Vor meinem einzigen Besuch bei B.C. im April 2009 hatten wir uns insgesamt vier Mal gesehen: Bei der ersten Begegnung in Berlin, zum zweiten Mal in Freiburg bei den Literaturtagen, dann beim Poetenfest in Erlangen – er stellte zusammen mit Lehmann, der sein vierzigjähriges Verlagsjubiläum feierte, seine Bücher als Sonderausgabe in einem einzigen Band vor, was mit einem Eklat endete –, schließlich liefen wir uns nur ein paar Wochen später auf dem Frankfurter Hauptbahnhof über den Weg, das war 2005.
In Freiburg hatte ich mich ihm mit schlechtem Gewissen genähert, weil ich seiner Einladung nicht nachgekommen war. Meine Entschuldigung überhörte er und drückte mir lange und fest die Hand. Er war aufgekratzt und in geradezu leutseliger Stimmung, nachdem er die Literaturtage vor einem überfüllten Saal mit einer Lesung hatte eröffnen dürfen. Eine Dreiviertelstunde habe er signieren müssen, verkündete er stolz. Elzbieta allerdings, die ihm auch hier nicht von der Seite wich, wirkte auf mich noch distanzierter und müder als damals in Berlin.
Ich sprach mit B.C. über seine Artikel zu den Kriegen im Kosovo und in Afghanistan und darüber, wie wahrscheinlich ein Krieg gegen den Irak mit deutscher Beteiligung sei. Er sagte, dass es zu den schmerzlichsten Erfahrungen gehöre, wenn Freundschaften aufgrund politischer Meinungsverschiedenheiten in die Brüche gingen. »Nichts erscheint einem dann so überflüssig und unnötig wie solche Diskussionen.« Wie oft habe er sich gesagt, dass es das nicht wert sei, und sich gezwungen zu schweigen. Doch mittlerweile bezeichne er sich zumindest in dieser Hinsicht als Fatalist. »Auch wenn man es nicht will, wenn man dagegen arbeitet, es geschieht doch«, sagte er. »Und dann wiederum geschehen auch Wunder, und es ist besser als je zuvor.«
In Erlangen trafen wir einander am Frühstücksbüfett. Ich war überrascht, weil ich gedacht hatte, er wäre nach dem Abend sofort abgereist. Auf der Bühne hatte er seinen Verleger Lehmann des Wortbruches bezichtigt, denn er habe ihm, B.C., zugesagt, keine Neuauflagen seiner Bücher zu veröffentlichen, was mit dieser Ausgabe aber geschehen sei, die scheußlich aussehe und noch dazu auf Löschpapier gedruckt sei, denn es wäre unmöglich, dieses Produkt mit einem Füllfederhalter zu signieren.
B.C. heimste ein paar Lacher ein, letztlich aber hatte Lehmann gute Gegenargumente und hielt am Ende sogar einen Vertrag hoch, unterschrieben von B.C. Auch ich verstand damals nicht, warum sich B.C. derart gegen die Ausgabe seiner Bücher in einem Band sträubte, noch dazu in aller Öffentlichkeit. Hatte er denn dem Auftritt nur zugestimmt, um Lehmann herunterzuputzen? In den Berichten, die ich später über Erlangen las, wurde sein Wüten gnädig übergangen.
Seine Stimmung bei dem unerwarteten Wiedersehen in Frankfurt am Main hingegen hätte nicht ausgelassener sein können. Und zum ersten Mal sahen wir uns allein. B.C. machte auf mich den Eindruck, als würde er eher jünger als älter werden. In seinem blonden Haar bemerkte man die weißen Strähnen kaum.