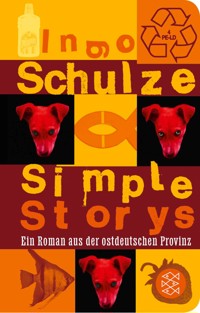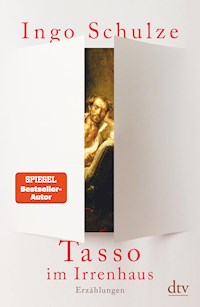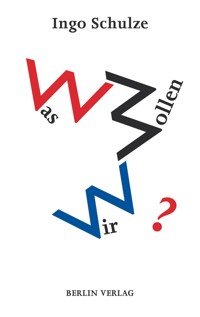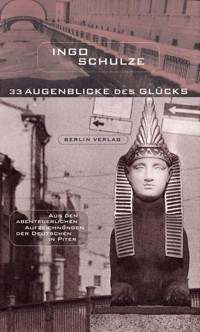9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Waisenkind zum Millionär - wie konnte das so schiefgehen? Peter Holtz will das Glück für alle. Schon als Kind praktiziert er die Abschaffung des Geldes, erfindet den Punk aus dem Geist des Arbeiterliedes und bekehrt sich zum Christentum. Als CDU-Mitglied (Ost) kämpft er für eine christlich-kommunistische Demokratie. Doch er wundert sich: Der Lauf der Welt widerspricht aller Logik. Seine Selbstlosigkeit belohnt die Marktwirtschaft mit Reichtum. Hat er sich für das Falsche eingesetzt? Oder für das Richtige, aber auf dem falschen Weg? Und vor allem: Wie wird er das Geld mit Anstand wieder los? Peter Holtz nimmt die Verheißungen des Kapitalismus beim Wort. Mit Witz und Poesie lässt Ingo Schulze eine Figur erstehen, wie es sie noch nicht gab, wie wir sie aber heute brauchen: in Zeiten, in denen die Welt sich auf den Kopf stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ingo Schulze
Peter Holtz
Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbstRoman
Über dieses Buch
Peter Holtz ist einer, der stets das Gute will. Naiv und hellsichtig kämpft er für eine bessere Welt. Und er staunt: Ständig wird er missverstanden, meistens läuft es anders als geplant. Die Revolution, für die er sich aufopfert, gelingt. Doch ihr Resultat ist keine christlich-kommunistische Demokratie, sondern eine kapitalistische Marktwirtschaft, die Peters Selbstlosigkeit mit märchenhaftem Reichtum belohnt. Ist das vielleicht der bessere Weg zu einer Gesellschaft, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist? Und vor allem: Wie wird Peter das Geld mit Anstand wieder los?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung: akg-images
Covergestaltung: KLASS Büro für Gestaltung
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490131-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Buch I
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Buch II
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Buch III
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Buch IV
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Buch V
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Buch VI
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Buch VII
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Buch VIII
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Buch IX
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Buch X
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Dank
Nachweise
Für Jutta Müller-Tamm
Nützlich ist, was für jemanden gut ist. Oder für alle?
Péter Esterházy, Die Markus-Version
Buch I
Erstes Kapitel
In dem Peter ohne einen Pfennig in der Tasche eine Gaststätte aufsucht und erklärt, warum er das für richtig hält. Überlegungen zum Stellenwert des Geldes im Sozialismus.
An diesem Sonnabend im Juli 1974, acht Tage vor meinem zwölften Geburtstag, weiß ich noch nichts von meinem Glück. Ich sitze auf der Terrasse eines Ausflugslokals nahe Waldau und warte darauf, dass jemand die Kellnerin von der Richtigkeit meiner Argumente überzeugt oder meine Rechnung in Höhe von vier Mark und fünfzig Pfennigen begleicht. Mehrmals habe ich ihr schon erklärt, über kein Geld zu verfügen, weder in meinen Hosentaschen noch dort, wo ich zu Hause bin, im Kinderheim Käthe-Kollwitz in Gradow an der Elbe.
»Geld ist doch nicht wichtig!«, sage ich und füge gleich darauf hinzu: »Solange ich ein Kind bin, muss unsere Gesellschaft für mich sorgen, egal, ob im Kinderheim oder auf einer Reise an die Ostsee.«
Wiederholt biete ich der Kellnerin an, die von mir verzehrte Portion Eisbein mit Kartoffeln, Sauerkraut und Senf sowie das Glas Fassbrause abzuarbeiten, sie brauche mir nur eine Aufgabe zuzuweisen. Ich wolle sie aber nicht wegen Kinderarbeit in Schwierigkeiten bringen. Naheliegend sei es hingegen, mir die Verköstigung nicht zu berechnen. »Warum soll mir unsere Gesellschaft das Geld erst aushändigen«, frage ich, »wenn dieses Geld doch über kurz oder lang sowieso wieder bei ihr landet?«
»Wo landet das Geld?«, ruft die Kellnerin, deren Stimme mit jedem Wort an Höhe gewinnt.
»Bei der Gesellschaft«, antworte ich.
»Bei dir piept’s ja!« Die Kellnerin tippt sich mehrmals mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe. »Hast se ja nich mehr alle!« Sie ergreift ihren dicken schwarzen Zopf, der schräg über ihrem Dekolleté liegt, und schleudert ihn über die Schulter zurück. Im Weggehen schwingt der Zopf zwischen Schulterblatt und Schulterblatt hin und her und beruhigt sich erst, als sie sich anschickt, die drei Stufen zur Eingangstür des Lokals hinaufzusteigen.
Ich versuche, wie immer in kniffligen Situationen, kühlen Kopf zu bewahren und meine Enttäuschung darüber, wie uneinsichtig selbst Erwachsene heute noch sein können, niederzukämpfen. Was würde Paul Löschau jetzt tun? Ich sehe in den Himmel. Die Wolkenbeobachtung, hat er gesagt, sei die beste Art der Erholung, wenn einem die Kraft zum Studieren fehle. In der Gestalt der Wolken haben wir immer etwas entdeckt. Gewaltige Igel, Krebse, Hasen und Bären zogen über uns hinweg. Es hat aber auch Tage gegeben, an denen wir die Vorkämpfer unserer Sache erblickt haben, Ernst Thälmann oder Rosa Luxemburg, einmal sogar Lenin mit vorgerecktem Kinn!
Doch heute will sich keine einzige Wolke verwandeln. Soll ich einfach wegrennen? Aber damit stellte ich meine eigenen Belange über die der Gesellschaft. Am Ende hält die Kellnerin ihren Egoismus noch für Wachsamkeit!
Der Andrang der Gäste ist inzwischen so groß geworden, dass es etliche Wartende gibt, die durch einen Kellner von der Eingangstür vertrieben und zu einer Reihe geordnet werden. Ich will einen letzten Versuch unternehmen, die Kellnerin zu überzeugen!
»Hinten beginnt die Reihe!«, ruft ein Mann. Fast stolpere ich, so grob packt er mich am Ellbogen und zerrt mich zurück. »Ganz hinten!«, ergänzt die Frau neben ihm.
»Ich muss meine Kellnerin sprechen«, sage ich. »Ich habe bereits gegessen und getrunken, aber die Kellnerin besteht darauf, dass ich bezahle …« Ich sehe von einem zum anderen, aber niemand erwidert meinen Blick. Als ich schließlich darzulegen beginne, wie unsinnig die Verwendung von Geld im Sozialismus ist, sieht mich die Frau mit verkniffenen Augen an und deutet mit dem Daumen über die Schulter. »Ganz hinten«, wiederholt sie.
Da sich die Kellnerin nicht zeigt, weiß ich mir nicht anders zu helfen und stelle mich dem Kellner in den Weg.
»Keene Oogen im Kopp?!« Er schiebt mich beiseite und eilt in seinen schwarzen Lackschuhen davon.
»So kriegst du hier nie einen Platz«, sagt leise ein älterer Mann, dessen beigefarbene Hose von einem dünnen weißen Gürtel auf Nabelhöhe gehalten wird.
»Mir geht es nicht um einen Platz …«, sage ich, wende mich aber wieder ab, weil der Kellner zurückkehrt, das leere Tablett unterm Arm. Neben ihm herlaufend, erneuere ich meine Bitte.
»Der Junge hat ein Anliegen!«, sagt der freundliche Mann mit der beigefarbenen Hose überm Bauch und tritt aus der Reihe. »Es ist Ihre Pflicht, ihm zu antworten!«
Als der Kellner erneut auftaucht, drückt er mir ein Buch vor die Brust und zieht einen Kuli hervor.
»Wiedersehen macht Freude, aber persönlich, capito?« Statt mich anzusehen, blickt er den freundlichen Mann an, der wieder in die Reihe der Wartenden zurückgekehrt ist.
»Jetzt musst du auch so mutig sein und schreiben!«, sagt der freundliche Mann.
Die dem lederartigen Einband aufgeprägten Goldbuchstaben füge ich zu dem Wort »Gästebuch« zusammen. Da kein Stuhl frei ist, setze ich mich auf das rotweiße Geländer an der Straße, den Campingbeutel zu meinen Füßen. Vorsichtig öffne ich das Gästebuch. Die ersten Seiten sind herausgerissen, die Reste sehen aus wie angebissene Schnitten. Deshalb beginnt das Gästebuch mit Fotos von Hochzeitsgesellschaften, zwei sogar in Farbe. Es folgt eine Eintragung. Der Text ist nicht lang, ich versuche, Silben zu bilden, um diese dann zusammenzuziehen. Meine Lese- und Schreibschwäche, das steht auch diesmal in meiner Beurteilung, ist ausgeprägt, benotet wird vor allem mein mündlicher Ausdruck. Mir erschließt sich nicht jeder Satz. Als ich wieder von vorn beginne, wird mir allmählich klar, dass das Geschriebene von der Damentoilette handelt, das erleichtert mir das Verständnis. Kein Klo sei benutzbar gewesen! Die Bestandsaufnahme der konkreten Situation lese ich mit wachsender Empörung. Die Schlussfolgerung lautet: Nicht mal ihr »Kleines Geschäft« habe sie gewagt, dort zu verrichten.
Die unterzeichnende Dagmar Freudental fordert eine Stellungnahme des Kollektivs der HO-Gaststätte. Darunter steht eine Adresse. Mich beeindrucken die Sachlichkeit und der Detailreichtum ihrer Eintragung. So würde auch ich gern meine Gedanken ausdrücken. Doch da ich das Schreiben der Losungen zum 1. Mai ausdauernd geübt habe, kann ich es jetzt selbständig anwenden: »Hoch lebe die Befriedigung notwendiger Bedürfnisse!« Eisbein und Fassbrause, davon bin ich überzeugt, waren die richtige Wahl. »Nieder mit dem persönlichen Egoismus, nieder mit dem Privateigentum!«, lautet mein zweiter Eintrag. Das Kollektiv der Gaststätte wird meine Forderungen auf seine konkrete Situation beziehen, darüber diskutieren, sein Fehlverhalten einstellen und sich bessern.
Ich bin im Begriff, meine Adresse zu schreiben, als jemand vor mir stehen bleibt. Eine junge Kellnerin überreicht mir ein randvolles Glas.
»Lemon-Limonade«, sagt sie. »Die geht aufs Haus!«
Ich will sie nach der Bedeutung ihrer Redewendung fragen, doch da sie so aufmerksam ist, das Gästebuch festzuhalten, während ich nach dem Glas greife, trinke ich die Lemon-Limonade in einem Zug.
»Hetz dich nicht«, sagt sie, »und schreib nicht schlecht über uns.«
»Wir müssen alle lernen«, sage ich und gebe ihr das leere Glas zurück. »Wir dürfen einfach nie aufhören zu lernen.« Sie sieht zu Boden. Sie denkt über das Gesagte nach, statt vorschnell zu antworten. Ich reiche ihr die Hand – da fällt mir der Kuli runter. Rasch bückt sie sich. »Danke!«, sage ich, ergreife ihre Rechte und drücke sie fest.
Dann vervollständige ich die Adresse des Käthe-Kollwitz und unterzeichne mit Vor- und Nachnamen. Zu spät bemerke ich die fehlende Grußformel. Zwischen Adresse und Unterschrift quetsche ich »Mit sozialistischer Hochachtung« und schlage das Gästebuch zu, froh, die ganze Angelegenheit zu einem guten Ende geführt zu haben. Schnell passiere ich die Schlange der Wartenden. Allesamt harren sie noch an derselben Stelle aus wie zuvor. Nur meinen Freund in der beigefarbenen Hose finde ich nicht. Zwar kann ich nicht behaupten, den anderen eine Lehre erteilt zu haben, aber auf jeden Fall habe ich meine Zeit besser genutzt als sie. Und etwas Ähnliches geht wohl auch ihnen gerade durch den Kopf angesichts eines heraufziehenden Gewitters.
Zweites Kapitel
In dem Peter in einen Bungalow gerät und wilden Tieren begegnet. Verzagtheit und Zuversicht. Wie er ein Ehepaar erschießt.
Ich schwenke meinen Arm, um eines der Autos anzuhalten, die vom See kommen und aus den Staubwolken des Waldweges auf die Straße biegen. Als mich die ersten Regentropfen treffen, gebe ich es auf und laufe weiter in den Wald hinein, bis ich vor einem Bungalow stehen bleibe. Da weit und breit niemand zu sehen ist, steige ich über den Zaun und erreiche das Vordach im selben Moment, als der Regen losbricht. Vor meinen Zehenspitzen sprudeln Springbrunnen empor.
Gegen die geschlossenen Fensterläden gelehnt, erinnere ich mich der Worte Paul Löschaus. »Wenn du dein Ziel kennst«, hat er immer gesagt, »dann konzentriere dich ganz auf deinen nächsten Schritt.« Mein nächster Schritt, so schlussfolgere ich, kann nur darin bestehen, ein trockenes Nachtlager zu finden. Paul Löschau hat mir mal von Gefangenen erzählt, die allein durch ihre Fähigkeit, im Stehen zu schlafen, überlebt hätten. Aber wie erlernt man diese Fähigkeit? Ganz sicher geht das nicht so schnell, wie ich es jetzt bräuchte.
Ich hänge meinen Campingbeutel an die Klinke der Eingangstür und trinke in kleinen Schlucken den kalten Tee aus meiner Thermoskanne – ich sehe den Campingbeutel zu Boden fallen, die Klinke schnappt wieder nach oben. Wie von Geisterhand öffnet sich die Tür einen Spaltbreit.
Ich wage nicht, nach meinem Campingbeutel zu greifen.
Doch es erscheint niemand. Zu hören ist nur der Regen. Vorsichtig schraube ich die Thermoskanne zu.
Als ich meinen Campingbeutel endlich wieder an mich genommen habe, klopfe ich an, rufe mehrmals: »Hallo?« und luge schließlich über die Schwelle. Aus der Düsternis tauchen Geweihe auf, kleine Geweihe, mit denen die Wände bestückt sind. Ich trete ein. Fuchs, Hase und Marder sehen mit glänzenden Augen von einer Schrankwand auf mich herab. Daneben bewegt sich etwas. Doch noch bevor mir der Schreck in die Glieder fahren kann, erkenne ich den Spiegel und darin mich. Ich atme auf – bemerke aber im nächsten Moment, dass sich was tut, obwohl ich still stehe. Es knurrt. Ein schwarzer Hund, groß wie ein Kalb, nasse Zotteln über den Augen. Als ich einen Schritt auf ihn zugehe, gibt er einen schrecklichen Laut von sich. Augenblicklich hebe ich beide Arme zum Zeichen, dass ich mich ergebe. Auch er verharrt reglos. Über das Geweih neben der Tür ist ein Jägerhut mit langer Feder gestülpt. Zwischen Scheibe und Gardine summt immer wieder eine Fliege kurz auf. In der Küchennische sirrt der Kühlschrank. Draußen ist es duster. Meine Oberarme beginnen zu schmerzen. Mehr noch, als gebissen zu werden, fürchte ich mich vor der Tollwutspritze. Denn die bekommt man direkt in den Bauch. Lange halte ich das nicht mehr aus … Als ich es wage, meine Tränen abzuwischen, berührt mich etwas kalt an der Wade. Rau ist es. Ich bin an ein Sofa gestoßen, ein altes Ledersofa. Langsam setze ich mich. Der schwarze Hund antwortet mit einem Gähnen und legt sich über die Schwelle, den Kopf auf den Vorderpfoten. Auch ich muss gähnen, als wäre das die Sprache, in der wir uns verständigen.
Ich trete die Sandalenriemen von den Fersen und mache es mir mit angezogenen Knien bequem. Sogar eine Decke gibt es. Kaum dass ich liege, spüre ich, wie dringend ich mal muss. Sofort ist auch der Hund auf den Beinen. Ich setze mich wieder, rutsche in Richtung Schrankwand und greife mir einen der beiden braunen Bierkrüge mit Deckel. Da hinein mache ich das, was Dagmar Freudental ihr »Kleines Geschäft« genannt hat, und stelle ihn vorsichtig zurück in die Schrankwand. Den zweiten nehme ich mir als Nachttopf mit. Die Decke ist kratzig. Ich darf mich nicht rühren. Der Regen hat aufgehört. Immer wieder glaube ich, Schritte zu hören. Immer wieder spähe ich hinüber zur Tür, um das Dunkel zu durchdringen. Auch wenn ich mir sage, dass es nur der Wind ist, der die Regentropfen von den Kiefern schüttelt, oder ein Zweig, der herunterfällt, bin ich dankbar für das schwarze Tier dort auf der Schwelle. Als ich mich auf die linke Seite drehe, drückt etwas auf mein Herz: Es ist der Kellner-Kuli, den ich vergessen habe zurückzugeben.
Ich bin überzeugt, die Nacht gemeinsam mit dem sich unentwegt an- und abschaltenden Kühlschrank zu durchwachen. Doch plötzlich ist es heller Tag, die Tür geschlossen, der Hund verschwunden. Auf dem Tisch steht ein Glas Milch. Daneben finde ich eine Doppelsemmel, meinen Kuli und einen Zettel. »Guten Morgen, Junge«, entziffere ich langsam. »Alles ist gut. Wenn du gehst, schließe bitte die Tür.«
»Wirrt gemacht, Gruhs, Peter«, schreibe ich darunter und stecke den Kuli zurück in meine Brusttasche. Die beiden Bierkrüge stehen mit offenem Deckel im Waschbecken.
Das Glas Milch in der einen, die Semmel in der anderen Hand, trete ich hinaus in den Julimorgen, blinzele durch die Kiefern hinauf zur Sonne und glaube für eine Sekunde, es wäre schon das Rauschen des Meeres, das ich höre. Nachdem ich die Semmel gegessen und die Milch getrunken habe, inspiziere ich den Bungalow. Hinten hinaus hat er zwei Schlafkammern. Zwischen den beiden Türen stehen Pantoffeln, der Größe nach geordnet, blau, rot, grün. Von einem der Geweihe neben der Kochnische hängt eine braune Lederhülle herab.
Das Fernglas ist so schwer, dass derjenige, der es um den Hals tragen will, ein halber Riese sein muss. Ich versuche hindurchzusehen, stelle es scharf und erblicke eine Pistolentasche. Die Pistole riecht ölig und nach Metall. Ich scheue mich, sie ganz herauszunehmen. So etwas kenne ich nur aus dem Fernsehen. Unsicher, als förderte ich damit eine Epoche des Krieges und des Faschismus zutage, und zugleich behutsam, als könnte da etwas lebendig werden und mir weh tun, ziehe ich sie schließlich heraus. Auch diese Waffe ist für einen Riesen gemacht.
Mit dem Jägerhut auf dem Kopf und der Pistole in der Rechten stelle ich mich vor den Spiegel. Langsam gewöhne ich mich an ihr Gewicht. Ich versuche, sie wie einen Colt um den Mittelfinger kreisen zu lassen. Einmal gelingt es mir, beim zweiten Versuch entgleitet sie mir und fällt zu Boden. Als ich sie ein drittes Mal kreisen lasse, geschieht alles gleichzeitig: Ich erblicke hinter mir einen Mann und eine Frau, es kracht fürchterlich, es scherbelt, es splittert, es schreit, es poltert, es bellt, es will kein Ende nehmen. Dann sehe ich niemanden und nichts mehr. Das rechte Handgelenk schmerzt. Die Pistole liegt vor meinen Füßen.
»Ich ergebe mich!«, rufe ich, als ich draußen wütende Stimmen höre, und beginne zu weinen, noch bevor ich jemanden erblicke.
Drittes Kapitel
In dem Peter sich satt isst. Darüber vergisst er nicht, seine Sicht auf die Welt darzulegen. Was für ein ungewöhnlicher Junge!
Keine Stunde später präsidiere ich gewaschen und gekämmt einer reichgedeckten Frühstückstafel auf der Terrasse vor dem Bungalow. Rechts von mir sitzt Herr Grohmann, links Frau Grohmann, der schwarze Hund, der auf den Namen Wanka hört, liegt auf dem Fußabtreter und sieht traurig in unsere Richtung.
»Iss dich erst mal satt«, sagt Frau Grohmann bereits zum zweiten Mal.
»Ja«, sage ich dankbar.
Herrn Grohmann verleiht eine Narbe, die sich über seine linke Wange bis hinunter zum Kinn zieht, ein verwegenes Aussehen, als wäre er früher einmal Seeräuber gewesen oder Bandit, allerdings einer mit Manieren. Selbst seine Schwarzbrotschnitte – Frau Grohmann und ich essen Brötchen – behandelt er mit Messer und Gabel.
Frau Grohmann ist nicht nur jung, sondern jungenhaft. Das liegt an ihren kurzen blonden Haaren und der Lebhaftigkeit, mit der sie spricht und gestikuliert.
Wahrheitsgemäß habe ich dem Ehepaar Grohmann erzählt, dass ich im Kinderheim Käthe-Kollwitz lebe, mich aber ohne Erlaubnis auf den Weg gemacht habe, um Paul Löschau, unseren alten Kinderheim-Direktor, der jetzt ein Kinderferienlager in Wiek auf Rügen leitet, zurückzuholen, zurück zu uns nach Gradow an der Elbe.
»Aber warum willst du denn, dass er seine neue Arbeit aufgibt?«, fragt Frau Grohmann.
»Weil der neue Direktor keine sozialistische Persönlichkeit ist, sondern ein Mensch, der nur an sich selbst denkt.«
»Ach so?«
»Und außerdem frönt er ständig seinem Geschlechtstrieb.«
»Ach!«, sagt Frau Grohmann. Herr Grohmann sieht weiter höflich auf sein Brot hinab und kaut.
»Auf welche Art und Weise frönt er denn seinem Geschlechtstrieb?«, fragt sie.
»Na, wie schon«, sage ich. »Er schließt sich mit allen Frauen ein, deren er habhaft werden kann.«
Auch Frau Grohmann hält jetzt ihren Blick gesenkt.
»Er stellt den Erzieherinnen nach, den Köchinnen und Küchenhilfen. Niemand ist vor ihm sicher, nicht mal die Putzfrauen. Die Sekretärin von Paul Löschau hat schon gekündigt.«
»Ach«, sagt Frau Grohmann wieder, »das ist nicht schön.«
»Er ist kein Vorbild, überhaupt nicht«, sage ich. »Er ist auch ungerecht.«
»Aber der vorige Direktor …«
»Paul Löschau lieben alle.«
»Und warum ist er weg?«
»Zuerst war er krank. Und dann hat man ihn zur Kur geschickt, an die Ostsee. Und dann hat man gesagt, dass er dortbleiben soll, wegen seiner Lunge. Er durfte sich nicht mal von uns verabschieden.«
»Aber dann kann er ja nicht zurückkommen! Dann muss er doch bleiben! Dann hat er doch gar keine Wahl!«
»Ohne ihn missraten wir völlig«, sage ich.
»Ihr missratet völlig?«, mischt sich Herr Grohmann ein.
»Ja! Ohne ihn entwickeln wir Kinder uns in eine völlig falsche Richtung.«
»Aber du darfst doch nicht so einfach weglaufen aus dem Heim?«, sagt Frau Grohmann.
»Ich habe einen Brief hinterlassen und versprochen, so schnell wie möglich zurückzukommen.«
»Ganz schön gewagt«, sagt sie.
»Wenn man mal etwas als richtig und notwendig erkannt hat«, erwidere ich, »soll man sich auch mit ganzer Kraft dafür einsetzen. Und was ist schon eine Fahrt an die Ostsee im Vergleich zu dem antifaschistischen Kampf von Paul Löschau, im Vergleich zu der Angst vor Folter, Hunger, Durst und Tod. Und trotzdem hat er sich überwunden und es getan!«
Frau Grohmann scheint sich nach meinen Worten zu genieren, in ihr Brötchen zu beißen, obwohl der Honig bereits über den Nagel ihres Daumens läuft.
»Du bist wirklich ein ungewöhnlicher Junge«, sagt sie schließlich und lässt das halbe Brötchen auf ihrem Teller los, das sich sofort wie ein Schiff in Seenot auf die Seite legt, so dass der Honig von der Reling tropft. Schweigend essen wir weiter. Schweigend reichen wir einander Butter und Honig.
»Nun mal ehrlich«, beginnt Herr Grohmann. »Erwartest du wirklich, dass du damit durchkommst? Dass man dir überall hilft, einfach so?«
»Aber ja«, erwidere ich freudig. »Ich bin doch ein Mitglied unserer Gesellschaft! Vor fünfzig Jahren hingegen …«
»Schon, schon«, unterbricht er mich. »Aber wie soll das gehen?«
»Wie meinen Sie das?«, frage ich voller Bangigkeit.
»Man kann doch andere nicht unentwegt bitten, einem zu schenken, was man will, ohne selbst etwas zurückzugeben«, sagt Herr Grohmann.
»Ich will ja nur das, was ich brauche. Der Mensch muss essen!«, beharre ich und schmiere Butter auf beide Brötchenhälften.
»Aber, Junge! Niemand kann dir immerzu Spezialitäten in den Mund stopfen, nur weil du gerade Lust hast, in einem Restaurant zu speisen! Niemand kann einfach so sagen: ›Da, nimm, was du willst, bedien dich, für dich ist’s umsonst!‹« Er klingt ungehalten, als wäre er darüber verärgert, dass die Rolle, die er aus seiner Serviette gemacht hat, sich nicht gleich durch den silbernen Ring schieben lässt.
»Was meinen Sie mit ›einfach so‹?«
»Na, einfach so! Für Gottes Lohn!«
Weder gefällt mir seine Argumentation noch seine mystische Ausdrucksweise. Die Aufmerksamkeit seiner Frau ermutigt mich jedoch zu argumentieren.
»Ob ich nun hier esse oder im Heim – was für einen Unterschied macht das?«, frage ich. »Ich hätte natürlich auch die Rinderroulade nehmen können für drei achtzig! Aber das Eisbein war stattlich, und ich hatte zwei Tage nichts Warmes im Bauch.«
»Tut er nur so, oder ist er wirklich so … so … einfältig?«, fragt er seine Frau, als wäre ich gar nicht anwesend. Dann lehnt er sich zurück und stößt die Luft durch die Nase aus.
»Du stellst wirklich sehr hohe Ansprüche an deine Mitmenschen«, sagt Frau Grohmann, die das Weiche aus ihrem aufgeschnittenen Brötchen pult.
»Paul Löschau hat mal gesagt: ›Wenn du ohne Geld durch unsere Republik reisen und dich satt essen kannst und alle freundlich zu dir sind, dann hat der Kommunismus gesiegt. Ich werde ihn nicht mehr erleben, aber du vielleicht schon.‹ Ich will, dass Paul Löschau es auch noch erlebt!«
»Du bist wirklich ein besonderer Junge«, sagt Frau Grohmann, zwischen deren Fingern teigige Röllchen entstehen. Eines tunkt sie ins geköpfte Ei.
»Beate!«, zischt Herr Grohmann. »Musst du das jetzt zelebrieren?«
Sie beugt sich über den Teller, wobei sie mit einer Hand die Bernsteinkette an die Bluse drückt, und bugsiert das eigelbgetränkte Röllchen in ihren Mund.
»Probier mal«, sagt sie kauend und bietet mir ein Röllchen an.
»Unsere Erzieher würden das als Mätzchen bezeichnen«, sage ich, nehme aber das Brötchenstück entgegen und betrachte es eingehend. »Nichts wird bei uns so sehr geahndet wie das Herumspielen mit Lebensmitteln.«
»Da hörst du es!«, sagt Herr Grohmann. »Da hörst du es!«
»Ich will es aber gern versuchen«, beeile ich mich hinzuzufügen, tunke das Röllchen ins Eigelb und kaue es langsam.
»Sehr gut«, sage ich und sehe zwischen ihnen hin und her.
»Nun, es freut mich außerordentlich, auch mal einem Jungen wie dir, einem mit solch klarem Bewusstsein, zu begegnen«, sagt Frau Grohmann. »Aber wir sind leider noch nicht so weit, dass die Menschen bereit wären, ohne Geld zu arbeiten, nicht mal in der Sowjetunion ist es schon so.«
»Versteh uns nicht falsch«, ergänzt Herr Grohmann – er sieht kurz zu seiner Frau und tippt sich ans Kinn –, »so wie du denkst, wäre es ja eigentlich richtig, aber …«
»… wir sind eben noch nicht so weit«, unterbricht ihn Frau Grohmann und wischt sich das Eigelb vom Kinn.
»Mir aber macht Arbeit gegen Bezahlung keine Freude«, beharre ich. »Dann erlebt man ja gar nicht mehr die Befriedigung, etwas für die Gesellschaft getan zu haben. Dann interessiert einen bald nur noch die eigene Bezahlung!«
Herr Grohmann nimmt einen Schluck aus seiner Teetasse. Frau Grohmann schiebt sich ein weiteres Röllchen in den Mund.
Trotz ihres Desinteresses wage ich einen neuen Versuch, sie zu überzeugen. Ich erzähle vom letzten September, als ich aus dem Käthe-Kollwitz flüchten musste und mir das halbe Heim auf den Fersen war.
Viertes Kapitel
In dem Peter erzählt, wie er vom Gejagten zum Anführer wird. Die Ernteschlacht für die Kartoffel. Ora et Aurora!
Das neue Schuljahr hat gerade erst begonnen. Tag für Tag erwarte ich die Rückkehr von Paul Löschau. Seit er nicht mehr da ist, macht jeder, was er will. Es gibt kaum noch Fahnenappelle, die Ansprachen des neuen Direktors sind ohne Kampfgeist. Sehr viel Essen wird weggeworfen, und aus Kofferradios und Kassettengeräten kommt nur englischsprachige Musik, deren Texte keiner versteht. Die Ecken der Grünflächen vor dem Käthe-Kollwitz sind von Trampelpfaden ruiniert. Als bräuchte es die Abkürzung dieser wenigen Meter, als hätten wir nicht die Zeit, um die Grünfläche herumzugehen. Warum zerstören wir mutwillig, was uns allen gehört und was wir mit eigener Hände Arbeit in vielen Subbotniks und freiwilligen VMI-Stunden geschaffen haben, warum sabotieren wir das Werk unserer eigenen Volksmasseninitiative?
Gerade hat mir die neue Sekretärin verboten, bei ihr nach Paul Löschau zu fragen – angeblich machen meine täglichen Besuche sie ganz verrückt –, als ich dazukomme, wie zwei Jungen aus der dritten Klasse über den Rasen schlurfen. Ich rufe ihnen zu, dass sie sofort von der Grünfläche runtergehen sollen. Das ist doch unser Grün!, sage ich. Wessen Grün?, fragen sie. Unser aller Grün!, sage ich. Also gehört es auch uns?, fragen sie. Ja, sag ich doch, unser aller Grün. Dann dürfen wir auch hier langgehen, sagen sie. Eben nicht!, rufe ich. Das dürft ihr nicht! Du hast uns gar nichts zu sagen, sagen sie und wollen mir ausweichen. Ich halte sie am Arm fest und bitte sie erneut, schleunigst den Fußweg zu benutzen. Sie aber zeigen sich weiter uneinsichtig. Als auch meine dritte Ermahnung nicht fruchtet, haue ich ihnen eine runter, zwei Ohrfeigen, jedem eine, klatsch und klatsch. Feige hetzen sie danach alle gegen mich auf. Sogar die Mädchen beteiligen sich daran. Karl, obwohl er aus der Gruppe über mir ist, warnt mich: Hau ab!, flüstert er, Hau ab! Sofort mache ich kehrt und renne die Treppe wieder hinunter – und da stürmen sie auch schon hinter mir her, das ganze Käthe-Kollwitz. Peter, Peter, Hackepeter!, schreien sie. Ich weiß, wie es ist, wenn eine ganze Klasse auf einen eindrischt. Noch mal will ich das nicht erleben. Beim ersten Mal hat Paul Löschau alle, deren Namen ich nannte, hart bestraft. Aber jetzt? Es gibt niemanden mehr, vor dem sie sich fürchten.
Weder mache ich im Park der Freundschaft halt noch am Ortsschild von Gradow. Die hinter mir tun es ja auch nicht. Statt in Richtung der Elbwiesen renne ich in den Wald hinein. Bald schon kenne ich mich nicht mehr aus. Wenn ich stehen bleibe, kann ich meine Verfolger hören. Peter, Peter, Hackepeter! Renne ich, dann ist es so, als wäre ich allein im Wald. Plötzlich aber sind die Bäume weg, vor mir ein Feld, ein Stoppelacker, auf dem eine Brigade von Bäuerinnen mit den Händen in der Erde wühlt. Sie sammeln Kartoffeln in ihre Drahtkörbe. Hinter ihnen her zuckelt ein Traktor, auf dessen Anhänger steht ein Bauer mit Schirmmütze, der die Körbe ausschüttet, die die Bäuerinnen heranschleppen und mit beiden Armen zu ihm hinaufstemmen. Ich gehe dem Traktor entgegen. Mein nächster Schritt sollte darin bestehen, Verbündete zu gewinnen.
Ich möchte helfen!, rufe ich dem Bauern auf dem Anhänger zu. Zuerst denke ich, seine Handbewegung bedeute, ich solle verschwinden. Dann aber fliegt ein Drahtkorb vor meine Füße. Renn uns nicht vor die Räder!, ruft er.
Ich werde Sie nicht enttäuschen!, rufe ich zurück und mache mich freudig an die Arbeit. Noch nie habe ich Kartoffeln aus der Erde gebuddelt. Aber das erlerne ich in Windeseile. Ich wundere mich nur, wie viele Kartoffeln die Kartoffelkombine auf dem Feld hat liegen lassen. Ich greife mit beiden Händen zu, und schon ist mein Korb voll. Ich bringe ihn zum Anhänger. Vor mir reichen zwei Bäuerinnen ihre Körbe hinauf. Der Bauer auf dem Anhänger beugt sich herab und schiebt etwas Dunkelrotes zwischen der Kuppe seines Daumens und seinem eingeknickten Zeigefinger hervor, das er auf den erhobenen Handteller der Bäuerin fallen lässt. Sie verstaut das kleine dunkelrote Ding in der Brusttasche ihres blauen Overalls. Als sie zurück zu ihrem Platz in der Ackerfurche geht, schwankt sie in ihren schweren Gummistiefeln hin und her.
Mir gibt der Bauer nichts. Stattdessen fragt er mich: Was ist mit deinen Kameraden dort drüben? Wollen die nicht auch helfen? Und noch ehe ich etwas sagen kann, erklärt er mir: Unsere Kartoffel heißt Aurora! Verstehst du? Aurora! Eine besonders gute Kartoffel. Ab morgen zieht hier der ZT 300 seine Kreise. Was wir heute nicht rausholen, wird morgen untergepflügt. Also, Junge, mobilisiere deine Kameraden! Es gilt, in die Ernteschlacht zu ziehen!
Wird gemacht, rufe ich. Meine Verfolger haben sich nur ein paar Meter aufs Feld getraut. Als sie mich kommen sehen, werden sie unruhig. Einige weichen zurück zwischen die Bäume. Ich winke ihnen zu. Sie rücken zusammen. Zehn Meter vor ihnen bleibe ich stehen.
Hört mal her!, beginne ich. Ihr könnt das alles wiedergutmachen. Niemand wird bestraft. Aber ihr müsst mithelfen, die Ernteschlacht zu gewinnen. Es geht um Aurora! Aurora ist die wertvollste Kartoffelsorte unserer Republik. Wer freiwillig mitmacht, hat nichts zu befürchten. Ich zähle gleich bis drei. Wer vortritt, gehört zu uns. Wer nicht, muss sofort zurück ins Heim, sich dort melden und gestehen, warum er weggerannt ist. Und schon beginne ich, laut zu zählen. Eins … zwei … Ich mache kehrt und stapfe zurück in Richtung Traktor. Dabei schreie ich vor mich hin: Viertel … halb … dreiviertel … um … Und dann, so laut ich kann: Drei! Ich halte es nicht mehr aus und drehe mich um. Niemand ist vorgetreten. Doch als ich schreie: Los! Alles hört auf mein Kommando!, setzen sie sich gleichzeitig in Bewegung.
Und wie sie sich ins Zeug legen. Zuerst lachen uns die Bäuerinnen aus, weil unsere Schuhe, überhaupt unsere Anziehsachen, viel zu gut für die Feldarbeit sind. Doch als sie sehen, wie schnell sich ihre Körbe mit unserer Hilfe füllen, verstummt ihr Gelächter.
Ora!, ruft der Traktorist bei jedem Korb, den ich ihm reiche. Aurora!, antworte ich.
Nicht durch Worte, durch Taten demonstrieren die Kollwitzer, wie sehr sie ihr Verhalten bereuen. Schon bald führt unsere Begeisterung zu einem Wettbewerb unter den Bäuerinnen. Angesichts unseres Einsatzes bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als selbst schneller und besser zu arbeiten.
Aus heiterem Himmel sagt eine Bäuerin: Ach, ihr Guten, von mir bekommt ihr nachher ein paar Marken. Die anderen glauben, es ihr gleichtun zu müssen, und versprechen uns ihrerseits ein paar ihrer dunkelroten Marken.
Ihre Marken interessieren uns nicht!, rufe ich unter dem Lachen der Kollwitzer. Nicht die Bohne interessieren die uns!
Gerade als der Anhänger mit Kartoffeln schon überzuquellen droht und die Frauen bereits in quasselnde Feierabendlaune geraten, scheppert ein Traktor mit einem leeren Anhänger vorbei. Unser Traktorist hupt, der andere Traktor stoppt und lenkt sein Gefährt zu uns. Und in Nullkommanichts hat unser Brigadier die Anhänger gewechselt.
Jetzt, rufe ich, geht es erst richtig los! Die Kollwitzer strahlen vor Freude! Sie wischen sich den Schweiß von der Stirn und blinzeln in die Sonne. Was für eine Aufgabe liegt da vor uns! Ora!, schreie ich. Die Kollwitzer antworten: Aurora!
Einige Bäuerinnen beginnen zu murren und zu maulen. Als der Traktor mit dem vollen Anhänger abfährt und der leere zurückbleibt, schreit eine junge, dicke Bäuerin auf, reißt sich ihr Kopftuch herunter, schwenkt es wie eine Flagge hin und her und stiefelt, so schnell sie kann, dem fahrenden Traktor hinterher. Zurück müsse sie, zurück ins Dorf, plärrt sie, dringend sei es, dringend, sie heult und zetert! Beschimpfungen und Kartoffeln fliegen in Richtung unseres Brigadiers, der aufrecht wie ein Kapitän, die Hände in die Hüften gestemmt, auf seinem neuen Anhänger steht. Er lacht. Ja, er ermuntert die Bäuerinnen, noch mehr Kartoffeln auf den Wagen zu werfen. Wir Kollwitzer lachen mit ihm. Und die junge, dicke Bäuerin plärrt weiter und hastet hinter dem Traktor her. Mehrmals stolpert sie. An ihren Sohlen klebt die Erde zentimeterdick. Der Acker selbst ist es, der sie zum Stehen bringt. Wie kann man sich nur so vergessen! Und auch noch vor Kindern!
Erna, du Huftier! Ran an die Buletten!, ruft der Brigadier. Still vor sich hin heulend, kehrt Erna zurück. Nun klauben die Bäuerinnen die Kartoffeln schneller aus den Furchen, wir Kinder helfen ihnen mit verdoppeltem Eifer. Unaufhörlich renne ich mit vollen Körben zum Hänger, ich gönne mir keinen Atemzug Pause.
Weiter, Kortschagin! Weiter!, muntert mich der Traktorist auf.
Ich beauftrage den Kleinsten von uns, ins Käthe-Kollwitz zu laufen, um weitere Kämpfer für die Ernteschlacht zu mobilisieren.
Sieh dir das an!, sagt der Brigadier und deutet mit dem Kopf auf die Ladefläche, die noch nicht mal zur Hälfte gefüllt ist. Den Hänger müssen wir heute noch schaffen!
Den schaffen wir!, sage ich.
Ich warte, dass er mir zwei dunkelrote Marken für die Bäuerinnen gibt. Ich habe keine mehr, flüstert er. Es muss auch ohne gehen! Unser Staat braucht Kartoffeln!
Er legt beide Hände auf meine Schultern und beugt sich herab zu mir, aus wachen funkelnden Augen sieht er mich an. Ora, sagt er dann leise. Aurora, flüstere ich.
Als ich die leeren Körbe zurückbringe, hält mir die Bäuerin erwartungsvoll die Hand hin, so wie man das von Bettlern aus Filmen kennt. Es gibt keine Marken mehr, sage ich und greife schon den nächsten vollen Korb.
Was? Sie reißt die Augen auf.
Es gibt keine Marken mehr, es muss auch ohne gehen, sage ich und will los. Da krallen sich zwei Hände an den Drahtkorb. Nichts da! Keine Marke, keine Kartoffeln!, kreischt sie.
Ohne Marken keine Arbeit!, ruft eine andere und wirft ihren Korb auf die Erde. Eine Dritte kippt ihren halbvollen Korb aus. Ohne Marken keine Arbeit!, rufen die Bäuerinnen.
Ihr arbeitet doch für euch!, rufe ich, für euch selbst! Ob mit oder ohne Marke. Ihr tut es für eure Familie, für uns, für das ganze Land!
Die Kollwitzer applaudieren. Aber die Bäuerinnen sind taub für Argumente. Schon brechen sie in Richtung Dorf auf. Nur Erna und ihre Freundin arbeiten weiter.
Wir schaffen es trotzdem!, rufe ich. In dem Moment sehe ich, wie vielleicht zwanzig Jungen und Mädchen aus dem Wald treten. Das ist der Sieg, denke ich! Vor Freude balle ich die Faust und recke sie nach oben.
Als es schon ganz dunkel ist, kehren wir, auf den Kartoffeln sitzend, ins Käthe-Kollwitz zurück, Erna und ihre Freundin in unserer Mitte. Alle Fenster sind erleuchtet. Auf den Stufen des Haupteingangs hält unser Brigadier eine Rede, in der er uns für unseren Einsatz dankt und unser solidarisches Klassenbewusstsein lobt. Und dann sagt er, dass alle Kartoffeln auf dem Anhänger für uns sind, für das Kinderheim Käthe-Kollwitz. Wir applaudieren aus Leibeskräften. Kartoffeln für ein Jahr!
Ora!, ruft der Brigadier zum Abschied. Und im Chor antworten wir …
Im selben Augenblick gibt es einen kurzen, trockenen Knall. Auch die Grohmanns zucken zusammen. Ein grüner Kiefernzapfen ist auf den weißen Plastetisch geknallt und liegt nun zwischen dem Honigglas und der Butter wie der vergessene Rest einer Weihnachtsdekoration.
Fünftes Kapitel
In dem Peter enttäuscht von der Ostsee zurückkehrt. Wiedersehen mit einer Kellnerin. Polizei und Verhaftung. Befreiung durch eine schöne Frau.
Sechs Tage später stehe ich erneut vor dem Bungalow in Waldau. Ich klettere über den Zaun, vergeblich rüttele ich an der Tür des Bungalows. Ich bin durstig und hungrig. Zum Glück finde ich den Weg zu dem Ausflugslokal Am tiefen See. Wie schön es hier gewesen ist, als ich mich noch darauf freuen konnte, Paul Löschau wiederzusehen. Jetzt weiß ich nicht einmal mehr, wo ich ihn suchen soll.
Ich bin im Zweifel, ob ich den Kellner, der mir den Kuli geliehen hat, um etwas zu essen bitten soll.
Lieber wende ich mich an das ältere Ehepaar auf der Terrasse. Denn die beiden haben als Kinder mit Sicherheit noch selbst erlebt, was Hunger bedeutet.
»Wären Sie bitte so freundlich und würden mir von Ihrem Schnitzel etwas abgeben?«, frage ich, nachdem ich mich vorgestellt habe. »Oder würden Sie für mich die gleiche Portion bestellen?«
Sie starren mich an, das Besteck in beiden Händen.
»Mir reichen auch ein paar Kartoffeln und ein Gurkensalat, vielleicht teilen Sie sich einen und geben den anderen mir?«
»Das gibt’s doch nicht!«, ruft der Mann.
»Na, so was!«, sagt sie.
»Hau bloß ab!«, sagt er. »Husch! Weg mit dir!«
Die Männer am Nebentisch winken mich heran.
»Hast’ Hunger?«
Ich nicke. »Essen Sie das nicht mehr?«
»Du kannst doch keine Reste essen!«, entrüstet sich der, der zwei Ringe an einer Hand trägt.
Ich nehme mir die übriggelassene Kartoffel, achte darauf, keine Soße zu verkleckern, und stopfe sie ganz in den Mund.
»Junge!«, ruft der andere mit dem Schnauzbart erschrocken.
»Ach! Kennen wir uns nicht?« Hinter mir steht die Zopf-Kellnerin. Ich habe den Mund voll und verziehe mich vorsichtshalber auf die Toilette. Am Waschbecken stille ich meinen Durst. Schließlich merke ich, dass ich auch groß muss. Die Kloschüssel ist blitzblank und die Rolle Toilettenpapier noch ganz dick. Hier hat sich einiges zum Besseren verändert.
Als ich hinausgehe, steigen gerade zwei Volkspolizisten aus ihrem Toni-Wagen. Das Blaulicht dreht sich weiter. Die Zopf-Kellnerin ist schon bei ihnen. Sie zeigt auf mich.
»Wir haben es ihm erlaubt«, ruft der Mann mit dem Schnauzbart. »Er hat nichts gestohlen!«
»Dass es das noch bei uns gibt!«, sagt der Mann mit dem Schnitzel. Sein Teller ist leer, auch das Schälchen mit Gurkensalat. Seine Frau hat erst die Hälfte geschafft.
Die beiden Volkspolizisten eilen zwischen den Tischen von zwei Seiten her auf mich zu.
»Na, Sportsfreund, wo sind denn deine Eltern?«
»Ich habe keine Eltern«, sage ich.
»Keine Eltern?«
»Der lügt doch!«, ruft die Zopf-Kellnerin. »Und klauen tut er auch – da!« Sie reißt mir den Kuli ihres Kollegen aus der Brusttasche. »Der gehört uns!«
»Meine Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen«, sage ich.
»Dann kommst du am besten mal mit«, sagt der, der mich »Sportsfreund« genannt hat.
»Ich danke Ihnen für die Kartoffel«, rufe ich auf dem Weg zum Toni-Wagen den beiden Männern zu. Sie sind aufgesprungen, kommen jedoch nicht vorwärts, weil sie sich ständig gegenseitig im Weg stehen.
»Können wir was tun?«
Ich weiß nicht, ob ihre Frage mir oder den Volkspolizisten gilt. Die Anwesenheit der beiden Uniformierten beruhigt mich.
Auf dem Volkspolizeikreisamt in Königs-Wusterhausen fühle ich mich auf der Stelle heimisch. Ich bekomme eine Kohlroulade mit Soße und so viele Kartoffeln, wie ich möchte. Allmählich dämmert mir, wie dumm ich mich verhalten habe. Auf dem Rückweg hätte mir jeder Volkspolizist sofort geholfen. Das sage ich auch ungefragt gleich zu Beginn des Gesprächs, das sich an das Essen anschließt. Die Volkspolizisten haben viele Fragen. Ich erzähle ihnen von Paul Löschau. Niemand im Kinderferienlager in Wiek auf Rügen kannte seinen Namen. Einen ganzen Tag lang habe ich vergeblich im Ort nach ihm gefragt.
»Und wie bist du denn von hier da hoch und wieder zurückgekommen?«
Ich habe die Bitte von Herrn Grohmann im Ohr, meinen Aufenthalt bei seiner Familie nicht an die große Glocke zu hängen. Aber gegenüber der Volkspolizei muss ich offen und ehrlich sein.
»Du meinst den Sohn von Kurt Grohmann?«
»Nein«, sage ich, »er ist verheiratet und hat an der Seite schon graue Haare und im Gesicht eine Narbe.«
Die Nacht verbringe ich in einem kleinen Raum mit vergittertem Fenster. Wegen des Lichts auf dem Flur bitte ich darum, die Tür schließen zu dürfen.
Am nächsten Morgen warte ich darauf, wie angekündigt der Transportpolizei übergeben und nach Gradow an der Elbe zurückgebracht zu werden. Beim Frühstück schmiere ich mir eine Semmel für unterwegs. Der Diensthabende hat mir versprochen, sich nach dem Aufenthaltsort von Paul Löschau zu erkundigen. Das stimmt mich zuversichtlich.
Plötzlich erscheint eine schöne Frau vor mir. Sie hat ein ärmelloses Kleid an, lächelt und breitet ihre gebräunten Arme aus, so dass ich die Härchen in ihren Achselhöhlen sehen kann. Ich springe auf. So hübsch habe ich Frau Grohmann gar nicht in Erinnerung.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, sagt sie.
»Ist heute der 14. Juli?«
»Du Glückspilz!«, sagt der Volkspolizist, der mir gestern das Abendbrot gebracht hat. »Herzlichen Glückwunsch.«
»Frau Grohmann?«, fragt ein anderer Volkspolizist. »Wir bräuchten noch eine Unterschrift.«
Frau Grohmann spricht leise mit ihnen. Nur die Antworten der Volkspolizisten sind zu verstehen: »Ja, Frau Grohmann!«, »Nein, Frau Grohmann!« Die drei Volkspolizisten benehmen sich, als wäre sie ihre Vorgesetzte.
»Fahren Sie mich nach Gradow?«, frage ich. Die Volkspolizisten lachen.
Frau Grohmann streicht mir über den Kopf. »Nein, nach Berlin, wenn du willst.«
»Mach’s gut, Großer«, sagt der Volkspolizist, der mich gestern hierhergefahren hat. Auch er gratuliert mir. »Und mach uns keine Schande, verstanden?«, sagt er zum Abschied.
Frau Grohmann nimmt mich an die Hand, was mir zuerst peinlich ist. Doch schon im nächsten Moment, da wir allein auf die Straße treten, erscheint mir diese Geste als ein passender Ausdruck ihrer Fürsorge.
Sechstes Kapitel
In dem Peter eine private Wohnung kennenlernt. Weitere Glückwünsche und eine Führung. Wie schnell Wünsche erfüllt werden können.
»Da sind wir«, sagt sie.
»Sie wohnen in diesem Haus?«
»Was hast du denn erwartet?«
»Ich dachte, in einem modernen Hochhaus!«
»Zum Glück nicht«, sagt sie, was wohl als Erwachsenenscherz gemeint ist. Denn das Haus, vor dem wir parken, ist alt und hat nur eine Etage über dem Erdgeschoss. An der Fassade sind noch vereinzelte schnörklige Verzierungen zu erkennen, an vielen Stellen liegen die roten Ziegel offen zutage. Früher hat es wahrscheinlich mal reichen Leuten gehört. Drumherum gibt es einen Rasen und Bäume. Den Weg zur Haustür, die auf der Rückseite liegt, säumen schmale Blumenbeete. Im Treppenhaus, von dem ebenerdig zwei große Türen abgehen, riecht es unangenehm.
»Das ist die Praxis von Hermann«, sagt Frau Grohmann. »Und hier wohnt Schönchen, unsere Vermieterin. Sie geht ihm an den Praxistagen zur Hand.«
»Was sind ›Praxistage‹?«
»Zahnarzt«, sagt Frau Grohmann und bohrt einen Finger in ihre Wange. »Hermann ist Betriebszahnarzt in der Glühlampenbude. Hier arbeitet er nur donnerstags und freitags nach Feierabend, manchmal auch am Sonnabend.«
»Ein wöchentlicher Subbotnik?«
»Kann man so sagen! Die Praxis hat irgendein Onkel von ihr betrieben, also von Frau Schöntag. Hermann hat ihm zuletzt geholfen, dann ist’s an ihm hängengeblieben, eine Zusatzstelle.«
Ich verstehe nicht, warum es außerhalb von Polikliniken und Betrieben noch Zahnärzte geben muss, aber die Bereitschaft von Herrn Grohmann, regelmäßig unentgeltlich zu arbeiten, beeindruckt mich.
Wir steigen die Treppe hinauf. Wie im Käthe-Kollwitz sind auch hier die Steinstufen in der Mitte ausgetreten und nur am Rande noch von hellblauer Farbe. Frau Grohmann öffnet die Tür im ersten Stock. Das Parkett glänzt. Mit Privatwohnungen kenne ich mich nicht aus. Vorsichtshalber fahre ich in die bereitstehenden Filzpantoffeln an der Garderobe und schiebe mich vorwärts.
Der Raum wirkt gemütlich wegen der Teppiche und der gerahmten Bilder und der Dinge, die überall herumliegen. Es gibt viele Bücher. Die Decken sind hoch und in den Ecken verziert.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!«, sagt Herr Grohmann und streckt mir seine haarige Hand entgegen.
»Der ist für dich«, sagt Frau Grohmann. Auf einem runden Tisch steht eine dunkelgrüne Glasvase mit einem großen Blumenstrauß, wie ich ihn nur aus dem Fernsehen kenne. Nelken sind es nicht.
»Glückwunsch«, sagt das Mädchen finster, um dessen Schulter Herr Grohmann einen Arm gelegt hat. Im selben Moment bricht sie in Gelächter aus. »Spinnt der?« Sie zeigt auf die Pantoffeln.
»Willst du dich nicht vorstellen?«, sagt Herr Grohmann.
»Ich heiße Olga.« Sie kichert.
»Im Sommer brauchst du keine Hausschuhe«, sagt Frau Grohmann.
»In welcher Klasse bist du?«, frage ich.
»Ist der doof!«, ruft sie und kichert wieder.
»Benimm dich«, sagt Herr Grohmann. »Peter hat dich was gefragt!«
»Olga kommt jetzt in die achte Klasse«, sagt Frau Grohmann.
»Ich komme in die sechste«, sage ich.
Zur Strafe muss mir Olga die Privatwohnung zeigen. Sie schlurft vor mir her und erklärt nichts. Sobald sie eine Tür öffnet, glaube ich, gleich andere Kinder zu sehen.
»Hier, dein Zimmer!«, sagt sie. »Mach’s auf.«
Ich drücke die Klinke, da springt Wanka heran, das schwarze Kalb. Olga kniet sich hin und umarmt ihren Hund, den ich schon ganz vergessen hatte. Das Zimmer ist dunkel.
»Hier kannst du pennen«, sagt sie.
Ich bleibe auf der Schwelle stehen, während Olga einen Rollladen hochzieht. Das Sonnenlicht berührt meine Fußspitzen.
»Ganz allein?«, frage ich.
Olga dreht sich um.
»Schlaft ihr nicht zusammen?«
»Spinnst du?«
»Auch nicht mit deiner Mutter?«
»Meine Mutter ist tot, das ist Beate.«
»Meine Mutter ist auch tot, beide sind tot.«
»Kanntest du sie, deine Eltern?«
»Nein. Als sie verunglückt sind, bin ich noch ein Baby gewesen. Und du?«
Olga schüttelt den Kopf.
Mir fällt es schwer, mich zu orientieren. Zimmer, die sie mir bereits gezeigt hat, scheinen auf dem Rückweg schon wieder ganz andere geworden zu sein.
»Wer wohnt denn noch hier?«, frage ich, als wir wieder vor meinem Blumenstrauß stehen.
»Hat alles meinem Opa gehört, Kurt Grohmann, kennste nicht?«
»Ich bin doch gerade erst angekommen«, sage ich.
»Der lebt nicht mehr«, sagt Olga und kichert wieder. »Der ist berühmt.«
»Hat der was mit Büchern gemacht?«
»Der war im Gefängnis und musste fliehen, nach Mexiko, deshalb gibt’s die Kurt-Grohmann-Schule, Kurt-Grohmann-Straße, Kulturhaus, alles Mögliche heißt nach ihm.«
»Ein Antifaschist! Hat er dir von früher erzählt?«, frage ich.
»Das hier haben wir alles ihm zu verdanken«, sagt Olga.
»Das denke ich auch immer«, sage ich. »Alles, was es Gutes gibt, haben wir denen zu verdanken, die gegen den Faschismus gekämpft haben und unseren Staat aufgebaut haben. Und der Sowjetunion natürlich«, ergänze ich. »Ohne die Sowjetunion wäre alles nichts.«
Im selben Moment ertönt ein Gong wie im Ferienlager. Ich folge Olga in die große Küche. Herr Grohmann sitzt bereits am Tisch.
»Hände gewaschen?«, fragt er.
Wir kehren wieder um. Auf dem Klo, im Bad und in der Küche, überall ist der Fußboden mit schwarzweißen Fliesen belegt, als würde hier ein Schachspieler wohnen.
»Ich habe noch mal mit dem Käthe-Kollwitz telefoniert«, sagt Herr Grohmann und sieht von unten herauf seine Frau an. Erst als er die Serviette aus dem Ring gezogen und sie sich, das Kinn hochgereckt, in den Kragen gestopft hat, spricht er weiter.
»Du kannst ein paar Tage bleiben, Peter, wenn du willst – Mahlzeit.« Er beugt sich über den Teller und beginnt, die Suppe zu löffeln. Nach der Suppe gibt es bestreuten Blumenkohl und Schinken. Ich bekomme sogar Nachschlag, weil Olga nur Suppe isst.
»Du darfst dir was zum Geburtstag wünschen«, sagt Frau Grohmann.
»Einen persönlichen Föhn«, sage ich schnell.
Wieder prustet Olga los. Suppe spritzt aus ihrem Mund über den Tellerrand auf die karierte Tischdecke.
»Ich föhne mich sehr gern«, erkläre ich.
»Einfach so?« Herr Grohmann wedelt mit seiner Hand am Ohr herum, was Olga wieder zum Lachen bringt.
»Ich habe die Wärme auch gern im Gesicht und am Hals«, antworte ich.
»Wenn Peter einen Föhn will, dann kriegt er einen Föhn«, sagt Frau Grohmann.
»Danke«, sage ich und würde gern mehr als nur »danke« sagen. Denn ich wundere mich, wie schnell bei den Grohmanns Wünsche erfüllt werden! Aber vielleicht ist das in Privatfamilien ein allgemeinverbreiteter Brauch.
Siebentes Kapitel
In dem Peter erfährt, wer Weltmeister ist. Wie er das Weintrinken erlernt und das Abwaschen und Abtrocknen. Seiner Freude weiß er angemessenen Ausdruck zu verleihen.
Um meinen Geburtstag zu feiern, haben die Grohmanns – ich darf zu Frau Grohmann nun Beate und zu Herrn Grohmann Hermann sagen – Klaus, den älteren Bruder von Beate mit seiner Frau Brigitte eingeladen. Ihre Kinder, ein Zwillingspaar, sind im Ferienlager.
»Na, Steppke, jetzt sind wir Weltmeister!«, sagt Klaus und reicht mir die Hand.
»In welcher Disziplin?«, frage ich.
»Na, im Fußball!«
»Ach«, sage ich, »das weiß ich noch gar nicht!«
»Haste das nicht gesehen?« Klaus stupst zweimal mit dem Daumennagel gegen den Filter seiner f6, die Asche fällt auf die Untertasse.
»Da saßen wir im Auto nach Rügen«, sagt Hermann. »Das haben wir verpasst.«
»Gegen wen haben wir denn gespielt?«, frage ich.
»Na, Holland!«
»Darüber sind Sie sicher traurig«, sage ich zu Hermann. »Bist du sicher traurig«, korrigiere ich mich.
»Du warst für Holland?«, fragt Klaus überrascht, aber Hermann hat das Zimmer schon wieder verlassen.
»Er hält Johan Cruyff für den besten Spieler«, erkläre ich Klaus. »Von dem sollen sich unsere Jungs ’ne Scheibe abschneiden.«
»Gewonnen haben immer noch wir!«, sagt Klaus und sieht mich durch seine dunkle Brille an. Seine großen, schön umrandeten Lippen schließen sich sanft um den Filter der f6. »Interessierst du dich nicht für Sport?« Er bläst den Rauch zur Seite.
»Nur für internationale Wettkämpfe, bei denen wir uns mit kapitalistischen Staaten messen, also wenn es darum geht, wer der Bessere ist. Vor zwei Jahren, bei der Sommerolympiade, hab ich täglich den Medaillenspiegel verfolgt. Ich weiß noch alle Goldmedaillen, zwanzig hatten wir, sechsundsechzig Medaillen insgesamt, sechsundzwanzig mehr als die BRD, Platz drei in der Gesamtwertung.«
»Das merkst du dir?«
»Auch die Namen! Renate Stecher, Siegerin über hundert und zweihundert Meter im Sprint, Roland Matthes, unser Ass im Rückenschwimmen, Ruth Fuchs, unser Trumpf beim Speerwurf, Karin Janz, unsere mädchenhafte Turnerin, Wolfgang Nordwig, unser …«
»Mach mal ’nen Punkt!«, ruft Klaus.
»Silbermedaillen errangen Kornelia Ender, Jaqueline Todten, in Erika Zuchold waren alle Jungs verliebt …«
»Im Fußball sieht’s aber anders aus! Du verwechselst da was …«
»Hat nicht unser Sieg über die BRD klar und deutlich gezeigt, wie es in Wirklichkeit um den Sozialismus bestellt ist?«
»Vertragt euch mal wieder«, sagt Beate, obwohl wir uns gar nicht streiten. »Das hier ist Peter, Schönchen, und das ist Frau Schöntag, sie wohnt unter uns.«
Ich stehe auf und gebe Frau Schöntag die Hand. Sie sieht aus wie eine freundliche, alte Lehrerin.
»Guten Tag, Peter«, sagt sie, dann umarmt Olga sie überschwänglich, Frau Schöntag muss sich an der Sessellehne festhalten, um nicht umzufallen. »Olgalein«, sagt sie und versucht, sich zu befreien. Wanka bellt.
»Keine Angst, Peter«, sagt Beate. »Er wedelt mit dem Schwanz. Er freut sich!«
»Dann können wir ja anstoßen!«, sagt Hermann.
Auch ich bekomme etwas von dem rumänischen Weißwein ins Glas. Ich habe noch nie Wein getrunken und bezweifle, ob das was für Zwölfjährige ist. Aber bevor ich die familiären Sitten kritisiere, muss ich mich erst mal mit ihnen vertraut machen. Ich ergreife das Glas – der Wein schmeckt süß und ist kühl.
»Halthalt – halt!«, ruft Hermann, aber da ist mein Glas bereits leer. »Junge! So geht das doch nicht!«
Die anderen sehen mich an. Meine Entschlussfreudigkeit überrascht sie.
»Hast du noch nie was getrunken?«
»Was für eine Frage!«, sage ich. »Jeder Mensch muss täglich trinken!«
Klaus ruft: »Bravo! Prosit!«
Hermann demonstriert nun, wie man bei Grohmanns Wein trinkt. Ich bekomme nachgeschenkt und übe gleich mit: das Glas am Stiel mit den Fingerspitzen anfassen, es hochheben, es gegen ein anderes Glas stoßen – vorsichtig! – und dabei dem anderen in die Augen sehen, was gelernt sein will, und zugleich »Zum Wohl!« oder »Sehr zum Wohle« oder »Prosit« oder »Wohl bekomm’s« sagen.
»Halt!«, ruft Hermann erneut. »Wein muss man genießen, man muss ihn im Mund behalten, nicht einfach runterkippen!«
Nach dem Essen helfe ich beim Abräumen. Olga, die bisher so getan hat, als gäbe es mich nicht, hält mich am Arm fest.
Als Beate die Küche verlassen hat, öffnet Olga den Kühlschrank und nimmt eine Flasche von demselben Weißwein heraus, den wir schon probiert haben. Weißwein schmeckt mir. Olga ermutigt mich, weiterzutrinken. Sie selbst nimmt auch einen Schluck. Dann zeigt sie mir, wie Abwaschen geht und Abtrocknen. Ich versuche, ihr die Maschine zu erklären, die das im Heim erledigt hat. Mir macht es Spaß, Olga zum Lachen zu bringen. Je genauer ich die Funktionsweise unserer Abwaschmaschine beschreibe, desto lauter lacht Olga. Dann nehmen wir jeder noch einen Schluck.
»Hurra! Wir sind Weltmeister!«, rufe ich, als wir das Wohnzimmer wieder betreten. »Hurra!«
Achtes Kapitel
In dem Peter Stimmen hört und einen Klassenfeind erkennt. Pläne für die Zukunft und ein Geschenk.
Als ich erwache, ist es hell. Zuerst denke ich, ich sei auf der Polizei. Die Vögel singen. Ich erkenne ein Regal. Die Fächer sind vollgestopft mit Büchern und den ramponierten Schachteln von Spielen. Neben meinem Bett steht ein roter Plasteeimer, dessen Boden mit Wasser bedeckt ist. Hineinzusehen verstärkt die Übelkeit. Ich höre Stimmen. Ich habe noch meine Hose an und das Nicki. Eine Mücke schwirrt über mir. Sie ist es also, die die Stimmen verspinnt.
»Olga!«
»… ist doch schon fast vierzehn! Ein Mädchen in dem Alter, alle Achtung!«
»Das ist es ja. Eigentlich ist sie überhaupt nicht kindlich, nicht die Bohne … furchtbar frühreif!«
»… ein richtiger Junge eben, guter Kerl, wirklich, aber …«
»Jedenfalls ist das ziemlich kompliziert. Aber wenn er sich hier bei uns wohlfühlen würde …«
»Was? Ihr wollt doch nicht etwa …«
»Wart doch erst mal ab …«
»Allgemein, ganz allgemein!«
»Was heißt das denn: die Gesellschaft allein?«
»Lass mich ausreden! … ein Zuhause.«
»Adoptieren!?«
»Er hat eine gute Einstellung. Außerdem …«
»Klassenbewusstsein? Das ist nicht dein Ernst?«
»Wenn du länger mit ihm … (lacht) Er ist wirklich überzeugt von dem, was er sagt …«
»Glaub ich nicht! Glaub ich einfach nicht!«
»Der hat doch ’ne Meise! ’ne Scheibe hat der Kleine!«
»Lach nicht so! Es gibt viel zu wenige seiner …«
»So ein Holzkopf!«
»… jemand, der selbstlos handelt, eben ein neuer … ein Charakter eben.«
»… neuer Typ Mensch, wolltest du das damit sagen?«
»Klaus! Nun lass mal Beate ausreden!«
»… erst mal überraschend. … doch gut … und dafür eintreten.«
»Er ist ein Kind, Beate, ein Kind!«
»Stimmt doch, dass es viel zu wenige gibt. Denkst du, Olga macht noch einen Finger krumm, wenn es darum geht, Altstoffe zu sammeln? Und die zahlen gut, da hast du ganz schnell zehn Mark!«
»Altstoffsammlung?! Soli-Aktion?! Ihr spinnt doch! Ihr spinnt komplett!«
Pause
»… an die Ostsee gefahren? Wie war er denn da so?«
Pause
»Braucht Olga denn guten Einfluss? Die ist völlig in Ordnung? Und bei so einem Kaspar Hauser! Da weißte nie, was noch … minderjährig und abgerichtet, der ist ’ne Wanze! ’ne Wanze, sag ich dir!«
»Du widersprichst dir ja unentwegt selbst!«
»… faustdick! Der steckt euch alle in den Sack!«
»Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit!«
»Jetzt fang du auch noch an …«
»… Spanienkämpfer, in Frankreich interniert, in Dachau …«
»Du meinst diesen Löschau?«
»… ihn gefoltert.«
»Nicht jeder, der im KZ war …«
»Er aber … recht anschaulich offenbar. Das durfte er nicht mehr erzählen.«
»Ist ja auch nichts für Kinder!«
»… von den Folterern genannt. Immer wieder, bis die Kinder die Namen kannten.«
»…?«
»… von Peter.«
»Was?«
»Wieso Westen?«
»Gibt es doch, dass sie die Kinder behalten, wenn sie klein sind …«
»… du denn das Märchen her?«
»… abgerichtet. Sie haben ihn abgerichtet! Verbrecher!«
»Wer sich um Waisenkinder kümmert, ist kein Verbrecher!«
»Du weißt doch, das alte Thema von Klaus.«
»Ohne Mauer wäre das Kind vielleicht gar nicht im Heim gelandet!«
»Es hat doch überhaupt niemand behauptet …«
»Ohne Mauer … ihre Ärsche vergoldet, Nazipack.«
»Wer hier geraubt und wer hier enteignet hat, ist doch wohl klar! Oder? Die Kommunisten natürlich!«
»Ach, Klaus! Das hat doch alles nichts mit Peter zu tun!«
»… eben. In diesem famosen Staat … Taxi!«
»Ich hab aber noch keine Lust zu gehen!«
»Ich bitte dich, Klaus …«
»Lass ihn, lass ihn doch! Wenn er gehen will …«
»Peter!«
»Eine ist gegen uns«, sage ich. »Unter den Mücken ist ein Klassenfeind!«
»Er träumt«, sagt Beate. »Er nachtwandelt.« Beate ist aufgestanden, sie legt einen Arm um meine Schulter und führt mich zurück ins Zimmer.
»Ich will nicht allein schlafen«, sage ich, als sie die Decke über mich zieht.
»Vergiss nicht, die Augen zuzumachen«, flüstert Beate.
»Ich will nicht allein schlafen«, wiederhole ich.
Am nächsten Tag, Olga und Wanka sind seit dem Morgen verschwunden, ich warte auf den Gong zum Mittagessen, bitten mich Beate und Hermann ins Wohnzimmer. Sobald ich sitze, verkünden sie mir, dass – erstens – sie Paul Löschau noch immer nicht haben ausfindig machen können und dass – zweitens – ich noch ein paar Tage bei ihnen bleiben kann, falls ich das wünsche, und – drittens – sie mich zukünftig gern in Gradow an der Elbe besuchen würden. Dann überreicht mir Beate einen Karton. Es ist ein Föhn, ein nagelneuer Föhn, der Haartrockner EfBe LD 65 aus dem VEB Elektrogeräte Bad Blankenburg, in Hellblau, meiner Lieblingsfarbe!
Buch II
Erstes Kapitel
In dem Peter die Klassenlehrerin der 8b empfängt. Frau Rosanowski begibt sich in Gefahr. Olga bringt Kuchen, Rat und Tat. Peter, der Verwirrte.
Frau Rosanowski hat sich bereits eine Zigarette angezündet, das Streichholz ausgewedelt und hält es nun demonstrativ in die Luft.
»Aschenbecher?«, fragt sie.
Ich öffne die Türen der Küchenschränke, als wollte ich ihr den Hausrat der Grohmanns vorführen.
»Untertasse tut’s auch«, sagt Frau Rosanowski und bläst den Rauch über meinen Kopf. »Was du Herrn Malitzki da gesagt hast, Peter …« Sie beugt sich zu der randvollen Kaffeetasse hinunter und schlürft. »Was du da gesagt hast, das stellt für uns alle ein Problem dar, ein großes Problem.«
»Was für ein Problem?« Ihr Tonfall beunruhigt mich.
»Du kannst Wolfgang seine ganze Zukunft verbauen«, sagt Frau Rosanowski in ihre Tasse hinein.
»Ich?«, frage ich. »Ich bin es doch gewesen, der ihn korrigiert hat! Als Einziger habe ich widersprochen und ihn in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, wie falsch seine Sichtweise ist!«
Frau Rosanowski pflichtet mir umgehend bei, wobei eine Welle ihren Körper durchläuft, ein Nicken, das aus dem Rückgrat heraufrauscht, über Schultern und Hals ansteigt und den Kopf nach vorn wirft. »Da hast du natürlich recht! Vollkommen recht! Wahrlich dummes Zeug!«
»Hat Peter wieder dummes Zeug erzählt?«
»Olga!«, ruft Frau Rosanowski und fährt herum.
Olga bleibt vor uns stehen, ein Päckchen auf der einen Hand und eine Papiertüte in der anderen. »Streuselkuchen und Kuchenränder!«
Olga reicht ihr die Tüte. Frau Rosanowski verzieht das Gesicht.
»Kuchenränder kosten nix«, sagt Olga. »Hat Peter wieder agitiert?«
»Nicht Peter, ein Mitschüler, ein guter Schüler, sehr intelligent! Er hat nur …«
»Wolfgang hat behauptet«, erkläre ich Olga, »bei uns gebe es keine Freiheit, denn wir dürften nicht in den Westen fahren, und die Wahlen seien auch keine richtigen Wahlen, und unser Parlament sei kein richtiges Parlament, weil die Beschlüsse dort alle einstimmig fielen. Und als ich ihm sage, dass er da der westlichen Hetze ganz schön auf den Leim gegangen sei, hat er gesagt, dass er das von seinem Vater habe und seinem Vater mehr glaube als mir oder der Aktuellen Kamera.«
»Ich glaube meinem Vater auch mehr als der Aktuellen Kamera«, sagt Olga. »Und unser Peter hat – widersprochen?«
»Ja«, sagen Frau Rosanowski und ich zugleich, obwohl ich mir vorgenommen habe, nicht mehr zu antworten, wenn Olga die Wendung »unser Peter« benutzt.
»Er hat ihm nicht nur widersprochen.« Frau Rosanowski macht ein Seufzgeräusch in die Tasse und drückt ihre Zigarette aus.
Ich erkläre Olga die Situation, auf die Frau Rosanowski anspielt. Im Staatsbürgerkundeunterricht, als Herr Malitzki uns den demokratischen Zentralismus erläuterte und nachwies, dass das westliche System eine Scheindemokratie ist, weil außer der DKP