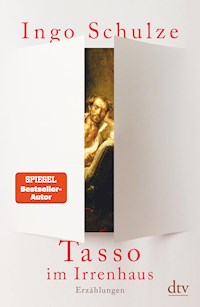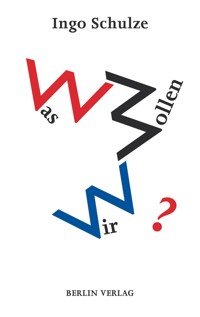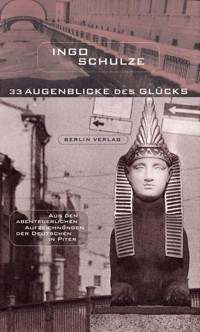8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rien ne va plus - es gibt kein Zurück und alle Wege stehen offen: Ostdeutsche Provinz, Januar 1990. Enrico Türmer, Theatermann und heimlicher Schriftsteller, kehrt der Kunst den Rücken und heuert bei einer neu gegründeten Zeitung an. Scheinbar erlöst vom Zwang, die Welt zu beschreiben, stürzt Türmer sich ins tätige Leben. Unter der Leitung seines Mephisto, des allgegenwärtigen Clemens von Barrista, entwickelt der Schöngeist einen ungeahnten Aufstiegswillen. Von dieser Lebenswende in Zeiten des Umbruchs erzählen die Briefe Enrico Türmers, geschrieben im ersten Halbjahr 1990 an seine drei Lieben - an die Schwester Vera, den Jugendfreund Johann und an Nicoletta, die Unerreichbare. Während er den Kapitalismus für sich entdeckt und von den Abenteuern des Geschäftsmannes berichtet, trägt er die Schichten seines bisherigen Lebens ab. Dabei entsteht, wovon Türmer so lange geträumt hat: Der Roman seines Lebens, in dessen Facetten sich die Zeitgeschichte bricht und spiegelt. So wird die widersprüchliche Gestalt Türmers zur Allegorie für die Fragwürdigkeit der alten, aber auch der neuen Leben. In seinem lang erwarteten neuen Roman erweist sich Ingo Schulze wiederum als großer Erzähler, der es auf unnachahmliche Weise versteht, den Irrwitz der so genannten Wendezeit heraufzubeschwören. Als Chronist der jüngsten deutschen Geschichte gelingt ihm das Panorama des Weltenwechsels 1989/90 - der Geburtsstunde unserer heutigen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Ingo Schulze
Neue Leben
Die Jugend Enrico Türmers in Briefen und ProsaHerausgegeben, kommentiert und mit einem Vorwortversehen von Ingo Schulze
BERLIN VERLAG
Für ChristaFür NataliaFür ClaraFür Franziska
VORWORT
Auf der Suche nach einem Romanstoff begann ich vor sieben Jahren Material über deutsche Geschäftsleute zu sammeln. Heinrich Türmer weckte mein Interesse, weil er in wenigen Jahren, gründend auf einer Zeitung, ein kleines Imperium geschaffen und eine ganze Region an der Grenze von Thüringen und Sachsen unter seinen Einfluss gebracht hatte. Das Ende von Türmers weitverzweigtem Unternehmen kam ebenso überraschend wie aufsehenerregend. Zum Jahreswechsel 1997/98 standen Gläubiger und Steuerfahnder vor offenen Türen und leeren Kassen. Türmer hatte sich der Strafverfolgung durch Flucht entzogen. Die Rechnung für seine Spekulationen zahlten andere, die Folgen sind bis heute in der Region spürbar.
Bei meinen Recherchen stieß ich auf viele merkwürdige und ungewöhnliche Vorgänge. Ein unspektakuläres Detail aber führte mich zu einer Entdeckung, die unerwarteter nicht hätte sein können.
Türmer hatte ursprünglich den Vornamen Enrico getragen und ihn erst in der zweiten Jahreshälfte 1990 zu Heinrich germanisiert. Ein in Dresden geborener und aufgewachsener Enrico Türmer jedoch war mir bekannt: als Bruder von Vera Türmer – einer Freundin, zu der nach ihrer Ausreise in den Westen der Kontakt verloren gegangen war – sowie als Schüler einer Parallelklasse. Mir fiel es schwer zu glauben, dass jener korpulente und elegant gekleidete Geschäftsführer auf den Zeitungsfotos derselbe Mensch sein sollte wie der unauffällige Enrico, mit dem ich einst Fußball gespielt und im Chor gesungen hatte.
Zu meiner weiteren Überraschung fand ich unter dem Stichwort Türmer einen aufwendig ausgestatteten Band Kurzprosa (Göttingen 1998). Ich vermute, dass die Publikation ohne das finanzielle Zutun des Autors nicht möglich gewesen wäre. Die wenigen Reaktionen waren ausnahmslos geringschätzig. Zu Recht. Wäre da nicht der bittere Beigeschmack seiner Flucht, ließe sich Türmers Versuch honorieren, den Alltag eines Unternehmers mit seinen Sorgen, Nöten und Freuden literaturfähig zu machen. Im Vorwort preist Türmer die Welt der Arbeit als »das gelobte Land zukünftiger Literatur«.
Meine Versuche, über den Verlag Kontakt mit Heinrich Türmer aufzunehmen, misslangen. Antwort erhielt ich dagegen von Vera Barakat-Türmer. Sie bestärkte mich sogar in meinem Wunsch, das Leben ihres Bruders als Vorlage für einen Roman zu verwenden. In selbstloser und großzügiger Weise stellte mir Vera Barakat-Türmer alle Aufzeichnungen ihres Bruders zur Verfügung, die er bereits 1990 in ihre Obhut gegeben hatte und die deshalb einer Beschlagnahme entgangen waren. Nun, so hoffte ich, würde ich den Fall Türmer zumindest bis in die Anfänge seines Unternehmertums nachvollziehen können.
Verteilt auf fünf voll gestopfte staubige Schuhkartons, fanden sich Tagebücher, Briefe, Notate und fragmentarische Prosaarbeiten neben Quittungen, Fahrscheinen, Einkaufszetteln und Ähnlichem. Das meiste, was Türmer – als Schüler in Dresden, Soldat in Oranienburg, Student in Jena und Theatermann in Altenburg – zwischen 1978 und 1990 zu Papier gebracht hatte, erwies sich aber für meine Zwecke als wertlos. Schwer erträglich war der pubertäre Tonfall. Türmer, so kam es mir vor, schielte selbst in seinen Briefen mit jedem Satz auf ein imaginäres Publikum. Bezeichnenderweise behielt er von seinen eigenen Briefen immer einen Durchschlag, die an ihn gerichteten dagegen bewahrte er nur äußerst selten auf.
Mein wachsender Widerwille gegen die Figur Türmer drohte das Vorhaben bereits zu gefährden, da wurde ich endlich fündig.
Vor mir lagen die Briefe an Nicoletta Hansen. Ihre Qualität ließ mich an Türmers Autorschaft zweifeln, doch vergeblich suchte ich in der Handschrift nach Indizien für meinen Verdacht.
Zwischen den Briefen an Nicoletta lagen in unregelmäßigen Abständen Schreiben an den Jugendfreund Johann Ziehlke aus derselben Zeit, dem ersten Halbjahr 1990. Auch hier schien Türmer, wie schon in den Briefen an Nicoletta, das geglückt zu sein, was er in seiner Prosa immer vergeblich versucht hat.
Auf meine Bitte hin gelang es Vera Barakat-Türmer, sowohl Nicoletta Hansen als auch Johann Ziehlke zu bewegen, mir sämtliche Briefe im Original zur Einsichtnahme zu überlassen. Zudem vertraute mir Vera Barakat-Türmer dreizehn an sie gerichtete Briefe ihres Bruders an.
Als ich die Briefe an alle drei Adressaten chronologisch geordnet (vom 6. Januar bis 11. Juli 1990) und komplettiert las, entfaltete sich vor mir das Panorama jener Zeit, in der das Leben Türmers auf der Kippe gestanden hatte, und nicht nur seins.
Ich las von einem Theatermann, der zu einem Zeitungsredakteur, von einem gescheiterten Schriftsteller, der zu einem glücklichen Unternehmer wird, ich las von einem Schuljungen, dessen Wunsch nach Ruhm sich als Fluch erweist, von einem Soldaten, der dem Einmarsch in Polen entgeht, nicht aber seinen Kameraden, von einem Studenten, der sich in eine Schauspielerin verliebt, von einem Zauderer, der zum Helden wider Willen wird, ich las von Demonstrationen und ersten Schritten in den Westen, ich las von einem Bruder, der nicht ohne seine Schwester leben kann, ich las von Krankheit und Teufelsbeschwörung – mit einem Wort, ich las einen Roman.
Und ich beschloss, mein eigenes Romanvorhaben zurückzustellen und mich mit ganzer Kraft der Herausgabe dieser Briefe zu widmen.
Um es vorwegzusagen: Die Suche nach einem Verlag wie auch die Gespräche mit den Betroffenen nahmen Jahre in Anspruch.
Nicht immer war es möglich, das Einverständnis von allen zu erreichen oder auf ihre Bedingungen einzugehen. Wie wenig ausgewogen, ja wie falsch und gehässig mitunter Türmers Beschreibungen sein konnten, haben fast alle erfahren müssen, auf die sein Blick fiel. Auch dem Verfasser dieser Zeilen blieb es nicht erspart, sich entstellt im Türmer’schen Zerrspiegel wiederzufinden.
Mein besonderer Dank gilt der Schauspielerin Michaela von Barrista-Fürst und ihrem Sohn Robert Fürst, mit denen Türmer damals zusammengelebt hat. Ohne ihr Verständnis und ohne ihre Großmut wäre das Vorhaben zum Scheitern verurteilt gewesen. Elisabeth Türmer zögerte lange mit ihrer Zusage, wirft doch die Veröffentlichung nicht gerade das günstigste Licht auf ihren Sohn. Dass sie schließlich einwilligte, verdient Anerkennung. Auch Johann Ziehlke, Freund aus Schultagen und studierter Theologe, musste für die Zustimmung über seinen Schatten springen. Denn als Vertrauter und leitender Angestellter Türmers bedeutete dessen Flucht nicht nur den Verrat an ihrer Freundschaft, sondern brachte ihn und seine Familie juristisch und finanziell in größte Schwierigkeiten. Die wenigen von ihm erbetenen Streichungen waren hinnehmbar und für den Gesamteindruck ohne Bedeutung.
Manchmal war ein Einverständnis nur durch die Zusage zu erlangen, auch eine gegenteilige Position zu Wort kommen zu lassen. Dass sich Marion und Jörg Schröder, die ehemaligen Zeitungskollegen, auf diesen Kompromiss eingelassen haben, freut mich sehr. Nicht zuletzt möchte ich Nicoletta Hansen danken, die ihr Verhältnis zu Türmer bereits 1995 wieder gelöst hatte. In einigen Fällen fehlt die Einwilligung, weil, wie zum Beispiel bei Dr. Clemens von Barrista, die Aufenthaltsorte nicht zu ermitteln waren.
Zu Anhang und Kommentar ist Folgendes zu bemerken:
Zwanzig der Briefe an Nicoletta Hansen wurden auf den Rückseiten alter Manuskripte geschrieben. Diese Manuskripte sind – und Türmer selbst hatte das als Erster erkannt – bestenfalls zweitrangig, dazu lückenhaft und unvollendet. Sie werden hier im Anhang abgedruckt, um das Verständnis dessen, was in den Briefen ausgespart bleibt oder nur angedeutet wird, gelegentlich zu verbessern.
Die Fußnoten sollen die Lektüre erleichtern. Was dem einen oder der anderen überflüssig erscheinen mag, werden gerade jüngere Leser dankbar zur Kenntnis nehmen. Ich habe mich eines Kommentars enthalten, wenn sich der Sachverhalt aus späteren Passagen erschließen lässt.
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgehen, dass der Briefschreiber Türmer ein und denselben Vorgang je nach Adressat in höchst unterschiedlichen Versionen schildert. Dies zu bewerten ist nicht Sache des Herausgebers.
Mein Erstaunen über Türmers geradezu manischen Bekenntnisfuror beantwortete Vera Barakat-Türmer mit der Bemerkung: »Ich habe mich bei Enrico immer gewundert, warum er so ein großes Bedürfnis hatte, sich jemandem anzuschließen und mitzuteilen. Es gab in jeder Phase seines Lebens einen Menschen, den er rückhaltlos bewunderte und dem er sich beinah hündisch ergeben zeigte.«
Ingo SchulzeBerlin, im Juli 2005
EDITORISCHE NOTIZ:
Die meisten Briefe wurden mit der Hand geschrieben, ein kleinerer Teil auf der Schreibmaschine, die letzten mit Computer.
Mit wenigen Ausnahmen behielt T. immer einen Durchschlag bzw. Computerausdruck. Sofern Original und Kopie vorlagen, wurden nur wesentliche Veränderungen vermerkt, wie beispielsweise Streichungen. Die von T. hervorgehobenen Wörter sind hier kursiv gesetzt.
Etwas unübersichtlicher verhält es sich mit dem kleinen Corpus von 13 Briefen an Vera Türmer. Von den Briefen nach Beirut haben sich lediglich drei erhalten, und zwar als Kopien. Die beiden Faxbriefe liegen nicht als empfangene Schreiben vor. Der letzte Brief wurde nicht mehr abgeschickt.
Fehler in Rechtschreibung und Grammatik wurden stillschweigend korrigiert, wobei auf die Eigenheiten Türmers sowie regionale Besonderheiten Rücksicht genommen wurde.
I. S.
[Sonnabend, 6. 1. 90]
[An Vera]1
… so?« Statt wie sonst hinter uns herzutrotten und für jeden Schritt eine Belohnung zu fordern, sprang Robert wie ein junger Hund davon. Wir mußten durch eine Senke, der Schnee schimmerte bläulich und reichte uns bis zu den Waden. Plötzlich schrie Robert auf und rannte den gegenüberliegenden Hang hinauf. Der Modder unterm Schnee war nicht gefroren. Auch Michaela und ich rannten. Als wir stehenblieben, hatten wir nur das weiße Feld vor und den graurosa Himmel über uns. Wir stiegen höher, überquerten einen Feldweg und gingen direkt auf den Wald zu. Der Wind fegte den Schnee von der Wintersaat. Ich gab mir Mühe, nicht hinter den beiden zurückzubleiben. Sie kehrten aber nicht wie verabredet am Rand des Waldes um, sondern liefen hinein. Und so folgte auch ich dem Wegweiser »Zum Silbersee«.
Der Teich war zugefroren. Bevor ich etwas sagen konnte, schlitterte Robert bereits übers Eis und Michaela hinterher. Robert, der stolz ist, im Stimmbruch zu sein, krähte etwas, das ich nicht verstand. Michaela rief, ich sei ein Angsthase. Aber ich wollte nichts riskieren und blieb am Ufer. Der Schnee bedeckte den herumliegenden Müll, aus dem ein Spielzeugpferd ragte. Ich bückte mich schon, da hörte ich meinen Namen, wandte mich um – etwas traf mich ins Auge. Es brannte höllisch.
Ich sah nichts mehr. Michaela glaubte, ich spiele Theater. Es sei doch Schnee gewesen, rief sie, nur Schnee, ein Schneeball!
Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu mir zu kommen. Als mich Robert an der Hand nahm, als er mich führte, war ich glücklich. Erst in diesem Moment schien ich zu begreifen, daß ich nicht mehr nur von diesem Deinem Brief träumte, sondern daß ich ihn tatsächlich erhalten hatte und in der Brusttasche trug. Ja es war, als hätte ich erst jetzt wieder angefangen zu atmen.
Michaela, die hinter uns herstiefelte, fand, ich solle mich nicht so haben. Sie meinte wohl, ich würde weinen. Sie hält mich für einen Hypochonder, für einen Simulanten gar, und fürchtete, ich suchte nur einen neuen Vorwand, um mich weiter krank schreiben zu lassen.
Mitten auf dem Feld geriet sie in Panik, weil vom Dorf her ein Köter auf uns zuraste. Er kläffte und machte wilde Sprünge, ließ sich aber schnell von mir beruhigen. Ich wurde ihn dann gar nicht mehr los. Das verwahrloste Tier begleitete uns bis zu der Straße, die den Hügel hinab zur Stadt führt. Robert winkte, und prompt hielt ein Wagen. Die Frau, die kerzengerade hinterm Lenkrad saß, nickte mir im Rückspiegel zu. Als schlüge mein Herz im Kopf, pochte der Schmerz im Auge. Aber dieser Schmerz, so kam es mir vor, war etwas Äußerliches, nichts, was mir wirklich etwas anhaben konnte, nichts, was mich beunruhigen mußte, ganz egal, was mit dem Auge werden würde, denn ich habe ja Dich!
Am Eingang der Poliklinik lief ich Dr. Weiß, meinem Krankschreibearzt, in die Arme. »So schnell verliert man kein Auge«, sagte er und faßte mich an der Schulter. Freitags würde ich hier um diese Zeit niemanden mehr finden, ich solle also stillhalten, Arzt sei Arzt. »Zeigen Sie her«, befahl er und drehte mich ins Licht. Die Leute schoben sich an uns vorbei hinein und hinaus, ich blinzelte in die Neonröhre. »Nur ein Äderchen«, murmelte er, »nur ein geplatztes Äderchen. Sonst ist da nichts!« Weiß ließ mich auf der Schwelle stehen, als bedauere er, sich überhaupt um mich gekümmert zu haben. Ich solle jetzt nicht zimperlich werden, rief er noch und verschaffte Michaela ihren Triumph. Mittlerweile tut es nicht mal mehr weh.
Der Schnee ist schon wieder getaut. Das Gras unter den Wäschestangen sieht aus wie Matsch mit Spinat. Ich muß Michaela zur Vorstellung fahren. Wie leicht alles wird, wenn ich an Dich denken kann.
In Liebe
Dein Heinrich2
Sonnabend, 13. 1. 90
Liebste Verotschka!
Ich war jeden Tag draußen, nie weniger als eine Stunde. Zudem bin ich fürs Einkaufen und Kochen zuständig und habe Roberts Schulspeisung den Rang abgelaufen, was kein Kunststück ist. Robert darf sich jeden Abend wünschen, was es mittags geben soll. Heute habe ich mich in Eierkuchen versucht. Und siehe da, Michaela hat sogar aufgegessen, was wir übrigließen. Ihre Kochbücher sind zur Zeit meine einzige Lektüre.
Diese Woche habe ich gleich zweimal an Mamus3 schreiben müssen. Der zweite Brief war notwendig geworden, weil Michaela sie angerufen4 und gefragt hatte, ob sie denn schon von meiner Entscheidung5 gehört habe.
Wir geben uns hier nicht mit Kleinigkeiten ab, es geht um den Verrat an der Kunst, Verrat an ihr, also an Michaela, an unseren Freunden, überhaupt am Leben, worauf ich ihr immer entgegenhalte, nicht ich sei desertiert, sondern die Kunst. Das akzeptiert sie natürlich nicht.6
Gestern nachmittag war ich nun zum ersten Mal in der »Redaktion«. Das Haus, das Georg, einem der beiden Zeitungsgründer gehört, liegt etwa dreihundert Meter hinter der Post in der Frauengasse. Man glaubt, am Ende der Welt zu sein. Hat man aber das Nadelöhr aus einstöckigen Ruinen und einer schiefen Mauer passiert, wird die Welt wieder freundlicher. Georgs Haus steht in einem Garten, ein Landhaus en miniature. Die Gartenpforte wird von einer maroden Holzkonstruktion, einem Rosengitter, überwölbt. Die Klingel erweckt Tote.
»Du kommst ja wirklich«, sagte er. Im Hausflur standen alle möglichen Gartengeräte und viele Fahrräder.
Links, der Treppe gegenüber, gelangt man durch einen fensterlosen Vorraum in eine kleine Stube mit breiten Dielen und Balkendecke, an die ich mit ausgestreckten Armen heranreiche. Tisch und Stühle nehmen fast den ganzen Raum ein. Es roch nach Möbelpolitur und Kaffee. Im Sitzen bin ich größer als Georg, dessen Oberkörper kurz und krumm auf seinen endlosen Beinen hockt. Solange er über die Pläne für die Zeitung sprach, sah er auf seine gefalteten Hände. Machte er eine Pause, verschwand sein Mund inmitten des Bartes. Dann blickte er mich von unten her an, als wolle er die Wirkung seiner Worte prüfen. Ich war unsicher, wie ich ihn anreden sollte – wir hatten uns bei unserer ersten Begegnung gesiezt.
Auf den Fensterbrettern stehen Briefwaagen. Die Scheiben sind alt und geben einen verzerrten Blick auf den Garten frei. Es reicht, den Kopf ein wenig zu bewegen, und die Bäume schrumpfen zu Sträuchern oder wachsen in den Himmel.
Später stiegen wir hinterm Haus empor, der Garten erhebt sich in mehreren Terrassen. Als ich glaubte, wir müßten umkehren, teilte Georg das Dickicht und begann einen steilen Trampelpfad hinaufzulaufen. Ich hatte Mühe zu folgen. Dann eine traumhafte Aussicht: unter einem lila Himmel lag die Stadt zu unseren Füßen, rechts der Schloßberg, links Barbarossas Rote Spitzen!7 Alles wirkte wohltuend fremd, sogar das Theater sah ich wie zum ersten Mal.
Ich inhalierte den Modergeruch und die kalte Luft und war sehr froh, diesen Blick von nun an genießen zu können, wann immer ich will.
Jörg, mein zweiter Chef, war inzwischen eingetroffen und hatte Tee gekocht. Er ist genau um das Stück kleiner, um das mich Georg überragt. Jörg formuliert druckreif. Was mich betrifft, scheint er seine Zweifel zu haben. Er ließ mich nicht aus den Augen und lächelte leicht spöttisch bei allem, was ich sagte. Aber das kann mich nicht abschrecken.
Georg und Jörg wollen mir dasselbe zahlen wie sich selbst, das heißt, ich werde zweitausend netto verdienen, fast das Dreifache meiner Gage als Dramaturg. Sie haben die Hoffnung aufgegeben, vom Neuen Forum Geld zu bekommen.8 Hauptsache, ich muß nicht mehr ins Theater. Dort ginge ich vor die Hunde. Es gibt keinen langweiligeren Ort!
Kurz vor sechs lud uns Georg zum Abendbrot ein. Franka, seine Frau, und die drei Söhne hatten sich schon um den Tisch versammelt. Als wir uns setzten, wurde es plötzlich still, unwillkürlich erwartete ich ein Tischgebet. Doch das blieb aus.
Ich lese jetzt Zeitungen. Auf der ersten Seite vom ND9 ein Photo von Havel.10 Da hat er gerade noch rechtzeitig die Profession gewechselt. Dafür sieht Noriega jetzt aus, wie von der Kripo photographiert.11 In Gleina verweigerten vor ein paar Tagen die Soldaten den Dienst.12 Sie forderten ein neues Wehrgesetz. Sogar der Militärstaatsanwalt rückte an. Aber sie ließen sich nicht einschüchtern. Und nun, lese ich, gibt es tatsächlich schon ein neues Wehrgesetz!
Ich denke die ganze Zeit an Dich!
Dein Heinrich
[Sonntag, 14. 1. 90]
Verotschka!
Dein Brief liegt seit gestern hier, in der Küche, auf dem Kühlschrank. Michaela hatte die Post geholt, deshalb war der Kasten leer, als ich nachsah. Vorhin, nach dem Frühstück, erkannte ich plötzlich Deine Schrift auf einem Kuvert.
Jetzt, da der Termin feststeht und Dein Flug gebucht ist … Seit ein paar Tagen fühle ich mich so stark wie schon lange nicht mehr. Selbst dem fuchsig lauernden Jörg war ich gewachsen. Bald jedoch, wenn Du so weit weg sein wirst … Oje, ich klinge wie Mamus. Weiß sie überhaupt davon?
Ich habe keine Vorstellung von Beirut, aber ich verstehe nicht, warum Nicola13 seine Mutter nicht lieber nach Berlin bringen will? Und was für Geschäfte wollen sie denn in dieser Trümmerwüste machen?
Ich habe Angst um Dich, auch ein egoistisches Gefühl. Ich werde Dir nicht helfen können. Zweitausend Mark sind auf meinem Konto. Brauchst Du das? Wieviel ist das? Dreihundert DM?
Zeit könnte ich Dir sehr viel mehr geben. Es ist wie verhext, um vier, spätestens um fünf bin ich wach. Dabei gehe ich selten vor zwölf ins Bett. Doch von Müdigkeit keine Spur, nicht mal nachmittags. Wenn mir das Sinnieren zu langweilig wird, blättere ich im Duden. Es ist merkwürdig, wie viele Verben und Adjektive man kennt, ohne sie je zu verwenden.
Mitte der Woche rief ich Johann an, um ihm zu sagen, daß ich am Theater gekündigt habe und bei einer neugegründeten Zeitung anheuere. Er war äußerst reserviert und kurz angebunden. Jetzt kam ein Brief, der klingt, als hätte Michaela ihn diktiert. Früher hätte ich doch nie Zeitung gelesen, warum ich mich vor den neuen künstlerischen Herausforderungen (er hat tatsächlich dieses Wort verwendet!) drücken wolle. So ging das über vier Seiten. Wie fremd er mir geworden ist!
Was Du über diesen Adligen schreibst, klingt ja ganz verheißungsvoll. Wenn er tatsächlich nach Altenburg kommen will, kannst Du ihm meine Adresse geben, in der Redaktion werden wir bald ein Telephon haben.
Verotschka, wenn ich Dich schon nicht sehen darf, dann schreib mir wenigstens, was Du machst, die letzten Handgriffe, irgendwas! Außer Dir habe ich niemanden, auf den ich zählen kann.
Dein Heinrich
Donnerstag, 18. 1. 90
Lieber Jo!
Ich habe Deine Briefe bekommen und gelesen, mir fehlt es aber an Lust und an Kraft, mit Dir zu streiten. Ich würde mich sowieso nur wiederholen. Warte noch ein paar Monate, dann werden wir gar nicht mehr darüber reden müssen.
Ich mache kleine Spaziergänge, lese Zeitungen und koche mittags für uns. Plötzlich habe ich so viel Zeit, daß ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll.
Gestern war ich sogar bei einer Versammlung des Neuen Forums, nicht ganz freiwillig, wie ich gestehen muß. Rudolph Franck, der wegen seines grauen Zuckerwattebartes der »Prophet« genannt wird, hatte mich gebeten zu kommen. Seiner Initiative und Fürsprache verdanke ich die Arbeit bei der Zeitung. Was er sich von meiner Anwesenheit versprach, ist mir schleierhaft. Ich werde ihn wohl enttäuscht haben.
Jörg meinte, es gebe ein Gerücht, Gerücht sei schon zuviel, man wispere nur, daß, wenn jemand (so wie ich) im Herbst den Mund nicht voll genug gekriegt hat, dann aber von heut auf morgen abtaucht, die Sache nicht koscher sein könne. Ich fürchte, es ist Jörg selbst, der solches Zeug streut. Es würde zu ihm passen.
Ein paar hundert Leute waren im Saal. Ich wollte mich schon setzen, als ich hinter mir meinen Namen hörte. Ich kannte diesen Mann nicht, braunäugig, mittelgroß, dunkles schütteres Haar. Er sei so froh, mich hier wiederzusehen. Seine Frau versicherte mir, wieviel ihr Ralf von meiner Rede damals in der Kirche erzählt habe. Mit ihr und Ralf geriet ich an einen der vorderen Tische. Georg und Jörg saßen bereits im Präsidium. Und dann ging es los.
Anfangs wurde ständig abgestimmt, um alles mögliche zu bestätigen. Eine derartige Prozedur habe ich mein Lebtag nicht über mich ergehen lassen müssen. Ich fühlte mich meiner Freiheit beraubt, plötzlich war ich ein Gefangener.
Ralf hingegen schien freudig erregt. Er krempelte seinen Einkaufsbeutel wie einen Ärmel auf, zum Vorschein kamen eine Schreibunterlage und ein A4-Block. Seine Hoffnung, sein Stolz, ja seine ganze Überzeugung lagen in der Sorgfalt, mit der er das Blaupapier zwischen die Seiten legte und, den Kopf dicht über dem Blatt, zu schreiben begann. Nur wenn Jörgs Rede vom Beifall unterbrochen wurde, hielt er inne und klatschte, den Kuli in der Rechten, lautlos mit.
Georg saß den ganzen Abend fast reglos am Präsidiumstisch und starrte vor sich hin. Beim Abstimmen riß er allerdings regelmäßig als erster den Arm hoch. Jörg, der Versammlungsleiter, grüßte unentwegt Bekannte, die er im Saal entdeckte, und lächelte. Ganz links erkannte ich jenen Schreihals wieder, der die Demonstration am 4. November gerettet hatte. Seine Augen glänzten.
Vielleicht müssen solche Sitzungen ja sein. Mir aber wurde vor Langeweile richtig schlecht.14
Nach einer Stunde etwa erhob sich zwei Tische entfernt eine Frau. Wegen ihrer großen Brille und der perückenartigen Haarpracht war ihr Alter schwer zu schätzen. Was sie von sich gab, blieb unverständlich. Aufgefordert, lauter zu sprechen, rief sie: »Ich bin bereit, die Führung des Neuen Forums zu übernehmen.« Gebeten, ihren Namen zu nennen, schrie sie enthusiastisch: »Ich heiße«, brach jäh ab und wiederholte ihre Bereitschaft, die Führung zu übernehmen. Von Applaus und Gejohle ermuntert, erhob sie die linke Faust zum Gruß.
Aus Rücksicht auf Georg und Jörg, vor allem aber auf Ralf klatschte ich nicht mit. Schon mein Lächeln schien ihn zu kränken.
Nach ihr riß der Schreihals im Präsidium das Mikro an sich. Er betonte jedes zweite oder dritte Wort und federte dazu in den Knien. Er sprach lachend, als erbrächte jedes seiner Worte den praktischen Beweis, wie unleugbar recht er habe. Mit dem Bleistift zeigte er dann auf diejenigen, denen er das Wort erteilte. Man beschimpfte ihn als Suffkopp15 und Stümper. »Für alles wird es eine Lösung geben«, schrie er, »wenn die grundlegenden Machtfragen beantwortet und demokratische Strukturen geschaffen sind!«
Schon verließen ganze Gruppen den Saal. Plötzlich sprach Ralf. Eine Hand am Gürtel, als müsse er die Hose am Rutschen hindern, hielt er mit der anderen Mikro und Manuskript. Ralf gestikulierte, war deshalb kaum zu verstehen und begriff nicht, was all die Mikro!-Mikro!-Rufe sollten. Punkt für Punkt trug er schließlich seine Forderungen vor, brachte sich selbst aus dem Rhythmus, weil er sich nach Zwischenrufern umdrehte, während seine Frau »Mach weiter!« zischte.
»Keine Übernahme der Westparteien, Partnerschaft mit den anderen demokratischen Kräften im Osten, Stopp dem Flächenabriß der Altstadt, Ermittlungen wegen verkaufter Ratsbibliothek, Bestrafung des Schalck-Golodkowski16, freie Wahlen, Erhalt der Braunkohle, Erhalt der Wismut17 für friedliche Zwecke, Entlassung von Scharfmachern aus dem Schuldienst, Austritt aus dem Warschauer Pakt, Zivildienst …«
»Mach weiter! Mach weiter!« flüsterte seine Frau.
Nach über drei Stunden wurde die Versammlung für beendet erklärt. Einige stimmten das Deutschlandlied an, es ging aber im Lärm unter. Die meisten Tagesordnungspunkte hatten entfallen müssen, so auch die Vorstellung unserer Zeitung.
Ralf schwieg. Ich versuchte zu lächeln. Seine Frau senkte den Blick, als schämte sie sich – für sich selbst, für mich, für Ralf, für die ganze Versammlung. Im Hinausgehen fragte mich Ralf nach meiner Meinung. »Aber ehrlich, Enrico, ganz ehrlich.«
An der Garderobe lief ich dem Propheten in die Arme. »Nein! Nein! Furchtbar!« rief er mir zu und trat schon im nächsten Moment mit seinem »Nein! Nein! Furchtbar!« einem anderen in den Weg. Ich hörte ihn, bis ich das Haus verlassen hatte.
Georg lud mich ein, sie in den »Wenzel«18 zu begleiten, wir würden dort erwartet.
An der Rezeption lehnte ein Hüne, der, als er uns sah, die Arme ausbreitete. Sein graues Jackett hatte Schweißflecken unter den Achselhöhlen. Er drückte mich an seine Brust und raunte mir zur Begrüßung meinen Vornamen ins Ohr. Sogar bei uns zu Hause sei er bereits gewesen. Dann belehrte er uns, Jan Staan, den wir gleich kennenlernen sollten, mit seinem Namen anzureden, also nicht nur »Guten Abend« zu sagen, sondern »Guten Abend, Herr Staan« (ich hätte schwören können, daß er Staan sagte), und auch von Wendungen wie »Freut mich sehr, Sie kennenzulernen« oder »Sehr angenehm« Gebrauch zu machen. Eine Kellnerin schloß gerade das Restaurant ab, und da Wolfgang, wie der Hüne hieß, schwieg, hörten wir für ein paar Augenblicke nur ihre Schritte, das Gezirpe der Lampen und eine ferne Musik. Plötzlich Schreie, Lachen, Rufe, Lärm, ohrenbetäubend! Eine Frau stolperte gegen meine Schulter, blond, füllig, eine Warze am Kinn. Sie betupfte ihr nasses Dekolleté, die weiße Bluse klebte an Bauch und Brüsten, an den Augen zerlief die Schminke. Die Gesichter im Türrahmen verschwanden. Die Blondine bog die Schultern zurück und spreizte sich wie vor einem Spiegel.
Wolfgang, der Hüne, streifte sie auf dem Weg in die Bar, sie fuhr zurück, als hätte er ihr einen Stoß versetzt. Wir folgten ihm ins Dunkel. Ich hielt mich dicht hinter Jörg. »Wollt ihr Polonaise tanzen?« schrie eine Frau und drückte mir ihre heißen Hände auf den Rücken. Jemand tätschelte mich am Hintern. Wohin ich auch sah, ich erkannte bestenfalls helle Kleidungsstücke. Der Scheinwerfer über der Tanzfläche, in dessen Lichtkegel sich nackte Arme wanden, war die einzige Orientierung.
Je weiter wir vordrangen, um so leichter kamen wir voran, um so heller wurde es. Wir steuerten auf eine Gruppe zu, deren äußerer Ring aus Männern bestand. Sie traten zurück und gaben den Blick frei auf eine Schar Frauen, die sich zu zweit oder zu dritt auf den wenigen Sesseln drängten.
Vor dem Mann in ihrer Mitte blieben wir stehen. Er schob sich ächzend nach vorn auf die Kante seines Sessels, erhob sich aber dann trotz seines mächtigen Bauches überraschend mühelos. Er fingerte an den Knöpfen seines Jacketts, während über seine Stirn Lichtpunkte von einer Diskokugel wanderten. Ich empfing als letzter seinen Handschlag und seine Visitenkarte: Jan Steen. Sein Blick glitt an mir herab, er lächelte und ließ sich wieder in den Sessel fallen.
»Jetzt werden Geschäfte gemacht«, rief einer der Männer im Kommandoton und klatschte in die Hände. Widerwillig erhob sich eine Frau nach der anderen, und wir setzten uns auf die noch warmen Sesselpolster.
Jörg und Georg hatten Steen in die Mitte genommen. Weil sie gegen den Lärm und die Musik anschreien mußten, sah es aus, als machten sie ihm Vorwürfe. Steen hingegen hatte offenbar schnell das Interesse an meinen Chefs verloren, sein Blick schweifte umher. Nur wenn er der Kellnerin, einer blondierten Bulgarin, die letztes Jahr, wäre es mit rechten Dingen zugegangen, den Miss-Altenburg-Wettbewerb hätte gewinnen müssen, sein Glas entgegenhielt, lächelte er und prostete den Frauen zu. Die taten, als würden sie ihn nicht sehen. Sie schmollten. Eine war derart beleidigt, daß sie abwinkte und uns ihren nackten fleischigen Rücken darbot.
Wolfgang und ich tranken jeden Weinbrand, den Steen orderte, um Jörgs Abstinenz und Georgs Zurückhaltung wettzumachen. Wolfgang stellte die leeren Gläser zwischen den Schuhen ab, wo auch der Aschenbecher stand, und knetete seine Hände. Er arbeitet für »Lufttechnische Anlagen«, die sich wie das Landestheater abkürzen, LTA. Ich erzählte ihm die Geschichte, wie man hier im »Wenzel« geglaubt hatte, in mir einen Betrüger gefaßt zu haben, weil die »Lufttechnischen Anlagen« sich weigerten, meine Rechnung zu bezahlen. Wolfgang lächelte vor sich hin. Mich hatten die wenigen Sätze heiser gemacht. Wir taten nichts anderes, als in alle Richtungen zu prosten und zu trinken. Bald schon durchflutete mich eine Welle des Wohlwollens.
Neben Wolfgang war eine gleichfalls sehr große Frau stehengeblieben. Ihrer Handtasche entnahm sie eine rahmenlose Brille. Ich wollte ihr meinen Platz anbieten, doch Wolfgang schlug mir auf den Schenkel und erhob sich. Jan Steen verabschiedete die Riesin mit einem Handkuß, ohne sie zuvor zum Bleiben aufgefordert zu haben. Jörg und Georg schlossen sich den beiden an. Und plötzlich war ich allein mit Jan Steen, der sich in einem unerforschlichen Rhythmus mit der Rechten aufs Knie schlug. Wenn ich ihm zuprostete, erwiderte er meinen Gruß mit großer Geste. Nach und nach kehrten die Frauen zurück und scharten sich wieder um ihn. Ich rief ihm zu, wie wunderbar es sei, betrunkene Leute tanzen zu sehen und selber zu trinken. Und dann lachte ich plötzlich, weil ich den Gedanken so komisch fand, daß er und ich nichts voneinander wollten, als beieinanderzusitzen und die Frauen zu beobachten, wie sie ihre Gläser leerten und auf die Tanzfläche staksten, wo sie sich immer wilder, immer schlangenhafter gebärdeten. Wenn es jetzt bloß nicht aufhört, dachte ich, wenn es nur weitergeht.
Jan Steens Doppelkinn führte unter dem schmalen Gesicht ein merkwürdiges Eigenleben. Je häufiger ich es betrachtete, um so klarer erkannte ich darin eine zweite, vollkommen selbständige Physiognomie. Ansonsten war Steens Körper aus einem Guß und wohl von jeher dazu bestimmt, sein Übergewicht zu tragen. Wir prosteten und lächelten uns weiter zu und genossen nebeneinander unser Dasein.
Als ich dann ihr Gesicht entdeckte, war ich sofort voller Begehren und Melancholie. Der Rücken ihres so langen wie dürren Tanzpartners schob sich immer wieder zwischen unsere Blicke. Unverwandt sah sie herüber. Offenbar war sie sich über die Rollenverteilung zwischen Steen und mir im unklaren. Ich wußte ja selbst nicht, was ich hier trieb. Sie war keine Schönheit, aber der Ernst ihres Gesichtes betörte mich.
In den musiklosen Sekunden bat ich sie um den nächsten Tanz. Ihr Begleiter schrie, ich solle mich zum Teufel scheren. Wir begannen zu tanzen. Er, nicht bereit, das Feld zu räumen, trat zwischen uns. Eine Drehung genügte, und er stand wieder abseits. Um ihm zuvorzukommen, nahm ich sie in die Arme, ich dachte nicht nach, ob ich richtig oder falsch handelte, aber als sie sich fügte, sich regelrecht zu mir flüchtete, war es pures Glück. Die Stimme des Dürren bebte vor Empörung, während er seine Geliebte anstarrte. Die Ärmel aufgekrempelt, die Hände halb erhoben, schien er gewillt, uns mit Gewalt voneinander zu trennen. Sie konnte nur an meinem Reflex, an der Bewegung meines Körpers gespürt haben, was geschah. Sie warf ihren Kopf zur Seite, und als würde sie ihm vor die Füße spucken, ergoß sich auf rumänisch, wie ich glaubte, eine Flut von Beschimpfungen.
So unterwürfig, wie er den Blick senkte, habe ich noch niemanden kapitulieren sehen. Sein Gestammel verstand ich nicht. Schließlich steuerte er auf einen Tisch am Rand der Tanzfläche zu, wo er, als er saß, förmlich zusammenbrach.
Sie küßte meinen Hals, und trunken spürte ich eine ungestüme Lust, in die ich nur hinabzutauchen brauchte, um meine Verlorenheit zu vergessen. Mir genügte es, diese Frau bei mir zu fühlen, und alles wurde einfach und klar.
Ich fragte, ob ich sie zu einem Glas einladen dürfe. Sie sah mich nahezu flehend an und schüttelte den Kopf. Etwas später aber nahm ich sie an der Hand und führte sie zu dem Tisch, an dem Steen und die Frauen uns schon erwarteten.
Kaum saßen wir, vor uns ein Tablett mit gefüllten Gläsern, trat ihr Freund heran und forderte sie sehr ernst zum Tanz auf. Ohne aufzusehen, schüttelte sie den Kopf. »Tanz mit mir«, wiederholte er. Es war ein Befehl, doch sein zitterndes Kinn verriet seine Angst.
»Sag etwas«, donnerte er plötzlich auf sie nieder, »sag, daß ich gehen soll! Sag irgendwas, und ihr seid mich los!«
»Ich bitte Sie«, sagte ich und stand auf, »gehen Sie.«
»Ein Wort aus diesem schönen Mund genügt«, preßte er hervor. »Diese da, nicht dieser Schwätzer, soll mir befehlen!« Er zeigte auf sie und entblößte dabei eine Tätowierung auf seinem Handgelenk, verwaschene Buchstaben, ein D und ein F.
Die Frauen begannen auf ihn einzureden. Die Männer im Hintergrund hatten sich mit mir erhoben. Ich war bereit, mich auf ihn zu stürzen, ich wollte diese Farce beenden.
Ich kann nicht sagen, ob es ein Schreckenslaut war oder eine hastige Bewegung, weshalb ich zu Steen sah. Er, der schon vorher kein Auge von meiner Schönen gewandt hatte, starrte sie nun an. Sein Lächeln war in den Mundwinkeln festgefroren. Eine Frau hinter ihm stieß einen Schrei aus. Entsetzt wich man vor meiner Schönen zurück. Mir offenbarte sie sich zuletzt. Hast Du je in einen Mund voller schwarzer Stummel geblickt? Sie lachte, wohl wissend, wie sehr sie damit ihre Häßlichkeit steigerte.
Der Dürre seufzte, machte kehrt und schlurfte davon. Bevor ich etwas sagen oder tun konnte, war sie aufgesprungen und ihm gefolgt. Es war leicht, ihren Weg zum Ausgang zu verfolgen, weil sich die Menge wie von selbst vor ihr teilte und hinter ihr nur zögerlich wieder schloß.
Soviel für heute!
Dein E.
Freitag, 19. 1. 90
Lieber Jo!
Das hier ist Manuskriptpapier, auf das alle Artikel übertragen werden müssen, dreißig Zeilen zu je sechzig Anschlägen. Ich übe schon mal.19
Heute morgen habe ich einen Brief an Dich eingeworfen, in dem ich Dir von meinen nächtlichen Abenteuern berichte. Heute mittag erwartete uns bereits die nächste Prüfung. Georg, Jörg und ich mußten uns nämlich die Gewerbegenehmigung im Handstreich erobern. Die Druckerei in Leipzig will endlich einen Stempel sehen. Ohne Registrierung kein Vertrag. Der Antrag liegt seit Mitte Dezember beim Rat des Kreises.
Das Vorzimmer war leer. Wir klopften beim Ratsmitglied für Handel und Gewerbe an und standen im nächsten Augenblick in seiner Höhle. Glaub mir: zum ersten Mal sah ich, wie Licht versickert. Jedwede Helligkeit verendete in einer Reuse aus Qualm, jahrzehntealtem Zigarrenqualm, der wie Vulkanasche auf den immergrünen Topfpflanzen lag. Die ungeputzten Fensterscheiben und die vergilbten Stores taten das ihre, doch der trübe Sickerstoff ging von dem Mann selbst aus! Es war ein Wunder, daß wir ihn, der sich da von seinem Schreibtisch erhob, überhaupt inmitten der Farb- und Schattenlosigkeit erkannten, seiner Farb- und Schattenlosigkeit. Außer den großen Zähnen, einem gelblichen, nachlässig gestutzten Bart und strähnigen Haaren fiel mir vor allem sein Lachen auf. Im Schein des Streichholzes, mit dem er seine Zigarre entzündete, flackerte sein Gesicht mal höhnisch, mal ängstlich.
Keinesfalls, sagte er und lachte, könne er uns die Genehmigung für eine Zeitung erteilen. Pause. Er setzte sich umständlich. Georg beugte sich zu ihm herab und sagte, er verzögere mutwillig das Erscheinen unserer Zeitung, ja er versuche sogar, es zu unterbinden, er überschreite seine Kompetenz, er sei ein Fall für die Kommission gegen Korruptions- und Amtsmißbrauch. Vulkanos lachte und bat Georg, diesen langen Namen zu wiederholen. Soviel er wisse, gebe es solch eine Kommission noch gar nicht. Es spiele keine Rolle, was er wisse oder denke, rief Georg, dessen Stirn vor Zorn dunkel wurde, er habe gar nichts mehr zu entscheiden, er solle nur den Stempel auf unseren Antrag drücken, für nichts anderes werde er bezahlt.
»Hohoho!« rief Vulkanos, entblößte seine Pferdezähne und stieß mit jedem »ho« mehr Rauch hervor. Georg verharrte vorgebeugt und sah ihn unverwandt von der Seite an, als gehörte er einer bisher unbekannten Spezies an.
»Hoho, hähä, Ihr Antrag, hohä, Ihr Antrag, ha, den gibt’s doch gar nicht, der liegt, hoha, Ihr Antrag, ho, der liegt gar nicht vor, nicht bei mir jedenfalls, hohä, da sind Sie aber an den Falschen geraten, an den ganz Falschen, hoho, der da gar nichts tun kann, hoho.« Dann sog er mehrmals an seiner Zigarre und blies den Rauch wortlos aus. Ich sah uns bereits auf dem Weg in eine andere Abteilung.
»Das macht nichts!« rief Jörg, der bisher seltsam ruhig geblieben war, und nahm, als gäbe er damit ein vereinbartes Zeichen, die Baskenmütze vom Kopf. »Dann stellen wir eben jetzt und hier den Antrag mündlich, Sie händigen uns das Formular aus und drücken gleich Ihren Stempel drauf.« Das Lachen sprang die Tonleiter hinauf, als wollte sich das Ratsmitglied im eigenen Hohn verflüchtigen, und verklang in einem langen Seufzer.
Leider seien ihm die Antragsformulare ausgegangen, sagte er. Es gebe zu viele Leute, die jetzt etwas anmelden wollten, viel zu viele, »geht nicht gut, nein, nicht gut«. Hastig paffte Vulkanos Wölkchen hervor, die ins Dämmerlicht seiner Höhle eingingen. »Da muß eine Regulierung her«, fügte er besorgt hinzu, sah von Georg zu Jörg, dann zu mir und wieder zu Jörg, »jawohl, eine Regulierung. Fragen Sie mal die Taxifahrer …« Mit der freien Hand deutete er eine Geste an, als wollte er den Qualm vertreiben, dann legte er die Zigarre im Aschenbecher ab.
Weder Georg, der vor der Tür Posten bezogen hatte, noch ich rührten uns. Vulkanos hatte seinen Rücken bis an die Lehne geschoben, mit gespreizten Fingern umspannte er sein Bäuchlein, als hielte er ein Kissen davor.
»Ich bin doch gar nicht für Zeitungen zuständig«, sagte er matt. Das müsse sowieso über Leipzig entschieden werden.
»Na also!« rief Jörg. »Nur ein bißchen guten Willen.« Vulkanos brauche sich überhaupt nicht zu sorgen, Sorgen gehörten nicht zu seinen Aufgaben. Jörg machte eine Pause, trat einen Schritt zurück, faßte mich am Arm und präsentierte in mir einen Artisten, der das Maschineschreiben blind und mit zehn Fingern beherrsche: »Enrico Türmer!«
Ich setzte mich an die Maschine, spannte drei Bögen des Rates des Kreises ein und tippte Ort und Datum. Nicht nur das a und das o, alle Buchstaben waren bis zur Unkenntlichkeit verdreckt. Außerdem fehlte der linken Hochstelltaste der Kopf. Nur frisches Blaupapier gab es reichlich.
Nach einigen Zügen aus seiner Zigarre maulte Vulkanos bereits wieder, seine Mittagspause habe längst begonnen. Georg warf mir sein Taschenmesser zu, damit ich die Lettern notdürftig säubern konnte.
»Und?« fragte Vulkanos zehn Minuten später. Als begutachte er die Qualität eines Kunstdruckes, sah er auf das Blatt und legte es vor sich ab. »Und? Was soll ich jetzt damit?«
»Nummer, Stempel, Rechnung!« erwiderte Jörg.
»Wie Sie wollen, wie Sie wollen«, sagte er, »aber es wird Ihnen nichts nützen.« Jörg erbat Stempel und Unterschrift auch für die Durchschläge und ließ einen davon auf der Schreibunterlage zurück.
Grußlos verließen wir Vulkanos. Auf der Straße klopften wir uns gegenseitig die Vulkanasche von den Kleidern. Jörg fuhr gleich nach Leipzig.
Bei meinen Landtouren verteile ich Zettel mit roter Schrift. Die Ankündigung der Zeitung samt Abo-Formular sieht aus wie eine Tollwutwarnung.
Ich soll auch von Michaela grüßen.
Enrico
Freitag, 19. 1. 90
Verotschka!
Ich denke unaufhörlich an Dich und zähle die Tage, die Du noch in Berlin bist, als lebten wir zusammen und müßten uns bald trennen.
Die Telephonnummer der Zeitung ist 6999. Vielleicht kannst Du von Beirut aus anrufen? Vormittags bin ich fast immer allein, aber das wird sich bald ändern. Hat Dein Adliger wieder von sich hören lassen?
Manchmal fürchte ich mich vor mir, nein, nicht vor mir, vor dem Gang der Dinge! Alles geschieht so zwangsläufig und folgerichtig, und plötzlich erblicke ich mich mittendrin wie in einem Traum. Ich habe Angst, eines Morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, was ich als nächstes, was ich überhaupt tun soll.
Gestern und heute habe ich an Johann geschrieben und ihm ein paar Geschichten erzählt. Geschichten beeindrucken ihn immer. Er wird mich noch um meine Stellung beneiden.
Mamus will uns unbedingt eine Busreise nach Paris schenken. Ich hoffe, ihr das noch ausreden zu können. Sie behauptet, es sei wegen der Wette, ich hätte die Wette gewonnen und sie wolle ihr Wort halten.20 Michaela und Robert sind begeistert. Wahrscheinlich wird uns Michaelas Spielplan davor bewahren, das hoffe ich zumindest.
Michaela wirft mir neuerdings Kälte vor. Meine Anwesenheit und meine Abwesenheit bringen sie gleichermaßen aus der Fassung. Ich versuche sogar, abrupte Bewegungen und Gesten in ihrer Gegenwart zu vermeiden, um sie nicht noch mehr zu reizen.
In den letzten Tagen hat sich zwischen uns ein morgendliches Ritual herausgebildet, das in der ersten Stunde trügerisch dem früheren Alltag gleicht. (Wir essen nur keine Eier mehr, das soll ungesund sein, sagt sie.) Wenn Michaela das Badezimmer verläßt, schenke ich den Kaffee ein, damit sie ihn dann gleich trinken kann. Jede Minute, die ruhig verstreicht, ist ein Geschenk. Auf dem Weg zum Auto sprechen wir meist über Robert und seine Schule, ein unerschöpfliches Thema. Solange wir reden, droht keine Gefahr.
Sobald wir losgefahren sind, verliert sich der ruhige Tonfall. Auf Höhe des Bahnhofs verstummen wir, das heißt, Michaela verfällt in Schweigen, und auch ich bringe kein Wort mehr über die Lippen. Wenn wir am Museum vorbeifahren, wird unser Schweigen eisig. Spätestens auf dem Parkplatz des Theaters erfolgt Michaelas Ausbruch. Am unheimlichsten ist die Vorhersehbarkeit, mit der sich das Ganze wiederholt, als würde Michaela jeden Morgen zum ersten Mal klar, daß ich nicht mit ihr zusammen aussteigen werde, daß sie allein ins Theater muß, und sie scheint um so mehr davon überrascht, weil doch bis dahin alles so gewesen ist wie früher.
Ich stelle den Motor ab, damit sie sich nicht gedrängt fühlt, und lasse mich erneut darüber belehren, daß es auch im Westen Theater gebe, daß es immer Theater gegeben habe und geben werde und im Theater der Mensch und die Gesellschaft zu sich selbst kämen. Nachdem sie ihre Worte gegen die Frontscheibe geschleudert hat, versinkt sie in Schweigen. Dabei wirkt sie hochkonzentriert, wie vor einem Auftritt. Das schlimmste wäre, sie jetzt an die Uhrzeit zu erinnern. Ich sitze neben ihr, als wartete ich auf das Ende des Regens, und achte darauf, das Lenkrad nicht zu berühren und überhaupt jede Geste zu vermeiden, die mir als Ungeduld ausgelegt werden könnte.
Plötzlich stößt sie dann die Tür auf und rennt los, ohne Abschied, den Kopf hochgeworfen, die Handtasche vor der Brust, ihr Mantel flattert ihr nach.
Über das Lenkrad gebeugt, verfolge ich ihren Lauf, bereit zu winken, falls sie sich umdrehen sollte. Ist Michaela verschwunden, lasse ich den Motor an und sehe mich im Rückspiegel lächeln.
Drei Minuten später bin ich schon in der Redaktion, lege Kohlen nach, setze Wasser auf und warte mit dem Rücken am Ofen, bis der Kaffee fertig ist. Georg kommt bald darauf herunter, klopft ans Barometer, zieht die Standuhr auf und inspiziert die Thermometer vor dem Fenster und neben der Garderobe. Kapitän Nemo könnte nicht aufmerksamer über seine Apparaturen wachen.
Nachmittags fahre ich meist übers Land und besuche die Amtsstuben. Zuerst erschrecken sie, wenn sie Zeitung hören. Die Sekretärinnen begreifen in aller Regel schneller als ihre Chefs, daß ihnen von mir keine Gefahr droht, und sind äußerst freundlich. Robert kommt manchmal mit. Während der Fahrt reden wir über alles mögliche. Er hat klare Vorstellungen von meinen Aufgaben. Die Zeitung deckt alles auf und sorgt überall für Gerechtigkeit. Die Stunden mit ihm genieße ich sehr.
Am Freitag, dem 16. Februar soll die erste Ausgabe erscheinen. Das klingt wie ein Märchen. Man denkt sich was aus, man macht es und lebt davon. Als kehrten wir zu einem vergessenen Brauch zurück, zu einer Lebensweise, wie sie eigentlich allen Menschen vertraut ist, nur uns nicht.
Am Dienstag werden wir für drei Tage nach Offenburg reisen, unabhängig von der offiziellen Altenburger Delegation. Ein Gönner21 spendiert uns die Übernachtungen. Hoffentlich hält unser Jimmy22 durch.
Verotschka, Liebste! Ich umarme Dich!
Dein Heinrich
Donnerstag, 25. 1. 90
Verotschka,
stell Dir vor, wir würden das Geld umtauschen! Vielleicht hundertvierzig-, hundertsechzigtausend? Ein Irrwitz! Aber das schönste waren trotzdem die Telephonzellen.23 Ist es denn zuviel verlangt, Dich einmal am Tag hören zu dürfen?
Manchmal dachte ich, es gibt ihn noch, den Westen. Immer wieder diese Träumereien und alten Reflexe. Leute wie Gläsle – der Mann im Rathaus, der nicht verstand, warum die Altenburger haufenweise diese Skatspiele schicken24 – müssen uns für Barbaren gehalten haben.
Georg, der mit Gläsle telephoniert hatte, war der Meinung, wir seien eingeladen, uns aus ihrem Fundus an Büroutensilien nach Herzenslust zu bedienen. Gläsle führte uns unweit des Rathauses auf einen Dachboden, der als Lager diente. Wir fielen sofort über die Herrlichkeiten her. Kaum aber hatten wir die Taschen voller Filzstifte, Tesafilm, Radiergummis und bunter Büroklammern, leerten wir sie wieder, um statt dessen Ablagefächer und durchsichtige Folien, Ordner und Prittstifte einzustecken. Sogar auf eine weiße Magnettafel erhoben wir Anspruch. Wir plünderten wie im Rausch. Ein paar Minuten später verstand ich mich selbst nicht mehr. Wie hatten wir das tun können, ohne ein einziges Mal nachzufragen!? Wir mußten wieder alles auspacken, es wurde gezählt und aufgelistet und gerechnet, mehr und mehr Sachen legten wir zurück. Gläsle war noch bleicher als wir. Gott sei Dank hatte Georg das Kuvert mit dem Geld parat. Das Ganze stellte sich als Gläsles Versuch heraus, uns etwas Gutes zu tun, indem er das Bürozeugs mit dem Rabatt der Stadtverwaltung an uns weitergab. Damit verstieß er gegen die Vorschriften. Er ermahnte uns, keinesfalls darüber zu reden. Gläsle zauberte dann doch noch, indem er die Abdeckung von einer riesigen elektrischen Schreibmaschine zog. Das sei das »grüne Ungeheuer«, sagte er, ob wir die nicht haben wollten, einen Sack voll Farbbänder gebe es dazu. Die, ja, die könne er uns schenken! Gläsle war regelrecht erlöst und überlegte laut, was er uns außerdem mitgeben könnte, aber schon die Maschine war ein Problem. Schließlich kam sie zwischen Georg und Jörg auf den Rücksitz, breit und grün wie eine riesige Kröte.
Wir müssen erst zivilisiert werden. Wir haben nicht unbedingt aus Charakterschwäche versagt, sondern weil unser ganzes Sensorium nicht stimmt.
Mit zweihundert D-Mark in der Tasche wurden die Schaufenster erst so richtig interessant. Stehenbleiben oder Weitergehen bedeuteten nun nicht mehr dasselbe wie zuvor. Warum wir ausgerechnet in einem Topfladen landeten, kann ich Dir nicht erklären. Ich mußte nur einen der schweren Deckel anheben, um der Faszination zu erliegen. Ich hielt den Topfrand für magnetisch, denn dieser schien den Deckel anzuziehen und automatisch für den perfekten Sitz zu sorgen.
Wir deckelten uns gerade durch den Laden, als Wolfgang, der Hüne, eintrat. Er ging auf unser Spiel ein, die Verkäuferin versuchte die jeweiligen Vorteile aufzuzählen, indem sie von Eintöpfen, Suppen, Gemüseaufläufen, Spätzle, Braten und überhaupt von allen Gerichten schwärmte, die je in dieser Stadt auf den Herd gekommen waren.
Wir lauschten. Wolfgang klopfte mit den Fingerknöcheln gegen die Töpfe, als prüfte er eine Glocke auf die Reinheit ihres Klangs.
Irgendwann war klar, wir würden unser Geld in diesem Laden lassen. Wir hatten uns schon auf zwei Töpfe ohne Deckel geeinigt, als uns Wolfgang einen Fünfziger zusteckte. Jetzt reichte es für das Sonderangebot: drei Töpfe inklusive Deckel für 249 D-Mark. Die Verkäuferin – niemals würden wir unsere Wahl bereuen – begleitete uns zur Tür. Erst dort händigte sie Michaela die dritte Plastetüte aus.
Ich suchte nach dem Autoschlüssel, als Michaela von einer Frau begrüßt wurde, die ich erst auf den zweiten Blick und dann auch nur an ihrem Mantel erkannte. Die Zeitungszarin hatte eine ganz andere Frisur. Sie fragte, wie es uns gehe, worauf mir nichts Besseres einfiel, als eine der Einkaufstüten aufzuhalten. »So schöne Töpfe!« sagte sie mit einer Inbrunst, als wären wir Kinder, nahm den Topf heraus und drehte ihn hin und her. Ich fürchtete, ihre Ringe könnten das Metall zerkratzen.
»So ein schöner Topf!« rief sie laut, überreichte ihn mir und verschwand mit einem Ade, das man in dieser Gegend auf der ersten Silbe betont.
Ach, Verotschka! Als gäbe es nichts Wichtigeres zu schreiben! Wenn doch wenigstens Dein Herr von B. endlich bei uns erscheinen würde! Hat er auch einen richtigen Namen? Ich will zur Post fahren, damit der Brief heute noch wegkommt.
Ich sehne mich so nach Dir!
Dein Heinrich
Freitag, 26. 1. 90
Lieber Jo!
Jan Steen hat unser Schicksal entschieden! Es war gruselig wie im Märchen, doch am Ende bekam der dumme Iwanuschka25 den Schatz!
Wäre uns klar gewesen, was für uns bei dieser Reise auf dem Spiel stand, hätten wir es wohl nicht ausgehalten, auf Michaela zu warten, die erst in der Nacht entschieden hatte mitzukommen und deshalb noch morgens Tante Trockel als Aufsicht für Robert herausklingeln mußte.
Von siebeneinhalb Fahrtstunden blieben uns knapp sechs, nur eine mehr, als Jan Steen mit seinem Flitzer für dieselbe Strecke braucht. Michaela behauptete, Roberts Schulatlas auf den Knien, die Beifahrerposition und tat überhaupt so, als gebe es weder Jörg und Georg im Auto noch Jan Steens Wegbeschreibung. Trotzdem war ich froh, daß sie dabei war.
An der Grenze in Schleiz mußte ich den Kofferraum öffnen. Der Zöllner griff nach dem Schuhkarton mit den Flugblättern und den »klartext«-Ausgaben26, Michaela hatte auf deren Mitnahme bestanden. Der Zöllner hielt die »Druckerzeugnisse« zwischen seinen Handschuhhänden und las oder tat wenigstens so, während Auto für Auto an uns vorbeirollte. Was das denn sei, fragte er. »Steht doch drauf«, sagte ich, »ein Aufruf zur Demo nach der Besetzung der Staatssicherheitsvilla.«
Als er sie zurücklegen wollte, hatte sich der Stapel verschoben und paßte nicht mehr in den Karton. Er stopfte die Blätter zurück, erteilte mir einen Wink, der alles hätte bedeuten können, und schlurfte in seinen Stiefeln davon, die matt in der Morgenröte glänzten. Ich fuhr sehr langsam über die Brücke, damit wir die Schneise im Wald sehen konnten.
Meine drei Beifahrer waren bald eingenickt, ich hingegen genoß alles, den rosaroten Wintermorgen, das seltsam flatternde Geräusch, das die Reifen auf der Fahrbahn machten, die weiten Kurven, das Tempo, die Musik, die Verkehrsnachrichten, die Lastzüge und dahinjagenden Autos, die Felder und Dörfer und Hügel. Sogar der Schnee erschien mir an diesem Morgen westlich!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!